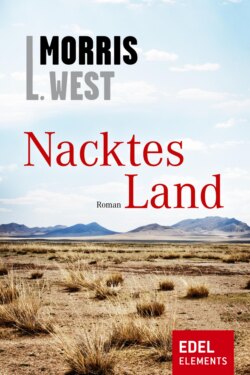Читать книгу Nacktes Land - Morris L. West - Страница 4
2
ОглавлениеMary Dillon stand bei Sonnenuntergang auf der Veranda des Farmhauses und sah zu, wie die Schatten auf der braunen Erde immer länger wurden, wie die Hügel sich von Ockergelb zu tiefem Purpur färbten, wie die Sonne dahinter am verhangenen rötlichen Himmel langsam versank. Dies war die Stunde, in der Frieden und Wohlbehagen sie wie sonst nie in diesem fremden, uralten Land überkamen.
Tagsüber kletterte das Thermometer am Türpfosten in der fiebrigen Hitze auf 50 Grad im Schatten, und der Wind wirbelte den Sandsteinstaub in dicken Wolken über die Pferdekoppeln. Die Nächte waren kalt und einsam, Dingos heulten im Unterholz, die Myalls sangen unten am Fluß, und Lance schnarchte, ohne von Marys Kummer zu ahnen, zufrieden vor sich hin. Doch während dieser kurzen Stunde, die weder Dämmerung noch Zwielicht, sondern nur eine Pause zwischen Tag und Anbruch der Nacht war, wurde die Erde friedlich und der Himmel sanft, und auch die farblosen einsamen Gebäude bekamen einen Anschein von Heimeligkeit.
Niemals würde sie sich hier wirklich zu Hause fühlen. Nach drei Ehejahren mit Lance Dillon und zwei Reisen nach Sydney zu ihrer Familie war sie dessen ganz sicher. Sie war ein Kind der Großstadt, geboren und aufgewachsen zwischen Ziegeldächern, gepflegten Rasenflächen und unter Leuten, die alle so waren wie sie selbst. Sie brauchte einen Mann, der um sieben nach Hause kam, morgens um halb acht das Haus verließ und dazwischen ein gemütliches häusliches Dasein führte, nicht diesen braunen Kerl voll lederner Kraft und mit den kühlen Augen, der zuweilen tagelang fortblieb, dann gemächlich heimgeritten kam, staubig und erschöpft, und von ihr Interesse, Ermutigung und auch Trost bezüglich seiner langweiligen Geschäfte erwartete.
Sie wußte, daß die anderen Frauen im Siedlungsgebiet mit ihrem Leben durchaus zufrieden waren. Hundert Meilen vom nächsten Nachbarn entfernt, hatten sie weiter keine Gesellschaft als die Lubras, die eingeborenen Hausmädchen mit ihren Negerkindern, und die einzigen Besucher waren der Polizist, der Pilot des Postflugzeugs und der fliegende Doktor. Doch wenn Mary ihrer Unterhaltung während der täglichen Plauderstunde über den Kurzwellensender zuhörte, bemerkte sie die Zufriedenheit in ihren Stimmen und fragte sich, warum sie selbst nicht so empfand. »Laß dir Zeit«, hatte Lance in seiner ruhigen, selbstsicheren Art gesagt. »Laß dir Zeit und hab Geduld; langsam wirst du dieses Land schon liebgewinnen. Es ist ein altes Land, Sweetheart, nicht so alt und verbraucht wie Europa, sondern alt, weil die Jahrhunderte an ihm vorübergezogen sind und die Ozeane es vor jeder Veränderung abgeschirmt haben. Bei uns gibt es Vögel, Tiere und Pflanzen, die man sonst nirgends auf der Welt mehr findet. Die Myalls und die Eingeborenen auf der Farm sind unsere letzte Verbindung zur Urzeit. Aber das Land ist auf der anderen Seite auch jung. Noch nie hat ein Pflug seinen Boden berührt, seine Gewässer sind nie eingedämmt worden, und bis jetzt weiß niemand, was sich unter seiner Oberfläche verbirgt. Wir brauchten bloß Öl zu finden, und schon wären wir über Nacht so reich wie Amerika. Lohnt es sich da nicht, ein bißchen Geduld und ein bißchen Mut aufzubringen?«
Wenn er so redete, völlig uncharakteristisch für einen hart arbeitenden Viehzüchter, hatte sie ihm nie widersprechen können. Sie lächelte dann nur immer zaghaft und ergeben. Aber nun, nach drei Jahren, war ihr das Land immer noch fremd, und auch Lance schien ihr fremd zu werden. Zwar war er stets gleich freundlich, war rücksichtsvoll auf seine beiläufige Art; aber er schien sie nicht mehr zu brauchen, offensichtlich hatte sie ihm gegenüber genauso versagt wie gegen sich selbst.
Sie mußte sich bald die Frage stellen: Was ist daran zu ändern? Dieses Land forderte einen ganz. Man konnte es nicht mit halbem Herzen lieben, man konnte es nicht ohne die richtige Einstellung verteidigen. Ein geborstener Stein sprang bald bei der brennenden Hitze am Tag und der bitteren Kälte bei Nacht. Eine Ehe mit einem Sprung hatte ebensowenig Chancen zu überleben. Für einen Mann bedeutete eine unzufriedene Frau nur eine Last. Ihre Alternative war deshalb kurz und bündig: Entweder erfüllte sie das Ehegelöbnis in Gehorsam und Hingabe, oder sie gestand ihre Niederlage ehrlich ein, ging weg und überließ es dem Mann und dem Land, sich in rauher Harmonie zusammenzufinden.
Diese Gleichung schien auf den ersten Blick sehr einfach, war aber höchst kompliziert zu lösen. Angenommen, Mary entschied sich für Gehorsam und Hingabe – brachte sie dann auch genug Liebe, und brachte auch Lance genügend Verständnis auf, um Beständigkeit und anhaltende Zufriedenheit zu garantieren?
Als Lance Dillon vor drei Jahren in ihr Leben getreten war, als er bronzehäutig, lächelnd und zuversichtlich, ein erdverbundener Riese in der Vorstadtwelt, vor ihr stand, hatte sie nicht den geringsten Zweifel verspürt. Hier stand einer, der das Land bezwingen konnte, so daß unter seinen Sohlen Wüsten zu blühen begannen, und er wußte auch über die Frauen zu gebieten, stark wie ein Baum, Schutz und Halt verheißend. Jetzt aber, unter anderen Verhältnissen und so weit weg von zu Hause, kam er ihr in ihrer Enttäuschung ganz anders vor. In der ungeheuren Weite wirkte er kleiner. Das rauhe Klima schliff seinen Humor ab, ähnlich wie der Wind den Sandstein zerklüftete und die Bäume bog, so daß ihre Wurzeln tiefer in dem durstigen Boden nach Nahrung und Halt graben mußten. Aber wenn der Boden trocken war und die Wurzeln nicht tief genug reichten, mußte der Baum sterben. Genauso würde ein Mann sterben, wenn nicht genug Liebe und Kraft ihn umgaben, um ihn vor dem Sturm zu schützen.
Sie hatte ihn geliebt. Sie liebte ihn immer noch. Aber ob es reichte? Das war eine schwierige Frage, und sie durfte nicht mehr allzu lange mit der Antwort warten.
Sie fröstelte, als der Wind die erste Abendkühle brachte, und ging ins Haus. Dort hantierten die Lubras auf leisen Sohlen in der Küche herum und deckten den Tisch zum Abendessen. Es war ein besonderer Abend, und von Mary hing es ab, ob er heiter oder traurig verlief. Heute war ihr Hochzeitstag, und Lance hatte versprochen, bis Sonnenuntergang zu Hause zu sein.
Gewöhnlich machte er sich nichts aus solch weiblichen Forderungen nach Pünktlichkeit und erklärte, zunächst geduldig und später irritiert, daß man hier in dem neu besiedelten Land unmöglich nach der Uhr leben könne. Die Herden waren weit über das Gebiet verstreut. Ein Mann war nur so schnell wie sein müdes Pferd, und die Pferde lahmten schnell, hinkten oder bekamen Koliken, weil sie zuviel von dem fetten Gras am Fluß gefressen hatten. Mary solle mit ihm rechnen, wann immer er käme. Sie solle lernen, sich weder zu sorgen noch ungeduldig zu werden, und vor allem sollte sie nicht nörgeln. Eine nörgelnde Frau sei für einen Buschmann schlimmer als ein im Sattel wundgeriebener Hintern. Und was noch wichtiger war: Die Viehtreiber hatten kaum Respekt vor einem Boss, der unterm Pantoffel stand. Für sie stand fest, daß ein Mann, der nicht Herr über seine Frau war, auch nicht Herr über sein Vieh und seine Leute sein konnte.
Aber heute abend – als er das sagte, leuchteten seine Augen auf –, ja, heute abend war es etwas anderes. Er wollte nicht zur Ausmusterung reiten, sondern ins Tal zu den Zuchttieren. Beim Einbruch der Dunkelheit käme er zurück – eine Stunde früher oder später, wie es im Busch so üblich war. Dann hatte er sie geküßt und war gegangen, und die Erinnerung an den Kuß war der einzige Lichtblick in ihrer Trostlosigkeit, ihren Zweifeln und Enttäuschungen. Vielleicht würde heute abend die Leidenschaft neu aufflammen und ihnen beiden neue Hoffnung geben.
Im Eßzimmer legte Big Sally, die Herrscherin über die anderen Hausmädchen, letzte Hand an das Silberbesteck. Sie war mit einem der Viehhirten verheiratet, und vom dauernden Kinderkriegen war ihr schwerer Körper fett und unförmig geworden. Sie trug ein schwarzes Baumwollkleid und darüber eine gestärkte Schürze; aber sie ging barfuß, und ihr breites glattes Gesicht stand in komischem Kontrast zu dem weißen Häubchen. Grinsend sah sie auf, als Mary Dillon hereinkam, und sagte mit ihrer vollen rauhen Stimme: »Alles in Ordnung, Missus. Boss bald kommen, ja? Machen ihm Bad, machen seine Kleider sauber. Gut essen, gut trinken. Vielleicht er wollen diesmal Baby machen?« Ihr fetter Körper zitterte, als sie in glucksendes Gekicher ausbrach, und Mary mußte unwillkürlich mitlachen.
»Kann schon sein, Sal. Wer weiß?«
Die große Lubrafrau kicherte prustend.
»Boss weiß. Missus weiß. Sie träumen es richtig, es kommen . . .«
Sie eilte hinaus, ihre nackten Füße patschten auf dem Fußboden, und das gestärkte Leinen knisterte. Mary Dillon blieb stehen und betrachtete das weiße Tischtuch mit dem glänzenden Silber, das hier mitten im Niemandsland so fremdartig wirkte.
»Sie träumen es richtig, es kommen . . .« Die Eingeborenen glaubten, daß ein Kind nur entstehen konnte, wenn nach dem Zeugungsakt ein lebensspendender Geist in die Gebärmutter hineingeträumt wurde. Vielleicht waren es die Träume, woran es bei ihr und Lance fehlte. Sie wünschten sich ein Kind, wünschten es sich über alles, wenn auch aus verschiedenen Gründen; sie aus Sehnsucht nach Erfüllung und aus dem Bedürfnis heraus, ihre Einsamkeit zu beleben; er in der Hoffnung auf einen Nachkommen, auf einen Sohn, der die Eroberung des Landes fortführen, die Grenzen erweitern und gegen die Einflüsse von Zeit und Natur verteidigen würde. Doch bis jetzt hatten sie wohl nicht richtig geträumt, und bald würde es vielleicht überhaupt keine Träume mehr geben.
Weil sie nichts Besseres zu tun hatte, ging sie zur Anrichte und füllte die Whiskykaraffe aus Lances letzter Flasche Scotch auf. Fast automatisch goß sie sich dann auch ein Glas ein, mischte Wasser dazu und trank es langsam aus. In Gedanken war sie in der Stadt, wo zu dieser Zeit die übliche Cocktailstunde stattfand, und mit dem Drink nahm sie im Geiste daran teil und gedachte ihres früheren Lebensstils. Aber der Drink bedeutete auch gleichzeitig Trotz und eine kleine Geste der Auflehnung.
Im ersten Jahr ihrer Ehe war Lance einmal nach Hause gekommen, als sie am Kamin gesessen hatte mit einem Drink neben sich. Lance hatte sie zuerst stirnrunzelnd angesehen und sie dann lächelnd getadelt: »Trinke nie zum Zeitvertreib, Sweetheart. Für sowas sind wir hier im falschen Land. Ich hab’ schon zu viele Frauen gesehen, die sind zu Säuferinnen geworden, weil sie sich das Trinken so langsam angewöhnt hatten, weil sie allein waren und sich gelangweilt hatten. Glaub mir, das ist kein schöner Anblick. Wenn du Lust auf etwas zu trinken hast, dann trinken wir eben zusammen. Und wenn wir dabei mal einen über den Durst trinken, dann ist nichts dabei.«
Sein leiser Vorwurf ärgerte sie, und sie fauchte los: »Was erwartest du eigentlich von mir? Soll ich vielleicht zwei Tage hier herumsitzen und warten, bis du zum Cocktail kommst? Wenn du nicht mal bei so einer Kleinigkeit Vertrauen zu mir hast, wie willst du mir dann bei wichtigen Sachen trauen?«
Er war augenblicklich zerknirscht.
»Mary, so hab’ ich das nicht gemeint! Aber ich kenne dieses Land besser als du. Ich weiß, wie es auf Menschen wirken kann. Es ist wie – wie ein halbwildes Tier, stark und unwiderstehlich, aber auch gefährlich, wenn man sich nicht vorsieht. Das gilt für Männer genauso wie für Frauen. In unserem Gebiet hier gibt es eine Menge Kerle, die haben sich entweder den Einheimischen angeschlossen, oder sie haben zur Flasche gegriffen, oder sie sind einfach verrückt geworden. Bei uns heißen sie ›Hatters‹ – nach Mad Hatters, dem verrückten Hutmacher auf Alices Teeparty. Auf den ersten Blick sind sie ganz normal, aber in Wirklichkeit sind sie total übergeschnappt.«
Seine Stimme wurde ganz sanft, und zärtlich legte er seine rauhen Hände auf ihre Schultern.
»Ich liebe dich, Mary. Ich weiß doch, daß die ersten Jahre hier nicht leicht für dich sind. Deshalb versuche ich, dich zu warnen, das ist alles.«
Die Berührung und seine Sanftheit wischten ihren Ärger wie üblich sofort weg. Doch diesmal war sie nicht zur Kapitulation bereit, und jeden Abend zur gleichen Stunde nahm sie einen Drink, nicht mehr und nicht weniger, nur um sich ohnmächtig ihres Rechtes zu versichern, sie selbst zu sein.
Mit dem Glas in der Hand ging sie ins Wohnzimmer, setzte sich hin, nahm eine uralte Zeitung auf und blätterte sie in Muße durch. Die Nachrichten waren so überholt, als kämen sie von einem anderen Stern, doch die Klatschspalten und Modefotos ließen sie auf jene Frauen eifersüchtig werden, die nur ein paar Schritte weit von den Läden und Boutiquen und von den täglichen Neuheiten der City wohnten. Das Gesellschaftsleben im Siedlungsgebiet beschränkte sich auf das Geplauder im Kurzwellenradio und ein alljährliches gemeinsames Picknick mit anschließendem Ball auf einem der größeren Güter, wobei die Kleider der Frauen nach Mottenkugeln rochen und die Männer sich munter an der Bar betranken oder stampfend und wortkarg zu den Klängen eines verstimmten Klaviers tanzten.
Den anderen genügte das vielleicht – den verwitterten Matronen oder den langbeinigen Halbwüchsigen, die noch nie eine Großstadt gesehen hatten; aber für sie, Mary Dillon, war das viel zu wenig.
Alte Erinnerungen kamen auf sie zu, leise und verführerisch. Der Drink wärmte sie, die Zeitung glitt unbemerkt zu Boden – unruhig schlief Mary im Sessel ein.
Plötzlich war sie hellwach, Sally schüttelte sie leicht, die Uhr auf dem Kamin zeigte neun Uhr fünfundvierzig. Sally sah sie fragend an.
»Sie essen jetzt, Missus. Boss nicht kommen. Ganzes Essen verbrennen, Schluß!«
Ärgerlich stand Mary auf. Dabei stieß sie gegen das Glas, das klirrend am Boden zersprang. Ihre Augen glitzerten, ihre Stimme krächzte hysterisch.
»Stell das Essen für den Boss in den Ofen. Gib das übrige den Mädchen. Ich gehe ins Bett!«
Die dunkelhäutige Frau sah ihr verständnisvoll und mitleidig nach, dann zuckte sie weise mit den Achseln und sammelte die Glasscherben vom Fußboden auf.
Mary Dillon rannte ins Schlafzimmer, knallte die Tür hinter sich zu und warf sich schluchzend aufs Bett; sie war verbittert und niedergeschlagen. Lance hatte sie im Stich gelassen, das Land hatte sie fertiggemacht. Es wurde Zeit, allem den Rücken zu kehren.
Aus seinem Versteck in den Pandangwurzeln, über das mondhelle Wasser hinweg, beobachtete Lance Dillon aus etwa dreißig Meter Entfernung die Lagerfeuer der Myalls am Ufer. Sie hockten auf den Fersen und brieten ein Stück vom Fleisch des erschlagenen Bullen; der Gestank von verbrannten Haaren zog über das Wasser. Jeder der Männer hatte in seinem Rücken ein eigenes kleines Feuer; die Flammen züngelten hoch und beleuchteten die Muskelstränge und die ölige Haut auf Schultern und Brust.
Die Myalls hatten ihre Waffen in den Sand gelegt und schienen völlig in ihre Mahlzeit und ihre Gespräche vertieft, doch bei jedem Geräusch – sei es der Schrei eines Nachtvogels oder das Hochschnellen eines Fisches – reagierten sie gespannt und aufmerksam; ihre Augen schweiften suchend über den Fluß, und ihre Zähne schimmerten wie poliertes Elfenbein in ihren dunklen Gesichtern. Dillon lehnte sich noch dichter an die Sandbank und schmierte sich sorgfältig noch mehr Schlamm ins Gesicht, damit auch nicht der geringste Widerschein vom Feuer oder vom Mondlicht seine Gegenwart verraten konnte.
Fünf Minuten, bevor die Jäger den Abhang hinuntergeschlichen waren, hatte er diesen Unterschlupf gefunden, und jetzt war er schon seit sechs Stunden hier. Der Fluß machte an dieser Stelle eine Biegung; an dem einen Ufer erstreckte sich ein breiter Strand, am anderen fiel eine Böschung steil in das tiefe ruhige Wasser ab. Sie war dicht mit Sträuchern bewachsen, und die haltsuchenden Wurzeln der Pandangpalmen reichten wie ein Fischkorb wenigstens drei Meter tief in den Fluß hinein, so daß das Treibholz an ihnen hängengeblieben war und sich eine Art Verschanzung gebildet hatte.
Dillon befand sich an einer gefährlichen Stelle; die Buschmänner hatten sie »Krokowasser« getauft. Aber er hatte nur die Wahl zwischen einem Myallspeer und der Aussicht auf eine im Morast schlummernde Rieseneidechse. Vorsichtig bog er das Treibholz auseinander und schlüpfte hinter die Wurzeln. Seine Füße sanken tief in dem schlammigen Grund ein und fanden erst auf einem Baumstumpf Halt. Das Wasser reichte ihm bis zur Taille; es war unmöglich, in diesem Wurzelgeflecht aufrecht zu stehen, und er mußte die Schultern schmerzhaft verrenken. Aber das Versteck lag im Schatten, das Treibholz war so dicht, daß, als die Myalls zum ersten Mal stromabwärts nach ihm gesucht hatten, sie bis auf einen Meter herangekommen waren und ihn nicht gesehen hatten.
Als er ihren Rückzug beobachtete, überkam ihn die Versuchung, in das offene Land auszubrechen, und er mußte hart dagegen ankämpfen, es zu tun. Sie würden bald merken, daß sie ihn verfehlt hatten, und zurückkommen, das war ihm klar. So blieb er, wo er war. Das Wasser bleichte seine Haut, Blutegel saugten sich an ihm fest, eine schwarze Spinne baumelte dicht vor seinen Augen, und ein aufgeregter Schwarm von Insekten umschwirrte ihn. Als die Kälte ihm ins Blut kroch, fing es in seiner Wunde schmerzhaft zu pochen an. Vorsichtshalber klemmte er sich einen dicken Zweig zwischen die Zähne, damit sie zu klappern aufhörten.
Behutsam versuchte er, sich in eine bequemere Lage zu bringen, doch jede Bewegung bedeutete Gefahr, das wußte er nur zu genau. Ein Stück Holz, das sich löste und den Fluß hinuntertrieb, oder ein Schlammwirbel in der Strömung würde ihn augenblicklich den geübten Augen seiner Verfolger verraten. Er konnte nichts tun, nur abwarten und hoffen, daß sie bei Einbruch der Nacht aufgeben würden.
Sie kamen früher zurück, als er erwartet hatte. Er sah sie in fünfzig Schritt Entfernung die Abhänge sorgfältiger prüfen und die schattigen Vorsprünge sowie die Vertiefungen unter den Sträuchern genauer untersuchen. Ein großer Bursche arbeitete sich schnell zu seinem Versteck vor. Dillon bückte sich ganz langsam noch tiefer, bis das Wasser sein Kinn umspülte. Als er dann nur noch Hinterteil und Knie des Verfolgers sehen konnte, atmete er tief ein und tauchte völlig in dem dunklen Wasser unter. Der Myall stand unterdessen neben der Verschanzung aus Treibholz, zog sie auseinander und stieß seinen Speer in das Loch dahinter. Seine Füße wühlten den schlammigen Boden auf, und Dillon hielt einen Zentimeter unter der Oberfläche den Atem so lange an, daß sein Herz zu zerspringen und sein Kopf zu zerplatzen drohten. Dann ging der Myall plantschend stromaufwärts davon, und Dillon tauchte wieder auf und sog gierig die Luft ein. Als er sich weitgehend erholt hatte, schaute er sich um und entdeckte die gefährliche Lücke in dem Schutzwall aus Treibholz. Sorgfältig, Stück für Stück, reparierte er die schadhafte Stelle, während die Myalls sich stromaufwärts entfernten, wobei sie sich mit ihren kehligen klangvollen Stimmen laut verständigten.
Durch das Untertauchen und die Bewegung hatte der Verband sich gelockert, und die Wunde fing erneut zu bluten an. Dillon unterdrückte die alte Angst vor den Krokodilen, während er sich abmühte, den Verband wieder zu befestigen und seine durchweichten Kleider zu ordnen. Auf einmal war er hoffnungslos erschöpft vor Hunger, Anstrengung und durch den Blutverlust. Er spürte, daß er nicht mehr lange bei Bewußtsein bleiben konnte. Doch wenn er sich dem Schlaf überließ, würde er ins Wasser gleiten und ertrinken.
Unter Schmerzen drehte er den Kopf und suchte im Halbdunkel nach einer Wurzel oder einer Stütze, die ihn halten könnte. Weil er nichts Geeignetes fand, schnallte er seinen Gürtel auf und löste ihn aus den Schlaufen seines Hosenbundes. Die durchnäßte Hose sank ihm langsam auf die Fesseln hinunter, doch er kümmerte sich nicht darum. Er schlang den Gürtel um den Brustkorb und schnallte sich an eine schmale knollige Palmenwurzel. Auf der rauhen Rinde könnte ihn der Gürtel vielleicht halten, während er schlief. Er probierte es aus, einmal, zweimal und noch einmal, dann entspannte sich sein Körper, und sein Geist überließ sich der Illusion von Ruhe.
Es war wirklich nicht mehr als eine Illusion, denn er wurde von Schmerzen geplagt, und fiebrige Schreckensbilder standen vor seinen Augen. Schwarze grinsende Gesichter blähten sich dicht vor ihm auf und platzten wie Luftballons, Bullenhörner durchbohrten seine Rippen wie Speere. Marys Gesicht, kalt und abweisend, war voller Spott, und als seine Hände nach ihr greifen wollten, zog sie sich feindselig und mitleidlos zurück. Er verbrannte in einem dunklen Meer, er ertrank in einem kalten Feuer, als fleischloses Skelett baumelte er an einem krummen Baum.
Dann wachte er auf, nahm erleichtert das Mondlicht und das silberne Wasser wahr, den Schein der Lagerfeuer und den Duft von gebratenem Fleisch. Seine obere Körperhälfte war total verkrampft, und von der Taille abwärts hatte er überhaupt kein Gefühl mehr. Mit unendlich vorsichtigen Bewegungen befreite er sich aus dem Gürtel, dann beugte er sich vor, bekam seine Hose zu fassen und zog sie hoch. Dabei biß er sich auf die Lippen, um keinen Schrei auszustoßen, weil der Schmerz von jedem einzelnen Nerv Besitz nahm. Schließlich stand er wieder, die Füße fest auf dem Baumstumpf und den Rücken gegen die schlammige Sandbank gelehnt.
Eine Nacht an diesem Ort würde er bestimmt nicht lebend überstehen. Er mußte vor Tagesanbruch hier weg, mußte Nahrung und Wärme finden und das träge Blut wieder in Bewegung bringen. In Kürze, wenn die Myalls mit Fleisch vollgestopft waren, würden sie sich wie Tiere in den Sand legen und bis Sonnenaufgang schlafen. Dann mußte er weiter. Aber wie und wohin? Vor ihm lag der Fluß, in seinem Rücken hatte er eine Wand aus Schlamm, und über allem strahlte kalt und höhnisch der Mond der Jäger.
Mundaru, der Mann des Büffels, stand vor einem Rätsel. Er kauerte im Sand, vor sich und hinter sich ein Feuer, von innen her wohlig gewärmt vom Fleisch des Totems, und überdachte noch einmal jeden Schritt der Verfolgung von Anfang an. Von neuem berechnete er, wie viele Schritte ein gesunder Mann laufen und gehen konnte, während die Schatten um Speereslänge wuchsen. Er fügte noch eine Strecke und etwas Zeit hinzu, um unerwartete Kraftreserven des weißen Mannes zu berücksichtigen – und war noch immer davon überzeugt, daß er ihn und seine Gefährten unmöglich überholt haben konnte.
Also mußte er den Fluß verlassen und sich zum offenen Land durchgeschlagen haben. Aber an welcher Stelle? Mundaru selbst hatte jeden Zentimeter des einen Ufers untersucht und war ganz sicher, daß ihm nichts entgangen war. Die Burschen vom anderen Ufer hatten mit derselben Überzeugung geschworen, daß sie nichts übersehen hätten. Aber Mundaru glaubte ihnen nicht so ganz. Das war eben der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Jäger. Hier lag der Grund für das alte Stammesgesetz, daß der Schwache den Starken begleiten und der Scharfäugige für diejenigen jagen mußte, die zum Zeichenlesen nicht taugten. Am Morgen wollte er selbst den Fluß überqueren und noch einmal nachschauen.
Ein Stück von den anderen entfernt saß er da, ein bemalter Mann, dessen Kiefer gleichmäßig das harte Fleisch kauten. Seine Augen streiften suchend übers Wasser und starrten dann wieder in die letzten aufzüngelnden Flammen der Kochstelle. Er sprach nicht mit den anderen, und sie sprachen nicht mit ihm, doch was sie dachten, war klar. Es war ihm nicht gelungen, den weißen Mann einzuholen, und das hatte ihn in ihren Augen herabgesetzt. Sie fragten sich, ob es nicht ein Fehler gewesen war, sich seiner Führung anzuvertrauen; ob an seiner Verbindung zu seinem Totem vielleicht etwas nicht stimmte; ob nicht ein böser Zauber von dem weißen Mann ausgehend gegen sie und besonders gegen Mundaru wirkte. Sollten ihre Zweifel andauern, so würden sie ihn wohl am Morgen verlassen, um dem Stamm und Willinja, dem Magier, die Kunde von Mundarus Versagen zu überbringen.
Mundaru selbst konnte nicht zurückkehren – aus Scham nicht und auch aus Furcht nicht, weil er nicht vollendet hatte, was das Gesetz seines Stammes verlangte. Er mußte weitermachen, bis er oder der weiße Mann tot war. Es war die gleiche Situation wie damals, als er die federgeschmückten Stiefel getragen und den geheimnisvollen Stein mit dem Namen eines Mannes betrachtet hatte.
Seine Gedanken gingen im Kreis, und er war jetzt wieder beim Ausgangspunkt angelangt. Alles hatte er gesehen, was es zu sehen gab, Gutes und Schlechtes. Jetzt brauchte er Schlaf. Er gähnte, kratzte sich, streckte seinen Körper im Sand aus und buddelte sich eine Kuhle zwischen den beiden Feuern. Dann legte er seine Speere so zurecht, daß er sie mit einer Hand leicht erreichen konnte, und ohne noch ein Wort mit seinen Begleitern zu wechseln, schloß er die Augen. Doch der Schlaf wollte nicht gleich kommen. Seine Gedanken flogen wie grüne Papageien zum Lager zurück, wo Menyan an der Seite ihres Mannes Willinja, des Zauberers, schlief.
Man hatte sie nach dem Neumond so genannt; und sie war schlank und jung. Als sie noch ein Kind war, hatte ihr Vater sie schon Willinja versprochen, weil er die Gunst eines Mannes brauchte, der die Geheimnisse der Traummenschen verstand, der Regen machen und den Tod auf einen Feind herabbeschwören konnte. Vom Augenblick dieses Versprechens an war sie mit Willinja vermählt. Sie schlief an seinem Feuer, sie wurde von seinen Frauen unterrichtet, sie lernte alles, was eine Frau wissen mußte, um ihrem Mann nützlich zu sein. Aber er nahm sie nicht, bevor sie nicht eine Frau geworden war und mit Blättern bedeckt an jenem geheimen Platz gesessen hatte, wo sie nichts zu sich nehmen durfte außer jener bestimmten Nahrung, die einer Frau während der Zeit ihrer Blutungen erlaubt war.
Für Mundaru war sie von diesem Augenblick ab verloren. Aber er begehrte sie immer noch. Er versuchte, sie allein zu treffen und ungesehen von den anderen Frauen mit ihr zu sprechen. Er war jung, ihr Mann war alt. Mundaru gefiel ihr. Das zeigten ihm ihre Augen; aber sie fürchtete ihren Mann – genau wie Mundaru auch. Willinjas Augen konnten nämlich bis ins Innerste eines Mannes eindringen, und sein Geist wandelte außerhalb seines Körpers und beobachtete, was in den verstecktesten Winkeln geschah.
Sogar jetzt, kurz vorm Einschlafen, konnte Mundaru seine feindselige Gegenwart spüren, die seine Gedanken von Menyan wegtrieb. Er durfte ihn nicht bekämpfen – jetzt noch nicht. Aber wenn der weiße Mann tot war und die Kräfte des weißen Mannes in ihn selbst eingedrungen waren, wäre er vielleicht für den offenen Kampf bereit. Ein leichter Schauer der Vorfreude überlief ihn, dann kuschelte er sich tiefer in den warmen Sand und schlief ein.
Die Burschen beobachteten ihn aus den Augenwinkeln. Sie unterhielten sich leise noch ein bißchen, dann streckten auch sie sich im Sand aus, und noch ehe die Flammen zu einer schwachen roten Glut zusammengesunken waren, schnarchten sie wie erschöpfte Tiere.
Für Lance Dillon, der eingepfercht in enger, feuchter Finsternis unter den Pandangwurzeln saß, gab es jetzt einen schwachen Hoffnungsschimmer. Das Licht des Mondes fiel schräg von hinten über seinen Kopf auf das schwarze stille Wasser vor ihm. Zentimeter für Zentimeter drehte er sich in seinem Gefängnis um, und als er hochsah, konnte er etwa einen Meter über sich eine schmale Öffnung zwischen den oberen Wurzeln und der Sandbank erkennen. Er schätzte sie groß genug für Kopf und Schultern. Wenn es ihm gelänge, dort hinaufzukommen und sich hindurchzuzwängen, könnte er vielleicht die steile Böschung im Schatten der Sträucher hochklettern und den schlafenden Myalls über das flache Gras entkommen.
Ja, wenn! Er war sehr schwach. Der eine Arm und seine Schulter waren nicht zu gebrauchen, und der turnerische Kraftakt mochte sich als viel zu anstrengend für ihn erweisen. Beim leisesten Geräusch würden die Myalls aufspringen und ihm durch den Fluß nachsetzen. Das erste Problem aber war die Böschung selbst. Die schwarze Erde war feucht und glitschig, und von den dicken Erdklumpen am Rand konnte sich einer lösen und mit Gepolter ins Wasser fallen.
Äußerst vorsichtig fing er an, mit den Händen unmittelbar über der Wasseroberfläche eine Stütze für die Füße zu graben. Jede Handvoll Erde ließ er lautlos vom Wasser wegtreiben. Er grub tief, damit seine Füße nicht ausrutschten, und tastete das Loch rundherum nach losen Erdbrocken ab, die eventuell herunterfallen könnten. Als er zwei Löcher gegraben hatte, griff er weiter hinauf und grub noch zwei Löcher oberhalb seines Kopfes. Er zitterte. Schweiß rann ihm übers Gesicht. Seine Kleider waren völlig naß. Sobald er hochkletterte, könnten die herabfallenden Tropfen auf dem Wasser vernehmbar werden; auch könnte er sich in den verschlungenen rauhen Wurzeln verfangen.
Er lehnte sich an eine dicke Wurzel, bückte sich ins Wasser und zog seine Stiefel aus. Er brauchte lange für diesen einfachen Handgriff. Die ledernen Schuhbänder waren eng geschnürt und glitschig. Er mußte oft ausruhen, bis er sie endlich aufbekam. Hose und Unterhemd folgten, und als er sie abstreifte, fühlte er die Egel, die schuppig und fett an ihm hingen. Er versuchte sie wegzuziehen, aber sie saugten sich nur um so fester. Er mußte es noch eine Weile dulden, daß sie sein Blut aussaugten, obwohl er sich diesen Verlust eigentlich nicht leisten konnte. Splitternackt kauerte er im Wasser und überlegte, ob er seine Kleider als Schutz gegen die Hitze des nächsten Tages aufbewahren sollte. Schließlich entschied er sich dagegen und ließ die nassen Kleidungsstücke auf den Grund sinken.
Er war jetzt bereit – bereit für den Versuch, von dem sein Leben abhing. Er sah zu der schmalen Öffnung auf, durch die das Mondlicht schimmerte, und zog sich dann mit ungeheurer Anstrengung in die erste Fußstütze hoch. Hinter ihm im Wasser schwammen die Speerspitze und der abgebrochene Schaft, die ihm unbemerkt aus der Hand geglitten waren, als er sich zum Schlafen rüstete.