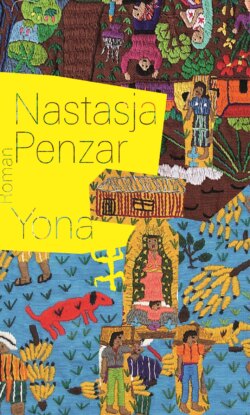Читать книгу Yona - Nastasja Penzar - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеMein Vater und ich fuhren an Sommerwochenenden in alle Freibäder. Manchmal saßen wir so lange im Auto, dass wir dreimal dieselben Nachrichten im Radio hörten. Wir bewerteten die Bäder nach verschiedenen Kategorien auf einer Zehner-Skala, zählten die Punkte zusammen und teilten sie durch zwei. Meinem Vater war die Grünanlage am wichtigsten, mir das Eisangebot. Meistens saßen wir dann mit Eis in der Hand am Beckenrand, kommentierten die springenden Jungs und ein, zwei Mädchen, bewerteten sie nach Eleganz und Mut oder wetteten, wer auf dem Bauch aufkommen würde. Einmal drehte ich mich plötzlich zu ihm. »Ich gehe jetzt auch springen.«
Er machte sein Stolzgesicht: »Vom Zehner, mija?«
»Ja, vom Zehner.«
Ich sprang auf, schob mir den Rest meiner Waffel in den Mund, sodass ich meine Hände frei hatte, und zupfte meinen Badeanzug zurecht. Ich hatte mir schon alles bei den Springerinnen von Olympia abgeschaut, streckte meine Brust raus, zog meinen Bauch ein und wuchs ein paar Zentimeter. Mein Vater schob seine Waffel mit der Eiskugel vor mein Gesicht, als Mikrofon: »Wie fühlen Sie sich an diesem sonnigen, glorreichen Tag, Madame Yona?« Ich lachte, sprach in das Eismikro, spuckte dabei noch ein paar Krümel meiner Waffel drauf, »Gut, wieso?« Sein Mikrofon wanderte zu ihm zurück. »Ihre Fans warten auf Sie, Madame Yona, und werden den Erfolg gebührend feiern nach Ihrer Wiederkehr.«
Dann sah er mich an, sein Gesicht wurde ernst und faltig. »Wenn du oben bist, mija, einfach laufen, glaub deinen Beinen nicht, wenn sie stehen bleiben wollen, immer im selben Tempo laufen, am besten fängst du hier unten schon damit an.« Er beugte sich zum Boden, sah zu mir hoch, klopfte mit seiner freien Hand langsam und gleichmäßig auf die nassen Platten neben dem Handtuch. »Zack, zack, zack, Yo-na, immer im sel-ben Tem-po.« Er machte mich nervös, ich nickte, blieb noch ein wenig stehen, »zack, zack, zack«, ich gewöhnte mich ans Tempo, sein »zack« hallte in mir nach, ich lief nach dem Trommelschlag in meinem Kopf los, ein kleiner Soldat in hellblauem Anzug am Beckenrand. Ich sah meine Füße, »zack, zack«, es war ein Marsch, ich erreichte die Leiter, es gab keine Schlange, »zack, zack«, es war beim Aufsteigen nicht einfach, das Tempo zu halten, Hände, »zack«, und Füße gleichzeitig, Stufe für Stufe, auf dem Fünfmeterbrett ging ich um die Treppe herum, »zack, zack«, ich flüsterte es mit, die Fläche war aus Beton, sie war kalt, das Zehnmeterbrett warf seinen Schatten darauf. Auf der Stufe zum Zehner wurde ich lauter, »zack, zack«, ich befahl es meinem Körper, er zitterte, meine Knie spürten das Ende, den Sprung, ich kämpfte mit dem Tempo, mein Herz pochte mindestens doppelt so schnell, der Boden unter mir wurde mit jedem Schritt weicher, »zack«, ich wurde panisch, das Blau des Beckens war weit, es vermischte sich mit dem Blau meines Badeanzugs, mein kleiner Bauch über meinen Zehen, die zitternd auf mein »zack« reagierten, ich streifte einen Körper, der neben mir am Geländer lehnte, konnte nicht aufblicken, »zack, zack«, kam am Rand an, wünschte mir ein hundert Meter langes Brett, mein Körper wusste, wie lang es war, alles pochte, es tat schon weh, mein rechter Fuß, »zack«, kam mit den Zehen über den Rand, meine Hände pressten sich an meine Beine, meine Stimme blieb stecken in meinem zitternden Körper, fand keinen Weg aus meinem Mund, der sich aufriss beim letzten, stummen »zack«. Mein linker Fuß trat in die Luft. Dann kam die Wucht. Sie zog meinen Körper mit sich, die Luft schnitt an meinem Körper entlang, die Bäume und der Rasen waren schnell, ich senkte den Kopf, er war so schwer, ich sah an meinem blauen Bäuchlein vorbei nach unten, meine Hände pressten, ich wurde schneller, meine Stimme löste sich, »za-«, das A wurde lang, mutierte zu einem nervösen Lachen, laut, befreite mich kurz, ich lachte hysterisch für einen Moment. Dann kam ich auf. Ein Pfeil in die Wasserdecke, sie stoppte mich. Es war plötzlich still. Kurz ohne Orientierung, sah ich meine Glieder irgendwo, oben und unten, suchte, fand die Oberfläche, nahm mir Zeit, es war schön, dumpf. Ich trieb schwerelos. Wurde ruhig. Ein Druck presste sich von allen Seiten auf meinen Körper. Ich wollte hierbleiben. Es war blau und stumm. Langsam trieb ich nach oben. Erst als die Not meiner Lunge in meinem Kopf ankam, machte ich zwei Züge, schloss die Augen, mein Kopf tauchte auf, ich atmete. Sah Umrisse. Ich hörte die Stimmen. Drehte mich auf den Rücken, ließ nur meine Ohren im Wasser, um die Stimmen zu dämpfen, hielt meine Augen geschlossen, bis ich am Beckenrand anstieß. Ich öffnete die Augen, hob den Kopf aus dem Wasser und das Erste, was ich hörte, war der Applaus meines Vaters.
Doña lächelt, sperrt das Gitter von innen auf, wir steigen aus dem Auto, ihre Schritte sind so langsam wie ihre Gesten, die sie größer wirken lassen, als sie ist. Sie läuft auf mich zu und umarmt mich. »Bienvenida.« Sie riecht nach Seife und Zwiebeln. Ich bedanke mich mit einem Nicken und versuche, ihrem Blick standzuhalten. Ich habe ihren Namen unendlich oft gelesen auf meinem Zettel, jetzt wundere ich mich, dass ich mir keinerlei Vorstellungen von ihr gemacht habe. Mein Körper ist schwer, sie nimmt meine Hand auf eine Art wie zuletzt meine Kindergärtnerin, drückt sie ein paarmal fest, dreht sich um, zieht mich mit sich, meine Taschen bleiben auf der Straße liegen, ich drehe mich nach Cris um, er hebt sie auf und bleibt dicht hinter uns. Doña zieht mich durch das Gitter, es riecht und dampft aus dem schmalen Gang. Sie weist mir den Weg. »Hier hoch, mija«, die Vertrautheit dieses Wortes erschüttert mich. »Oben ist gerade niemand, du hast da dein eigenes kleines, ja«, wir passen kaum durch das schmale Treppenhaus, Doña ist geübter im Quetschen, hebt ihre Hand über sich und streckt zwei Finger in die Luft, »Paradies.« Plötzlich bleibt sie stehen vor dem Treppenabsatz, ich stoße fast in sie hinein, sie dreht sich um, sieht zur mir herunter, zwinkert, greift mein Gesicht von beiden Seiten, schließt die Augen und sieht dabei aus wie mein Vater, wenn er für mich betete. »Mija«, ihre Augen sind tränenunterlaufen, »es ist ein Wunder, dass du hier bist«, etwas daran weckt den Ton in meinem Kopf. Ich halte ihrer Berührung nicht stand und trete an ihr vorbei auf die Terrasse. Der Himmel hier ist dicht, überall begrenzen Masten und Berge den Blick. Doña zeigt auf die Tür. »Hier, dein Zimmer.« Sie schiebt mich von hinten hinein, es ist dunkel, die Vorhänge zugezogen, ein großes Bett, auf dem eine Wolldecke mit Tigeraufdruck liegt. »Magst du es?«, fragt sie, ich nicke stumm. Sie geht zum Fenster, schiebt die rosafarbenen Vorhänge zur Seite und winkt mich heran. Meine Schritte sind immer noch langsam, diese Art der Schwüle kenne ich nicht. Doña nimmt mich am Arm, stellt mich neben sich und zeigt seufzend nach draußen. Ein weißlicher Film liegt zwischen uns und der Straße. Bis zum gezackten Horizont ziehen sich rechteckige Betonsiedlungen. Doña öffnet das Fenster, ich zucke zusammen. »Unsere Straße, mija.« Etwas Theatralisches liegt in diesem Satz. Zwei Jungs mit weißen Hemden und dünnen Beinen kicken einen Ball vor sich her, ein Metalllager quetscht sich dazwischen. »Welcher von denen ist der Pacaya?« Meine Frage wundert mich selbst. Cris lacht von hinten, ich bemerke, dass er auch noch da ist. »Der mit den Wolken um die Spitze.« Der Rauch, der den Vulkan krönt, eine kleine graue Haube, bewegt sich nicht. »Kann man da hoch?«, meine Stimme klingt dumpf. Cris nickt: »Morgen?« Doña schlägt ihm einmal fest auf die Schulter. »Es reicht jetzt. Mija, hier«, Doña zeigt auf die rotweiße Markise direkt unter uns, »guck, da mache ich cena für alle, Abendessen, da kommst du dann runter, wenn du ein bisschen geschlafen hast, oder hast du jetzt Hunger vielleicht? Mein Gott, was erzähle ich da, du hast jetzt Hunger, ich bin so blöd«, sie schlägt sich mit der Hand gegen die Stirn. »Nein, danke.«
»Ich mache dir was, ich bring’s dir gleich.«
»Aber«, ich sehe Doñas Gesicht und gebe mich geschlagen, »okay.« Cris setzt sich aufs Bett, prüft es wippend. »Gut, also, dann sehen wir uns, ich melde mich, wenn er sich meldet, wegen dem Haus und so«, er sieht zu Doña herüber, sein Gesicht ist plötzlich keck wie das eines kleinen Jungen, er steht abrupt auf und gibt Doña einen Kuss auf die Wange, bevor er verschwindet. Sie scheint Cristóbals Abschied nicht zu bemerken und starrt unentwegt auf mich, dann auf meine Hände, ihre Augen sind feucht und zittern ein wenig. Sie seufzt, »ah, das Essen«, tätschelt mir abwesend die Wange, schüttelt ihren Rock zurecht und verschwindet. Ich lege mich unter die Tigerdecke, mein Kopf macht nichts mehr, kein Ton ist hier, keine Bilder. Ich schlafe so schnell ein wie seit dem Tod meines Vaters nicht mehr.
»Der Vulkan, der Vulkan, mija!« Mein Vater schnalzte mit der Zunge und fuhr mir stolz durch die Haare. »Was die euch beibringen.« Er roch nach zu viel Eau de Cologne, hatte sich schick gemacht, grüßte die anderen Eltern ein wenig zu höflich, siezte sie, bis ihn einer duzte, dann duzte er sie, bis ihn wieder einer siezte. Wir waren in der Schule, an einem Abend, weil unser neuer Musiklehrer es so wollte. Ein langer Mann mit langen Haaren, der sich ständig nach meiner Herkunft erkundigte. »Super super, je weiter, desto besser!«, nach meinem Namen, »wie der Prophet?«, und daraufhin immer Walgeräusche machte, um die Lacher der Klasse zu kassieren. Er hatte mit uns für die Aufführung seinen Lieblingssong einstudiert. Am Ende standen wir also in einer Reihe auf der Bühne der Aula, wedelten bunte Fächer aus Krepppapier hin und her, mein Vater klatsche wild in der ersten Reihe, und wir sangen. »Du bist so heiß wie ein Vulkan.« Nach »Tanze Samba mit mir« sollten wir alle einen kleinen Hüftschwung machen, in den Proben hatte das gut geklappt, auf der Bühne verwechselten die meisten links und rechts, oder verpassten knapp ihren Einsatz, sodass wir ständig gegeneinanderstießen. Mein Vater konnte sich das Lachen nicht verkneifen und wippte vor Begeisterung in seinem Stuhl mit. Als wir fertig waren, machten wir uns wie üblich als Erste auf den Weg nach draußen, stiegen in die U-Bahn. »Weißt du, mija, das mit dem Vulkan«, er hielt sich die Nase zu, unterdrückte einen Lachanfall, »er ist heiß, ja, so ein Vulkan, das schon, aber das ist nicht das Schlimmste an ihm, das ist schön eigentlich, wenn einer aktiv ist.« Er wurde ernster. »Wenn einer aktiv ist, dann läuft er, und das ist auch nicht schlimm, das ist sehr schön, wie Adern in der Nacht sieht das aus, und er raucht«, er atmete ein, »und er spendet Leben, allen, die um ihn herum wohnen, er lebt, mija, aber er hat einen eigenen Willen. Wenn er will, dann lässt er alles raus, dann bricht er aus seinen Fesseln aus, die Menschen rufen dann Katastrophe, das Ende, das Ende, die Apokalypse«, er schüttelte den Kopf, »aber eigentlich, Yona, macht er alles sauber um sich herum, verbrennt alles, damit«, er beugte sich zu mir, flüsterte jetzt, seine Stimme hatte ihre Ruhe wiedergefunden, »damit alles von Null anfangen kann, das ist ein Anfang, wie eine Geburt.« Er summte das Samba-Lied, lachte. »Du bist so heiß wie ein Vulkan, qué locura, so ein Unsinn.«
Etwas reißt mich aus dem Schlaf. Alles ist dunkel, bis auf das orangefarbene Licht, das sich Spalten sucht zwischen den Vorhängen. Mit dem Licht kommen auch Stimmen von unten ins Zimmer, ich erkenne Doñas Lachen sofort. Andere fallen sich gegenseitig ins Wort. Alles an mir ist schwer. Noch immer habe ich die Klamotten von der Reise an, mein BH ist verrutscht und sticht mir Muster in die Haut. Ich stelle mich an das Fenster, schiebe mich zwischen die Vorhänge und starre auf die Markise unter mir. Sie ist eingerahmt von Rauch und den Lichtern darunter, es riecht nach Fleisch. Ein Alter kommt von der anderen Straßenseite, rennt fast, ruft schon von Weitem, ob es noch etwas gäbe. Doñas Stimme erwidert »Vengase!«, dann verschwindet er unter dem Rot-Weiß. Ich fühle mich beobachtet von all den Stimmen, manche Wörter sprechen sie fast wie mein Vater aus, der Ton hinter meinen Schläfen mischt sich langsam darunter. Nicht einmal in den Telenovelas sind die Worte so nah an denen meines Vaters gewesen.
Wegen meines Vaters zog der Ton in meinen Kopf ein. Nach seinem Arztbesuch wartete ich mit dem Abendessen auf ihn. Er schloss auf, räusperte sich im Flur, wartete dann einen Moment, seufzte und kramte wie so oft seine sorgenlose Stimme hervor. »Oh oh, das riecht fantastisch, da lohnt sich diese Krankheit doch fast, für mich zumindest.« Er kam in die Küche und wich meinem Blick geschickt aus, musterte nur das Essen, rieb sich die Hände und ließ die Zunge über seine Lippen fahren, hob den Teller an und roch am Essen, während er die Augen weit aufriss. Seine Gesten waren zu übertrieben, als dass ich sie ihm hätte abkaufen können. Sie bewirkten das Gegenteil von dem, was er wollte. Die Diagnose stach aus jeder dieser kleinen Bewegungen hervor. Er holte aus, griff mir mit seinen kalten Händen ins Gesicht, suchte nach meinem Blick, jetzt war ich es, die auswich. Er lächelte gegen die Sorge in seinen Augen an. Genau da legte sich der Ton zum ersten Mal auf mich. Mein Brustkorb wurde hart, ich wollte nicht mehr atmen, er stach. Mein Vater ließ ab von mir, setzte sich an den Tisch, pfiff eine kurze Melodie, faltete die Hände, dankte Gott für das Essen, wartete kurz, »und für das Leben. Amen«. Ich konnte ihm nichts nachsprechen, alles an mir war starr, ich starrte auf seine Hände, darauf, wie er die Gabel zum Mund führte, kurz pustete, die Augen schloss und kaute. Mit großer Mühe ignorierte er, dass ich nur das sah, was er versteckte. Etwas durchfuhr mich heftig bei jeder seiner bekannten Bewegungen, beim Öffnen seines Mundes, beim Kauen, dem schweren Atmen durch die Nase. Am Ende war er ruhig. Mein Essen war kalt geworden, ein feiner Film lag auf der Soße, nichts dampfte mehr. Sein Teller war leer, er strich mit seiner Gabel Muster in die Rückstände der Soße, immer im selben Tempo, von oben nach unten und zurück wie ein Pendel. Das Kratzen auf seinem Teller wurde in meinem Kopf lauter, durchfuhr mich heftig, er machte immer weiter, ich wollte nach seiner Hand greifen, sie stoppen, drücken, an ihr zerren, aber mein Körper machte nichts. Das spitze Geräusch seiner Gabel stieg in meinen Kopf, blieb dort, kreiste, drückte von innen gegen meine Schädelwände, veränderte sich, ich wollte die Augen schließen, es ging nicht.
Doña klopft. Ich erkenne sie an den zögernden Pausen. Sie flüstert meinen Namen in den Türspalt hinein, ich sage nichts, sie versteht es als Einladung, öffnet die Tür, ich drehe mich zu ihr, so in der Tür sieht sie groß aus, lächelt, räuspert sich, setzt ein paar Mal an, »willst du?« Sie geht auf mein Bett zu, stützt sich mit beiden Händen auf die Matratze, ein kleiner Schlitz macht sich in ihrem Dekolleté lang. »Komm runter, wenn du willst, wir haben frische chicharrones.« Mein Kopf tut weh, meine Kehle ist trocken, ich will etwas sagen, es kommt nichts. Sie klatscht in die Hände, dann mir auf die Schulter: »Komm, wann du willst, ich esse dir nicht alles weg.«
Ich hörte meinen Vater laut atmen, als ich die Haustür aufschloss. Die Herbstsonne fiel bedrohlich auf den Staub. Ich behielt die Jacke an und ging um die Ecke. Er saß am Küchentisch, krumm, hatte die Hände über dem Zettel ineinander gefaltet, sein Kinn lag auf der Brust und dort, wo sonst ein Doppelkinn daraus geworden wäre, hing die Haut nur noch ein wenig schlapp. Ich stellte mich vor den Tisch, legte meine Hände auf seine, auf den Zettel darin, und wartete. Seine Atmung war langsam, ich wusste nicht, ob er betete oder schlief. »Du bist dir sicher, mija?« Wir hatten dieses Gespräch schon so oft geführt, dass die Frage eine rhetorische sein musste. Ich sagte nichts.
»Wenn du gehen willst, musst du wissen, was dort ist, in diesem Haus«, er schloss die Augen, runzelte die Stirn, ich wartete lange, setzte mich dann, er war irgendwo. »Dieses Haus, Yona, deine –«, seine Hände umschlossen sich so fest, dass seine Knöchel weiß aufleuchteten. »Yona«, er atmete, ich war diese Langsamkeit nicht gewöhnt, wurde unruhig, mein Ton schaltete sich ein, er fing immer schneller an zu kreisen im Schädel, im Uhrzeigersinn, blieb abrupt stehen, legte sich von innen auf meine Stirn. »In dem Haus, mija«, der Ton wurde schärfer, fing an zu bohren, »ist deine Mutter«, und durchbohrte meine Trommelfelle. Ich stand auf, strengte mich an, meine Hände zu denen meines Vaters zu bewegen, umfasste sie einmal stark, sein Gesicht bewegte sich noch, er sagte etwas, blickte kurz zu mir auf, ich hörte nichts, drückte seine Hände noch einmal, die Ameisen in meinem Kopf wurden immer lauter und zischten, ich sprang auf, mein Ton trieb mich vor sich her, bekam Gewicht, legte sich zuerst auf meine Schultern. Ich versuchte, ihn zu kontrollieren, er wehrte sich, ich rang mit ihm, gab nicht nach und stand so lange da, bis er sich langsam, mit einem Wehen, verzog, in irgendeine Ecke meines Kopfs.
Doña sitzt vor dem Gitter, spricht mit einer Frau in eng anliegender Uniform und mit Pomade im Haar. Sie sieht mich kurz im Augenwinkel und klopft zweimal auf den Stuhl neben sich. Die Straße wirkt bei natürlichem Licht fast freundlich, die Markise ist noch da, unter ihr ist nichts, kein Grill, keine Stühle, keine Tische, nur ein leichter Rauchgeruch haftet hier noch von gestern. Die Frau ist über Doña gebeugt, die mit verschränkten Armen und besorgtem Gesicht hoch zu der Frau spricht über Dinge, die ich nicht wissen kann. Dann bemerkt die Pomadenfrau meinen Schatten, folgt ihm, mustert mich langsam von unten nach oben, ihre Schminke ist ein wenig zu dick aufgetragen, besonders um die Augen herum, es passt zur Pomade. Sie rüttelt an Doñas Schulter, zeigt auf mich. »Oh, bienvenida«, Doña lacht, klopft einmal auf ihren Bauch, hievt sich im Stuhl hoch, taumelt zwei Schritte zu mir, hält sich an meinen Armen fest, ich halte sie, bis sie ihr Gleichgewicht wiederfindet. »Zu schnell aufgestanden, danke, danke, oh, mija, das ist Yona, das Mädchen, schau, wie hübsch sie ist«, sie zerrt ein wenig an meinem Arm, ich winke ab, die Nachbarin scheint noch nicht überzeugt zu sein, reicht mir zögernd die Hand und spricht, so langsam sie kann: »Mucho gusto.« Ich antworte, sie erschrickt und kommentiert mein fabelhaftes Spanisch nach zwei Wörtern. Doña stellt sich fast zwischen uns, nimmt mit beiden Händen ihre Hand. »Gracias, Freundin, wir reden dann später weiter, Yona hier und ich sind verabredet.« Die Nachbarin zeigt wenig Regung. »Bis bald, Doña, danke für den Kuchen, oíste, hast du gehört?« Sie sieht nur mich dabei an, geht dann langsam über die Straße, ihre Hornhaut lugt an allen Seiten zwischen den Riemchen ihrer Sandalen hervor. Sie sperrt das Gitter vor der Haustür gegenüber auf. »Sie ist ein bisschen eine Pute, Yona, aber sie hat ein gutes Herz. Und, na ja, sie ist halt die Nachbarin.« Doña hebt ihre Arme an dabei. »Gut, dass du mal rausgekommen bist, du kannst ja nicht ewig schlafen, oder?« Ich setze mich auf den Stuhl, er ist so niedrig wie ihrer, sie fächert sich mit Karton Luft zu, wir liegen halb wie zwei alte Damen am Strand, die Sonne steht schon fast über uns. Ich kenne das hier alles noch nicht um die Mittagszeit, es ist staubiger als abends, und es riecht mehr nach Benzin als nach Kohle und Fleisch. Wir hören die LKWs, die Busse und ihre ayudantes, wie sie die Ziele der Busse schreien. Die Nachbarin gegenüber taucht kurz wieder auf, streckt ihren öligen Kopf durch das Fenster und schüttet irgendetwas aus einem Topf auf die Straße. »Das ist die mamá von Niña, verlorene Seele, hat alles Mögliche gemacht, außer sich um die Kleine zu kümmern.« Doña zischt es kaum hörbar, winkt kurz. Ich zeige mit meinem schweren Finger auf den Topf am Boden, der Doña bis zum Knie geht. »Sind das die chicharrones?« Sie freut sich, hebt ihn mit beiden Händen auf ihren Schoß. »Probier mal.« Ich greife in den Topf, sie sind hart und ölig, sie greift nach mir hinein, nimmt sich eine Hand voll. »Du musst nicht so zögerlich sein.« Dann schiebt sie sich einen nach dem anderen in den Mund, die Krümel fallen ihr auf das Kinn beim Reden. »Das ist auch dein Haus, Kleine, und deshalb sind es auch deine chicharrones!« Sie hält mir den Topf hin, ich greife hinein, nehme so viele ich kann, es freut sie. »Du musst essen, du hast ja nichts gegessen, ach mija, ich wollte dich ja wecken.« Ich esse schneller, bemerke mit jedem Bissen mehr, wie hungrig ich bin, die Krümel kleben an meinen glänzenden Fingern wie beim Chipsessen mit meinem Vater vorm Fernseher. Doña hört auf zu essen und mustert mich sorgenvoll. »Ich hätte dich wecken sollen, nicht? Ich weiß nicht, die haben alle gesagt, lass sie, bei ihr ist es ja mitten in der Nacht, in ihrem Körper, damit kenne ich mich nicht aus, aber nur einmal am Tag essen, ich hab mir schon gedacht, dass das nicht gut ist.« Ich wische mir den Mund mit meinem Ärmel ab, schüttle den Kopf. »Nein, danke, ich schlafe sehr gerne.« Sie lacht, ihre Stimme ist schallend und warm, mein Körper entspannt sich, ich kaue langsamer, lehne mich zurück, strecke die Beine aus, sie beobachtet mich, atmet laut zwischen ihren Bissen, greift mir mit ihrer Hand an das Bein, drückt ein wenig zu, sucht meinen Blick, ich gebe mir Mühe, ihm nicht auszuweichen. »Yona. Yona. Das ist bestimmt nicht so leicht, ich meine, wenn du was sagen willst, das alles hier, vielleicht ist es gut, dass du so viel geschlafen hast.« Sie nimmt ihre Hand weg, auf meiner Hose bleibt ein Fleck, sie bemerkt ihn nicht, ihre Hand reibt in ihrem Gesicht herum. »Es ist alles eine Überraschung, du wirst es hier gut finden, mija, du bist doch eine von uns.« Ich kaue schneller, sehe an Doña vorbei, nehme den Topf von ihrem Schoß in meine Hände und rieche daran. »Was ist das eigentlich, chicharron?« Ich nehme noch einen zwischen Zeigefinger und Daumen und mustere die Struktur. »Haut vom Schwein.« Ihr Blick wird weich, sie wischt die fettigen Hände an ihrer Schürze ab. »Schön, dass du hier bist, mija, dass jemand von euch noch einmal zurückkommt! Weißt du, keiner ist zurück von denen, die weg sind, von deinem Vater, den Deutschen, dem Club. Dein Vater wollte mit denen nichts zu tun haben, aber er hat mir einen Brief geschrieben.« Doñas Hand macht abweisende Bewegungen. »Dass ich mir keine Sorgen machen soll. Dein Vater war ein Guter, weißt du«, sie seufzt. »Hat mir geschrieben, dass ihr jetzt dort bleibt, dass er jetzt neu anfängt, ein Haus von seinen Eltern, die er hasst, und Geld von seinen Eltern, die er hasst. So hat er das geschrieben. Aber Yona, ich glaube nicht, dass er sie gehasst hat, das glaube ich wirklich nicht. Er hat das alles gemacht, damit du wegkommst von hier, alles neu, hat er geschrieben, ich habe den Brief noch irgendwo, und dass er nicht mehr schreiben will, um mich zu schützen, es war ja Krieg, mija, du musstest ja hier weg, Yona, du darfst nicht denken, dass«, sie hält inne, um ihren Mund herum ist alles glänzend vom Schweinefett, »na ja. Ich habe Kerzen angezündet, zu jedem Geburtstag.« Ich will nichts mehr hören, versuche irgendein Ausweichmanöver, ich kenne sie noch nicht gut genug, biete ihr noch einen chicharron an, sie ignoriert ihn, nimmt mein Gesicht in beide Hände, unterdrückt ein Weinen, in mir zieht sich alles zusammen, mein Vater hat mir nicht beigebracht, wie man solchen Emotionen ausweicht, wenn man mit beiden Händen festgehalten wird. »Du siehst aus wie dein Vater«, sie flüstert es mehr zu sich selbst als zu mir, ihre Augen sind feucht, in mir spannt sich alles an, mein Magen, meine Brust, mein Hals, dann mein Kopf. »Aber hier«, sie nimmt meine Hände, »deine Hände sind von deiner Mutter.« Der Ton platzt so heftig und laut aus einer Ecke meines Schädels heraus, wie sonst selten, mir wird schwindelig, die Ameisen wirbeln in allen Nischen meines Körpers. Ich hatte immer gedacht, das mit den Händen sei nur ein Spruch von meinem Vater gewesen, damit er irgendetwas hatte, das er über meine Mutter sagen konnte und ich keine weiteren Fragen stellen musste. Dass ich ihre Hände hatte, reichte uns.
Ich habe meinem Vater all seine Abwehrmethoden abgeschaut. Ich lief an seiner Hand im Supermarkt herum, er kaufte eine Haarbürste, die Verkäuferin lächelte, griff mir in die Haare, mein Vater zog mich weg, ich erschrak vor beiden. Dann sagte sie etwas zu mir, über meine Mutter, sie würde das sicher ganz toll machen, das Bürsten, bei den Haaren, ich wusste nicht, was sie von uns wollte. Ich schaute zu meinem Vater hoch, er hob seine Augenbrauen, nickte dreimal entschieden und versuchte ein Lächeln, bevor wir gingen. Ich merkte es mir. Von da an lächelte ich jedes Mal, wenn mich jemand nach meiner Mutter, nach meiner Herkunft, meinem Gesicht oder meinen Haaren fragte. Dreimal nickte ich dann. Nur meine Kindergärtnerinnen fingen an, mich traurig anzuschauen, wenn ein anderes Kind irgendetwas über seine Mutter erzählte. Ich schaute erst traurig zurück, aber irgendwann begann ich auch hier dreimal zu nicken und zu lächeln.
Doña stöhnt ein wenig nach dem Essen, hält inne, greift nach mir, ihre Hand landet auf meinem Arm. »Ich bin froh, weißt du«, sie presst ihre Augen zusammen, schluckt, »seit wir wissen, dass du kommst, Yona, seit dein Vater uns angerufen hat, ist es«, sie neigt ihren Kopf zur Seite, überlegt, »es ist, als wäre ihre Seele ruhig.« Sie beugt sich vor, ihr fettiges Gesicht berührt mich fast, sie flüstert, während sich ihre Hand um meinen Arm festzieht, »tu mamá.« Alles an ihr verlangt eine Reaktion von mir, ich versuche mich zu winden, sie blockiert die Fluchtwege. Der Ton dreht auf, rebelliert anstelle meines Körpers, den ich nicht bewegen kann. Doña bemerkt davon nichts. Ich weiß, dass niemand außer mir bemerkt, wenn es wild wird in meinem Kopf, wenn es anfängt zu zischen und zu schmerzen, nicht einmal mein Vater konnte immer so genau sagen, was mein Ton gerade machte. »Yona, deine mamá ist die Einzige, die ruhig damit ist, weißt du. Alle hier, Cris und der Club, Barriga, die alte Wampe und dein Vater, vor allem dein Vater, wir waren alle ein bisschen in Angst, was du hier willst, wenn du kommst. Was, wenn sie gar nicht mit dir reden will, haben sie zu mir gesagt, was, wenn sie so fresa ist.« Sie lässt meinen Arm ein wenig locker, ihre Worte stechen in meinem Kopf. Sie lacht plötzlich nervös, ich bemühe mich, wenigstens meine Augen von ihr abzuwenden, aber nicht einmal die kann ich kontrollieren. »Weil die doch nur die Deutschen vom Club kennen, mija, aber das hat mir dein Vater vor langer Zeit schon am Telefon erklärt. ›Nein‹, hat er gesagt, ›es sind nicht alle so hier.‹« Sie erschrickt, beißt sich in den Knöchel ihres Zeigefingers, ihre Augen entschuldigen sich bei mir, sie lässt langsam ihren angebissenen Finger sinken, mein Ton lässt nach. »Ich habe ihn gefragt, es tut mir leid, mija, ob du kommst, weil du das Geld willst, oder das Haus, da oben«, sie wirft eine Hand in die Luft und zeigt auf ihre Markise, »oder das hier, das ist ja auch von der Familie.« Sie zuckt mit den Schultern. »Aber dein Vater konnte es auch nicht so genau sagen, mija, er wusste ja gar nicht genau, warum du kommen willst.« Sie nickt eindringlich, wartet, will wieder eine Antwort, ich zucke nur mit den Schultern. »Gut, mija, es ist ja gut, dass du hier bist, wohin sonst? Also das und dann, was wollte ich?« Ich bete, dass sie sich nicht daran erinnert, es ist das erste Mal, dass ich bete seit der Diagnose meines Vaters. Es ist umsonst. Sie erinnert sich. »Ah, die Seele, also die Seele deiner«, sie beißt sich auf die Lippe. Mein Körper versteift wieder. »Ihre Seele, mija, hat sich jedenfalls gefreut, Ruhe gegeben, sie ist in Frieden jetzt, aber ich kann dir leider nicht sagen, warum.« Mein Ton pocht, langsam und sorgfältig, breitet sich über meinen ganzen Körper aus, die Ameisen erkrabbeln sich ihren Weg durch meine Glieder. »Hier ist ja alles aufgewühlt, seit dem Krieg sind diese Seelen überall, mich hat das nie gestört, nicht wirklich, nur dass sie so unruhig war, das hat mich traurig gemacht, ich meine, meine Schwester hat doch ihren Frieden verdient, findest du nicht?« Sie zuckt mit den Schultern, in und an mir kribbelt alles, die Starre meines Körpers fängt an mir wehzutun, meine Sicht verschwimmt, mein Ton feiert, trällert immer lauter. Doña greift noch einmal nach mir, und mein Ton verzieht sich plötzlich in eine Ecke, als hätte er Angst, von ihr erwischt zu werden. »Aber sie ist ruhig, seit du hier bist, ist alles ruhig.« Ihre Worte suchen sich ihren Weg durch diese Starre in meinem Körper, was sie sagt, erreicht mich sehr langsam. Ich versuche zu atmen, die Ameisen werden langsamer, verziehen sich wie der Ton, im Gleichschritt, meine Sicht wird klarer, ich sehe Doña in allen ihren Details vor mir. Ich gehe ihr Gesicht ab nach Zügen, die mir bekannt vorkommen, nach Schnittmengen mit mir. Ich wünsche mir einen Spiegel. Ich kann mir Doña nicht mit einer Schwester vorstellen. Ich denke an die Geschwisterkinder in meiner Schule und wie man ihnen ansah, dass dieselbe Person ihnen die Klamotten rauslegte am Morgen, wie sie sich mieden auf dem Schulhof oder wie die Jüngeren immer hinter den Älteren herschleiften, ohne ihre Füße anzuheben, vor allem morgens. Ich kann mir Doña nicht vorstellen als Kind. Wie sie ihre verträumte Schwester an der Hand hinter sich herschleift, die beiden Mädchen hatten sicher das Gleiche an, auf einem von diesen Bergen. Ich nicke Doña mit aller Mühe dreimal zu und lasse mich tiefer in den Stuhl sinken. Sie schüttelt den Topf, damit die besten chicharrones hochsteigen, nimmt sich noch einen, »das ist der letzte!«, sie wirft ihn sich in den Mund und kaut. Es entspannt mich. Bei den Mädchen aus der Schule gab es zu Hause immer dieses letzte Anstandsstück, egal wovon, das man auf dem Teller liegen lassen musste, damit man nicht gierig wirkte. Mein Vater hatte darüber gelacht, wir hatten ein Spiel daraus gemacht und spielten Schnick-Schnack-Schnuck um das letzte Gummibärchen oder um den letzten Keks. »Gefällt es dir?«, ich bin überrascht, weiß nicht, was sie meint. »Was?« Sie ist verblüfft von meiner Frage. »Na, das hier«, sie zeigt auf den Topf, etwas in mir löst sich, ich nehme den Topf hoch und nicke, unsere Finger und Gesichter sind fettig, der Topf auf meinem Schoß rutscht mir weg, ich weiß nicht, wie ich ihn halten soll. Doña greift nach ihm, erwischt ihn zu spät, er fällt auf die Straße und rollt ein bisschen weiter, bis er, von seinem Henkel gebremst, liegen bleibt. Die Krümel der chicharrones sind um uns herum verstreut wie Konfetti, mein Gesicht läuft warm an, ich entschuldige mich bei Doña, sie lacht, schon fangen Ameisen an, ihr Gelage zu planen, sie kommen von allen Seiten, Doña nimmt mich am Arm. »Komm, wir lassen sie, ich habe jetzt keine Lust, kommst du mit auf den Markt?« Sie schließt die Haustür und das Gitter ab, wir lassen die Stühle auf der Straße stehen und die Ameisen ihren Teil erledigen.
Mein Vater telefonierte jeden Sonntag nach der Kirche mit der casa, ich saß meistens daneben, müde und zufrieden vom Eisessen, und hörte nur seine Hälfte des Gesprächs. Er fragte nach Namen und erzählte von mir, ich grinste ein wenig, wenn er mich lobte. Später, als ich schon lange in der Schule war und bei den Telefonaten nur noch dabei sein wollte, um mich vor den Hausaufgaben zu drücken, veränderte sich etwas. Ich verstand mit jeder Woche weniger. Einmal wurde er hitzig, er fragte nach immer mehr Namen, nach den Kindern der Namen, er senkte die Stimme, blickte sich um nach mir und dachte wohl, ich hörte ihn nicht, wenn er bei seinen Fragen nach den Toten die Hand vor den Hörer hielt. Dann schwieg er kurz und legte auf. In diesen Wochen murmelte er das Wort immer wieder mantraartig in sich hinein, mara, mara, er flüsterte und schüttelte den Kopf. Nachdem ich das monatelang gehört hatte, fragte ich nach. Er sah mich an, nahm mein Handgelenk, atmete einmal tief aus, schloss seine Augen und grub von irgendwoher ein Lächeln aus. »Mara kommt von marabunta, Yona, eine Ameise.« Er nahm seine Hand von mir und legte sie auf den Tisch. »Die marabunta ist eine Kriegerin«, er malte mit beiden Händen einen Wurm, der die Größe meines Unterarms hatte, »und hier ist die kleine Kriegerin mit allen ihren Brüdern, mit ihrem Heer, sie kommen von allen Seiten«, seine Fingerspitzen spielten auf dem weißen Plastiktisch herum. Er tippte um den Wurm herum, kam ihm näher und fiel über ihn her. Seine Fingerspitzen, die Ameisen, kletterten auf ihn. »Es sind viele. Weißt du, wie groß dieser Wurm ist für eine Ameise? Sie und ihre Freunde schleppen das Tier nach Hause«, sein Fingergewirr bewegte sich in trommelndem Plastiktischwirbel in meine Richtung, ich verschränkte meine Arme vor meinem Körper, »und fressen es auf!« Seine Ameisenhorde überfiel meinen Oberkörper, meinen Hals, meine Arme. Ich schob mein Gesicht über meine linke Schulter, bis er von mir abließ.
Wir laufen los, Doña geht vor. Das Geräusch wird mit jedem unserer ungleichen Schritte lauter. Es ist das Klatschen. Zwei Häuser weiter stehen drei Mädchen hinter dem Gitter, tragen Zöpfe und Trachten, nicken Doña zu, legen ihre Fladen aus den kleinen Händen auf ein rundes Blech über dem Feuer, ein Schwall von Hitze kommt uns entgegen aus dem kahlen Raum, Ziegeln, er hat kein Fenster. Die Gesichter der Mädchen sind starr, ihre Handflächen geübt und fast genauso groß wie die Tortillas, die sie den ganzen Tag in ihre Form klatschen.
»Ich komme später, das hier ist Yona, sie wohnt jetzt bei uns«, die Mädchen grüßen mich ohne Ausdruck, verlassen ihren Klatschrhythmus nicht dabei. »Wir kommen später und holen alles für die cena, heute vielleicht ein bisschen weniger, oíste, hast du gehört?« Die Kleine, die am nächsten an Doña steht, nickt, Doña zieht mich mit sich, weg von dem Tortilla-Gitter. »Gute Mädchen, sind noch nicht lange hier unten, ist vielleicht besser für sie, dass sie da drin bleiben, besser als hier draußen.« Sie zeigt auf die Häuser, an denen wir vorbeilaufen, die alle aussehen wie ihres, und sagt die Namen der Bewohner, zweimal fügt sie noch ein »assasinado« hinzu und bekreuzigt sich.
Ich mache es ihr nach. »Das ist nicht mehr lustig, mija, weißt du, die mara bringt heute mehr Menschen um als die Soldaten und alle zusammen im Krieg.« Sie hebt ihre Hände. »Da, da auch, siehst du, ihr Sohn ist vermisst, wenn du verstehst, was ich meine.« Ich verstehe nichts. Sie hebt die Hand und grüßt einen Jungen, dann hakt sie sich bei mir unter und zischt zweimal. »Und keiner kann denen was, weißt du, wir müssen uns selber helfen, niemand tut was! Früher war das nur in den roten Zonen, aber jetzt, jetzt ist die mara überall.« Sie wippt im Laufen, ich passe mich ihr an. »Homies sagen sie zu ihren Freunden«, sie spricht das H mit Nachdruck, sie ist stärker, als ich dachte, schiebt mich an den Straßenrand, ein Pick-up fährt so knapp an uns vorbei, dass ich husten muss vom aufgewirbelten Staub. Wir biegen links ab, ein kleiner Hügel, unten sehe ich schon, was sie meinen muss mit Markt. Eine Halle mit blauem Dach, links ist etwas wie ein Wettbüro oder eines der Lädchen, die hier tienda heißen, sie grüßt hinein, nur eine abgewetzte Stimme kommt zurück. Wir bleiben vor der Markthalle stehen, ein Junge hockt vor einem kleinen Plastiktisch, hält sich ein Tuch vor die Nase, in seinen Augen ist alles rot, was weiß sein sollte, sein Blick ist tot. In der Kiste vor ihm, auf einem kleinen Haufen Stroh, ein Hahn, er bewegt sich fast nicht mehr, sein Gefieder ist schütter, seine Geräusche klingen rostig. Die Ware passt zu ihrem Verkäufer. Ich schaue den Jungen ein bisschen zu lange an, Doña bemerkt es, sammelt sich, nimmt mich am Ellenbogen. »Lösemittel, mija, das ist billiger als Zigaretten, gibt’s an jeder tienda, traurig traurig.« Sie atmet einmal laut aus, damit ist ihre Trauer bekundet. Auf ihrer Stirn liegt neuer Schweiß, die Sonne prallt auf uns, ihre Hand in meiner Armbeuge wird schwitzig. »Wir müssen rein, mija, drinnen ist es kühler, und es stinkt nicht so.« Am Eingang zur Halle hockt noch ein Junge, jünger als ich, er hält seinen Kopf gelangweilt in den Händen, vor ihm steht eine Kühlbox, wie meine Lehrerinnen sie zu Picknicks mittrugen und von denen sie immer wollten, dass jemand sie ihnen abnimmt. Doña hält ihm zwei Scheine hin, aus der Halle kommen kühle Luft und künstliche Geräusche von Musik und anderen Dingen. Doña nimmt sich ein rotes Tütchen aus der Picknickbox, ich auch. »Hier«, Doña beißt mit den Zähnen die Folie vom Wassereis ab, »musst aufpassen, kannst du nicht bei jedem kaufen, manchmal ist das Wasser schmutzig, und dein Magen macht ein paar Tage alles, was du nicht willst.« Sie macht ein blubberndes Geräusch, ich lache, dann saugt sie an dem kleinen Loch, das sie aufgebissen hat, bis um ihre Lippen herum das Eis seine rote Farbe verliert, ich mache es ihr nach, die Folie schmeckt bitter, was dahinter kommt ist seifig und süß, es tut gut. Dann gehen wir in die Halle, schieben uns durch die Menschen, wie ein Vorhang stehen sie herum. Doña geht vor, sie schiebt sie zur Seite, aus dem Weg. Sie rufen ihre Waren in die Halle, die Preise, Grüße, die Schönheit oder die Summen, die Tagesangebote, es gibt Kurzwaren, Nadeln, Batterien, daneben der Mann mit den Hühnerteilen, die Beine hängen schlaff in die Halle hinein. »Lecker«, Doña fragt mich, was ich brauche, ich zucke mit den Schultern, am Boden sitzt ein Junge und verkauft Lichterketten, singende Weihnachtsmänner und blinkende Tannenbäume. »Mijo, wir kommen nächstes Jahr wieder.« Er nickt, Doña verdreht die Augen wegen der Unangemessenheit der Weihnachtsbeleuchtung, wie mein Vater, wenn er mit seinen letzten Sommershorts durch den Discounter ging und sich an der Kasse beschwerte, dass die Spekulatius so aufgestellt waren, dass er sie sehen musste, auf Augenhöhe, in den Zwischenregalen, eine Frechheit. Wir hatten Regeln. Nichts, dass nach Weihnachten roch, aussah oder schmeckte, durfte in unser Haus, geschweige denn in unseren Mund kommen vor dem ersten Advent. Nur in seinem letzten Jahr machte er eine Ausnahme.
»Ich werde zu Weihnachten nicht mehr da sein, mija.« Mein Vater hatte bei mir einen Schokoladennikolaus bestellt, hielt ihn in seinen Händen, stellte ihn auf den Kopf. »Wahrscheinlich«, er schwenkte ihn hin und her, wankte, setzte sich. Ich hasste den Supermarkt dafür, dass diese Sachen so früh in den Verkauf kamen, er war zu schnell in seinen Händen gelandet. Er entblätterte ihn zittrig, oben, an der Kappe, zog ein wenig rote Alufolie ab. »Deshalb darf ich auch jetzt schon.« In seinem Scherzen war nichts Bitteres, aber mein Körper vereiste. Der schokoladenbraune Kopf erschien unter seinem erwartungsvollen, ausgezehrten Gesicht. Er legte ihn auf seine untere Zahnreihe, biss langsam ab, seine Kraft reichte gerade noch für die billige Schokolade. »Das ist lustig, Yona«, er kaute, schloss die Augen, genoss kurz. »Ich habe es ausgerechnet, das Ende ist dann ungefähr«, seine Worte kamen sehr langsam, »auch das Fest der Geburt.« Er wischte sich mit einem Finger die verzuckerten Mundwinkel ab und hielt mir den Rumpf hin, ich winkte ab. »Stimmt, du darfst auch gar nicht probieren, bei dir würde das ja gegen die Regeln verstoßen, ganz eindeutig«, sagte er und biss noch ein wenig ab. Er kaute, schluckte. »Was ich noch sagen will, also, es ist ja immer auch ein Anfang.« Er nickte und legte den angebissenen kleinen Körper auf den Couchtisch. Dort lag er sehr lange. Er aß ihn nicht auf.
Ein Junge spielt an einem dicken Gameboy herum, wir laufen weiter, die Halle ist dunkel und kühl, auf allem liegt dieser Fleischgeruch, sodass ich die frischen Farben kaum abkaufen kann. Eine dicke Frau steht hinter zwei Feuerstellen, Suppen, sie rührt abwechselnd und klopft die Kellen am Topfrand ab. Doña begrüßt sie mit einem Handschlag, stellt mich vor, die Frau macht mir ein Kompliment, bevor sie wieder in Interesselosigkeit fällt. Doña bestellt zwei liquados, holt Münzen aus ihrer Schürzentasche, die Frau schüttelt den Kopf, Doña diskutiert nicht und steckt sie sofort wieder zurück. Die Frau schneidet Früchte in allen Farben, die sich auf ihrem Schneidebrett zu einem Braun vermischen, wirft sie in den Mixer, fragt nach Milch, Doña nickt, sie fragt nach Zucker, Doña hält ihre Hand über den Mixer, lässt ein paar Millimeter zwischen Daumen und Zeigefinger, »un poquito.« Die Frau füllt einen Plastikbecher voll, gibt ihn in den Mixer, füllt alles mit Eiswürfeln auf, legt den Deckel darauf und mixt. Ihre Blicke wandern von mir zu Doña. »Das ist sie also«, sie schnalzt mit der Zunge, Doña stellt sich einen kleinen Schritt vor mich. »Was?« Die Frau zuckt mit den Schultern. »Das Mädchen, das Mädchen, auf das der Bauch gewartet hat«, sie hebt ihre Augenbrauen, »auf das alle gewartet haben. Wie sie aussieht«, sie mustert mich und reicht uns unsere Becher. Doña reißt sie ihr aus der Hand, wünscht einen guten Tag, verschüttet dabei einen großen Teil und wendet sich heftig von der Frau ab. Was wir trinken, ist rosa, kühl und süß. Sie trinkt bis auf den Grund des Bechers, saugt an seinem Boden herum, und stößt ein paar Worte seitlich am Strohhalm vorbei in meine Richtung. »Lass dich nicht verunsichern, mija.« Sie hakt sich bei mir unter, schiebt mich aus der Halle, auf die Straße. Wir laufen zurück, an den Straßenrändern sind manchmal Stücke eines Gehwegs, links ein paar Blechhäuschen, Kinder, Hunde und frische Wäsche, der Mittag ist geschäftig, die Straße ist voll von klappernden Flip-Flops und Blechmusik, links ist ein Neubau, davor ein älterer Herr als Wachmann mit Schrotflinte. Die Sonne steht steiler als vorhin, ich schwitze, Doña bleibt kurz stehen, atmet aus und holt von irgendwoher plötzlich das Wichtigste hervor: »Bist du wegen dem Haus hier, mija?« Ich verschlucke mich an nichts, schüttle den Kopf, zucke mit den Schultern. »Na gut«, sie hakt sich wieder bei mir ein und zieht mich die Straße entlang. Ich verstehe ihr Timing nicht. »Die haben es in den Händen«, als hätte das Thema an Wichtigkeit verloren, verfällt sie in ein märchenhaftes Erzählen, »auf beiden Seiten, die alemanes, der Club, und der, na ja, und Barriga, der Bauch, du lernst ihn bald kennen, er hat einen Fuß auf der einen Straßenseite.« Sie kichert. »Eine Brücke, stell ihn dir als Brücke vor, nur mit einer Wampe, hier«, sie hält sich ihre Hände einen halben Meter vor den Bauch und kichert, »ist mit uns aufgewachsen, also da oben«, sie hebt ihren Finger, zeigt auf den Berg, »im Haus mit deinem papá, deiner ma –«, sie sieht mich mitleidig an, »mit mir, allen, den Deutschen, ein Waise, kannte nur uns und deinen Vater, ist ihm immer hinterhergelaufen, schon als Kind, hat ihn fast vergöttert«, sie bekreuzigt sich. »Das sollte man nie, Menschen vergöttern ist immer eine dumme Idee, mija.« Sie klopft mir auf den Arm. »Aber das machst du nicht, ich sehe das. Das sieht man Menschen an, du hast diesen Rücken.« Sie geht mit ihren Fingern meine Wirbelsäule ab. »Diesen geraden Rücken, du weißt ganz genau, wie groß du bist, du fragst dich das nicht bei jedem Schritt, und noch wichtiger, mija, deine Augen«, sie bleibt stehen, stellt sich vor mich, um mir lange in die Augen zu sehen, dann lächelt sie. »Ja, deine Augen sind von deinem Vater, diesen Punkt, du hast nur einen Punkt, immer«, sie hakt sich wieder bei mir ein, »habe ich gleich gesehen, du suchst nicht überall, kommst in ein neues Haus, ein neues Land, zu uns, wir sind ja alle neu für dich, aber deine Augen wissen, welchen Punkt sie sich suchen. Deshalb mache ich mir keine Sorgen, dass da irgendetwas passiert, wenn du ihn kennenlernst, weil du weißt, wie groß du bist, mija. Du darfst nur nicht lachen! Er sieht ein bisschen peinlich aus«, sie zieht ihren Arm aus meiner Beuge, fährt sich mit beiden Händen durch die Haare, zieht sie an ihrem Kopf entlang nach hinten. »So, mija, mit dem Fett in den Haaren, wie in den Filmen, ich glaube, er war ein bisschen zu lange in den Staaten.« Sie lacht, zischt etwas in Gedanken an den Mann, der die finca »verwaltet«, so hat mein Vater das genannt und sein Gesicht dabei zwischen Fingeranführungszeichen bewegt. »Genug, ich Plappertante, er ist jedenfalls oft hier gewesen, hat etwas vorbereitet, hat jemanden gesucht, der dich hinbringt und so weiter, ich habe gesagt, Cristóbal macht das, dann hat er sich mit ihm getroffen, und du hättest Cris’ Gesicht sehen sollen, als er zurückkam, das war nicht schön, aber geredet hat er nicht, nein«, sie bleibt an der Kreuzung mit unserer Straße stehen, nimmt meine Hände. »Was ich sagen will, keine Angst, Cris ist ein Guter, fast so etwas wie mein Sohn, mija, aber pass auf, ich weiß nicht, was das alles soll, ich weiß nicht, was er will, was mit dem Haus ist, dem Club, ich weiß nichts davon, ich weiß nur, dass alles gut wird.« Sie drückt meine Hände, ihre Worte verlieren die Floskelhaftigkeit. »Aber pass auf dich auf, ich bete.« Sie drückt noch einmal, hakt sich wieder bei mir ein. »Aber schön, sehr schön, mija, dass du hier bist, das ist ein bisschen Zuhause, oder?«
Wir wussten beide, dass seiner Diagnose nichts entgegenzusetzen war, gaben uns Mühe, ihr keine Beachtung zu schenken, wir übertrafen uns dabei, dachten uns Ausreden aus für sein Zittern und für seine schwindende Kraft. Unser Lachen darüber wurde mit jeder Woche hektischer. Einmal, während ich kochte, schimpfte er über die Steuererklärung, was dort alles angegeben werden müsse: »Das Erbe wollen die wissen, noch von meinen Eltern«, er machte eine Pause, so lange, bis ich mich umdrehte, »und die finca im alten Ort, die noch uns gehört.« Er sah mich eindringlich an, nur kurz, atmete aus, ich drehte mich wieder zum Kochtopf, versuchte, die Gedanken abzuschütteln, er keuchte ein paarmal. »Yona«, sein Hals war trocken, »Yona, dreh dich um, ich muss mit dir reden.« Ich rührte schneller, tat, als hätte ich ihn nicht gehört. »Du musst dich entscheiden, weißt du.« Ich hörte ihn ja. »Yona!« Er stand auf, lief auf mich zu, ich ließ den Schwamm erst fallen, als er seine Hand auf meinen Arm legte. Ich sah ihn nicht an. »Es gibt zwei Wege«, er winkte ab, »zwei leichte Wege, du kannst natürlich auch etwas anderes machen.« Ich versuchte zu lächeln, wir gaben uns große Mühe. »Aber so oder so, mija, ich habe lange nachgedacht, ich wollte es dir nicht«, er schluckte, nahm meinen Arm fester, als ich es ihm in seinem Zustand zugetraut hätte. »Yona, ich muss das jetzt, sonst kann ich nie«, er zog mich zum Tisch, ich setzte mich, er suchte einen Zettel und einen Stift, setzte sich mir gegenüber, legte die Spitze des Stiftes auf den Zettel. »Zwei Wege, Yona.« Er sah mich nicht an dabei. »Nummer eins, das Haus hier, du bleibst, machst, was du willst, und ich rufe morgen drüben an, im alten Ort.« Er starrte auf die Spitze des Stifts, der sich fast durch den Zettel bohrte. »Und sie verkaufen die finca, ich mache das so, dass das Geld bei dir ankommt, es ist nicht so einfach, aber das kriegen wir schon hin.« Seine Stimme veränderte sich, Tränen schossen ihm in die Augen, und er zwang ein paar von den Worten hervor, die wir mein ganzes Leben lang virtuos irgendwo verscharrt hatten. »Diese finca, Yona, im alten Ort, sie ist befallen, mija, ich möchte, dass du sie verkaufst«, er fing an, Kreise in den Zettel zu malen, immer schneller und enger, »es ist nur nicht ganz einfach, wegen der Ameisen, mija.«
Der Kreis im Zettel durchbrach das Papier. »Und Weg Nummer zwei ist das Gegenteil.« Er kniff die Augen zusammen, als wäre ihm etwas herausgerutscht, das er nicht hatte sagen wollen, und machte eine Pause. Ich half ihm: »Ja?« Er wusste nicht mehr, wo wir waren. »Du willst mir Weg zwei erklären.« Er nickte erschrocken, wandte sich wieder dem zerfetzten Zettel zu. »Hier«, er rang mit sich, »unser Haus hier verkaufst du und gehst in den alten Ort.« Er sprach so schnell, dass ich es fast nicht verstand, ich lehnte mich zurück in den Stuhl, wir wussten beide, dass es nie wirklich eine Wahl gab. Er riss einen unversehrten Teil des Zettels ab, setzte den Stift an, öffnete den Mund, schloss ihn wieder, lehnte sich vor und schrieb Doñas Namen, ihre Adresse und ihre Telefonnummer auf. Seine Schrift war vom Zittern ganz kindlich geworden.
Als wir vor Doñas Haus stehen, sind fast alle chicharron-Reste vom Boden abgetragen. »Die kleinen Fleißigen.« Doña bückt sich über den Ameisen und summt ihnen ein Lied, winkt mich herbei, zeigt auf sie. »Guck genau hin, mija, siehst du, wie groß sie sind, ich glaube, das sind die Asiatischen.«
Ich sehe ihnen an, dass es keine Asiatischen sein können, mein Vater hat mir alle Arten erklärt. Doña stemmt ihre Hände in die Hüften: »Weißt du, warum die mara mara heißt, warum sie sich nach Ameisen benannt haben? Hat er dir das erzählt?« Ich sage nichts, sehe den Ameisen weiter bei der Arbeit zu, es ist das Einzige hier, das ist wie bei uns.
»Es gab einen Film, als die alle kamen, aus Amerika, wann war das?«, mein Ton pfeift ein wenig. »Vor, ich denke, vielleicht zehn Jahren, als die alle aus Amerika kamen mit ihren Tätowierungen, da gab es einen Film, das war, ja!«, sie findet irgendein Puzzleteil ihrer Story, erzählt ruhig weiter, »das war kurz nach dem Krieg, also, da gab es endlich wieder Kino, und dann war da dieser Film über diese Riesenameisen, die alles auffressen, Menschen, Häuser, alles, Angriff der Ameisen. Alle sind reingegangen, mija, es war wie ein Fest, es gab wieder was im Kino! Und dann hat ein Polizist, als die alle zurückgekommen sind aus Amerika mit ihren Knarren und Tätowierungen und dem Tod in ihren Augen, weißt du, wie so was aussieht«, sie dreht sich kurz zu mir, »der Polizist hat sie dann irgendwann marabuntas genannt, und wir wussten alle, was er damit meinte, es hatten ja alle den Film gesehen, und seitdem nennen wir sie mara, und sie nennen sich selber auch so.« Sie hält sich einen Finger vor den Mund, mit aufgerissenen Augen. Dann zuckt sie mit den Schultern und schüttelt das Thema ein bisschen zu abrupt ab. »Komm, wir müssen die cena vorbereiten, jetzt habe ich wieder so viel gequatscht.« Ich folge ihr durch den schmalen Gang.
Ich kannte meine Antwort schon seit Wochen. Ich wusste, dass es keine Möglichkeit für mich gab, dort zu bleiben. Ich stand nachts auf, schaltete das Licht nicht an, ging runter ins Wohnzimmer, sah die Couch, auf der er lag und schnarchte, die Pflanzen, mit denen er immer sprach, die Küche, die er gebaut hatte, die glatt gewordene Stelle auf dem Tisch, auf der die Fernbedienung immer liegen musste. Ich zog meine Gummistiefel an, ging in den Garten, durchquerte seine Beete, trat auf die kleinen Pflanzen, deren Namen nur er kannte, ich wusste nichts darüber und wollte es auch nicht wissen. Eine Wut stieg in mir auf, er hatte mir ständig von den Pflanzen erzählt, während ich meistens nur genickt und dabei an anderes gedacht hatte. Sie sahen ruhig aus. Ich wusste nicht, wann welche zu wässern war, wofür sie gut waren, aus welchen ihrer Stämme sich welche Heilmittel machen ließen und in welcher Sprache sie wie hießen. Sein Garten würde mit ihm irgendwohin gehen. Ich setzte mich mitten ins Beet, es war nass, ich schloss die Augen. Mein Vater zog sich jeden nassen Morgen die Gummistiefel an, nur im Sommer ging er barfuß, während der Kaffee dampfte, »der Schöpfung guten Morgen sagen«, durch diese Beete und pflückte dabei, wenn ich erkältet, nervös, übermüdet oder sonst irgendetwas war, immer die richtigen Blätter oder Wurzeln. Er berührte ihre Blätter, musterte sie, nahm sie ernst. »Wir pflücken nach ihrem Bedarf, mija, wie sie es wollen, nicht wie wir es wollen.« Ich hatte darüber gelacht, jetzt saß ich hier, und sie fühlten sich anders an, als sie aussahen bei Tag, die meisten Blätter hatten einen kleinen Widerstand in sich. Ich fuhr eine Pflanze an ihrem dünnen Stamm ab, es brannte, gab mir einen Ruck, ich stand auf, nahm meine andere Hand, packte die Pflanze so tief am Stamm, wie ich konnte, ihre Härchen gruben sich in meine Finger, in meine Hände. »Nur die Hände hast du von deiner Mutter.« Mein Ton wurde laut, erhöhte seine Frequenz, es schmerzte überall, mein Pyjama war jetzt nass, ich zog mit aller Kraft an der Pflanze, es brannte, sie wehrte sich, war widerspenstiger, als ich es ihr zugetraut hätte. »Von ihnen kannst du viel lernen, mija.« Ich zog, sie gab nicht nach, ich bückte mich, klammerte, meine Hände brannten, fingen an zu graben, um die Pflanze herum, wurden schneller, erreichten ihre Wurzeln, zogen jede Ader einzeln aus ihrer Bodenhaftung, zupften sie heraus, eine nach der anderen, das Gestrüpp nickte mit meinen Bewegungen mit, spendete mir Beifall, dann stellte ich mich auf, zogen wieder am schwach gewordenen Stamm, lehnte mich gegen ihn, die Pflanze verabschiedete sich zäh aus ihrer Erde und gab mit einem Ruck auf. Ich konnte mich gerade noch fangen. Ich hielt sie in der Hand, fasste noch einmal fest um ihren Stängel, ihre brennenden Haare gruben sich tiefer in meine Haut, »zum Beispiel, mija, was echte Eigenwehr ist«, ich warf sie irgendwohin, mein Ton wurde wilder. Ich legte meine Hände auf die feuchte Erde, tastete sie ab, erfasste noch eine Pflanze, sie hatte keine Härchen, ließ sich mit einer Hand ausreißen, die neben ihr auch, die nächste hatte Stacheln, ich grub meine Hand in sie ein, riss sie heraus. Mit jeder Pflanze wurde mein Ton rasender, ich hieß ihn willkommen, riss alles aus, was ich fassen konnte, zog an ihnen, brach sie ab, grub um ihre Wurzeln herum, bis die Erde unter meinen Fingernägeln zu schmerzen anfing. Als ich alle Pflanzen getötet hatte, keuchte ich, meine Lunge brannte, überall sonst war ich taub, an den Händen, an den Ohren, selbst meine Augen sahen nichts mehr richtig. Ich richtete mich auf, sah in der Terrassentür meinen Vater eingesackt in seinem Pyjama stehen, ich wischte mir die Hände an meiner Hose ab, lief über den Rasen, an ihm vorbei, er wirkte sehr klein jetzt, ich gab ihm einen Kuss auf die Wange, er nickte, hatte Tränen in den Augen. Er sah meine Hände, ließ den Kopf sinken, am liebsten hätte ich auch ihn ausgerissen, ich lief an ihm vorbei, ließ ihn stehen, wollte, dass er litt, ich wusste nicht warum, meine Wut fing allmählich an, in meinen Händen zu stechen, die Taubheit wich dem Schmerz, das Blut pulsierte in meine Handflächen, ich drückte auf den Wunden herum, bis ich einen Laut von mir gab. Ich ging ins Bad, schlug mit den brennenden Fäusten gegen meine Beine, ich spürte nichts, ich suchte etwas, das ich schlagen konnte, ich holte aus gegen die Wand, entschied mich um, nahm die Tür und schlug heftig in sie hinein, bis ich ruhig wurde. Wir fuhren beide im Pyjama in die Notaufnahme und sagten nichts. Danach trug ich sechs Wochen lang einen Gips.