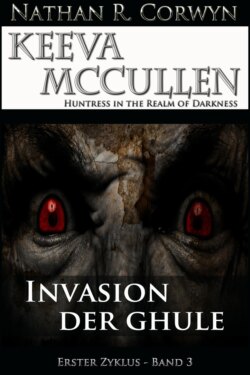Читать книгу Keeva McCullen 3 - Invasion der Ghule - Nathan R. Corwyn - Страница 4
Prolog
Оглавление10. Februar
Edward Skeffington, Inspektor bei New Scotland Yard, blickte düster in den Raum. Hier, in einem unbewohnten Haus nahe des Londoner Zentrums, war vor etwas mehr als einer Woche ein Dämon, eine Sukkubus, in diese Welt gerufen worden - und eine grausige Mordserie hatte ihren Anfang genommen.
Edward musterte den Fußboden. Fünf dicke, nur noch wenige Zentimeter hohe Kerzenstummel standen dort, alle jeweils inmitten einer großen Pfütze aus erkaltetem, schwarzem Wachs.
Der frisch beschworenen Sukkubus und dem von ihr auserwählten Gehilfen – einziger Überlebender der anfänglich drei Beschwörer – war es beim Verlassen des Hauses herzlich egal gewesen, ob hinter ihnen die Kerzen noch glimmten oder nicht. Und so waren diese nahezu komplett heruntergebrannt, ehe sie glücklicherweise von selbst erloschen sind - und nicht auch noch ein Hausbrand ausgelöst haben. In diesem dicht bebauten Viertel hätte das sonst mit einer Katastrophe enden können.
Mehrere große, geheimnisvoll wirkende und mit Kreide gezeichnete Symbole waren auf dem Boden zu sehen, teilweise von den erstarrten Wachspfützen überdeckt.
Edward hatte das Buch sicherstellen können, aus dem diese Symbole stammten. Es war sehr alt und enthielt noch einige weitere Anleitungen für dämonische Rituale. Nach Aussage des einzigen Überlebenden stammte es von dem jungen Mann, der ursprünglich die Idee zu dieser Beschwörung gehabt hatte.
Ein anderer Kreideumriss auf dem Boden, weniger geheimnisvoll als diese Symbole, aber aufgrund seiner Eindeutigkeit umso erschreckender, wies auf das Schicksal dieses unvorsichtigen jungen Mannes hin. Er und einer der beiden Freunde, die er zu diesem Ritual überredet hatte, waren die ersten Opfer der Sukkubus geworden.
Ihre Leichen waren längst abtransportiert. Die riesigen Blutflecken, die rings um die Umrisse ihrer Körper den Boden verunzierten, riefen Edward jedoch erneut jenes grausige Bild ins Gedächtnis zurück, das sich ihm dargeboten hatte, als er kurz nach dem Tod der Sukkubus in dieses Zimmer getreten war.
Ihm schauderte bei der Erinnerung. Er zog die Schultern hoch, steckte die Hände in die Manteltaschen, drehte sich um und ging in Richtung Treppenhaus. Unten waren Schritte und menschliche Stimmen zu vernehmen. Endlich, dachte Edward und sah auf die Uhr. Eine halbe Stunde zu spät. Nun gut, bei dem Londoner Stadtverkehr war das noch völlig im Rahmen des Üblichen.
Einige Sekunden später kam ein bulliger Mann Mitte Vierzig die Treppen hinauf und grüßte Edward mit einem Kopfnicken. Es handelte sich um Herbert Bliss, dem Chef einer Firma, die sich auf das Reinigen von Tatorten und Leichenfundorten spezialisiert hatte. Die beiden Männer kannten einander schon lange.
„Hi Edward“, sagte Herbert Bliss.
Er trug einen weißen Einweg-Overall und hatte sich bereits einen Mundschutz um den Hals gehängt.
„Hi Herbert“, erwiderte Edward. „Das hier ist das Zimmer.“
Herbert stellte sich neben ihn und pfiff leise durch die Zähne.
„Sieht ja aus wie in einem Horrorfilm“, meinte er.
Edward, der versuchte, dämonische Aktivitäten so weit wie nur möglich vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, erwiderte nur: „Ein Dummejungenstreich, der aus dem Ruder gelaufen ist.“
Er wusste, dass Herbert schon von Berufs wegen hundertprozentig vertrauenswürdig war - und auch nicht allzu neugierig. Trotzdem fügte er hinzu: „Es waren eine Menge Drogen im Spiel.“
Der bullige Reinigungsfachmann nickte.
„Was zu einer Menge Blut geführt hat, wie es scheint“, meinte er dann lakonisch und deutete auf die Flecken neben den Leichenumrissen.
„Ja“, bestätigte Edward. „Aber keine ansteckenden Krankheiten bei den Opfern, sagt die Gerichtsmedizin.“
Herbert zuckte mit den Schultern.
„Egal, ich fahre trotzdem das ganze Programm“, erwiderte er, wandte sich um und ging zum Treppengeländer.
„Jack, Vollkörper-Schutzausrüstung und Desinfektionslösung, wir haben massenweise Blut hier oben“, brüllte er hinunter ins Erdgeschoss.
„In Ordnung, Boss“, schallte es zurück.
Herbert wandte sich wieder dem Inspektor zu.
„Sollen wir noch auf irgendetwas achten?“, fragte er.
Edward Skeffington schüttelte den Kopf.
„Nein, der Tatort ist komplett freigegeben. Nur aufräumen“, sagte er.
Er trat ein paar Schritte zur Seite und sah anschließend den beiden Männern der Spezialreinigungsfirma dabei zu, wie sie die für ihre Arbeit notwendigen Gerätschaften in das Zimmer trugen. Ein makabrer Job, dachte er bei sich. Ständig hinter den Taten von Verbrechern aufzuräumen.
Doch dann musste er unwillkürlich lächeln, denn ihm war bewusst geworden, dass er als Inspektor bei New Scotland Yard im Grunde ja auch nichts anderes tat. Auch wenn er für seine Tätigkeit keine Eiweißlöser, Kaltnebeldesinfektionsgeräte oder Ozongeneratoren benötigte...
Er überließ die beiden Männer ihrer Arbeit und ging zur Treppe. Fast schon automatisch stieg er die Stufen in die oberen Stockwerke hinauf, um das Haus noch ein weiteres Mal zu durchsuchen. Sie hatten das in den vergangenen Wochen schon so oft getan – und waren nie auf irgendwelche Anzeichen für das Vorhandensein eines Tores aus dem Dämonenreich gestoßen.
Liam McCullen, ein ehemals berühmter Dämonenjäger und seit vielen Jahren ein guter Freund von Edward Skeffington, hatte sich deswegen Sorgen gemacht. Edward jedoch hoffte, dass diese unbegründet waren. Sicher, in den letzten Wochen hatte es schon zweimal Dämonenalarm gegeben – aber deshalb musste man ja nicht gleich Rückschlüsse auf ein mögliches neues Portal aus der Hölle ziehen.
Die Räume des Hauses waren verstaubt, überall lagen kaputte Möbel und Schutthaufen herum und einmal sah Edward sogar eine Ratte davon huschen - aber nichts von alledem war auf irgendeine Weise ungewöhnlich.
Schließlich gelangte er zum Dachgeschoss und betrat den letzten großen Raum. Trübes Februarlicht fiel durch die kaputten Ziegel und beleuchtete die hintere Wand, an der einige Möchtegern-Graffiti-Künstler ihre Signaturen verewigt hatten. Mit einem Mal war Edwards Aufmerksamkeit jedoch geweckt. Er kniff die Augen zusammen und starrte auf die grob aufgesprühten Linien der bunten Buchstaben. War da nicht eine gewisse Unschärfe?
Langsam trat er näher...
*
„Wie geht es dem Tor?“, fragte der Meister.
Liekk-Baoth, Metamorph und oberster Berater des Erzdämons, las die altmodisch anmutende Skala des Gerätes ab, das er in seinen klauenartigen Fingern hielt.
Er verzog sein von Falten durchzogenes Gesicht.
„Noch immer recht schwach“, meinte er schließlich. „Auch wenn seine Kraft stetig zunimmt.“
Der Erzdämon schnaubte gereizt.
„Wenigstens nimmt sie zu. Das Versagen dieses unfähigen Höllenhundes hat den Zeitablauf meiner gesamten Planung durcheinandergebracht.“
Liekk-Baoth sah seinen Meister neugierig an.
„Darf ich fragen, von welcher Planung Ihr sprecht?“, sagte er und bemühte sich um einen unterwürfigen Ton. Die Laune des Erzdämons war heute nicht die beste.
„Fragen darfst du schon – aber antworten werde ich nicht“, entgegnete dieser prompt.
Der Gestaltwandler zuckte innerlich mit den Schultern. Einen Versuch war es wert, dachte er, und wandte sich wieder dem Portal zu.
Die bläulich schimmernde, ovale Scheibe schwebte senkrecht über einem flachen Steinpodest in der kleinen Höhle. Ihr unterster Rand berührte den sandigen Boden nicht. Liekk-Baoth änderte die Einstellung seines Gerätes und hielt es nahe an das Tor. Dann las er das Ergebnis ab und nickte zufrieden.
„Der Überdeckungszauber hat noch immer die volle Stärke.“
Der Erzdämon sah ihn misstrauisch an.
„Auf der anderen Seite kann man das Portal also nicht sehen?“, fragte er.
„So gut wie nicht“, korrigierte Liekk-Baoth vorsichtig. Eigentlich sollte sein Meister das wissen. Aber er wirkte schon den ganzen Tag so, als suchte er nur nach einem Blitzableiter für seine schlechte Laune. Der alte Gestaltwandler machte sich innerlich darauf gefasst, dass wohl er derjenige war, der die volle Ladung abbekommen würde.
„Auf der anderen Seite nimmt man lediglich eine gewisse Unschärfe der Struktur hinter dem Portal wahr“, erklärte er. „In einem kaum bevölkerten Gebiet käme das einer Unsichtbarkeit gleich. Aber mitten in einer Großstadt wie London gibt es natürlich immer ein gewisses Restrisiko...“
„Es muss aber London sein!“, donnerte der Erzdämon, dem die unterschwellige Kritik in den Worten seines Beraters nicht entgangen war. „Du wirst schon noch früh genug erfahren, warum das so ist. Schließlich bist du ein Teil meiner Pläne!“
Liekk-Baoth wollte gerade ein weiteres Mal nachhaken, welche Pläne sein Meister denn nun mit diesem Tor hätte und was für eine Rolle er dabei spielen sollte – als er eine Resonanz wahrnahm.
Er hob die Hand, um den Erzdämon um Ruhe zu bitten, streckte den Hals vor und brachte sein Ohr so nahe wie möglich an das Portal.
„Da ist jemand auf der anderen Seite“, flüsterte er erschrocken.
Der Erzdämon war mit wenigen Schritten neben ihm.
„Er darf das Tor auf keinen Fall enttarnen!“, zischte er wütend. „Ist es ein Dämonenjäger?“
Liekk-Baoth konzentrierte sich.
„Nein“, sagte er schließlich zögernd. „Ich spüre kein entsprechendes Echo. Wer auch immer da gerade um das Tor schleicht, er hat auf jeden Fall nicht das Ritual der Dämonenjäger durchgeführt.“
Dieses Ritual, das die Ausbildung eines jeden Dämonenjägers – üblicherweise zu dessen achtzehntem Geburtstag – abschloss, bewirkte, dass der Jäger in der Lage war, Dämonen ohne weitere Hilfsmittel aufzuspüren. Allerdings wurde er dadurch für höhere Dämonen ebenfalls erkennbar – doch Liekk-Baoth konnte in diesem Moment keine Schwingungen fühlen, die darauf hindeuten würden.
Es gab natürlich immer noch die Möglichkeit, dass der Jäger ein starkes Schutzamulett trug und sich überdies noch mit diversen Zaubern abgeschirmt hatte – aber das sagte er seinem Meister nicht. Dann könnte man ja gleich eine scharfe Handgranate in einen Vulkan werfen, der kurz vor einem Ausbruch stand.
Stattdessen brachte er sich lieber in eine sichere Position vor dem Tor und konzentrierte sich auf die geistigen Vibrationen, die er von der anderen Seite her wahrnahm.
„Was machst du denn jetzt schon wieder?“, grollte sein Meister.
„Wenn dieser neugierige Mensch dem Tor zu nahe kommt“, entgegnete Liekk-Baoth mit einem grausamen Lächeln. „Dann schicke ich einen tödlichen Energiestoß hindurch – und man wird nur noch einen Haufen Asche von ihm finden...“
*
Edward blinzelte erneut. Es gelang ihm einfach nicht, die aufgesprühten Schriftzüge an der Wand scharf zu erkennen.
„Verdammt“, murmelte er. Schon seit einer Weile befürchtete er, demnächst eine Brille zu benötigen.
Er ging noch einen Schritt näher in Richtung Wand.
Er dachte daran zurück, wie er bei seiner letzten Augenkontrolle vor ein paar Monaten die immer kleiner werdende Buchstabenreihen hatte vorlesen müssen. Damals konnte er lediglich die untersten Zeilen nicht mehr fehlerfrei erkennen und hatte sich einreden können, dass alles noch im grünen Bereich sei – doch jetzt waren bereits die Konturen der einige dutzend Zentimeter großen Zeichen vor ihm unscharf, auch wenn er die Buchstaben selbst natürlich noch entziffern konnte.
Das beunruhigte ihn, denn in letzter Zeit hatte er sich immer häufiger dabei ertappt, wie er Kleingedrucktes möglichst weit von sich entfernt hielt. Die vorher unscharfen kleinen Buchstaben wurden dadurch etwas schärfer – wegen der zusätzlichen Entfernung jedoch natürlich auch noch kleiner, sodass er sie erst recht nicht mehr lesen konnte.
Er seufzte.
Bisher hatte er einen erneuten Besuch beim Augenarzt ständig vor sich hergeschoben. Er ging langsam aber sicher auf die Fünfzig zu und hatte sich immer eingebildet, für sein Alter ziemlich gut in Form zu sein.
Seine zwei Jahre jüngere Ehefrau wiederum benutzte schon länger eine Lesebrille, wirkte sonst jedoch noch sehr jugendlich - von daher wäre es wohl kein Zeichen von Schwäche, wenn er sich auch bald eine anschaffen würde. Allerdings bemerkte Edward gerade einen eitlen Wesenszug an sich: wenn er zugeben müsste, dass er ebenfalls – altersbedingt – eine Sehhilfe benötigte, dann käme es dem Eingeständnis gleich, dass er … nun ja, dass er eben alt wurde. Und er hätte nie geglaubt, dass ihm das einmal so schwer fallen würde.
Vielleicht ist hier oben ja auch nur die ungenügende Beleuchtung schuld, dachte er hoffnungsvoll.
Um herauszufinden, in welcher Nähe die Konturen letztendlich scharf sein würden, ging er noch einige Schritte in Richtung Wand – doch die Buchstaben blieben verschwommen.
Das kann doch nicht sein, schoss es ihm durch den Kopf. Er stand jetzt vielleicht zwei Meter von der Wand entfernt. Waren seine Augen denn wirklich schon so schlecht? Jetzt wollte er es aber genau wissen! Energisch schritt er weiter auf die Mauer zu und hatte sie bereits fast erreicht - als von unten eine laute Stimme zu vernehmen war: „He, Edward!“
Das unverwechselbare Organ von Herbert Bliss dröhnte durch das Haus.
„Bist du da oben irgendwo?“
Edward blieb stehen, drehte sich um und ging zurück ins Treppenhaus.
„Ich komme gleich zu dir“, rief er und warf noch einen letzten, wehmütigen Blick auf das verschwommene Graffiti-Geschmiere. Er würde gleich nächste Woche einen Termin beim Augenarzt vereinbaren. Es wurde wohl langsam Zeit, sich damit abzufinden, dass er einfach keine Zwanzig mehr war. Auch wenn das natürlich nur seine Sehkraft betraf, ansonsten war er unverändert fit.
Betont schwungvoll eilte er die Treppen zu dem Reinigungsfachmann herunter, der ihn im ersten Stock erwartete.
„Was ist los?“, fragte er, als er unten ankam. Er ignorierte das heftige Klopfen seines Herzens.
Herbert deutete auf ein Handy.
„Habe gerade den Anruf von meinem zweiten Trupp bekommen. Sie wären jetzt soweit und könnten zu dem anderen Tatort kommen, von dem du gesprochen hast. Wir brauchen nur die Adresse und die Schlüssel.“
Edward nickte. Gemeint war das Versteck der Sukkubus. Im Gegensatz zu dem gut gekühlten Haus hier war jene Wohnung allerdings beheizt gewesen – und das dort vergossene Blut und die abgerissenen Hautfetzen der Opfer waren in einen deutlich fortgeschritteneren Zustand der Verwesung übergegangen.
Er nannte Herbert die Adresse.
„Ich komme auch gleich dorthin, ich habe die Schlüssel bei mir“, sagte er dann. „Aber deine Jungs sollten sich auf einen ziemlich üblen Gestank einstellen.“
Herbert grinste schief.
„Na, dann kann ich ja nur froh sein, dass ich mir bei der Auftragsverteilung heute morgen diese Baustelle hier zugeteilt habe“, meinte er fröhlich – und machte sich sogleich daran, seinen Mitarbeitern per Handy die notwendigen Informationen zu übermitteln.
*
Liekk-Baoth zog sich vom Portal zurück. Er wirkte erleichtert, aber auch ein klein wenig enttäuscht.
„Er ist weg“, meinte er, zu seinem Meister gewandt.
Dieser schnaubte nur und begann mit seiner Wanderung durch die Höhle, die mächtigen Pranken auf dem Rücken verschränkt – wie üblich, wenn er über irgendein Problem nachdachte.
„Das war mir zu knapp“, meinte er düster.
Liekk-Baoth musste ihm recht geben.
Doch er konnte nicht mehr tun, als seinem Herrn immer wieder zu erklären, dass ein Dämonenportal – und sei es noch so gut getarnt – in einer belebten Großstadt nun einmal eher in Gefahr geriet, entdeckt zu werden, als irgendwo in einem finsteren, womöglich sowieso schon verrufenen und daher gemiedenen Wald.
Er würde ja zu gerne wissen, warum der Erzdämon dieses Risiko trotzdem eingegangen war – aber er musste sich wohl weiterhin in Geduld üben, ehe er diesbezüglich eine Antwort bekam.
„Wir müssen ein Ablenkungsmanöver starten“, überlegte sein Meister gerade laut. Er verstummte, wanderte einige weitere Male hin und her – und blieb schließlich mit entschlossenem Gesichtsausdruck stehen.
„Schicke ein paar Ghule durch“, befahl er. „Aber warte damit, bis es drüben Nacht ist.“
Liekk-Baoth konnte nicht anders, er musste seinem Meister einmal mehr Hochachtung zollen: Ghule waren einfach perfekt für ein derartiges Täuschungsmanöver!
Diese niedrigen Dämonen vermehrten sich wie eine Seuche, sie waren anspruchslos, vollkommen frei von Intelligenz – konnten also auch niemanden verraten – und was das Wichtigste war: sie würden sich sofort vom Portal entfernen, auf irgendeinem hoffentlich recht weit entfernten Friedhof einnisten und dort nach einiger Zeit ganz bestimmt Aufmerksamkeit erregen – und so, wie erwünscht, vom wirklichen Standort des Tores ablenken.
„Meister, Ihr seid genial“, schleimte der Formwandler und verneigte sich tief.
Der Erzdämon grunzte geschmeichelt, kehrte seinem Berater den Rücken zu und verließ das Gewölbe.
*
Poppy Rowle schrak aus dem Schlaf hoch. Irgendetwas hatte sie geweckt!
Sie dachte sofort an das furchteinflößende Gebrüll zurück, das vor einigen Wochen aus dem Haus gegenüber geklungen war und für ziemliche Aufregung gesorgt hatte. Sie selbst hatte es leider nicht mitbekommen, aber die Nachbarn hatten ihr davon erzählt und die Polizei hatte das Gebäude wochenlang abgesperrt.
Und damit nicht genug: kaum war die Sperre aufgehoben worden, hatten irgendwelche zugedröhnten Jugendliche in demselben Haus satanischen Rituale durchgeführt und sich dabei selbst umgebracht. So jedenfalls hatte der Klatsch in der Nachbarschaft die erneute Anwesenheit von einem Leichenwagen und der Polizei erklärt. Und meistens war an solchen Gerüchten doch immer auch etwas Wahres dran, oder nicht?
Sie lauschte erregt. Möglicherweise passierte dort drüben ja erneut etwas Unheimliches. Und diesmal würde sie es als eine der ersten mitkriegen - und hätte dann endlich einmal selbst etwas zu erzählen. Doch alles blieb still. So still es in diesem heruntergekommenen Viertel jedenfalls sein konnte. Seit Ken sie verlassen hatte, musste sie mit wenig Geld über die Runden kommen – und da konnte sie sich leider keine Wohnung in einer besseren Gegend leisten, so sehr sie sich das auch gewünscht hätte.
Ein blauer Lichtblitz zuckte über die verdreckte Scheibe ihres Schlafzimmerfensters. War sie dadurch vorhin aus dem Schlaf gerissen worden? Zwei weitere Blitze folgten, stumm, aber trotzdem - oder vielleicht auch gerade deswegen - ganz schön unheimlich. Wie die Übertragung eines Feuerwerks im Fernsehen, nur ohne Ton.
Sie starrte eine Weile in Richtung des Fensters, doch das schien es schon gewesen zu sein - es folgten keine weiteren Lichterscheinungen mehr.
Wer weiß, was das war, überlegte sie. Bestimmt nur irgendwelche Jugendliche mit ihren neumodischen elektronischen Spielereien. Oder ein Gewitter, das sich ankündigte. Allem Anschein nach jedoch nichts Geheimnisvolles, glaubte sie, etwas enttäuscht.
Mühsam drehte sie sich auf die andere Seite und sah auf die Uhr. Es war drei Uhr morgens. Sie stöhnte. In nur drei Stunden würde der Wecker klingeln und sie musste sich für die Arbeit fertig machen. Sie sollte also schleunigst wieder einschlafen, wenn sie morgen nicht den ganzen Tag von Kopfschmerzen geplagt sein wollte.
Poppy zog die Bettdecke über die Schultern und schloss die Augen, merkte aber recht schnell, dass das keinen Sinn haben würde. Sie schwitzte und war durstig, so würde sie niemals einschlafen können.
Seufzend schob sie die Decke wieder herunter und setzte sich auf. Seit sie so stark zugenommen hatte, war das jedes Mal eine Herausforderung für sie. Auch jetzt verhedderte sie sich in der dünnen Bettdecke, ihr schweißnasses Nachthemd klebte unangenehm fest auf ihrer weit ausladenden Brust und schnürte ihr den Hals zu. Als sie es endlich geschafft hatte, sich aufzurichten, blieb sie erst einmal für eine ganze Weile auf dem Rand des Bettes sitzen und wartete, bis sich ihr Atem wieder etwas beruhigt hatte.
Unglücklich betrachtete sie die wulstigen Oberschenkel, die sich unter dem dünnen Stoff ihres Nachthemdes abzeichneten. Sie hatte sich zwar zu Silvester vorgenommen, diesmal eine Diät auch bis zum Ende durchzuhalten – wie schon so oft -, hatte aber in den vergangenen zwei Monaten genügend Ausreden gefunden, warum sie gerade jetzt nicht damit anfangen konnte - und auch das war nichts Neues.
Doch inzwischen war endgültig die Obergrenze erreicht: die elektronische Waage in ihrem Bad konnte Poppys Körpergewicht nicht mehr ermitteln, sondern zeigte in ihrem Display nur noch ein hektisch blinkendes Error. Sie ekelte sich vor sich selbst. Kein Wunder, dass Ken die Schnauze voll gehabt hat, dachte sie nicht zum ersten Mal.
Langsam hatten sich Atem und Puls wieder normalisiert und sie schob sich mühsam in die Höhe. Ihr enormes Übergewicht war nicht mehr nur ein rein ästhetisches Problem, sondern bereitete ihr schon seit Längerem auch massive gesundheitliche Schwierigkeiten. Doch was sollte sie machen? Sie liebte nun einmal Torten und Schokolade – seit Ken weg war umso mehr.
Und, wenn man ehrlich war, es war auch nicht ganz fair: so manch anderer konnte genauso viel Süßkram in sich hineinstopfen und nahm dabei kein Gramm zu; sie wiederum brauchte ein Stück Kuchen nur anzusehen und wog zwei Kilo mehr...
Ächzend bewegte Poppy sich in Richtung Küche, blieb schwer atmend vor dem Kühlschrank stehen, öffnete ihn und suchte nach einem Getränk. Die zwei Flaschen Mineralwasser, die schon seit Monaten im unteren Fach lagen, ließ sie auch diesmal unberührt. Jetzt brauchte sie etwas mit mehr Geschmack! Sie griff zu einer der Tüten mit gezuckertem Eistee, goss sich ein Glas ein und trank es gleich in großen Zügen leer. Dann schenkte sie nach, stellte die Tüte zurück in den Kühlschrank und watschelte zum Küchenfenster.
Gedankenverloren blickte sie nach draußen, während sie das zweite Glas mit dem herrlich süßen Eistee in kleinen Schlucken genoss. Was für eine miese Gegend, dachte sie. Neugierig beugte sie sich ein wenig nach vorn, um die gesamte Straße überblicken zu können. Vielleicht waren die Jugendlichen, die vorher dieses unheimliche Leuchten verursacht hatten, ja noch da. Sie konnte jedoch niemanden sehen und wollte sich gerade umdrehen und das mittlerweile leere Glas abstellen, als sie stutzte. Da war doch eine Gestalt zu sehen! Nein, nicht nur eine, gleich mehrere!
Sofort presste sie ihr Gesicht an die Fensterscheibe, konnte aber dennoch nicht genau erkennen, was sich da gegenüber in der Hofeinfahrt zu dem verlassenen Haus herumtrieb. Es sah irgendwie aus wie... ja, wie große Hunde. Ein ganzes Rudel!
Poppy schrak unwillkürlich ein Stück vom Fenster zurück und erschauderte. Jetzt liefen in diesem Viertel schon Raubtiere frei herum!
Schlimm genug, dass viele der Hundebesitzer in der Straße sich nicht die Mühe machten, die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge vom Gehweg zu entfernen – jetzt durften die Viecher auch schon nachts hier unbeaufsichtigt herumstreunen. Es wurde wirklich Zeit, dass sie sich eine andere Wohnung suchte!
Ihr Blick fiel auf die Küchenuhr: halb vier Uhr morgens. Sie musste endlich zurück ins Bett, wenn sie noch ein klein wenig Schlaf bekommen wollte. Seufzend drehte sie dem Fenster den Rücken zu, stellte das Glas in das Waschbecken und ging mit schwerfälligen, kleinen Schritten zurück in ihr Schlafzimmer.
Es entging ihr, wie sich aus dem Dunkel gegenüber sechs hundeartige Gestalten lösten und mit weit ausholenden Sprüngen lautlos in der Nacht verschwanden...