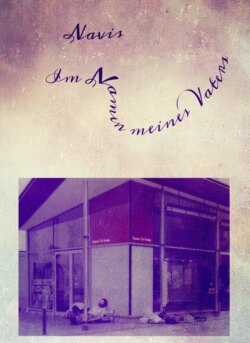Читать книгу Im Namen meines Vaters - Navis - Страница 5
ОглавлениеVater, Staat
Vater, Staat
Die ganze Zeit habe ich mich dagegen gewehrt, ich wollte nicht so werden wie meine Nachbarn, meine Bekannten, mein Vater. Ich habe versucht etwas Besonderes zu sein, jemand, der seinen eigenen Weg geht. Ich wollte herausragen, etwas Neues darstellen, ich wollte rebellieren, gegen die Obrigkeit, meinen Vater, seine ganze spießige Welt. Niemals wollte ich ohne Ideale leben, nie mein Leben vom Alltag bestimmen lassen, ich wollte entscheiden. Ich wollte ein Jemand sein und nicht ein Niemand im System. Eine Zahl, eine Nummer. Mein Name sollte etwas bedeuten, mit ihm sollte man ein Gesicht verbinden. Sei es auch ein berüchtigtes Gesicht, so doch wenigstens eins. Ich wollte niemals ein gewöhnlicher Fisch im Schwarm sein, der bloß um seine Existenz zu sichern, mit anderen Fischen schwimmt. Ich wollte leben, sei es auch als ein vereinsamter Wal, der letztlich irgendwo strandet. Ich wollte so viel erreichen, viel mehr als mein Vater, als alle anderen Menschen zuvor und ich dachte, ich sei dazu in der Lage. Ich hatte Hoffnungen, nein, ich war zuversichtlich, dass ich anders bin, dass ich eine eigene Existenz habe, ein eigenes Ich, dass ich fern ab von allen, von meinem Vater lebe und denke.
Nichts davon. Irgendwann musste ich erfahren, dass selbst mein langweiliger Vater ähnliche Wünsche hatte, einst als er jung war. Irgendwann musste ich feststellen, dass auch mein spießbürgerlicher Vater einer dieser gescheiterten Revoluzzer ist. Er wollte die Welt verändern, ist mit anderen Studenten auf die Straße gerannt, hat Flaschen auf Polizeiautos geworfen, Zäune aufgerissen. Er war für die freie Liebe und folgte irgendwelchen selbsternannten Gurus. Er war einer der Studenten, die alle Bücher auswendig lernten, um genug Argumente gegen das faschistische Vaterregime aufbringen zu können. Nur damit konnte er damals Eindruck schinden. Dann änderte sich eines Tages alles: Sein Studium holte ihn ein. Jura. Im Laufe seines Studiums lernte er, dass er mit seinen Argumenten weitaus größeren Eindruck auf die Professoren machte als auf die zugekifften Menschenmassen. Und vor allem, und das war wohl für ihn entscheidend, zog der Eindruck bei den Professoren Folgen nach sich. Positive Folgen. Seine Noten wurden immer besser. Das änderte alles. Plötzlich war er einer der Kommilitonen, die glaubten, aus der Materie etwas anderes machen zu können, als sie schon ist. Am Ende ist er zu dem systemtreuen Egoisten geworden, den er zuvor bekämpft hatte. Aus der freien Liebe wurde schließlich Ehe, aus Flaschen Stifte und aus Faltblättern das BGB. Dank der neuen Einstellung hat er sehr schnell einen Aufstieg erlebt, hat sehr schnell Geld verdient. Folglich raubte ihm diese Materie jedweden revolutionären Gedanken aus der Seele. Er wurde Vater von drei Kindern, wobei das dritte ein Unfall war. Ich bin dieser Dritte. Und genau hier fangen wir an, uns zu unterscheiden. Meine Revolte wurde mir in die Wiege gelegt, während seine ein Massenphänomen war. Als Einzelkind trat er auf, ich war der dritte von drei Söhnen. Der, mit dem niemand gerechnet hatte und mit dem niemand rechnen wollte. Das ist nicht unser einziger Unterschied.
Meine Brüder waren bereits Jungs als ich geboren wurde. Sie waren sich beide ziemlich ähnlich. Sie waren nicht nur Brüder, sondern auch beste Freunde. Ich besetzte von Anfang an die Rolle des Außenseiters, ich war der Störenfried, das fünfte Rad am Wagen, die Krücke in Händen eines gesunden Menschen. Das ließen sie mich bei jeder Gelegenheit spüren. Immer haben sie gezeigt, dass sie mit mir waren, nur weil die Eltern es so wollten, die Mutter. Aber das änderte sich, als sie in die Pubertät kamen. Von nun an waren sie mit Mädchen beschäftigt und mit ihren Pickeln. So konnte ich in Ruhe alleine spielen. Das ging so jahrelang. Ich habe auch nie wie sie Freunde, oder später ein Mädchen mit nach Hause genommen. Meine Eltern machten sich dann auch Sorgen, dass die Natur es mit mir anders gemeint hatte. Wobei es nicht schlimm gewesen wäre wenn, meinten sie.
Jungs haben mich generell nicht interessiert. Ich habe mich nie für das Wettbewerbsdenken begeistern können. Ich spielte wie alle anderen Kinder auch gern, (selbst Fußball), doch ich machte es nur so lange, bis es anfing von Schweiß zu triefen. Ich habe diesen Geruch gehasst. Die Mädchen hingegen dufteten zuckersüß. Mit den Mädchen kam ich besser zurecht. Ihre Präsenz war mir angenehmer. Ihr Duft, die langen Haare, der zauberhafte Blick, all das bewunderte ich. Bei dieser nackten Bewunderung blieb es zunächst auch. Als ein soziales Wrack konnte ich weder bei den Jungs, noch bei den Mädchen ankommen. Es blieb mir nur der Rückzug. In meinen vier Wänden, mit meinen Büchern, auf meinem Bett konnte ich meine kindliche Neugier stillen. Meine Fragen waren bei den Erwachsenen nicht willkommen. Einzig die Bücher beantworteten sie unermüdlich. Dafür war ich dankbar. Ich las wie verrückt. Selbst heute noch fühle ich mich bei den Büchern sehr wohl. Sie sind meine Zuflucht. Wenn irgendetwas aus den Fugen gerät, haben sie immer eine Antwort parat: das hat diesen Grund und diese Konsequenzen usw. Meistens behalten sie Recht.
Mein Vater hatte nie Zeit für mich. Er war so sehr mit seinem Beruf beschäftigt – auch wenn er zu Hause war. Immer wenn ich an ihn denke, sehe ich, wie er am Schreibtisch sitzt und irgendwelche Tabellen entwirft. Für mich waren es immer irgendwelche Linien und Kreise, die nichts anderes aussagen, als dass der Mensch alles für Geld tun würde. Und doch hatten wir mehr als genug davon. Meine Klassenkameraden beneideten mich immer, weil ich in einem Haus wohnte und mein eigenes Zimmer hatte. Sie mussten sich meistens mit einer Wohnung in irgendeinem Reihen- oder Hochhaus begnügen. Heute verstehe ich ihre Bewunderung. Sie war nichts weiter als der Wunsch in Frieden zu leben, ohne Geschrei im Treppenhaus und ohne Angst, der Aufzug könnte stecken bleiben.
Mein Vater hat zwei seiner Söhne so erziehen können, dass sie ihren Wohlstand bewahren und vermehren konnten. Er sorgte auch sehr früh dafür, dass sie die besten Erzieher, die besten Lehrer und nur die besten Professoren bekamen. Einer trat schließlich in seine Fußstapfen und wurde Anwalt. Der andere studierte immerhin Wirtschaftswissenschaften und wurde Manager. Für mich hingegen reichte eine einfache Gesamtschule aus. Sie befand sich nicht weit von unserem Haus und ich konnte ohne Begleitung hinlaufen - das war das entscheidende Kriterium bei meiner Schulsuche. Mein Schicksal war damit besiegelt, denn dort konnte ich auch nur derjenige sein, der in einem riesigen Haus wohnt und reich ist. Kinder können manchmal sehr grausam sein, aber die Eltern umso mehr. Nie habe ich ein aufmunterndes Wort gehört. Immer hieß es, ich solle mich zusammenreißen, weil das vergehen wird. Irgendwann werde man mich akzeptieren. Mein Vater winkte oft nur mit den Händen ab, wenn meine Mutter ihn darauf aufmerksam machte, dass ich in der Schule geschlagen werde. Von seiner Seite hieß es nur, ich solle mich wehren lernen, das gehöre eben zum Leben. Wer sich nicht wehren könne, wer nicht aktiv sei, habe in der Welt ohnehin nichts zu suchen und werde immer das Opfer sein. Niemand gönne einem das Glück, das man hat, je früher man das erfahre, umso gewappneter sei man für später.
Ausgeschlossen von allen verkroch ich mich in meine eigene Bücherwelt und lebte dort ein vielfältiges Leben, das selbst die alten Männer, die diese Bücher geschrieben haben, nicht durchlebten. Das gab mir Trost. Geschichten wurden meine Zuflucht, sie wurden zu meinem Raum, zu dem nur ich Zutritt hatte. Dort war ich etwas Besonderes und konnte fern ab von allen und jedem für mich sein. Bedingungslos. Dort lernte ich ein wunderbares Mittel kennen, das jedem Menschen die Ruhe ermöglicht, die er braucht: Vergessen. Als Opfer vergaß ich ein Opfer zu sein, ich vergaß, in einer prekären Lage zu sein, ich vergaß, dass man mit meinem Leben Ping-Pong spielt und mir meine eigene Denkweise nicht ermöglicht, meine eigene Entwicklung. Ich vergaß jeden Schlag, jeden Tritt, jedes böse Wort, jede Ignoranz seitens meiner Eltern, Lehrer, Brüder, Mitschüler. Ich wusste nur tief im Inneren, dass irgendetwas nicht stimmte. Solange mein Raum bestand, meine Zuflucht, war dieses innere Gefühl sehr sanft und hielt sich im Stillen auf. Für mich war es nur logisch, dass ich diesen Raum niemals aufgeben werde, nicht solange ich ihn brauche. Ich konnte nur bei den Büchern bleiben, bei meinen Geschichten, ich konnte nur die Gedanken der bereits toten Männer studieren. Als dann im Fernsehen die Bilder vom Mauerfall liefen, als die Menschenmassen die vielen Ziegelsteine herunterrissen und sich nach West-Berlin aufmachten, entschloss ich mich auch weg zu gehen. Sobald ich mein Abitur in der Tasche habe, werde ich weg sein. Endlich befreit. Ich werde auch meine Mauer überwinden, mein Regime stürzen, ihn entthronen. Ich hatte zum ersten Mal die Hoffnung, dass sich etwas ändern würde.
Mein Vater verzweifelte fast ein wenig, zumindest hoffte ich das, als er von meinem Vorhaben erfuhr. Er kam mit Schweißperlen auf der Stirn auf mich zu und erklärte mir recht hastig, dass Lesen als Hobby eine schöne Sache, aber doch kein Beruf sei. Wie will man davon leben, wie soll man eine Familie davon ernähren? Ich bin doch gescheit, ich könnte auch etwas Anständiges studieren. Er fuchtelte mit den Armen herum und verhaspelte sich beim Sprechen. Ich hingegen blieb still. Ich widmete ihm kein Wort. Jedes Wort wäre eine bloße Rechtfertigung. Das verdient er nicht. Eigentlich wollte ich ihm so viel sagen, ihn bloßstellen, dass er endlich erkennt, was er ist. Ich wollte ihm den Boden unter den Füßen wegreißen. Ihm sein nichtiges Dasein vor die Augen führen. Ihm sagen, dass ich bloß nicht so wie er sein möchte. Bloß kein Anwalt. Von diesen gibt es genug in Deutschland. Ihm sagen, dass er mich anwidert, dass ich lieber ungeboren wäre als ihn zum Vater zu haben. Ich sagte aber nichts. Ich schwieg lediglich. Ich bestrafte ihn mit bloßem Schweigen. Als er sich beruhigte, nichts mehr zu sagen hatte, weil ihm seine gespielte Aufregung selbst zu langweilig wurde, machte er sich davon und ließ mich in Ruhe. Meine Mutter meinte, es wäre vieles einfacher, wenn ich ein Mädchen gewesen wäre. Aber ein Junge, der Schriften studiert, das passe einfach nicht zu seinem Weltbild. Er sei eben vom alten Schlage (ein Vater sorge für seine Familie und von Geschichten könne man nicht wirklich leben, keine Familie gründen). Dafür sei ein anständiger Beruf notwendig, etwas, das Geld bringt, etwas, das die Welt braucht.
Damals haben mir diese Worte noch wehgetan, vor allem, wenn es aus ihrem Mund kam. Aber ich blieb dabei, ich zog aus, in eine WG in einer anderen Stadt, fing an Literatur und Philosophie zu studieren und lernte das Leben außerhalb meines Hauses kennen. Persönlich. Das Leben schmeckt anders als ein Buch. Mag es auch gutgeschrieben sein, es ist nie wie das wahre Leben. Wobei Heisenberg etwas anderes sagt – Unschärferelation: der Beobachter verändert das Beobachtete. In meiner Sprache gesprochen: der Lesende verändert das Erlebnis. Mein Vater würde sagen: der Bürger verändert den Staat. Ja, das ist mein Vater. Ich sehe ihn, wie er an seinem Schreibtisch sitzt und neue Konzepte entwickelt. Er erfindet nichts. Er sucht bloß, wie er sich den Gegebenheiten anpassen kann. Jedes Mal aufs Neue. Sein Leben ist von so vielen Faktoren umgeben, er aber kennt nur den einen: Arbeit. Ich kenne ihn nicht als Privatperson. Er ist viel zu öffentlich, so durchschaubar. Man braucht nur die Faktoren zu ändern und die Folgen sind gleich abzusehen. Er ist wie ein Mechanismus, bei dem nur ein Rädchen bewegt werden muss, damit ein ganzer Prozess in Gang gesetzt wird. Und er läuft immer noch, verdient Geld.
Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwann aus purer Freude losgelacht hat. Wenn er mal irgendwo herumlächelte, dann nur, weil er sich dem gesellschaftlichen Druck beugen musste, um anderen schöne Augen zu machen, um nicht aufzufallen. Er war kein Revoluzzer, weil er sein Elternhaus nicht mehr aushalten konnte, weil er für Ideale kämpfte, wie Freiheit, weil er sich als Individuum fühlte. Nein, mein Vater hat all das mitgemacht, weil er nicht anders sein wollte. Wurde ihm ein Stein in die Hand gedrückt, so hat er diesen geworfen. Sind die anderen nackt herumgelaufen, so zog er sich mit aus. Hätten sie Adolf statt Che Guevara gerufen, hätte das für ihn keinen Unterschied gemacht. Er war genau wie sein Vater. Wäre mein Vater in einem Krieg gewesen, hätte es ihn genauso wie seinen Vater an der Front erwischt. Nicht als einen, der dazu gezwungen wurde, sondern als denjenigen, der ganz vorne seine Brust hebt, um eine Kugel abzufangen. Wie kann man mit so einem Menschen Mitleid haben? Oder mit ihm fühlen, ihn lieben? Wie konnte meine Mutter ihn nur heiraten, sich zu ihm ins Bett legen, ihm Kinder gebären? Selbst heute, nach einer so langen Abwesenheit, kann ich das für mich nicht beantworten.
Besucht hat er mich auch nur, weil sie es so wollte. Geld schickte er mir auch nur, weil sie darauf bestand. Auch sein altes Pflichtgefühl nötigte ihn wohl dazu. Wenn es nach seinem Grundgefühl gegangen wäre, hätte er mich längst zum Teufel gejagt, mich längst vergessen und beiseite geschoben. Schon rein äußerlich. Innerlich hatte er nie etwas für mich übrig. Ich war einfach nicht geplant, war unvorhergesehen, eine Unordnung in seinem liebgewonnenen Reich, ein schwaches Glied in der Kette. Schon immer suchte er nach Dingen, die uns beide unterschieden, nach dem, was uns abgrenzte, wie etwa die Tatsache, dass ich ihre Augen habe, oder ihren schmächtigen Körper, dass ich einige Worte anders aussprach als er, dass ich anders aß, mich für andere Dinge interessierte, mich nicht fürs Segeln begeistern konnte oder für Autos. Immer begegnete er mir mit Misstrauen, wartete nur auf einen Fehler in meiner Aussage, Geschichte, um sich darüber in einer kalten Art lustig zu machen. Ich solle mir bloß nicht einbilden, etwas zu wissen, bloß weil ich etwas irgendwo gelesen habe, wichtige Menschen haben ohnehin keine Zeit fürs Schreiben gehabt, über sie wurde nur geschrieben.
Wie ich da nur weg wollte und wie froh ich nur war, da weg zu sein, aber nicht weil ich ihn hasste. Ich wollte endlich ungebremst leben. Ohne Kommentare. Habe ich ihn gefragt, warum dies, warum jenes, hielt er mir gleich einen Vortrag. Dabei wollte ich nur Konversation betreiben, ich wollte, dass er sich mir widmet, mich ansieht, nicht dem, was ich für ihn darstelle: Ein fragender, nerviger Junge. Nein, verdammt, dein Sohn. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Verstand, eine Seele. Ein Leben. Nicht Masse, die Materie braucht, um die Lebensfunktionen zu erhalten. Nicht eine Aufgabe, die erst bewältigt werden muss, bevor sie zu den Akten gelegt werden kann. Ein Mensch mit seinem eigenen Willen, seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen. Ganz anderen Vorstellungen.
In der Jugend habe ich ihm das alles noch an den Kopf geworfen, aber irgendwann musste ich aufgeben, es brachte nichts. Ein Kind kann seine Eltern nicht erreichen. Es ist ihnen ausgeliefert. Egal in welchem Alter. Das ist die erste Lebenserfahrung. Der erste Rückzug.
Wann hat er wohl diesen gehabt? Als sein Vater starb?
Von wegen. Für ihn ist er ein Held. Meine Großmutter erzählt heute noch stolz, wie ihr Mann für seine Ideologien gefallen ist. Für ihre wäre es richtiger. Jeder wusste, dass sie ihn nur geheiratet hatte, weil er aus einer wohlhabenden Familie kam. Sie, eine reinrassige Ausfertigung eines deutschen stubenreinen Mädchens, nahm ihre Gelegenheit wahr, dem Industriellensohn schöne Augen beim sonntäglichen Brötchenkauf zu machen. Er war dumm genug auf die Extrasüßigkeiten einzusteigen, davon zu probieren und nicht davon zu laufen.
Ich lache heute noch, wenn ich mich daran erinnere wie ihr angetrunkener Bruder, sie vor der ganzen Familie als Hure beschimpfte. Es war das erste und letzte Weihnachtsessen zu welchem er eingeladen war. Da saß die ganze Familie zu Tisch, aß und trank wie jedes Jahr schweigend, während meine Großmutter mit funkelnden Augen die alten Abenteuer erzählte. Jeder wusste, dass es irgendwelche BdM-Geschichten gewesen sind, die sie von sich gab, aber niemand traute sich einzugreifen oder bloß irgendwie zu kommentieren. Am Tisch durfte immer nur sie reden. Als sie wieder auf den Großvater zu sprechen kam, und wie stramm er in seiner Uniform aussah, da geriet ihr Bruder außer sich und beschimpfte sie aufs Übelste, sie habe ihn auch in einen SS-Anzug stecken wollen, erschießen wollten sie ihn, als er ablehnte. Auf der Flucht habe er zwei Zehen verloren und beinahe auch sein linkes Bein. Nur mit unendlich viel Glück habe er es irgendwie geschafft, nicht umzukommen, zu überleben. Irgendwann packte ihn mein Vater, nur ein Blick von meiner Mutter reichte und der Soldat warf den alten gebrechlichen Mann auf die Straße. Alles war still. Für einen Moment. Dann stand meine Großmutter auf und ohne sich aufzuregen, zu weinen (oder was man sonst für eine Gefühlsregung erwartet hatte), nahm sie etwas von der Gans und tat es meiner Mutter auf den Teller. Dann fing sie an über die Nachkriegszeit zu erzählen und wie schwer sie es damals hatten, weil ja alles zerstört war.
Das stimmte nicht. Mein Vater hatte es nie schwer gehabt. Obwohl er als Halb-Waise aufwuchs, war meine Großmutter Mann genug, um auch die Vaterrolle zu übernehmen. Geld dafür war genug da. Sein toter Vater hatte genug hinterlassen. Schwer hatten es nur die anderen, die auch vorher nicht so viel hatten. Er hingegen konnte ohne großartige Probleme zu einem anständigen Bürger heranwachsen, zu einem, der seinen Pflichten nachkommt, der immer wählen geht, einen anständigen Beruf hat, pünktlich seine Steuern bezahlt. Ohne großartige Schwierigkeit hat er eine eigene Familie mit einer anständigen, gebildeten, deutschen Frau gründen können, obwohl sein Aussehen nicht gerade besonders ansprechend war. Sein Leben war nie von großartigen Eskapaden gezeichnet, das ließ die Erziehung einfach nicht zu. Er lernte zu gehorchen. Es machte für ihn keinen Unterschied, wer die Befehle erteilte, seine Knechtschaft wurde ihm in die Wiege gelegt. Selbst diese revolutionistische Zeit, die wir heute als die Studentenbewegung der 60er Jahre kennenlernen und uns Bilder ansehen, wie selbst angesehene Politiker diesem Massenphänenomen folgten, so war das durch die Augen meines Vaters betrachtet, nichts weiter als eine Sache, der er sich gefügt hat. Es war halt einfach die Zeit, antwortete er immer, wenn er nach seiner wilden Phase gefragt wurde. Für ihn war das überhaupt nicht wild, sondern einfach eine Modefrage, wie etwa, was man für ein Auto fährt oder bei welcher Bank man ist.
Natürlich ist er ein Kunde der Deutschen Bank. Er fährt ein deutsches Premiumfahrzeug und hat einen alten Käfer in der Garage, den er nur sonntags spazieren fährt, damit der Motor nicht einrostet. Mein Vater hat einen Vornamen, den tausende Menschen tragen – mir hat er ebenfalls einen solchen Massennamen verpasst. Mein Vater ist derartig ersetzbar, ihn kann man in abertausend Haushalten Deutschlands vorfinden. Das einzige, was ihn von etlichen anderen Menschen unterscheidet, bin ich. Das ungewollte Unfallkind. Nur weil einmal die Pille vergessen wurde und Alkohol die Hemmungen überdeckt hat, bin ich entstanden. Ich habe seine kleine zusammengebastelte Welt durcheinander gebracht und bin niemals über eine Duldung hinausgekommen. Die Pflicht rief ihn dazu auf, für mich zu sorgen, mir das Sprechen beizubringen, bei den Hausaufgaben zu helfen. Es war nichts weiter als die formale Pflicht, die uns beide verband. Sehr früh musste ich erkennen, dass kein Platz für mich vorgesehen war, dass seine Pläne immer nur für meine Brüder galten. Nichts habe ich unternehmen können, nichts hätte passieren können, um irgendetwas daran zu ändern. Ich war auf der Welt, ich existierte und lebte, das war das Haupthindernis zwischen uns. Jedes Mal wenn er mich ansah, konnte er nur seine Makel erkennen. Bei jedem Anblick erinnerte ihn meine Anwesenheit daran, dass auch er schwach ist, tief im Inneren auch bei ihm Chaos herrscht. Das wollte er nicht wahrhaben. Deswegen suchte er jede Gelegenheit, um mich zu verstoßen, mich abzuschieben. Er wollte vergessen, dass auch er fehlerhaft und vergänglich ist, nichts Heiliges, Vollkommenes an sich hat, dass er einfach nicht anders ist als der stinkende und fette Metzger um die Ecke. Nicht anders als ich.