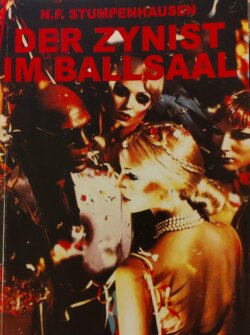Читать книгу Der Zynist im Ballsaal - NF Stumpenhausen - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog - Monzablau
ОглавлениеDie graue und trübe Wetterlage der vergangenen Tage begann sich zu verändern. Noch hing die schwüle Hitze des langen Sommers zäh und klebrig über der Stadt, doch erste, leichte Windböen versprachen Aufklarung und Frische.
Im Inneren eines am Straßenrand geparkten monzablauen Ford Taunus L beobachtete der kleine Müller die Plastiknadel eines Thermometers, wie sie sich milimeterweise dem roten Bereich näherte, während er seine Hände schützend zwischen Oberschenkel und kunstlederner Sitzfläche schob.
Sein Vater hatte „kurz etwas zu erledigen“ und Müller wollte warten, wollte schwitzen, wollte dösen. Vorne, auf dem Beifahrersitz, wo er nur Platz nehmen durfte, wenn sein Vater mit ihm unterwegs war. Am liebsten wäre er sogar auf den Fahrersitz gerutscht, hätte sich hinter das große Lenkrad gesetzt, seine kleine Hand auf den Schaltknüppel gelegt, so, wie seines Vaters Hand während der Fahrt ständig darauf ruhte. Die kräftige Männerhand, die beim Fahren Vertrauen bedeutete, bei deftigen Ohrfeigen Schmerz.
Eine dieser Ohrfeigen, vermutlich die Mutter aller Ohrfeigen, weil Müllers Vater verdammt hart zuschlagen konnte, spürte er wie Phantomschmerz noch immer auf der linken Wange. „Die hast du dir verdient“, sagte sein Vater, nachdem es mächtig geschallert hatte und ein bisschen konnte Müller dessen Wut sogar nachvollziehen, denn der liebte sein Auto und wollte partout keine Prilblumen auf der Motorhaube.
Müllers Vater hatte sich mit der geräumigen Limousine einen Traum erfüllt und war vom beengten Escort auf dieses rollende Wohnzimmer umgestiegen. Weich und gemächlich glitt der Taunus durch die Stadt, wenn beide mit geringer Geschwindigkeit im hohen Gang unterwegs waren. Beschleunigung war mit der kleinen Maschine reinweg sinnlos. Unangemessen. Nein, der Taunus war ein „Straßenkreuzer“, mit dem flitzte man nicht.
Er kannte diese Bezeichnung aus den Detektivserien, die Freitagabends liefen und die er nur bei den Großeltern schauen durfte. Mit solchen Straßenkreuzern kurvten der dicke Frank Cannon, der Einzelgänger David Ross und Joe Mannix, dessen Name ebenfalls sechs Buchstaben aufwies und mit einem großen M begann, durch Los Angeles. Ob die drei sich kannten? Sie waren schließlich „private eyes“, Privatdetektive.
Das konnte Müller sich für später auch einmal vorstellen. Lässig den Wagen am Straßenrand abstellen, einen kurzen Blick auf das kleine Wappen mit der Hubraum-Angabe an der Seite und den verchromten Kühlergrill mit der ausgeprägten Knudsen-Nase werfen, Tür satt zuschlagen, nicht abschließen und dann ab ins Abenteuer. Sein Vater hingegen, vermutlich sogar alle Männer, ging in der Regel noch einmal um den Wagen herum und überprüfte Türen und Kofferraumdeckel nach korrektem Verschluss. Gern auch zwei Mal.
Müller träumte sich an das große dunkle glänzende Lenkrad, legte seine Hand auf den schwarz glänzenden Schaltknüppel und bildete sich ein, dort die seines Vaters zu sehen, mit dessen Siegelring und der seltsamen menschenähnlichen Abbildung eines Kopfes mit aufgerissenen Augen auf grünem Stein, die der kleine Müller zuerst auf einer Zigarrenkiste in Großvaters Vitrine erblickt und die ihn zugleich fasziniert und abgeschreckt hatte, aufgepflanzt auf der starken väterlichen Hand mit den exakt gerade geschnittenen Fingernägeln, dem rotblonden Haarflaum am Unterarm, den kräftigen Adern und Muskeln eines Ringers. Er spürte die Ruhe, die von dem warmen Material des Schaltknüppels ausging, umfasste den kugelrunden Knauf…. und zog abrupt die Hand zurück, als er Schritte hörte.
Doch es war nicht sein Vater, nur eine Frau mit einem Mädchen an ihrer Hand, die ebenfalls auf dem Weg in das große alte Haus am Ende der Straße waren, vor dem der Wagen parkte.
Lautstark unterhielten sie sich, es klang nach einem Streit, von dem nur wenige Wortfetzen Müllers Ohren erreichten.
„Wir müssen uns beeilen…“, sagte die Mutter, „…noch Sachen packen vor der Abreise...“
„Zieh mich nicht so…“
Da richtete das Mädchen ihren Blick in Müllers Richtung, sah ihn für einen kurzen Augenblick durch die Seitenscheibe in die Augen. Müller spürte einen tiefen Stich im Herzen und erinnerte sich an sie mit Schmerz und Wehmut. War sie es tatsächlich? Oder sah sie ihr nur zum Verwechseln ähnlich? Müller ertrank fast in diesen Augen und der Anblick dieses Wesens brannte sich in seinem Gedächtnis aufs Neue fest. Wie in Zeitlupe schwebte sie am Autofenster vorbei, zwei, drei Schritte für die Ewigkeit, ein einziger tiefer Blick, der eine epische Geschichte erzählte.
Alles stand still, die Stadt hielt den Atem an und die Sonne stoppte ihre Bahn, die Motoren der Autos erstarben, Flugzeuge blieben wie festgenagelt am Himmel, Blätter unterbrachen ihr sanftes Rauschen, weil auch der aufkommende Wind erkannt hatte, dass es besser war, diesen Moment wirken zu lassen, um ihn für immer festzuhalten – und dann begannen die Vögel zu singen:
„Every sha-la-la-la
Every wo-o-wo-o, still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they´re startin to sing´s so fine.“
Müller konnte nicht reagieren, nur starren. Er war nicht in der Lage, an die Scheibe zu klopfen, die Kurbel zu bedienen, die Tür zu öffnen, zu rufen oder ein Zeichen des Wiedererkennens zu geben. Dazu fehlte ihm der Mut.
Die Mutter zog das Kind hinter sich her in den Eingang des Altbaus, die Tür schloss sich und Müller blieb mit traurigem Blick und pochendem Herzen zurück.
Nun war ihm noch heißer geworden. Sein himmelblauer Nicki-Pullover, seine kurze Lederhose, die Ringelsocken, die Sandalen – er hätte am liebsten alles ausgezogen und Abkühlung in einem Schwimmbecken gesucht.
Ob er dieses engelsgleiche Gesicht jemals wiedersehen würde?
Müller wendete sich wieder den Dingen im Auto zu. Sein Blick streifte den mittig auf dem breiten Armaturenbrett aufgeklebten Dackelwackelhund, den gigantischen Aschenbecher, die Anzeigen, Tank, Temp, das Tachometer, das eine Geschwindigkeit bis 220 km/h vorgab, die sein Vater allerdings noch nie erreicht hatte. Zumeist stoppte Müllers Mutter solche Versuche frühzeitig, in dem sie ihren Körper sichtbar versteifte, ihre rechte Hand in der oberen Haltegriffschlaufe strangulierte, demonstrativ lauter atmete und anschließend mit den Füßen das Bodenblech im Fußraum der Beifahrerseite zu bearbeiten begann. Als nächste Maßnahme folgte ein Blick nach links auf das Tachometer. Sie bewegte zunächst nur leicht ihren Kopf. Beim zweiten Blick beugte sie sich bereits wenige Zentimeter hinüber. Sein Vater ignorierte und richtete seinen Blick stur geradeaus. Natürlich bekam er das mit, es war ja stets das gleiche Schauspiel. Beim dritten Blick beugte sich Müllers Mutter weit auf die Fahrerseite, starrte übertrieben lange auf die für sie unfassbare Geschwindigkeit, schüttelte verständnislos den Kopf, rückte sich wieder gerade in ihren Sitz. Ihre rechte Hand war mittlerweile kreideweiß, blutleer vor Anstrengung.
Der Motor heulte hochtourig auf, sein Vater hatte längst begonnen zu schwitzen und hielt das Lenkrad ebenso verkrampft, die Tachonadel zitterte sich über die 140. Dann holte Müllers Mutter zum finalen Schlag aus:
„Du denkst an den JungEN?“ Mehr sagte sie nie in solchen Momenten. Tat dies jedoch mit strenger Betonung der letzten Silbe und einem rätselhaften Unterton, der Müllers Vater augenblicklich in die Gegenwart zurückrief, ihn geradezu wachrüttelte, seine rebellische Albernheit zerbrach, so wie eiskalter Frost dürre Äste knacken lässt. Der Ford trollte sich dann mit knapp 100 zurück auf die rechte Spur.
Müller beobachtete diese wiederkehrenden Szenen stumm von der Rückbank aus und empfand seinen Vater mutlos, wünschte sich, dass dieser sich gegen die Mutter durchsetzen, das Gaspedal durchdrücken und mit dem Auto abheben würde. Mitten hinein in ein Abenteuer, hoch oben über den Wolken, die dicht und dunkel über der Landschaft lagen.
Es waren die Momente, in denen Müller die Hoffnung hegte, seine Mutter wäre ein bisschen abgelenkter, mehr mit sich selbst beschäftigt, so wie Tante Ilse bei den gemeinsamen Ausflügen mit der Familie, die zu seinem Bedauern sonntags stattfanden, wenn in wenigstens einem der drei Fernsehprogramme mal etwas nach seinem Geschmack ausgestrahlt wurde. „Rauchende Colts“ mit Marshall Matt Dillon aus Dodge City, oder, noch besser, „Die Leute von der Shiloh Ranch“ mit Trampas und dem Virginian. Sonntag war der beste Fernsehtag, auch wenn im dritten Programm sämtliche Folgen von der „Einführung in die Experimentalphysik“ wiederholt wurden. Dabei ließ es sich wenigstens dösen.
Doch genau wie sein Vater mochte der kleine Müller am liebsten Western. Gern mit John Wayne, diesem kantigen Raubein und unerschütterlichen Kämpfer. Ein Monument, gemeißelt aus Prinzipien, Werten und Normen. An dem kam keiner vorbei. Wenn im ersten Fernsehprogramm ein Spielfilm mit John Wayne gezeigt wurde und es nicht zu spät war, dann durfte Müller mit seinem Vater zusammen bewundern, wie ihr Held den Westen rettete. In der Uniform der Nordstaaten, vorneweg, dem Kugelhagel der durchtriebenen Konföderierten ebenso trotzend wie den Pfeilen der listigen Sioux, Dakotas oder Cheyenne. Aufgeregt saßen sie beide im Wohnzimmer, der Vater mit schweißnassen Händen Reval in Kette rauchend, die Mutter hatte sich üblicherweise in die Küche verzogen, um eine Illustrierte zu lesen. Wurde ihrer Meinung nach zu viel geschossen, pflegte sie sich aus der Ferne einzumischen: „Du denkst an den JungEN?“. Müllers fröstelnder Vater entgegnete pflichtschuldig: „Der weiß doch, dass die alle wieder aufstehen.“
Nur ein einziges Mal führte das Einmischen seiner Mutter beinahe zum Abbruch des gemeinschaftlichen Filmgenusses. Es war in den Sommerferien ein Jahr zuvor. Auf der kleinen Nordseeinsel herrschte fürchterliches Wetter. Regen, Wind und Langeweile bestimmten die Tage. Im Inselkino liefen zwei Filme: „Küss mich, Dummkopf“ mit Dean Martin, was die Eltern erheiterte, und „Ein Fressen für die Geier“ mit Clint Eastwood. Müllers Zuneigung zu John Wayne begann in jenen Tagen ohnehin leicht zu bröckeln, nachdem er Bilder in den Illustrierten seiner Mutter von Clint Eastwood entdeckt hatte. Seitdem lieh er sich manchmal ihren Poncho.
Als es einige Tage später erneut unaufhörlich regnete, stand „Ein Fressen für die Geier“ auf dem Programm. Vater links, Sohn mittig, Mutter rechts. Es wurde geschossen, es flog Dynamit, es wurde geflucht und gespuckt. Rechts von sich nahm Müller die ausgestreckten Beine seiner Mutter auf der Suche nach einem Bodenblech wahr. Links starrte sein Vater mit glänzenden Augen auf die trübe Leinwand. Als Clint Eastwood von einem Indianerpfeil getroffen im Staub lag, murmelte die Mutter: „Das ist kein Blut. Das ist nur Ketchup.“
Nachdem sich im Laufe der Handlung herausstellte, dass Schwester Sara gar keine Nonne ist, sondern die Chefin eines Freudenhauses, lächelte der Vater kurz. Vor Müllers Augen wurde es plötzlich schwarz, seine Mutter hielt ihm die Hand vor das Gesicht, damit er die halbnackte Nonne nicht sehen konnte. Müller drehte sich nach links, die Hand folgte.
„Lass das, Mama!“
„Das ist nichts für dich!“
„Wieso. Denn. Nicht?“
Müller versuchte, der Zensur zu entkommen. Keine Chance.
„Was macht ihr denn da?“ brummte der Vater.
„Du musst auch mal an den Jungen denKEN“ zischte die Mutter.
„Das kann der ruhig sehen. Der weiß doch sowieso Bescheid“ meinte der Vater und Müller überlegte, worüber er erneut genau Bescheid wissen solle.
Für Müller war Filme schauen wie Autofahren. Man wusste nie so genau, wohin die Reise gehen und was man unterwegs erleben würde. Zog die Geschwindigkeit an, wurde es unter Garantie spannend. Kroch die Handlung dahin, konnte man sich den Landschaftsbildern widmen. Vielleicht war all dies ja auch ein Sinnbild fürs Leben? Müller nahm sich vor, eines Tages darüber zu entscheiden, ob er auf der Überholspur unterwegs sein, oder sich lieber schön in Ruhe mit den Dingen links und rechts am Rande beschäftigen wollte.
So wie er das auf den Sonntagsausflügen stets machte. Vorzugsweise hinten links, Blick aus dem Fenster, dösend die Tiefebene beobachtend. Wenn Onkel Hans seinen Fiat mit farbiger Geschwindigkeitsanzeige steuerte, die Hände gewissenhaft auf 10vor2, saß Tante Ilse mit ihrer Handtasche beschoßt daneben und plapperte munter mit Müllers Mutter oder Oma. Für die Geschwindigkeit interessierte sie sich überhaupt nicht. Ob Onkel Hans nun raste oder schlich war ihr einerlei. Hauptsache er fuhr nicht ruckartig an, weil ihr sonst der Hut verrutschen könnte.
Aufregend waren diese Ausflüge nie. Sie waren langweilig. Sonntagsöde. Autofahren, spazieren gehen, Kuchen essen, zuschauen, wenn Tante Ilse mit Oma tanzte und Onkel Hans seine Mutter aufforderte, spazieren gehen, Autofahren. Im Radio liefen auf der Rückfahrt am frühen Abend immer Wunschsendungen mit beliebten Melodien für die lieben Großeltern, Tanten, Onkel und Verwandten mit herzallerliebsten Grüßen von Sohn, Tochter und den süßen Enkelkindern. Müller überfiel dann eine sanfte Melancholie, er döste sich weg, sah die Welt dort draußen wie in wattedicken Novembernebel verpackt und fühlte sich irgendwie allein.
Abwechslung versprach nur die Hoffnung darauf, dass der nächste Sonntagsausflug mit seinem Vater stattfinden könnte. Doch der hatte zumeist kurzfristig etwas „zu erledigen“ und konnte nicht dabei sein. So erklärte sich Opa bereit, zu fahren und ächzte seinen schwer lenkbaren K70 aus der Garage. Ein Prachtstück in pastellorange, tiptop gewienert und mit ultrageringem Kilometerstand, weil Opa seine schönen Sachen lieber schonen wollte. Auf dem Beifahrersitz saß nun Müllers Oma mit Hut, hinten quetschte sich seine Mutter neben Tante Ilse, die wie üblich ihr Kölnisch Wasser namens „Chapeau“ umgab.
„Komischer Geruch“ dachte Müller noch zu Beginn der Fahrt, als sich Tante Ilses Duft mit Omas „Anna Bolleur“-Parfum vereinte. Über allem lag zudem der schwere Qualm von Opas Fehlfarben. Das Stück zu 30 Pfennig, mit grüner Banderole.
Seine Zigarre nahm er selten aus dem Mund, schon gar nicht beim Autofahren. Da brauchte er die Hände für das gediegene Nachfassen beim Lenken, welches wiederrum der Tatsache geschuldet war, dass Opa, sommers wie winters, einen klobigen Mantel und seinen Hut trug. Auf Müller wirkte er dann wie eine Figur von Meister Geppetto. Ruckartige unnatürliche Bewegungen mit den Armen, der Rest des Körpers steif. „Mutti, guck du mal“ sagte er dann, wenn er die Spur wechseln, ausparken oder abbiegen wollte.
Müller mochte seinen Opa sehr gern. Aber diese olfaktorische Herausforderung bei stur verschlossenen Fenstern war zu viel für seinen Magen. Ihm wurde kotzübel und nach spätestens drei Kurven musste er würgen. Seine Mutter erkannte als erste.
„Mutti“, sagte sie zu ihrer Mutter, „dem Jungen ist schlecht.“
Vatti“, sagte seine Oma zu seinem Opa, „dem Jungen ist schlecht.“
„Kann gar nicht sein“ nuschelte Opa am Stumpen vorbei.
„Fahr bitte vorsichtiger“, sagte Oma zu Opa.
„Kann ich nicht“, sagte Opa zu Oma.
Was im Übrigen stimmte, Müllers Opa fuhr nie unvorsichtig. Das konnte man allein an der Schlange hupender Autos hinterm K70 sehen.
Das Würgen wurde schlimmer.
„Oh Gott, ich hab nichts dabei“ sagte seine Mutter, „Mutti, hast du…?“
Müllers Oma kramte in ihrer Handtasche und bot zunächst ein Erfrischungstuch an. Müller schüttelte verzweifelt den Kopf. Wollte er nicht.
„Oh warte, nimm die hier...“ Oma nahm die beschmierten Brote aus einer Tüte und gab sie nach hinten. Müller sehnte sich nach einem offenen Fenster, aber auf die Idee kam irgendwie niemand. Bevor seine Mutter ihm die Tüte vor das Gesicht halten konnte, erreichte ihn noch ein Schwall Zigarrenqualm und gab ihm den Rest. Der Junge erbrach sich reinen Herzens in die Plastiktüte, in der sich üblicherweise das Schnittbrot vom Kaufmann befand; stets frisch gehalten durch kleine Luftlöcher am Boden.
Müller stierte auf das stumme Elektra Benlos-Radio, aus dem, sobald sein Vater den Zündschlüssel gedreht hatte, Dean Martin „everybody loves somebody sometime“ croonen würde. Das war Vaters Lieblingslied und direkt auf Seite 1 der sanft leiernden Cassette, die ohne schützende Hülle im Mittelfach herumlag, wenn er die zweite Cassette, die er sein eigen nannte in den Schlitz des Autoradios rammte. Best of Frank Sinatra. „Strangers in the night“. Doo-bee-doo-bee-do. „Seltsam“, dachte Müller, als er den Vierfarbkugelschreiber seines Vaters neben der Cassette entdeckte, „den hat er doch sonst immer bei sich.“
Obwohl er grundsätzlich gerne mit seinem Vater unterwegs war, blieb das ständige Warten der ungeliebte Teil der gemeinsamen Unternehmungen. Viel schöner war es, mit dem großen Taunus durch die Stadt zu juckeln, dieses und jenes einzukaufen, einen Freund zu besuchen, Bekannte zu treffen. Dabei ging es selten um Dinge, die den kleinen Müller betrafen; und ehrlich gesagt wusste er eigentlich nie, was wirklich geschah. Er war eben einfach dabei, wartete, saß an Nebentischen oder in anderen Zimmern, spielte mit Bierdeckeln oder döste vor sich hin. Auf diese Weise entdeckte Müller das Dösen und entwickelte es für sich zur wirkungsvollen Kunstform.
Wenn Müller döste, dann war das nicht so, dass er dabei an gar nichts dachte. Im Gegenteil. Beim Dösen schossen ihm nicht selten mehr Gedanken durch den Kopf als im wachen Zustand.
In der Fernsehzeitschrift seiner Mutter hatte er sogar einen kleinen Artikel auf der Gesundheitsseite gefunden, in dem ein Wissenschaftler aus Amerika empfahl, Kinder ab und an dösen zu lassen, sie nicht abrupt zu stören. Denn beim Dösen verarbeiten Menschen Gelerntes, sie speichern es ab und vertiefen somit ihr Wissen. Das war der Beweis! Müller war spontan begeistert von diesem Artikel und beschloss, auszuprobieren. Hier und da ein bisschen im Unterricht mitmachen und dann erstmal dösen. Abspeichern. Vertiefen. Er wurde ein Meister darin. Erklärte seine Mutter ihm, was er vom Kaufmann am Eck mitbringen solle, nickte Müller und döste vor sich hin. „Willst du nicht langsam mal los?“, erinnerte sie ihn an den Einkauf. „Kleinen Moment, ich vertiefe noch.“
Beim Sportunterricht erklärte sein Lehrer eine Übung und gab mit der Pfeife das Kommando. Müller blieb stehen und speicherte das Gehörte in Ruhe ab. Er wurde prompt aufgefordert, konterte jedoch mit dem Argument, sein neues Wissen gerade vertieft zu haben, woraufhin sein Lehrer recht garstige Worte fand und ihn zum Duschen schickte. Da hatte er dann ausreichend Zeit zum Dösen.
Am schönsten war das Dösen jedoch unterwegs im Auto, wenn Fahrzeuge, Häuser, Wälder, Wolken oder Wiesen an ihm vorbeizogen, er dabei den Gesprächen im Auto lauschte und Wortfetzen in seine Tagträume einfließen ließ.
Darin tummelten sich heldenhafte Abenteuer, wagemutige Einsätze, ritterliche Rettungstaten, tollkühne Flugeinlagen, sportliche Höchstleistungen, entschlossene Handlungen, treffsichere Duelle, rasante Autorennen, eiskalte Polarexpeditionen, schwebende Tauchgänge, legendäre Wettläufe, epische Sandkastenschlachten, verwegene Reiteinlagen, geschichtsträchtige Mondspaziergänge, sonore Gesangseinlagen, umjubelte Konzerte, waghalsige Wendemanöver, atemlose Verfolgungsjagden, meisterhafte Quartettstiche, wunderbare Kochkenntnisse, federleichte Verführungskünste, zärtliche Gesten, zaghafte Zärtlichkeiten, stürmische Eroberungen, brillante Schauspielkünste, einschmeichelnde Wesensmerkmale, markante Gesichtszüge, galante Formulierungen, perfekte Manieren, wache Gedanken, blitzende Blicke, stählerne Muskeln, vernarbte Kampfspuren, superstarke Kräfte, kämpferische Aufforderungen, mitreißende Ideen, markige Worte, messerscharfe Analysen, schnelle Reflexe, märchenhafte Reichtümer, grenzenloser Mut, fabelhafte Rekorde, intelligente Fragen, kluge Antworten, feurige Tänze, stichhaltige Argumente, listige Manöver, besonnene Einschätzungen, tapfere Niederlagen, überlegene Siege, unfassbare Matheleistungen.
Diese bunte und spannende Welt, die nur ihm gehörte und in der er in rasender Abfolge zumeist alles auf einmal erlebte, brachte ihn vor lauter Aufregung zum Schwitzen. Nicht nur im Taunus bei über 40 Grad Innentemperatur.
Das letzte Mal, dass der kleine Müller ähnlich lange auf den großen Müller warten musste, war gerade erst eine Woche her. Sein Vater wollte Robert besuchen, einen Freund, der in einem soliden Gartenhaus am Kanal im großen Stadtpark wohnte.
Roberts Haus war flach, windschief und nach drei Seiten mit Holz provisorisch ausgebaut. Raum an Raum, verwinkelt und muffig. Im hinteren Bereich befand sich eine Art Großküche. Robert war bekannt für seinen Brataal und seine Frikadellen, die er an Imbissbuden lieferte, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ein „Lebemann“, wie sein Vater ihn nannte, ein „Windhund“, wie die Mutter es ausdrückte. Robert war eine außergewöhnliche Erscheinung und faszinierte den kleinen Müller allein schon optisch.
Das dunkle und im Nacken über den Kragen fallende Haar kämmte dieser sehr große und spindeldürre Mann ölig straff nach hinten und seine imposanten Koteletten wuchsen wie bei Noddy Holder unterm Kinn beinahe zusammen. Robert trug stets den gleichen Anzug; schmal geschnittenes auffälliges Glencheck-Muster, die Hose mit Schlag, spitze braune Halbschuhe. Dazu die passende Weste und ausnahmslos pastellige Hemden mit gleichfarbiger Krawatte. Das taillierte Jackett zog er nur aus, wenn er zum Kochen und Backen eine Schürze umband. Dabei bewegte er sich so selbstverständlich in dieser Aufmachung, dass der kleine Müller glaubte, einem Rockstar zu begegnen. Zumindest lag die Vermutung für den kleinen Jungen recht nahe, da Robert ein großer Johnny Cash-Fan war und ausschließlich Schallplatten des ihm erstaunlich ähnlich sehenden Sängers auf den Teller seines Lenco-Plattenspielers legte. Mit tatterigen Händen ließ er die Nadel dabei unsanft auf die erste Rille plumpsen, manchmal rutschte sie dabei direkt in den ersten Song und verursachte ein unangenehmes Kratzen.
„When I was just a baby, my mama told me: Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno, just to watch him die.
When I hear the whistle blowin', I hang my head and cry.“
Von der Küche aus kam man in einen großen ehemaligen Bootsschuppen an dessen Rückwand mehrere durchlöcherte Zielscheiben und Blechschilder hingen. Robert und Müllers Vater machten sich gelegentlich einen Spaß daraus, mit Kleinkalibergewehren oder Revolvern auf die Scheiben zu schießen, während sie dabei Reval rauchten, Cola-Rum tranken und die ofenwarmen Frikadellen mit Senf aßen.
Der kleine Müller musste währenddessen warten. Vom Wohnzimmer aus hörte er gedämpft die Schüsse, vor sich ein Glas Milch, einen Teller mit Frikadellen und Ketchup. Um ihn herum hantierte Susi, Roberts Freundin, denn auch sie durfte nicht mit dabei sein. Susi schielte höllisch, trug keine Brille, dafür reichlich Lidstrich, Wimperntusche, Lippenstift und eine Art Negligé, welches bei ihm unangenehme Gefühle auslöste.
Vor allem, wenn sie sich ihm gegenüber in einen Sessel setzte, die Beine übereinanderschlug und mit ihren rot lackierten Fingernägeln eine orientalische Zigarette aus der exotischen Schachtel zog. Susi hantierte dabei fürchterlich umständlich mit einem Tischfeuerzeug, bis der Tabak endlich glühte, zog lang und tief, blies den Rauch genau in seine Richtung, hielt den Raucherarm seltsam angewinkelt nach hinten und legte die Zigarette nach einem zweiten Zug in den Aschenbecher, wo sie dann langsam verqualmte. Würde an dem Filter nicht so dermaßen viel Lippenstift kleben, Müller hätte glatt mal versucht, daran zu ziehen. Denn diese aufreizende Art war für den kleinen Jungen verwirrend und peinlich zugleich, obwohl er ahnte, dass sie all das nicht für ihn machte.
Dafür liefen diese Nachmittage zu sehr nach dem gleichen Muster ab. Erst saßen alle zusammen im Wohnzimmer, dann verschwanden Müllers Vater und Robert, es knallte eine gute Stunde im Schuppen, dann kehrte Robert zurück ins Wohnzimmer, um mit Müller die Zeit totzuschlagen während Susi für die nächste halbe Stunde verschwand. Danach tauchte dann auch sein Vater wieder auf, packte schweigend ein paar Frikadellen ein, überreichte Robert noch einige Geldscheine, vermutlich für die sehr teuren Frikadellen und beide Müllers verschwanden wieder.
Warum dauerte es nur dieses Mal so lange? Ihm wurde langsam schlecht von der Hitze, die Sonne brannte auf das matte monzablau, der Taunus heizte sich mehr und mehr auf, die schwarze Nadel berührte den roten Bereich. „Meine Güte“, dachte Müller, „fast 50 Grad. Rekord!“.
Er schaute durch die Frontscheibe auf die wabernden Hitzewellen über dem Asphalt und entdeckte einen kleinen Lastwagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein junger Mann hantierte am linken Hinterrad, versuchte nach einem Reifenwechsel die Radmuttern festzuschrauben. Als ihm sein Werkzeug wiederholt aus der Hand rutschte, brach er die Arbeit unvollendet ab und entfernte sich kopfschüttelnd. Müller fiel noch die ebenso schlampig angebrachte Beschriftung an der Seite des schmuddelig grauen Kastens auf; konnte aber mit „Ottos 1a deutsch“ nicht viel anfangen und schnappte sich vor lauter Langeweile den Vierfarbkugelschreiber seines Vaters aus dem Mittelfach. Lieblingsstück und eigentlich tabu für seine Kinderhände. Die filigrane Technik im Inneren des Stifts war ihm ein Rätsel. Er schob den blauen Knopf herunter und hätte zu gern nachgeschaut, wie die Minen gelagert sind, wie der Mechanismus funktioniert und warum sein Vater ständig fluchte, wenn die innen gelagerten Minenschächte hakelten. Das taten sie häufig; und trotzdem behielt er den Stift. Während Müller darüber nachdachte, hatte er bereits unwillkürlich am oberen Ende die Kappe abgeschraubt. Zwei Federn sprangen ihm entgegen, flutschten durch die Finger, landeten im Nirgendwo zwischen Autositz und Mittelkonsole. Als ob das Unglück noch nicht groß genug war, rutschten zudem die drei anderen Minen heraus und purzelten auf seinen Schoß. Müller sammelte sie klopfenden Herzens ein, stopfte sie in den Schacht und verschraubte das obere Ende.
Er testete den Mechanismus. Nichts. Es hakelte. Also alles wie zuvor. Dann legte er schuldbewusst den Stift zu den Cassetten in die Mittelkonsole und verdrängte das Geschehene. Für viele Jahre.
Der Parkplatz lag nun im gleißenden Licht der Sonne, die ein gutes Stück weitergewandert war. Selbst dem großen Mietshaus schien der Schatten abhandengekommen zu sein. Wie weggebrannt. Keine Menschenseele zu sehen, es gab keine Bewegung, nur Stillstand.
Hitzekoller.
Er begann innerlich zu kochen, schwitzte in seinen Nicki-Pullover, sein Hirn wurde weich, der Mund trocken. Er vernahm fremde Geräusche, ein Pfeifen, ganz hoch, dann ein Brummen, ganz tief, untermalt von einer Melodie, begleitet von einem Zirpen, einem Zwitschern...
„Every sha-la-la-la
Every wo-o-wo-o, still shines“
Müller musste an das Mädchen denken.
„Every shing-a-ling-a-ling
That they´re startin to sing´s so fine…“
Ihr Gesicht tauchte auf, wurde größer. Sie blutete aus der Nase, schaute ihn traurig an und löste sich auf, wandelte sich zu einem weit entfernten weißen Punkt, wie am Ende eines dunklen Korridors.
Dann kippte nach vorne, mit der linken Wange auf das Armaturenbrett.
Ein Vorhang zog sich vor die Augen.
Dunkelheit.