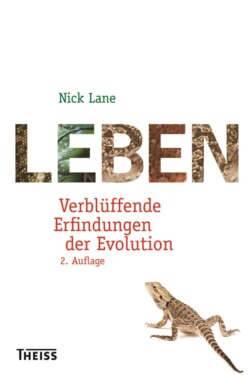Читать книгу Leben - Ник Лейн - Страница 8
1 Die Entstehung des Lebens
ОглавлениеAus dem rotierenden Erdball
Rasch folgte die Nacht auf den Tag. Ein Tag auf der Erde war zu jener Zeit nur fünf oder sechs Stunden lang. Der Planet drehte sich wild um die eigene Achse. Der Mond hing schwer und furchteinflößend am Himmel, wesentlich näher an der Erde als heute, wodurch er um Einiges größer wirkte. Sterne schienen selten, da die Atmosphäre voller Dunst und Staub war, jedoch durchzogen eindrucksvolle Sternschnuppen regelmäßig den Nachthimmel. Die Sonne – wenn sie durch den trüben, roten Dunst hindurch überhaupt sichtbar war – war verschwommen und schwach, ohne die Kraft ihrer strahlenden Schönheit. Menschen könnten hier nicht überleben. Unsere Augen würden zwar nicht anschwellen und zerspringen wie auf dem Mars, aber unsere Lungen würden keinen Sauerstoff zum Atmen finden. Wir würden eine Minute lang verzweifelt kämpfen und dann ersticken.
»Erde« wäre ein schlechter Name. »Meer« würde es besser treffen. Auch heute noch bedecken Ozeane zwei Drittel unseres Planeten und dominieren ihn auf Bildern aus dem Weltraum. Zur damaligen Zeit bestand die Erde nahezu aus Wasser mit wenigen kleinen vulkanischen Inseln, die über die turbulenten Wellen hinausragten. In der Knechtschaft jenes bedrohlichen Mondes war der Tidenhub überdimensional groß und bewegte sich in Bereichen von mehr als 100 Metern. Einschläge von Asteroiden und Kometen waren seltener als zuvor, da der größte von ihnen dem Mond entrissen und ins All geschleudert wurde. Doch selbst in dieser Zeit relativer Ruhe kochten und schäumten die Ozeane und auch darunter brodelte es. Die Erdkruste war von Rissen durchzogen, Magma quoll auf, schoss nach oben und Vulkane machten die Unterwelt dauerhaft gegenwärtig. Es war eine Welt im Ungleichgewicht, eine Welt rastloser Betriebsamkeit, ein fieberndes Kind von einem Planeten.
Es war eine Welt, in der Leben entstand, vor 3800 Millionen Jahren – möglicherweise angetrieben durch eine Kraft aus dem unruhigen Planeten selbst. Dies belegen wenige Gesteinskörner aus jener vergangenen Zeit, welche die ruhelosen Äonen bis zum heutigen Tag überlebten. In ihnen sind winzigste Spuren von Kohlenstoff eingeschlossen, die in ihrer atomaren Zusammensetzung den unverkennbaren Abdruck des Lebens selbst tragen. Wenn dies auch wie ein fadenscheiniger Vorwand für einen hohen Schadensersatzanspruch klingt, was es vielleicht auch ist, so gibt es darüber unter Experten keinen einstimmigen Konsens. Streifen wir jedoch einige weitere Häute von der Zwiebel der Zeit ab, werden vor 3400 Millionen Jahren untrügliche Lebenszeichen sichtbar. Damals war die Welt voller Bakterien, die ihre Spuren nicht nur in Kohlenstoffsignaturen hinterließen, sondern in formenreichen Mikrofossilien und in jenen domartigen Kathedralen bakteriellen Lebens – den meterhohen Stromatolithen. Bakterien dominierten unseren Planeten weitere 2500 Millionen Jahre, bevor die ersten komplexen Organismen im Fossilbericht auftauchten. Und einige sagen, sie tun es immer noch, denn die Fülle von Pflanzen und Tieren kann es nicht mit der Biomasse der Bakterien aufnehmen.
Was war es, das anorganischen Elementen auf der frühen Erde Leben einhauchte? Sind wir einzigartig oder außerordentlich selten oder ist unser Planet nur eine von Millionen Milliarden Brutstätten, die über das Universum verstreut sind? Gemäß dem anthropischen Prinzip ist dies kaum von Bedeutung. Wenn die Wahrscheinlichkeit von Leben im Universum eins zu einer Million Milliarden beträgt, dann gibt es unter einer Million Milliarden Planeten genau einen möglichen, auf dem sich Leben entwickelt. Und weil wir uns auf einem belebten Planeten wiederfinden, müssen wir offensichtlich auf diesem einen leben. Wenngleich Leben besonders selten sein mag, so gibt es in einem unendlichen Universum immer eine Eintrittswahrscheinlichkeit, dass sich auf einem Planeten Leben entwickelt – und wir leben wohl auf diesem Planeten.
Wenn Sie, wie ich, allzu kluge Statistiken unbefriedigend finden, erhalten Sie hier eine weitere unbefriedigende Antwort, die von keinen geringeren Staatsmännern der Wissenschaft vorgebracht wurde als Fred Hoyle und später Francis Crick. Das Leben begann irgendwo anders und »infizierte« unseren Planeten, entweder zufällig oder durch die Machenschaften einer gottähnlichen, extraterrestrischen Intelligenz. Womöglich war es so – wer würde für die Behauptung, dass es anders war, seine Hand ins Feuer legen? –, aber die meisten Wissenschaftler distanzieren sich aus gutem Grund von einer solchen Argumentation. Sie ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass die Wissenschaft die Frage nicht beantworten kann, bevor wir uns überhaupt bemüht haben, der Frage nachzugehen, ob die Wissenschaft tatsächlich darauf antworten kann. Die übliche Begründung oder rettende Lösung für andere Rätsel irgendwo im Universum ist die Zeit: Die Erde hatte noch nicht genug Zeit, um die verblüffende Komplexität des Lebens zu entwickeln.
Doch wer weiß? Der nicht minder bedeutende Nobelpreisträger Christian de Duve argumentiert noch vehementer, Zufallsunabhängigkeit in der Chemie bedeute, dass das Leben sich schnell entwickeln musste. Im Wesentlichen sagt er, dass chemische Reaktionen entweder schnell ablaufen oder gar nicht. Braucht eine Reaktion ein Jahrtausend, um vollständig abzulaufen, ist es wahrscheinlich, dass sich alle Reaktionspartner in der Zwischenzeit einfach umwandeln oder aufspalten, sofern sie nicht durch andere, schnellere Reaktionen kontinuierlich angereichert werden. Die Entstehung des Lebens war zweifellos eine chemische Angelegenheit, auf die man die gleiche Logik anwenden kann: Die grundlegenden Reaktionen, aus denen Leben hervorging, müssen spontan und schnell abgelaufen sein. So ist es nach de Duve wesentlich wahrscheinlicher, dass sich das Leben in 10.000 Jahren entwickelt hat als in 10 Milliarden.
Wir werden niemals in Erfahrung bringen, wie das Leben auf der Erde wirklich begann. Auch wenn es uns gelingt, Bakterien oder Bazillen herzustellen, die aus einem Strudel von Chemikalien aus einem Reagenzglas herauskrabbeln, werden wir niemals wissen, ob das Leben auf unserem Planeten wirklich so entstanden ist. Wir wissen nur, dass es auf diese Weise möglich wäre und vielleicht wahrscheinlicher, als wir früher dachten. In der Wissenschaft geht es aber nicht um Ausnahmen, sondern um Regeln. Und die Regeln, die das Auftreten von Leben auf unserem eigenen Planeten steuern, müssen im gesamten Universum gelten. Die Suche nach der Entstehung von Leben ist kein Versuch zu rekonstruieren, was am Donnerstagmorgen um 06:30 Uhr im Jahr 3.851.000.000 v. Chr. passierte, sondern eine Suche nach allgemeingültigen Regeln, die jegliches Auftreten von Leben steuern – überall im Universum und besonders auf unserem Planeten, dem einzigen Beispiel, das wir kennen. Obwohl die Geschichte, die wir verfolgen, höchstwahrscheinlich nicht in jedem Detail vollkommen richtig ist, ist sie allgemein plausibel, wie ich finde. Ich möchte zeigen, dass die Entstehung des Lebens nicht das große Geheimnis ist, zu dem sie manchmal gemacht wird, sondern dass das Leben womöglich fast unvermeidlich aus der Drehung unseres Erdballs hervorgeht.
*
In der Wissenschaft geht es natürlich nicht nur um Gesetze; es geht ebenso um die Versuche, diese Gesetze zu erklären. Unsere Geschichte beginnt im Jahre 1953, ein annus mirabilis, ein schicksalhaftes Jahr, das durch die Krönung von Queen Elisabeth II. geprägt wurde, durch die Erstbesteigung des Mount Everest, den Tod Stalins, die Aufklärung der Struktur der DNA und – nicht zu vergessen – das Miller-Urey-Experiment, den symbolischen Ursprung in der Erforschung des Ursprungs von Leben. Stanley Miller war zu diesem Zeitpunkt ein eigensinniger Doktorand im Labor des Nobelpreisträgers Harold Urey. Er starb, vermutlich ein wenig verbittert, im Jahre 2007, immer noch für die Ansichten kämpfend, die er tapfer ein halbes Jahrhundert lang vertrat. Doch lassen wir das Schicksal seiner eigenen, speziellen Ideen außer Acht. Millers wahres Vermächtnis ist der Forschungsbereich, der sich auf seinen bemerkenswerten Experimenten gründete, deren Ergebnisse die Kraft besitzen, uns auch heute noch in Staunen zu versetzen.
Miller füllte einen großen Glaskolben mit Wasser und einer Gasmischung, um die von ihm angenommene Zusammensetzung der ursprünglichen Erdatmosphäre zu simulieren. Spektroskopischen Untersuchungen zufolge bilden die ausgewählten Gase heute die Atmosphäre des Jupiters und waren vermutlich ebenso reichlich auf der jungen Erde vorhanden, nämlich Ammoniak, Methan und Wasserstoff. Durch diese Mischung leitete Miller elektrische Funken, die Blitze simulieren sollten. Dann wartete er. Nach einigen Tagen, Wochen und Monaten nahm er Proben und analysierte sie, um herauszufinden, was er da eigentlich zusammenbraute. Seine Ergebnisse übertrafen selbst seine kühnsten Erwartungen.
Er kochte eine Ursuppe, eine beinahe mythische Mischung aus organischen Molekülen, einschließlich einiger Aminosäuren – den Bausteinen von Proteinen und die wohl symbolträchtigsten Moleküle des Lebens zu einer Zeit, bevor die DNA Berühmtheit erlangte. Noch eindrucksvoller war, dass sich bevorzugt solche Aminosäuren in Millers Suppe bildeten, die auch von Lebewesen benutzt werden, neben anderen, die sich unter den unzähligen möglichen Strukturen fanden. Mit anderen Worten setzte Miller eine einfache Gasmischung unter Strom und die grundlegenden Bausteine des Lebens traten daraus hervor. Es war, als warteten sie darauf, in Erscheinung treten zu dürfen. Auf einmal erschien die Entstehung des Lebens so einfach. Diese Idee muss etwas vom damaligen Zeitgeist eingefangen haben, denn die Geschichte kam auf das Titelblatt des Time-Magazins – eine noch nie dagewesene Öffentlichkeit für ein wissenschaftliches Experiment.
Mit der Zeit jedoch geriet die Vorstellung einer Ursuppe in Verruf. Ihr Erfolg erlitt einen Rückschlag, als Analysen alter Gesteine zeigten, dass die Erde niemals reich an Methan, Ammoniak und Wasserstoff gewesen war, zumindest nicht nach dem großen Asteroiden-Bombardement, bei dem der Mond abgesprengt wurde. Dieses gewaltige Bombardement zerriss die erste Atmosphäre unseres Planeten und fegte sie hinaus ins Weltall. Realistischere Simulationen der ursprünglichen Atmosphäre erwiesen sich als enttäuschend. Versuchen wir elektrische Entladungen durch ein Gemisch aus Kohlendioxid und Stickstoff mit Spuren von Methan und anderen Gasen zu leiten, nimmt der Anteil organischer Moleküle drastisch ab – kaum eine Aminosäure in Sicht. Die Ursuppe entpuppte sich lediglich als Kuriosität. Sie war nicht mehr als eine anschauliche Demonstration dafür, dass organische Molküle unter einfachen Laborbedingungen hergestellt werden können.
Durch die Entdeckung zahlreicher organischer Moleküle im Weltall, insbesondere in Kometen und Meteoriten, widerfuhr der Ursuppe eine Ehrenrettung. Einige dieser Himmelskörper schienen fast vollkommen aus schmutzigem Eis und organischen Molekülen zu bestehen und wiesen eine Reihe von Aminosäuren auf, die jenen auffallend ähnelten, die sich in elektrisch geladenen Gasen bilden. Neben der überraschenden Tatsache, dass sie existieren, begann es so auszusehen, als ob die Moleküle des Lebens speziell bevorzugt wurden – ein kleiner Teil aus der großen Bibliothek aller möglichen organischen Moleküle. Das gigantische Asteroiden-Bombardement bekam nun ein ganz neues Gesicht: Es war nicht länger nur zerstörend. Die Einschläge waren letztendlich die Quelle, aus der Wasser und organische Moleküle hervorgingen, die wiederum dazu nötig sind, das Leben in Gang zu bringen. Die Suppe hatte ihren Ursprung nicht im Inneren der Erde, sondern wurde aus dem Weltall geliefert. Und obwohl die meisten organischen Moleküle bei den Einschlägen wohl in Fetzen gerissen wurden, belegen Berechnungen, dass genug von ihnen überdauert haben könnten, um die Zutaten einer Ursuppe zu bilden. Auch wenn das Leben nicht aus dem All ausgesät wurde, wie es der Kosmologe Fred Hoyle vertritt, so verband diese Idee dennoch die Ursprünge des Lebens – oder letztendlich die Ursuppe – mit dem Bau des Universums. Leben war nicht länger eine einsame Ausnahmeerscheinung, sondern eine maßgebende kosmologische Konstante, unabwendbar wie die Schwerkraft. Unnötig zu erwähnen, dass Astrobiologen von dieser Idee begeistert waren. Viele sind es heute noch. Abgesehen davon, dass es eine schöne Idee ist, sichert sie ihnen ihren Arbeitsplatz.
Die Ursuppe ist nebenbei auch gut mit der Molekulargenetik vereinbar, insbesondere mit der Idee, dass es im Leben um Replikation geht, um spezielle Gene, die aus DNA oder RNA bestehen, welche sich selbst genauestens kopieren können und an die nächste Generation weitergegeben werden (mehr dazu im nächsten Kapitel). Es ist sicherlich richtig, dass natürliche Selektion nicht ohne eine gewisse Art von Replikator funktionieren kann, und es ist ebenso richtig, dass die Entwicklung von komplexem Leben ausschließlich unter der Federführung der natürlichen Selektion möglich ist. Für viele Molekularbiologen ist der Ursprung des Lebens auch der Ursprung der Replikation. Und eine Ursuppe passt gut zu dieser Idee, da sie alle Zutaten enthält, die konkurrierende Wettstreiter brauchen, um zu wachsen und sich zu entwickeln. In einer schönen dicken Suppe nehmen sich die Replikatoren, was sie brauchen, formen immer längere, komplexere Polymere und verwandeln letzten Endes andere Moleküle in ausgeklügelte Strukturen wie Proteine und Zellen. So gesehen ist diese Suppe ein alphabetisches Meer, in dem Buchstaben schwimmen, die nur darauf warten, dass die natürliche Selektion sie herausfischt und sie in unvergleichliche Prosa verwandelt.
Im Grunde ist die Idee einer Ursuppe tückisch. Nicht weil sie zwangsläufig falsch wäre – es mag vor langer Zeit tatsächlich eine Ursuppe gegeben haben, auch wenn sie viel stärker verdünnt war, als ursprünglich angenommen. Sie ist tückisch, weil sie unsere Aufmerksamkeit von den eigentlichen Grundlagen des Lebens ablenkt. Nehmen wir eine keimfreie Dosensuppe (oder Erdnussbutter) und lassen sie für einige Millionen Jahre stehen. Wird sich Leben entwickeln? Nein. Warum nicht? Weil die Bestandteile sich lediglich zersetzen würden, wenn sie sich allein überlassen sind. Wenn wir auf die Dose wiederholt einschlagen, wird es auch nicht besser. Die Suppe verdirbt sogar noch schneller. Zeitweilige gewaltige Entladungen, wie Blitze, mögen einige verbindungsfreudige Moleküle dazu bewegen, sich zu Klumpen zusammenzuballen, jedoch zerreißen diese sehr wahrscheinlich wieder in ihre Einzelteile. Kann auf diese Weise eine Population hochentwickelter Replikatoren entstehen? Ich bezweifle es. Wie schon der Arkansas-Reisende aus dem Lied sagt: »Du kannst von hier aus nicht dorthin gelangen.« Es ist thermodynamisch einfach nicht möglich, genauso wie ein Körper durch wiederholte Stromschläge nicht wiederbelebt werden kann.
Thermodynamik ist eines dieser Wörter, die in populärwissenschaftlichen Büchern gerne vermieden werden. Die Bedeutung des Wortes wird verbindlicher, wenn man Thermodynamik als das sieht, was sie ist: die Wissenschaft des »Verlangens«. Die Existenz von Atomen und Molekülen wird von »Anziehung«, »Abstoßung«, »Mangel« und »Entladungen« bestimmt. Das geht so weit, dass es geradezu unmöglich wird, über Chemie zu schreiben, ohne einen gewissen Anthropomorphismus einzustreuen. Moleküle »wollen« Elektronen abgeben oder aufnehmen, ziehen gegensätzliche Ladungen an, stoßen gleiche Ladungen ab oder verbinden sich mit Molekülen, die gleiche Eigenschaften haben. Eine chemische Reaktion läuft spontan ab, wenn alle molekularen Partner das Verlangen haben, sich daran zu beteiligen; ansonsten können sie mithilfe einer größeren Kraft dazu gezwungen werden, widerwillig zu reagieren. Und natürlich gibt es Moleküle, die ein wirkliches Verlangen danach haben, zu reagieren, aber nur schwer ihre angeborene Schüchternheit überwinden können. Ein kleiner, netter Flirt mag eine gewaltige Flut der Begierde auslösen, eine Entladung purer Energie – aber ich sollte an dieser Stelle wohl besser aufhören.
Ich bin der Meinung, dass Thermodynamik die Welt bewegt. Wenn zwei Moleküle nicht miteinander reagieren wollen, können sie nur schwer davon überzeugt werden, es dennoch zu tun. Wollen sie miteinander reagieren, werden sie dies auch tun, auch, wenn es einige Zeit dauern mag, bis sie ihre Schüchternheit überwunden haben. Unser Leben wird durch eine solche Art des Verlangens bestimmt. Die Moleküle in unserem Essen wollen unbedingt mit Sauerstoff reagieren, aber glücklicherweise reagieren sie nicht spontan (sie sind ein wenig schüchtern), sonst würden wir alle in Flammen aufgehen. Die Flamme des Lebens jedoch, die langsam brennt und uns alle am Leben erhält, ist eine Reaktion von exakt dem gleichen Typ: Wasserstoff, der dem Essen entzogen wird, reagiert mit Sauerstoff, wodurch die Energie frei wird, die wir zum Leben brauchen.1 Im Grunde wird alles Leben durch eine ähnliche »Hauptreaktion« aufrechterhalten: eine chemische Reaktion, die ablaufen will und bei der Energie frei wird. Diese Energie kann nun dazu verwendet werden, alle Nebenreaktionen in Gang zu setzen, die den Stoffwechsel ankurbeln. All diese Energie, all unser Leben läuft auf die Gegenüberstellung zweier Moleküle hinaus, die völlig aus dem Gleichgewicht geraten sind: Wasserstoff und Sauerstoff – zwei Gegenspieler, die sich in trauter molekularer Zweisamkeit verbinden, wodurch massenhaft Energie frei wird. Übrig bleibt nichts weiter als eine kleine, heiße Wasserpfütze.
Und das ist das Problem mit der Ursuppe: Sie ist thermodynamisch gesehen im Gleichgewicht. Nichts in dieser Suppe will wirklich reagieren, schon gar nicht so, wie Wasserstoff und Sauerstoff es tun. Es gibt kein Ungleichgewicht, keine treibende Kraft, die das Leben den unsagbar steilen energetischen Hang hinaufjagen könnte, an dessen Ende die Bildung wirklich komplexer Polymere steht – Proteine, Lipide, Polysaccharide und ganz besonders RNA und DNA. Die Idee, dass Replikatoren wie die RNA, die ersten Erfindungen des Lebens waren, die jeglicher thermodynamischen Kraft vorausgingen, ist Mike Russell zufolge so, »als ob man den Motor eines Autos ausbauen und erwarten würde, dass die Computersteuerung das Fahren übernimmt«. Aber wenn nicht aus einer Suppe, woher kam der Motor dann?
*
Der erste Schlüssel zu einer Antwort wurde in den frühen 1970er Jahren gefunden, als entlang der Galápagos-Verwerfung, unweit der Galápagos-Inseln, Schlote entdeckt wurden, aus denen heißes Wasser aufstieg. Passenderweise boten diese Inseln, deren Artenvielfalt Darwin einst auf die Idee zur Entstehung der Arten brachte, nun eine Erklärung für die Entstehung des Lebens selbst.
Einige Jahre lang tat sich wenig. Dann, im Jahre 1977, acht Jahre nachdem Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond gesetzt hatte, tauchte das US-Marine-U-Boot Alvin zu der Verwerfung hinab. Es suchte die untermeerischen hydrothermalen Quellen, die vermutlich die heißen Schlote speisten, und fand sie ordnungsgemäß. Während ihre Existenz nicht wirklich überraschte, war die schiere Fülle des Lebens, die in den dunklen Tiefen der Verwerfung herrschte, ein wahrer Schock. Hier gab es riesige Würmer – einige davon fast zweieinhalb Meter lang – und Muscheln, die so groß wie Essteller waren. Auch wenn Riesen in solchen Meerestiefen keine Seltenheit sind – denken wir nur an Riesenkalmare –, so war ihre Häufigkeit dennoch erstaunlich. Die Populationsdichten an Tiefseeschloten sind mit denen eines Regenwaldes oder Korallenriffs vergleichbar. Der Unterschied besteht darin, dass das Leben hier nicht durch die Sonne, sondern durch die Exhalationen der Schlote gespeist wird.
Wahrscheinlich waren die Schlote selbst das Spektakulärste an der Sache. Sie erhielten bald den Namen »Schwarze Raucher« (s. Abb. 1.1). Wie sich herausstellte, waren die Schlote der Galápagos-Verwerfung eine harmlose Angelegenheit, verglichen mit einigen der anderen 200 Schlotfelder, die seitdem entdeckt wurden und die entlang der Mittelozeanischen Rücken des Pazifischen, Atlantischen und Indischen Ozeans verteilt sind. Schwankende schwarze Schornsteine, manche so hoch wie Häuser, pumpen schwarze Rauchschwaden in das darüberliegende Meer. Der Rauch ist jedoch kein richtiger Rauch. Es handelt sich um kochende metallische Sulfide, die ins Meerwasser eindringen und aus der heißen Magmakammer darunter hervorquellen. Sie sind sauer wie Essig und erreichen unter dem großen Druck der Meerestiefen Temperaturen von 400°C, bevor sie sich in das kalte Wasser ergießen. Die Schornsteine selbst werden von Schwefelmineralen wie Eisenpyrit (besser bekannt als Katzengold) aufgebaut, die sich aus dem schwarzen Rauch abscheiden und über weite Bereiche in dicken Ablagerungen ansammeln. Manche Schornsteine wachsen rasch – bis zu 30 Zentimeter am Tag – und können 60 Meter erreichen, bevor sie in sich zusammenfallen.
Abb. 1.1 Ein durch Vulkanismus gesteuerter Schwarzer Raucher auf dem Juan-de-Fuca-Rücken im nordöstlichen Pazifik, der bei Temperaturen von 350°C entgast. Der eingezeichnete Maßstab beträgt einen Meter.
Abb. 1.2 Nature Tower, ein 30 Meter hoher, aktiver basischer Schlot an der Hydrothermalquelle Lost City, der aus dem umgebenden Serpentinit aufsteigt. Die aktiven Bereiche sind strahlend weiß. Der eingezeichnete Maßstab beträgt einen Meter.
Diese bizarre und abgeschiedene Welt erinnerte an eine Vision der Hölle, vollgestopft mit Schwefel und dem faulen Gestank von Schwefelwasserstoff, der aus den Schwarzen Rauchern ausströmte. Vermutlich konnte sich nur der wirre Verstand eines Hieronymus Bosch riesige Röhrenwürmer vorstellen, denen entweder ein Mund oder ein Anus fehlte, oder die augenlosen Garnelen, von denen es auf den Felsenriffen zwischen den Kaminen nur so wimmelt – grotesk wie eine Heuschreckenplage. Das Leben an den Schwarzen Rauchern erträgt diese höllischen Bedingungen nicht nur, es kann ohne sie nicht existieren. Es gedeiht durch sie. Aber wie?
Die Antwort liegt im Ungleichgewicht. Während Meerwasser zum Magma unter den Schwarzen Rauchern durchsickert, wird es stark erhitzt und mit Mineralen und Gasen angereichert, insbesondere mit Schwefelwasserstoff. Schwefelbakterien können den Wasserstoff aus dieser Verbindung lösen, ihn mit Kohlendioxid verbinden und so organisches Material bilden. Diese Reaktion ist die Grundlage für das Leben an den Schloten. Sie erlaubt den Bakterien zu gedeihen, ohne dass dazu Sonnenlicht nötig wäre. Jedoch kostet die Umwandlung von Kohlendioxid in organisches Material Energie und um diese zu gewinnen, brauchen die Schwefelbakterien Sauerstoff. Durch die Reaktion zwischen Schwefelwasserstoff und Sauerstoff wird die Energie frei, die die Welt an den Schloten zum Leben erweckt. Sie ist mit der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff vergleichbar, die unser eigenes Leben in Gang hält. Es entsteht Wasser, wie zuvor, aber auch elementarer Schwefel, jener biblische Schwefel, der den Schwefelbakterien ihren Namen gab.
Es ist wichtig anzumerken, dass die Schlotbakterien keinen direkten Nutzen aus der Hitze oder irgendeiner anderen Eigenschaft des Schlotes ziehen. Sie nutzen lediglich den Schwefelwasserstoff.2 Dieses Gas ist von Natur aus nicht energiereich. Erst durch die Reaktion mit Sauerstoff wird Energie frei. Diese Reaktion ist wiederum auf die Kontaktzone zwischen Schlot und Meerwasser angewiesen, auf die Gegenüberstellung zweier Welten in einem dynamischen Ungleichgewicht. Nur die Bakterien, die in direkter Nachbarschaft der Schlote leben und von beiden Welten gleichzeitig zehren, sind in der Lage, diese Reaktionen ablaufen zu lassen. Die Tiere, die an den Schloten leben, weiden entweder die Bakterienmatten ab, wie die Garnelen, oder züchten Bakterien in ihrem Inneren und kümmern sich quasi um ihre eigene Farm. Dies erklärt beispielsweise, warum die riesigen Röhrenwürmer keinen Verdauungstrakt brauchen – sie werden in ihrem Inneren von Bakterienherden gefüttert. Jedoch bringen die besonderen Anforderungen, sowohl Schwefelwasserstoff als auch Sauerstoff zu beschaffen, die tierischen Gastgeber in ein Dilemma. Sie müssen nämlich etwas von den beiden Welten in sich vereinen. Einige Eigenheiten in der merkwürdigen Anatomie der Röhrenwürmer rühren von dieser unvermeidbaren Bindung.
Es dauerte nicht lange, bis Wissenschaftler die Entstehung des Lebens mit den Bedingungen an den untermeerischen Schloten in Verbindung brachten. Der Erste unter ihnen war der Ozeanograph John Baross von der University of Washington in Seattle. Die Schlote lösten umgehend viele der Probleme, die man mit der Ursuppe hatte, besonders das der Thermodynamik. In dem aufsteigenden schwarzen Rauch herrschte kein Gleichgewicht. Die Kontaktzone zwischen den Schloten und dem Meerwasser muss auf der frühen Erde allerdings anders ausgesehen haben, denn damals gab es nur wenig oder noch gar keinen freien Sauerstoff. Die Reaktion zwischen Schwefelwasserstoff und Sauerstoff kann demzufolge nicht die treibende Kraft gewesen sein, wie das heute bei dieser Form der Atmung der Fall ist. Wie auch immer, die Zellatmung ist ein komplizierter Prozess, der einige Zeit benötigt haben muss, um sich zu entwickeln, und kann nicht die ursprüngliche Energiequelle gewesen sein. Stattdessen, so behauptet der revolutionär denkende deutsche Chemiker und Patentanwalt Günter Wächtershäuser, war die spontan ablaufende Reaktion zwischen Schwefelwasserstoff und Eisen der ursprüngliche Motor des Lebens. Bei dieser Reaktion bildet sich das Mineral Eisenpyrit, wobei eine kleine Energiemenge freigesetzt wird, die, zumindest theoretisch, eingefangen werden kann.
Wächtershäuser entwickelte ein chemisches Modell für die Entstehung des Lebens, das genauso aussah. Da die Energie, die bei der Bildung von Eisenpyrit frei wird, nicht ausreicht, um Kohlendioxid in organisches Material umzuwandeln, kam Wächtershäuser auf die Idee, Kohlenmonoxid als reaktionsfreudigeres Zwischenprodukt zu verwenden. Dieses Gas wurde tatsächlich auch an sauren Schloten entdeckt. Er überlegte sich weitere träge, organische Reaktionen mit unterschiedlichen Eisen-Schwefel-Mineralen, die außergewöhnliche Katalysekräfte zu haben schienen. Darüber hinaus gelang es Wächtershäuser und seinen Kollegen, viele dieser theoretischen Reaktionen im Labor nachzuweisen. Sie waren also mehr als nur plausibel. Wächtershäuser gelang eine Meisterleistung, die jahrzehntealte Vorstellungen darüber, wie das Leben entstanden sein könnte, über den Haufen warf. Der Schauplatz, eine höllische Umgebung, in der die am wenigsten zu erwartenden Zutaten zu finden waren, nämlich vorwiegend Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid und Eisenpyrit – zwei giftige Gase und Katzengold. Ein Wissenschaftler, der zum ersten Mal Wächtershäusers Werk las, bemerkte, dass es sich so anfühlte, als sei er über eine wissenschaftliche Abhandlung gestolpert, die durch ein Zeitloch aus dem ausgehenden 21. Jahrhundert gefallen war.
Aber hat er recht? Harsche Kritik wurde auch an Wächtershäuser geübt – teilweise, weil er ein wahrer Revolutionär war, der lang vertretene Ideen umwälzte, teilweise, weil er mit seiner hochmütigen Art dazu neigte, wissenschaftliche Kollegen auf die Palme zu bringen, und teilweise, weil es berechtigte Zweifel an dem Bild gab, das er zeichnete. Die wohl heikelste Schwachstelle ist das »Konzentrationsproblem«, das auch das Bild von einer Ursuppe trübt. Alle organischen Moleküle lösen sich in einem Meer von Wasser und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie sich jemals begegnen und miteinander reagieren werden, um Polymere wie RNA und DNA zu bilden. Es gibt nichts, worin sie aufgefangen werden könnten. Wächtershäuser entgegnete, dass alle seine Reaktionen auf der Oberfläche von Mineralen wie Eisenpyrit ablaufen können. Hierbei gibt es jedoch eine Schwierigkeit, denn die Reaktionen können nicht vollständig ablaufen, wenn die Endprodukte nicht von der Oberfläche des Katalysators abgelöst werden. Entweder verklebt alles oder es verteilt sich.3
Mike Russell, der heute im Jet Propulsion Laboratory in Pasadena arbeitet, machte in den 1980er Jahren einen Lösungsvorschlag zu diesen Problemen. Russell ist eine Art prophetischer Wissenschaftsbarde, der zu »geopoetischen« Zauberformeln neigt. Seine Lebensanschauung, die in Thermodynamik und Geochemie wurzelt, erscheint vielen Biochemikern obskur. Im Laufe der Jahrzehnte zogen Russells Ideen jedoch eine zunehmende Reihe von Befürwortern an, die in seinen Visionen eine durchaus einleuchtende Antwort auf die Frage nach dem Ursprung des Lebens sehen.
Wächtershäuser und Russell stimmen darin überein, dass hydrothermale Quellen bei der Entstehung des Lebens eine bedeutende Rolle spielen. Abgesehen davon, sieht der eine schwarz, wo der andere weiß sieht. Während der eine Vulkanismus voraussetzt, ist der andere dagegen; der eine bevorzugt ein saures Milieu, der andere ein basisches. Für zwei Ideen, die manchmal miteinander verwechselt werden, haben sie auffallend wenig gemeinsam. Lassen Sie mich erklären.
*
An den Ozeanrücken, wo die Schwarzen Raucher auftreten, entsteht neuer Ozeanboden. Von diesen Orten vulkanischer Aktivität drückt das aufsteigende Magma die benachbarten tektonischen Platten langsam auseinander. Sie bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von wachsenden Fußnägeln. Kollidieren die dahinkriechenden Platten an anderer Stelle miteinander, ist eine Platte gezwungen, unter die andere abzutauchen, wodurch es zu Erdbeben kommt. Der Himalaya, die Anden, die Alpen – alle Gebirge entstanden durch die Kollision tektonischer Platten. Mit der Bildung neuen Ozeanbodens werden neue Gesteine aus dem Erdmantel, dem Bereich unterhalb der Erdkruste, hervorgebracht. Diese Gesteine sind die Heimat eines zweiten Typs von Hydrothermalquellen, die sich stark von den Schwarzen Rauchern unterscheiden – der Typ, den Russell für den Entstehungsort des Lebens hält.
Dieser zweite Schlottyp ist nicht vulkanischen Ursprungs. Magma spielt bei seiner Entstehung keine Rolle. Stattdessen hängt er von der Reaktion der neugebildeten Gesteine mit dem Meerwasser ab. Das Wasser sickert nicht einfach in diese Gesteine ein, sondern reagiert mit ihnen. Es wird in die Gesteine eingebaut und verändert ihre Struktur. Dadurch bilden sich Hydroxidminerale wie Serpentin (benannt nach seiner Ähnlichkeit mit den grün marmorierten Schuppen einer Schlange). Die Reaktion mit dem Meerwasser dehnt das Gestein, bewirkt, dass es aufreißt und zerbricht, wodurch wieder weiteres Wasser eindringen und den Prozess fortsetzen kann. Das Ausmaß dieser Reaktionen ist erstaunlich. Die Menge des Wassers, die auf diese Weise in das Gestein eingebunden wird, gleicht vermutlich derer der Meere selbst. Während sich der Ozeanboden spreizt, tauchen die hydratisierten Gesteine an anderer Stelle letztendlich unter eine kollidierende Platte ab und werden im Erdmantel wieder aufgeschmolzen. Hier geben sie ihr Wasser wieder ab und entlassen es in das Innere der Erde. Diese Verschmutzung mit Meerwasser treibt die Konvektionsströme tief im Erdmantel an, durch die das Magma an den Mittelozeanischen Rücken aus Vulkanen wieder zurück an die Oberfläche aufsteigt. Der unruhige Vulkanismus unseres Planeten wird also vorwiegend durch den stetigen Fluss von Meerwasser im Erdmantel gesteuert. Dies ist es, was die Welt aus dem Gleichgewicht bringt – die Drehung unseres Planeten.4
Die Reaktion von Meerwasser mit den Mantelgesteinen steuert aber nicht nur den steten Vulkanismus unseres Planeten. Sie setzt außerdem Energie in Form von Hitze sowie einer reichhaltigen Menge an Gasen wie Wasserstoff frei und verwandelt sämtliche im Meerwasser gelösten Bestandteile – wie ein magischer, verzerrter Spiegel, der groteske, aufgequollene Bilder zurückwirft, in denen alle Reaktionspartner mit Elektronen aufgeladen wurden (fachlich ausgedrückt wurden sie »reduziert«). Das meiste ausströmende Gas ist Wasserstoff, einfach deshalb, weil Meerwasser größtenteils aus Wasser besteht. Es bilden sich jedoch auch geringere Mengen an verschiedenen anderen Gasen, die an das Gemisch von Stanley Miller erinnern und für die Bildung von Vorstufen komplexer Moleküle wie Proteine und DNA benötigt werden. So werden Kohlendioxid in Methan, Stickstoff in Ammoniak oder Sulfat in Schwefelwasserstoff umgewandelt und wieder ausgestoßen.
Die Hitze steigt zusammen mit den Gasen zurück zur Oberfläche auf und durchbricht sie in Form des hydrothermalen Schlottyps Nummer 2. Diese Quellen unterscheiden sich nahezu in jedem Detail von den Schwarzen Rauchern. Sie sind in keiner Weise sauer, sondern neigen sogar zu einem stark basischen Milieu. Ihre Temperatur ist warm oder heiß, liegt jedoch erheblich unter der der überhitzt wütenden Schwarzen Raucher. Gewöhnlich findet man sie in einiger Entfernung der Mittelozeanischen Rücken, der Quelle neu entspringenden Ozeanbodens. Und anstatt senkrechtstehende, schwarze Schornsteine mit einer einzigen Austrittsöffnung zu formen, durch die schwarzer Rauch wabert, tendieren sie dazu, komplexe Strukturen zu bilden, durchsiebt von winzigen Blasen und Kammern, die sich an ihnen abscheiden, während die warmen, basischen, hydrothermalen Fluide in das darüberliegende kalte Meerwasser einströmen. Ich vermute, der Grund für den geringen Bekanntheitsgrad dieses Schlottyps ist das abschreckende Wort »Serpentinisierung« (hergeleitet von dem Mineral Serpentin). Für unsere Zwecke geben wir ihnen einfach den Namen »basische Schlote«, auch wenn dies im Vergleich zu der kraftvollen Bezeichnung Schwarze Raucher ein wenig schwach klingt. Wir werden die volle Bedeutung des Wortes »basisch« später noch erkennen.
Merkwürdigerweise wurden basische Schlote bislang im Grunde immer vermutet, konnten aber nur anhand weniger Fossilablagerungen nachgewiesen werden. Die berühmteste, die bei Tynagh in Irland entdeckt wurde, ist um die 350 Millionen Jahre alt und gab Mike Russell den entscheidenden Denkanstoß, damals in den 1980er Jahren zurückdenken. Als er Dünnschliffe der blasigen Gesteine aus der Umgebung der fossilen Quellen unter dem Elektronenmikroskop untersuchte, sah er, dass die winzigen Kammern ähnlich groß waren wie organische Zellen – ein Zehntel Millimeter oder weniger im Durchmesser – und labyrinthartig miteinander vernetzt waren. Er nahm an, dass sich ähnliche mineralische Zellen bilden könnten, wenn sich Fluide basischer Quellen mit saurem Meerwasser vermischten, was er auch erfolgreich im Labor nachweisen konnte, indem er durch die Mischung von Basen und Säuren poröse Gesteinsstrukturen erzeugte. In einem Nature-Beitrag von 1988 bemerkte Russell, dass die basischen Bedingungen an den Schloten diese zu einem perfekten Brutplatz für Leben gemacht hätten. Die Kammern stellten eine natürliche Form von konzentrierten organischen Molekülen dar, während ihre Wände, die aus Eisen-Schwefel-Mineralen wie Mackinawit bestehen, den mineralischen Zellen die katalytischen Eigenschaften verliehen, die Günter Wächtershäuser vorausgesagt hatte. In einer Veröffentlichung von 1994 schreiben Russell und seine Kollegen Folgendes:
Das Leben ging aus wachsenden Ansammlungen von Eisensulfidblasen hervor, die mit einer basischen und stark reduzierten, hydrothermalen Lösung gefüllt waren. Diese Blasen wurden vor vier Milliarden Jahren an sulfidischen, untermeerischen, heißen Quellen, die sich in einiger Entfernung von den ozeanischen Spreizungszonen befinden, hydrostatisch gebildet.
Diese Worte waren visionär, denn zu jenem Zeitpunkt war ein solches lebendes, basisches Tiefseequellen-System noch gar nicht bekannt. Erst zur Jahrtausendwende stießen Wissenschaftler an Bord des Tauchboots Atlantis auf genau diesen Schlottyp. Sie fanden ihn etwa 15 Kilometer vom Mittelatlantischen Rücken entfernt, auf einem untermeerischen Massiv, das ebenfalls den Namen Atlantis erhielt. Den Schlot nannte man Lost City, nach dem mythischen Metropolis. Seine filigranen weißen Säulen und Finger aus Karbonat, die in die tintenschwarze Umgebung aufragen, machten diesen Namen auf unheimliche Weise passend. Das Schlotfeld war anders als alle anderen, die bislang untersucht worden waren. Einige der Schornsteine waren so hoch wie die Schwarzen Raucher. Der höchste, Poseidon, erreichte stolze 60 Meter. Jedoch waren dies keine schweren, robusten Gebilde, sondern feine, kunstvoll verzierte Äste, die eher an gotische Architektur erinnerten – voll von »sinnlosem Gekritzel«, wie es John Julius Norwich formulieren würde. Die hydrothermalen Gase waren farblos und vermittelten den Eindruck einer kurz zuvor verlassenen Stadt, die für alle Zeit in ihrer verschlungenen gotischen Pracht konserviert wurde. Dies waren keine Höllenlöcher, wie die Schwarzen Raucher, sondern grazile, weiße Nicht-Raucher, die ihre versteinerten Finger gen Himmel richteten (s. Abb. 1.2).
Abb. 1.3 Mikroskopische Struktur eines basischen Schlots, die miteinander verbundene Kammern zeigt, welche einen idealen Brutplatz für die Geburt des Lebens darstellen. Der Dünnschliff ist etwa einen Zentimeter lang und 30 Mikrometer dick.
Die Gase mögen unsichtbar sein, aber es gibt sie wirklich und sie reichen aus, um eine lebendige Stadt zu versorgen. Die Schornsteine bestehen nicht aus Eisen-Schwefel-Mineralen (Eisen löst sich kaum in sauerstoffreichem Meerwasser; Russells Vorhersagen beziehen sich auf ein wesentlich früheres Erdzeitalter), ihre Struktur ist aber tatsächlich porös – ein Labyrinth aus mikroskopischen Kammern mit federartigen Wänden aus Aragonit (s. Abb. 1.3). Seltsamerweise sind die alten, stillgelegten Strukturen, in denen keine hydrothermalen Fluide mehr sprudeln, wesentlich massiver und ihre Poren sind mit Calcit verfüllt. Dagegen geht es an den aktiven Schloten sehr lebendig zu. In ihren Poren herrscht rege bakterielle Betriebsamkeit; das chemische Ungleichgewicht wird hier voll und ganz ausgenutzt. Tiere gibt es ebenfalls und ihre Artenzahl kann es mit der an den Schwarzen Rauchern durchaus aufnehmen, jedoch ist ihre Körpergröße hier deutlich kleiner. Dies hat ökologische Gründe. Die Schwefelbakterien an den Schwarzen Rauchern haben sich ihren tierischen Wirten angepasst, während die Bakterien (oder genauer gesagt Archaebakterien), die in Lost City angetroffen wurden, keine partnerschaftlichen Beziehungen eingehen.5 Ohne innerbetriebliche »Farmen« ist das Wachstum der Tiere an den Schloten weniger effizient.
Das Leben in Lost City beruht auf der Reaktion von Wasserstoff mit Kohlendioxid, die die Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten ist. Ungewöhnlicherweise läuft die Reaktion in Lost City direkt ab, während sie in praktisch allen anderen Fällen indirekt abläuft. Reiner Wasserstoff, der als Gas aus dem Untergrund aufsteigt, ist ein seltenes Geschenk auf unserem Planeten. Daher ist das Leben üblicherweise dazu gezwungen, geheime Vorräte auszukundschaften, in denen die Atome in einer festen molekularen Verbindung mit anderen Atomen stehen, wie dies in Wasser oder Schwefelwasserstoff der Fall ist. Den Wasserstoff von solchen Molekülen abzuspalten und an Kohlendioxid zu binden kostet Energie, die bei der Photosynthese letztendlich von der Sonne geliefert wird. In der Welt der Schlote wird die Energie dagegen durch die Ausnutzung des chemischen Ungleichgewichts gewonnen. Nur im Falle des Wasserstoffgases läuft die Reaktion spontan ab, wenn auch mühevoll und langsam. Aus thermodynamischer Sicht ist diese Reaktion jedoch ein kostenloses Mittagessen, für das man bezahlen muss, wenn man es isst (wie es Everett Shock denkwürdig formulierte). Anders ausgedrückt, bringt die Reaktion auf direktem Wege organische Moleküle hervor und lässt dabei sofort eine beträchtliche Energiemenge frei, die im Prinzip dazu genutzt werden kann, andere organische Reaktionen anzutreiben.
Russells basische Schlote werden also den Anforderungen an eine Brutstätte des Lebens gerecht. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil eines Systems, das sich über die Erdoberfläche wälzt und den ruhelosen Vulkanismus unseres Planeten antreibt. Sie befinden sich in einem stetigen Ungleichgewicht mit den Ozeanen und sprudeln einen festen Vorrat an Wasserstoff aus, der mit Kohlendioxid reagiert und organische Moleküle formt. Sie bilden ein Labyrinth aus porösen Kammern, in denen alle neugebildeten organischen Moleküle angereichert und gespeichert werden, was den Bau von Polymeren, wie RNA, wesentlich wahrscheinlicher macht (wie wir im folgenden Kapitel sehen werden). Sie sind langlebig – die Schornsteine von Lost City qualmen bereits seit 40.000 Jahren, zweimal länger als die meisten Schwarzen Raucher. Und sie waren auf der frühen Erde, als der abkühlende Erdmantel unmittelbarer mit dem Meerwasser in Verbindung stand, noch reichlicher vorhanden als heute. Außerdem waren die Meere damals mit gelöstem Eisen angereichert und die mikroskopisch kleinen Kammern müssen katalytische Wände gehabt haben, die aus Eisen-Schwefel-Mineralen bestanden, wie die fossilen Schlote im irischen Tynagh. Sie müssen wie natürliche Stromreaktoren funktioniert haben – mit thermischen und elektrochemischen Gradienten, die reaktionsfreudige Fluide durch die katalytischen Kammern zirkulieren ließen.
Schön und gut, ein einzelner Reaktor mag zwar nützlich gewesen sein, kann aber kaum alles Leben hervorgebracht haben. Wie entwickelte sich nun das Leben, das von solchen natürlichen Reaktoren ausging, weiter zu dem komplexen und wunderbaren Bilderteppich genialer Erfindungen, den wir um uns herum betrachten können? Die Antwort kennen wir selbstverständlich nicht. Jedoch haben wir Hinweise, die uns das Leben mit seinen Eigenschaften selbst gibt, ganz besonders wohlbekannte innere Abläufe, derer sich heute fast alle Lebewesen bedienen. Dieses Herzstück des Lebens ist der Stoffwechsel – ein lebendes, inneres Fossil, in dem der Widerhall aus einer weit entfernten Vergangenheit eingeschlossen ist, eine Reflexion, die die Ursprünge an einer basischen Hydrothermalquelle widerspiegelt.
*
Es gibt zwei Wege, sich dem Ursprung des Lebens anzunähern: von unten nach oben oder von oben nach unten. Bis hierhin haben wir uns in diesem Kapitel mit dem Weg von unten nach oben beschäftigt und dabei die geochemischen Bedingungen und thermodynamischen Gradienten berücksichtigt, die höchstwahrscheinlich auf der frühen Erde vorhanden waren. Wir haben heiße, untermeerische, hydrothermale Quellen, die Wasserstoffgas in einen mit Kohlendioxid gesättigten Ozean einströmen lassen, als möglichen Schauplatz für die Entstehung des Lebens angenommen. Solche natürlichen, elektrochemischen Reaktoren müssen dazu in der Lage gewesen sein, sowohl organische Moleküle als auch Energie zu erzeugen; jedoch haben wir bislang noch nicht wirklich darüber nachgedacht, welche möglichen Reaktionen abgelaufen sein könnten, geschweige denn, wie sie das Leben hervorriefen, das wir heute kennen.
Der einzige Schlüssel zur Entstehung des Lebens ist das Leben, wie wir es heute kennen. Wir beschäftigen uns nun also mit dem Weg von oben nach unten. Wir können die Eigenschaften auflisten, die alle Lebewesen gemeinsam haben, um damit die hypothetischen Eigenschaften eines letzten, universellen, gemeinsamen Vorfahren (Last Universal Common Ancestor), liebevoll LUCA genannt, zu rekonstruieren. So ist es beispielsweise unwahrscheinlich, dass LUCA Photosynthese betreiben konnte, da heute nur eine kleine Gruppe von Bakterien dazu fähig ist. Sollte er dazu in der Lage gewesen sein, hätte die große Mehrheit seiner Nachkommen eine wertvolle Eigenschaft aufgeben müssen, was bestenfalls unwahrscheinlich ist, wenn es auch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Umgekehrt betrachtet, hat alles Leben auf der Erde gemeinsame Eigenschaften: Alle Lebewesen bestehen aus Zellen (ausgenommen Viren, die nur innerhalb der Zellen leben können); alle besitzen Gene, die von DNA aufgebaut werden; alle entschlüsseln Proteine anhand eines universellen Codes für die einzelnen Aminosäuren. Und alles, was lebt, bezahlt mit derselben Energiewährung, die als ATP (Adenosintriphosphat) bekannt ist und mit einem 10-€-Schein vergleichbar ist. ATP ist das Zahlungsmittel für jegliche Art von Arbeit in den Zellen (mehr dazu später). Wir können daraus schließen, dass alle Lebewesen diese gemeinsamen Eigenschaften von jenem entfernten gemeinsamen Vorfahren namens LUCA geerbt haben.
Jegliches heutige Leben besitzt auch eine gemeinsame Grundlage an Stoffwechselreaktionen, deren Herzstück ein kleiner Reaktionskreislauf ist, der als Citrat- oder Krebs-Zyklus bekannt ist. Er wurde nach Sir Hans Krebs benannt, dem deutschen Nobelpreisträger, der diesen Kreislauf erstmals in den 1930er Jahren in Sheffield vorstellte, nachdem er vor den Nazis geflohen war. Der Citrat-Zyklus steht in der Biochemie auf heiligem Boden, wenn auch viele Studentengenerationen ihn als staubige, altertümliche Geschichte in Erinnerung behalten haben, die rechtzeitig für Prüfungen auswendig gelernt werden musste und anschließend wieder vergessen wurde.
Und dennoch hat der Citrat-Zyklus Symbolcharakter. An die Wände von unordentlichen Büros in biochemischen Instituten gepinnt – solche Büros, in denen Stapel von Büchern und wissenschaftlichen Abhandlungen auf den Tischen verstreut sind und sich weiter über den Fußboden bis hin zum Papierkorb, der seit Jahrzehnten nicht geleert wurde, ausbreiten – findet man oft ein verblichenes, gewelltes und mit Eselsohren versehenes Stoffwechseldiagramm. Wir starren es mit einer Mischung aus Faszination und Horror an, während wir darauf warten, dass der Professor zurückkommt. Seine Unübersichtlichkeit ist schockierend und erinnert uns an den verworrenen Plan eines U-Bahn-Tunnels, mit kleinen Pfeilen, die in alle Richtungen zeigen und umeinander herum wieder zurückverlaufen. Obwohl das Diagramm verblichen ist, können wir erkennen, dass diese Pfeile einem Farbcode unterstellt sind, der die unterschiedlichen Pfade kennzeichnet – Proteine sind rot, Lipide grün und so weiter. Ziemlich weit unten – man hat irgendwie den Eindruck, dies sei der Ursprung des Wirrwarrs an Pfeilen – sehen wir deutlich einen kleinen Kreis, womöglich der einzige Kreis oder zumindest das einzige wohlgeordnete Stückchen auf dem gesamten Plan. Das ist er, der Krebs-Zyklus. Und während wir ihn anstarren, beginnen wir zu begreifen, dass nahezu alle anderen Pfeile auf dem Diagramm irgendwie dem Krebs-Zyklus entspringen, wie die Speichen eines verbogenen Rades. Er ist der Mittelpunkt von allem, der Kern des Stoffwechsels in der Zelle.
Der Citrat-Zyklus wirkt nun nicht mehr so verstaubt. Jüngste medizinische Studien haben ergeben, dass er sowohl den zentralen Mittelpunkt der Physiologie als auch der Biochemie einer Zelle darstellt. Änderungen in seiner Drehgeschwindigkeit beeinflussen alles, von der Alterung über Krebsgeschwüre bis hin zum energetischen Zustand. Die größte Überraschung war jedoch, dass der Citrat-Zyklus rückwärts ablaufen kann. Normalerweise nimmt der Kreislauf organische Moleküle (aus der Nahrung) auf und gibt Wasserstoff (der bei der Atmung zusammen mit Sauerstoff wieder verbrannt wird) und Kohlendioxid ab. Demzufolge liefert der Citrat-Zyklus nicht nur die Ausgangssubstanzen für verschiedene Stoffwechselprozesse, sondern auch die kleinen Wasserstoffpäckchen, die für die Erzeugung von Energie in Form von ATP nötig sind. In umgekehrter Reihenfolge macht der Citrat-Zyklus das Gegenteil: Er nimmt Kohlendioxid und Wasserstoff auf, um neue organische Moleküle zu bilden, die die grundlegenden Bausteine des Lebens sind. Und anstatt Energie abzugeben, verbraucht der rückwärtslaufende Kreislauf nun ATP. Stellen wir ihm also ATP, Kohlendioxid und Wasserstoff zur Verfügung, so spuckt der Citrat-Zyklus, wie durch Zauberei, die Grundbausteine des Lebens aus.
Dieser umgekehrte Ablauf des Citrat-Zyklus ist nicht weit verbreitet – auch nicht in Bakterien –, aber er ist relativ häufig in Bakterien zu beobachten, die an hydrothermalen Quellen leben. Er ist offensichtlich ein wichtiger, wenn auch einfacher Weg, um Kohlendioxid in die Bausteine des Lebens zu verwandeln. Der wegbereitende Biochemiker Harold Morowitz, ehemals an der Yale University, heute am Krasnow Institute for Advanced Study in Fairfax, Virginia, hat vor einigen Jahren die Geheimnisse aus dem umgedrehten Citrat-Zyklus herausgekitzelt. Im Großen und Ganzen gelangte er zu dem Ergebnis, dass der Kreislauf von alleine abläuft, wenn man ihm ausreichende Konzentrationen von allen Zutaten zur Verfügung stellt. Das ist Chemie aus dem Baukasten. Ist die Konzentration eines Zwischenproduktes aufgebaut, so wird es dazu bestrebt sein, sich in das nächste Zwischenprodukt der Reihe umzuwandeln. Von allen möglichen organischen Molekülen sind die des Citrat-Zyklus die stabilsten und damit auch diejenigen, die am wahrscheinlichsten gebildet werden. Der Citrat-Zyklus wurde also nicht durch Gene »erfunden«, sondern er ist das Resultat von Wahrscheinlichkeitschemie und -thermodynamik. Als sich später Gene entwickelten, dirigierten sie die Filmmusik, die bereits komponiert war, wie der Dirigent eines Orchesters, der für die Interpretation des Stückes verantwortlich ist – für das Tempo und die musikalischen Feinheiten –, jedoch nicht für die Musik an sich. Die Musik der Welt war die ganze Zeit über vorhanden.
Nachdem der Krebs-Zyklus sich erstmals in Bewegung gesetzt hatte und mit einer Energiequelle versorgt war, waren Nebenreaktionen nahezu unvermeidbar. Aus ihnen gingen komplexere Ausgangsstoffe, wie Aminosäuren und Nukleotide, hervor. Wie viel aus dem inneren Stoffwechsel der Lebewesen auf der Erde spontan hervorgeht und wie viel später das Produkt von Genen und Proteinen ist, ist eine interessante Frage, die jedoch über die Grenzen eines solchen Buches hinausgeht. Ich möchte dennoch einen wichtigen Punkt erwähnen. Die große Mehrheit der Versuche, die Bausteine des Lebens künstlich herzustellen, waren zu »puristisch«. Sie beginnen mit einfachen Molekülen, wie Cyaniden, die nichts mit der Chemie des Lebens, wie wir sie kennen, zu tun haben (sie sind eigentlich sogar Gegensätze dazu). Dann versuchte man, die Bausteine des Lebens zu synthetisieren, indem man mit Faktoren wie Druck, Temperatur oder elektrischen Entladungen herumspielte – allesamt völlig unbiologische Parameter. Was passiert aber, wenn wir Moleküle aus dem Citrat-Zyklus und etwas ATP zusammen in einen idealisierten elektrochemischen Reaktor geben, ähnlich jenem, den Mike Russell vorschlug? Wie viel auf unserem mit Eselsohren versehenen Diagramm bildet nun spontan aus diesen Zutaten eine Art etherisches Ensemble, das, von unten ausgehend, allmählich mit den thermodynamisch wahrscheinlichsten Molekülen angereichert wird? Ich bin nicht der Einzige, der vermutet, ziemlich viel davon – möglicherweise bis hin zu kleinen Proteinen (genauer gesagt Polypeptiden) und RNA. An diesem Punkt übernimmt die natürliche Selektion die Regie.
Das alles ist eine Sache von Experimenten, die erst noch gemacht werden müssen. Um jedes Experiment realitätsnah zu gestalten, brauchen wir eine schön stetige Produktion dieser magischen Zutat ATP. Und an diesem Punkt werden Sie sagen, dass wir etwas vorwegnehmen und versuchen zu rennen, bevor wir gelernt haben zu laufen. Wie sollten wir denn ATP herstellen? Die für mich überzeugendste Antwort liefert der geniale wie auch mehrfach ausgezeichnete amerikanische Biochemiker Bill Martin, der die USA verließ, um eine Botanik-Professur an der Universität in Düsseldorf anzutreten. Dort war Martin der stetig sprudelnde Quell bahnbrechender Ideen zur Entstehung von annähernd allem, was in der Biologie von Bedeutung ist. Einiges davon mag falsch sein, aber er versteht es immer, das Auditorium zu begeistern, und schafft es auch nahezu immer, dass man die Biologie aus einer anderen Perspektive sieht. Vor einigen Jahren setzte sich Martin mit Mike Russell zusammen und beide bewältigten gemeinsam die Überleitung von der Geochemie zur Biochemie. Seitdem sprudeln die Erkenntnisse nur so heraus. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen.
*
Martin und Russell gingen zurück zu den Wurzeln: zum Eintrag von Kohlenstoff in die organische Welt. Sie stellten fest, dass es heute lediglich fünf Wege des Stoffwechsels gibt, über die Pflanzen und Bakterien Wasserstoff und Kohlendioxid in die Welt der Lebewesen einbringen, um organische Substanzen zu bilden. Wie wir gesehen haben, ist einer davon der rückwärts ablaufende Citrat-Zyklus. Auf vier dieser fünf Stoffwechselwege wird ATP aufgenommen (wie beim Citrat-Zyklus), weshalb ein Ablauf nur unter Energiezufuhr möglich ist. Auf dem fünften Weg, der direkten Reaktion zwischen Wasserstoff und Kohlendioxid, werden dagegen nicht nur organische Moleküle gebildet, sondern es wird auch Energie frei. Zwei Gruppen uralter Organismen machen genau dies, und zwar über eine Reihe weitgehend ähnlicher Schritte. Eine dieser beiden Organismengruppen haben wir bereits kennengelernt – die »Archaeen«, die im Schlotfeld von Lost City gedeihen.
Wenn Martin und Russell recht behalten, haben die entfernten Verwandten dieser Archaebakterien vor 4000 Millionen Jahren, als das Leben seinen Anfang nahm, in einer weitestgehend identischen Umgebung die gleichen Reaktionsschritte unternommen. Die Reaktion zwischen Wasserstoff und Kohlendioxid läuft jedoch nicht ganz so direkt ab, wie es sich anhört; die beiden Moleküle reagieren nämlich nicht spontan miteinander. Sie sind eher »schüchtern« und müssen von einem Katalysator zum Tanzen aufgefordert werden. Außerdem benötigen sie einen kleinen Energieschub, um in die Gänge zu kommen. Nur unter diesen Voraussetzungen gehen die beiden eine Verbindung ein und geben dabei sogar noch viel mehr Energie ab. Der Katalysator ist nichts Besonderes. In den Enzymen, die heute diese Reaktion katalysieren, sind kleine Anhäufungen von Eisen, Nickel und Schwefel eingebaut, die eine ähnliche Struktur aufweisen wie ein Mineral, das an den Schloten entdeckt wurde. Dies deutet darauf hin, dass die ursprünglichen Zellen einfach einen gebrauchsfertigen Katalysator eingebaut hatten – eine Eigenschaft, die auf die Urtümlichkeit dieses Stoffwechselweges hinweist, da sie nicht die Evolution hochentwickelter Proteine voraussetzt. Dieser Weg hat also steinige Wurzeln, wie Martin und Russell es ausdrücken.
Es stellte sich heraus, dass die Energiequelle, die benötigt wird, um den Ball in der Schlotwelt ins Rollen zu bringen, letztendlich die Schlote selbst sind. Ein unerwartetes Reaktionsprodukt verrät uns das: eine reaktionsfreudige Form von Essig, die unter dem Namen Acetyl-Thioester bekannt ist.6 Acetyl-Thioester bilden sich, weil Kohlendioxid ziemlich stabil ist und die Angriffe des Wasserstoffs abwehrt, jedoch von reaktionsfreudigeren »frei-radikalen« Kohlenstoff- oder Schwefelfragmenten angegriffen wird, wie sie an den Schloten zu finden sind. Die Energie, die benötigt wird, um Kohlendioxid zur Reaktion mit Wasserstoff zu bewegen, stammt also aus den Schloten selbst, und zwar in Form von reaktionsfreudigen freien Radikalen, die zur Bildung von Acetyl-Thioestern führen.
Acetyl-Thioester sind von signifikanter Bedeutung, weil sie an einer uralten Gabelung im Stoffwechselprozess auftauchen und auch heute noch in Organismen zu finden sind. Wo Kohlendioxid mit einem Acetyl-Thioester reagiert, nehmen wir eine Abzweigung, die uns zur Bildung komplexerer organischer Moleküle führt. Bei dieser spontan ablaufenden Reaktion wird Energie frei, mit der wiederum ein Molekül mit drei Kohlenstoffatomen gebildet wird, das unter dem Namen Pyruvat bekannt ist. Dieser Name sollte Biochemiker aufspringen und sich zuzwinkern lassen, denn diese Verbindung stellt einen Einstiegspunkt in den Citrat-Zyklus dar. Anders ausgedrückt, führen uns ein paar einfache Reaktionen, die alle thermodynamisch günstig sind, sowie einige, die durch Enzyme mit mineralähnlichen Strukturen – »steinigen Wurzeln« – in ihrem Inneren gesteuert werden, geradewegs zum metabolischen Herzstück des Lebens, nämlich dem Citrat-Zyklus. Sind wir einmal in den Citrat-Zyklus eingedrungen, brauchen wir nichts weiter als eine stetige Zufuhr von ATP, um ihn in Gang zu bringen und die Bausteine des Lebens zu bilden.
Energie ist genau das, was an der anderen Zinke der Gabel frei wird, an der Phosphat mit einem weiteren Acetyl-Thioester reagiert. Allerdings entsteht bei dieser Reaktion kein ATP, sondern eine einfachere Form namens Acetylphosphat, die trotzdem fast denselben Zweck erfüllt und auch heute noch, neben ATP, von einigen Bakterien genutzt wird. Acetylphosphat macht genau das Gleiche wie ATP: Es überträgt seine reaktive Phosphatgruppe auf andere Moleküle und versieht diese damit quasi mit einem Energie-Etikett, das die Moleküle aktiviert. Dieser Ablauf erinnert ein wenig an das Kinderspiel Fangen, bei dem ein Kind »dran« ist und ein anderes Kind berühren muss, das dann an seiner Stelle »dran« ist. Das Kind, das »dran« ist, erwirbt eine Reaktionsfähigkeit, die es an das nächste Kind weitergibt. Das Übertragen von Phosphat von einem Molekül auf ein anderes funktioniert annähernd genauso: Das Energie-Etikett aktiviert Moleküle, die sonst nicht reagieren würden. Auf diese Weise kann ATP den Citrat-Zyklus rückwärts ablaufen lassen – und Acetylphosphat ebenfalls. Ist das reaktionsfreudige Phosphat-Etikett übertragen, entsteht als Abfallprodukt einfacher Essig, ein übliches Produkt heutiger Bakterien. Wenn Sie das nächste Mal eine Flasche Wein öffnen, der sauer geworden ist (sich also in Essig verwandelt hat), haben Sie einen Gedanken für die Bakterien übrig, die in der Flasche arbeiten und ein Abfallprodukt herstellen, das so alt wie das Leben selbst ist – Abfall, der sogar ehrwürdiger ist als der beste Jahrgang.
Fassen wir zusammen: Basische Hydrothermalquellen produzieren kontinuierlich Acetyl-Thioester und liefern damit sowohl einen Ausgangspunkt für die Bildung komplexerer organischer Moleküle als auch die Energie, die nötig ist, um diese Moleküle herzustellen und die im Wesentlichen in das gleiche Format gepackt ist, das von heutigen Zellen benutzt wird. Die mineralischen Zellen, die die Schlote durchlöchern, stellen umgehend die Hilfsmittel zur Verfügung, die nötig sind, um die Reaktionsprodukte zu sammeln und die Reaktionen zu begünstigen. Nebenbei stellen sie die Katalysatoren bereit, die den Reaktionsablauf beschleunigen, und zwar ohne dass komplexe Proteine in diesem Stadium erforderlich sind. Und schließlich bewirkt das Einströmen von Wasserstoff und anderen Gasen in das Labyrinth von mineralischen Zellen, dass sämtliche Rohmaterialien kontinuierlich nachgeliefert und gründlich vermischt werden. Es ist in der Tat ein Quell des Lebens – mit Ausnahme eines quälenden kleinen Details, das die tiefgreifendsten Konsequenzen nach sich zieht.
Das Problem bezieht sich auf den kleinen Energieschub, der zunächst benötigt wird, um Wasserstoff und Kohlendioxid für eine gemeinsame Bindung zu erwärmen. Ich erwähnte, dass dies in den Quellen selbst kein Problem darstellt, da unter den hydrothermalen Bedingungen reaktionsfreudige freie Radikale gebildet werden, die den Ball ins Rollen bringen. Für freilebende Zellen, die nicht an Hydrothermalquellen gebunden sind, ist es jedoch ein Problem. Sie benötigen ATP, um in die Gänge zu kommen – so, als ob sie beim ersten Date einen Drink bräuchten, um das Eis zu brechen. Wo liegt nun das Problem? Es ist eine Frage des Rechnungswesens. Bei der Reaktion zwischen Wasserstoff und Kohlendioxid wird genügend Energie frei, um ein ATP-Molekül zu bilden. Wenn wir aber ein ATP ausgeben müssen, um ein ATP zu erzeugen, erzielen wir keinen Nettogewinn. Und wenn wir keinen Nettogewinn haben, kann der Citrat-Zyklus nicht anlaufen und es können keine komplexen organischen Moleküle gebildet werden. Das Leben mag an hydrothermalen Quellen begonnen haben, müsste dann aber für immer mit einer Art thermodynamischer Nabelschnur, die niemals durchtrennt werden kann, an sie gebunden sein.
Offensichtlich ist das Leben nicht an Hydrothermalquellen gebunden. Wie kommen wir also aus dieser Zwickmühle wieder heraus, wenn diese Rechnung keine reine Phantasie ist? Die Lösung, die Martin und Russell liefern, ist brillant, denn sie erklärt, weshalb fast alle heutigen Organismen sich einer höchst eigenartigen Methode der Atmung bedienen, um Energie zu gewinnen. Wahrscheinlich ist dieser Mechanismus der verwirrendste und widersinnigste in der gesamten Biologie.
*
In dem berühmten Roman Per Anhalter durch die Galaxis stürzen die hoffnungslos unbeholfenen Vorfahren des modernen Menschen auf den Planeten Erde und verdrängen die dort ansässigen Affenmenschen. Sie bilden eine Unterkommission, um das Rad neu zu erfinden und ein Gesetz für die Legalisierung von Haschisch einzuführen, was alle ungeheuer reich macht. Sie bekommen jedoch ein ernsthaftes Problem mit der Inflation, in der eine einzige eingeschiffte Erdnuss drei Laubwälder kostet. Also starten unsere Vorfahren ein gewaltiges Deflationsprogramm und brennen alle Wälder nieder. Das klingt alles erschreckend einleuchtend.
Hinter dieser Leichtfertigkeit steckt jedoch, wie ich vermute, ein ernst zu nehmender Kritikpunkt, der die Eigenschaft des Geldes betrifft – es gibt nichts, was einen Wert festlegen könnte. Eine Erdnuss kann einen Goldbarren wert sein, einen Penny oder eben drei Laubwälder; das ist alles abhängig vom relativen Wert, von der Seltenheit und so weiter. Eine 10-€-Note kann wert sein, was immer sie will. In der Chemie ist dies jedoch nicht der Fall. An früherer Stelle habe ich ATP mit einer 10-€-Note verglichen und ich habe diesen Wert mit Bedacht gewählt. Mit den Bindungsenergien im ATP verhält es sich in etwa so, dass man 10 € ausgeben muss, um ein ATP zu erzeugen, und exakt 10 € erhält, wenn man es ausgibt. Dies ist nicht so relativ wie unsere Währung. Und das ist die Wurzel des Problems, das alle Bakterien haben, die versuchen, die hydrothermalen Quellen zu verlassen. ATP ist keine überall gültige Währung wie eine überall gültige 10-€-Note, unflexibel im Wert und ohne Kleingeld zum Wechseln. Wenn Sie einen billigen Drink bestellen möchten, um das Eis beim ersten Date zu brechen, müssen Sie Ihre 10-€-Note über den Tresen reichen, erhalten aber kein Wechselgeld – auch nicht, wenn der Drink nur 2 € kostet. So etwas wie ein Fünftel eines ATP-Moleküls gibt es nicht. Und wenn Sie die Energie auffangen, die bei der Reaktion von Wasserstoff und Kohlendioxid frei wird, können Sie diese nur in 10-€-Verpackungseinheiten einlagern. Sagen wir, Sie könnten im Prinzip 18 € aus der Reaktion gewinnen; diese würden nicht ausreichen, um zwei ATPs herzustellen, also müssten Sie sich mit einem zufrieden geben. Sie verlieren 8 €, da kein Kleingeld zum Wechseln vorhanden ist. Viele von uns sehen sich in Wechselstuben, die ausschließlich mit großen Banknoten handeln, mit dem gleichen ärgerlichen Problem konfrontiert.
Wir sind also immer gezwungen, unsere weltweit gültige 10-€-Note zu benutzen, ungeachtet dessen, dass wir nur 2 € benötigen, um alles in Gang zu bringen und eigentlich 18 € Wechselgeld zurückbekommen müssten. Wir müssen also immer 10 € ausgeben, um 10 € zu gewinnen. Bakterien können diese Gleichung nicht umgehen: Sie können nicht durch die direkte Reaktion von Wasserstoff mit Kohlendioxid, nur unter Zuhilfenahme von ATP, wachsen. Sie tun es dennoch, und zwar mithilfe einer ausgeklügelten Methode, mit der sie die 10-€-Note in kleines Wechselgeld aufbrechen. Diese Methode ist unter dem beeindruckenden Namen Chemiosmose bekannt und trug dem exzentrischen britischen Biochemiker Peter Mitchell, der sie erstmals vorstellte, 1978 den Nobelpreis ein. Damit fanden jahrzehntelange harte Auseinandersetzungen schließlich ein Ende. Heute jedoch, aus der Sicht eines anderen Jahrtausends, erkennen wir, dass Mitchells Entdeckung zu den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts zählt.7 Doch selbst die wenigen Forscher, die lange Zeit die Bedeutung der Chemiosmose hochhielten, hatten Mühe zu erklären, warum ein solch eigenartiger Mechanismus im Leben allgegenwärtig sein sollte. Wie der universelle genetische Code, der Krebs-Zyklus und das ATP ist auch die Chemiosmose für alles Leben allgemeingültig. Es stellte sich heraus, dass LUCA, der letzte, universelle, gemeinsame Vorfahr, die Eigenschaft der Chemiosmose besaß. Martin und Russell erklären, warum.
Allgemein ausgedrückt, ist Chemiosmose der Fluss von Protonen durch eine Membran (abgeleitet von dem Begriff Osmose, der den Fluss von Wasser durch eine Membran beschreibt).* Bei der Atmung passiert Folgendes: Elektronen werden von der Nahrung abgespalten und über eine Trägerkette zum Sauerstoff transportiert. Die Energie, die dabei an mehreren Stellen frei wird, wird dazu benutzt, um Protonen durch eine Membran zu pumpen. Dies hat zur Folge, dass an der Membran ein Protonengradient aufgebaut wird. Die Membran hat dabei die Funktion eines hydroelektrischen Dammes. Ähnlich wie Wasser, das von einem Reservoir in den Bergen hinabfließt, um Turbinen zur Stromerzeugung anzutreiben, kurbelt der Protonenfluss durch die Protein-Turbinen in der Zellmembran die Produktion von ATP an. Dieser Mechanismus ist völlig überraschend: Mitten in eine schöne, direkt ablaufende Reaktion zwischen zwei Molekülen ist ein eigenartiger Protonengradient eingeschaltet.
Chemiker sind es gewohnt, mit ganzen Zahlen zu arbeiten; es ist nicht möglich, dass ein Molekül mit der Hälfte eines anderen Moleküls reagiert. Die wahrscheinlich erstaunlichste Eigenheit der Chemiosmose ist, dass bei ihr Fragmente von ganzen Zahlen auftauchen. Wie viele Elektronen müssen übertragen werden, um ein ATP herzustellen? Etwa acht oder neun. Wie viele Protonen? Die bisweilen genaueste Schätzung beläuft sich auf 4,33. Solche Zahlen machten überhaupt keinen Sinn, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Zwischenschaltung eines Gradienten entdeckt wurde. Ein Gradient wird im Grunde genommen von einer Million Abstufungen aufgebaut: Er zerbricht nicht in ganze Zahlen. Und der große Vorteil eines Gradienten ist, dass eine einzelne Reaktion immer und immer wieder ablaufen kann, nur, um ein einziges ATP-Molekül hervorzubringen. Wird bei einer bestimmten Reaktion ein Hundertstel der Energie frei, die für die Herstellung von einem ATP nötig ist, wird diese Reaktion einfach hundertmal wiederholt. Der Gradient wird dabei Schritt für Schritt aufgebaut, bis das Protonenreservoir groß genug ist, um ein einziges ATP zu bilden. Mit einem Mal ist die Zelle in der Lage zu sparen; sie hat eine Tasche voller Wechselgeld.
Was bedeutet das alles? Gehen wir zurück zur Reaktion zwischen Wasserstoff und Kohlendioxid. Immer noch kostet es die Bakterien ein ATP, um den Ball ins Rollen zu bringen; sie sind aber nun dazu in der Lage, mehr als ein ATP herzustellen, da sie auf ein zweites ATP sparen können. Kein gutes Leben vielleicht, aber zumindest ein ehrliches. Um es auf den Punkt zu bringen: Der Unterschied besteht darin, entweder die Möglichkeit zum Wachsen zu haben oder nicht. Wenn Martin und Russell richtig liegen und die frühesten Lebensformen aus dieser Reaktion hervorgingen, ist der einzige Weg, auf dem das Leben die Tiefseequellen verlassen konnte, der der Chemiosmose. Es ist zweifellos richtig, dass die einzigen Lebensformen, die heute von dieser Reaktion leben, von der Chemiosmose abhängig sind und ohne sie nicht wachsen können. Und es ist ebenfalls richtig, dass fast alles Leben auf der Erde diesen merkwürdigen Mechanismus besitzt, auch, wenn er nicht immer benötigt wird. Warum? Ich vermute, einfach, weil sie ihn von einem gemeinsamen Vorfahren geerbt haben, der nicht ohne ihn leben konnte.
Hierin liegt jedoch der wirkliche Grund, der beweist, dass Martin und Russell recht haben – im Gebrauch von Protonen. Warum nicht beispielsweise Natrium-, Kalium- oder Calciumionen, die von unserem eigenen Nervensystem benutzt werden? Es gibt keinen offensichtlichen Grund, weshalb Protonen anstelle anderer geladener Teilchen für einen Gradienten bevorzugt werden; es gibt auch einige Bakterien, die lieber einen Natrium- als einen Protonengradienten aufbauen, wenn auch selten. Ich denke, der Hauptgrund geht auf die Eigenschaften von Russells Schloten zurück. Erinnern wir uns daran, dass die Schlote basische Fluide in einen Ozean blasen, der durch gelöstes Kohlendioxid sauer ist. Säuren definieren sich über Protonen: Eine Säure ist reich an Protonen, eine Base arm. Demzufolge baut sich durch die einströmenden basischen Fluide in das saure Meerwasser ein natürlicher Protonengradient auf. Mit anderen Worten ausgedrückt, sind die mineralischen Zellen in Russells basischen Schloten auf natürliche Weise chemiosmotisch. Russell selbst wies bereits vor vielen Jahren darauf hin, aber die Erkenntnis, dass Bakterien die Quellen ohne Chemiosmose einfach nicht verlassen konnten, war das Ergebnis seiner Zusammenarbeit mit Martin, der sich mit der Energetik von Mikroben befasste. Diese elektrochemischen Reaktoren produzieren also nicht nur organische Moleküle und ATP, sondern zeigen uns auch ihren Fluchtplan, nämlich den Weg, auf dem sie das weltweite 10-€-Noten-Problem umgehen.
Selbstverständlich ist ein natürlicher Protonengradient nur von Nutzen, wenn das Leben ihn auch nutzbar machen kann und dazu fähig ist, einen eigenen Gradienten aufzubauen. Es ist sicherlich leichter, einen bereits existierenden Gradienten nutzbar zu machen, als von Grund auf etwas aufzubauen, jedoch passierte beides nicht auf direktem Wege. Diese Mechanismen entwickelten sich durch natürliche Selektion, daran gibt es keinen Zweifel. Heute sind dazu zahlreiche Proteine nötig, deren Bauanleitung in den Genen liegt, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ein derart komplexes System ohne Proteine und Gene entstanden sein könnte – Gene, die von DNA aufgebaut werden. Wir spannen hier einen interessanten Bogen. Das Leben konnte die Tiefseequellen nicht verlassen, bevor es nicht gelernt hatte, seinen eigenen chemiosmotischen Gradienten nutzbar zu machen, aber es konnte ihn nur nutzbar machen mithilfe von Genen und DNA. Es scheint unausweichlich: Das Leben muss einen unerwarteten Vollkommenheitsgrad in seinem steinigen Brutplatz erreicht haben.
Dies ergibt ein außergewöhnliches Bild des letzten gemeinsamen Vorfahren allen irdischen Lebens. Wenn Martin und Russell recht haben – und ich denke, das haben sie –, war LUCA keine freilebende Zelle, sondern ein steiniges Labyrinth aus mineralischen Zellen, das von katalytischen Wänden aus Eisen, Schwefel und Nickel gesäumt war und von natürlichen Protonengradienten angetrieben wurde. Das ursprüngliche Leben war also ein poröser Stein, der komplexe Moleküle und Energie erzeugte, bis hin zur Bildung von Proteinen und DNA selbst. Und dies bedeutet, dass wir nur die halbe Geschichte in diesem Kapitel verfolgt haben. Im nächsten werden wir die andere Hälfte betrachten – die Erfindung des wohl symbolträchtigsten aller Moleküle, dem Stoff, aus dem die Gene sind, der DNA.
________________
* Anm. d. Übers.: Osmose beschreibt allgemein den gerichteten Fluss von Molekülen durch eine semipermeable Membran.