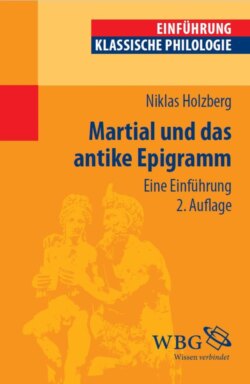Читать книгу Martial und das antike Epigramm - Niklas Holzberg - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|13|EINLEITUNG
ОглавлениеWer seine Interpretation von Martials Epigrammen auf eine Auseinandersetzung mit der Person des Verfassers stützen möchte, steht vor einem Problem, vor das uns die meisten Texte der antiken Literatur stellen: Wir wissen sehr wenig über das Leben ihrer Autoren. Zudem sind wir überwiegend auf autobiographische Angaben angewiesen, und wenn diese wie im Falle Martials von einem Dichter stammen, dürfen wir sie nicht ohne weiteres als authentische Zeugnisse betrachten. Denn in poetischen Texten spricht in der ersten Person ein poetisches Ich. Dieses kann im Rahmen eines poetischen Rollenspiels eine Maske tragen, die das Gesicht des tatsächlich Redenden vollständig verhüllt. Daher ist jede Äußerung des „ich“ Sagenden in Martials Epigrammen daraufhin zu befragen, ob sie zu einem solchen Rollenspiel gehört oder sich auf die realen Lebensumstände des Autors bezieht. Zur zweiten Kategorie sind wahrscheinlich nur die Äußerungen zu zählen, denen sich Folgendes entnehmen läßt: Geboren um 40 n. Chr. an einem 1. März (9.52; 10.24; 12.60) – daher das cognomen – in dem spanischen municipium Bilbilis (1.61; 4.55; 10.103), kam M. Valerius Martialis (epist. zu 2, 8 und 12; 1.5.2) um 64 nach Rom (10.103.7). Dazu ist dies zu ergänzen: 1. Die Zeit, in der Martial die zwölf Epigrammaton libri publizierte – über die Datierung des Liber spectaculorum sowie der Xenia und Apophoreta läßt sich nichts Sicheres sagen (s. S. 40 und 44) –, erstreckte sich, wie man aus Anspielungen auf historische Ereignisse folgern darf, etwa über die Jahre 85–102. 2. Der Tod des Dichters fällt – das kann man aus einem Nachruf des |14|jüngeren Plinius (epist. 3.21) erschließen – spätestens in das Jahr 104.
Mehrere römische Dichter der späten Republik und der frühen Kaiserzeit präsentieren sich in ihren Werken entweder explizit oder durch Andeutungen als Angehörige des Ritterstandes. Vielleicht dürfen wir also die Stellen in Martials Gedichten, an denen der Ich-Sprecher sich als eques bezeichnet (5.13.2; 9.49.4; 12.29.2), gleichfalls als Hinweise auf die Lebensumstände des Autors verstehen. Man mag es daher auch für glaubwürdig halten, daß Martial ebenso wie sein poetisches Alter ego das Privileg des ius trium liberorum genoß (2.92, 3.95, 9.97), sich tribunus nennen durfte (3.95.9; vermutlich ist ein durch Militärdienst erworbener Rang gemeint) und im Besitz eines Hauses sowohl in der Stadt als auch auf einem Landgut nahe bei Nomentum (ca. 20 km nordöstlich von Rom) war (9.97.7f.; 12.57.1). Doch die Textpassagen, aus denen all dies hervorgeht, stehen in einem gewissen Widerspruch zu denjenigen, die, wenn man auch sie autobiographisch liest, den Autor als einen um Geld oder einen Mantel bettelnden Hungerleider erscheinen lassen (vgl. bes. 6.82; 7.16; 92; 8.71). Freilich tritt Martial hier, wie noch näher ausgeführt werden soll, ganz offenkundig in einer bestimmten Rolle auf (S. 74ff.). Aber wirklich nur hier? Ein Vergleich der „Mantelgedichte“ mit den Epigrammen über den „ich“ Sagenden als Ritter ergibt dies: Das Betteln ist meist mit Klage und Selbsterniedrigung verbunden, während die Äußerungen der Martialschen persona über die Vorteile ihrer sozialen Stellung oft Selbstbewußtsein und Stolz artikulieren. Dadurch entsteht ein scharfer Kontrast, der insgesamt konstruiert wirkt. So zeigt sich immerhin die Möglichkeit, daß auch das Prunken des Ich-Sprechers mit seinem Rittertum zu einem Rollenspiel gehört. Deshalb sind die mit dem Prunken verbundenen Informationen von zweifelhaftem Wert für eine Rekonstruktion der Martial-Vita.
Dasselbe gilt für alle Äußerungen der epigrammatischen persona, aus denen man geschlossen hat, daß Martial um 98/99 in seine Heimatstadt Bilbilis zurückkehrte, dort das zwölfte |15|Epigrammbuch verfaßte und starb. Gewiß, einen längeren Spanienaufenthalt des Dichters, der in seine letzten Lebensjahre fällt, sollte man wohl nicht in Zweifel ziehen. Aber die „Heimkehr“ kann Fiktion sein, die dadurch bedingt sein könnte, daß Martial seine zwölf Epigrammaton libri wie Vergil die Aeneis als „Dodekalog“ komponierte und dabei dem letzten Buch die Aufgabe zuwies, vom „Nostos“ des Protagonisten zu „erzählen“. Wie dem auch sei – Bilbilis als eines der Themen dieses Buches ist so gut wie gar nicht dazu geeignet, historisch wirklich Greifbares über eine Episode im Leben Martials auszusagen, um so mehr dagegen dazu, im poetischen Diskurs eine bestimmte Funktion auszuüben. Die Provinzstadt erscheint hier als das Gegenstück zu Rom, und zwar ebenso als Ort der Romferne, wo dem Dichter das gebildete Publikum der Hauptstadt fehlt (12 epist.), wie als alternativer Lebensraum, der Freiheit vom Klientendienst gewährt (12.21). Was Martial uns über Bilbilis verrät, bietet fast nichts Konkretes über die Stadt als Hintergrund für die Vita des Dichters, also etwa ihre Topographie, Sozialstruktur oder ihr Erscheinungsbild. Im Falle Roms stellt sich das auf den ersten Blick anders dar. Martials Epigramme berichten nicht nur über die Gebäude, Straßen und Plätze der Metropole, sondern auch über ihre Bewohner so viel, daß man die Texte immer wieder als Quellen für die römische Kulturgeschichte ausgewertet hat. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich: Martials Rom ist wie sein Bilbilis für eine bestimmte Aussage funktionalisiert, also eine „Textstadt“, ein Produkt von „Writing Rome“ (Edwards 1996), und die in dieser Stadt wohnenden Menschen sind Typen, wie sie dem Dichter von der Gattung vorgegeben waren.
Wie man sieht, ist es nicht die Realität des Lebens im Rom der frühen Kaiserzeit und ebensowenig die Realität der eigenen Lebenserfahrung, die Martial in seinen Epigrammen beschreibt, sondern eine fiktive Welt. Die dafür vorauszusetzende Fiktionalisierung der Sprecher-persona durch den Autor wird freilich nicht von allen Martialforschern als Faktum anerkannt. |16|Viele von ihnen gehen bei ihren Interpretationen nach wie vor davon aus, daß die Trennung zwischen Autor und poetischem Ich, die bei der Interpretation moderner Lyrik nahezu als selbstverständlich gilt, von antiken Dichtern noch nicht vollzogen worden sei. Nun ist aus dem Altertum keine theoretische Äußerung überliefert, durch die eine solche Auffassung widerlegt werden könnte. Aber es gibt mehrere Stellen in erotischen Gedichten römischer Autoren, an denen der „ich“ Sagende erklärt, unanständig seien nur seine Verse, er selber sei es jedoch nicht. Dazu gehört der Schlußsatz von Martials Epigramm 1.4, das an Domitian gerichtet ist. Dort verkündet der Sprecher, nachdem er den Kaiser um Verständnis für die in seinen Gedichten enthaltenen Obszönitäten gebeten hat: „Meine Buchseiten sind anstößig, meine Lebensweise <aber> ist rechtschaffen“ (8: lasciva est nobis pagina, vita proba). Freilich redet auch hier, wie ich meine, nicht der Autor, sondern Martials persona, und deshalb kann ich das, was der Vers aussagt, nicht als Beleg für die Trennung der beiden Ichs lesen. Der Text dürfte vielmehr so zu verstehen sein, daß der Sprecher etwas Unzutreffendes behauptet. Denn in mehreren seiner Gedichte präsentiert er sich, wie noch näher gezeigt werden soll (S. 114ff.), als jemand, der auch im „Leben“ sehr „anstößig“ denkt und handelt. Aber seine Äußerung dürfte beweisen, daß antiken Lesern ein Unterscheiden zwischen der Person eines Verfassers erotischer Poesie und seinem lasziven Alter ego durchaus möglich war. Vielleicht spielt Martial in 1.4.8 mit der vergleichbaren Äußerung eines uns nicht überlieferten erotischen Textes, die erkennbar der Autor machte.
Martial war nicht der erste antike Epigrammatiker, der seine Sprecher-persona fiktionalisierte. Es ist nicht mehr festzustellen, wer innerhalb der Gattung damit begann, aber man darf annehmen, daß die Tradition, an die der römische Autor hier anknüpfte, nicht viel früher als in der hellenistischen Epoche der griechischen Literatur einsetzte. Auf jeden Fall spielt Martial eine herausragende Rolle in der historischen Entwicklung des Genres. Er war es, der das Witzepigramm zum |17|wichtigsten Gattungstyp machte und ihm seine für künftige Dichter gültige Gestalt gab. Außerdem komponierte er offensichtlich erstmals – wir wissen das nicht genau, haben aber gute Gründe, es zu vermuten – Epigrammbücher in der Weise, daß ähnlich wie bei den großen Augusteern Vergil, Horaz, Properz, Tibull und Ovid die einzelnen Gedichte zusammen eine thematische und formale Einheit auf höchstem künstlerischem Niveau bilden. Man darf Martial demnach ohne weiteres als den Klassiker des Epigramms apostrophieren. Um seine literarhistorische Bedeutung möglichst genau zu bestimmen, möchte ich in dieser Einführung zunächst die Gattungsgeschichte skizzieren und dabei besonders herausarbeiten, in welchen Bereichen seiner Dichtkunst der Römer von Vorgängern etwas lernen konnte und inwieweit er seine Nachfolger bis zum Ausgang des Altertums beeinflußte. Dabei behandle ich in einer ersten Übersicht Martials Hauptwerk, seine zwölf Epigrammaton libri, und in Verbindung mit ihnen den Liber spectaculorum sowie die Bücher Xenia und Apophoreta. Anschließend wird der „Dodekalog“ unter zwei Gesichtspunkten untersucht: Bei einer Betrachtung der häufigsten Epigrammtypen will ich Form und Gehalt des Witzepigramms spezielle Aufmerksamkeit schenken, und dann soll Martial als Schöpfer und Theoretiker des Epigrammbuchs gewürdigt werden. In meine Darstellung lege ich immer wieder Interpretationen einzelner Gedichte und Gedichtgruppen sowie ganzer Bücher ein. Dabei setze ich voraus, daß Martials Epigramme ebenso wie die Texte in den anderen uns überlieferten römischen Gedichtbüchern vom zeitgenössischen Publikum linear gelesen wurden, also in der Reihenfolge, in der sie in den libri stehen.
Was bisher deutlich geworden sein dürfte, ist dies: Martial als historische Person ist, da wir so gut wie nichts über ihn wissen und er sich noch dazu hinter der Sprecher-persona versteckt, für die Interpretation von sehr geringer Bedeutung. Nun nennt sich aber auch der „ich“ Sagende der Epigramme Martial, und deshalb bietet es sich an, diesen Namen für seine persona zu verwenden. So werde ich von jetzt an verfahren. |18|Um dabei in Zusammenhängen, wo eine Unterscheidung zwischen der historischen Person und ihrem Ich-Sprecher nochmals erforderlich ist, Mißverständnisse zu vermeiden, werde ich dort die historische Person als „Autor“ bezeichnen. Entsprechendes gilt für die anderen Epigrammatiker, die ich zusammen mit dem Klassiker der Gattung in meiner historischen Übersicht vorstellen möchte.
Überlegungen zur Rekonstruktion der Vita Martials (mit Angabe der Stellen, die man bisher als autobiographische Zeugnisse gelesen hat) bieten FRIEDLAENDER (1886), I,3–14; HELM (1955), 55–58; ALLEN (1969/70); HOWELL (1980), 1–5; SULLIVAN (1991), 1–55; WALTER (1996), 19–26; BARIÉ/SCHINDLER (1999), 1092–1102. Zur Trennung von Autor und Sprecher-persona vergleiche man besonders SCHUSTER (1930); HUMEZ (1971), 38–57; BOYLE (1995), 88. 99; NAUTA (1995), 39–57; KLEIJWEGT (1998), 256; OBERMAYER (1998), 9f.; BARIÉ/SCHINDLER (1999), 1089–1092; LORENZ (2002), 4–42, zum Rombild in Martials Epigrammen NEUMEISTER (1991), passim; SULLIVAN (1991), 147–155; PRIOR (1994); FEARNLEY (1998), 110–186.
Im folgenden werden die Epigramme Martials nach der Ausgabe von LINDSAY (1903b), diejenigen der Anthologia Graeca (= AG) nach BECKBY (21965–1967) und diejenigen der Anthologia Latina nach RIESE (21894–1906) zitiert.