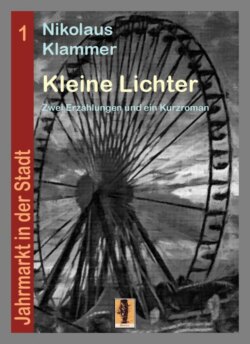Читать книгу Kleine Lichter - Nikolaus Klammer - Страница 7
PASENOWS SCHÖPFUNG
EINE ERZÄHLUNG
ОглавлениеUnd, ich darf sagen, vergessen Sie mir Pasenow nicht!“, warf der Zeitschriftenverleger ein.
„Ja, genau, was ist eigentlich aus Pasenow gewor-den?“, fragte der Autor begeistert.
„Pasenow? Der ist meines Wissens vor einigen Jahren gestorben“, behauptete die Moderatorin.
An dieser Stelle erreichte das Gespräch einen toten Punkt. Es entstand ein Schweigen, wie es in einer normalen Unterhaltung durchaus befruchtend sein konnte. Hier, in einer Fernsehdiskussion, die der Augsburger Lokalsender a-tv gerade live aus-strahlte, durfte es jedoch kein Schweigen geben. Daher wandten sich die drei Kombattanten hilfesuchend an die vierte Person in ihrer Runde. Das war ein älterer, korpulenter Herr, der - die Hände wie zum Gebet gefaltet - in einem hellen Clubsessel thronte und überlegen lächelte. Wenn überhaupt jemand die Frage nach dem Verbleib von Hermann Pasenow beantworten konnte, dann war es Claus M. Bergmann, der Kritiker der deutschen Nachkriegsliteratur, der von der Redaktion des Senders zu diesem mitternächtlichen Gespräch als Fachmann für das bald vergangene 20. Jahrhundert eingeladen worden war. Bislang hatte Bergmann seinen Ruf als amüsanter Plauderer unter Beweis gestellt und eben noch einige publikumswirksame Anekdoten über Hans Werner Richter und Günter Grass zum Besten gegeben; wie jene, in der sie sich einmal um ein belegtes Brötchen stritten, das Grass dann triumphierend mit zwei Bissen - man könne es nicht anders sagen - ‚vernichtete‘. Darüber hatte der Kritiker freilich niemals Thomas Mann aus den Augen gelassen, den er gar nicht oft genug ins Gespräch bringen konnte, ob er nun zum Thema passte oder nicht. Bergmann war der Auffassung, Mann ‚ginge immer‘, denn ‚wo Thomas Mann sei, dort würde Deutschland zu sich selbst finden‘.
Doch jetzt zögerte auch er. Bergmanns Blick wanderte unruhig hin und her, irrlichterte zwischen der beflissenen Moderatorin, dem jungen, hoffnungsvollen Autorentalent - von dem er vorher noch nie etwas gehört hatte - und Peter Wismuth, dem selbstzufriedenen Herausgeber einer Literaturzeitschrift; also jener Gesprächsrunde, die ihn so überraschend ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit gestellt hatte.
„Pasenow?“, wiederholte er, um Zeit zu gewinnen, während er seine Augen nun fest auf das Objektiv der nächsten Kamera richtete. „Er muss leben, denn ich habe seinen Nachruf noch nicht geschrieben.“ Bergmann sprach den Satz mit seinem berühmt gleichgültigen und heiseren, präzisen Tonfall aus. In der Runde wurde leise gelacht. Bergmann zuckte mit den Schultern. Von einem leichten Schwindelanfall begleitet, stellte sich ein überwältigendes Gefühl von Déjà-vu ein. Viel zu oft hatte man ihm in den letzten vier Jahrzehnten die Frage nach Pasenows Verbleib gestellt. Schließlich war er es ja gewesen, der die erste Kritik über jenes Talent veröffentlichte, das dann nach seinem Erstling so überraschend verstummt war und bis zum heutigen Tag hartnäckig schwieg. Auch seine Antwort auf diese Frage hatte Bergmann in all der Zeit nicht geändert. Er blähte die Backen auf und ließ durch die Mundwinkel lautlos Luft entweichen. Im Monitor zu seinen Füßen sah er sich bei dieser Grimasse zu, denn die Kamera hielt ihn weiterhin in einer Großaufnahme erfasst. Offenbar gab man sich mit seiner kurzen Antwort nicht zufrieden. Die Runde blickte ihn erwartungsvoll an.
„Hermann Pasenow ist für diejenigen, die sich seiner noch erinnern und auch für die Jungen, die ihn für ihre Generation gerade wiederentdecken, ein Autor, der in die Legende - ich bin beinahe gewillt zu sagen - in den Mythos reicht“, führte Bergmann weiter aus. Ja, dachte er dabei, vor fünfunddreißig Jahren, fast auf den Tag genau, begann die Lüge. Das war im August 1961.
Er sah kurz nach seiner Frau Hilde. Sie stand irgendwo bescheiden im Hintergrund des Studios, wie Bergmann wusste. Aber von seinem grell ausgeleuchteten Platz aus konnte er sie nicht entdecken.
„Das Pseudonym Pasenow, hinter dem sich bis heute erfolgreich der wahre Name dieses Autors verbirgt“, fuhr er fort, „weist nicht nur auf eine Romanfigur von Hermann Broch hin, sondern auch auf eine kleine Gemeinde mit diesem Namen auf halbem Weg zwischen Prenzlau und Neubrandenburg in der Nähe von Woldegk. Der Moment von Pasenows Verstummen, der mit der Zeit des Baus des ‚antifaschistischen Schutzwalls’ zusammenfällt, legt freilich den Verdacht nahe, er könnte aus diesem bäuerlichen Umfeld stammen oder habe doch zumindest im Arbeiter- und Bauernstaat gewohnt.“ Bergmann räusperte sich. „Jedoch sind Spekulationen müßig. Die einzige Person, die die wahre Identität Pasenows kannte, war der Verleger seiner ‚Blauen Schrift’, der alte Dr. Max Guttmann, der ein großer Mäzen und Freund der Literatur war. Guttmann weilt aber bedauerlicherweise schon lange nicht mehr unter uns. Ihm haben wir übrigens die Entdeckung einer ganzen Reihe von beachtlichen Talenten zu ver-danken, wie zum Beispiel …“
„Herr Bergmann, Sie haben eben die ‚Blaue Schrift’ erwähnt“, warf der Autor hastig ein, der ungeduldig auf ein Stichwort gewartet hatte, um sich selbst reden zu hören. Dadurch raubte er dem Kritiker die Möglichkeit, den Themenwechsel vorzunehmen, den er gerade vorbereitet hatte. „Wenn ich mich nicht irre, ist dies doch der einzige Erzählband des Autors, sechs oder sieben kurze Geschichten und eine Erzählung. Sie hatten, da sind wir uns in dieser Runde wohl einig, für die deutschen Schriftsteller der Sechziger und frühen Siebziger eine ähnliche Wirkung wie ‚under milk wood‘ von Dylan Thomas für den angelsächsischen Raum. Pasenow wagte sich in Bereiche der Sprache, die vor ihm niemand betreten hatte. Sein Deutsch war ein neues, ein unerhörtes.“
Bergmann zog säuerlich einen Mundwinkel breit, als hätte er einen schlechten Geschmack im Mund. Der Herr Autor macht sich wichtig, dachte er. Auch er ist nur ein Schwätzer, der Einbandtexte von sich gibt. Und diese selbstgerechte Schnepfe, die hier als Moderatorin fungiert, weiß auch nichts Besseres, als ihm zuzustimmen. Wahrscheinlich schläft sie mit dem Autor. Die Unterwürfige nickte gerade besonders eifrig:
„Nicht wahr? Ohne Pasenow wäre die deutschsprachige Literatur eine andere. Enzensberger, Plenzdorf …“, sie zögerte, suchte nach wohlklingenden Namen.
„Handke!“, fiel dem Autor ein.
„… ja, sogar Handke: Sie alle sind ohne die ‚Blaue Schrift’ nicht denkbar. Was meinen Sie, Herr Bergmann, warum hat Pasenow oder wer sich auch immer hinter diesem Namen verbarg - vielleicht war es ja eine Frau -, nach seinem durchaus einem Erdbeben vergleichbaren Erstling nie wieder etwas veröffentlicht?“
Bergmann sah hilfesuchend zu dem Verleger, der ihm der einzige Vernünftige in dieser Runde zu sein schien. Er hatte Lust, den beiden anderen den Kopf zu waschen und sie dem Publikum als die eitlen, dummen Schwätzer zu präsentieren, die sie in seinen Augen waren. Aber er war selbst Teil der Show und da fiel man den anderen nicht in den Rücken. Wohin sind sie nur verschwunden, dachte er wehmütig, all die gewandten, klugen Leute, die in und mit der Sprache lebten; die noch zu vollständigen und sinnvollen Sätzen mit einer gelungen Konjunktivkonstruktion befähigt waren? Deren Kritik keine Inhaltsangabe, sondern ein neues Kunstwerk war? Bin ich denn eines der letzten Exemplare einer aussterbenden Gattung? Lädt man mich deshalb so häufig zum Gespräch, damit man mich wie ein Museumsstück bestaunen kann? In Ermangelung eines Tisches klatschte Bergmann mit der flachen Hand auf den Oberschenkel. Er wollte mit einem Rundumschlag gegen die zeitgenössische Literatur im Allgemeinen, diesen aufgeblasenen Wichtigtuer von jungem Schriftstellertalent und das Fernsehen im Besonderen ausholen. Der Verleger, der bislang geschwiegen hatte, kam ihm zuvor. Er hob beschwichtigend die Hand:
„Sie irren, wenn Sie mutmaßen, Pasenow wäre für immer verstummt. Er hat nur - ich darf mal sagen - während der DDR aus Protest nicht veröffentlicht. Er war nicht einmal im Schriftstellerverband … und ich muss Sie enttäuschen, er ist durchaus keine Frau, sondern inzwischen ein netter, älterer Herr“, sagte Wismuth in seinem beiläufigen Plauderton, sich der Wirkung seiner Worte vollkommen bewusst. Er hatte den Autor der ‚Blauen Schrift’ eben nur ins Gespräch gebracht, um jetzt seine Bombe zum Detonieren zu bringen. Die Kamera, deren Auge bislang auf Bergmann geruht hatte, wandte sich gierig zu Wismuth, der sichtlich genoss, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Bergmann atmete schnaubend aus, rutschte aufgeregt in seinem Sessel nach vorn. Hätte er noch sein Gesicht im Monitor sehen können, der nun den Schnauzbart des Verlegers zeigte, hätte er sein plötzliches Erbleichen bemerkt.
Das weiß ich wohl besser, dachte er. Dieser Wismuth ist auch nur ein Angeber. Mit was für Menschen muss ich mich abgeben! Das ist das bisschen Geld nicht wert! Ich hatte Wismuth eigentlich anders eingeschätzt. Nun, den Zahn werde ich ihm ziehen …
„Das ist vollkommener Unsinn“, stellte er mit Nachdruck fest. Der Verleger sah überlegen zu ihm. Was er erwiderte, verschlug Bergmann die Sprache.
„Ich darf sagen, ich widerspreche Ihnen nur ungern. Aber ich will Ihnen mitteilen, dass Hermann Pasenow in den letzten Jahren einen Roman geschrieben hat. In der nächsten Ausgabe meiner Zeitschrift beginne ich mit dem - ich darf sagen - exklusiven Vorabdruck. Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich heute behaupte, dieser Roman sei das monumentale Tor, durch das die - ich darf das sagen - deutsche Literatur sich befreien und endlich ohne Ballast ins 21. Jahrhundert hineintreten kann.“ Bergmann richtete sich voller Wut auf.
„Das ist Unfug! Pasenow ist tot!“, schrie er heiser, beim Namen des Schriftstellers spuckte er zornigen Speichel. „Er ist tot!“ Das einzige Argument, das ihm auf die Schnelle einfiel, war eines, das er eben selbst in Abrede gestellt hatte. Wieder suchte er vergebens nach einem Blickkontakt mit seiner Frau. Das ganze Studio bestaunte den unmotivierten Wutausbruch des Kritikers. Wismuth lächelte mitleidig.
„Herr Bergmann, bei allem Respekt! Sie irren“, bestand er, „Hermann Pasenow ist - ich darf sagen - so lebendig wie Sie und ich. Wenn sie möchten, können Sie ihn kennenlernen. Er ist in der Stadt, ich glaube, sogar im gleichen Hotel wie Sie untergekommen. Ich darf sagen - er wird im Rahmen der Brechttage eine Lesung aus seinem neuen Buch halten.“ Wismuth wollte noch etwas hinzufügen, wahrscheinlich den Termin von Pasenows Lesung, aber er verstummte erschrocken. Bergmann stand auf. Er zielte mit seinem Zeigefinger wie mit einer Waffe auf den Verleger und trat einen Schritt nach vorn. Der Kopf des Kritikers glühte nun.
„Er ist tot“, wiederholte er schon schwächer. Er klang, als müsse er sich selbst von seinen Worten überzeugen. „Er ist schon vor vierzig Jahren gestorben.“ Bergmann machte noch einen Schritt. Er stolperte über ein Kabel zu seinen Füßen und wäre mit dem Kopf voran zu Boden gestürzt, wenn nicht der Autor gedankenschnell aufgesprungen und ihn gestützt hätte. Der Kritiker hing wie ein Sandsack in den Armen des jungen Mannes und sah verblüfft auf die Moderatorin, die eilige und ihm unverständliche Gesten in Richtung Regie machte. Gleichzeitig spürte er einen ziehenden, lästigen Schmerz in der Seite, es war ein Schmerz, der ihn schon lange nicht mehr heimgesucht hatte. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals.
„Sterbe ich?“ fragte er erstaunt und wurde ohnmächtig, bevor ihm jemand antworten konnte.
Claus M. Bergmann kniete wie in ein demütiges Gebet versunken vor der Minibar seines Hotelzimmers und kramte in ihrem Inhalt. Im trüben Licht der Nachttischlampe suchte er lange vergeblich. Endlich fand er versteckt hinter Piccolos und Gläsern verborgen eine kleine Flasche Kräuter-bitter.
„Goetheseidank“, stöhnte er und richtete sich schwerfällig auf. Seine Knie knirschten dabei vernehmlich. „Ich befürchtete schon, ich müsste hinun-ter in die Bar.“
Bergmann öffnete den Schraubverschluss der Flasche und erzeugte dabei ein ähnliches Geräusch wie jenes, das eben seine Gelenke gemacht hatten. Aufmerksam goss er die ölig braune Flüssigkeit in einen Zahnputzbecher. Dabei vermied er weiterhin den Augenkontakt mit Hilde, die schweigend auf dem Hotelbett saß. Er konnte sich ihren Blick gut vorstellen, ohne sich extra von ihm überzeugen zu müssen: Er war eine Mischung aus Vorwurf und Sorge. Ob wohl auch etwas Liebevolles in ihm lag? Er hoffte es, auch wenn er in Hildes Augen schon lange keine Zärtlichkeit mehr entdeckt hatte. Bergmann fragte sich flüchtig, welches Bild sie von ihm bewahrte, wie sie ihn sah, wenn sie ihn aufmerksam musterte; er wie jetzt ihren Blick auf sich lasten spürte. In der letzten Zeit hatte sich der anfänglich so unbedeutende Altersunterschied von gut zwanzig Jahren immer stärker zwischen ihn und seine Frau geschoben. Sie sah wahrscheinlich nur noch den alternden Mann, untersetzt, immer ein wenig schmuddelig; einen Gatten, der mit seinen sechzig Jahren ihr Vater hätte sein können, häufig missgelaunt war und an vielerlei Krankheiten laborierte. Noch vor kurzem hatte er sie mit wenigen Sätzen in einem Netz aus Worten und Bewunderung einfangen können. Doch inzwischen häufte sich ihr gleichgültiges Achselzucken.
Bergmann nahm einen vorsichtigen Schluck. Sofort lag scharfer Geschmack auf seiner Zunge. Er schüttelte sich und sah auf das Etikett der Flasche. St.-Afra-Balsam, las er. Dieses Gesöff war ja wider-wärtig! Es kostete ihn Überwindung, die Flüssigkeit zu schlucken. Wie er befürchtet hatte, brannte sie in seiner Speiseröhre, wärmte aber seinen Magen und half ihm, die Übelkeit in den Griff zu bekommen, die seit seinem Ohnmachtsanfall gegen die Kehle drückte. Das Telefon läutete. Unvorsichtig sah Bergmann auf und direkt in Hildes missbilligenden Blick, in dem er unausgesprochen die Verordnung seines Arztes lesen konnte, auf keinen Fall Alkohol zu sich zu nehmen. Während Hilde abhob und sich meldete, der Stimme in der Leitung lauschte und ein paar bestätigende Worte murmelte, nahm sie die anklagenden, dunklen Augen nicht von ihrem Mann.
„Er steht neben mir“, sagte sie und streckte Bergmann den Hörer hin. „Es ist deine Frau.“ Ja, Hilde war wütend. Nur wenn wirklich dicke Luft herrschte, bezeichnete sie Beate als ‚seine Frau’. Dabei hatte sich Bergmann zwei Jahre, bevor er Hilde kennenlernte, von Beate scheiden lassen. Andererseits hatte Hilde recht: So vollkommen hatte Beate die Trennung nie akzeptiert und sie gehörte weiterhin, nicht zuletzt wegen der Kinder, zu Bergmanns Familie, war ihm vielleicht mehr Familie als seine große Liebe, mit der er jetzt das Leben teilte. Während sich Bergmann voller Vorahnung meldete, sah er auf die Uhr. Es war inzwischen drei Uhr morgens. Es würde ihn einige Arbeit kosten, seine Exfrau zu beruhigen.
„Mein Gott, Claus! Ich war ja schon im Bett, aber Heinrich hat mich sofort angerufen, als er gesehen hat, wie du im Fernsehen zusammengebrochen bist. Was machst du denn für Sachen?“ Beates Stimme, die normalerweise schon schmerzhaft klirrte, klang aus dem Telefon noch gequetschter und höher als gewöhnlich. Bergmann hielt den Hörer etwas vom Ohr.
„Wie geht es Heinrich?“, fragte er erfreut. Der ‚grüne’ Heinrich, Jahrgang ’67, war der jüngere seiner beiden Söhne. Er hatte mit Ausnahme einer nichtssagenden Geburtstagskarte seit über einem Jahr nichts mehr von sich hören lassen. Der Gedanke, dass er seinen Vater im Fernsehen sah, schmeichelte Bergmann.
„Sag mal, wir machen uns wirklich Sorgen!“, erwiderte Beate leicht irritiert. Bergmann atmete einmal ein und langsam wieder aus, bevor er wiederholte, was er in den letzten Stunden sicherlich bereits zwanzigmal gesagt hatte:
„Das war nur ein kleiner Schwächeanfall, kein Grund zur Beunruhigung. Ich habe beim Griechen zu fett gegessen und es war sehr heiß im Studio … Hast du nicht gesehen, wie ich geschwitzt habe? … Nein, mein Blutdruck ist wieder in Ordnung, ich nehme doch … Die hatten einen Sanitäter, mir geht es wieder gut … Ja, ich gehe zum Arzt, wenn ich wieder zu Hause bin …“ Er betete seine Beruhigungslitanei herunter, ohne sich selbst zuzuhören oder auf Beates aufgeregte Nachfragen einzugehen. Dabei vermied er erneut, in Hildes Richtung zu sehen. Erst nach mehreren vergeblichen Anläufen gelang es ihm, das Gespräch zu beenden. Seufzend legte er den Hörer zurück aufs Empfangsteil. Er war jetzt sehr müde, aber die letzte Auseinandersetzung stand ihm noch bevor. Auf in den Kampf, dachte er und wandte sich an Hilde:
„Heinrich hat mich gesehen. Findest du das nicht auch interessant? Schließlich hat er sich noch nie für mich oder für Literatur interessiert. Kann man in Braunschweig diesen Sender überhaupt empfangen?“, schwatzte er ziellos und nahm noch einen Schluck vom Magenbitter. Hilde ging nicht auf den ungeschickten Versuch ein, das Thema zu wechseln.
„Jetzt bin ich dran, Claus“, stellte sie nüchtern fest. „Was also ist mit diesem Pasenow? Bist du nicht in dieser Ortschaft geboren?“
„Das ist ein seltsamer Zufall. Ich habe keine Erinnerungen mehr an Pasenow. Ich habe dir das doch schon einmal erzählt. Nach dem Krieg wurden meine Eltern enteignet und der Bauernhof einer LPG angegliedert. Wir zogen dann in den Westen. Ich war sechs oder sieben Jahre alt.“
„Warum hast du dich so aufgeregt wegen dieses Mannes?“
„Aber nein. Ich habe mich nur wegen Wismuth aufgeregt“, log Bergmann, „behauptet der doch einfach, Pasenow wäre noch am Leben. Dabei habe ich ihn selbst beerdigt.“
„Bitte?“
„Ich meine“, verbesserte sich Bergmann schnell, „ich war selbst bei seiner Beerdigung anwesend. Das ist jetzt fünfunddreißig Jahre her, kurz vor Friedrichs Geburt war das, im Sommer ’61.“ Friedrich war Bergmanns erster Sohn, der seit ein paar Jahren in Weißrussland lebte und dort einen Büromaschinen-handel betrieb. „Dieser neue Pasenow muss ein Hochstapler sein. Einen Roman soll er geschrieben haben. Das kann ich mir nicht vorstellen …“
„Du hast doch selbst behauptet, Pasenow lebe noch.“
„Da habe ich mich eben geirrt!“ Bergmann wurde wieder zornig. „Ich kann doch auch mal etwas vergessen. Pasenow ist tot und damit basta. Das war irgendeine Lungensache. Guttmann hat mich dann zu der Beerdigung eingeladen. Pasenow wurde verbrannt. Das Urnengrab lag in einem Friedhof in Dahlem, jetzt erinnere ich mich wieder. Wahrscheinlich hat man es längst platt gemacht; das ist schließlich schon ewig her.“ Er sah demonstrativ auf seine Uhr. „Und jetzt will ich in mein Bett. Es ist gleich halb Vier. Ich habe morgen Vormittag einen Termin mit einem Zeitungsmenschen.“ Er zögerte. „Du musstest ihn ja unbedingt auf elf Uhr bestellen. Dabei bin ich eigentlich nur Kritiker geworden, damit ich morgens ausschlafen kann“, fügte er hinzu und leerte sein Glas, verzog den Mund. „Nach dem Zeug brauche ich mir nicht mehr die Zähne zu putzen. Das schmeckt wie Mundwasser.“
Es gelang ihm nicht, Hilde aufzuheitern. Sie sah ihn skeptisch an, ergab sich aber. Sie wusste aus jahrelanger Erfahrung: Wenn ihr Mann ein Gespräch für beendet erklärte, dann hatte es keinen Sinn, weiter mit ihm zu diskutieren. Sie machte daher nur eine resignierende Handbewegung und verschwand beleidigt im Badezimmer. Bergmann stellte erleichtert das Glas auf die Anrichte und begann sich auszuziehen. Hatte sie ihm diese Geschichte abgekauft? Er bezweifelte es, aber er wusste, sie würde von sich aus nicht mehr über dieses Thema reden.
In der kurzen Nacht lag Claus M. Bergmann neben seiner Frau wach und lauschte ihrem schweren Atem. Es gab vieles, worüber er nachdenken musste. Bei Morgengrauen schlief er endlich ein und er hatte einen wirren Traum:
Er war fünf Jahre alt, ging eilig über den Bauernhof seiner Eltern. Die Mutter, die aber auch Beate war, rief ihn und schickte ihn mit einer Kanne zum Milch holen. Claus musste die Milch aus einem Brunnen schöpfen, der mitten in den Feldern stand. Hinten auf einer Anhöhe standen ein paar niederländische Windmühlen.
„Helpter Berge“, sagte er zu sich selbst.
Der Eimer, den er mit Mühe aus dem Brunnen zog, war leer. Claus sah sich um: Hoffentlich hatte das niemand bemerkt. Aber Max Guttmann stand neben ihm. Der alte Mann lachte ihn an und klopfte auf seine Schulter. Claus fürchtete sich. Das wollte er aber nicht zugeben.
„Ich schäme mich“, sagte er deshalb und wollte vor dem alten Juden davonlaufen, stolperte jedoch. Seine nun mit einem Mal volle Milchkanne kippte um, leerte sich. Ihr Inhalt lief den Weg hinab. Guttmann schüttelte den Kopf.
„Renn heim, du kriegst dein Kind“, sagte er traurig, „es ist hier im Hotel.“
Bergmann erwachte. Sein Herz schlug ihm wieder bis zum Hals. Er konnte sich deutlich an den Traum erinnern und er wusste auch, was ihn so erschreckt hatte. Diesen letzten Satz von Guttmann aus seinem Traum, den hatte gestern Wismuth zu ihm gesagt. Bergmann hatte ihn nur vergessen:
Pasenow war hier im Hotel.
Claus M. Bergmann nippte an seinem koffeinfreien Getränk, das Hilde in Ermangelung einer anderen Bezeichnung bei der Bedienung als ‚Kaffee‘ bestellt hatte. Wie er befürchtete, war das Gebräu zwar heiß, aber trotz der Süßstofftablette und der fettarmen Ersatzkaffeesahne aus Sojamilch eine geschmacklose, durchsichtige Brühe, die außer Sodbrennen nichts bewirkte und ihn persönlich beleidigte.
„Blümchenkaffee“, fiel ihm ein. Hilde, die ihm gegenüber saß, sah auf. „Ja, Blümchenkaffee. So hat meine Mutter das genannt“, erläuterte er, „weil man das Muster der Tasse durch den Kaffee hindurch-sehen kann. Ich habe heute Nacht von ihr geträumt, fällt mir ein, von meiner Mutter und den Woldegker Windmühlen.“ Obwohl Hilde wahrscheinlich nicht wusste, wovon ihr Mann sprach, fragte sie nicht nach. Bergmann nahm in einem Anfall von Masochismus noch einen Schluck „Blümchenkaffee“ und brauchte plötzlich jemanden, den er anschreien konnte. Aber mit seiner Frau konnte er nicht streiten; sie erschlagen, ja, das war ihm möglich. Aber mit ihr streiten, das ging nicht. Sie war hingebungsvoll damit beschäftigt, ihm ein Brötchen zu richten. Da sie keine Margarine bekommen hatte, strich sie eine homöopathische Menge Butter auf eine Hälfte, aus der sie vorher das wattene Innenleben herausgedreht und in den Behälter mit dem Tischabfall geworfen hatte. Anschließend wog sie skeptisch mit zwei Fingern einen Teelöffel Marmelade ab und verteilte diesen sorgfältig und gleichmäßig auf der Butter. Erst nachdem sie das Ergebnis ihrer Arbeit von mehreren Seiten begutachtet hatte, legte sie das Brötchen auf Bergmanns Teller, nickte ihrem Mann aufmunternd zu.
Nein, mit dieser Frau konnte er nicht streiten. Auf der Suche nach einem passenden Ersatz sah sich Bergmann um, doch er fand kein Opfer. Der Frühstückssaal des Hotels war so früh am Morgen beinahe leer. Obwohl die Sonne längst ihre Strahlen durch die hohen Fenster schickte, waren noch alle Lichter an und die Bedienungen richteten in aller Ruhe das Frühstücksbüfett. Aus der Küchentür drangen klappernde und klirrende Geräusche, es roch nach Kaffee und warmem Brot. Achselzuckend wandte sich Bergmann wieder zu Hilde und ertappte sie dabei, wie sie ihm eben das weiche Ei wegnahm, das er sich vorhin geholt hatte.
„Du willst mich verhungern lassen“, stellte er mit einem wehleidigen Blick auf die winzige Vollkorn-brötchenhälfte fest, die ihm seine Frau zum Früh-stück zugestanden hatte. ‚Ne müde Schrippe‘, hätte seine Mutter dazu gesagt. Früher war die Sprache eindeutig reicher. Hilde seufzte und unterbrach seine larmoyanten Gedanken.
„Muss ich dich jeden Morgen an deinen Cholesterinspiegel und deine Diabetes erinnern? Es ist nicht meine Schuld, wenn du nicht ausgeschlafen und schlecht gelaunt bist. Ich jedenfalls wollte nicht schon um sieben Uhr aufstehen.“ Sie zögerte. „Und vergiss nicht, deine Tabletten zu nehmen“, fügte sie hinzu. Jetzt war Bergmann nahe daran, sie wirklich zu erschlagen, hier am Tisch, mit der hässlichen Messingvase, in der eine Plastikblume verstaubte.
„Als alter Mann braucht man nicht mehr so viel Schlaf“, wiegelte er stattdessen ab und nahm das halbe Brötchen in die Hand, um nicht in Versuchung zu geraten, nach dem Mordinstrument zu greifen. Hilde gähnte verstohlen in die Hand. Trotz dieser Geste waren ihr die wenigen Stunden Schlaf kaum anzumerken. Sie wirkte frisch und gesund. Es verblüffte ihren Mann immer wieder, wie sie es schaffte, durch einen kurzen Badezimmeraufenthalt zehn Jahre jünger zu werden. Er konnte sich gut vorstellen, dass er momentan den gegenteiligen Eindruck erweckte und gerade an den fünfzehn Jahre älteren Martin Walser erinnerte, dem er recht ähnlich sah. Auch wenn Walser faltiger war und wesentlich mehr Haare auf dem Kopf hatte, wurden die beiden häufig miteinander verwechselt. Hilde hatte recht: Ein längerer Schlaf nach dieser fürchterlichen Nacht hätte ihm gutgetan. Aber nachdem sich Bergmann an Wismuths Bemerkung erinnert hatte, Pasenow wäre hier im Hotel abgestiegen, war es ihm unmöglich gewesen, länger im Bett liegen zu bleiben.
Er sah sich wieder in dem Saal um. Er musste nur warten. An einem dieser Tische würde der Hochstapler früher oder später Platz nehmen. Damit Bergmann ihn erkennen konnte, hatte er nur noch herauszufinden, an welchem Tisch der falsche Pasenow sitzen würde. Das festzustellen, würde ihm nicht schwerfallen, schließlich war dies ein ordentliches Hotel: Auf jedem Tisch befand sich eine Platzkarte, auf die der Name und die Zimmernummer der Hotelgäste geschrieben waren.
„Wann kommt noch mal der Reporter wegen des Interviews? Ich will schließlich vorbereitet sein“, fragte Bergmann, einen noch im Bett geschmiedeten Plan in die Tat umsetzend. Hilde reagierte, wie er es von ihr erwartete.
„Um halb elf Uhr, wir haben noch viel Zeit. Es ist eine gewisse Magda Mayer-Reischl von der AZ. Hast du die Fragen, die sie dir stellen will, schon gelesen?“ Bergmann schüttelte harmlos den Kopf und biss in sein mageres Frühstück. „Das dachte ich mir schon. Ich habe sie hier.“ Hilde schob ihrem Mann ein Blatt Papier zu, das sie aus ihrer dünnen Aktenmappe zog, die sie immer mit sich trug, wenn sie für ihn die Sekretärin spielte. „… das Übliche“, fügte sie hinzu.
Erst beiläufig, dann ernsthaft die Stirn runzelnd suchte Bergmann seine Lesebrille, dabei überzeugend den zerstreuten Professor spielend. Hilde verfolgte stumm sein vergebliches Mühen. Als sie ihn lange genug hatte forschen lassen, fragte sie resignierend:
„Hast du die Brille denn im Zimmer liegen lassen?“
Es klang wie eine Feststellung. Das war ein wichtiger Moment. Jetzt durfte Hilde keinen Verdacht schöpfen. Er musste glaubwürdig klingen.
„Ja, ich denke, sie liegt noch im Bad. Dort sind auch meine Tabletten. Holst du sie mir schnell?“ fragte Bergmann unschuldig. Tatsächlich hatte er die Brille vorhin heimlich in die Innentasche seines zweiten Jacketts geschoben. Dort würde Hilde sie schon finden, wenn sie ein wenig suchte. Auf jeden Fall verschaffte ihm diese List genügend Zeit. Ohne eine weitere Bemerkung stand Hilde in ihr Schicksal ergeben auf. Beim Hinausgehen warf sie ihrem Mann jedoch einen strafenden Blick zu. Bergmann tat so, als hätte er ihn nicht bemerkt. Er nahm noch einen Schluck von seinem dünnen Kaffee-Ersatz, um den trockenen Bissen im Mund aufzuweichen. Dann zählte er langsam bis zehn, nahm als Alibi seinen Teller in die Hand und folgte seiner Frau. Er sah aus der Tür, vergewisserte sich, ob Hilde noch vor der Fahrstuhltür stand. Erst dann suchte er systematisch die Tische in dem großen Raum ab. Nach längerer Suche fand Bergmann den Namen „HR. PASENOW“ und die Zimmernummer „312“ auf der Karte eines Tisches am Fenster, den er von seinem Platz aus gut im Auge behalten konnte. Sein Rückweg führte ihn am Büfett vorbei, wo er schnell im Stehen ein paar Wursträder in den Mund stopfte. Es war ihm egal, wenn er dabei von einigen überraschten Augenpaaren beobachtet wurde, denn der vollkommene Fettverzicht, zu dem ihn der Arzt und Hilde seit seinem Herzanfall vor zwei Jahren zwangen, hatte ihn süchtig nach Fleisch und Speck gemacht.
Er saß längst wieder auf seinem Stuhl und trug eine harmlose Miene, als Hilde zurückkam. Sie reichte ihm die Tablettenbox und die Lesebrille, ohne eine Bemerkung zu machen, wo sie sie gefunden hatte. Sie hatte sich auch an der Rezeption eine Tageszeitung besorgt, die sie nun auf ihrem Platz studierte.
„Machst du mir die zweite Hälfte auch?“, fragte Bergmann, um Zeit zu schinden, obwohl er absolut keinen Appetit auf ein weiteres trockenes Brötchen hatte. Hilde legte ihre Zeitung gehorsam beiseite und griff in den Brotkorb. Bergmann setzte zufrieden seine Lesebrille auf und nahm das Blatt mit den Fragen in die Hand, das die Reporterin bereits gestern an der Rezeption abgegeben hatte. Auch wenn die Fragen nicht gerade vor Originalität sprühten, wusste Bergmann diese Geste, aus der Professionalität sprach, zu schätzen. In den ungezählten Interviews, die er in den letzten zwanzig Jahren gegeben hatte, seit er als Literaturkritiker selbst zu einer Persönlichkeit der Zeitgeschichte geworden war, hatte er jede dieser Fragen schon häufig beantwortet. Er war längst in dem Alter, in dem sich alles wiederholte und gefühlt alle drei Monate Weihnachten war. Trotzdem gab sich Bergmann beschäftigt, nahm einen Kugelschreiber aus seiner Jackentasche und machte sich Notizen auf dem Blatt. Dabei sah er immer wieder hinüber zu dem leeren Tisch am Fenster. Obwohl sich der Frühstückssaal nun füllte, ließ Pasenow lange auf sich warten. Dieser Hochstapler konnte es sich offenbar leisten, in den Tag hinein zu schlafen. Hilde beschäftigte sich wieder mit der Zeitung, in der sie offenbar einen interessanten Artikel gefunden hatte, den sie mit hochgezogenen Augenbrauen studierte.
Dass sich dann doch jemand auf Pasenows Platz setzte, bemerkte Bergmann zuerst nicht. Dann zuckte er erschrocken zusammen, bemühte sich, nicht allzu auffällig auf den Mann zu starren, der gerade der Bedienung zum Beweis, dass er hier rechtmäßig saß, seinen Zimmerschlüssel zeigte. Er schien sich unbeobachtet zu fühlen. Einmal sah er auf, aber sein Blick ging gleichgültig über Bergmann hinweg. Der vorgebliche Pasenow war im Alter des Kritikers und seine Erscheinung alles andere als eindrucksvoll: Er hatte ein flaches Dutzendgesicht, das wacklig auf einem langen Hals thronte. Er war ein dürrer, fast ausgezehrt wirkender Mann, dem der schwarze Rollkragenpulli und die graue Stoffhose, die er trug, viel zu weit waren. Bergmann war ihm noch nie in seinem Leben begegnet, da gab es für ihn keinen Zweifel. Er fühlte sich betrogen. Dieser unscheinbare Wicht spielte also den großen Schriftsteller, der mit seinem Herzblut die ‚Blaue Schrift‘ geschrieben hatte und danach verstummt war.
Wegen diesem Hampelmann hatte ich gestern fast einen Herzinfarkt, dachte er. Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Aber er würde diesen Kerl bloßstellen, das Interview später bot ihm dazu die beste Gelegenheit. Er brauchte nur noch einen Beweis. Und plötzlich wusste er auch, wie er ihn bekommen würde. Bergmann wartete, bis Pasenow aufstand und zum Büfett trat, das um eine Säule herum aufgebaut war. Jetzt musste er schnell handeln.
„Ich gehe mal auf die Toilette“, erklärte er seiner Frau, die ihm kaum zuhörte. Hoffentlich sah sie ihm nicht hinterher, denn dann würde sie den seltsamen Umweg bemerken, der ihn direkt an Pasenows Tisch vorbeiführte, auf dem dieser wie die meisten Gäste seinen Zimmerschlüssel deutlich sichtbar liegengelassen hatte.
Nachdem Bergmann das Zimmer 312 von innen verriegelt hatte, lehnte er noch eine Weile mit dem Rücken gegen die Tür. Das Verriegeln war natürlich ein vergebliches Mühen, auch wenn er den Schlüssel stecken ließe. Aber es vermittelte ihm ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit. Er wartete, bewusst langsam atmend, bis sich sein Pulsschlag, den er mahnend am Hals pochen spürte, wieder verlangsamte.
Solche Unternehmungen sind meiner Gesundheit absolut nicht zuträglich, dachte er, ‚und meinem Ruf auch nicht. Was ist nur in mich gefahren?’ Freilich kokettierte er nur mit dem Schuldgefühl: Tatsächlich war er stolz auf seine Chuzpe. Er fühlte sich jung und unternehmungslustig. Dabei wunderte er sich, wie leicht es ihm gefallen war, in diesem Zimmer einzubrechen. Hoteldiebe hatten offenbar keinen allzu schweren Beruf. Vielleicht sollte er umsatteln. Einbrüche waren bei weitem lukrativer und unterhaltsamer, als einen unerfreulich fetten neuen Roman von Bodo Kirchhoff zu bekritteln.
Niemand hatte eben im Speisesaal bemerkt, wie er den Schlüssel vom Tisch aufnahm und eilig in seine Hosentasche schob, weder der falsche Pasenow, der halb verdeckt von der Säule mit sich rang, welcher Marmeladensorte er den Vorzug geben sollte, noch eine der Bedienungen, die Tee und Kaffee austrugen. Der Schlüssel war wie ein Bleigewicht in Bergmanns Tasche gelegen und er hatte jeden Moment erwartet, auf seine Tat angesprochen zu werden. Vorsichtig hatte er sich den Weg zwischen den Tischen zum Ausgang des Frühstückssaals gebahnt. Dabei war er auch knapp an Pasenow selbst vorbei-gekommen, der ihn wie vorhin keines Blickes für würdig erachtet hatte. Bergmann hatte dann schnell die Lobby gequert und war mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock gefahren. Auch hier lachte ihm das Glück: Der lange Gang war leer, der Wagen des Zimmerservices mit Putzsachen und den frischen Handtüchern stand noch weit vorn auf dem Hotelflur. Das schwierigste Unterfangen war es gewesen, mit seiner zitternden Hand das Schloss der Nummer 312 aufzusperren.
Aber jetzt befand sich Bergmann im Hotelzimmer seines Feindes, wie er Pasenow inzwischen in Gedanken bezeichnete. Viel Zeit würde ihm nicht bleiben, es zu durchsuchen, vielleicht ein paar Minuten, nicht länger. Wahrscheinlich würde Pasenow den fehlenden Schlüssel bald bemerken und nach dem Rechten sehen. Die Zimmerflucht war geschnitten wie seine eigene. Bergmann fand sich in einem kurzen Gang wieder, links führte eine Tür ins Badezimmer, rechts stand ein Spiegelschrank. Kurzentschlossen sah Bergmann in das Möbel, in dem Pasenow seine Kleidung bewahrte. Der Hochstapler hatte sie sauber übereinander gelegt und ordentlich aufgehängt, sie roch jedoch muffig und aufdringlich nach billiger Seife. Im unteren Fach lag eine leere Reisetasche. Hier war auch ein kleiner Safe in die Rückwand eingelassen, der, wie Bergmann von seinem eigenen Zimmer wusste, mit einem Zahlenschloss gesichert war. Da er gehofft hatte, der Hochstapler würde seinen Ausweis offen herumliegen lassen, war er enttäuscht. Hoteldieb war vielleicht doch kein so toller Beruf. Bergmann verzichtete auf einen Blick ins Bad und ging in den Hauptraum. Hier standen neben einem Doppelbett, das nur auf einer Hälfte bezogen war, eine Anrichte mit einem kleinen Fernseher und nahe an der Balkontür ein Schreibtisch, an den Bergmann nun zufrieden nickend trat. Auf ihm lagen ein Ledermappe mit dem Briefpapier des Hotels, ein schmales Taschenbuch … und ein dickes Manuskript!
Bergmann rieb sich aufgeregt die Hände. Er hatte gefunden, was er suchte. Er warf den Zimmerschlüssel, den er nicht mehr brauchte, auf das Bett und beugte sich über den Schreibtisch. Das Taschenbuch, das dort lag, erkannte er sofort an seinem Umschlag. Es war die ‚Blaue Schrift’ in einer inzwischen antiquarischen Ausgabe aus den Sechziger Jahren. Zärtlich nahm der Kritiker das Werk in die Hand und schlug es auf. Er hatte gehofft, auf der ersten Seite einen Stempel oder eine Widmung zu finden, wurde aber enttäuscht. Schnell blätterte er den dünnen Band mit dem Daumen durch. Dabei blieb er an einem Text hängen, den der vorgebliche Pasenow oder ein anderer Leser mit Kugelschreiber dick unterstrichen hatte. Bergmann hasste die Angewohnheit, vermeintlich interessante Stellen zu markieren. Normalerweise war es ihm unmöglich, Bücher, die solchermaßen verunstaltet waren, in die Hand zu nehmen. Sie erschienen ihm wie vergewaltigt. Diese Stelle jedoch las er:
„heimat ist erinnerung ein ort an dem ich verweilen und ruhen kann sie ist der platz zwischen dem abend und der nacht ein trügerisch grauer ort weithin verschwimmen die umrisse der wogenden getreidefelder aber die vom walde aufsteigende kühle hat mich nicht erreicht hier sitze ich der ich noch keine schatten kenne und lausche den büschen die leise von stille und dauer erzählen. alle konflikte finden ihr ende und der morgen das morgen ist fern.“
Bergmann hätte umblättern müssen, um weiterzulesen. Doch das brauchte er nicht. Er konnte den Rest auswendig hersagen:
„Die Vergangenheit ist in mir geborgen. Sie hat Erbarmen mit mir. Sie ist ein sicherer Ort. Gestern ist die Heimat, in der ich leben will“, flüsterte er und legte das Buch zufrieden zurück an seinen Platz.
Heute würde ich das kitschig nennen, aber vor fünfzig Jahren … ja, da habe auch ich noch so empfunden, stellte er in Gedanken fest. Jetzt nahm er das dicke Geheft in die Hand, das aus etwa fünfhundert einseitig beschriebenen A4-Blättern bestand, die ganz offensichtlich mit Hilfe einer mechanischen Schreibmaschine getippt und mehrmals handschriftlich überarbeitet waren. Aber Herr Pseudo-Pasenow, dachte Bergmann lächelnd, den schweren Pack prüfend in der Hand wiegend‚ wer macht denn noch so etwas? Aus welchem Jahrhundert stammen Sie denn? Heute gibt es doch Computer.
Auf der Titelseite des Manuskripts stand handschriftlich:
D i e B r u n n e n d e r N a c h t
Roman von Hermann Pasenow
Bergmanns Hände begannen wieder zu zittern.
„Hermann Pasenow“, sagte er und lauschte dem Klang. Gerade hatte er sich noch über den Schriftsteller lustig gemacht, der Pasenow so unverfroren wieder zum Leben erweckte. Aber als er den Titel des Buches und den Namenszug darunter las, stieg eine vage Erinnerung in ihm auf. Nein, Erinnerung war das falsche Wort. Es war nur ein flüchtiger Eindruck, ein Geruch, ein Geräusch oder eine Farbe, ein vertrautes Gesicht, das er lange nicht mehr gesehen hatte, aber nicht zu greifen wusste, ein Traumgesicht, das er vergessen hatte, aber noch schmecken konnte. Ihm war, als wäre er dabei, heimzukehren. Er stand schon an der Pforte. Drei Granitstufen trennten ihn noch von Zuhaus, drei Stufen und eine schwere Holztür, die in den Flur des Klinkerbaus führte. Davor standen die schweren, hohen Stiefel des Vaters. Ein weiches, warmes Gefühl machte sich in ihm breit. Vielleicht war dieser falsche Pasenow doch ein ordentlicher Autor. Anstatt mit seiner Beute zu verschwinden, was er eigentlich im Sinn hatte, blätterte Bergmann neugierig eine Seite weiter und begann zu lesen:
1. Kapitel
Ich sehe durch das Fenster hinaus auf die leere Straße. Ihr Schnee ist rostig braun verfärbt. Er erinnert mich an geronnenes Blut. Die Nacht hat das getan. Sie nahm dem Schnee die Unschuld.
Das milchige Licht dieses Morgens bringt es an den Tag. Die Nacht stahl Leben. Ein abgeschmacktes Wortbild kommt in meinen Sinn: Die Stunden der Nacht sind mir wie Sand zwischen den Fingern zerronnen. Sie sind ein Brunnen, aus dem zu oft geschöpft wurde.
Der Fokus meines Blicks ändert sich. Nun sehe ich nicht mehr den vom Pulver der Knaller und Raketen gefärbten Schnee, sondern mich selbst: Ich erscheine gespensterhaft im Spiegel der Fensterscheibe. Mitleidig nicke ich mir zu. Denn wir hatten nur wenig Zeit. Wieder und wieder versuchte ich mein Glück. Jedes Mal scheiterte ich. Nur dieser frühe Morgen ist übrig, der erste eines neuen Jahres, der letzte meines Lebens.
Ich bin alt geworden in dieser Nacht. Der zitternde Fensterspiegel schönt die Falten nicht. War mein schütteres, weißes Haar nicht gestern noch dunkel? Kann sich ein Haupt über Nacht verfärben oder ist das eine Legende der Dichter?
Der Kritiker in Bergmann hob Einhalt gebietend seine Hand und warf ihn unsanft aus dem Lesefluss. Schon lange war es ihm nicht mehr möglich, einen literarischen Text einfach nur so zu lesen. Die ‚professionelle Deformation’ war zu weit fortgeschritten. Denn was er da las, war nach dem vielversprechenden Titel enttäuschend. Es war nicht unbedingt schlecht geschrieben und ähnelte der Sprache der ‚Blauen Schrift’, es war aber auch nicht gut. Der Anfang eines Buches ist entscheidend, dachte Bergmann, wenn die ersten Sätze stimmen, ist der Roman schon fast geschrieben, alles Weitere machen Fleiß und Zeit. Der Anfang muss eine Mausefalle sein, er soll den Leser fassen und darf ihn für zweihundert atemlose Seiten nicht mehr loslassen. Und es ist ein Gerücht, dass Mäuse Käse mögen; sie wollen Süßes. In dieser Mausefalle liegt allerdings nur Käse. Wie hat Wismuth es so schön formuliert: Das also soll, darf ich sagen, das Tor sein, darf ich sagen, durch das die deutsche Literatur ins, darf ich sagen, neue Jahrtausend tritt?
„Ach, wie bin ich all des Unzulänglichen müde, das durchaus Ereignis sein soll!“, zitierte Bergmann laut Nietzsche. Diesen Spruch hatte er für den häufigen Fall auswendig gelernt, wenn ihm jemand ein schlechtes Buch als Großtat anpries. „Und wer von den Dichtern hätte nicht seinen Wein verfälscht? Manch giftiger Mischmasch geschah ihn ihren Kellern, manches Unbeschreibliche ward da getan,“ fuhr er fort und klappte das Manuskript lautstark zusammen, „ach, wie bin ich der Dichter müde …“
„Amen. Und könnten Sie mir jetzt bitte verraten, was Sie hier in meinem Zimmer zu suchen haben?“
Bergmann sah unwillig auf. Er mochte es nicht, mitten in seinen klugen Gedanken unterbrochen zu werden. Er war in einem Alter und in einer Position, in denen er unbedingte Aufmerksamkeit fordern durfte. Erst als er den anderen sah, erschrak er. Der falsche Pasenow stand im Zimmer, einen Zweitschlüssel in der Hand. Gerade trat er zum Telefon, nahm ab.
„Ich werde die Polizei rufen. Und legen Sie das bitte weg!“ Er deutete mit dem Telefonhörer auf das Manuskript in Bergmanns Händen. Dessen Gedanken rasten. Wie konnte er aus dieser Misere entkommen, in die er sich so leichtsinnig manövriert hatte? Seine Idee, in Pasenows Zimmer herumzu-wühlen, erschien ihm mit einem Mal überhaupt nicht mehr brillant. Was würde Hilde sagen?
„Bitte tun Sie das nicht. Sie machen einen Fehler. Ich muss mit Ihnen reden“, beeilte sich Bergmann zu antworten und entschied sich zu einer Flucht nach vorn. Pasenow zögerte und kniff die Augen zusammen. Erst jetzt schien er sich den Mann in seinem Hotelzimmer genauer anzusehen. Dann hob er überrascht beide Augenbrauen.
„Ich kenne Sie. Sie habe ich gestern im Fernsehen gesehen“, sagte er zögernd. Bergmann nickte eifrig. „Sie sind dieser Kritiker, der behauptet hat, ich sei tot. Sie sind …“
„Claus M. Bergmann, Sie haben schon von mir gehört“, stellte der Kritiker sich vor und verbeugte sich sogar dabei leicht, das Manuskript hielt er aber weiter fest in seinen Händen. Es war eine Beute, die er nicht so schnell wieder hergeben wollte.
„Claus M. Bergmann, genau … und das hier, in meinem Hotelzimmer, welch eine Ehre für einen armen Autor.“ Pasenow runzelte die Stirn und lachte auf. „Was ich Sie schon immer fragen wollte: Wofür steht eigentlich das M. in Ihrem Namen?“
„Das weiß ich auch nicht so genau. Das M. ist eine Erfindung der ersten Zeitung, für die ich arbeitete, das hat dann später jeder abgeschrieben. Inzwischen ist es offiziell, es steht auch so im Brockhaus. Dort ist zu lesen, das M. kürze ‚Maria’ ab, aber ich denke, es bedeutet einfach ‚Mittelinitial’“, erklärte Bergmann ausführlich und musste plötzlich selbst lachen. Er sah dem vorgeblichen Pasenow in die Augen und dieser war ihm sympathisch. Welch eine seltsame Fügung: Da stand er auf frischer Tat ertappt in einem fremden Hotelzimmer und antwortete auf eine Frage, die ihm noch nie jemand gestellt hatte, niemand in all den Jahren, in all den Interviews, den Diskussionen und Briefen. Pasenow stimmte unsicher in das Lachen ein, sah dabei auf den Telefonhörer, den er noch in der Hand hielt. Dann legte er ihn nachdrücklich auf die Gabel und fragte ernst:
„Was also wollen Sie von mir? Ein richtiger Einbruch ist das hier doch nicht. Sie haben sich wahrscheinlich den ärmsten Mann im ganzen Hotel als Opfer herausgesucht. Wollen Sie meinen Roman als Erster kritisieren? Wissen Sie, das sind aber seltsame Methoden, die Sie da haben.“ Bergmann hätte diese Vermutung bejahen und eine einfache Geschichte erfinden können. Damit hätte er sich vielleicht herausgewunden. Plötzlich spürte er wieder das Gewicht des Manuskripts in seinen Händen. Er entschied sich für die Wahrheit.
„Ich wollte eigentlich nur mit Ihnen reden“, sagte er bestimmt, “Sie mögen zwar ein Autor sein, aber Sie sind nicht Hermann Pasenow, der die ‚Blaue Schrift’ geschrieben hat.“
„Weil ich tot bin, nicht wahr?“, lächelte Bergmanns Gegenüber, wirkte aber verunsichert.
„Nein. Weil ich Hermann Pasenow bin“, erwiderte Bergmann einfach.
Das Kind läuft über einen staubigen Feldweg nach Hause. Der Junge ist erst sechs Jahre alt, aber schon im nächsten Monat wird er sieben. Eigentlich ist er damit schon sieben, also bald erwachsen. Er pfeift ein Lied und schlägt im Vorbeigehen mit seinem Stock gelbe Löwenzahnblüten von ihren Stängeln. Das Schwert trennt die Köpfe der feindlichen Ritter von ihren Hälsen. Auch der Stock pfeift dabei sein Lied.
Es ist ein ungewöhnlich heißer Tag im Mai, die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel. Das Kind war mit Freunden unten am Weiher. Erst badeten sie, dann legten sie sich auf die Rücken und walzten, sich gegenseitig jagend, Wege durch das hohe Gras. Erst nachdem die Bremen allzu lästig und zornig stachen, beendeten sie ihr Spiel. Jetzt riecht der Junge nach Wiese. Seine Haut ist gerötet, zerkratzt und sie juckt. Aber das stört ihn noch nicht. Er hat nur Hunger. Heute gibt es Grießklöße mit Backpflaumen. Mutter hat es versprochen.
Das Kind kommt den Weg herauf, rennt am Stall und am Brunnen vorbei, schleudert in einem letzten Angriff gegen die Feste seiner Widersacher den Stock in die Brennnesseln. Es läuft über den Hof. Dort, neben den grauen Stufen vor dem roten Haus steht der Vater mit drei Männern. Sie reden laut miteinander. Wenn Erwachsene das tun würden, würde das Kind meinen, sie stritten sich. Einen der Männer kennt der Junge: Es ist ein Nachbar, früher trug er dauernd ein schwarzes Hemd, inzwischen aber ein blaues. Die anderen beiden sind vielleicht mit dem Auto gekommen, das in der Auffahrt steht. Der Junge ist stolz auf den Vater. Wichtige Leute reden mit ihm. Bei der Gruppe angekommen, bleibt er neben dem Vater stehen und schmiegt sich an seine Seite.
„Geh ins Haus“, sagt der Vater, „das ist nichts für dich.“
Das Kind stapft mit den nackten Füßen in eine Pfütze vor dem Haus. Der Schlamm schmatzt, wenn es die Beine hebt. Es nieselt. In diesem Jahr ist der Sommer nass. Der Junge weiß, das ist schlecht für die Ernte. Ein Lieferwagen fährt die Auffahrt hoch. Am Zaun vorne stehen und gaffen ein paar Leute. Auch seine Freunde sind dabei. Aber eigentlich, so hat er beschlossen, sind sie überhaupt keine Freunde. Er streckt ihnen die Zunge heraus. Vater trägt schon den ganzen Vormittag mit dem Nachbarn im blauen Hemd Möbel aus dem Haus. Mutter steht plötzlich neben dem Kind.
„Verabschiede dich, Claus“, sagt sie, sie sagt aber nicht, von wem. Der Junge beschließt, sich von den Hühnern zu verabschieden und zur Korthals-Oma geht er auch, die wohnt gleich nebenan. Die gibt ihm ein Bonbon, das sie selbst gemacht hat.
Berlin ist eine große Stadt. Die Wohnung ist aber ganz klein. Berlin ist eine laute Stadt, viele Menschen gibt es hier, jedoch bekommt man wenig zu essen. Die Kinder im Hof werfen mit Steinen nach dem Jungen und sie lachen, weil seine Schnürsenkel immer offen sind. Vom ’jwd’ ist er, sagen sie, ‘eine Pommeranze’. Mutter ist in der letzten Zeit sehr bleich geworden. Sie arbeitet viel in einer Änderungsschneiderei.
„Nein, Claus, wir gehen nicht heim. Das hier ist unser Zuhause. Am Sonntag machen wir einen Ausflug. Dort gibt es auch eine Windmühle wie daheim und ein richtiges Schloss. Da wohnte der Alte Fritz; der war mal unser König. Wir können ein Stück mit der S-Bahn fahren.“
Der Junge wird älter, gewöhnt sich an die Stadt. Sie ist nicht mehr so groß, seit der Vater Arbeit in den Borsig-Werken gefunden hat und die Familie im französischen Sektor in Tegel wohnt. Wenn der Junge aufs Rad steigt und den Waidmannsluster Damm hinunterradelt, an der ‚Freien Scholle’ vorbei, dann nennt sich Tegel plötzlich Lübars und es ist dort ein bisschen wie in Pasenow.
Die Sehnsucht ist ihm geblieben. An vielen Abenden macht sie ihm die Brust eng. Mit sechzehn, siebzehn beginnt er über sie zu schreiben. Sie ist der Brunnen, aus dem er seine Kunst schöpft. Mit dem echten Ort hat das nichts mehr zu tun, er interessiert ihn auch kaum mehr. Obwohl er die Gelegenheit hat, ihn zu besuchen, denn noch ist die Grenze nicht geschlossen, fährt er nie dort hin. Er würde nur enttäuscht werden. Er meint auch, es seinen Eltern schuldig zu sein, die nie über ihren alten Hof reden.
Der junge Mann besucht die Humboldt-Universität, abends geht er ins Theater. Er lernt Dr. Guttmann kennen, einen der wenigen jüdischen Emigranten, der wie Arnold Zweig oder Stefan Heym zurückkehrt ist. Max Guttmann hält Vorlesungen über Literaturgeschichte und Rhetorik. Er ist ein väterlicher Freund. Ihm zeigt Claus in einem kühnen Moment seine Texte über die verlorene Heimat. Über Guttmanns Verbindungen, der mit Stephan Hermlin und Anna Seghers befreundet ist, gelingt es ihm, einen Band seiner lyrischen Texte anonym in einem kleinen Westverlag zu veröffentlichen. Was liegt näher, als sich ‚Pasenow’ zu nennen?
Überraschend bekommt er eine Volontariatsstelle beim ‚Tagesspiegel’. Durch seinen gewandten und humorvollen Stil wird er zu einer Größe im Feuilleton. Er bricht das Studium ab, wird festes und bezahltes Mitglied der Redaktion, schreibt Kritiken und Glossen. In dieser Zeit entfremdet er sich von Guttmann.
Obwohl er als Zeitungsschreiber recht erfolgreich ist, verkauft sich sein liebstes Kind schlecht, eine distanzierte Kritik des Erzählbandes in der NDL erscheint wirkungslos. Da kritisiert sich Claus kurzentschlossen selbst. Plötzlich ist die ‚blaue Schrift’ in Westdeutschland ein Erfolg. Jetzt kann er nicht mehr zugeben, sich selbst gelobt zu haben. Das Pseudonym beginnt ein Eigenleben. Max Guttmann, der einzige Mitwisser, hält bis zu seinem Tod still. Claus beginnt einen Roman, mit er nicht so recht vorwärtskommt.
1958 stirbt der Vater, sechs Monate später die Mutter. Claus lernt während eines Urlaubs in Österreich Beate kennen. Die beiden heiraten. Weil das Geld knapp ist, zieht das Paar zu ihren Eltern in den Westen nach Frankfurt, wo Claus bei der ‚Rundschau’ arbeitet. Bald ist Beate schwanger, der ältere Sohn, Friedrich, kommt im August 1961 auf die Welt.
Claus Bergmann schreibt nie wieder ein literarisches Buch. Die Brunnen seiner Inspiration ist versiegt. Es ist ihm peinlich, wenn er auf Pasenow angesprochen wird.
Claus M. Bergmann war als erster am verabredeten Platz. Es hatte ihm keine Schwierigkeiten gemacht, den Ort zu finden, den ihm Werner Studenrecht beschrieben hatte. Das war der echte Name jenes Schriftstellers, der sich überall unverfroren als Hermann Pasenow ausgab. Der Treffpunkt war eine Parkbank unter einem martialischen Kriegerdenkmal im Dompark in der Nähe des Hotels. Das hinter Büschen und hohen Akazien schamhaft verborgene Denkmal war wahrscheinlich nach dem deutsch-französischen Krieg errichtet worden, denn es zeigte eine siegreiche Germania, die triumphierend ihr bluttriefendes Schwert zurück in die Scheide steckte. Zu ihren Füßen und um den Sockel herum tanzten schwerbewaffnete Putten zwischen Kanonen und anderen Militaria. Geschmackloser ging es wohl nicht mehr! Bergmann machte sich nicht erst die Mühe, die heroischen Inschriften zu entziffern. Er schlenderte langsam auf einem Kiesweg rund um das Denkmal und suchte sich die von der Sonne beschienene Bank, auf der er auf Studenrecht warten konnte. Vom nahen Dom schlug es dreiviertel zwölf Uhr. Wenn der Hochstapler ihn nicht so genau kopierte, dass er ebenso überpünktlich war wie Bergmann selbst, dann hatte der Kritiker noch eine Viertelstunde, seine Gedanken zu ordnen und zu einer Entscheidung zu kommen. Trotz der Mittagsstunde war es recht einsam am Denkmal. Ab und an schob eine Mutter einen Kinderwagen an Bergmann vorbei. Er hielt die Augen geschlossen, genoss die milde Maisonne und dachte über sein weiteres Vorgehen nach.
Eigentlich war alles sehr gut verlaufen: Als Bergmann gestand, er sei Pasenow, hatte Studenrecht keinen Augenblick lang an der Wahrheit dieser Behauptung gezweifelt. Er hatte sofort nachgegeben und zugegeben, wer er wirklich war; nämlich ein zwar durchaus begabter, aber gleichzeitig erfolgloser Autor, der seit Jahren mit Romanen und Geschichten hausieren ging, die niemanden interessierten und die auch niemand verlegen wollte. Mit den verschwendeten Jahren wuchsen bei Studenrecht die Hilflosigkeit und auch die Wut. Schließlich war der der Meinung, dass seine Texte mit denen der anderen problemlos konkurrieren konnten. Er glaubte, ihm würden allein die Beziehungen fehlen, die aus einem erfolglosen, unbekannten und armen Autor einen erfolgreichen, bekannten und armen Autor machten. Aus einer Weinlaune heraus war Studenrecht dann der Einfall gekommen, sich als Pasenow auszugeben. Selbstverständlich hatte er die ‚Blaue Schrift’ gelesen und dies nicht nur einmal. Ihr Stil erinnerte ihn an seinen eigenen; auch wenn er den seinen für moderner hielt. Er wusste zudem, dass dieser legendäre Autor ein Phantom war, das seit vierzig Jahren verstummt, zudem wahrscheinlich längst verstorben war - eine Art J. D. Salinger der deutschen Literatur. Niemand hatte jemals Pasenows Identität aufdecken können. Es war unwahrscheinlich, wenn es jetzt plötzlich geschehen würde, auch wenn nun ein neuer Roman von ihm erschien. Daher hielt Studenrecht es für ungefährlich, sich diese Identität zu stehlen. Es sollte eigentlich auch nur ein kleiner Scherz werden, eine Köpenickiade, eine Scharade, die niemandem weh tat und dem Autor wenigstens einmal in seinem Leben die verdiente Anerkennung bringen würde. Nachdem ‚Brunnen der Nacht‘ gebunden in den Auslagen der Buchhandlungen liegen würde, konnte er immer noch die Wahrheit gestehen. Das würde seinen Erfolg wahrscheinlich noch vergrößern.
Zu Studenrechts eigener Überraschung waren Peter Wismuth und mit ihm ein renommierter Verlag sofort auf die Täuschung hereingefallen. Begierig darauf, etwas Neues von einem zum Schulkanon zählenden Autor zu veröffentlichen - also ein gutes Geschäft zu machen -, nahm man die hanebüchene und keiner ernsthaften Überprüfung standhaltende Geschichte vom einsamen Hermann Pasenow im Elfenbeinturm, der jahrzehntelang unter einer Schreibblockade gelitten und den nun doch wieder die Muse geküsst habe, bereitwillig hin. Das war genau so, als hätte man von Wolfgang Borchert einen unbekannten Roman entdeckt, nein: Es war noch besser. Im Gegensatz zum jungen Borchert - nach Bergmanns Meinung übrigens ein stark überschätzter Autor, der seinen Ruhm nur seinem frühen Tod verdankte, auf keinen Fall seinen schwächelnden Kurzgeschichten -, lebte Hermann Pasenow noch und konnte weiterschreiben. Das bedeutete viel, viel Geld. Jetzt gab es kein Zurück mehr, eine Dynamik überrollte Studenrecht, mit der er nicht gerechnet hatte. Doch er fühlte sich dabei weiterhin nicht als Betrüger. Schließlich war der ‚Brunnen der Nacht‘ ja ein eigenes, umfangreiches und vielen Schreibnächten abgerungenes Werk, das er endlich in einem guten Verlag unterbrachte. Studenrecht hatte nirgendwo abgeschrieben und er tat niemandem weh, wenn er sich mit fremden Federn schmückte. Es war noch kein halbes Jahr her, da hatte er den Roman unter seinem wirklichen Namen dem gleichen Verlag, der ihn nun veröffentlichte, angeboten. Er war ihm ungelesen mit einem Formbrief zurückgeschickt worden. Nachdem Studenrecht das Deckblatt ausgetauscht hatte, war das Buch ja kein anderes; es war nicht besser oder schlechter, aber plötzlich war es verkäuflich. So einfach funktioniert das Verlagsgeschäft, der Name auf dem Umschlag und das Frontcover sind wichtiger als der Inhalt. Würde ein findiger Reporter Studenrecht später doch auf die Schliche kommen, würde er sich vielleicht noch besser verkaufen. Und er könnte ein Buch mit dem Titel schreiben:
Der Mann, der Pasenow war …
Und bevor Bergmann wusste, wie ihm geschah, kniete Studenrecht in seinem Hotelzimmer vor ihm und flehte ihn mit feuchten Augen an, sein Wissen über diesen Betrug für sich zu behalten. Bergmann legte peinlich berührt das fette Manuskript des angeblichen Pasenow-Werks zur Seite, aber er konnte sich dabei ein überhebliches Lächeln nicht verkneifen. Nun war die Situation wieder so, wie sie sein sollte. Er war Herr der Lage und nicht mehr ein frisch ertappter Einbrecher. Ein Satz von ihm konnte vernichten oder in den Himmel heben. Er war wiederauferstanden: Claus M. Bergmann, der Kritiker - der Gott der Kritiker! Was galt ihm schon seine kleine Jugendsünde, die er eben zum ersten Mal in seinem Leben jemandem eingestanden hatte. Bergmanns Herz fing heftig an zu schlagen, es pochte so laut, dass er sich wunderte, dass es der Autor nicht bemerkte. Trotzdem sah er lässig und fast gleichgültig auf seine Uhr. Sollte dieser Studenrecht - was für ein Name übrigens, da konnte man ja als Autor keinen Erfolg haben - noch ein wenig in seinem eigenen Saft schmoren:
„Ich habe in einer halben Stunde einen Termin mit einer Zeitungsreporterin von der AZ. Glauben Sie, ich werde mir diese Gelegenheit entgehen lassen und die Wahrheit über den neuen Pasenow verschweigen?“, fragte er von oben herab. Kurz glaubte der Kritiker, der Autor würde sich noch weiter herabbeugen, ihm vielleicht die Schuhe lecken, aber Stundenrecht fing sich rechtzeitig und sah stolz auf. Nun liefen ihm tatsächlich die Tränen über die Wangen. Seine Stimme war zwar brüchig, aber nicht ohne Stolz.
„Wissen Sie, wie das ist, wenn man wie ich sein Leben lang schreibt und keinen Erfolg sieht? Niemand liest mich, niemand interessiert sich für meine Literatur. Ich werde nicht besprochen und nicht gelobt, nicht einmal kritisiert. Man ignoriert mich. Es ist nur ein Vakuum um mich herum, ein luftleerer Raum, in dem ich ersticke. Freunde und Familie zuckten anfangs mit den Schultern: Da spinnt er eben, man darf ihn nur nicht darauf ansprechen. Das will man nicht einmal geschenkt. Jeder Hund kann mir ans Bein pinkeln. Und gleichzeitig weiß ich: Meine Geschichten würden sich ebenso gut verkaufen wie die der anderen. Sie sind sicher nicht besser - sie sind aber auch nicht schlechter. Ich brauche nur diese eine Chance und die kriege ich nicht, egal, was ich versuche. Ich habe sogar eine Seite im Internet geführt, verrückt, nicht wahr? Als ob sich dafür jemand interessiert. Glauben Sie mir, das ist entsetzlich. Ich fühlte mich, als wäre ich unter die Vampire geraten. Ich habe mein Leben der Literatur geweiht. Das klingt durchgeknallt, aber: Diese Entscheidung traf ich schon als Kind und konnte sie als Erwachsener nie rückgängig machen. Das war mir nicht möglich; meine Psychologie verbot es mir. Sehen Sie mich an: Was bin ich denn schon? Mein Leben lang habe ich mich mit irgendwelchen Kurzzeit-Jobs über Wasser gehalten, damit mir ja die Zeit zum Schreiben blieb. Nächtelang tippte ich mir die Finger wund. Ich habe inzwischen keine Familie, keine Kinder, keine Freunde mehr, alles opferte ich meinem unbarmherzigen Götzen. Nur wenn ich einen Stift in der Hand halte und schreibe, dann fühle ich mich, dann hat mein Leben einen Sinn. Leben oder Schreiben. Ich habe mich längst für eine Seite entschieden.“
„Jetzt werden Sie nicht so dramatisch.“
„Sie sind doch nur ein weiterer dieser Eunuchen, die alles über den Sex zu wissen glauben, Herr Claus M. Bergmann. Wer sind Sie denn, dass Sie es wagen, mich zu verurteilen?“ Das hatte Studenrecht empört gefragt, und jetzt, beim Denkmal in der Sonne sitzend, klang Bergmann diese Frage noch in den Ohren: “Wer sind Sie denn, dass sie es wagen, mich zu verurteilen?“
Da hatte der Betrüger schon recht: Was wusste er eigentlich noch vom Schreiben, von dem Ringen um ein Wort oder einen Satz, von den Selbstzweifeln, den Opfern, ja, der Selbstzerfleischung eines Schriftstellers? Niemanden fällt das Schreiben schwerer als einem Schriftsteller und je besser er ist, umso schwieriger wird es für ihn. Bergmann lebte bequem von den Kopfgeburten der Dichter, weil die Leser gerne jemanden hatten, der sie bei der Hand nahm und ihnen mit weisen Worten ein Werk empfahl oder es - noch viel aufregender und besser - in der Luft zerriss. Zudem verdiente Bergmann als Kritiker in einem Jahr ein Vielfaches von dem, was er bis in die 70er Jahre mit den Tantiemen aus der ‚Blauen Schrift‘ eingenommen hatte und die über ein kompliziertes System von Strohmännern, Verlagsanwälten und einer Schweizer Bank schließlich gewaschen und steuerfrei auf seinem Privatkonto gelandet waren. Inzwischen hatte er alle Rechte an dem Werk an Guttmanns Erben abgegeben und diese hüteten sein Pseudonym eifersüchtig wie ein Drache seinen Hort. Sie würden Studenrecht mit tausend Klagen überziehen, wenn sein Identitätsdiebstahl bekannt würde. Der ehemalige Pasenow jedoch war ganz froh, dass er mit seinem Jugendwerk nichts mehr zu tun hatte. Warum also verurteilte er Studenrecht für dessen Anmaßung? War es verletzte Eitelkeit? Sentimentalität?
Nur aus dem Grund, die Zeit zu finden, sich selbst diese Frage zu beantworten, hatte Bergmann Studenrecht mit ein paar Worten beruhigt und ihm erzählt, er würde sich das Ganze überlegen. Studenrecht hatte auf einem Treffen bestanden, darum gefleht, sich ausführlich erklären zu dürfen, damit ihm Bergmann nicht die letzte Chance zunichtemachte, seinen ihm zustehenden Platz in der Literatur einnehmen zu können. Dabei wurde Studenrecht wohl das Unwürdige seiner kauernden Stellung zu Füßen des Kritikers bewusst und er war entschlossen aufgestanden. Reichlich spät kam ihm der Gedanke, dass ein Gegenangriff mehr einbringen konnte als seine bisherige Unterwürfigkeit.
„So einfach kommen Sie mir übrigens nicht davon“, hatte er trotzig erklärt und sich in Rage geredet, „schließlich sind Sie bei mir eingebrochen. Wenn Sie einen Skandal vermeiden wollen, müssen Sie mit mir reden. Und überhaupt - wie wollen Sie beweisen, dass ausgerechnet Sie Pasenow sind? In mir ist ebenso viel Pasenow wie in Ihnen. Was sage ich: In mir ist mehr Pasenow. Ich schreibe immerhin noch. Mein ganzes Leben habe ich der Literatur gewidmet.“ Bergmann hatte abgewinkt. Ihm war bewusst geworden, dass er tatsächlich keinen Beweis herbeibringen konnte, der ihn zweifelsfrei als Pasenow identifizieren konnte. Die Originalhandschriften seiner alten Erzählungen waren längst verloren. Es gab allerdings noch eine alte typografische Abschrift, die er mit Anmerkungen versehen hatte, zudem besaß er das Manuskript zu dem Romanfragment, an dem er nach der ‚Blauen Schrift’ gearbeitet hatte. Die ausgeblichenen und von Säure angefressenen, da billig in Ostdeutschland produzierten Blätter, verstaubten in einer Geheimschublade seines Schreibtischs in seiner Zweitwohnung in Berlin. Aber was war damit schon bewiesen? Und eine gerichtliche Auseinandersetzung mit Studenrecht würde ihn wahrscheinlich überleben. Schließlich war Bergmanns Gesundheit in den letzten Jahren doch ziemlich angegriffen. Einen Prozess um ein paar Erzählungen und ein Pseudonym wollte er seinen Kindern nicht vererben.
„Kommen Sie mir nicht mit Drohungen. Mir reicht, wenn ich beweise, dass Sie nicht Pasenow sind! Dann hat man Sie in zehn Minuten vergessen“, hatte Bergmann deshalb wütend gekontert und wieder seinen Herzschlag gespürt. Studenrecht schwieg betreten und gab sich geschlagen. Plötzlich tat er Bergmann leid.
Das könnte ich sein, dachte er, ‚wenn ich Guttmann nicht kennengelernt hätte. Er gab mir die Chance, die Studenrecht nie hatte. Er sah wieder auf das Manuskript der ‚Brunnen der Nacht’. Zu dem Mitleid gesellte sich Neid. Er fühlte sich wie ein Stich in die Lunge an. Einen Roman hatte Bergmann nie geschrieben. Er hatte zwar einen begonnen, aber der war nie über die ersten Kapitel hinausgekommen. Nach der ‚Blauen Schrift’ war seine Kraft erschöpft gewesen.
Wie ein Brunnen, aus dem man zu viel getrunken hat, fiel ihm ein, ‚mein Talent war tatsächlich ein Brunnen in der Nacht, Tau, der sich in einer Senke bildet. Ich habe ihn durstig und gierig bis zur Neige ausgeschöpft; danach ist nie wieder Wasser nachgeflossen, so tief ich auch im anfangs noch feuchten Erdreich wühlte. All die Jahre hatte er seiner ersten Frau daran die Schuld gegeben: Beate, die ihn und nicht den Autor liebte, die so plötzlich schwanger wurde und nicht mehr arbeiten konnte. Er musste alleine für die Familie aufkommen, Geld verdienen, Verantwortung tragen. Da hatte er keine Zeit mehr, Bücher zu schreiben. Und später, je mehr er las und kritisierte, umso deutlicher wurde ihm bewusst, wie wenig er doch zu sagen hatte. Heute musste er Beate von jeder Schuld freisprechen. Der widrige Umstand, der ihn am Dichten hinderte, war er selbst gewesen und das Leben, für das er sich bewusst entschieden hatte. Schreiben oder Lesen, hatte Studenrecht vorhin gesagt, es gehe nur das eine oder das andere. Die Musen sind eifersüchtige Geliebte; sie duldet nichts und niemanden neben sich. Aber über das Lesen schreiben und über andere urteilen, das ist leicht, dachte Bergmann bitter, nein, mein Brunnen war sehr seicht. Das Wasser war gut, aber es war zu knapp. Es konnte nur einen ersten Durst stillen.
Bergmann hatte es plötzlich eilig gehabt, von Studenrecht weg zu kommen. Er verabredete sich mit ihm für zwölf Uhr im nahen Stadtpark und floh das Zimmer. Ihm wurde dabei ein wenig schwindlig und er war kurzatmig. Sein linker Arm schmerzte und die Finger seiner Hände waren taub. Er benutzte dieses Unwohlsein als Ausrede bei der ernsthaft besorgten Hilde und der gelangweilten Reporterin, die ihn bereits gemeinsam in der Lobby erwarteten. Er machte sich nicht beliebt, als er das Interview absagte. Aber er brauchte im Moment Ruhe und die Gelegenheit, über sich nachzudenken. Er wollte jetzt nicht die ewig gleichen Antworten auf die ewig gleichen Fragen geben. Die Reporterin steckte ihr Diktaphon wieder ein und zog wütend ab. Hilde wartete, bis sich die automatische Tür des Hotels hinter der Frau schloss.
„Claus, was ist los? Erst verschwindest du für eine halbe Stunde auf der Toilette, dann ist dir ein wenig übel und du sagst diesen Termin einfach so ab. Das ist nicht typisch für dich, du bist doch sonst so gewissenhaft. Fühlst du dich wirklich nicht gut? Sollen wir zu einem Arzt gehen? Hast du denn deine Tabletten jetzt endlich genommen? Vielleicht messen wir mal deinen Blutdruck.“ Bergmann schüttelte den Kopf. Was er überhaupt nicht brauchte, war die Fürsorge seiner Frau und ihre besorgten Fragen, mit denen er sich nicht beschäftigen wollte.
„Ich will allein Spazieren gehen. Einmal die Straße runter und einmal wieder rauf. Eine Stunde an der frischen Luft tut mir gut.“ Er zögerte, denn er wollte Hilde nicht beleidigen. Das Leben mit ihr war zwar schwierig, aber ohne sie konnte er nicht existieren. Hilde trat einen Schritt auf ihn zu, hob eine Hand und berührte ihren Mann an der Wange.
„Bist du dir sicher?“, fragte sie zärtlich und besorgt.
„Ich komme bald zurück und dann gehen wir zum Mittagessen. Es ist ein schöner Tag und ich will das ausnutzen“, versuchte er seine Frau zu beruhigen. „Ich muss mir außerdem noch Gedanken über die Rede machen, die ich morgen bei der Veranstaltung halten werde.“ Hilde gab sich geschlagen.
„Dann zieh dir wenigstens deine Jacke über“, seufzte sie und reichte ihm das Kleidungsstück, das er im Frühstückssaal zurückgelassen hatte. Sie sah ihrem Mann nachdenklich hinterher, als er allein und recht schleppend das Hotel verließ und sich draußen orientierte. Wenn Bergmann sich jetzt umgedreht hätte, dann hätte er in Hildes Gesicht die Liebe gelesen, die sie für ihn empfand. Aber daran dachte er nicht.
Jetzt, im Park auf einer Bank sitzend, die viel zu warme Jacke neben sich über die Lehne geworfen, bedauerte er, Hilde nicht gesagt zu haben, wie sehr er sie brauchte und wie dankbar er war, dass sie immer für ihn einstand.
Auf der Wiese vor ihm spielten Kinder. Zu seinen Füßen blühte giftig gelb ein zaghafter, vereinzelter Löwenzahn.
Ist der Frühling doch noch gekommen, dachte der Pasenow in ihm, der sich lange verborgen hatte. Mein Leben lang habe ich gewartet. Aber nun ist er endlich da. Und das Kind, das noch in ihm war, beugte sich mühsam herab.
Werner Studenrecht verspätete sich etwas, weil er noch mit Wismuth telefonieren und ihm ein paar bittere Wahrheiten eingestehen musste. Suchend sah er sich in dem Dompark um. Schließlich fand er Claus M. Bergmann in der Nähe eines hässlichen Denkmals etwas zusammengesunken auf einer Bank sitzen. Der Kritiker hatte die Augen geschlossen und schien zu schlafen, die Sonne zu genießen, die ihm ins Gesicht schien. Seinen Kopf hatte er in den Nacken gelegt und der Mund stand ein wenig offen. In der rechten Hand hielt er eine Löwenzahnblüte, die er anscheinend im Park gepflückt hatte.
Studenrecht zögerte ein wenig, dann rüttelte er an Bergmanns Schulter. Der Kritiker öffnete nicht die Augen.
ENDE