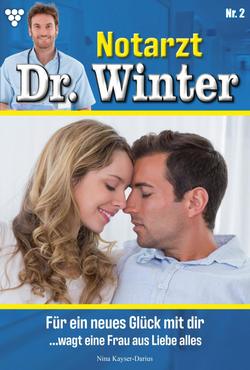Читать книгу Notarzt Dr. Winter 2 – Arztroman - Nina Kayser-Darius - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Wahnsinn!« murmelte Dr.
Adrian Winter vor sich hin und fuhr sich mit der rechten Hand durch seine dunkelblonden Haare. »Echter Wahnsinn! Wer hätte das gedacht?« Wie angewurzelt stand er da, den Kopf in den Nacken gelegt und sah sich bewundernd um.
Er hatte seinen freien Sonntag dazu benutzt, allein ein wenig aufs Land zu fahren – und nun stand er in dieser kleinen Kirche, die er eigentlich nur aus einer Laune heraus betreten hatte. Denn daß sie eine Sehenswürdigkeit war, hatte er nach ihrem unscheinbaren Äußeren nicht annehmen können. Und jetzt also das: Wunderbare Fresken, meisterlich restauriert, zogen sich an den Wänden entlang. Er hielt den Atem an. »Wirklich unglaublich!«
»Freut mich, daß Sie so beeindruckt sind«, sagte eine sanfte Stimme in seinem Rücken.
Er fuhr herum. »Meine Güte, haben Sie mir einen Schrecken eingejagt«, sagte er zu dem schlanken dunkelhaarigen Mann mit dem schmalen Gesicht, der hinter ihm stand. Er hatte auffallende blaue Augen, die Adrian voller Interesse betrachteten. »Ich dachte, ich bin allein, ich habe Sie überhaupt nicht kommen hören.«
»Ich bin auch nicht gekommen, ich war schon die ganze Zeit da«, erklärte der andere lächelnd. »Sie haben mich bloß nicht bemerkt, als Sie hereingekommen sind.«
»Ich weiß nicht einmal, warum ich überhaupt in diese Kirche gegangen bin«, meinte Adrian nachdenklich. »Jedenfalls habe ich nicht solche Sehenswürdigkeiten erwartet, das muß ich sagen.«
»Es gefällt Ihnen also wirklich?«
»Natürlich! Wem gefiele das nicht? Wenn Sie die ganze Zeit in der Kirche waren, müssen Sie doch gehört haben, was ich gesagt habe.« Adrian lächelte. »Normalerweise spreche ich nicht mit mir selbst, aber in diesem Fall mußte ich meine Bewunderung einfach laut zum Ausdruck bringen.«
Neugierig sah er den anderen an. »Interessieren Sie sich aus einem bestimmten Grund für diese Fresken?« fragte er.
»Ja«, lautete die schlichte Antwort. »Ich habe sie restauriert und frage mich manchmal, ob die Farben nicht zu üppig für diese bescheidene kleine Kirche ausgefallen sind.«
»Aber nein!« rief Adrian. »Wie kommen Sie denn auf die Idee? Dadurch wird doch alles so plastisch, daß man beinahe das Gefühl hat, ein Teil der dargestellten Szenen zu sein.«
»So empfinden Sie das also?« fragte der andere nachdenklich. »Das ist sehr schön. Übrigens: mein Name ist John Tanner.«
»John?« fragte Adrian. »Sind Sie Engländer oder Amerikaner? Sie haben gar keinen Akzent.«
»Ich bin Berliner«, lachte der junge Mann. »Mein kompletter Vorname ist Jonathan, und daraus ist schon sehr früh ›John‹ geworden.«
»Ich bin Adrian Winter und arbeite in der Notaufnahme an der Kurfürsten-Klinik.«
»Arzt?«
Adrian nickte. »Unfallchirurgie.«
Die beiden Männer schüttelten einander die Hand, dann bat Adrian: »Erklären Sie mir noch ein wenig, was Sie hier gemacht haben. Es interessiert mich wirklich sehr.«
John Tanner lachte, und sein schmales Gesicht bekam auf einmal etwas Jungenhaftes. Sonst wirkte er eher ernst, aber in diesem Augenblick sah er aus wie ein Lausejunge. »Sie hätten die Kirche mal sehen sollen, als ich mit der Arbeit begonnen habe, Herr Winter. Armselig sah sie aus, anders kann man es nicht ausdrücken. Kalt und zugig war es hier, die Farben an den Wänden blätterten ab. Verrottetes Gestühl, kaputte Fliesen auf dem Fußboden. Schlechte Beleuchtung, marode Heizung. Es war reiner Zufall, daß die Fresken entdeckt worden sind. Eine elektrische Leitung war defekt, die Wände mußten zum Teil aufgeklopft werden – und da fand man auf einmal ›so komische Zeichnungen‹, wie sich einer der Handwerker damals ausgedrückt hat.«
Er lächelte bei der Erinnerung. »Na ja, dann wurde ich gebeten, mir die Sache anzusehen. Meine Hoffnung, etwas wirklich Wertvolles zu finden, war nicht sehr groß – aber ich hatte mich geirrt. Doch mit dieser Entdeckung fingen die Probleme erst an, denn natürlich war kein Geld da, um mich für meine Arbeit zu bezahlen.«
»Und wie wurde dieses Problem gelöst?«
»Spendenaufrufe«, antwortete John Tanner sachlich. »Man glaubt es nicht, aber wenn man es schafft, die Menschen für etwas zu begeistern, dann mobilisieren sie ungeheure Kräfte. Jedenfalls war nach kurzer Zeit zumindest so viel da, daß ich mich bereiterklärt habe, mit der Arbeit zu beginnen…«
Er sagte es nicht, aber Adrian konnte sich denken, daß er mit weniger Geld zufrieden gewesen war, als ihm eigentlich zugestanden hätte. Wenn er John Tanner richtig einschätzte, dann war dieser ein Mann, der seine Arbeit liebte und dem Geld nicht so wichtig war.
»Und während ich gearbeitet habe, konnten die Leute ja immer verfolgen, was mit ihrem Geld geschah. Offenbar waren sie zufrieden, denn sie haben weiterhin gespendet, und heute sind sie sehr stolz auf ihre kleine Kirche.«
»Mit Recht«, sagte Adrian und ließ seinen Blick erneut in die Runde schweifen. »Sie ist wunderschön.«
»Ich habe zwei Jahre hier zugebracht, können Sie sich das vorstellen?«
»Und wann sind Sie mit der Arbeit fertig geworden?« erkundigte sich Adrian.
»Erst vor einem Monat, aber ich kann mich noch immer nicht von der Kirche trennen. Sie ist mir während dieser zwei Jahre fast zu einem Zuhause geworden.«
»Verständlich«, meinte Adrian. Dann kam ihm ein Gedanke. »Sagen Sie, haben Sie etwas vor? Oder darf ich Sie zu einem frühen Abendessen einladen? Aber nur, wenn Sie mir als Gegenleistung noch mehr erzählen.«
»Da sage ich bestimmt nicht nein«, antwortete John Tanner lächelnd. »Ich rede sowieso gern über meine Arbeit. Und wenn sich dann noch jemand wirklich dafür interessiert, dann bin ich kaum noch zu bremsen.«
»Um so besser!« Adrian lachte.
»Aber ein wenig könnten Sie mir auch erzählen, was Sie so machen. Die Arbeit in einer Notaufnahme stelle ich mir sehr anstrengend vor.«
»Das ist sie auch, aber für mich ist sie genau das Richtige«, erklärte Adrian. »Es gibt jedenfalls nichts anderes, das ich lieber täte. Und das war schon immer so. Ich gehöre also nicht zu den Menschen, die ständig sagen: ›Ich würde so gern dies oder jenes tun.‹ Ich habe genau den Beruf, den ich haben wollte.«
»Wie ich«, stellte John nachdenklich fest. »Wissen Sie eigentlich, daß das sehr selten ist?«
Adrian nickte. Langsam verließen sie die Kirche. »Ich glaube, ich werde in Zukunft gelegentlich hierherkommen und Ihren Fresken ›Guten Tag‹ sagen, Herr Tanner. Ich verstehe gar nicht, daß die Leute nicht Schlange stehen, um sie zu bewundern.«
»Normalerweise tun sie das«, erwiderte der junge Restaurator bescheiden. »So viel Zulauf wie in den letzten Wochen hat die kleine Kirche lange nicht mehr erlebt. Aber es wird ja schon langsam Abend, da fahren die Leute wieder nach Hause. Tagsüber war hier sehr viel los.«
»Gut, daß ich jetzt erst gekommen bin«, stellte Adrian zufrieden fest. »Ich hätte Ihre Fresken nicht gern mit vielen anderen geteilt.«
»Kommen Sie«, sagte John Tanner. »Ich weiß einen wunderbaren Gasthof hier in der Nähe, der wird Ihnen auch gefallen. Und dann erzähle ich Ihnen alles, was Sie wissen wollen.«
Adrian folgte ihm. Welch großartiger Abschluß für diesen Sonntag, dachte er. Er durfte nicht versäumen, Esther, seiner Zwillingsschwester, von dieser Kirche und John Tanner zu erzählen.
*
Mareike Sandberg versuchte mit aller Macht, die aufsteigenden Tränen zu unterdrücken. Sie wußte genau, wie ihr Mann darauf reagieren würde, und das wollte sie vermeiden. Er stand vor ihr, groß und kräftig, und sah ein wenig spöttisch auf sie herunter, wie er es immer tat, wenn sie wieder einmal vergeblich versucht hatte, ein offenes Gespräch mit ihm zu führen. Mareike fühlte, wie ihr Mut sie verließ. Es war aussichtslos, wie jedes Mal. Sie kam nicht einen einzigen Schritt weiter.
Robert Sandberg war fünfzehn Jahre älter als seine Frau. Dreiundvierzig war er gerade geworden, und er war einer der erfolgreichsten Industriellen des Landes. Ein imposanter Mann von hohem Wuchs und breiter Statur, einem energischen Gesicht mit harten Lippen und kalten blauen Augen. Seine braunen Haare waren bereits von grauen Fäden durchzogen.
Mareike dagegen war zierlich und blond, eine schöne junge Frau von achtundzwanzig Jahren. Ihre Haare fielen ihr weich und glatt in einem schönen Schwung bis auf die Schultern, das ebenmäßige Gesicht bekam seine pikante Note durch den etwas zu vollen Mund und die kleine Nase. Die Augen waren groß und braun, von dichten dunklen Wimpern gesäumt.
Vor drei Jahren, als sie Robert Sandberg geheiratet hatte, war er ihr wie ein Märchenprinz erschienen – aber mittlerweile fragte sie sich immer häufiger, ob sie die Begeisterung beider Familien über diese Verbindung nicht einfach mit Liebe verwechselt hatte.
Aber damals schien alles einfach perfekt zu sein. Auch Mareike kam aus einem reichen Haus, und sie brachte alle Voraussetzungen mit, um die ideale Ehefrau von Robert Sandberg zu werden. Sie war schön und immer elegant angezogen. Nie sah man sie schlampig oder auch nur nachlässig gekleidet. Sie konnte ein großes Haus führen, und sie hatte es direkt nach der Heirat mit ungewöhnlichem Geschmack, aber absolut stilsicher eingerichtet. Sie wußte, wie man mit Personal umging, und sie hatte keine Schwierigkeiten damit, große Summen zu verwalten. Ihre Umgangsformen waren tadellos – und selbst bei Gesellschaften in höchsten Kreisen machte sie nie einen Fehler. Sie war liebenswürdig und charmant, dabei intelligent und gebildet.
Sie war perfekt als Frau für Robert Sandberg, so hatten es seinerzeit alle gesehen, sie selbst eingeschlossen.
Aber Robert Sandberg war nicht der richtige Mann für sie. Sie begriff das allmählich, wehrte sich jedoch noch immer gegen diese Erkenntnis. Sie wollte alles richtig machen. Eine Trennung von einem so mächtigen und angesehenen Mann wie Robert aber würde mit Sicherheit nicht nur von ihren Eltern als Schandfleck in der Familienchronik angesehen.
Aber es ließ sich nicht leugnen, daß sie immer häufiger davon träumte, noch einmal ganz von vorn anzufangen und ein Leben ohne einen Mann zu führen, der ihr ständig diktierte, was sie zu tun hatte. Doch sie verdrängte diese Träume, so gut es eben ging.
»Warum mußt du mich behandeln wie ein kleines Mädchen?« fragte sie.
»Ich bin erwachsen, Robert. Und wir sind seit drei Jahren miteinander verheiratet.«
»Wenn du erwachsen wärst«, antwortete er kalt, »dann würdest du nicht ständig versuchen, mir völlig unsinnige Diskussionen aufzuzwingen, Mareike. Du bist seit drei Jahren meine Frau, wie du eben völlig richtig festgestellt hast, und du hast gewußt, was es bedeutet, mich zu heiraten. Ich brauche eine Frau, die mich unterstützt, die unser Haus so führt, wie es meiner gesellschaftlichen Stellung angemessen ist. Wozu also willst du dein Kunststudium wieder aufnehmen? Du hast für solche Mätzchen keine Zeit und nimmst nur jemand anderen den Studienplatz weg, das weißt du ganz genau!«
»Aber ich fühle mich so nutzlos!« rief sie. »Und unausgefüllt! Alles, was ich tue, hat mit dir und deiner Stellung zu tun. Für mich selbst tue ich nichts, verstehst du? Du gehst jeden Morgen deinen Geschäften nach, und dann sitze ich hier in diesem Riesenhaus und bespreche mit dem Personal, wen wir zu unserer nächsten Gesellschaft einladen und was es zum Essen geben soll. Oder ich entscheide, welche Farbe die neue Markise über der Südterrasse haben soll. Oder ich kaufe mir ein neues Kleid, obwohl ich bereits hundert im Schrank hängen habe, die höchstens einmal getragen sind.« Ihre Stimme wurde leiser. »Das ist doch kein Leben, Robert!«
»Andere wären froh, wenn sie so ein Leben hätten«, erwiderte er noch frostiger als zuvor. »Ich möchte wissen, worüber du dich eigentlich beklagst? Ich gebe dir viel Geld, damit du dir alles kaufen kannst, was du willst. Du bist die bestangezogenste Frau der Stadt, alle bewundern dich. Deine Qualitäten als Gastgeberin sind unbestritten. Warum also müssen wir immer und immer wieder diese unsinnige Diskussion führen?«
»Weil ich unglücklich bin«, flüsterte sie. »Es geht doch nicht um Geld, Robert. Es geht um Gefühle. Um Glück. Verstehst du das nicht?«
Er warf ihr einen letzten Blick zu, bevor er mit raschen Schritten das Zimmer verließ. »Nein«, sagte er knapp. »Das verstehe ich ganz und gar nicht. Und du solltest dich schämen, so undankbar zu sein. Du lebst wie eine Prinzessin und redest von Unglück! Für wen hältst du dich eigentlich?«
»Für deine Frau«, antwortete sie leise. Aber das hörte er schon nicht mehr, denn die Tür fiel bereits hinter ihm ins Schloß. Sie schluckte, aber es war zu spät. Nun kamen sie doch noch, die Tränen, die sie die ganze Zeit so mühsam zurückgehalten hatte.
*
Esther Berger schloß für einen kurzen Augenblick die Augen. Sie war glücklich, rundherum glücklich. Ein sehr harter Arbeitstag lag hinter ihr. Sie war Kinderärztin an der Charité, und sie war es gerne. Manchmal aber wurde ihr alles zuviel, und so war es heute gewesen.
Jetzt jedoch war sie auf dem Bauernhof vor den Toren Berlins, auf dem sie ihr Pferd stehen hatte: Luna, eine große braune Stute, die sehr temperamentvoll, aber auch gutmütig war. Sie hatte den Kauf des Pferdes, das sie sich eigentlich gar nicht leisten konnte, in einer Vollmondnacht perfekt gemacht und damals sofort gedacht, daß Luna der richtige Name für die hübsche Stute war.
Durch Zufall hatte sie dann diesen Bauernhof gefunden, auf dem sie Luna untergebracht hatte – und seitdem war es ihr größtes Glück, nach der Arbeit hierherzufahren und zu reiten. Und irgendwann hatte sie zusätzlich angefangen, mit behinderten Kindern zu arbeiten. Die liebten ihre Reitstunden und freuten sich immer schon lange im voraus, wenn die Frau Doktor kam. Das war meistens am Wochenende der Fall.
Wenn man Esther Berger dann inmitten der fröhlich kreischenden, manchmal auch ängstlich aussehenden Kinder sah, mußte man zweimal hinsehen, um zu erkennen, daß sie die Erwachsene war, die die Kinderschar anleitete. Sie war sehr schlank und zierlich, und mit ihren kurzen blonden Haaren und den frech blitzenden Augen konnte man sie leicht für einen ihrer Schützlinge halten.
Heute gehörte der Abend ihr allein. Sie hatte Luna gesattelt und ritt gemächlich durch den Wald. Es war mild draußen, und der Streß des Tages fiel allmählich von ihr ab. Luna war offensichtlich auch sehr zufrieden, sich endlich bewegen zu können, und so trabten sie in völliger Eintracht über die wohlvertrauten Wege.
Als sie nach anderthalb Stunden auf dem Weg zurück zum Bauernhof waren, tauchte plötzlich ein anderer Reiter vor Esther auf: Das war keine Seltenheit, denn in der Nähe gab es einen ziemlich exklusiven Reitstall, in dem etliche reiche Berliner ihre Pferde stehen hatten. Esther kannte einige von ihnen. Mit den meisten hatte sie keinerlei Kontakt, sie lebten einfach in zu verschiedenen Welten. Doch es gab Ausnahmen.
Als sie näherkam, stellte sie fest, daß es sich um eine Reiterin handelte, deren Pferd im Schritt ging. Und nun erkannte sie die Frau auch und rief: »Frau Sandberg! Hallo!«
Mareike Sandberg sah sich um und lächelte, als sie die junge Kinderärztin sah. »Frau Dr. Berger, wie schön, Sie zu sehen.«
Sie meinte es ernst, das wußte Esther. Sie waren einander schon öfter begegnet, hatten einige Worte miteinander gewechselt, und Esther hatte bald festgestellt, daß die junge Frau Sandberg, ungeachtet ihrer Schönheit und ihres Reichtums, eine ausgesprochen nette und unkomplizierte Frau war. Gelegentlich tranken sie eine Tasse Kaffee miteinander, und jedesmal hatte Mareike Sandberg sich außerordentlich interessiert nach Esthers Arbeit in der Charité erkundigt.
Esther hatte dazu ihre eigene Theorie. Sie glaubte, daß Mareike Sandberg unglücklich und unausgefüllt war. Und seit sie ihren Mann einmal gesehen hatte, glaubte sie auch zu wissen, warum das so war. Aber das ging sie natürlich nichts an. Und es würde sicher niemals Gegenstand eines ihrer Gespräche sein. Esther hatte selbst eine kurze, aber unglückliche Ehe hinter sich. Sie erinnerte sich nur ungern daran, und sie sprach fast nie darüber.
Manchmal kam sie mit Adrian Winter, ihrem Zwillingsbruder, auf das Thema zu sprechen – aber sie sorgte stets dafür, daß das nicht allzulange dauerte. Es war einfach zu unerfreulich, und die Erinnerung daran half auch nicht weiter. Es war ein Fehler gewesen. Ein verhängnisvoller Irrtum, den sie mit vielen Tränen und großem Unglück bezahlt hatte. Doch das war vorbei, und sie hatte es verarbeitet. Endlich.
Mareike Sandberg, fand sie, sah heute besonders unglücklich aus. Doch sie kannten sich nicht gut genug, als daß sie sich danach hätte erkundigen können. So begnügte sie sich damit zu sagen:
»Ich hatte einen schrecklichen Tag, und das einzige, was mich dazu gebracht hat, ihn durchzustehen, war die Freude auf diesen Ausritt. Jetzt geht es mir wieder gut. Reiten ist wirklich etwas Wunderbares.«
»Ja«, bestätigte Mareike Sandberg leise, »das finde ich auch. Aber leider funktioniert es bei mir heute nicht so wie bei Ihnen, Frau Berger. Ich hätte meinen Tag auch gern abgeschüttelt, doch es gelingt mir einfach nicht.«
»Dann lassen Sie uns doch ein Glas Wein zusammen trinken«, schlug Esther vor. »Oder haben Sie keine Zeit?«
»Doch«, antwortete Mareike und lächelte. »Das ist eine gute Idee. Sie haben immer so interessante Geschichten zu erzählen. Sie wissen ja, wie gern ich Ihnen zuhöre.«
Sie verabredeten einen Treffpunkt, und dann trennten sich ihre Wege. Esther kehrte zum Bauernhof zurück, und Mareike schlug den Weg zu ihrem Reitstall ein. »Bis in einer halben Stunde also«, rief Esther.
»Ja, bis gleich.«
Sie ist unglücklich, dachte Esther, wie sie es schon so oft gedacht hatte. Arme Frau. So schön, so reich – und es hilft ihr offenbar gar nicht.
*
Adrian Winter sah den großgewachsenen Mann mit den harten Augen, der vor ihm lag, nachdenklich an. Er war von seinem Chauffeur in die Notaufnahme der Kurfürsten-Klinik gebracht worden, was ungewöhnlich genug war.
Sein Chef, hatte der Chauffeur erklärt, sei während der Fahrt plötzlich totenbleich geworden. Er habe über Übelkeit geklagt, und kalter Schweiß sei ihm ausgebrochen. Da habe er es mit der Angst zu tun bekommen. Und da die Klinik in der Nähe gewesen sei, habe er sich gedacht, es sei besser, Herrn Sandberg sofort dorthin zu bringen und untersuchen zu lassen.
Erst allmählich hatte der junge Notaufnahmechef begriffen, daß er es mit einem ausgesprochen prominenten Patienten zu tun hatte. Denn der Mann, dessen Untersuchung er gerade beendet hatte, war jener Industrielle Sandberg, über den man jeden Tag sowohl auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen, als auch in den Klatschspalten der Regenbogenblätter eine Geschichte lesen konnte.
»Sie müssen aufpassen, Herr Sandberg«, sagte er sehr ruhig. »Ihr Blutdruck ist viel zu hoch. Ich nehme an, Sie nehmen Medikamente dagegen?«
Robert Sandberg nickte. »Ja, sicher, schon seit Jahren.«
»Aber leben Sie auch entsprechend? Sie sollten sich beim Alkohol sehr zurückhalten, gesund und abwechslungsreich essen, viel Bewegung…«
»Kommen Sie mir bloß nicht mit solchen Ratschlägen!« rief der andere herrisch. Es ging ihm offenbar schon wieder besser, seine Wangen bekamen allmählich Farbe. »Das ist völlig unrealistisch!«
»Wenn Sie sich an solche Ratschläge nicht halten, dann wird Ihr Leben schneller zu Ende sein, als Ihnen vielleicht lieb ist«, erwiderte Adrian ungerührt. »Sie sind nur knapp an einem Schlaganfall vorbeigekommen, Herr Sandberg. Und was ein Schlaganfall bedeutet, das muß ich Ihnen doch sicher nicht erzählen, oder?«
Robert Sandberg funkelte ihn wütend an, sagte aber nichts.
»Bedanken Sie sich bei Ihrem Chauffeur«, fuhr Adrian fort, »daß er Sie sofort hierhergebracht hat. Und nehmen Sie die Sache als Warnschuß, auf den Sie unbedingt hören sollten. Denn wenn Sie das nicht tun…«
Der Patient richtete sich ein wenig auf. »Wollen Sie mir drohen?« rief er aufgebracht, ohne zu merken, wie lächerlich seine Worte waren.
»Womit sollte ich Ihnen denn drohen?« erkundigte sich Adrian ruhig. »Ich sage Ihnen lediglich, was ich Ihnen als Arzt sagen muß.«
»Was bilden Sie sich eigentlich ein?« knurrte Robert Sandberg. »Mir fehlt nichts, überhaupt nichts.«
»Ich bilde mir nichts ein«, antwortete Adrian, noch immer völlig ruhig. Wütende Patienten kannte er schon. »Und daß Ihnen nichts fehlt, ist schlichter Unsinn. Ich weiß es besser und wenn Sie ehrlich sind, wissen Sie es auch. Ich sage Ihnen, was Sie erwartet, das ist alles. Aber es ist Ihr Leben, Herr Sandberg. Natürlich können Sie damit anfangen, was Sie wollen.«
»Ach, was wissen Sie denn schon«, gab der andere mürrisch zurück und ließ sich wieder auf die Liege sinken. »Ich esse gern, und ich trinke gern. Und ich… Aber lassen wir das jetzt. Wollen Sie mir alles wegnehmen, was mir Spaß macht?«
»Alles nicht«, antwortete der junge Arzt mit feinem Lächeln.
»Kann ich jetzt gehen?«
»Sicher können Sie das. Aber wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, bleiben Sie noch eine Stunde hier liegen und lassen sich dann zu Ihrem Hausarzt fahren. Der erzählt Ihnen das Gleiche wie ich, aber auf ihn hören Sie ja vielleicht, weil Sie ihn schon länger kennen als mich und Vertrauen zu ihm haben. Und dann leben Sie vernünftiger und können steinalt werden.«
Wider Willen imponierte Robert Sandberg dieser junge Mediziner, der sich von ihm und seinem prominenten Namen ganz offensichtlich überhaupt nicht beeindrucken ließ.
»Wer will das schon – steinalt werden?« knurrte er unwillig und richtete sich erneut auf. Mit lauter Stimme rief er nach seinem Chauffeur und verließ wenige Minuten später, schwer auf dessen Arm gestützt, die Notaufnahme der Kurfürsten-Klinik.
Adrian sah ihm kopfschüttelnd nach. Hoffentlich sah er diesen Mann nicht wieder. Ein angenehmer Zeitgenosse war er wirklich nicht.
»Geht er schon?« fragte seine Kollegin Julia Martensen verblüfft. »Hast du ihn entlassen?«
»Nein, habe ich nicht«, antwortete er seufzend. »Aber er gehört zu diesen Unbelehrbaren, Julia, die sich für unsterblich halten.«
Die schlanke Endvierzigerin nickte. »So hat er auch gewirkt«, stellte sie sachlich fest. »Vergiß ihn, Adrian. Wir haben jede Menge Arbeit.«
Er folgte ihr, und bald darauf hatte er Robert Sandberg tatsächlich vergessen.
*
»Es ist sehr schön, mit Ihnen hier zu sitzen und zu reden«, sagte Mareike Sandberg. Sie sah Esther dabei offen ins Gesicht, und diese erschrak, als sie das Unglück in den schönen Augen der anderen sah. Aber sie tat, als habe sie nichts davon bemerkt, denn sie ahnte, daß es Frau Sandberg nicht recht gewesen wäre, zuviel von sich selbst zu offenbaren.
Esther überlegte, ob eine Frau wie Mareike wohl eine Freundin hatte, mit der sie über alles, was sie bewegte, sprechen konnte. Wenn nicht, dann mußte sie sehr einsam sein in ihrem riesigen Haus mit den vielen Dienstboten und dem Mann mit den kalten Augen. Warum sie ihn wohl geheiratet hatte?
Sie war so in ihre Gedanken versunken, daß sie völlig verblüfft war, als sie plötzlich bemerkte, daß etwas geschehen sein mußte. Denn auf einmal lächelte Mareike Sandberg, ihre Augen glänzten, und auf ihren Wangen lag ein rosiger Schimmer. Im nächsten Augenblick wußte Esther auch, warum das so war.
Ein dunkelhaariger junger Mann mit blauen Augen blieb an ihrem Tisch stehen und grüßte höflich. Esther kannte ihn genauso gut und genauso wenig wie Mareike Sandberg. Es war John Tanner, von dem sie nur wußte, daß er Künstler war. Außerdem war er ebenfalls leidenschaftlicher Reiter und fiel, wie Mareike auch, in dem exklusiven Reitstall eher aus dem Rahmen. Esther hatte bisher erst wenige Worte mit ihm gewechselt, aber es war jedesmal angenehm gewesen.
Er war klug, gebildet und überhaupt nicht arrogant. Es war ihr ein Rätsel, wie er in jenen exklusiven Reitclub geraten war. Bei Mareike Sandberg lag es wegen ihrer gesellschaftlichen Stellung auf der Hand, aber bei John Tanner hatte sie sich sogar schon gefragt, ob er überhaupt reich war. Sie hatte ihn ein paarmal in einem uralten, zerbeulten Auto gesehen, und seine Kleidung bestand in der Regel aus Jeans und karierten Hemden oder T-Shirts.
»Guten Tag, Herr Tanner«, sagte sie freundlich, als sie merkte, daß es Mareike offenbar die Sprache verschlagen hatte. »Warum setzen Sie sich nicht ein wenig zu uns?«
»Wenn ich nicht störe«, erwiderte er und warf Mareike einen fragenden Blick zu.
Sie errötete heftig und rückte zur Seite. Dann sagte sie leise: »Natürlich stören Sie nicht.«
Er setzte sich, und schon bald waren sie in ein angeregtes Gespräch vertieft, an dem sich alle drei beteiligten. Erstaunt sah Esther, daß Mareike auch temperamentvoll ihre Meinung vertreten und richtig aus sich herausgehen konnte. Sieh mal einer an, dachte sie, sie ist gar nicht so sanft und still, wie ich immer dachte. Sie hat auch andere Seiten.
Und John Tanner? Auch ihn hatte sie bisher noch nie so erlebt. Er war ihr sonst immer eher ernsthaft vorgekommen, aber heute lachte er mehrmals aus vollem Herzen. Schließlich hörte Esther auf, sich darüber Gedanken zu machen, und sie genoß es, sich mit den beiden zu unterhalten.
Schon lange, so kam es ihr vor, hatte sie kein so interessantes Gespräch mehr geführt.
*
Als Mareike nach Hause kam, wirbelten noch immer tausend Gedanken durch ihren Kopf. Wie schön das Leben sein konnte, wenn man mit Menschen zusammen war, mit denen man sich gern unterhielt, die gut zuhören konnten und die über vieles, was in der Welt passierte, nachdachten. Ach, wenn sie doch nur einmal so mit Robert hätte reden können! Aber sobald sie es versuchte, lächelte er nur herablassend und sagte: »Zerbrich dir darüber nicht deinen hübschen Kopf, Mareike, das tun andere schon zur Genüge.«
Als sie das Haus betrat, spürte sie sofort, daß etwas nicht in Ordnung war.
Im nächsten Augenblick teilte ihr eins der Mädchen leise mit, Herr Sandberg habe einen Zusammenbruch erlitten, der Arzt sei bereits bei ihm gewesen.
Die fröhliche Stimmung, die Mareike bis eben noch erfüllt hatte, verflog sofort. Sie eilte die Treppe hinauf in den ersten Stock und stand im nächsten Augenblick am Bett ihres Mannes, dem es sichtlich nicht gutging. Er war sehr blaß und atmete schwer. Das hinderte ihn jedoch keineswegs daran, sie böse anzufunkeln und zu sagen: »Niemand wußte, wo du warst. Ich liege hier seit Stunden und muß mich von Dienstboten versorgen lassen, während sich meine Frau Gott weiß wo herumtreibt!«
»Aber Robert!« sagte sie erschrocken. »Ich war im Reitstall, das wußtest du doch.«
»Ich habe dort angerufen, und man sagte mir, du seist bereits wieder fort. Das ist schon Stunden her.«
»Ich habe mit einer Bekannten noch ein Glas Wein getrunken«, stammelte sie. »Ich konnte doch nicht wissen…«
»Dein Platz ist hier!« sagte er herrisch.
»Bei mir. Und nicht bei irgendwelchen Bekannten von irgendwelchen Reitclubs. Wie oft soll ich dir noch sagen, daß du endlich erwachsen werden sollst!«
Sie sagte nichts mehr, es hatte ohnehin keinen Zweck. Er würde nur immer wütender werden, das wußte sie. Sie konnte es ihm nicht recht machen. Wäre sie hier gewesen, hätte er einen anderen Grund gefunden, um sie zu tadeln.
»Was ist passiert?« fragte sie leise.
»Schön, daß du dich auch schon dafür interessierst«, sagte er mit beißendem Spott. »Irgend so ein hergelaufener junger Arzt in einer Klinik hat mir erklärt, ich sei knapp an einem Schlaganfall vorbeigekommen.«
»Was?« fragte sie entsetzt. »Welcher Arzt denn? Und in welcher Klinik bist du gewesen?«
»Müller hat sich eingebildet, er müsse mich sofort in eine Klinik bringen«, antwortete ihr Mann mürrisch. »Er hat mich in die Kurfürsten-Klinik gebracht, und dort in der Notaufnahme hat sich so ein junger Schnösel wichtig gemacht.«
Er schnaubte bei der Erinnerung daran, was er sich alles hatte anhören müssen, obwohl er nach wie vor zugeben mußte, daß ihn die ruhige Souveränität des jungen Arztes sehr beeindruckt hatte. Aber das wußte seine Frau nicht, und sie würde es auch nie erfahren.
»Und was hat er gesagt, dieser Arzt?« fragte Mareike.
»Nichts, was ich nicht längst weiß«, antwortete Robert Sandberg. »Wenig Alkohol, viel Bewegung, gesunde Ernährung, kein Stress – kurz gesagt, lauter dummes Zeug. Wir leben hier schließlich nicht auf einer Insel der Glückseligkeit. Ich kann die Welt nicht ändern, ich muß sie so nehmen, wie sie ist.«
»Etwas könntest du schon ändern«, wagte sie einzuwenden. »Beim Essen und beim Alkohol zum Beispiel…«
Eine steile Zornesfalte erschien auf seiner Stirn, und sie schwieg erschrocken. »Jetzt fang du nicht auch noch damit an!« rief er erbost. »Mir reicht’s für heute. Und jetzt laß mich allein, ich bin müde.«
Sie zögerte, aber der Blick, mit dem er sie ansah, war so hart und kalt, daß sie tat, was er wünschte. »Gute Nacht, Robert«, sagte sie leise und ging aus dem Zimmer.
*
John Tanner arbeitete an einem Auftrag, den er von einem Museum bekommen hatte. Er restaurierte ein Gemälde aus dem siebzehnten Jahrhundert. Die Arbeit war knifflig und erforderte viel Geduld und handwerkliches Geschick. Normalerweise liebte er solche Aufgaben, aber heute schien es ihm, als habe er zwei linke Hände. Nichts wollte ihm gelingen, für alles brauchte er ewig lange Zeit.
Stirnrunzelnd sah er auf das, was er bisher geschafft hatte. Es war fast nichts! Woran lag das nur? Sonst arbeitete er in den frühen Morgenstunden am besten, aber heute flogen seine Gedanken hierhin und dorthin, und diese Unkonzentriertheit rächte sich bitter. Dabei hatte er einen Termin, zu dem er die Arbeit abgeschlossen haben mußte. Er konnte es sich nicht leisten, herumzutrödeln.
Erneut beugte er sich über das Bild. Die blonde Frau dort in der Ecke – hatte sie nicht Ähnlichkeit mit Mareike Sandberg? Er unterdrückte einen Fluch. Wenn er nicht endlich aufhörte, an sie zu denken, dann würde er mit seiner Arbeit nie fertig werden.
Sie war eine reiche und schöne Frau, und verheiratet war sie auch. Warum nur konnte er nicht aufhören, an sie zu denken? Sie war für ihn völlig unerreichbar, und es wurde allerhöchste Zeit, daß er sich das klarmachte. Aber sein Herz spielte nicht mit. Sein Herz wollte träumen! Ende der Woche würden sie sich vermutlich sehen im Reitstall, sie hatte erwähnt, daß sie am Freitag dort sein wollte…
Und allein, daß sie das getan hatte, brachte ihn nun fast um den Verstand. Warum hatte sie den Tag erwähnt? Sein Herz sagte: ›Weil sie dich sehen will‹, aber sein Verstand wußte, daß das unmöglich war. Er war kein Mann für eine Frau wie sie. Und sie war keine Frau für ein Abenteuer. Sie hatte, seit sie verheiratet war, sicherlich niemals einen anderen auch nur angesehen, während man von ihrem Mann ganz andere Geschichten hörte.
Aber das ging ihn nichts an. Nie jedenfalls hatte Mareike Sandberg zu erkennen gegeben, daß sie mehr in ihm sah als einen Mann, der zufällig Pferde genauso liebte wie sie.
Pferde… Er stieß einen lauten Seufzer aus. Eigentlich war er in diesem teueren Club völlig fehl am Platze, er konnte mit den meisten Leuten, die dort verkehrten, überhaupt nichts anfangen. Das war nicht seine Welt. Und wenn er nicht zufällig für den Besitzer des Clubs vor zwei Jahren eine sehr aufwendige Restaurierungsarbeit übernommen hätte – der Mann hatte eine sagenhafte Kunstsammlung in seiner Wohnung –, dann wäre er niemals in diesen Club gelangt. Aber damals war John mit seinem Auftraggeber irgendwann einmal auf die einzige Leidenschaft zu sprechen gekommen, die er außer seiner Arbeit noch hatte, und das waren Pferde.
Schließlich hatte er die Arbeit abgeschlossen, und der Clubbesitzer war außerordentlich zufrieden gewesen. Mit Recht, fand John noch heute. Er hatte sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, und er war auch gut dafür bezahlt worden. Aber nicht nur das: eines Tages hatte John eine Mitgliedskarte für den teuren Reitclub zugeschickt bekommen, ohne auch nur einen Cent dafür bezahlt zu haben. Sein Auftraggeber hatte also ihr Gespräch über Pferde nicht vergessen.
Ja, so etwas gab es auch noch, selbst heute, wo doch die Menschen angeblich nur an sich selbst dachten.
Aber ganz so war es offensichtlich doch nicht. Und wenn er nicht durch diesen Zufall in den teuren Club geraten wäre, hätte er Mareike Sandberg sicherlich niemals kennengelernt. Sie lebten einfach nicht in der gleichen Welt.
Er konnte sich noch gut an seine Gedanken erinnern, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Er hatte sie für eine von diesen schönen, verwöhnten Ehefrauen gehalten, die nichts anderes taten, als mit Freude das Geld ihrer Männer auszugeben.
Unwillkürlich lächelte er. Das war ein Vorurteil gewesen. Selten hatte er sich so getäuscht wie in diesem Fall, das hatte er schon bald erkannt. Ja, und seitdem spielte sein Herz verrückt, wenn er nur in ihre Nähe kam.
Er riß seine Gedanken nun mit Gewalt von diesem Thema los und beugte sich energisch über das Bild. Tatsächlich gelang es ihm, fast eine Stunde lang zu arbeiten, ohne daß er ständig Mareikes ein wenig zu vollen Mund vor sich sah.
Danach gab er es auf. Er würde es heute nicht mehr schaffen, vernünftig zu arbeiten, da konnte er genausogut auch noch ein bißchen reiten gehen. Mareike würde heute sicher nicht kommen, von daher drohte seinem Herzen an diesem Tag also keine Gefahr mehr.