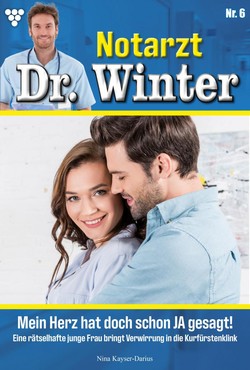Читать книгу Notarzt Dr. Winter 6 – Arztroman - Nina Kayser-Darius - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie hübsche junge Frau lag völlig reglos auf der Parkbank. Sie war sehr blaß, ihre langen blonden Haare hingen ihr unordentlich ins Gesicht. Ihre Kleider sahen teuer aus, und sie wirkte eigentlich gar nicht wie »so eine«, fand der Rentner Ewald Mönke, der ein wenig ratlos vor ihr stand, aber sie mußte wohl doch eine sein. Eine andere Erklärung fand er jedenfalls nicht. Er hatte versucht, sie aufzuwecken, und es war ihm nicht gelungen.
»So eine« war für ihn eine Drogenabhängige. Mit Junkies kannte er sich aus, denn die Wohnung, in der er seit mehr als dreißig Jahren lebte, lag mittlerweile in einer Gegend, die Politiker gerne mit dem Namen »sozialer Brennpunkt« umschrieben. Früher war es eine gute Wohngegend gewesen, aber diese Zeiten waren schon lange vorbei. Sogar unten im Flur des Hauses, in dem er selbst wohnte, hatte er schon gesehen, daß Drogen den Besitzer wechselten – aber was sollte ausgerechnet er dagegen tun?
Wenn nicht einmal die Polizei etwas erreichte, dann konnte ein armer Rentner wie er, der froh war, die Miete für seine schäbige kleine Wohnung noch bezahlen zu können, erst recht nichts ausrichten.
Ewald Mönke murmelte beschwichtigend: »Sei ruhig, Herr Müller. Mir wird schon was einfallen, aber ich muß nachdenken. So lange wirst du dich ja wohl gedulden können, oder etwa nicht?«
Herr Müller, eine recht häßliche Promenadenmischung mit wunderschönen braunen Augen, bellte leise, um seine Zustimmung auszudrücken. Er ließ sich direkt vor der Parkbank nieder, wobei er sein Herrchen unablässig ansah, um nur ja nicht den Moment zu verpassen, in dem dieser sich erneut in Bewegung setzen würde.
Ewald Mönke und Herr Müller befanden sich nämlich auf ihrem täglichen Morgenspaziergang, der mindestens eine Stunde dauern mußte, um Herrn Müller auch nur annähernd zufriedenzustellen. Sie waren kaum zehn Minuten unterwegs gewesen, als Ewald Mönke völlig unprogrammgemäß stehengeblieben war.
Aber Herr Müller war ein wohlerzogener Hund, deshalb gab er keinen Mucks mehr von sich, sondern wartete. Nur sein kleines Stummelschwänzchen, das unablässig hin und her schlug, verriet seine Ungeduld.
»Ich weiß, was ich tue, Herr Müller«, sagte Ewald Mönke in diesem Augenblick erleichtert. »Ich rufe einen Rettungswagen, der bringt die Frau ins Krankenhaus, und dort werden sie dann schon herausfinden, was mit ihr los ist.«
Herr Müller jaulte leise, und Ewald Mönke beugte sich erneut über die junge Frau und sagte: »Hallo, Sie! Wenn Sie jetzt nicht aufwachen, hole ich einen Rettungswagen, hören Sie? Vielleicht wollen Sie ja nicht ins Krankenhaus, dann sollten Sie jetzt aber wirklich schnellstens aufwachen und mir sagen, was mit Ihnen los ist! Sie haben mir einen großen Schrecken eingejagt – einfach so hier zu liegen am frühen Morgen und sich nicht zu rühren!«
Er wartete einige Sekunden, doch er bekam auch dieses Mal keine Antwort. Deshalb wandte er sich seufzend ab. »Komm, Herr Müller!« sagte er. »Wir müssen jetzt zuerst telefonieren. Danach gehen wir wieder in den Park.«
Das war nicht direkt das, was Herr Müller gewollt hatte, aber er ergab sich in sein Schicksal und folgte seinem Herrchen, das den Park auf dem schnellsten Wege verließ.
*
»Adrian?« Schwester Monika Ullmann kam in den kleinen Aufenthaltsraum gestürmt, in dem sich der Unfallchirurg Dr. Adrian Winter gerade eine Tasse Kaffee eingeschenkt hatte, um etwas wacher zu werden. Es war Vollmond, und er hatte nicht besonders gut geschlafen.
»Eine junge Frau wird gleich gebracht«, sagte Schwester Monika außer Atem. »Ein Rentner hat sie in einem Park gefunden, auf einer Parkbank, und er hat sie nicht aufwecken können. Verdacht auf Drogenmißbrauch.«
Adrian nahm einen zu großen Schluck Kaffee und verbrannte sich die Zunge. »Au, verdammt!« Er verzog das Gesicht und stellte hastig die Tasse ab. Dann lächelte er die hübsche Schwester an. »Ich bin sofort da, Moni. Haben sie sonst noch etwas gesagt? Ist sie immer noch ohne Bewußtsein?«
»Nein, im Wagen ist sie zu sich gekommen. Mehr haben sie nicht gesagt. Sie hatten es ziemlich eilig.«
Adrian trank den restlichen Kaffee – diesmal war er vorsichtiger und nahm nur kleine Schlucke, um sich nicht noch einmal zu verbrennen. Dann folgte er Schwester Monika in eine der Notfallkabinen. »Bereite schon mal eine Infusion mit Kochsalz vor, Moni, und außerdem…«
Er kam nicht dazu weiterzusprechen, denn in diesem Augenblick wurde die angekündigte junge Frau auch schon gebracht. »Die Patientin ist achtundzwanzig Jahre alt, wieder bei Bewußtsein. Behauptet, keine Drogen zu nehmen, kann aber nicht erklären, warum sie bewußtlos auf der Parkbank gelegen hat. Stark unterkühlt, sie hat dort offenbar die ganze Nacht verbracht. Sie hat bereits eine kreislaufstabilisierende Infusion bekommen«, berichtete einer der Sanitäter. »Wir müssen wieder los, Herr Dr. Winter!«
Adrian nickte und wandte sich der Patientin zu. »Wo ist Julia?« fragte er.
»Sie kommt gleich, sie war bis eben mit einem Herzanfall beschäftigt«, antwortete Schwester Monika, die der Patientin die Infusion mit Kochsalzlösung anlegte.
»Ich brauch’ sie hier«, sagte Adrian knapp, und Schwester Monika verschwand gleich darauf wortlos, um sich auf die Suche nach Dr. Julia Martensen zu machen. Adrian Winter und sie bildeten ein großartiges Team – der junge, engagierte Chirurg und die souveräne, bereits auf die fünfzig zugehende Internistin.
»Können Sie mich hören?« fragte Adrian die junge Frau, die ihn aus großen blauen Augen ansah. Er war sicher, daß sie ihn hörte, aber offenbar verstand sie nicht, was vor sich ging.
»Ja«, antwortete sie. Mehr sagte sie nicht.
»Ist sie das?« fragte Julia Martensen, die in diesem Augenblick hereinkam.
»Ja, ich finde nicht, daß sie wie eine Drogensüchtige aussieht«, sagte Adrian nachdenklich. »Sie hat auch keinerlei Einstiche oder so.«
»Vielleicht kokst sie«, erwiderte Julia nüchtern. Sie war eine gutaussehende, sehr schlanke Frau mit kurzen braunen, nach der neuesten Mode geschnittenen Haaren. »Irgendwelche Verletzungen?«
»Ich habe keine entdecken können«, stellte Adrian fest. »Sie ist dehydriert und unterkühlt, das steht fest. Moni, bitte besorg als erstes ein paar angewärmte Decken. Und sie sollte auch eine angewärmte Infusion bekommen. Wir führen ihr zunächst einmal Flüssigkeit zu, machen eine große Blutuntersuchung mit Drogenscreening, und danach sind wir hoffentlich klüger.«
Julia beugte sich über die Patientin, die unruhig war, aber noch immer nichts sagte. »Wie heißen Sie?« fragte sie behutsam.
Die junge Frau sah sie an und drehte den Kopf weg. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Julia richtete sich auf und blickte Adrian fragend an. »Verstehst du das?«
»Nein«, antwortete er leise. »Ich verstehe es auch nicht, aber das Beste wird sein, wenn wir sie erst einmal in Ruhe lassen. Vielleicht sind wir nach den Untersuchungen klüger.«
Schwester Monika kam mit den angewärmten Decken, in die sie die Patientin mit vereinten Kräften hüllten, und bald darauf wurde ihr auch noch eine angewärmte Infusion angelegt. Sie nahmen ihr Blut ab und schickten es mit der Bitte ins Labor, es möglichst bald zu untersuchen.
»Merkwürdiger Fall«, murmelte Adrian kopfschüttelnd vor sich hin. »Normalerweise würde ich sagen, sie muß sich nur ordentlich aufwärmen, genug essen und trinken, und danach wird sie sich sofort besser fühlen. Aber ich habe ein komisches Gefühl bei der Sache.«
»Ich auch«, gestand Julia, und das überraschte ihren jüngeren Kollegen. Julia stand mit beiden Beinen auf der Erde, und sie glaubte in der Regel nur das, was man ihr auch beweisen konnte. Für Intuition war in ihrem Team Adrian zuständig – obwohl man sie im allgemeinen eher den Frauen nachsagt. Aber in der Notaufnahme der Kurfürsten-Klinik in Berlin, die Dr. Adrian Winter leitete, waren zumindest in diesem Punkt die Rollen anders als üblich verteilt.
»Es bleibt uns trotzdem nichts anderes übrig, als die Laborergebnisse abzuwarten«, stellte Adrian fest. »Meinst du, wir sollten noch ein CT machen lassen?«
»Wegen ihrer Bewußtlosigkeit, meinst du?«
Er nickte.
»Wenn uns die Laborwerte nicht weiterhelfen, würde ich das auf jeden Fall tun«, antwortete sie. »Es könnte natürlich einfach ein Kreislaufkollaps gewesen sein, weil sie offenbar nichts gegessen und getrunken hat. Aber ich hoffe, daß sie anfängt zu reden, sobald es ihr bessergeht. Vielleicht erfahren wir dann alles, was wir wissen wollen.«
Er glaubte es nicht, und sie ebensowenig, das sah er ihr an. Aber er sagte nichts mehr.
Im Augenblick jedenfalls konnten sie nichts tun.
*
Lukas Bromberger hatte keinen Blick für Frankfurts neue Hochhäuser. Er wollte so schnell wie möglich nach München zurück, denn dort wartete Felicitas auf ihn. Seine wunderschöne blonde Verlobte, die er zärtlich Feli nannte. Sie waren schon seit zwei Jahren ein Paar und würden in vier Wochen endlich heiraten. Er hatte sie schon öfter gefragt, aber sie hatte nicht so früh heiraten wollen. »Laß uns erst ganz sicher sein, Lukas«, hatte sie jedesmal gesagt. »Wir haben es doch nicht eilig.«
Er hatte es sehr wohl eilig gehabt, aber das hätte er niemals zugegeben. Noch immer konnte er sein Glück nicht fassen, daß sie sich unter allen Männern dieser Welt ausgerechnet ihn ausgesucht hatte. Lukas litt nicht an mangelndem Selbstbewußtsein, denn er hatte es mit seinen zweiunddreißig Jahren schon weit gebracht. Er hatte eine eigene Agentur für Öffentlichkeitsarbeit, die gut lief, er sah gut aus mit seinen braunen Locken und den warmen braunen Augen, und er war ein allgemein sehr beliebter Mann. Er hielt sich außerdem für jemanden, auf den man sich verlassen konnte.
Trotzdem fand er, daß er nichts Besonderes war – Feli hingegen war das sehr wohl. Sie war nicht nur schön und klug, sie hatte auch eine Menge Temperament, sie war künstlerisch begabt, darüber hinaus humorvoll und zuverlässig. Lukas fand, daß das eine einmalige Kombination war. Er zumindest kannte keine andere Frau, die so viele positive Eigenschaften hatte wie Feli. Ein Leben ohne sie erschien ihm absolut unvorstellbar.
Und deshalb war er nicht gern länger von ihr getrennt. Deshalb auch hatte er es mit dem Heiraten so eilig.
Denn noch immer saß ihm die Angst im Nacken, ein anderer Mann könnte kommen und ihr Herz im Sturm erobern. Ein Mann, der genauso etwas Besonderes war wie Feli.
Lukas seufzte. Es wäre sehr viel schöner gewesen, wenn er nicht immer diese Angst gehabt hätte, sie zu verlieren. Er war sonst gar nicht so. Er neigte nicht übermäßig zur Eifersucht, und er war auch niemand, der sich viele Gedanken um »ungelegte Eier« machte. Aber wenn es um Feli ging, dann funktionierte sein Gehirn völlig anders als gewöhnlich. Es war offenbar die Liebe, die das bewirkte.
»Herr Bromberger?«
Der Auftraggeber, mit dem er sich in einem exklusiven Frankfurter Hotel getroffen hatte, sah ihn fragend an, und Lukas wurde es abwechselnd heiß und kalt. Er hatte dem anderen mindestens eine Minute lang nicht zugehört und dementsprechend nicht die geringste Ahnung, was dieser jetzt von ihm hören wollte. Das war unverzeihlich, schließlich ging es bei dem möglichen Auftrag um eine Menge Geld. Er entschloß sich, die Wahrheit zu gestehen und sein Gegenüber dadurch zu entwaffnen.
»Entschuldigen Sie bitte, aber Sie wissen vielleicht, daß ich in vier Wochen heiraten werde. Und deshalb passiert es mir in letzter Zeit gelegentlich, daß ich an meine zukünftige Frau denke, wenn ich mich eigentlich auf meine Arbeit konzentrieren sollte. Wenn Sie können, verzeihen Sie mir, daß ich einige Augenblicke lang mit meinen Gedanken woanders war.«
Auf dem Gesicht des Mannes, der ihm gegenüber saß, erschien ein breites Lächeln. »Kann ich gut verstehen – schließlich war ich auch mal frisch verliebt!« Er wiederholte, was er gesagt hatte, und diesmal antwortete Lukas ausführlich und mit großem Sachverstand.
Allmählich entspannte er sich wieder. Offenbar hatte er diese gefährliche Situation gemeistert. Jetzt durfte er sich nur keinen weiteren Patzer leisten, dann hatte er den Auftrag sicher in der Tasche.
*
»Kein Alkohol, keine Drogen«, stellte Dr. Adrian Winter fest, als die Laborwerte der jungen Patientin vorlagen, die noch immer in der Notaufnahme war. »Aber sie muß stationär aufgenommen werden, denn sie hat sich vielleicht eine Lungenentzündung geholt. Zur Vorsicht muß sie weiter beobachtet werden.«
»Wir können sie auf die Innere verlegen«, meinte Julia Martensen, »wir haben noch einige Betten frei, und ich kann mich dort weiter um sie kümmern.«
»Du hast diese Woche Dienst in der Notaufnahme, vergiß das nicht«, sagte Adrian mit gespielter Strenge. »Da wird nicht nebenbei noch heimlich auf der Station nach dem Rechten gesehen.«
Sie lächelte ihn voller Zuneigung an. »Das mußt ausgerechnet du sagen! Dr. Adrian Winter, der Arzt, der sich noch um Patienten kümmert, wenn sie die Notaufnahme längst verlassen haben.«
»Schon gut, schon gut«, murmelte er verlegen, »ich sag’ keinen Ton mehr. Aber laß uns bitte noch einmal zu ihr gehen, ob sie jetzt bereit ist, mit uns zu reden. Ihr Fall wird immer rätselhafter. Wenn weder Drogen noch Alkohol im Spiel sind, Julia, was hat sie dann auf dieser Parkbank getan? Sie wirkt doch nicht so, als hätte sie keine Wohnung, in die sie gehen könnte. Warum also war sie unterkühlt, dehydriert und hatte nichts im Magen?«
»Ich kann es dir auch nicht sagen«, antwortete seine Kollegin. »Kreislaufkollaps, etwas anderes wüßte ich nicht. Komm, wir fragen sie selbst.«
Wenige Auenblicke später standen sie neben der jungen Frau, die ihnen entgegensah, aber durch nichts zu erkennen gab, daß sie sich erinnern konnte, wer sie waren.
»Wissen Sie, wo Sie sind?« fragte Julia behutsam.
»Nein«, antwortete die Patientin, und Adrian atmete auf. Immerhin hatte sie geantwortet, das war schon mal ein Fortschritt.
»In der Kurfürsten-Klinik in Berlin«, sagte er. »Sie sind hier in der Notaufnahme. Können Sie sich erinnern, wie Sie hierher gekommen sind?«
Wieder antwortete sie mit: »Nein.« Ihre großen blauen Augen waren jetzt aufmerksam auf die beiden Ärzte gerichtet.
»Sie sind auf einer Parkbank gefunden worden«, fuhr Julia fort. »Sie waren bewußtlos, und der ältere Herr, der Sie gefunden hat, hat sich Sorgen um Sie gemacht und einen Rettungswagen gerufen.« Sie hatte absichtlich nichts von dem Verdacht auf Drogenmißbrauch gesagt. Adrian war froh darüber.
»Bitte, sagen Sie uns, wie Sie heißen«, sagte er. »Ich bin Dr. Adrian Winter und leite hier die Notaufnahme. Dies ist meine Kollegin Dr. Julia Martensen, sie ist Internistin. Wir werden Sie auf die Innere verlegen, weil Sie stark unterkühlt waren und wir sichergehen wollen, daß Sie sich keine Lungenentzündung geholt haben.«
Er bekam keine Antwort.
»Wie heißen Sie?« wiederholte Julia die Frage.
»Doris… Doris Willbrandt.« Sie stieß die Worte hervor, als bereiteten sie ihr körperliche Schmerzen.
»Wen sollen wir benachrichtigen, Frau Willbrandt?« fragte Adrian.
»Benachrichtigen?« fragte sie verwirrt.
»Ja, daß Sie hier sind«, erklärte er geduldig. »Ihre Eltern? Ihren Mann? Freunde? Sie werden doch sicher jemandem mitteilen wollen, daß Sie jetzt in einer Klinik sind. Außerdem macht man sich bestimmt bereits Sorgen um Sie.«
Es war, als lege sich ein Schatten über ihr Gesicht. Sie öffnete den Mund und schloß ihn wieder. Julia Martensen und Adrian Winter warteten geduldig. Schließlich sagte Doris Willbrandt: »Ich wohne in Hamburg, Sie müssen niemanden benachrichtigen. Das würde nur für Unruhe sorgen. So schlecht geht es mir ja nicht. Ich wollte mir ein paar Tage Berlin ansehen und dann zurückfahren. Kein Grund, meine Familie zu beunruhigen.«
»Wie Sie wollen«, meinte Adrian nach kurzem Zögern. Kam es ihm nur so vor – oder reagierte sie tatsächlich erleichtert, als er das sagte?
»Gut«, sagte Julia energisch, »dann schlage ich vor, wir verlegen Frau Willbrandt auf die Innere, und danach sehen wir weiter. Allerdings müssen wir noch herausfinden, warum Sie bewußtlos geworden sind. Das können wir uns nämlich nach wie vor nicht erklären.«
Diesmal war es ganz eindeutig, daß die Patientin erschrak. Mit großen Augen fragte sie: »Was meinen Sie damit?«
»Nun, ein gesunder Mensch wird nicht einfach bewußtlos, wenn er auf einer Parkbank sitzt oder liegt«, erklärte Julia freundlich. »Es muß einen Grund dafür geben, und den sollten wir herausfinden, bevor wir Sie wieder entlassen, Frau Willbrandt.«
Die junge Frau preßte ganz fest die Lippen zusammen, dann fragte sie: »Und wie wollen Sie das herausfinden?«
»Wir werden ein CT machen – eine Computertomographie also. Das tut nicht weh. Vielleicht gibt es uns Aufschluß über das, was passiert ist.«
»Das möchte ich nicht«, erklärte die Patientin. »Dazu wird man doch in so eine Röhre geschoben, nicht?«
Beide Ärzte nickten.
»Ich habe Platzangst. Das will ich nicht!« wiederholte Doris Willbrand, diesmal mit allen Anzeichen von Panik in der Stimme.
»Beruhigen Sie sich bitte«, sagte Adrian Winter ruhig. »Wir werden Sie zu nichts zwingen, Frau Willbrandt. Wir dachten nur, daß wir Ihnen so vielleicht am besten helfen können.«
»Ich bin spätestens morgen wieder fit«, erklärte die junge Frau. »Ich war hungrig und müde, da hat mein Kreislauf schlapp gemacht – das ist alles. Lassen Sie mich nur ein bißchen schlafen und essen, dann sind Sie mich auch schon wieder los.«
»So eilig haben wir es gar nicht, Sie loszuwerden«, erklärte Adrian mit einem kleinen Lächeln. »Vor allem wollen wir, daß Sie wieder völlig gesund sind und nicht mehr an rätselhaften Ohnmachten leiden.«
Sie preßte die Lippen fest zusammen, erwiderte aber nichts mehr.
Julia und Adrian wechselten einen schnellen Blick, dann sagte Julia: »Ich bringe Sie jetzt zunächst einmal auf die Innere, Frau Willbrandt. Alles andere sehen wir später.«
Mit Adrians Hilfe schob sie die Liege aus der Kabine und machte sich auf den Weg zum Fahrstuhl. Adrians nachdenklicher Blick folgte den beiden. Irgend etwas stimmte hier nicht. Aber was?
*
Thomas Laufenberg, der neue Verwaltungsdirektor der Kurfürsten-Klinik, sah seine Mitarbeiterin Sabine Meyer fragend an. »Was soll das heißen?« erkundigte er sich stirnrunzelnd. Er war ein gutaussehender Mann von dreiundvierzig Jahren, mit braunen Haaren, die sich an den Schläfen bereits silbrig färbten. Ihm gefiel das nicht besonders, aber Frauen fanden es in der Regel äußerst interessant. Davon wußte er allerdings nichts, denn das hatte ihm noch keine gesagt.
Die junge Frau, die jetzt vor ihm stand, hatte noch nicht viel Berufserfahrung, und sie hatte außerdem Angst vor Thomas Laufenberg. Es gab dafür zwar keinen Grund, denn er war bisher immer freundlich zu ihr gewesen, aber sie fürchtete sich trotzdem. Er war immerhin ein »hohes Tier« an diese Krankenhaus, und sie hatte große Angst, schrecklich zu versagen und dann ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
Sabine Meyer war eigentlich klug, aber die Angst zu versagen blockierte gelegentlich ihr Gehirn, was ein großer Jammer war. Thomas Laufenberg selbst wäre nie auf die Idee gekommen, daß sie Angst vor ihm hatte – er fragte sich deshalb manchmal, ob er sich vielleicht für die falsche Mitarbeiterin entschieden hatte. Aber sie hatte bei allen Tests hervorragend abgeschnitten…
Jetzt strich sie sich die schulterlangen braunen Haare aus dem Gesicht und sagte mit einer Stimme, die kaum wahrnehmbar zitterte: »Die Patientin wurde von der Notaufnahme in die Innere verlegt – sie war unterkühlt, und die Ärzte befürchteten, sie hätte sich vielleicht eine Lungenentzündung zugezogen.«
»Na, und?« fragte der Direktor, der allmählich ungeduldig wurde. »Das ist doch völlig in Ordnung, Frau Meyer. Ich kann kein Problem erkennen.«
Sabine Meyers Stimme zitterte heftiger, aber sie sprach tapfer weiter. »Wir haben von der Frau keine Adresse, keine Krankenversicherungsnummer, nichts…«
»Offenbar weiß sie die Antwort nicht – oder sie tut vielleicht auch nur so. Jedenfalls hat sie jetzt schon zweimal gesagt, daß sie sich an nichts erinnern kann. Oder sie hat andere Ausflüchte vorgebracht. Es war wohl schon schwierig, ihren Namen aus ihr herauszuholen, und deshalb weiß hier niemand etwas über sie, obwohl sie schon seit gestern vormittag hier ist. Und sie ist bei Bewußtsein, daran liegt es also nicht.«
Allmählich fing Thomas Laufenberg an, sich für diesen Fall zu interessieren. Es war zwar eigentlich nicht seine Aufgabe, sich um solche Einzelfälle zu kümmern – aber wenn er es nicht tat, dann tat es vermutlich niemand. Und er mußte es schaffen, dieses Krankenhaus neu und besser zu organisieren, sonst drohte der Kurfürsten-Klinik, wie anderen Häusern auch, Bettenabbau und vielleicht sogar noch schlimmeres.
»Wie heißt die Patientin?« fragte er knapp.
»Doris Willbrandt«, antwortete Sabine Meyer jetzt mit fester Stimme wie aus der Pistole geschossen. »Aber sie ist nicht aus Berlin, sie ist aus Hamburg. Sie hat hier nur einen Kurzurlaub gemacht.«
»Soso, das immerhin hat sie erzählt«, murmelte er. »Wer hat sie aufgenommen?«
»Dr. Winter.«
»Natürlich«, stöhnte Thomas Laufenberg. Das hatte ihm zu seinem Glück gerade noch gefehlt.
Dr. Adrian Winter gehörte zu denjenigen Ärzten der Kurfürsten-Klinik, die dem neuen Verwaltungsdirektor nach wie vor äußerst mißtrauisch, wenn nicht sogar mit versteckter Feindseligkeit gegenüberstanden. Thomas wußte eigentlich gar nicht, warum das so war, denn er bemühte sich wirklich nach Kräften, das medizinische Personal der Klinik in jeder Hinsicht zu unterstützen – aber es war ihm bisher nicht gelungen, Dr. Winter davon zu überzeugen, daß er auf seiner Seite stand und nicht etwa gegen ihn arbeitete.
Und nun also gab es einen Fall, der wieder für einen Zusammenstoß sorgen würde. Denn natürlich konnte es nicht akzeptiert werden, daß Patienten sich weigerten, ihre Personalien vollständig anzugeben. Und wenn Dr. Winter die Patientin aufgenommen hatte, dann mußte er auch dafür sorgen, daß alle notwendigen Informationen über sie vorlagen. Er brauchte sie ja nicht unbedingt selbst zu beschaffen, aber er mußte zumindest dafür sorgen, daß sich jemand um die Angelegenheit kümmerte.
»Geben Sie mir bitte die Unterlagen, ich werde mal sehen, was sich tun läßt«, sagte er und streckte seine Hand aus.
Sabine Meyer reichte ihm die schmale Mappe mit so sichtbarer Erleichterung, daß er unwillkürlich lächeln mußte. »Sie sind wohl froh, daß Sie die lästige Angelegenheit los sind, Frau Meyer, was?«
Sie nickte und floh aus seinem Zimmer, aber das merkte er schon nicht mehr, denn er hatte sich bereits in die spärlichen Informationen vertieft, die die Kurfürsten-Klinik bisher über die Patientin Doris Willbrandt hatte zusammentragen können.
*
Lukas Bromberger war nervös. Er war am Vortag erst sehr spät abends aus Frankfurt zurückgekehrt und hatte es deshalb nicht gewagt, Feli noch anzurufen, obwohl er sie zuvor mehrmals nicht erreicht hatte. Er wußte ja, daß sie eine Menge zu tun hatte, nicht nur mit ihrer Arbeit – sie war Innenarchitektin –, sondern jetzt auch mit den Vorbereitungen für die Hochzeit. Er konnte nicht erwarten, daß sie jederzeit erreichbar war. Sie schaltete ihr Handy oft ab, wenn sie ihre Ruhe haben wollte, obwohl er sie vor seiner Abreise gebeten hatte, das nicht zu tun. Er haßte Tage, an denen er Feli nicht sah, aber noch schlimmer wurden sie, wenn er nicht einmal mit ihr sprechen konnte.
Sein bester Freund Wolfgang Ostermann hatte ihm schon oft gesagt, daß er ihn zu besitzergreifend fand, und insgeheim gab Lukas ihm recht. Er versuchte sich auch immer wieder zusammenzunehmen, aber leider gelang ihm das häufig nicht. Und wenn dann noch eine Situation eintrat wie die jetzige – Feli war nicht zu Hause, sie war auf dem Handy nicht zu erreichen, und die Sekretärin ihres Chefs fragte sich ebenfalls schon, wo sie blieb –, in solchen Situationen fehlte nicht viel, um Lukas vollständig die Fassung verlieren zu lassen.
Er biß die Zähne zusammen und rief ihre Eltern an. »Hier ist Lukas«, meldete er sich, als er die Stimme von Felis Mutter hörte. Bevor er weitersprechen konnte, rief Marianne Markwart erleichtert: »Gott sei Dank, endlich meldet sich wenigstens einer von euch beiden mal, Lukas! Was ist denn in Feli gefahren, daß sie plötzlich von der Bildfläche verschwindet, wo wir so viel zu besprechen haben? Wo ist sie?«
In seinem Kopf rasten die Gedanken. Ihre Eltern haben also auch nichts von ihr gehört! Auf einmal bekam er es mit der Angst zu tun. Feli war kein Mensch, der einfach verschwand, ohne eine Nachricht zu hinterlassen – wieso war ihm das nicht gleich klargewesen? Aber er hatte ja wieder einmal nur an sich gedacht und sich geärgert, daß sie nicht erreichbar gewesen war, als er das Bedürfnis gehabt hatte, mit ihr zu sprechen. Was für ein dämlicher Egoist bin ich doch! dachte er, aber das half ihm natürlich auch nicht weiter.
»Lukas?« fragte Marianne Markwart beunruhigt. »Bist du noch dran?«
Er mußte ihr die Wahrheit sagen, alles andere hatte keinen Zweck. »Ja, bin ich. Entschuldige bitte, Marianne. Ich habe eigentlich bei euch angerufen, weil ich hoffte, daß Feli bei euch ist. Es ist nämlich so, daß ich sie von Frankfurt aus nicht erreicht habe – und seit ich zurück bin, erreiche ich sie auch nicht. Sie ist nicht zu Hause, im Büro ist man schon sauer, weil sie nicht auftaucht, und ihr Handy ist abgeschaltet.«
Für einige scheinbar endlose Sekunden war es totenstill in der Leitung. Dann fragte Felis Mutter mit völlig veränderter Stimme: »Was hat das zu bedeuten, Lukas?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete er, und die Verzweiflung, die er empfand, war seiner Stimme deutlich anzuhören. »Vielleicht gar nichts. Vielleicht hat sie einen wichtigen Termin und hat nur vergessen, im Büro Bescheid zu sagen. In zwei Stunden ist sie wieder da, ruft an und hat eine einleuchtende Erklärung. Und wir haben uns ganz umsonst Gedanken gemacht.«
»Aber du glaubst nicht, daß es so ist.« Es war keine Frage, sondern eine Feststellung.
»Stimmt«, gab er zu. »Ich glaube nicht daran. Aber bevor wir uns verrückt machen, rufen wir zuerst noch ein paar Leute an, die wissen könnten, wo sie ist. Vielleicht hat sie auch plötzlich schreckliche Angst vor der Hochzeit bekommen und heult sich bei einer Freundin aus.«
»Daran glaubst du auch nicht«, sagte Marianne Markwart. »Und ich tue es genausowenig. Wenn ihr nur nichts passiert ist, Lukas. Das alles sieht ihr gar nicht ähnlich – einfach zu verschwinden, meine ich.«
»Ich weiß.« Seine Stimme klang rauh, und er räusperte sich, als es ihm auffiel. »Ich weiß«, wiederholte er, »aber laß uns Ruhe bewahren. Ich werde jetzt ein paar Telefonate führen und wenn niemand etwas von ihr gehört hat, überlegen wir, wie wir weiter vorgehen.«
»Ich werde Gerd noch nichts sagen«, meinte sie ängstlich.
»Das würde ich auch nicht tun an deiner Stelle, das würde seinem Herzen sicher nicht gut bekommen«, sagte Lukas mit erzwungener Ruhe. »Wenn dir noch jemand einfällt, bei dem sie sein könnte, dann ruf bitte dort an. In einer halben Stunde spätestens melde ich mich wieder bei dir.«
»Ist gut, Lukas.« Er hörte die Tränen in ihrer Stimme und legte rasch auf. Es fiel ihm auch so schon schwer genug, sich zu beherrschen. Eine weinende Schwiegermutter konnte er jetzt nicht gebrauchen.
Er griff zu einem Block und fing an, ihn mit Namen von Personen zu füllen, bei denen sich Feli eventuell aufhalten könnte. Aber plötzlich hielt er inne. Das war doch alles Unsinn! Es war Mittwochnachmittag, da arbeiteten fast alle Leute, die sie kannten. Wenn Feli irgendwo war, dann mußte es mit ihrem Beruf zusammenhängen. Seufzend griff er zum Telefon, um erneut in dem Architekturbüro anzurufen, in dem Feli seit einem Jahr arbeitete.
*
»Bitte, Frau Willbrandt, sagen Sie mir jetzt, wo Sie versichert sind. Und dann brauchen wir noch Ihre Adresse in Hamburg. Es ist doch auch in Ihrem Interesse, daß die Formalitäten möglichst schnell geregelt werden.«
Sie wandte der Schwester ihr Gesicht zu und gab ihr mit klarer Stimme Auskunft. Die Überraschung war der anderen deutlich anzusehen. Sie hatte offenbar erneut damit gerechnet, keine Auskunft zu bekommen. Eifrig schrieb die junge Schwester alles auf, was sie ihr diktierte, und dann verließ sie sehr zufrieden das Zimmer.
Das war’s also. Erleichtert sah sie ihr nach. Sie war froh, wieder allein zu sein. Es gab soviel, worüber sie nachdenken mußte. Dieser Krankenhausaufenthalt war in ihrem Plan nicht vorgesehen gewesen, aber jetzt mußte sie eben sehen, wie sie mit der Situation zurechtkam.
Ihr war in der vergangenen Nacht einiges klargeworden, und deshalb hatte sie beschlossen, diesmal auf die Fragen Antwort zu geben. Es war nicht in ihrem Interesse, in dieser Klinik besondere Aufmerksamkeit zu erregen. Im Gegenteil. Und zum Glück ging es ihr bereits bedeutend besser. Von einer Lungenentzündung war nicht mehr die Rede, man würde sie ohnehin bald entlassen. Sie würde mit Frau Dr. Martensen heute darüber reden. Die resolute Ärztin, die gerade Dienst in der Notaufnahme hatte, nahm sich die Zeit, immer mal wieder bei ihr vorbeizukommen und sie zu fragen, wie es ihr ging.
Als hätte sie geahnt, was die junge Frau gerade dachte, betrat Dr. Julia Martensen das Zimmer genau in diesem Augenblick. »Nun, Frau Willbrandt?« fragte sie freundlich. »Wie fühlen Sie sich jetzt?«
»Ganz gut«, antwortete sie, und das entsprach sogar der Wahrheit.
Die Ärztin nickte, fuhr aber fort, sie prüfend anzusehen. Das war sehr unangenehm, am liebsten hätte sie sich versteckt, doch das ließ sich natürlich nicht machen.
»Ich bin froh darüber«, sagte Dr. Martensen schließlich. »Wir haben uns große Sorgen um Sie gemacht, aber das wissen Sie ja schon. In einigen Tagen werden Sie sich wieder ganz gesund fühlen, hoffe ich. Aber ich möchte noch über etwas mit Ihnen reden.«
Sie konnte sich schon denken, worüber, aber ihr Gesicht blieb völlig unbewegt.
»Warum wollen Sie nicht, daß wir ein CT machen?« fragte die Ärztin ruhig. »Es geschieht doch auch zu Ihrer eigenen Sicherheit. Man wird nicht einfach aus heiterem Himmel ohnmächtig, Frau Willbrandt. Es ist wichtig, der Sache auf den Grund zu gehen, glauben Sie mir das.«
Sie nickte. Auch über dieses Problem hatte sie in der vergangenen Nacht nachgedacht. »Ich bin einverstanden«, sagte sie leise. »Aber frühestens morgen. Ich… also, ich brauche noch etwas Zeit, bevor ich mich freiwillig in so eine Röhre begebe.«
»Ich verstehe, daß einem der Gedanke daran unangenehm sein kann«, sagte Julia Martensen ruhig. »Aber Sie können Musik hören während der Zeit oder sich auf andere Weise ablenken. Es ist gar nicht so schlimm, wenn man sich erst einmal klarmacht, wie wichtig die Erkenntnisse sind, die eine solche Aufnahme bringen kann.«
»Ist mir klar.« Ihre Stimme klang gelassen, und das war gut so. Nur nichts von dem durchblicken lassen, was in ihr vorging.
»Dann sind wir uns ja einig. Ich bin froh, daß Sie sich nun doch dazu entschlossen haben, Frau Willbrandt. Bis morgen, ich sehe wieder nach Ihnen.«
»Bis morgen.«
Als sie wieder allein war, schloß sie die Augen. Wenn jetzt noch jemand kommt, wollte sie nicht mehr reden. Sollten sie denken, daß sie schlief – das war ihr recht. Sie hatte genug gesagt. Mehr als genug.
Tränen wollten ihr in die Augen steigen, aber sie hielt sie mit Gewalt zurück. Sie würde jetzt nicht weinen, nein, das würde sie ganz bestimmt nicht tun.
*
»Wir bekommen Besuch, Adrian!« Es war Dr. Bernd Schäfer, Assistenzarzt der Chirurgie, der diesen Satz flüsterte. Er tat es gerade noch rechtzeitig, um Adrian die Gelegenheit zu geben, die Augen unwillig zusammenzukneifen und zu knurren: »Was will der denn hier?«
Die Rede war von Thomas Laufenberg, dem Verwaltungsdirektor, der sich gerade höchstpersönlich in der Notaufnahme blicken ließ. Ein seltener Besuch, obwohl sich »der Neue«, wie selbst Adrian zugeben mußte, seit seinem Amtsantritt vor etlichen Wochen schon öfter hier hatte sehen lassen als sein Vorgänger während mehrerer Jahre. Doch das reichte nicht, um Adrians Urteil über Thomas Laufenberg günstig zu beeinflussen. Für ihn war Laufenberg ein Paragraphenreiter, der nichts anderes im Sinn hatte, als den Ärzten an der Kurfürsten-Klinik das Leben schwerzumachen.
Es gab mittlerweile etliche Kollegen, die mit Thomas Laufenberg sehr zufrieden waren – zu diesen gehörte auch Julia Martensen. Sie mied jedoch dieses Thema, wenn Adrian und sie zusammen Dienst hatten. Es war sinnlos, darüber mit ihm zu diskutieren, er konnte außerordentlich stur sein, wenn er einmal von etwas überzeugt war. Es würde ein Wunder geschehen müssen, um ihn dazu zu bringen, seine Meinung zu revidieren.
Bernd Schäfer hatte sich noch nicht entschieden, was er vom neuen Verwaltungsdirektor halten sollte. Er bewunderte Adrian sehr und schloß sich schon aus diesem Grund gelegentlich unbesehen dessen Meinung an. In diesem Fall aber hatte er eine vage Ahnung, daß sich der sonst so verehrte Notaufnahmechef vielleicht irrte.
Aber, wie gesagt, ganz entschieden war der junge Arzt noch nicht. Er brachte seine beachtlich vielen Pfunde jetzt eilig in Sicherheit – bei einer Auseinandersetzung zwischen Adrian Winter und Thomas Laufenberg wollte er nicht unbedingt in die Schußlinie geraten. Und zu einer Auseinandersetzung würde es sicher kommen, dachte er. Es wäre schließlich nicht das erste Mal.