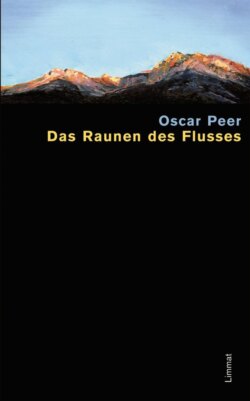Читать книгу Das Raunen des Flusses - Oscar Peer - Страница 4
Mutters Eigenwille
ОглавлениеImmer wieder die Frage: bis wohin reicht das Gedächtnis zurück, diese mysteriöse Fähigkeit, längst Vergangenes von innen her zu sehen. Manches hat sich schon in der Kindheit verankert, wenn auch nur schemenhaft. Oft bin ich nicht sicher, ob etwas Erinnerung ist oder blosse Imagination. Zum Beispiel wie ich im Bettchen liege, wie die Türe aufgeht und meine Mutter lautlos neben mir erscheint, wie sie mit mir redet – wobei ich, im vorsprachlichen Stadium, ihre Worte vermutlich nur als freundliches Gelalle wahrnehme.
Das war noch in Carolina, dessen Welteinsamkeit mich möglicherweise für immer geprägt hat. Kaum zu ermessen, wie sehr Umwelten an uns hängen bleiben. Schon die Mutter selber war eine Umwelt. Ich sehe noch, wie sie mich morgens vom Bett holt, mich auf den Arm nimmt, mit mir in die Stube geht und regelmässig vor den Spiegel tritt. Für sie wahrscheinlich ein heiterer Tagesbeginn, während ich selbst den Spiegel nicht mochte und mir das Gesicht verhüllte. Nachher stand sie mit mir am Fenster.
Ich war noch im Nachthemd, sie selber noch im Schlafrock und mit gelöstem Haar. Sie spazierte mit mir auf dem Arm in der Stube umher; wenn ich kalte Füsse hatte, setzte sie mich auf einen Stuhl, sie selber setzte sich nahe vor mir und nahm meine Füsse, um sie zu wärmen, zwischen ihre Beine. Ich hatte das nicht gern, etwas sträubte sich dagegen, so sehr ich sonst ihre Nähe suchte. Nachts zum Beispiel war ich glücklich, neben ihr zu schlafen und noch im Schlaf ihre Wärme zu spüren. Es bekümmerte mich, wenn ich morgens erwachte und statt ihrer meine Schwester oder einer meiner Brüder neben mir lag. Nächtliche Bettwechsel gab es immer wieder, umständehalber oder weil eines der Grösseren unerwartet auch zur Mutter ins Nest kroch und sie ihn dann nicht vertreiben wollte; nur war für drei zu wenig Platz vorhanden, weshalb sie, sobald der Zuzüger eingeschlafen war, das eigene Bett verliess und im freigewordenen weiterschlief.
Bevor Johann, unser Jüngster, zur Welt kam, genoss ich acht Jahre lang das Privileg des Nestkückens. Vielleicht der Grund einer starken Mutterbindung. Ich frage mich, ob mir aus dieser Bindung nicht sogar Eigenschaften erwachsen sind, die man sonst als erblich bezeichnet, während sie vielleicht durch lange leibliche und seelische Nähe einfach übertragen wurden – in meinem, beziehungsweise unserem Fall eine gewisse Schwerblütigkeit, Stimmungsschwankungen, Wechsel zwischen Geselligkeit und Einsamkeit, gelegentliche Gesellschaftsflucht, Festtagsallergien, Müdigkeit am Morgen und Aufleben bei Nacht. Vielleicht sogar gewisse nervlich bedingte Herzschwächen bei Bise oder Föhn.
Wenn sie hie und da auf Reisen ging, nahm sie mich mit, wobei ich mich schon als Kleiner daran gewöhnt hatte, dass wir fast immer den ersten Zug verpassten. Ich weiss nicht, ob sie nicht auf die Uhr schauen konnte oder ob sich in ihr irgendetwas gegen Uhren und Fahrpläne sträubte. Vielleicht wusste sie schon im voraus ganz genau, dass wir den ersten Zug verpassen würden. Sie hatte ihren eigenen Rhythmus, vor allem eine für sie offenbar lebensnotwendige Morgenlangsamkeit, war dann auch eigenwillig genug, sich von der Welt nichts aufzwingen zu lassen. Eine Hoteldirektorin in St. Gallen, bei der sie einst als erwachsenes Mädchen angestellt gewesen war, soll ihr einmal gesagt haben: «Du hast einen Kopf, und der gehört dir!»
Unsere Reisen fanden meistens an Sonntagen statt. Manchmal gingen wir nach Sent zu ihrer jüngeren Schwester Hermina. Falls wir ausnahmsweise den ersten Zug erwischt hatten, konnten wir in Scuol das Postauto besteigen, das auf uns wartete, durch die Ortschaft fahren und uns dann in sanften Kurven bergwärts tragen lassen. Hinter uns blieb eine Staubwolke zurück, die Strasse war von Bäumen gesäumt. Bei schönem Wetter war das Autodach geöffnet, dann huschten grüne Laubkronen über uns hinweg ... Doch wenn wir erst den zweiten Zug benützt hatten, gab es kein Postauto, dann stand uns ein langer Marsch bevor; zuerst das langgezogene Scuol mit Hotels, Läden und Schaufenstern, und wenn wir die Ortschaft endlich hinter uns hatten, erklärte sie: «Jetzt haben wir schon fast die Hälfte.» Ich widersprach nicht, obwohl ich wusste, dass es nicht stimmte. Kurz nach dem Dorfausgang gab es oberhalb der Strasse eine schwefelhaltige Mineralquelle. Wir gingen hinauf, man konnte eine Röhre nach unten drücken, worauf das Wasser kam. Ich fand es scheusslich, trank aber trotzdem, weil es gratis war und weil Mutter erklärte, das fördere den Appetit für das herrliche Mittagessen, das uns in Sent erwarte. Nachher ging es den Berg hinauf, Kurven hin und her, Naturstrasse, am Rande die staubige Böschung, graue Wermutsträucher, Disteln und Grillengezirp. Sie musste mich ein bisschen ziehen und immer wieder aufmuntern. Irgendwo sah man auf dem Berg endlich das Dorf, eine kompakte Häuserkulisse im blauen Himmel, aber noch unendlich fern. Man sah den schlanken Turm, vernahm etwas Glockengeläute. Irgendwo machten wir eine Pause, sie nahm ihr Taschentuch, benetzte es mit Speichel und putzte irgendeine Stelle an meinem Gesicht. Doch unsere Ankunft in Sent, das Haus der Verwandten, die Begrüssung und das herrliche Mittagessen, mit dem sie mir den Marsch schmackhaft gemacht hatte, das ist weg, vergessen, ausgelöscht, als wären wir nie in Sent angekommen. Es bleibt nur Mama, die Mühsal und der unendliche Weg.
Ich denke an jene Reisen mit ihr, an den Knirps, den sie an der Hand mitzog, frage mich, ob das schon die gleiche Person war wie diejenige, die sich jetzt zu erinnern versucht.
Sie nahm mich wie gesagt immer mit. Erstens war niemand zu Hause, um mich zu hüten, zweitens gab ihr meine Begleitung vielleicht eine gewisse Sicherheit. Sie war zwar eine starke Persönlichkeit, doch kann ich mir vorstellen, dass bei längeren Reisen eine leichte Weltbangigkeit mitging und dass sie dann froh war, sich an mir festhalten zu können. Chur zum Beispiel war schon sehr weit weg. Die Reise nach Chur war schon deshalb aufregend, weil es nach Bever, wo man umsteigen musste, durch einen langen Tunnel ging. Wenn man jenseits herauskam, schien die Welt irgendwie verändert. Zuerst noch Wald und Felsen, doch bald gelangte man in sanftere Täler hinab, die im Gegensatz zum noch winterlichen Engadin schon grün schimmerten. Man sah ganze Haine weiss blühender Obstbäume, die meine Mutter zu Freudenausrufen bewegten. Unter einer hallenden Metallbrücke strömten zwei Flüsse zusammen, um dann gemeinsam weiter zu ziehen. Merkwürdig schien mir, dass wir, nachdem es zuerst immer westwärts gegangen war, auf einmal wieder nach Osten fuhren, und ich fürchtete, wir könnten, trotz der veränderten Gegend, wie durch Zauberei plötzlich wieder zu Hause ankommen.
In Chur wohnten die Grosseltern väterlicherseits, zudem ein Onkel und eine Tante. Bei Grossmutter Berta kam einem ein bestimmter Hausgeruch entgegen, den ich jedesmal wieder erkannte – unten duftete es nach Waschküche, zwei Treppen weiter oben nach Gasherd. Wir betraten jeweils die Wohnung ohne zu läuten, weil nona schwerhörig war und das Läuten gar nicht gehört hätte. Hinter dem Glas der Küchentüre sah man ihren Schatten. Mutter klopfte, öffnete dann vorsichtig, um sie nicht zu erschrecken. Wenn man sich mit ihr unterhielt, musste man sehr laut reden. Ich fand es merkwürdig, dass sie dann selber ebenfalls laut redete, als wären alle taub. Wenn man sass, bediente sie sich eines hornartigen Geräts, das sie sich ans Ohr hielt und in dessen muschelartige Öffnung man hineinreden musste.
Im Gegensatz zu allen andern Verwandten war sie blond und bleich, im übrigen auch die einzige Katholikin in der Familie. Zu Hause unterhielt man sich oft darüber, dass sie von Zeit zu Zeit Erscheinungen hatte, fragte sich, ob das mit ihrer Schwerhörigkeit zusammenhängen könnte. Ihr Mann, Grossvater Andri, glaubte nicht daran, weil sie nämlich schon früher Visionen gehabt hatte; er war überzeugt, die Sache habe etwas mit ihrem katholischen Glauben und ihrer Religiosität zu tun – sie denke zu viel ans Jenseits und an die Toten, und dann kämen sie eben. Hie und da, etwa bei Tisch, konnte es geschehen, dass sie plötzlich erschrak, das Besteck fallen liess, verwirrt ins Leere blickte und hastig flüsterte: «Schau da! Schau da! Habt ihr gesehn?» Das Ganze dauerte nur ein paar Sekunden, dann war der Spuk vorbei. Nachher schien sie noch blasser als sonst. Sie hatte jemanden gesehen, der zur Türe hereinkam, etwas im Küchenschrank suchte und dann durch die Mauer verschwand. Sie erkannte die Person nie genau, manchmal war diese wie durchsichtig, doch sie war überzeugt, es handle sich um ihre Tochter Chatrina, die mit dreiundzwanzig Jahren gestorben war. «Mein böses Gewissen», sagte sie. Sie dachte an damals, als Chatrina mit Lungentuberkulose darniederlag und sie selber ihre Tochter, aus Angst vor Ansteckung, durch jemand andern pflegen liess und nicht einmal in der Nacht ihres Todes bei ihr blieb – aus purer Feigheit. Dafür hatte sie jetzt ihre Heimsuchungen, die sie, wie sie behauptete, manchmal schon eine Weile vorher kommen spürte. Wenn sie dann plötzlich aufhorchte und zur Türe starrte, fragte Grossvater ganz ruhig, die Suppe löffelnd: «Kommt sie wieder?»
Grossvater Andri war ein grosser, starker Mann, damals in Chur als Bauarbeiter tätig. Bei ihm sah ich übrigens zum ersten Mal im Leben ein Grammofon. Er führte mich in die Stube, holte ein Köfferchen herbei, öffnete es, nahm eine schwarz schimmernde Platte mit feinen Rillen aus einer Papierhülle und legte sie auf den beweglichen Teller des Apparates, drehte an einer Kurbel, bewegte einen mit einer dünnen Nadel versehenen Metallarm, senkte ihn vorsichtig auf die Platte herab. Eine Weile vernahm man ein kratzendes Geräusch, dann plötzlich Ländlermusik – jene Musik, die ich von zu Hause kannte, wenn Vater mit den Müllers spielte – doch hier tönte sie aus diesem kleinen Kasten, was für mich an Zauberei grenzte. Grossvater schaute mir ernst nickend ins Gesicht, wie jemand, der tatsächlich zaubern kann. «Siehst du?», sagte er. «Hörst du die Klarinette und die Bassgeige? Und die Handorgel, das ist dein Vater! Die sind jetzt alle da drin!» Ich staunte, konnte mir nicht erklären, wie die Männer in diesem Köfferchen Platz hatten und noch so gutgelaunt aufspielten. Nach einer Weile jedoch, während sich die Platte drehte und es drauflos ländlerte, akzeptierte ich das Unglaubliche als etwas Naturgegebenes. Zuletzt schien alles möglich. Als die Musik zu Ende war und es wieder kratzte, legte Grossvater die Platte auf die andere Seite, dann kam ein neues Stück, und diesmal glaubte ich, meinen Vater noch viel deutlicher herauszuhören.
Am nächsten Tag hätte ich die Musik gern nochmals gehört, doch mittags schien Grossvater schlechtgelaunt, und abends warteten wir vergebens mit dem Nachtessen auf ihn. Grossmutter Berta schien besorgt. Da er nicht kam, assen wir allein. Als später eine meiner Cousinen (sie war ein Jahr älter als ich) auftauchte, schickte man sie zu einem nahe gelegenen Wirtshaus, um nachzuschauen, ob der «Neni» dort sei. Sie eilte davon, kam bald wieder wie ein Sturmwind zur Türe herein und meldete ausser Atem, er sei tatsächlich dort, man höre ihn bis auf die Strasse heraus. Nona Berta forderte sie auf, so rasch wie möglich ihre Mutter zu holen, die Cousine rannte wieder davon, etwas später erschienen sie beide. Es wurde diskutiert, was zu tun sei. Meine Mutter, tapfer wie sie war, anerbot sich, in jene Beiz zu gehen und den Grossvater nach Hause zu bringen, doch wurde ihr davon dringend abgeraten. Am besten, meinte die Tante, wir würden so rasch wie möglich unsere Sachen zusammenpacken, mit ihr kommen und bei ihr übernachten. Das geschah denn auch, wir verabschiedeten uns von der Grossmutter, wechselten das Quartier, wanderten mit unserem Gepäck durch heiter beleuchtete Strassen, kamen auch an jener berüchtigten Kneipe vorbei, aus der es tatsächlich laut tönte. Bald erreichten wir das Haus an der Paradiesgasse, in welchem die Tante wohnte. Es gab noch etwas Obst und Schokolade, dann steckte man mich ins Bett, und zwar zu meiner Cousine, die sich über die Ereignisse des Abends geradezu riesig freute und vor Vergnügen mit den Beinen strampelte.
Als ich älter war, erfuhr ich übrigens, dass meine Mutter damals, während ich schlief, doch noch jenes Wirtshaus aufgesucht und Grossvater herausgeholt hatte. Sie brachte ihn nach Hause und blieb dort, bis er den von ihr verordneten schwarzen Kaffee getrunken hatte und dann zu Bett ging.
Unsere längste Reise führte uns ins Ausland, das heisst ins Liechtensteinische. Ich wusste nicht, was «Ausland» bedeutete, merkte nur, dass die Fahrt länger dauerte als sonst. Verwandte hatten wir dort keine, doch in Liechtenstein waren die Zahnärzte billiger als bei uns. Mutter musste ihre Zähne behandeln lassen, und da sie als Frau eines Bähnlers eine Gratisfahrkarte besass, konnte sie durch die lange Reise etliche Franken einsparen.
Den ersten Zug hatten wir diesmal nicht verpasst. Ich vermute, dass wir gegen Mittag in Vaduz ankamen. In einer Konditorei kauften wir etwas Patisserie, dann wanderten wir aufs Feld hinaus, setzten uns neben einem Zaun ins Gras und assen zu Mittag. Vielleicht war es Frühling, ich glaube mich an Löwenzahn zu erinnern, an weidende Schafe, auf einem Felsen ein imposantes Schloss, vom Dorf herüber Glockengeläute.
Nach der Mahlzeit benetzte Mutter ihr Taschentuch und putzte mir den Mund. Sie lehnte mit dem Rücken am Zaun, ich lag neben ihr, mit dem Kopf auf ihrem Schoss. Morgens waren wir früh aufgestanden, jetzt nickten wir bald ein und schliefen eine ganze Weile. Doch plötzlich fuhr sie zusammen und sprang auf. Wir mussten uns beeilen, rannten über das Feld in Richtung Dorf, sie zog mich mit sich fort, einmal fiel ich hin, darauf trug sie mich ein Stück weit. Wir betraten ein Haus, das sich gerade neben der Konditorei befand. Während sie sich dann stundenlang vom Zahnarzt behandeln liess, schlief ich in einem Zimmer mit rosafarbenen Tapeten. Ich erinnere mich nicht mehr, wie man mich dort zu Bett brachte, sondern nur an mein Erwachen: ein Fräulein in weissem Kittel kam lächelnd auf mich zu, sagte etwas auf Deutsch, nahm mich auf den Arm und verliess mit mir das Zimmer. Unten wartete Mama.
In St. Moritz wohnte ihre Schwester Ottilia. St. Moritz grenzte ans Märchenhafte: unten der schimmernde See, oben die schlossähnlichen Gebäude mit Türmen und Terrassen. Es gab rötliche Plätze, wo Männer und Fräuleins miteinander Ball spielten; es gab duftende Bäckereien, zauberhafte Schaufenster, Warenfülle – ein Schlaraffenland, man hätte sich durch Berge von Pralinen, Kuchen und Bananen hindurchfressen mögen. Auf den Strassen Fahrzeuge mit oder ohne Dach, Pferdekutschen, Kummetgeklingel. Die Leute grüssten nicht. Mutter sagte: «Hier reden sie nicht mehr romanisch, hier wimmelt es von Fremden, und die sind anders als wir.» Sie hatten glättere Gesichter, waren anders gekleidet, sie bewegten sich mit einer gewissen Trägheit; manche trugen Sonnenbrillen, irgendeine buntscheckige Mütze. Man sah Frauen mit blutroten Lippen, und mir schien, dass sie ihre Münder bewusst nach vorn hielten, damit man sie besser sehe. Es gab sogar alte Frauen mit solchen Lippen, wobei das Rot merkwürdig von ihren bleichen Gesichtern abstach.
In einer Parkanlage nahe der Strasse sass ein Fräulein auf einer Bank, neben ihr ein älterer Herr, der sie um die Schulter hielt und ihre Haare streichelte. Das Fräulein war mir aufgefallen, weil sie nicht nur die Lippen, sondern das ganze Gesicht gefärbt hatte – die Wangen rötlich, die Augenlider wie mit Grafit bemalt und zudem dunkel umrandet, Brauen und Wimpern schwarz –, so dass ich zuerst glaubte, sie trage eine Maske. Sie schien traurig zu sein, weshalb ihr der ältere Herr das Haar streicheln mochte. Vielleicht starrte ich sie an, denn plötzlich zeigte sie mit dem Finger auf mich und begann zu lachen. Mutter zog mich mit sich fort, einige Schüler lärmten an uns vorbei, einer von ihnen warf seine Schultasche weit von sich auf die Strasse, ein Auto hupte. Irgendwo hörte man Musik, dann gerade über den Dächern das Gesurre eines Flugzeugs.
Der Ort hatte etwas Verwirrendes. Auf dem Dorfplatz, mitten im Mittagsverkehr, blieb Mutter auf einmal stehen: ein gewisser Onkel, den ich nicht kannte, war hier Polizist und hatte offensichtlich etwas mit diesem Verkehr zu tun. Sie sagte: «Siehst du dort drüben – das ist Onkel Gisep!» Der Mann stand, in grüner Uniform und mit weissen Handschuhen, auf einem Podest, gestikulierte mit Armen und Händen, schien den Automobilisten Befehle zu erteilen. Die Autos kamen von verschiedenen Seiten, einzelne blieben stehen, andere fuhren los und überquerten den Platz; er winkte, spedierte sie nach links oder rechts ... Wie ging das zu? Entweder wählten die Fahrer genau die Richtung, die er ihnen angab, das heisst sie gehorchten ihm, oder es verhielt sich so, dass er genau wusste, wohin sie fahren mussten.
Die Wohnung der Tante kannte ich, auch den Blick zum Stubenfenster hinaus – Dächer und Kamine, irgendwo eine grosse Kuppel, in der Nähe ein Kirchturm, der ganz schief stand, weit unten der See, einige Segelschiffchen. Doch was mir in diesem Haus am besten gefiel, war die Toilette, ein längliches Lokal, an dessen Türe ein farbiger Karton hing; man sah darauf einen sommersprossigen Spitzbuben mit einer Zahnlücke, der mir kameradschaftlich zugrinste.
Bevor wir uns verabschiedeten, musste ich der Tante zuliebe immer ein bestimmtes Lied singen, das ihr, wie sie sagte, so gut gefiel. Manchmal, vor allem wenn noch andere Leute da waren, sträubte ich mich dagegen. Dann liess man mich im Nebenzimmer singen, während die Türe einen Spalt offen blieb.
Abends, auf dem Weg zum Bahnhof, fragte ich mich, ob wir nochmals das Fräulein mit dem Maskengesicht treffen würden. Es reizte mich, sie noch einmal zu sehen. Doch als wir an jener Stelle vorbeikamen, war das Bänkchen verlassen.
Einmal war Mutter ohne mich verreist. Vater war auch nicht da, wir Kinder allein zu Hause. Es dunkelte schon, als Betta von der Terrasse hereinrief, wir sollten schnell herauskommen. Mutter hatte dort ihre Blumen, unter anderem einen Kaktus, der soeben zu blühen begann. Aus der dornigen Schale entliess er eine herrliche weisse Blüte, auf die Mutter jahrelang gewartet hatte. Nun war sie da. Wenn man genau hinschaute, glaubte man, sie langsam wachsen zu sehen – eine füllige Dolde, zuerst noch aufgerichtet, dann durch das eigene Gewicht sich neigend.
Wir staunten über dieses Weiss, das wie Schnee im Dunkel schimmerte. «Wie schade, dass Mama nicht zu Hause ist», meinte Betta. «Sollte man nicht zum Nachbarn gehen und nach Zürich anrufen, damit sie es wenigstens weiss?» – «Das hat keinen Sinn», sagte Adrian. «Wenn sie es weiss, kann sie die ganze Nacht nicht schlafen.» Hierauf Thom: «Aber morgen kommt sie nach Hause, dann sieht sie’s.» – «Ja, dann sieht sie’s», sagte Adrian, «aber morgen ist sie wahrscheinlich schon verblüht – was so schön ist, dauert nicht lange.»
Leider stimmte es. Als Mama am nächsten Tag heimkam, war die Blüte schon halb verwelkt, ihr Zauber dahin, das Weiss gelblich verfärbt. Mutter war sichtlich enttäuscht. Sie schaute, kehrte in die Küche zurück, ging später nochmals hinaus: «Vielleicht hättet ihr den Kaktus in den Flur tun sollen, wo es kühl und schattig ist. Die Sonne hat ihm nicht gut getan.» Betta tröstete sie: «Aber der wird sicher wieder einmal blühen.» – «Ja, ja, aber das dauert wieder Jahre, und wer weiss, ob wir dann noch da sind.»
Ich war sechsjährig (wir wohnten damals schon in Zernez), als ich zu stehlen begann. Ich stahl Geld, sonst nichts, nur Geld, und zwar aus Mamas Haushaltbörse. Diese befand sich in einer kleinen Schublade des Küchenbüffets. Ich nahm immer nur Kleingeld, weil ich vermutete, das falle weniger auf. Angefangen hatte ich mit einem Zehnrappenstück, für das ich im Laden bei Regi, knapp zwei Minuten von uns entfernt, einige Zuckerplätzchen oder einen Schokoladestengel bekam. Später nahm ich dann mehr, zwei Zehnräppler, einen Zwanziger, dann einen Fünfziger, je nach Börseninhalt. Die Fünfziger waren kleiner als die Zwanziger, versteckten sich manchmal auch in den Falten des Beutels und schienen mir schon deshalb geeigneter zu sein. Als ich einmal in der Börse einen einzigen Zehner vorfand, liess ich ihn drin und kam mir dabei sehr klug vor. Am günstigsten war es, wenn Mutter gerade vom Laden kam und dort mit einem grösseren Geldschein bezahlt hatte. Ich sass dann in der Küche und schaute zu, wie sie Brot, Spaghetti, Kaffee, Konservenbüchsen auspackte, wobei der Geldbeutel eine Weile wie ein Kätzchen vor mir auf dem Tisch liegen blieb.
Ich erinnere mich, wie leicht mir das Stehlen fiel und wie der Reiz zunahm. Es war der intensivste Reiz, den ich je erlebt hatte. Das geklaute Geld steckte ich jeweils in die Tasche, schlenderte vor mich hin pfeifend die Treppe hinunter und aus dem Haus, ging dann entweder zu Regi oder in die Bäckerei Füm, kaufte Schokolade, Makrönchen oder Mohrenköpfe, was ich dann in irgend einem verborgenen Winkel verspeiste.
Süssigkeiten waren das eine, der Diebstahl das andere, denn während ich stahl, dachte ich noch kaum an den Bäckerladen, da war das Klauen noch Selbstzweck. Mit leichtem Kitzel betrat ich die Küche, dann die Stube, ich rief: «Hallo, ist jemand da?» Wenn sich niemand meldete, näherte ich mich dem Büffet, öffnete die kleine Schublade, griff nach dem Geldbeutel, spürte die Berührung mit dem weichen Leder. Jetzt nahm ich gelegentlich auch Einfrankenstücke. Für einen Franken bekam man allerhand, oft reichte es sogar für eine der grossen Schokoladen und einige Makrönchen. Von bösem Gewissen war nicht die Rede, vielleicht war ich mir nicht einmal bewusst, etwas Böses zu begehen. Im Gegenteil, in einem Anflug von Generosität war ich dazu übergegangen, das Gekaufte jeweils mit ein paar Kameraden zu teilen. Ich merkte, dass sie mich schätzten. Wir vereinbarten einen stillen Ort, wo sie auf mich warteten, bis ich mit meinem Papiersack auftauchte. Es wurde nie gefragt, woher ich das Geld hätte, um die Sachen zu kaufen. Vielleicht ahnten sie es, sagten aber kein Wort.
Einmal hätte es mir schlecht ergehen können. Ich war mit zwei Kirschen aus Zuckerguss heimgekommen. Auch die bekam man bei Füm; sie waren gross, rot glasiert, hingen voll und appetitlich an einem zweigähnlichen Goldfaden, wie zwei richtige Kirschen, die mir schon ihrer Farbe und Grösse wegen gefielen. Ich hielt sie in der Hosentasche versteckt, ging auf die Terrasse hinaus, um sie dort in aller Stille zu geniessen. Ich zerriss den Goldzweig, steckte eine der beiden Früchte wieder in die Tasche, die andere in den Mund. Die Türe stand offen, doch niemand störte mich; ich begann zu lutschen, genoss die leckere Kugel in meinem Mund, zumal sie kompakt schien und nicht so bald zergehen würde. Doch eine Weile später, als sie kleiner geworden schien und ich sie schlucken wollte, blieb sie mir im Halse stecken; ich hatte mich verrechnet, brachte sie weder hinunter noch in den Mund zurück, konnte auf einmal nicht mehr atmen, schreien ging auch nicht; ich erstickte, stiess vermutlich nur stöhnende Laute hervor, schüttelte die Arme und stampfte mit den Füssen ... Ein Schutzengel kam mir zu Hilfe, genau im richtigen Moment wie alle Schutzengel, nämlich Frau Giamara, die Gattin unseres Hausvermieters, die zufällig einige Ferientage hier verbrachte. Sie erschien an der Terrassentüre, sah meinen grotesken Tanz, eilte heraus. Am Vorabend (das wurde mir erst später erzählt) hatten meine Eltern, die Frau Giamara sonst sehr schätzten, über sie gesprochen und sich dabei über ihre langen Fingernägel gewundert. Doch gerade diese kamen mir jetzt zugute: die Frau hielt mich mit dem linken Arm fest, steckte mir den Kleinfinger der Rechten in den Rachen, grübelte darin mit ihrem langen Fingernagel, bis es ihr gelang, die stecken gebliebene Kugel herauszuholen. Dabei rief sie laut nach meiner Mutter, und als diese herbei rannte, war ich bereits gerettet und konnte einen Schrei ausstossen. Später sagte man mir, ich sei schon ganz blau gewesen.
Merkwürdig übrigens, wie Frau Giamara die Zuckerkirsche in der flachen Hand hielt und fragte: «Was soll ich damit tun?» – «Wegwerfen!», sagte meine Mutter. Später, als ich allein war, warf ich auch die andere weg.
Leider kam mir diesmal der liebe Gott, den ich sonst in kritischen Situationen herbeirief, nicht in den Sinn, sonst hätte ich den Vorfall als Fingerzeig von oben deuten können. Stattdessen klaute ich weiter.
Mit der Zeit begann Mutter, die Dieberei zu bemerken, schien aber im Zweifel, welches ihrer Kinder dahinter steckte. Vielleicht dass sie mich, als ihren Jüngsten, vorerst ausschloss. Eines Abends bei Tisch sagte sie enttäuscht: «Heute ist mir schon wieder Geld gestohlen worden; ich frage mich, welches meiner Kinder ein Dieb ist.» – Betretenes Schweigen, man blickte sich um. Dann Betta, halb zornig weinend: «Also mich müsst ihr nicht anglotzen, ich habe noch nie gestohlen.» Hierauf Thom, die Ruhe in Person: «Ich auch nicht.» Adrian, damals schon Sekundarschüler, erklärte trocken: «Wenn jemand stiehlt, hat er das im Blut, dann ist ihm nicht zu helfen.» Vater fragte ihn: «Woher weisst du das? – Hast du es genommen? Zum Beispiel für Zigaretten?» Adrian war empört: «Für wen hältst du mich? Übrigens habe ich noch nie geraucht, wenn du es wissen willst!» Vater meinte: «Also wenn es niemand von euch war, dann ist es wahrscheinlich die Katze gewesen.»
Ich selber tat, als hätte ich kaum zugehört. Eine Weile herrschte Schweigen, doch als ich das Gesicht vom Teller hob, sah ich, dass alle Blicke auf mich gerichtet waren. Vor allem Vater musterte mich mit einer unheimlichen Miene. Ich weiss nicht, ob es mir gelang, Unschuld vorzutäuschen, jedenfalls passierte diesmal noch nichts.
Ich war entschlossen, nicht mehr zu stehlen. Nie wieder. Doch einige Tage später, da mich niemand zur Rede gestellt hatte und die Sache schon vergessen schien, tat ich es wieder. Es war Nachmittag, Mutter hatte erklärt, sie müsse zu einer Nachbarin. Ich hörte, wie sie die Treppe hinunterstieg, die Haustüre öffnete und wieder zumachte. Etwas später, als ich in der Küche die kleine Büffetschublade öffnete, vernahm ich ein Geräusch: sie beobachtete mich, ich sah ihr Gesicht im Türspalt.
Es folgte eine Gerichtsszene, nicht laut, aber schrecklich. Ich stand da, vermutlich mit kurzer Hose und Hosenträgern, sie sass nahe vor mir, schaute mir ins Gesicht: «Dann bist du es also? Mein jüngster Sohn, den ich am liebsten hatte, und der nun ein Dieb ist, ein richtiger Dieb, der seiner Mutter Geld stiehlt. Ich hätte nie gedacht, einen solchen Sohn zu haben. Wie konnte ich mich nur so täuschen ...» Ich weinte nicht, ich schwieg, verstand vielleicht erst jetzt, was ich getan hatte.
Für den Tag darauf war ein Ausflug des Kindergartens geplant. Doch daraus wurde nun nichts: «Morgen bleibst du zu Hause», sagte sie, «kommt gar nicht in Frage, dass du auf die Schulreise gehst. Wenn ich der tanta Maria (das war unsere geliebte Kindergärtnerin) erzählen würde, was du getan hast, würde sie dich gar nicht mehr sehen wollen. Jetzt gehst du sofort ins Bett, bevor die andern heimkommen, damit ich mich nicht für dich schämen muss.»
Ich ging ohne Widerrede, eilte ins Schlafzimmer hinauf, zog mich bis auf die Unterhose aus und schlüpfte ins Bett. Ich kam nicht mehr dazu, an das Vorgefallene zu denken, weil ich bald einschlummerte. Während der Nacht begann ich einmal im Schlaf zu weinen, erwachte aber erst, als ich merkte, dass Mutter neben mir im Bett lag. «Hör nur auf zu weinen», sagte sie, «das hat jetzt keinen Sinn.»
Am nächsten Morgen frühstückte ich allein. Als ich vom Schulplatz herüber Lärm hörte, ging ich ans Fenster, sah, wie sich die Gesellschaft dort besammelte, alle mit Rucksäckchen und Wanderausrüstung. Auch einige Mütter waren dabei. Später erschien tanta Maria, unser Zauberengel, ebenfalls mit Rucksack, auf dem Kopf ein hübsches grünes Hütchen. Man umgab sie von allen Seiten, sie reichte allen die Hand. Zuletzt sangen sie noch ein Lied, das wir eben gelernt hatten, dann zogen sie davon. Ich setzte mich wieder an den Tisch. Ich war hungrig, seit dem Vortag mittags hatte ich nichts mehr gegessen. Einmal kam Mutter herein, setzte sich an den Tisch, blätterte in der Zeitung, wortlos und ohne dass wir uns ins Gesicht schauten. Sie trank einen Schluck Kaffee, stand wieder auf und entfernte sich.
Um Bussebereitschaft zu demonstrieren, ging ich nach dem Frühstück wieder ins Bett, lag dort lange auf dem Rücken und verbrachte die Zeit damit, aus den Ästen und Maserungen in den Brettern der Zimmerdecke allerlei Gesichter und Fratzen herauszulesen, wobei ich sie mit Zuhilfenahme der Hände und mit Augenzukneifen verändern konnte. Eine Weile hielt ich die Augen geschlossen, sah dann im eigenen Innendunkel farbige Tupfen umherschweifen, versuchte auch, sie mit dem blossen Willen nach rechts oder nach links zu bewegen. Später holte ich vom Nachttisch der Eltern den grossen Wecker, spielte ein bisschen damit, liess ihn wiederholt klingeln, drehte die Zeiger nach vorn und nach hinten, zog ihn wieder auf, steckte ihn schliesslich unter mein Kissen, legte mich hin und horchte, wie er darunter tickte. Fast wäre ich dabei wieder eingeschlafen, doch da erschien Mutter, legte ein sauberes Hemd und saubere Hosen auf einen Stuhl, sagte, ich solle mich anziehen und dann sofort hinunterkommen. Als ich die Küche betrat, hatte sie meine hohen Schuhe geputzt, erklärte, wir würden jetzt gleich gehen; ich beeilte mich, die Schuhe anzuziehen und die Bändel festzuknüpfen, schweigend, während sie noch etwas in den Rucksack steckte. Man wusste, wo die Gesellschaft hingegangen war – es handelte sich um eine Bergterrasse mit einem kleinen See –, eine knappe Stunde vom Dorf entfernt.
Wir machten uns auf den Weg, ich trug den Rucksack. Es war unsere schweigsamste Wanderung. Wenn ich etwas sagte, antwortete sie kaum oder dann so einsilbig, dass ich bald wieder verstummte. Ziemlich erstaunt war ich dann über die fröhliche Art, wie sie oben, als wir den Ort erreichten, tanta Maria begrüsste und sich für unsere Verspätung entschuldigte. Ich hatte mich bald zu den andern gesellt und sprang mit ihnen umher. Etwas später bemerkte ich, wie sie irgendwo am Rande stand und mich beobachtete. Nachher entfernte sie sich, wanderte um den See herum, blieb irgendwo stehen und schaute eine Weile ins Wasser, ging dann weiter und verschwand beim Waldweg, wo wir heraufgekommen waren.
Der Vorfall wurde später nur mehr sporadisch erwähnt, hinterliess aber in mir einen beharrlichen Schatten. Hie und da vergass ich ihn, dann war er plötzlich wieder da, vor allem morgens, wenn ich erwachte, je nachdem auch wenn ich zum Essen kam und mich zu den andern an den Tisch setzte. Es kam vor, dass jemand eine kleine Anspielung machte; Adrian erkundigte sich etwa, ob ich der Familie etwas Süsses zum Nachtisch mitgebracht hätte. Betta, zwei Jahre älter als ich und damals in der zweiten Schulklasse, fragte mich, ob ich die zehn Gebote kenne; ich schüttelte den Kopf, wusste nicht einmal, was das Wort bedeutete, ahnte aber, was damit gemeint sein könnte. Eine Verwandte war auf Besuch, ich sass mit ihr und den Eltern am Tisch; einmal begannen sie zu murmeln und deutsch zu reden, obwohl ich schon Deutsch verstand und genau merkte, worum es ging. Als ich etwas später mit der Frau allein am Tisch zurückblieb und von dem feinen Kuchen ass, den sie mitgebracht hatte, schaute sie mir ernst ins Gesicht und fragte mich, ob ich kein böses Gewissen hätte. Ich antwortete nicht, ich ass ihren Kuchen, der geradezu nach Sünde schmeckte. Vielleicht lernte ich damals das entsetzliche Gefühl der Schuld kennen.
Eines Nachmittags, als ich die Küche betrat, lag der schwarzlederne Geldbeutel auf dem sauber abgeräumten Tisch, genau in der Mitte. Ich berührte ihn nicht einmal mit dem Finger.
Sie hatte ihre Grillen. Eine davon bestand darin, dass sie oft noch abends spät mit einem Zuber voll Wäsche an den Brunnen ging und dort stundenlang wusch, mit Vorliebe, wenn es regnete. Man sah sie dann im Schein der Strassenlampe über den Brunnentrog gebeugt, eine Pelerine oder Vaters ehemaligen Waffenrock über die Schultern geworfen. Ab und zu kam sie ins Haus, ging wieder ins Freie. Wir sassen in der Stube, hörten ihre Schritte. «Sie arbeitet noch immer», sagte Betta.
Glücklich war sie, wenn es ihr abends gegen zehn Uhr gelang, die ganze Meute, inklusive Familienvater, ins Bett zu schicken, um noch eine oder zwei Stunden allein zu sein. Oft buk sie dann noch einen Kuchen. Kuchen waren ihre Spezialität, beispielsweise die Engadiner Nusstorte. Bei letzterer musste sie vorher eine Menge Nüsse knacken, was sie jeweils mit dem Hammer bewerkstelligte, sodass man, wenn man im Bett lag, von unten ein dauerndes Klopfen vernahm, an dem man immer wieder erwachte. Einmal hörten wir, wie Vater auf die Treppe hinausging und hinunterrief: «Wenn du nicht bald aufhörst, steh ich wieder auf!»
Während später der Kuchen im Backofen lag, sass sie am Tisch und las die Zeitung, trank dabei schwarzen Kaffee und ass ein Stück Schokolade. Ich habe das öfters gesehn, weil ich dank ihrer Klopferei wach geblieben war, wieder aufstand und hinunterging. Sie war eine leidenschaftliche Zeitungsleserin, und zwar las sie alles – Leitartikel, Feuilleton, mit Vorliebe auch die kleineren Notizen, «Unglücksfälle und Verbrechen», sogar die Inserate und natürlich die Todesanzeigen. Schokolade hatte sie übrigens sehr gern, eigentlich lieber als die Kuchen, die sie uns zubereitete. Wenn einer von uns auf Reisen gewesen war und wieder heimkehrte, gehörte es zu einer Art Tradition, dass man ihr eine Schokolade mitbrachte. Sie war dann jedes Mal glücklich wie über ein unerwartetes Geschenk, konnte andrerseits verstimmt sein, wenn man es vergessen hatte.
Sie arbeitete auch an Sonntagnachmittagen, flicken oder Strümpfe stopfen, allerdings nie ohne sich sonntäglich umgezogen zu haben, auch wenn sie allein zu Hause war.
An Weihnachten, besonders am Morgen des Weihnachtstages, war sie oft schlecht gelaunt, unterschwellig gereizt. Ich weiss nicht, ob das mit der Jahreszeit zusammenhing, etwa mit den winterlichen Raunächten und den langen Morgendämmerungen, oder dann mit dem Fest an sich, dieser programmierten und verbrämten Feierlichkeit, die sie vielleicht als verlogen empfand, und die auch schlecht ins Gewühl der eigenen Befindlichkeiten hineinpasste. O du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit ... Der geringste Anlass genügte dann, um eine Szene auszulösen; sie drohte, die angekommenen Geschenke wieder den Verwandten zurückzuschicken und keinen Christbaum zu machen. Natürlich kam später die Feier trotzdem zustande; gegen Abend holte sie das Tännchen herein, ging damit in die Stube und schmückte es stundenlang, schien dabei, im Gegensatz zum Morgen, auffallend still und zufrieden.
Ihr Bild hier auf meinem Büchergestell, ein schwarzweisses Foto, zwei Jahre vor ihrem Tod entstanden. Sie sitzt auf dem Brunnenrand, einen Kupferkessel haltend, hinter ihr der Garten mit dem Kirschbaum, die gedeckte Holzbrücke. Hier sieht sie noch gesund aus, während sich die Krankheit wahrscheinlich schon in ihr eingenistet hatte, unbemerkt wie ein Schatten. Nun ist sie seit vielen Jahren tot, zu Erde geworden, während ein Teil von ihr in mir noch weiterdauert – vielleicht ihre Gesichtszüge, ihr Blick, ihr Zorn oder ihr Verstummen, ihre Schwere und ihre Zähigkeit, ihre Härte und ihr Erbarmen, ihr Unfriede und ihre gelegentliche Heiterkeit.
Wenn in meinen Träumen die Jugend zurückkehrt, ist oft auch sie da. Ich träume zum Beispiel, dass ich eben vom Seminar heimgekehrt bin und fast allein die ganze Ernte bewältigen muss. Ich sehe die Riesenarbeit vor mir, das Gras steht dicht und hoch, ich zähle die Wiesen auf, die ich alle zu mähen habe, vor allem auch die unseligen Böschungen der Rhätischen Bahn, die wir gepachtet haben ... Ich träume, dass von Mitleid mit mir keine Rede ist, ich bin noch ein Jüngling und muss die Arbeit von Erwachsenen erledigen, ohne Lohn; es gibt das Essen, saubere Kleider und Wäsche, während der Schulzeit das Geld für Schulsachen und Konvikt, etwas über tausend Franken pro Jahr, beim bescheidenen Einkommen Vaters gewiss keine Kleinigkeit. Aber Jugend habe ich keine, frei bin ich nie, entweder Schule oder Fronarbeit. Ich träume, dass Mutter unerbittlich ist; wenn es regnet und man nicht ernten kann, muss ich den Stall ausmisten, Holz spalten, oder sie schickt mich mit Axt und Säge in den Wald. Sie ist die Liebe in Person, sie würde für mich in den Tod gehen, doch sie gönnt mir keinen freien Tag.
Zornig wurde ich, wenn ich den ganzen Morgen auf einer Bergwiese gemäht hatte, mittags müde und hungrig war und sie mit dem Essen auf sich warten liess. Sie kam einfach nicht, während andere Leute im Schatten eines Baumes sassen und gemütlich speisten. Ich stellte mir dann vor, wie Mutter, statt zu Hause vorwärtszumachen, vielleicht noch die Zeitung las und wieder einmal nicht auf die Uhr schaute. Zuletzt, des Wartens überdrüssig, warf ich die Sense hin und ging ihr entgegen, entschlossen, ihr einmal gründlich die Leviten zu lesen. Ich bereitete eine Strafpredigt vor, doch wenn ich sie hinter einer Strassenbiegung oder in einem buschigen Hohlweg daherkommen sah, mit Kopftuch, sauberer Ärmelschürze, den Esskorb und die Kaffeekanne mit sich tragend, blieb ich stehen und wartete, während sich meine grosse Wut wie ein Sommerdunst auflöste.
Natürlich mussten auch die Geschwister arbeiten, wenn sie zu Hause waren; doch der Älteste studierte, die andern hatten ihre Berufslehre, während ich für meine langen Sommerferien zu büssen hatte.
Kleine Parenthese: Am Lehrerseminar hatte ich Klavierunterricht, ich übte mit Leidenschaft, Klaviermusik wurde zur Besessenheit. Ich machte Fortschritte, der Lehrer lobte mich. Ein Problem waren meine dank Schwerarbeit gross und knochig gewordenen Hände – Bauernpranken, deren Mittelfinger kaum zwischen den schwarzen Tasten Platz hatten. Wenn ich mit meinem Lehrer, einem liebenswürdigen Mann aus Ftan, darüber sprach, meinte er, meine Hände seien schon recht, lieber gross als klein, ich müsse sie nur entspannen und häufig Lockerungsübungen machen. Grosse Hände, die hätte zum Beispiel auch Rubinstein, und ich müsse hören, wie der spiele. «Das mag schon sein», sagte ich, «aber der war doch nie bei den Bauern – Rubinstein mit Sense oder Mistgabel, das kann man sich nicht vorstellen.» Er lachte, klopfte mir auf die Schulter. Das komme schon, sagte er. «Nur fleissig üben, üben, üben, und die Hoffnung nicht aufgeben.» Nach zweieinhalb Jahren Unterricht spielte ich die «Pathétique» auswendig. Weiss Gott wie das tönte, aber ich spielte mit Leidenschaft.
Leidenschaften ... Vielleicht sind sie es, die uns über die Dauermühsal des Lebens hinweghelfen. Mein Vater zum Beispiel hätte in Sachen Leidenschaften eine Balzac-Figur sein können. Auch Mutter waren sie nicht fremd, im Gegenteil. Zum Beispiel eben das Zeitungslesen, das Briefeschreiben, das Kuchenbacken, die Haustiere. Dann vor allem Pilze und Beeren. Preisel- und Heidelbeeren gab es in höher gelegenen Regionen, Himbeeren, Hagebutten und Holunder auch unten im Tal. Sie wusste, wo sie zu finden waren, schweifte dann tagelang durch verlassene Schluchten, an Waldrändern und Geröllhalden entlang. Sie dachte an die Beeren, war aber dabei wohl unbewusst von Naturmagie durchdrungen. Oft vergass sie dann, nach Hause zu gehen, liess sich von der Nacht überraschen. Wir warteten mit dem Essen auf sie, man forderte mich auf, ihr entgegenzugehen. Ich wanderte bis zum Dorfausgang, wo die Strassenbeleuchtung aufhörte und sich die Dunkelheit verdichtete. Dort blieb ich stehen, zählte bis hundert, dann bis zweihundert. Je nachdem kam noch ein Bauer vom Feld, ich fragte ihn, ob er meine Mama gesehen hätte; wenn er verneinte, ging ich ein Stück weiter, bis zu einer Weggabelung, wo ich, um sie nicht zu verpassen, Halt machen musste. Ich wartete wieder, begann zu rufen. Wenn ich endlich im Dunkeln ihre Gestalt auftauchen sah, schwand die Beklemmung dahin und ich atmete auf.
Im Gegensatz zu Vater, der gewisse Besucher (besonders die vornehmeren und gut gekleideten) nicht leiden mochte, war sie ausgesprochen gastfreundlich, und zwar schätzte sie gerade die Gebildeten – einen bekannten Zürcher Professor, einen Zeitungsredaktor aus Bern, der hier mit der Familie Ferien verbrachte, ein Ehepaar aus Florenz –, Leute, die einen Hauch von Urbanität ins Haus brachten. Sie wusste sie würdig zu empfangen, bewirtete sie mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, zeigte ihnen unsere Stube mit dem alten Nussbaumschrank, die grosse Bibel aus dem siebzehnten Jahrhundert, führte die Gäste sogar in den Stall. Sie sollten nur sehen, was es in ihrem Haus gab und worauf sie stolz war – ihre grossäugigen Kühe, die Kälblein, Ziegen und Schafe; vor allem auch die grosse Sau mit ihren zwölf oder vierzehn Ferkeln, die ihr besonders am Herzen lag. Sie betrat den Koben, streute frisches Stroh hinein, hob eines der noch frisch duftenden Schweinchen auf und zeigte es den Gästen, sagte ihnen, sie sollen es mit der Hand streicheln. «Das interessiert doch die Leute nicht!», meinte Vater. Er täuschte sich, es interessierte sie sogar sehr, nicht nur die rührenden Ferkel mit dem geringelten Schwanz, sondern der ganze Stall, der Geruch von Heu und Mist und tierischer Wärme – ein einfacher Stall wie zu Bethlehem, was sie noch nie im Leben gesehen hatten.
Einzig mit einer Besucherin (wir nannten sie Tante Didi) hatte auch sie Mühe, weil die Frau zu viel redete. Sonst eine liebe Person, eine gut aussehende Fünfzigerin mit lebendigem Gesicht und grossen braunen Augen, nur konnte sie einen mit ihrer Redseligkeit fertigmachen. Zuerst, wenn sie erschien, war man von ihr angetan, sie hatte einen gewissen Charme. Man setzte sich zu Tisch, sie begann zu erzählen, und das konnte sie ausgezeichnet. Nur hörte es nie auf, es ging immer weiter, über die Mahlzeit hinaus, stundenlang, sie redete und redete, schilderte uns Leute, denen sie irgendwo in der Welt begegnet war, sie erzählte, was diese Leute ihr erzählt hatten, was ihnen widerfahren war, rührende, lustige oder schreckliche Geschichten. Sie wusste noch alles bis in kleinste Details, hatte leider ein phänomenales Gedächtnis.
Man hoffte umsonst, dass sie gelegentlich alles gesagt hätte, denn der Vorrat war unerschöpflich. Ein lockeres Gespräch gab es nie. Wenn Adrian oder Vater einmal das Wort an sich rissen, um ihren Redefluss zu stoppen, mimte sie Aufmerksamkeit, lächelte ins Leere, wobei man genau merkte, wie sich hinter ihrer konkaven Stirn eine neue Geschichte bereithielt und dann unweigerlich auch kam. Man war blockiert, ermüdet, und gegen Mitternacht glücklich, ins Bett zu gehen. Doch am nächsten Morgen ging es weiter.
Adrian, damals schon Student, behauptete, diese Redebesessenheit sei wahrscheinlich eine Form verdrängter Sexualität. «Schade», sagte Mutter, «sie meint es sicher gut, aber ich habe einfach keine Zeit, ihr den ganzen Tag zuzuhören.» Sie ging trotz allem ihrer Arbeit nach, spülte das Geschirr oder bereitete das Schweinefutter, während Didi neben ihr stand und redete. Wenn Mutter mit dem Schweinefutter in den Stall ging, kam sie mit und plauderte weiter, um die angefangene Geschichte nicht unterbrechen zu müssen.
Einmal hatte Mama genug, hörte ostentativ nicht mehr zu, liess die Erzählerin mitten in ihrer Geschichte stehen und ging hinaus. Später, als Didi wieder loslegte, sagte sie trocken: «Entschuldige, ich habe jetzt leider keine Zeit.» Abends bei Tisch merkten wir, dass etwas nicht mehr stimmte, Tante Didi schwieg, ging nach dem Essen gleich zu Bett. Tags darauf, als sie mit Mutter allein war, fragte
sie: «Was ist eigentlich los? Störe ich euch? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich wäre froh, wenn du es mir ganz offen erklärtest.»
«Es tut mir leid, Didi», sagte Mutter, «ich möchte dir nicht wehtun, aber du redest zu viel ... Es ist sicher interessant, was du sagst, aber du machst einen fertig. Es gibt auch keinen Dialog mit dir, du stellst kaum je eine Frage, du redest einfach drauflos. Im Grunde hast du dein Leben zerschwätzt ...»
Es half nichts, dass sie sich später entschuldigte. Noch am selben Tag packte die Besucherin ihre Koffer, kam damit die Treppe herunter, verabschiedete sich von Mutter im Hausgang. Sie umarmten sich flüchtig, beide mit nassen Augen. Ich begleitete die Frau mit ihrem Gepäck an den Bahnhof, wo sie mir etwas Geld zusteckte und mich bat, Mutter auszurichten, sie danke ihr für die Gastfreundschaft.
Später wurden zwischen ihr und Mutter trotz allem noch Kartengrüsse gewechselt. Freundschaft auf Distanz, doch sahen sie sich nie wieder.
Besondere Anteilnahme zeigte sie für Randexistenzen, für Gestrandete oder Ausgestossene. Zum Beispiel für Veronica C., die sie während ihres ersten Ehejahres in Sent kennen lernte, eine Frau, die dort als Hexe verschrien war, zwanzigstes Jahrhundert hin oder her. Natürlich wurde Veronica nicht gefoltert und nicht verbrannt, das gab es zum Glück nicht mehr, aber sie war geächtet.
Die Frau hatte einfach Pech gehabt. Man suchte offenbar eine Hexe und man fand sie; drei oder vier zufällige Vorkommnisse genügten, zudem fand jemand auch, sie habe den bösen Blick: Ein Steuereinnehmer, der ihr in ihrer eigenen Stube ihr letztes Bargeld abgezwackt hatte, wobei es zu einem Streit gekommen war, glitt beim Verlassen des Hauses auf der Türschwelle aus, fiel hin und verrenkte sich den Fussknöchel. Einem Bauern, der mit einer Heuladung vom Feld kam, war das Fuder, auf dem er selber sass, unmittelbar vor Veronicas Haus umgestürzt, und zwar gerade, als Veronica zum Fenster herausschaute; er hatte sogar deutlich gehört, wie sie dabei lachte. Ein Kaminfeger, der ihren Stubenofen putzte, zog sich eine Gasvergiftung zu. Und zu guter Letzt, als Veronica im Spätherbst nach Italien verreist war, wo sie jeweils den Winter verbrachte, entdeckte jemand, dass zuhinterst in ihrem Hausflur ein kleines Licht brannte. Es brannte den ganzen Winter hindurch, doch kurz bevor Veronica im folgenden Frühling wieder zurückkam, war es plötzlich erloschen. Jetzt schien alles klar. Man wich ihr aus, man grüsste sie kaum mehr.
Mein Vater, selber in Sent aufgewachsen, traute ihr auch nicht. Mutter fand das lächerlich, vor allem unmenschlich. Als sie eines Sonntags zum Gottesdienst ging, war die Kirche schon voll (das gab es damals noch), eine einzige Bank leer, und dort zuhinterst sass Veronica, allein. Es herrschte Stille, doch wie Mutter sich zu ihr setzte, ging durch den Raum ein Gemurmel. Jemand berührte von hinten ihre Schulter, flüsterte: «Hier wäre noch ein Platz frei.» Sie blieb sitzen, die Glocken verstummten, der Pfarrer erschien auf der Kanzel. Während der Predigt bemerkte sie immer wieder Leute, die sich nach ihr umwandten.
Ab und zu begegnete sie Veronica auf der Strasse, fand sie übrigens durchaus anständig, eine bleichgesichtige Frau mit dunklen Augen und einer sanften Stimme. Sie wirkte verunsichert, einmal sagte sie: «Ich weiss nicht, was die Leute gegen mich haben.» Es war schon viel, dass sie im Laden und beim Bäcker bedient wurde. Eines Tages sah sie Mutter mit ihrem Erstgeborenen, sie näherte sich, neigte sich über das Wägelchen, um das Kind zu sehen. Mutter nahm es heraus und gab es ihr auf den Arm. Veronica war entzückt, drückte das Kind an sich, herzte es, gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Drei Frauen, die am Brunnen wuschen, hatten zugeschaut. Eine von ihnen traf abends meinen Vater und erzählte es ihm, aus Pflichtgefühl. Zu Hause gab es eine Szene. Ich stelle mir vor, wie er mit seiner Frau schimpft: Bist du eigentlich wahnsinnig? Wie kannst du so etwas tun – unser Kleines einer solchen Person in die Hände zu geben? Sie lacht ihn aus, ist zugleich empört: Mein Gott, was für ein Volk seid ihr hier! Man muss sich geradezu schämen, in einem solchen Dorf zu leben. Das ist noch Mittelalter, grotesker Aberglaube, und du selber bist ebenso abergläubisch wie die andern! Vater antwortet, das habe mit Aberglauben rein nichts zu tun, er wisse genau, dass mit der Person etwas nicht stimme – jedenfalls, wenn es alle sagen, müsse etwas daran sein. – Und du wärst wohl dafür, dass man die Frau verbrennt ...?
Vielleicht ihr erster Ehestreit, wegen einer armen Hexe. «Ich behaupte nicht, sie sei eine richtige Hexe», sagt er, «aber wenn nächstens mit dem Kleinen etwas passiert, dann wissen wir warum.»
Zum Glück passierte nichts. Einige Zeit danach bekam Vater eine andere Stelle, sie kehrten dorthin zurück, wo sie sich kennen gelernt hatten, das heisst nach Lavin, in Mutters Dorf, wo die Leute um einiges intelligenter und vernünftiger waren als die von Sent. Die von Sent, da bestand für Mutter kein Zweifel, hatten das Mittelalter noch nicht überwunden, lagen jedenfalls in ihrer Entwicklung mindestens ein Jahrhundert zurück.
Ich glaube nicht, dass sie der Frau je wieder begegnet ist. Später erfuhr sie, dass Veronica in Sent alles verkauft hatte und definitiv nach Italien gezogen war. Man erzählte auch, ihr Treuhänder habe lange suchen müssen, bis er für ihr Haus einen mutigen Käufer fand.