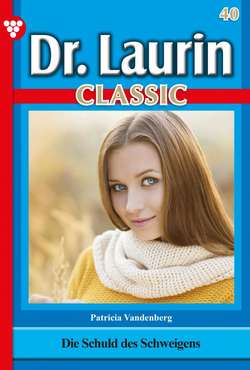Читать книгу Dr. Laurin Classic 40 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAn dem Tag, an dem der neue Assistenzarzt Dr. Lars Petersen seinen Dienst in der Prof.-Kayser-Klinik antrat, machte Dr. Leon Laurin die Bekanntschaft von Tamara Roth.
Irgendwie war ihm der Name gleich vertraut, als Hanna Bluhme ihm die neu ausgeschriebene Karteikarte auf den Schreibtisch legte.
Vor ein paar Tagen war Leon Laurin auf Drängen seiner Zwillinge zu einer Elternversammlung in die Schule gegangen. Insgeheim hatte er zwar die Hoffnung gehegt, daß man ihn nicht in den Elternbeirat wählen würde, da es eine ganze Anzahl anderer Bewerber gab. Konstantin und Kaja hatten ihn so lange beschwatzt gehabt, bis er sich ihnen zuliebe nominieren ließ. Er war nun mal Vater von vier Kindern, und da hatte man eben gewisse Pflichten. Mit Kritik hielt er dann auch nicht zurück und so entfielen auf ihn die meisten Stimmen.
An diesem Abend hatte er auch den Lehrer seiner Zwillinge, Jürgen Roth, kennengelernt. Er war ein kluger und toleranter Pädagoge. Leon Laurin hatte sich lange mit ihm unterhalten. Er hatte den allerbesten Eindruck von ihm gewonnen, und das gleiche konnte er nun sagen, als Tamara Roth, die junge Frau des Lehrers, ihm gegenübersaß.
Tamara Roth war schon im sechsten Monat der Schwangerschaft, aber man sah ihr noch gar nicht soviel an.
»Jetzt möchte ich aber doch so langsam wieder mal wissen, ob alles in Ordnung ist«, sagte sie zu Dr. Laurin.
Es war nicht das erste Mal, daß eine Patientin zu ihm kam, die so sorglos die Zeit der Schwangerschaft durchlebte.
»Haben Sie einen Mutterpaß?« fragte er nur.
Sie sah ihn verlegen an. »Nein.«
Er mußte lächeln.
»Das ist in unserer Klinik üblich«, erklärte er. »Es werden das Normalgewicht, die Körpergröße, Blutgruppe und so weiter eingetragen. Vor allem der Rhesusfaktor muß festgestellt werden. Aber das können wir nachholen, falls es noch nicht geschehen ist. Es ist Ihr erstes Kind?«
Tamara Roth errötete flüchtig. »Ja«, erwiderte sie leise. Ein Unterton war in ihrer Stimme, der ihn stutzig machte. Er sah sie forschend an, sagte aber nichts.
»Dann werden wir Ihnen gleich mal Blut abzapfen«, fuhr er in seiner verbindlichen Art fort.
Das machte der neue Arzt Dr. Petersen. Tamara Roth musterte ihn kurz und lächelte.
»Es ist nett, daß Dr. Laurin auch bezüglich seiner Ärzte keine Vorurteile hegt«, sagte sie.
»Wie meinen Sie das?« fragte Dr. Petersen reserviert.
Tamara Roth wurde verlegen. »Mißverstehen Sie mich bitte nicht. Mein Mann ist auch Bartträger. Er ist Lehrer, und da hat es allerlei Schwierigkeiten gegeben.«
»Tatsächlich? Woran die Menschen nur Anstoß nehmen«, bemerkte er ironisch. »Man kann sich nur wundern.«
»Was hat es eigentlich mit dem Rhesusfaktor auf sich?« fragte Tamara Roth.
»Nun, fünfundachtzig Prozent der Menschen sind Rhesus positiv, fünfzehn Prozent Rhesus negativ. Es kann zu Komplikationen führen, wenn die Eltern des Kindes verschiedene Rhesusfaktoren haben. Aber glücklicherweise ist das ja selten der Fall.«
»Bei uns hoffentlich nicht«, sagte Tamara. Sie war so optimistisch eingestellt, daß sie gar nicht mehr wissen wollte. Dr. Laurin war schon auf der Station, als sie sich von Hanna verabschiedete, die ihr sagte, daß sie in drei Tagen nochmals kommen solle, dann würde sie auch ihren Mutterpaß mit allen Eintragungen bekommen.
Tamara Roth trat den Heimweg an. Es war ein schöner, warmer Tag. Sie ließ sich Zeit und ging durch den Wald. Es war ein Umweg, aber Jürgen kam ohnehin erst gegen halb zwei Uhr heim, und bis dahin hatte sie noch viel Zeit.
Daheim angekommen, öffnete sie alle Fenster der hübschen Parterrewohnung. Sie liebte frische Luft, die Natur überhaupt, und auch darin stimmte sie mit Jürgen überein.
Das Essen hatte sie schon vorbereitet. Jürgen war mit allem zufrieden, und das konnte er auch sein, denn Tamara verstand es, auch mit einfachen Mitteln ein wohlschmekkendes Essen zu bereiten. Ordentlich war sie von zu Haus aus, denn ihrer Mutter hatte sie frühzeitig helfen müssen, da sie noch drei kleine Geschwister hatte.
Doch auch in ihrem Leben, das an sich bisher ohne Komplikationen verlaufen war, gab es eine kurze Zeitspanne, an die sie sich nicht mehr erinnern wollte und die sie meinte, aus ihrem Gedächtnis gestrichen zu haben.
Jetzt freute sie sich auf die Heimkehr ihres Mannes. Jürgen konnte endlich beruhigt sein, daß sie seinem Drängen nachgegeben und Dr. Laurin aufgesucht hatte.
Vor drei Tagen war die Elternversammlung gewesen, und danach hatte Jürgen von Dr. Laurin erzählt.
»Ein phantastischer Mann«, hatte er gesagt, und da er sonst nie in Superlativen über einen Menschen redete, wußte Tamara gleich, wie tief beeindruckt er war.
»Mit Dr. Laurin kann man reden«, sagte er. »Wenn alle Väter so wären, gäbe es kaum Schwierigkeiten. Man merkt es ja auch sofort an den Kindern. Wenn du in seine Klinik gehst, Tamara, weiß ich dich bestens aufgehoben.«
Nun hatte auch sie Dr. Laurin kennengelernt und verstand Jürgens Begeisterung. Solch einen Arzt hatte sie in ihrem Leben noch nicht kennengelernt. Aber Dr. Petersen fand Tamara auch sehr nett, nicht nur deswegen, weil er einen Bart hatte wie ihr Mann.
Punkt halb zwei Uhr kam er heim. Tamara hörte seinen Wagen schon von weitem.
Tamara eilte zur Tür. Mittelgroß, schlank, mit blondem Haar und Bart, stand ihr Mann vor ihr. Er begrüßte Tamara mit einem zärtlichen Kuß.
»Warst du bei Dr. Laurin?« war dann seine erste Frage.
»Ja, ich hatte es dir doch versprochen«, erwiderte Tamara.
»Da bin ich aber froh. Alles in Ordnung?« Er sah sie besorgt an, obgleich es eigentlich keinen Anlaß gab.
»Soweit schon, aber er macht alles sehr gründlich. Ich bekomme noch einen Mutterpaß – wegen des Rhesusfaktors. Hast du das gewußt?«
»Daß es einen gibt – schon.«
Selbst bei dem bescheidensten Essen sparte er nicht an Lob.
»Wir müssen doch ein bißchen was auf der hohen Kante haben, wenn ich in die Klinik muß«, sagte Tamara. »Dann mußt du auswärts essen, Jürgen. Daran darf es nicht fehlen.«
»Denk lieber an dich, Tamara«, sagte er.
Er streichelte sacht über ihre Wange. »Es sind ja noch ein paar Monate bis dahin, und außerdem sollst du daran wirklich keine Gedanken verschwenden. Schau, uns Lehrern geht es so gut. Wir haben doch viel Freizeit.«
»Hat das wieder einer gesagt?« fragte sie.
»Das bekommt man fast tagtäglich zu hören. Ich mache mir nichts daraus. Du kannst es glauben, Tamara«, sagte er betont, als sie ihm einen schrägen Blick zuwarf. »Ich weiß nicht, wie es kommt, aber seit ich Dr. Laurin kennengelernt habe, bin ich viel selbstbewußter. Er hat meine Ansichten akzeptiert. Anerkennung von einem solchen Mann zählt doppelt, und die Kritik von anderen verliert dadurch an Schärfe.«
»An deinen Bart wird man sich auch noch gewöhnen«, meinte Tamara.
»Hat man schon. Kollege Renk läßt sich auch einen Bart wachsen. Ich mußte fast lachen.«
»Dr. Petersen in der Prof.-Kayser-Klinik hat auch einen«, sagte Tamara. »Da gibt es anscheinend nur nette Ärzte.«
»Dr. Laurin wird auch nicht jeden nehmen, wie ich ihn einschätze«, sagte Jürgen Roth.
*
So war es allerdings. Lange hatten Leon Laurin und seine Frau gesucht, bis sie zu den beiden Assistenten Dr. Rasmus und Dr. Thiele den Kollegen gefunden hatten, der zu diesem Team paßte.
Weder Peter Rasmus noch Jan Thiele gehörten zu jenen, die Konkurrenz fürchteten. Das brauchte man in der Prof.-Kayser-Klinik auch nicht, denn hier wurde Wert auf harmonische Zusammenarbeit gelegt, und der Chef ließ nicht die anderen für sich arbeiten, sondern war immer zur Stelle.
So war es auch schon zu Zeiten von Professor Joachim Kayser gewesen, Antonia Laurins Vater, der die Klinik gegründet hatte. Er konnte seinen Lebensabend mit seiner zweiten Frau Teresa genießen, denn er wußte die Klinik bei seinem Schwiegersohn in besten Händen.
Dr. Leon Laurin genoß größtes Ansehen, allerdings wurden ihm seine Erfolge hin und wieder auch von Klinikärzten geneidet.
Dr. Laurin hatte viele prominente Patientinnen, um die es manchmal recht dramatische Ereignisse gab.
Ja, man hätte schon ein Buch über die Prof.-Kayser-Klinik schreiben können, und das tat Schwester Marie schon seit einiger Zeit in aller Heimlichkeit. Niemand wußte davon.
Schwester Marie war schon viele Jahre an der Prof.-Kayser-Klinik tätig. Sie war schon Professor Kaysers engste Vertraute gewesen und wurde von der gesamten Familie ebenso geliebt wie von den meisten Patientinnen. Einige hatte es in den vielen Jahren aber auch gegeben, mit denen man mehr Ärgernis gehabt hatte als Freude.
Mit diesem Tag, an dem Dr. Lars Petersen seine Arbeit in der Prof.-Kayser-Klinik aufgenommen hatte, begann in Schwester Maries Tagebuch ein neues Kapitel.
Als Dr. Laurin sie nach ihrer Meinung fragte, hatte sie seiner Entscheidung zugestimmt. Das besagte nun allerdings nicht, daß sie sogleich Feuer und Flamme für Dr. Petersen war, wie zum Beispiel Schwester Emma. Schwester Marie wollte erst Beweise seines Könnens sehen.
Vom Typ her war er ganz anders als Dr. Rasmus oder Dr. Thiele, obgleich man den beiden gewiß nicht nachsagen konnte, daß sie unkompliziert wären. Aber Dr. Petersen schien Schwester Marie fast ein wenig geheimnisumwittert. Er war ein ganz eigenartiger Mann, er war höflich und verbindlich und doch verschlossen, wenn auch nicht so scheu, wie es Dr. Rasmus anfangs gewesen war.
Wäre Marie ganz ehrlich mit sich selbst gewesen, hätte sie zugeben müssen, daß Dr. Petersen sie außerordentlich beeindruckte. Sie hätte sich dieses in ihrem Alter durchaus leisten können, ohne in falschen Verdacht zu geraten, aber sie hütete sich, ein Wort darüber verlauten zu lassen.
Begeistert hatte sich Schwester Emma über Lars Petersen geäußert, aber sie war erst dreißig und bei aller Tüchtigkeit doch interessiert, noch einen Mann abzubekommen. Gerade deshalb enthielt Schwester Marie sich jeder Bemerkung, als Schwester Emma ihre Lobeshymnen anstimmte.
»Ist er eigentlich verheiratet?« fragte Schwester Emma.
Marie lächelte in sich hinein. »Keine Ahnung«, erwiderte sie, obgleich sie wußte, daß Dr. Petersen verwitwet war.
Das hatte Antonia Laurin ihr erzählt.
Schwester Marie wußte mehr über Dr. Petersen, denn Antonia Laurin hatte vor ihr keine Geheimnisse. So hatte sie auch erfahren, daß Dr. Petersens Frau eine Südamerikanerin gewesen war, und daß er aus dieser Ehe einen vierjährigen Sohn hatte, der Ronald hieß.
»Er ist ein Gentleman«, sagte Schwester Emma schwärmerisch.
»Das will ich sehr hoffen«, meinte Schwester Marie anzüglich.
Lars Petersen benahm sich wirklich wie ein Gentleman, und selbst Schwester Marie genoß nicht den Vorzug, mit mehr als einigen höflichen Worten bedacht zu werden. Aber das nahm sie ihm nicht übel. Nein, es gefiel ihr.
Sie fügte ihrem Tagebuch über die Prof.-Kayser-Klinik am Ende eines wie immer arbeitsreichen Tages ein ganz langes Kapitel hinzu, das ausschließlich den Betrachtungen über den neuen Assistenzarzt Dr. Lars Petersen gewidmet war.
Für Dr. Laurin wäre es sehr interessant gewesen, das zu lesen, was sie geschrieben hatte, aber er bekam es nicht zu Gesicht, wie auch kein anderer. Schwester Marie verschloß dieses Tagebuch immer sehr sorgfältig.
*
»Nun, wie macht sich Dr. Petersen?« empfing Antonia Laurin ihren Mann.
Leon Laurin lachte leise auf. »Zuerst möchte ich einen Kuß haben«, sagte er.
Den bekam er, und dann kamen die Kinder schon in Schlafanzügen, denn es war bereits acht Uhr.
»Bist wieder spät dran«, sagte Konstantin. »Wir dachten, jetzt wird es besser, wo noch ein Arzt da ist.«
»Doch nicht gleich am ersten Tag«, meinte Leon. »Schließlich hatten wir noch manches zu besprechen. Es ist erfreulich, daß sich die gesamte Familie so interessiert zeigt.«
»Ist doch klar, Papi«, sagte Kaja. »Wir wollen dich doch mehr für uns haben. Ist sein Sohn schon da?«
Das interessierte sie am meisten. Man hatte über diesen kleinen Ronald gesprochen, auch darüber, daß er ein bißchen anders aussah als die Kinder hierzulande. Daß er bräunliche Haut hatte, schwarzes Haar und ganz dunkle Augen. Antonia wollte die Kinder nur vorbereiten, daß dieser kleine Ronald sich fremd ausnehmen würde in dieser Umwelt.
»Nein, er ist noch nicht da«, erwiderte Leon. »Er kommt erst nächste Woche.«
»Schade, ich bin schon sehr neugierig«, sagte Kaja.
»Typisch Mädchen«, meinte Konstantin. »Sie sind immer neugierig.«
»Sag nur, daß du es nicht bist«, meinte Kaja.
»Ist doch egal, wie er aussieht«, meinte Konstantin. »Hauptsache ist, daß Papi früher heimkommt. Er ist jetzt Elternbeirat. Wir müssen ihm alles sagen, was uns in der Schule nicht gefällt«, sagte Konstantin.
»Jemine, da habe ich mir was Schönes eingebrockt«, sagte Leon.
»Frau Meiler hat mich meinen Topflappen dreimal auftrennen lassen«, sagte Kaja empört. »Ich kann nicht schön häkeln.«
»Muß das überhaupt sein?« fragte Leon.
»Weiß der Himmel, warum. Ich habe mich auch schon abgeplagt, aber ändern werden wir das wohl nicht können. Selbst wenn du jetzt Elternbeirat bist, Leon«, sagte Antonia.
»Manche Kinder machen es ja auch gern«, räumte Kaja ein, »aber warum muß man es machen, wenn man es nicht gern tut?«
»Ja, warum läßt man eigentlich den Kindern nicht den Spaß, das zu machen, was sie gern tun?« fragte Leon. »Dann ist es doch schon halb getan.«
»Siehste, Kaja, Papi versteht uns«, sagte Konstantin. »Er ist richtig für den Elternbeirat.«
»Danke für das Kompliment«, sagte Leon lächelnd, »aber hoffentlich seid ihr nicht böse, wenn ich doch nichts ändern kann.«
Leon und Antonia sahen sich an und lächelten. Sie waren sich einig.
Über Dr. Petersen konnten sie erst später sprechen, denn für die nächste halbe Stunde wurde Leon von den Kindern belagert. Sie schauten zu, wie er aß und animierten ihn immer wieder, nur ja richtig zu essen.
Karin, die treue Seele des Hauses, konnte die Kleinen dann endlich mit dem Versprechen ins Bett locken, ihnen noch eine Geschichte zu erzählen.
»Hoffentlich verkünden sie nun nicht in der Schule, daß sie so lange aufbleiben dürfen«, sagte Leon. »Sonst kommt man zu der Erkenntnis, daß ich nicht gerade der richtige Vertreter für die Elternschaft bin.«
»Das wäre dir doch nur recht«, neckte ihn Antonia.
»Ach, weißt du, so ist es auch nicht«, meinte Leon. »Man kann vielleicht doch manches beeinflussen. Übrigens war heute Frau Roth bei mir.«
Antonia sah ihn überrascht an. »Sind sie nun verheiratet oder nicht?« fragte sie.
»Natürlich sind sie verheiratet«, erwiderte Leon, »nur weil er unkonventionell aussieht und einen Bart hat, braucht man ihm doch wahrhaftig nicht auch noch eine wilde Ehe anzuhängen. Außerdem ist es heutzutage nichts Besonderes mehr, wenn junge Paare unverheiratet zusammenleben.«
»Manche sind aber so«, sagte Antonia lächelnd. »Ist sie auch so nett wie er?«
»Nett und natürlich. Dennoch ein ziemlich schwieriges Kapitel für mich.«
»Wieso denn das?« fragte Antonia interessiert.
»Rhesus negativ«, erwiderte er lakonisch.
»Liebe Güte, aber es ist doch ihr erstes Kind«, sagte Antonia. »Da wäre wohl eigentlich nichts zu befürchten.«
»Wenn sie nur nicht schon mal eine Fehlgeburt gehabt hat«, sagte Leon nachdenklich. »Man kann ja nicht wissen. Ich werde sie fragen müssen. Du weißt ja selbst, daß die eigentliche Gefahr erst bei dem zweiten Kind gegeben ist, gleich, ob ein erstes ausgetragen wurde oder nicht.«
»Dann wollen wir hoffen, daß dies nicht der Fall ist«, sagte Antonia. »Und nun erzähl mal von Dr. Petersen.«
»Ja, was soll ich da schon sagen, Antonia. Wir haben Glück gehabt. Er kann mehr, als ich erhofft habe. Eigentlich wäre er der geborene Chefarzt. Sicher in der Diagnose, jeder Situation gewachsen.«
»Soll das etwa heißen, daß du dich zur Ruhe setzen willst?« scherzte Antonia.
»Nein, weiß Gott nicht, aber es bleibt zu fürchten, daß er uns nicht lange erhalten bleibt.«
»Oh, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, daß er unbedingt Karriere machen will. Er sucht Ruhe.«
»Schön wäre es ja. Ich hoffe auch, daß wir ihm mit dem hübschen Haus die Stellung schmackhaft gemacht haben.«
*
Dieses Haus betrat Dr. Petersen erst gegen elf Uhr abends. Er hatte noch gewissenhaft die Krankenberichte zweier Patientinnen studiert, die an diesem Tag eingeliefert worden waren, und danach hatte er sich mit Dr. Thiele unterhalten, der in dieser Nacht Dienst tat. Es hatte sich ganz von selbst ergeben, weil sie sich beide Gedanken über Frau Wenniger machten, der ein Eierstock entfernt werden sollte und die aus diesem Grunde unter schweren seelischen Depressionen litt.
Sie war gerade erst siebenundzwanzig Jahre alt geworden und wünschte sich sehnlichst Kinder.
Seit ihr Mann sie in die Klinik gebracht hatte, weinte sie unaufhörlich. Dr. Petersen hatte sie endlich beruhigen können. Sie war eingeschlafen.
»Dafür gebührt Ihnen ein Orden«, sagte Dr. Thiele. »Das hat nicht mal der Chef fertiggebracht. Wie ist es Ihnen gelungen, Kollege?«
»Ich habe ihr eindringlich gesagt, daß sie die Hoffnung auf ein Kind nicht aufgeben müßte.«
»Das ist augenblicklich aber nur ein frommer Wunsch. Wir wissen noch nicht, ob der zweite Eierstock auch zu retten ist«, sagte Dr. Thiele skeptisch.
»Aber was nützt es, wenn sie völlig verzweifelt an diese Operation herangeht? Sie braucht jetzt ihre ganze Widerstandskraft und einen eisernen Lebenswillen. Manche Leiden kann man nicht mit einer Operation heilen.«
Natürlich mußte ihm Dr. Thiele recht geben, nur hätte er soviel Einfühlungsvermögen bei dem anderen nicht vorausgesetzt. Doch nach diesem Gespräch ahnte er bereits, daß man wohl noch manche Überraschung mit ihm erleben würde.
Nun betrat Dr. Petersen das hübsche Haus, das dicht am Wald gelegen war. Als er durch den Garten gegangen war, hatte er gedacht, daß Ronald sich hier wohl fühlen müßte. Immer fühlte er sich beklommen, wenn er an seinen kleinen Sohn dachte, den er so selten gesehen hatte. Er empfand auch ein Schuldbewußtsein seiner Schwester Birgit gegenüber, die Ronald nun schon von Geburt an betreute.
Endlich konnte er sie nun beide zu sich holen, und doch bedrückte es ihn, daß er nicht vollends glücklich bei dem Gedanken war.
Als er Ronald zum ersten Mal im Arm gehalten hatte, war der einzige Gedanke gewesen, daß sein Leben das Leben seiner Mutter gekostet hatte. Darüber war Lars Petersen bis heute nicht hinweggekommen.
Als er nun den hellen Wohnraum betrat, fiel sein erster Blick auf die Fotografie, die auf einem niedrigen Schränkchen stand.
Ein anmutiges Gesicht blickte ihn an.
Seine Finger schlossen sich so fest um den schmalen Silberrahmen, daß sie ganz weiß wurden.
»Malita«, flüsterte er, »warum hast du mich verlassen?«
Die Jahre, die seit ihrem Tode vergangen waren, hatten den Schmerz nicht verlöschen lassen. Wie sehr hatte er dieses junge Geschöpf geliebt, das nur für so kurze Zeit eine glückliche Frau sein konnte. Seine Frau, Ronalds Mutter!
Wie ähnlich ihr der Junge war! Wie sollte er es nur ertragen, ihn Tag für Tag zu sehen und immer an Malita dabei zu denken?
Er mußte damit fertig werden. Der Junge brauchte ihn. Er konnte nicht alles Birgit überlassen. Sie war jung. Sie hatte ein Recht auf ein eigenes Leben. Auch ein Recht auf eigene Kinder.
Wir werden jetzt eine Heimat haben, ging es ihm durch den Sinn, ein schönes, ein friedliches Haus. Hier gab es Menschen, die Ronald wegen seiner etwas dunkleren Hautfarbe nicht als Fremdling betrachten würden.
Er liebte sein Kind. Er wollte es um sich haben. Ronald war Malitas Vermächtnis, alles, was von ihr geblieben war, außer der Erinnerung an eine unendlich glückliche, doch viel zu kurze Ehe.
Jetzt verspürte Lars Petersen das brennende Verlangen, mit seiner Schwester zu sprechen. Selbst auf die Gefahr hin, sie aus dem Bett zu holen, rief er sie an.
*
Birgit Petersen hatte leise den Hörer aufgelegt und wollte in ihr Zimmer zurückgehen. Auch sie empfand eine tiefe innige Freude, nun bald bei ihrem Bruder sein zu können. Es hatte sie froh gestimmt, daß Lars ihr mit so liebevollen Worten gesagt hatte, wie sehr er sich auf ein Wiedersehen freute.
»Biggi«, tönte ein Flüsterstimmchen an ihr Ohr, als sie den schmalen Gang der kleinen Wohnung entlangging.
Schnell ging sie in das kleine Kinderzimmer.
»Ich habe es läuten gehört«, sagte er. »Hat Daddy angerufen?«
»Ja, mein Liebling«, erwiderte sie zärtlich. »Jetzt werden wir bald zu ihm fahren.«
»Freut er sich auch?« fragte Ronald.
»Er freut sich sehr, und er hat ein sehr schönes Haus mieten können, in dem du ein großes Kinderzimmer haben wirst.«
Mit seinen großen samtenen Augen sah Ronald sie an. »Aber du bleibst bei mir«, flüsterte er flehend.
»Natürlich bleibe ich bei dir«, erwiderte sie.
Seine Ärmchen legten sich um ihren Hals. »Ich habe dich so lieb«, sagte er.
»Daddy mußt du auch liebhaben, Ronald«, sagte Birgit leise. »Ja, und nun schläfst du schön, mein Liebling. Morgen fangen wir mit dem Packen an.«
Wer weiß denn, wie lange Lars dort an der Prof.-Kayser-Klinik bleiben wird, dachte sie. Vielleicht treibt es ihn doch bald wieder hinaus in die Fremde.
Wenn er doch nur endlich über Malitas Tod hinwegkommen würde! Sie seufzte schwer.
Ronald schaute sie fragend an.
»Hast du wieder Sorgen, Biggi?« fragte er.
»Nein, Ronald. Ich freue mich. Einen schönen großen Garten werden wir haben. Du bekommst einen Sandkasten und eine Schaukel.«
»Und du machst dir keine Sorgen mehr«, sagte Ronald.
Sorgen hatte sie in ihrem jungen Leben wahrhaftig zur Genüge gehabt. Den Vater hatten sie früh verloren, die Mutter war leidend gewesen. Ein paar Wochen nach ihrem Tod war Lars nach Südamerika gegangen und hatte die damals achtzehnjährige Birgit mitgenommen.
Birgit blickte auf das Kind, das nun wieder eingeschlafen war. Ronalds Wange lang auf ihrer Hand. Die zärtliche Liebe und Anhänglichkeit dieses kleinen Jungen bedeuteten ihr so unendlich viel.
Hatte sie nicht manchmal sogar Angst davor, daß Lars doch wieder eine Frau finden und ihr Ronald dann wegnehmen könnte?
Jetzt wollte sie ihn nicht mehr hergeben.
Birgit Petersen war jetzt vierundzwanzig Jahre alt und ein sehr attraktives Mädchen. Silberblondes Haar umgab ein ovales Gesicht, das von klaren graugrünen Augen beherrscht wurde. Obgleich ihr Spiegelbild einen sehr erfreulichen Anblick bot, widmete sie ihm nur einen kurzen Blick im Vorübergehen. Sie ging noch nicht zu Bett. Sie mußte noch einige Übersetzungen machen. Das tat sie schon geraume Zeit für eine Firma, die geschäftliche Verbindungen mit Südamerika hatte. Spanisch und Portugiesisch beherrschte Birgit ebenso perfekt wie Englisch.
Lars durfte nichts davon wissen, daß sie nebenbei noch arbeitete. Er hatte ihr immer genügend Geld überwiesen, aber Birgit war geistig viel zu rege, um die Tage so verstreichen zu lassen.
Mitternacht war längst vorbei, als Birgit ihre letzte Arbeit beendet hatte, die allerletzte, denn die kommenden Tage würde sie doch für die Vorbereitungen zur Reise brauchen.
*
Schwester Marie hatte am folgenden Tag Gelegenheit, neue Erkenntnisse über Dr. Petersen zu sammeln, nachdem er es tatsächlich fertiggebracht hatte, Frau Wenniger jede Angst vor der Operation zu nehmen. Sie war schon soweit gewesen, aus der Klinik davonzulaufen, und hatte damit einige Aufregung verursacht.
Inzwischen hatte sich Frau Wenniger entschieden. Für die Operation! Dr. Petersen hätte sie überzeugt, erklärte sie.
»Womit haben Sie sie überzeugt?« fragte Dr. Laurin. »Doch nicht etwa mit falschen Hoffnungen?«
»Nein«, erwiderte der andere ruhig. »Ich habe ihr die Situation ganz sachlich erklärt. In diesem Fall hat es doch keinen Sinn, falsche Hoffnungen zu wecken. Das Risiko ist zu groß. Ich habe es Frau Wenniger gesagt. Sie weiß jetzt, daß sie nur eine geringe Chance hat, Kinder zu bekommen, aber sie will diese Chance wahrnehmen.«
Dr. Laurin blieb skeptisch, aber als er selbst mit Frau Wenniger sprach, änderte sich das. Dr. Petersen schien tatsächlich Überzeugungskraft zu haben.
Die Operation wurde für den nächsten Tag festgesetzt. Frau Wenniger hatte ihre schriftliche Einwilligung gegeben, doch am Spätnachmittag kam ihr Mann, und auch er äußerte Dr. Laurin gegenüber seine Skepsis.
»Dieser Dr. Petersen hat meine Frau wohl hypnotisiert«, sagte er zu Dr. Laurin. »Sie haben mir doch selbst gesagt, daß wir uns nicht zuviel Hoffnung machen sollen, Herr Doktor. Und Sie sind der Chef.«
»Dr. Petersen hat meines Wissens Ihrer Frau auch gesagt, wie gering die Chance ist«, sagte Dr. Laurin. »Sie ist sich darüber im klaren.«
»Das ist es ja eben. Sie ist so optimistisch, obgleich sie es nun weiß. Ich verstehe das nicht.«
»Immerhin wäre der Allgemeinzustand Ihrer Frau ernsthaft gefährdet, wenn die Operation nicht durchgeführt wird«, sagte Dr. Laurin. »Das wollen Sie doch nicht?«
»Um Himmels willen«, sagte Wilhelm Wenniger. »Wenn es eben nichts nützt, dann adoptieren wir ein Kind, hat sie gesagt. Davon durfte man früher gar nicht reden.« Er machte eine kleine Pause.
»Ich möchte gern selbst mal mit Dr. Petersen sprechen, Herr Doktor. Geht das?« fragte Herr Wenniger.
»Selbstverständlich. Ich werde ihn rufen lassen.«
Nicht die kleinste Unsicherheit war Dr. Petersen anzumerken, als er kam. Dr. Laurin ließ ihn mit Herrn Wenniger allein. Eine Viertelstunde später sah er die beiden nebeneinander durch die Halle gehen. Wilhelm Wenniger sah den Arzt unentwegt an, und dann schüttelte er kräftig dessen Hand. Es war nicht zu übersehen, daß Übereinstimmung zwischen ihnen herrschte.
Am Nachmittag kam Tamara Roth. Hanna Bluhme hatte sie angerufen, denn die drei Tage waren noch nicht vergangen.
Tamara war bestürzt gewesen. Sie hatte ihrem Mann nichts von dem Anruf gesagt, weil sie ganz plötzlich von einem beklemmenden Gefühl erfaßt wurde. Sie sagte ihm, daß sie Besorgungen machen wolle.
»Vielleicht gehe ich noch zum Friseur«, sagte Tamara, als sie sich verabschiedete. »Ich werde mir die Haare etwas kürzen lassen.«
Jürgen zwinkerte ihr zu. »Soll das ein Wink mit dem Zaunpfahl sein?« fragte er. »Willst du mir zuvorkommen?«
»I wo, so darfst du es nicht auffassen.« Tamara fühlte sich schuldbewußt, weil sie Jürgen etwas verheimlichte.
Einmal hatte sie ihm etwas verheimlicht. Etwas ganz Entscheidendes sogar, aber da war sie der Überzeugung gewesen, daß die Wahrheit ihr Glück gefährden könnte. Sie hatte sich fest vorgenommen, ihm niemals wieder etwas zu verheimlichen, und nun bedrückte sie selbst diese kleine Ausrede.
»Ich gehe morgen auch zum Friseur«, sagte er lächelnd.
Tamara gab ihrem Mann noch einen Kuß.
»Du gefällst mir immer, Jürgen«, sagte sie zärtlich.
Was wäre, wenn das Bild zerstört würde, das er sich von mir macht? dachte Tamara Roth, als sie den Weg zur Prof.-Kayser-Klinik einschlug. Ihr Herz klopfte schmerzhaft. Eine wahnsinnige Angst war plötzlich in ihr. Warum eigentlich?
»Wir haben die Befunde schon«, hatte Hanna Bluhme am Telefon gesagt. »Es würde zeitlich heute gut passen, wenn Sie kommen könnten.«
Das brauchte doch nichts Besonderes zu sein. Sie war nicht krank. Sie fühlte sich pudelwohl, wie Jürgen immer sagte.
Sie gestand sich nicht ein, daß sie mit solchen Gedanken andere verdrängen wollte. Und doch überfielen sie diese mit Macht.
Nichts werde ich sagen, dachte Tamara. Es gehört der Vergangenheit an. Es ist längst vergessen. Aus einer Blutuntersuchung konnte man bestimmt nicht entnehmen, daß eine Frau bereits einmal eine Fehlgeburt hatte.
Kalter Schweiß trat ihr bei dem Gedanken auf die Stirn, und sie war sehr blaß, als sie bei Hanna Bluhme eintrat, um sich anzumelden.
Hanna sah das sofort. Sie hatte ihre eigene Art, aufmunternd auf die Patientinnen einzureden, und meistens hatte sie auch Erfolg. Auch Tamara Roth beruhigte sich. Die Farbe kehrte in ihr Gesicht zurück, und als Dr. Laurin nach zehn Minuten kam, wirkte sie wieder halbwegs frisch.
Ganz wohl war es Dr. Laurin allerdings auch nicht, als sie sich dann in seinem Sprechzimmer gegenübersaßen.
»Sie brauchen jetzt nicht zu erschrecken, Frau Roth«, begann er betont ruhig. »Die Blutuntersuchung hat ergeben, daß Ihr Rhesusfaktor negativ ist. Ich muß es Ihnen sagen, aber da es Ihr erstes Kind ist, fällt es nicht so sehr ins Gewicht. Allerdings darf ich Ihnen nicht verschweigen, daß es für jedes weitere Kind eine Gefahr wäre.«
Tamara war wieder tief erblaßt. Ihre Hände preßten sich aneinander. Sie fühlten sich feucht an, und auch auf ihrer Stirn erschienen wieder kleine Schweißtropfen.
»Inwiefern?« fragte sie heiser.
»Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken«, sagte Dr. Laurin beruhigend. »Wir sind heute in der Medizin schon so weit fortgeschritten, daß wir auch da Maßnahmen ergreifen könnten, um die Gesundheit des Kindes nicht zu gefährden. Man muß beizeiten einen Blutaustausch vornehmen.«
»In welcher Beziehung könnte ein zweites Kind gefährdet sein?« fragte Tamara.
»Damit brauchen Sie sich gar nicht zu belasten. Es ist ja Ihr erstes Kind«, sagte Dr. Laurin. »Um jedoch ganz sicherzugehen, möchte ich doch die Frage an Sie stellen, ob Sie eventuell schon eine Fehlgeburt hatten.«
»Nein!« stieß Tamara hervor.
Dr. Laurin stutzte. Forschend blickte er sie an. »Dann ist ja alles soweit in Ordnung«, sagte er, aber irgendwie fühlte er sich unbehaglich.
»Möchten Sie mir nicht näher erklären, was eine Fehlgeburt damit zu tun hätte?« fragte Tamara. »Ich möchte gern mehrere Kinder haben. Gesunde Kinder«, fügte sie nach einem tiefen Atemzug hinzu. »Mit dem Rhesusfaktor habe ich mich erst beschäftigt, seit ich neulich bei Ihnen war. Mein Mann hat mir erklärt, daß nur fünfzehn Prozent aller Menschen den Rhesusfaktor negativ haben.«
»Ja, das stimmt. Wer zerbricht sich darüber schon den Kopf, wenn er nicht weiß, daß er davon betroffen ist. Immerhin bestünde auch die Möglichkeit, daß Ihr Mann ebenfalls Rhesus negativ ist.«
»Aber angenommen, ich hätte schon eine Fehlgeburt gehabt, könnte es Komplikationen geben?« sagte sie gepreßt.
»Allerdings.«
»Wieso?«
»Wissenschaftlich kann man das so erklären: Rhesusunverträglichkeit bedeutet Zerstörung der Hämolyse, auf Deutsch, der roten Blutkörperchen bei Neugeborenen. Wie schon gesagt, besteht diese Gefahr nur, wenn der Vater des Kindes Rhesus positiv und die Mutter negativ ist. Die Mutter bildet dann im Laufe der Schwangerschaft gewisse Abwehrkörper gegen die Bluteigenschaft des Kindes auf. Aber wenn man als Arzt vorbereitet ist, kann man Schäden verhindern. Deshalb fragte ich Sie, ob Sie bereits eine Fehlgeburt hatten, denn eine Schwangerschaft, die unterbrochen wurde, spielt eine ebenso beträchtliche Rolle wie eine vollendete Geburt.«
Nein! dachte Tamara. So grausam kann das Schicksal nicht sein, daß ich noch so viele Jahre danach bezahlen muß!
Ihr Blick war leer, als sie den Kopf hob. »Es ist mein erstes Kind«, sagte sie schleppend. »Aber bitte, tun Sie alles, damit es gesund zur Welt kommt, Herr Doktor.«
»Das ist selbstverständlich. Aber Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen zu machen, Frau Roth.«
Keine Sorgen, ich soll mir keine Sorgen machen? hämmerte es in ihrem Kopf, als sie heimwärts ging.
Ich muß mich genau informieren, dachte sie dann. Dr. Laurin geht ja von dem Standpunkt aus, daß es das erste Kind ist, das ich erwarte. Ich habe ihn belogen. Ich habe auch Jürgen nicht die Wahrheit gesagt.
Wild überstürzten sich ihre Gedanken.
Ich kann es Jürgen nicht sagen, dachte sie. Er würde es niemals verstehen, daß ich es ihm verschwiegen habe. Aber hätte er sie geheiratet, wenn sie ihm die ganze Wahrheit damals gesagt hätte?
*
Jürgen Roth klappte das letzte Schulheft zu. Er war alles in allem ganz zufrieden mit den Leistungen der Zweitklässler. Konstantin und Kaja Laurin hatten wieder die besten Diktate geschrieben.
Bei den Eltern, dachte Jürgen Roth und lächelte. Tamara würde sicher auch eine liebevolle Mutter werden.
Bei diesem Gedanken angelangt, vernahm er ein Geräusch an der Tür. Es schreckte ihn auf, und schnell eilte er in die Diele und öffnete die Tür. Seine Frau lehnte an der Wand. Sie sah elend aus.
Weil sie niemals Schwächezustände gehabt hatte, hatte er sich bisher auch nicht allzu viele Gedanken über ihren Zustand gemacht. Besonders nicht, nachdem sie bei Dr. Laurin gewesen war. Rücksichtsvoll war er selbstverständlich gewesen, doch jetzt bekam er es mit der Angst, als er ihren leeren Blick bemerkte.
»Soll ich nicht lieber den Arzt anrufen, Tamara?« fragte er.
»Nein, nein!« stieß sie hervor. »Jetzt geht es mir schon wieder besser. Bitte, mach dir keine Sorgen, Jürgen.«
Er streichelte ihre Wangen und ihre Hände, aber als sie aufstehen wollte, drückte er sie sanft in die Kissen zurück. »Jetzt bist du ganz brav«, sagte er liebevoll. »Heute mache ich das Abendessen, und du bleibst hübsch folgsam liegen. Nein, keinen Widerspruch, mein Liebes.«
Tränen quollen aus Tamaras Augen und rollten über ihre Wangen. Lieber Gott, laß mich doch nicht für etwas büßen, was ich nicht wollte, ging es ihr durch den Sinn. Ich liebe Jürgen. Ich möchte ihn nicht verlieren. Ich möchte ihm ein gesundes Kind schenken.