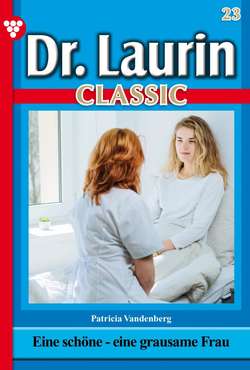Читать книгу Dr. Laurin Classic 41 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDr. Leon Laurin hatte die Morgenvisite noch nicht ganz beendet, als er dringend von Hanna Bluhme verlangt wurde. Es mußte schon etwas Wichtiges sein, wenn Hanna ihn durch die Sprechanlage rufen ließ.
»Macht ohne mich weiter«, sagte er zu seinem Team und eilte zur Aufnahme.
»Na, wo brennt’s denn?« fragte er. Hanna hatte den Telefonhörer noch in der Hand.
»Irgendwo ist eine Frau zusammengebrochen«, erwiderte sie. »Sie sind mit dem Notarztwagen schon unterwegs. Gleich müssen sie eintreffen.«
Da hörten sie auch schon die Sirene. »Dabei sind wir ausgebucht«, stöhnte Hanna.
»Ruhe bewahren«, sagte Dr. Laurin. Die Türen des Notarztwagens waren schon geöffnet, und er sah eine bewußtlose junge Frau.
»Kleberg«, stellte sich der junge Arzt vor, der bereits ausgestiegen war. »Scheint sich um eine Fehlgeburt zu handeln.«
Dr. Petersen war, von Hanna herbeizitiert, in der Tür erschienen.
»OP fertigmachen«, rief Dr. Laurin ihm zu.
»Nicht gerade typisch für eine Fehlgeburt«, sagte Dr. Laurin nachsichtig.
»Sie hat viel Blut verloren«, sagte Dr. Kleberg.
Dr. Laurin hatte es eilig. Schwester Marie, die Getreue, hatte alles schon bereitgelegt. Die Bewußtlose war auf den Untersuchungstisch gelegt worden.
Wenige Minuten später machte Dr. Laurin die erste Injektion selbst. »Blutgruppe feststellen«, ordnete er dann an.
»Die Personalien auch. Die Angehörigen müssen verständigt werden. Leider sehe ich da nur eine winzige Überlebenschance. Ich möchte wissen, wer das verbockt hat.«
Was er damit meinte, erfuhr Dr. Lars Petersen später. Leider hatte man die Personalien der jungen Frau noch nicht feststellen können, denn sie hatte keine Papiere bei sich.
»Sie muß vor drei bis vier Monaten ein Kind zur Welt gebracht haben«, sagte Dr. Laurin zu Dr. Petersen.
»Die Nachgeburt ist nicht genau kontrolliert worden. Folge davon ist eine Sepsis. Gebe Gott, daß wir sie durchbekommen.«
Dr. Petersen hegte nicht den geringsten Zweifel an Dr. Laurins Diagnose. Während der Monate, die er an der Prof.-Kayser-Klinik tätig war, hatte er feststellen können, daß die Diagnosen seines Chefs stimmten.
»Dann war es möglicherweise eine Hausentbindung?« überlegte Dr. Petersen. Dr. Laurin runzelte die Stirn. »Nach dem Äußeren, der Kleidung und dem Schmuck der Patientin, kann man schließen, daß sie der sogenannten gehobenen Gesellschaft zugehört. An eine Hausentbindung glaube ich nicht, sondern an eine ganz verdammte Nachlässigkeit, und leider…«, er unterbrach sich kurz, weil Hanna wieder in Erscheinung trat.
»Da ist eben ein Anruf von einem Polizeirevier gekommen, Chef. Eine Frau wird vermißt. Sie wird von ihrem Mann gesucht. Der Name ist Höhne. Ich habe gesagt, daß hier eine Patientin eingeliefert worden ist, deren Namen wir noch nicht wissen. Herr Höhne wird kommen.«
»In Ordnung«, sagte Leon Laurin, und zu Dr. Petersen gewandt: »Wir sprechen später noch über derartige Fälle.«
*
Pünktlich halb ein Uhr, wie jeden Tag, war Helmut Höhne aus seinem Büro daheim angekommen. Der Bungalow war ein Meisterwerk moderner Architektur, bestechend durch seine glatten Linien. Helmut Höhne war ein genialer Architekt. Der Bungalow war gerade noch rechtzeitig vor der Geburt seines ersten Kindes fertig geworden.
Als er die Tür aufschloß, hörte er das Baby weinen. Das junge Kindermädchen kam mit verstörtem, unglücklichem Gesicht aus dem Kinderzimmer.
»Patrick läßt sich nicht beruhigen«, sagte sie. »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er will sein Fläschchen nicht trinken. Frau Höhne ist noch immer nicht vom Arzt zurück.«
»Das kann doch nicht möglich sein«, sagte Helmut erschrocken. »Sie wollte doch gleich morgens fahren.«
»Das ist sie ja auch«, sagte Traudel. »Ich mache mir ja schon solche Sorgen, Herr Höhne.«
Helmut Höhne kümmerte sich jetzt nicht um seinen kleinen Sohn, den er doch über alles liebte. Er rief in der Privatklinik Dr. Schollmeier an. Er fragte nach seiner Frau. Sein Gesicht verdüsterte sich, als er erfuhr, daß sie zwar zum vereinbarten Termin dort gewesen sei, Dr. Schollmeier aber durch eine Operation verhindert gewesen sei, sie zu empfangen.
»Und einen anderen Arzt haben Sie wohl nicht«, stieß er erregt hervor. »Jedenfalls ist meine Frau noch nicht daheim, und wenn ihr etwas zugestoßen ist, kann Ihr Dr. Schollmeier etwas erleben.«
Dann knallte er den Hörer auf. Das Temperament ging leicht mit ihm durch, und jetzt war er von Angst gejagt.
Wieder nahm er den Telefonhörer zur Hand und wählte die Nummer seiner Mutter. Überstürzt berichtete er von seinen Sorgen.
Marga Höhne versprach, sofort zu kommen. Sie teilte die Sorge ihres Sohnes. Sie hatte ihre Schwiegertochter gern und sich in letzter Zeit schon manche Gedanken um deren Gesundheitszustand gemacht.
Marga Höhne war eine jugendliche Fünfzigerin. Ihr kleiner Enkel war ihr ganzes Glück. Er war ein kräftiges, gesundes Kind. Man hatte gestaunt, daß eine so zarte Frau wie Katja einen so strammen Buben zur Welt gebracht hatte. Aber leider schien die Geburt sie sehr geschwächt zu haben. Allerdings hatte Marga Höhne auch andere Bedenken gehegt. Ihr hatte nämlich so manches in der Schollmeier-Klinik nicht gefallen.
Mit dem Wagen brauchte sie eine knappe Viertelstunde, um in den südlich von München gelegenen Villenvorort zu gelangen, aber als sie dort ankam, war Helmut schon unterwegs und Traudel in Tränen aufgelöst. Marga Höhne mußte sich höllisch zusammennehmen, aber jetzt galt es erst, den kleinen Patrick zu beruhigen, der schon krebsrot und heiser war vom Schreien.
»Er ist gewöhnt, von seiner Mami gefüttert zu werden«, sagte Traudel entschuldigend. »O Gott, o Gott, des wird doch nichts passiert sein? Sie hat ja so schlecht ausgesehen heute morgen.«
Marga Höhne fand es überflüssig, jetzt etwas dazu zu sagen. Sie nahm den Kleinen auf und sprach beruhigend auf ihn ein. Ihre weiche Stimme schien ihn doch zu beruhigen, und endlich begann er auch an seinem Fläschchen zu saugen. Das wenigstens hatte sie erreicht.
Helmut war indessen bei der Prof.-Kayser-Klinik angekommen.
»Ich suche meine Frau, ich suche Katja«, stieß er hervor.
Dr. Laurin hielt sich nicht damit auf, sich eine Beschreibung von dieser Frau geben zu lassen. Er führte Helmut Höhne zu dem Raum, in den man das Bett mit der Unbekannten geschoben hatte, da ein Zimmer augenblicklich mit bestem Willen nicht verfügbar war.
»Katja«, stöhnte Helmut auf. »Mein Gott, was ist geschehen? Sag doch etwas, Liebling.«
Dr. Leon Laurin hatte Verständnis für einen solchen Gefühlsausbruch. Unwillkürlich dachte er, wie es wohl ihm zumute wäre, wenn seine Frau Antonia solches geschähe. Wenn er sie suchen müßte und sie dann in einem solchen Zustand fände.
»Ihre Frau ist bewußtlos, Herr Höhne«, sagte er leise. »Wir werden alles tun, um ihr Leben zu erhalten. Mehr kann ich jetzt nicht sagen.«
Entsetzen malte sich auf den Gesichtszügen des Mannes. »Ihr Leben erhalten? Wollen Sie sagen, daß Katja… Nein, sie darf doch nicht sterben, sie darf mich nicht verlassen. Mein Gott, so sagen Sie doch…« Er konnte nicht mehr weitersprechen. Ein trockenes Schluchzen schüttelte ihn.
»Ich werde Ihnen Beruhigungstropfen geben«, sagte Dr. Laurin mitfühlend.
»Ich hoffe, von Ihnen einige Auskünfte zu bekommen«, sagte Dr. Laurin nun sehr bestimmt. »Bitte, fassen Sie sich jetzt, Herr Höhne. Ihrer Frau können Sie jetzt nicht helfen, aber mir, wenn ich mehr über sie erfahre. Sie sehen, daß ein Arzt und eine Schwester bei ihr sein werden. Sie wird keine Minute aus den Augen gelassen. Ich verstehe Ihre Verzweiflung, aber jetzt bitte ich Sie, mir einige Fragen zu beantworten. Es muß sein. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Arzt, der helfen möchte, als im Dunkeln zu tappen.«
»Können Sie denn nicht feststellen, was Katja fehlt?« fragte Helmut Höhne tonlos.
»Doch, das konnte ich. Ich muß wissen, wann genau sie ein Kind geboren hat. Wo ist es geboren worden?«
Helmut blickte zu Boden. »Patrick ist drei Monate und ein ganz gesundes Kind«, erwiderte er geistesabwesend. »Verzeihen Sie, Herr Doktor, daß ich mich so gehenließ, aber Katja bedeutet mir doch soviel.«
»Ich kann das sehr gut verstehen«, sagte Leon teilnahmsvoll. Er hätte ihm sagen müssen, wie gering die Chance war, aber er brachte es nicht über die Lippen.
Wieder einmal klammerte er sich an das winzige Fünkchen Hoffnung, das man nie aufgeben durfte, solange Atem in einem Menschen war.
Endlich hatte sich Helmut Höhne so weit beruhigt, daß er Dr. Laurins Fragen beantworten konnte.
*
»Wir sind erst nach der Geburt des Kindes umgezogen«, sagte Helmut Höhne stockend, als wolle er sich dafür entschuldigen, daß seine Frau das Kind nicht in der Prof.-Kayser-Klinik zur Welt gebracht hatte. Wir suchten die Klinik aus, die unserer früheren Wohnung am nächsten lag. Katja ist zwar sehr zierlich, aber die Schwangerschaft verlief normal. Katja sagte immer, daß sie sich noch nie so wohl gefühlt hätte, und es sah auch so aus. Sie war fröhlich, und wir haben uns so sehr gefreut.«
»Sie hatten doch wohl auch Grund zur Freude, denn Ihre Frau bekam einen gesunden Sohn«, sagte Dr. Laurin beiläufig. »Und es war eine normale Entbindung, wie ich feststellen konnte.«
»Ja, es stimmt. Es hat gar nicht so lange gedauert, wie ich befürchtet hatte. Nachmittags gegen vier Uhr brachte ich sie in die Klinik, und um neun Uhr durfte ich Patrick schon sehen. Zu Katja durfte ich allerdings nicht gleich. Die Schwester sagte, daß sich die Nachgeburt verzögere. Ich verstehe ja nichts davon. Ist das öfter der Fall?«
»Ja, es kommt schon vor. Man kann nachhelfen«, bemerkte Dr. Laurin beiläufig. »Das wird Dr. Schollmeier doch wohl auch getan haben.«
Helmut Höhne schien zu überlegen. »Er kam und gratulierte mir, dann aber wurde er dringend abgerufen. Sein Assistenzarzt blieb bei Katja. Meine Mutter hat sich darüber ziemlich aufgeregt, aber…« Er unterbrach sich. »Vielleicht ist das so üblich«, fuhr er dann zögernd fort.
Dr. Laurin äußerte sich nicht dazu. Er hatte sich nebenbei Notizen gemacht, aber das merkte Helmut Höhne gar nicht.
»Nach wie vielen Tagen holten Sie Ihre Frau heim?« fragte er.
»Nach einer Woche.«
»Wie war der Allgemeinzustand?«
»Anfangs ganz gut. Sie hatte wohl die üblichen Begleiterscheinungen. Katja ist nicht wehleidig. Sie hat immer lächelnd abgewinkt, wenn ich sagte, daß sie öfter zum Arzt gehen solle. ›Ach was‹, hat sie gesagt, ›er schaut mich an und sagt, es ist alles in Ordnung‹. Herr Doktor, sagen Sie mir jetzt doch bitte, was meiner Frau fehlt.«
»Sie hat eine Sepsis, Herr Höhne. Die Nachgeburt ist nicht ordnungsgemäß gelöst worden. Ich kann Ihnen leider nicht verschweigen, daß der Zustand Ihrer Frau bedenklich ist.«
*
Antonia Laurin mußte heute wieder einmal vergeblich auf ihren Mann warten. Das geschah nur noch sehr selten, seit Dr. Petersen eingestellt worden war. Er hatte die Erwartungen, die in ihn gesetzt worden waren, nicht enttäuscht. Das Ärzteteam ergänzte sich außerordentlich harmonisch.
Es mußte schon etwas Besonderes vorliegen, wenn Leon mittags nicht heimkam, denn seit er in den Elternbeirat der Schule gewählt worden war, kümmerte er sich auch weit mehr darum, was die Zwillinge zu berichten hatten.
Heute war das eine ganze Menge, und so waren Konstantin und Kaja schwer enttäuscht, ihren Papi nicht vorzufinden.
»Gerade, wo wir so was Wichtiges mit ihm zu bereden haben«, maulte Konstantin. »Da muß nämlich sofort was getan werden.«
»Dann erzählt es mir«, meinte Antonia nachsichtig.
»Du bist bloß eine Frau«, sagte Konstantin. »Auf die hören sie nicht. Fränzis Mutter war ja schon in der Schule und hat sich beschwert, aber genützt hat es gar nichts.«
»Worüber hat sie sich beschwert?« fragte Antonia interessiert.
»Daß die Vera mit Pocken in die Schule kommt. Schon den zweiten Tag«, erklärte nun Kaja.
»Mit Pocken?« fragte Antonia entsetzt. »Das ist doch wohl nicht möglich!«
»Ich sage dir, mit Pocken«, erklärte Konstantin. »Lauter Pusteln hat sie im Gesicht, heute noch mehr als gestern. Das wäre bloß allergisch, hatte ihre Mutter gesagt, und deswegen braucht sie die Schule nicht zu versäumen. Papi ist Arzt, der muß was machen. Wenn sie uns nun alle ansteckt? Sie ist sowieso immer so schmuddelig.«
»Dann werde ich eben etwas unternehmen«, sagte Antonia energisch. »Schließlich bin ich ja auch Ärztin.«
»Du warst eine«, sagte Konstantin. »Jetzt bist du unsere Mami, und gegen Frau Remke kommst du sowieso nicht an.«
»Frau Remke ist die Mutter von der Vera«, fügte Kaja hinzu. »Die Vera ist sowieso ordinär. Sie sagt, daß wir feine Pinkel sind.«
Seit sie zur Schule gingen, mußte Antonia sich an manches gewöhnen, aber Ausdrücke waren etwas anderes, als eine möglicherweise doch ansteckende Krankheit.
Da sie den Lehrer Roth, dessen Frau unter recht dramatischen Umständen ihr Kind in der Prof.-Kayser-Klinik zur Welt gebracht hatte, auch persönlich gut kannte, beschloß Antonia, sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Aber damit die hellwachen Zwillinge ihre Nasen nicht in alles steckten, wollte sie ihn aufsuchen.
Sie rief an und fragte, ob sie ihn sprechen könne. Selbstverständlich war er sofort bereit dazu. Er war den Laurins zu tiefstem Dank verpflichtet.
»Jetzt machst du es wieder hinter unserem Rücken«, beschwerte sich Konstantin. »Papi wäre gleich zum Rektor gegangen und hätte ihm den Marsch geblasen.«
»Man muß sich alles erst einmal anhören«, erklärte Antonia. »Ihr wolltet doch heute sowieso mit Biggi und Ronald spazierengehen.«
»Was ist denn hier für eine Aufregung?« fragte Karin, die Seele des Hauses.
»Das werden Ihnen die Trabanten haarklein erzählen«, sagte Antonia. »Ich fahre mal für eine halbe Stunde weg.«
»Zum Lehrer Roth«, klärte Kaja Karin gleich auf. »Weißt du, Karin, da ist was los in der Schule.«
»In der Schule ist immer was los«, sagte Karin ungehalten. »Sind ja auch keine Zustände, wenn so viele Kinder aufeinander hocken.«
Während also Dr. Leon Laurin um das Leben seiner neuen Patientin kämpfte und außerdem noch mit Gewissenskonflikten rang, ob er dem Kollegen Dr. Schollmeier Pflichtverletzung vorwerfen konnte, warf sich Antonia Laurin für ihre Kinder ins Gefecht.
Bei dem Lehrer Jürgen Roth fand sie ein geneigtes Ohr.
Zuerst hatte sie Tamara Roth guten Tag gesagt und den kleinen Clemens gebührend bewundert, der prächtige Fortschritte machte und dem man heute schon nicht mehr ansah, daß er ein äußerst gefährdetes Rhesusbaby gewesen war.
Jürgen Roth sah man allerdings noch immer an, daß er einen schweren Unfall gehabt hatte. Die Narben in seinem Gesicht würden ihm bleiben, aber sie beeinträchtigten den sympathischen Eindruck nicht.
»Es ist eine ganz dumme Geschichte, Frau Dr. Laurin«, sagte er, denn er wußte ja, warum Antonia ihn sprechen wollte. »Selbstverständlich ist es keine ansteckende Krankheit, wie wir durch die Schulärztin feststellen ließen. Es sind Mangelerscheinungen, dazu kommt noch mangelnde Sauberkeit, aber wie soll man einer solchen Mutter beikommen? Und dann ist da noch etwas, was ich gerade Ihnen nicht verschweigen möchte, da man ja nicht weiß, wie Frau Remke jetzt reagiert. Sie ist nämlich Putzfrau in dem Haus, in dem Dr. Petersen wohnt.«
»Was hat das mit diesen Zuständen zu schaffen?« fragte Antonia verwundert.
»Sie hat dumme Bemerkungen über den kleinen Ronald gemacht. Ich möchte die Ausdrücke gar nicht wiedergeben, aber sie weiß ja, daß die Petersens aus Südamerika kommen, und da redet sie darüber, daß man gar nicht weiß, was für Seuchen die einschleppen. Sie will jetzt alles darauf schieben. Es ist schrecklich peinlich, aber sie hetzt überall herum«, erklärte Jürgen Roth.
»Sie hetzt gegen die feinen Pinkel«, sagte Antonia ironisch.
Nun mußte Jürgen Roth sogar ein bißchen lachen. »Konstantin ist unübertrefflich«, sagte er. »Der Junge hat einen so trockenen Humor, daß ich manchmal nicht ernst bleiben kann.«
»Jetzt werden wir uns aber lieber mal um diese Frau Remke kümmern. Ich werde das in die Hand nehmen. Wenn ich richtig unterrichtet bin, ist immer noch Frau Dr. Schöler Schulärztin. Sie mag mich zwar nicht, aber das soll mich nicht hindern, mal mit ihr zu sprechen. Und wenn es gar nicht anders geht, muß das Gesundheitsamt eingeschaltet werden«, sagte Antonia.
O ja, sie konnte sehr energisch werden, diese bezaubernde Frau Dr. Antonia Laurin. Das hatte sie schon manchmal bewiesen.
Sie ließ sich die Adresse von Frau Remke geben und machte sich gleich auf den Weg zu ihr.
*
Dr. Laurin hatte es endlich fertiggebracht, Helmut Höhne zu überreden, nach Hause zu fahren.
Patrick schlief jetzt. Marga Höhne wartete ungeduldig auf ihren Sohn. Stumm umarmten sie sich.
Stockend erzählte er, aber schon bald wurde er von seiner Mutter unterbrochen.
»Schollmeier«, sagte sie. »Ich hatte gleich kein Vertrauen. Aber wenn er dafür verantwortlich ist, wird er es büßen, so wahr ich Marga Höhne heiße.«
Sie hatte das gleiche Temperament wie ihr Sohn, aber Helmut war jetzt viel zu deprimiert, um sich noch zu erregen.
»Was nützt alles, wenn Katja daran stirbt«, flüsterte er.
»Sag das nicht. Um Himmels willen, Junge, das darfst du nicht denken! Dr. Laurin ist ein bekannter, ein sehr guter Arzt. Wäre Katja doch nur gleich in die Prof.-Kayser-Klinik gegangen.«
Es war jetzt müßig, darüber zu reden, warum sie das nicht getan hatte. Die Klinik Dr. Schollmeier war eben die nächste gewesen.
Ihr war auch trostlos zumute, aber sie wollte ihrem Sohn das Herz nicht noch schwerer machen. Tränen traten ihr in die Augen, als sie das schlafende Baby betrachtete, für das sein Vater heute keinen Blick gehabt hatte.
Herrgott, laß Katja leben, betete sie. Sie wußte nicht, daß Schwester Marie das gleiche tat.
»Wenn die nächste Injektion das Fieber nicht drückt, sehe ich keine Chance mehr«, sagte Dr. Laurin leise.
»Aber vielleicht war es ihre einzige Chance, daß sie dieses Fieber bekam«, bemerkte Dr. Petersen gedankenvoll.
»Ich nehme an, daß sie ständig Zwischenblutungen hatte und sich die Natur so selbst helfen wollte. Dann sind diese Blutungen durch ein Mittel eingedämmt worden, und der Fäulnisherd in der Gebärmutter breitete sich aus.«
»Genau, Herr Petersen. Das waren auch meine Überlegungen. Wir stimmen wieder einmal völlig überein. Ich muß Schollmeier sprechen. Er muß mir Auskunft geben.«
»Sie sagen das so skeptisch«, bemerkte Dr. Petersen.
»Weil ich Bedenken habe, daß er Auskunft geben wird. Halten Sie es bitte nicht für Konkurrenzneid, wenn ich sage, daß ich keine sonderlichen Sympathien für diesen Kollegen hege.«
»Konkurrenzneid brauchen Sie wahrhaftig nicht zu hegen«, meinte Petersen. »Guter Gott, niemand würde Ihnen das zutrauen.«
»Niemand? Nun, vielleicht Dr. Schollmeier. Wir wissen doch beide, welche Gefahren unser Beruf mit sich bringt. Wir wissen auch, daß menschliches Versagen manchmal totgeschwiegen wird. Wir haben doch unsere Berufsehre, wir Ärzte.« Das klang sehr sarkastisch. »Die Götter in Weiß müssen unfehlbar sein, sagt man nicht so? Aber genug der Worte. Ich werde Schollmeier anrufen.«
Allerdings war das ein vergeblicher Versuch. Dr. Schollmeier sei bei einer schweren Entbindung, wurde ihm gesagt. Ob man ihm etwas ausrichten könne.
»Nein, das möchte ich selbst mit ihm besprechen«, sagte Dr. Laurin scharf.
*
Schwester Marianne, die Dr. Laurins Anruf entgegengenommen hatte, war Dr. Schollmeier treu ergeben. Sie war jung und hübsch, und ihre Beziehungen zu dem Gynäkologen waren durchaus nicht nur beruflicher Natur.
Gewissensbisse brauchte sie sich darüber nicht zu machen, denn Dr. Schollmeier war seit einigen Monaten geschieden, und Schwester Marianne wiegte sich in der Hoffnung, einmal Frau Schollmeier zu werden.
Heute war ein recht aufregender Tag für sie. Begonnen hatte es damit, daß Frau Höhne, wie bestellt, gekommen war. Aber so ganz wohl war es Schwester Marianne nicht bei dem Gedanken, daß es nur eine Ausrede gewesen war, daß Dr. Schollmeier im OP unabkömmlich sei. Er war ganz einfach mit beträchtlicher Verspätung in der Klinik erschienen. Ihm sei nicht gut gewesen, hatte er erklärt, und so hatte er auch ausgesehen.
Nicht, daß Marianne ihm etwas nachgetragen hätte, aber sie kannte ihn immerhin so gut, daß sein Unwohlsein mal wieder auf übermäßigen Alkoholgenuß zurückzuführen sein könnte.
Nun war er jedenfalls wieder da und voll in Aktion. Der Anruf von Herrn Höhne hatte Schwester Marianne nicht in Bedrängnis bringen können, da sie ihn nicht entgegennahm. Sie erfuhr erst von ihrer Kollegin Hanna davon, die Dr. Schollmeier gegenüber nicht gar so tolerant war.
»Wenn da was passiert ist, kann er ganz schön was auf den Deckel kriegen«, hatte Hanna gesagt.
»Und du fliegst, wenn du so dumm daherredest«, fauchte Marianne die Ältere an.
Schwester Hanna war ein verträgliches Wesen. Sie wollte keinen Streit, aber sie hatte in letzter Zeit schon manchmal überlegt, ob sie nicht doch die Stellung wechseln solle.
Daß so manches nicht in Ordnung war, blieb ihren wachen Augen auch nicht verborgen.
Immerhin hatte er auch seine charmanten Seiten, der Chefarzt Dr. Reinhard Schollmeier. Aber auch ein dickes Fell, wie Schwester Hanna für sich vermerkte.
Als Dr. Laurin anrief, brauchte Schwester Marianne nicht zu lügen. Da befand sich der Chefarzt tatsächlich im Operationssaal. Es war eine Kaiserschnittentbindung.
Schwester Marianne überlegte nur, was ausgerechnet Dr. Laurin von Schollmeier gewollt hätte. Auf Dr. Laurin war Dr. Schollmeier nämlich gar nicht gut zu sprechen. Dr. Laurins Stimme hatte so scharf und gar nicht verbindlich geklungen. Sie wurde ein Unbehagen nicht los.
Es war halb sechs Uhr, als Dr. Schollmeier aus dem Operationssaal kam. Sein schmales Gesicht hatte einen verkniffenen Ausdruck.
»Was ist los, Reinhard?« fragte Marianne leise.
»Wir sind im Dienst«, fauchte er sie an. »Vergiß das nicht.«
»Sie sehen so besorgt aus, Herr Chefarzt«, sagte sie kleinlaut.
»Ach was, besorgt. Frauen mit fast vierzig, sollten keine Kinder mehr in die Welt setzen wollen. Das Risiko ist immer groß.«
Marianne hielt den Atem an.
Er ging weiter. Sie starrte ihm nach.
Dr. Fiedler, der Assistenzarzt, erst seit einigen Tagen an der Klinik, wankte totenbleich an ihr vorbei. Sie wagte nicht, eine Frage an ihn zu stellen. Sie wagte allerdings auch nicht, Dr. Schollmeier von Dr. Laurins Anruf zu berichten.
*
Zusammengesunken saß indessen Helmut Höhne wieder in der Klinik. Schwester Otti schaute ab und zu nach ihm. Sie hatte ihm auch eine Tasse Tee und Sandwiches gebracht. Er rührte nichts an.
Dr. Laurin hatte die dritte Injektion gemacht. Das Fieber sank etwas ab, aber das Thermometer stand immer noch auf 39,5.
»Wir müssen alles auf eine Karte setzen, Petersen«, sagte er. »Länger kann ich nicht warten, sonst überlebt sie die Nacht nicht mehr.«
»Und sonst?« fragte Petersen. Dr. Laurin zuckte die Schultern.
»Ich werde mit Herrn Höhne sprechen. In diesem Fall muß ich mich rückversichern. Bei allem guten Willen kann ich nicht meinen Kopf für einen anderen hinhalten.«
Helmut Höhne verstand gar nichts, außer daß das Leben seiner Frau an einem hauchdünnen Faden hing.
»Versuchen Sie das Menschenmögliche, Herr Doktor«, sagte er verzweifelt. »Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Bitte, tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht.«
Oft schon hatte Dr. Laurin diese Worte gehört. Für ihn war es selbstverständlich, das Menschenmögliche zu tun, aber er hielt sich nicht für göttergleich, und Wunder konnte er auch nicht vollbringen.
Katja Höhne war in den OP gebracht worden. Dr. Petersen, Dr. Rasmus, Schwester Marie und Schwester Marena standen bereit.
Schwester Marie trat dicht an Dr. Laurin heran. Sie legte ihm die Maske um.
»Immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her«, sagte sie leise.
Wie oft hatte sie das schon gesagt, wie oft hatte er auf den Spruch geschaut, der über seinem Schreibtisch hing. Seine Augen waren ernst.
Marie versuchte ein aufmunterndes Lächeln. Lautlose Stille herrschte.
Da draußen wartet ein verzweifelter Mann, ging es Leon Laurin durch den Sinn. Ich bin seine letzte Hoffnung. Da ist ein kleines Kind, erst drei Monate auf dieser Welt. Und vor ihm lag eine junge Frau, die noch vor kurzer Zeit lebensfroh, glücklich und vor allem geliebt war.
»Man darf nie kapitulieren, Leon«, schien Antonias Stimme in seinen Ohren zu tönen.
Auch Antonia kapitulierte nicht. Sie hatte Frau Remke nicht angetroffen. »Ich darf nicht aufmachen«, hatte eine schrille Kinderstimme durch die Tür gesagt. Das mochte wohl Vera gewesen sein.
Sie war heimgefahren. Karin berichtete, daß die Kinder mit Birgit Petersen und Ronald bereits vor einer Stunde gegangen seien.
»Dann hat auch Hanna angerufen, daß der Chef heute nicht nach Hause kommt. In der Klinik ist wieder was los. Es kommt ja immer alles zusammen«, murrte Karin.
»Na, dieses Schultrara wollen wir nicht zu tragisch nehmen«, meinte Antonia. »Ich trinke jetzt eine Tasse Kaffee, und dann fahre ich mal zu Frau Schöler. Wenn unser Elternbeirat keine Zeit dafür hat, muß ich es übernehmen. Wie geht es Ronald?« fragte sie Karin bei ihrem Eintreffen.
»Ein süßes Kerlchen ist er«, sagte Karin. »Unsere Kinder sind ja auch ganz narrisch mit ihm, weil er alles so putzig herausbringt. Fräulein Petersen ist wirklich eine reizende Person. Es wäre ein Jammer, wenn wir nicht einen Mann für sie finden würden.«
»Nun mal langsam, Karin«, lachte Antonia. »Heiratsvermittlung wollen wir nicht auch noch anfangen.«
»Aber wenn der Dr. Petersen mal Frau Bennet heiratet, dann…«
»Darüber wollen wir uns nicht den Kopf zerbrechen. So schnell geht das nicht bei den beiden.«
»Aber sie passen so gut zueinander«, sagte Karin. »Und es geht doch nun auch schon ein paar Monate.«
Es war Karins Lieblingsthema, und da war sie nicht zu bremsen. Dagmar Bennet, die nach ihrer Scheidung ihren Mädchennamen wieder angenommen hatte, bot ja auch ein sehr hübsches Gesprächsthema. Sie und ihr Töchterchen Nicola gehörten ebenso wie Clemens Bennet, Dagmars Vater, bereits zum engeren Freundeskreis der Laurins.
Aber daran wollte Antonia jetzt keine Gedanken verschwenden. Es ging ihr nicht aus dem Sinn, was Jürgen Roth über Frau Remke gesagt hatte, und sie wollte keinesfalls, daß der kleine, von allen so geliebte Ronald in den Klatsch einbezogen wurde.
Unglaublich, worauf Menschen alles kamen.
Aber solchen Menschen begegnete man in allen Berufsklassen, wie Antonia bald darauf feststellen konnte, als sie Frau Dr. Schöler aufsuchte.
»Sie kommen gerade zu ungelegener Zeit, Frau Laurin«, sagte sie.
»Ich wollte mit Ihnen in Ihrer Funktion als Schulärztin sprechen«, sagte Antonia, »und da es sehr dringlich scheint, können Sie mir vielleicht doch ein paar Minuten Gehör schenken. Lange werde ich Sie nicht aufhalten.«
»Wenn es sich um Vera Remke handelt, ist alles Gerede lächerlich. Das sind einfach Entwicklungsstörungen.«
»Bei einem achtjährigen Kind? Ja, Mangelerscheinungen will ich gelten lassen, aber dazu müßte ich das Kind erst gesehen haben, jedoch scheint es mir angebracht, daß eine gründliche Untersuchung durchgeführt wird. Im Interesse aller Kinder!«
Frau Dr. Schöler kniff die Augen zusammen.
»Wäre es dann nicht angebracht, daß Sie diesen kleinen Mestizen untersuchen lassen?« sagte sie.
Das schlug nun wirklich dem Faß den Boden aus.
»Diesbezüglich werden Sie von uns hören«, sagte Antonia erbost. »Wenn Frau Remke so was verbreitet, finde ich ja noch Entschuldigungsgründe, aber wenn das eine Ärztin vom Sohn eines Kollegen sagt, kann man nur den Kopf schütteln.«
Sie merkte, daß Frau Schöler jetzt einlenken wollte.
Konstantin mochte recht gehabt haben. Sie sollte solche Dinge lieber Leon überlassen. Er blieb immer sachlich, und er konnte seine Gegner mit einem Blick zum Schweigen bringen. Aber sollte sie ihn denn mit allem Kleinkram belasten? Es war doch anerkennenswert genug, daß er seine Wahl zum Elternbeirat tatsächlich ernst nahm und auch schon allerlei erreicht hatte. Vor dem Herrn Dr. Laurin hatten sie doch Respekt, vor der Frau Dr. Laurin anscheinend nicht. Aber vielleicht hatte sie der Schöler doch einen Schrecken eingejagt.
Jedenfalls wollte Antonia heute mal mit Biggi Petersen sprechen. Ganz diplomatisch natürlich. Hoffentlich kamen die Kinder nicht so spät nach Hause, daß dafür noch Zeit blieb.
Aber sie waren schon daheim, und sie machten einen bedrückten Eindruck. Aber besonders Biggi machte einen solchen.
»Ich muß dir was sagen, Mami«, erhob Konstantin sogleich die Stimme.
»Das laß mich lieber tun, Konstantin«, sagte Biggi ernst
»Ihr spielt noch ein bißchen, und ich setze mich mit Biggi ins Wohnzimmer. Bitte, stört uns nicht.«
»Es geht um Ronald«, begann Biggi leise. »Lars darf ich es gar nicht sagen. Er regt sich furchtbar auf.«
»Ich wollte auch etwas mit Ihnen besprechen, Biggi«, sagte Antonia, »aber zuerst kommen Sie.«
»Diese Putzfrau hetzt die Kinder auf«, sagte Biggi leise. »Diese Frau Remke ist einfach gräßlich.«
»Setzen Sie sie doch vor die Tür«, sagte Antonia.
»Ich habe Angst, daß sie dann noch mehr hetzt. Eigentlich ist sie ja auf den Verdienst angewiesen, und ich hätte auch nicht gedacht, daß sie dahintersteckt. Darauf hat mich erst Konstantin gebracht.«
»Und es ist gut, daß wir offen darüber reden. Ich werde mir Frau Remke sowieso vorknöpfen, und ich werde dafür sorgen, daß Sie eine andere Hilfe bekommen.«
»Meinen Sie, daß damit das Gerede unterbunden wird?«
»Aber schnellstens. Wenn Leute wie Frau Remke vor etwas Respekt haben, dann davor, vor Gericht zitiert zu werden. Ich bin ziemlich dickköpfig. Sie haben sich einschüchtern lassen, Biggi«, sagte Antonia. »Wegen so eines dummen Wortes werden Sie sich doch nicht ins Bockshorn jagen lassen?«
»Ich liebe Ronald«, sagte Biggi verhalten. »Er ist für mich mein Kind. Wenn ihm weh getan wird, fühle ich es doppelt schmerzhaft. Ich möchte ihn nie hergeben.«
Nachdenklich sah Antonia das hübsche junge Mädchen an. Sie fühlte plötzlich, daß ihr Kummer nicht nur der war, daß Ronald zwischen ihrem Bruder und Dagmar Bennet stehen könnte, sondern daß sie noch mehr Angst hatte, das Kind zu verlieren. Antonia Laurin hatte auch dafür Verständnis, denn sie wußte, daß Birgit Petersen von Anfang an für den Kleinen gesorgt hatte, dessen Mutter bei der Geburt gestorben war.
»Ihre Kinder haben sich wunderbar benommen«, sagte Biggi. »Kevin hat es auch nicht richtig mitbekommen, aber Konstantin und Kaja haben sich gar nichts anmerken lassen.«
»Obgleich Konstantin diesen Bengeln wohl am liebsten an die Gurgel gesprungen wäre«, sagte Antonia. »Nehmen Sie es nicht so schwer. Es ist auch nicht anders, als wenn unsere Kinder feine Pinkel genannt werden. Liebe Güte, wenn Erwachsene schon so blöd sind, muß man bei Kindern einfach weghören.«
Es klopfte, und Karin steckte den Kopf zur Tür herein. »Der Chef hat eben noch mal anrufen lassen. Er bleibt noch in der Klinik. Dr. Petersen auch. Ein schwerer Fall von Sepsis.«
»Mein Gott, doch nicht bei uns?« rief Antonia erschrocken aus.
»Eingeliefert«, sagte Karin kurz.
Ein paar Minuten schwiegen Antonia und Birgit. Dann sagte Antonia: »Bleiben Sie doch bei uns zum Essen. Wir verlegen es vor. Ich werde noch mal kurz zu Frau Remke fahren, und dann kann ich Ihnen gleich Bericht erstatten.«
»Sie sollen sich aber meinetwegen keine Unannehmlichkeiten machen«, sagte Birgit.
»Es geht um andere Dinge auch«, sagte Antonia. »Nicht so traurig schauen, Biggi. Hören Sie, wie Ronald lacht.«
Man konnte es hören. Es war unverkennbar ein süßes, weiches und doch so fröhliches Lachen, und als sie dann ins Kinderzimmer gingen, sahen sie ihn auf dem Schaukelpferd sitzen. Seine großen dunklen Augen strahlten in dem bräunlichen feinen Gesichtchen.
»Ist das nicht schön?« sagte Antonia mit weicher Stimme zu Biggi. »Die Menschen werden wir nie verändern können, Biggi, aber wenn sich nur einige so gut verstehen, ist es doch viel wert.
»Ich bin so froh, daß ich zu Ihnen kommen darf«, sagte Biggi. »In Südamerika war alles anders. Da kamen die armen Menschen zu uns. Sie waren dankbar, wenn wir ihnen helfen konnten, aber hier…«
»Hier geht es den meisten zu gut«, sagte Antonia.
*
Diesmal war Frau Remke da. Sie war eine üppige Frau, höchstens dreißig Jahre alt, sah aber verlebt aus. Das grobe Gesicht war fahl, und der dümmliche Ausdruck ihrer Augen verriet, daß es mit dem Denken bei ihr nicht weither war.
»Mein Name ist Laurin«, stellte sich Antonia vor.
»Die Frau vom Doktor?« fragte Frau Remke, und ihre Augen kniffen sich zusammen. »Ihre Zwillinge sind mit meiner Vera in einer Klasse.«
»Ganz recht, und wegen Vera komme ich«, sagte Antonia.
»Weil die Feinen das Kind aus der Klasse haben wollen?« keifte Frau Remke los.
»Können wir uns nicht drinnen unterhalten, Frau Remke?« fragte Antonia. »Es braucht nicht jeder zu hören. Könnte ich Vera einmal sehen? Ich bin Ärztin. Es wäre doch im Interesse Ihres Kindes, wenn ihm geholfen werden könnte.«
»Frau Dr. Schöler hat gesagt, daß mit Vera nichts weiter ist. Das sind nur Pickel. Ein Theater wird darum gemacht! Aber wenn man nichts weiter zu tun hat, kann man das ja! Ich muß arbeiten. Ich muß mein Geld hart verdienen.«
»Ich möchte vernünftig mit Ihnen sprechen, falls das möglich wäre«, sagte Antonia energisch. Sie war einfach in die Diele eingetreten, die winzig war. Es roch muffig, ungelüftet, nach Kohl, nach Schweiß und nach Schmutz.
»Ich muß erst putzen«, sagte Frau Remke. »Tagsüber muß ich bei anderen putzen für Geld. Wir haben keinen Ernährer. Wir sind nicht so fein heraus wie Sie.«
»Was aber durchaus kein Grund ist, daß die Gesundheit Ihres Kindes vernachlässigt wird«, sagte Antonia. »Ich kann Sie nicht zwingen, das Kind untersuchen zu lassen. Das Gesundheitsamt kann dies allerdings. Und dann noch eines…«, endlich hatte Antonia ganz begriffen, daß diese Frau nur harte Worte verstand, »Sie haben da Äußerungen über den Sohn von Dr. Petersen getan, die mir gar nicht gefallen, die an böswillige Verleumdung grenzen, wenn Sie verstehen, was ich damit meine. Er ist ein gesundes Kind. Seine Mutter war Südamerikanerin, daher die etwas dunklere Hautfarbe. Da ich nicht soviel Angst vor einem losen Mundwerk habe wie andere Menschen, sage ich das so klar und deutlich, daß Sie es verstehen werden. Ich werde es nicht auf sich beruhen lassen, wenn Sie weiterhin solche Äußerungen tun. Dr. Petersen ist Arzt an unserer Klinik. Sie werden sich eine andere Stellung suchen müssen, denn wir werden ihm eine andere Hilfe besorgen, die keine diskriminierenden Äußerungen tut.«