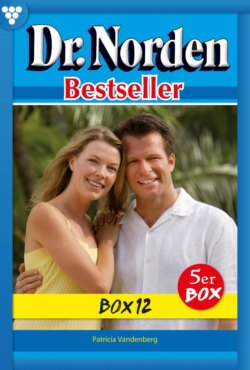Читать книгу Dr. Norden Bestseller Box 12 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas Mädchen, das sich Dr. Norden mit dem Namen Elisabeth Roth vorgestellt hatte, sah aus wie achtzehn, und er war überrascht, als sie ihm ihren Paß vorlegte, aus dem hervorging, daß sie dreiundzwanzig war.
»Nur, damit Sie nicht denken, daß ich Ihnen Märchen erzähle, Herr Doktor«, sagte sie stockend. »Meine Schwester Hilde war doch bei Ihnen.«
Er zögerte mit der Antwort. Er mußte auch erst überlegen. Eine Hilde Roth war nicht bei ihm gewesen, aber vor etwa vier Wochen eine junge Frau mit einem recht seltsamen Anliegen, und sie hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Mädchen gehabt, jedenfalls die gleichen grüngrauen Augen, ungewöhnlich in ihrem schrägen Schnitt.
»Eine Hilde Roth war nicht bei mir«, erwiderte er.
»Dann hat sie vielleicht einen anderen Namen benutzt«, sagte Elisabeth. »Ich weiß nicht, wozu dieser unmögliche Kerl sie bewegt hat. Ich will Ihnen gern erklären, warum ich zu Ihnen komme. Frau Zeller hat gesagt, daß ich offen mit Ihnen sprechen kann.«
Frau Zeller kannte Dr. Norden sehr gut. Sie war schon seit Jahren seine Patientin, eine nette, bescheidene Frau.
»Wir wohnen bei ihr«, fuhr Elisabeth fort, »das heißt, jetzt wohne nur ich noch bei ihr. Meine Schwester nicht mehr. – Ich weiß nicht recht, wo ich anfangen soll. Es ist eine ziemlich lange Geschichte. Aber mir geht es vor allem darum, daß mal festgestellt wird, was in diesem Entbindungsheim Miranda vor sich geht.«
Es klang alles noch ein bißchen verworren, aber als sie dieses Entbindungsheim erwähnte, wurde Dr. Norden hellhörig.
»Hätten Sie noch eine Viertelstunde Zeit?« fragte er. »Dann kann ich inzwischen die zwei anderen Patienten noch behandeln, und wir könnten uns in aller Ruhe unterhalten.«
»Kann ich schnell noch eine Besorgung machen? Sonst haben die Läden geschlossen«, sagte sie.
»Ja, selbstverständlich!« Aber als sie gegangen war, fragte er sich, ob sie überhaupt wiederkommen würde. Vielleicht hatte sie sich überlegt, lieber doch nichts zu sagen.
Doch Elisabeth kam wieder, und Dr. Norden erfuhr eine Geschichte, die ihn sehr nachdenklich stimmte.
»Sie wissen ja, daß Frau Zeller Zimmer vermietet«, begann sie. »Ihr war es sehr recht, daß sie uns die Mansardenwohnung geschlossen abgeben konnte, weil sie schon ziemlich viel Ärger gehabt hatte. Hilde, Sandra und ich waren auch froh, daß wir mit der Miete so gut wegkamen. Sandra Trento ist meine Freundin.« Ein schwerer Seufzer folgte. »Jetzt muß ich vielleicht sagen, sie war meine Freundin. Entschuldigen Sie vielmals, Herr Doktor, ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Vor ein paar Monaten war alles in bester Ordnung, und nun sitze ich allein da und weiß nicht, was ich denken soll.«
»Erzählen Sie mal alles hübsch der Reihe nach, Fräulein Roth«, sagte Dr. Norden.
»Sandra kenne ich schon von der Handelsschule her. Wir sind ein Jahrgang, sie ist ein feines Mädchen. Eigentlich wollte sie das Abitur machen, aber ihr Vater hat wieder geheiratet und bestand darauf, daß sie schnellstens einen Beruf ergriff. Wir haben uns dann bei der Papierfabrik Hellbrink beworben und wurden auch eingestellt. Mittlerweile sind wir schon fünf Jahre dort als Sekretärinnen. Das heißt, Sandra ist nun nicht mehr da. Da war so eine Geschichte mit dem Juniorchef, Götz von Hellbrink, ja, sie sind adlig. Er war erst im Ausland, und als er ein paar Wochen in der Firma war, spann sich was zwischen ihm und Sandra an. Ich habe mir gleich gedacht, daß es der Familie nicht passen würde, denn sie sind ziemlich hochgestochen. Vor allem die Tochter Carola. Jedenfalls wurde der Junior vor sechs Monaten wieder ins Ausland abkommandiert. Sandra hat nie mehr über ihn gesprochen, aber ich glaube, daß sie sich heimlich geschrieben haben. Schlimm ist ja, daß Sandra ein Baby erwartet. Als man es sehen konnte, hat sie gekündigt. Ich habe sie so gebeten, mir doch zu vertrauen, aber eines Tages war sie mit zwei Koffern verschwunden. Sie hat mir einen Brief hinterlassen, daß ich mich nicht sorgen solle. Sie würde sich schon wieder melden. Ich habe dann meiner Schwester Hilde die Stellung verschafft. Hilde ist zwei Jahre jünger als ich, und ich habe ihr eindringlich geraten, ja keine Liebelei am Arbeitsplatz anzufangen, aber prompt läßt sie sich doch mit jemandem ein, mit diesem Fechner. Nun kriegt auch sie ein Kind. Ich bin ganz kopflos, Herr Doktor. Der Fechner denkt gar nicht daran, sie zu heiraten, er ist ein mieser Bursche. Er hat es ja eigentlich auf Carola von Hellbrink abgesehen, aber Hilde war blind und taub.«
Dr. Norden konnte sich jetzt genau erinnern, daß er die bestehende Schwangerschaft im zweiten Monat bei Hilde festgestellt hatte, und sie hatte den Namen Fechner als ihren eigenen angegeben. Er konnte sich an ein auffallend hübsches Mädchen erinnern. Aber er wollte Elisabeth, die nun ruhiger sprach, nicht unterbrechen.
»Hilde war furchtbar niedergeschlagen nach einer Aussprache mit Fechner«, fuhr sie fort. »Sie sagte, daß sie das Kind abtreiben lassen will, und alles gute Zureden nutzte nichts. Vor acht Tagen hat sie mir dann auch gesagt, daß Fechner ihr das Geld gegeben hätte und daß sie in dieses Entbindungsheim Miranda gehen würde. Sie hat Urlaub genommen, und schon war sie weg. Ja, und ich bin dann dorthin gefahren. Ich muß schon sagen, daß mir manches merkwürdig vorkam. Es wurde geleugnet, daß Hilde dort sei. Ich wurde gar nicht eingelassen, und ich bin da herumgeschlichen, weil ich Angst um Hilde hatte. Und mir blieb die Luft weg, als ich Sandra sah, meine Freundin Sandra! Sie ging im Garten spazieren.«
»Wenn sie ein Baby bekommt, ist es doch eigentlich natürlich, daß sie ein Entbindungsheim aufsucht«, sagte Dr. Norden.
»Aber eins, wo auch Abtreibungen vorgenommen werden? Ich habe da meine eigene Einstellung, Herr Doktor. Und dann habe ich was gehört, was mir ganz seltsam vorkam, als ich noch ein bißchen herumgelaufen bin, weil ich so aufgeregt war. Da ging auch ein Ehepaar spazieren, schon so im guten Mittelalter. Sie sprachen Englisch, aber das kann ich sehr gut. Ich muß ja die englische Korrespondenz erledigen. Der Mann sagte zu der Frau, daß sie ja nun bald ihr Baby haben würden. Aber sie war nicht schwanger! Nächste Woche könnten sie es abholen, und dann würden sie gleich heimreisen.« Sie sah ihn an. »Finden Sie das nicht auch merkwürdig, Herr Doktor?«
»Es gibt viele kinderlose Ehepaare, die ein Kind adoptieren«, sagte Dr. Norden begütigend. »Und es gibt viele junge Mädchen, die ihr uneheliches Kind zur Adoption freigeben.«
»Ich finde so was schrecklich«, sagte Elisabeth, »aber was meinen Sie, wenn jemand sagt, daß der Preis eigentlich ein bißchen hoch sei?«
»Wer hat das gesagt?«
»Der Mann, dieser Amerikaner. Es war einer, das habe ich an der Aussprache gehört. Aber die Frau sagte, es sei ihr gleich, aber sie wolle einen Jungen. Mir ist es eiskalt über den Rücken gelaufen. Werden da Kinder verkauft? Ich wäre ja am liebsten gleich zur Polizei gegangen, aber dann habe ich an Hilde und Sandra gedacht. Und ich hatte ja auch keine Beweise in der Hand. Frau Zeller hat immer so von Ihnen geschwärmt, und da habe ich mir halt gedacht, daß ich erst mal mit Ihnen spreche.«
»Es ist wirklich interessant, was Sie erzählt haben, Fräulein Roth«, sagte Dr. Norden nachdenklich. »Ich weiß nichts von diesem Entbindungsheim, aber ich werde mich erkundigen.«
»Und sagen Sie mir dann Bescheid?« fragte sie bebend. »Ich habe meine Schwester sehr gern und Sandra auch. Ich meine, wenn man schon ein Baby bekommt, muß man auch dafür geradestehen. Mir ist so vieles durch den Kopf gegangen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, daß Sandra ihr Baby verkauft, und es will mir schon gar nicht in den Sinn, daß meine Schwester mit einer Abtreibung einverstanden sein soll.«
»Manchmal mag das besser für das Kind sein und auch für die Mutter, wenn sie noch jung und unreif ist.«
»Aber so jung ist Hilde mit einundzwanzig Jahren nicht mehr, daß sie sich erst mit solch einem Kerl einläßt und dann allen Anstand, der uns anerzogen wurde, vergißt. Aber ein bißchen wohler ist mir jetzt schon, weil Sie mich angehört haben. Sie sind sehr nett, Herr Dr. Norden.«
»Sie haben keinen festen Freund?« fragte er väterlich.
Sie schüttelte heftig den Kopf. »Mir vergeht’s, wenn ich so erlebe, was andere mitmachen. Aber der Götz von Hellbrink hat Sandra bestimmt sehr gern gehabt. Die beiden sind nur von der Familie auseinandergebracht worden, davon bin ich überzeugt.«
Dr. Norden sah sie nachdenklich an. Er verriet nichts davon, und das durfte er ja auch nicht, daß er erst vor einer Woche in das Haus Hellbrink gerufen worden war, weil Frau von Hellbrink einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Sie hatte die Nachricht bekommen, daß ihr Sohn Götz in Afrika verschollen war, wohin er von seinem Vater geschickt worden war, um die geschäftlichen Interessen der Firma wahrzunehmen. Nun ahnte er, daß dies nicht der einzige Grund gewesen war, sondern auch eine der Familie unwillkommene Liebesgeschichte eine Rolle spielte.
»Ich werde Sie anrufen, wenn ich etwas erfahren habe, Fräulein Roth«, sagte er.
»Vielen Dank, Herr Doktor. Ich fürchte, daß ich nun auch noch entlassen werde, und dann weiß ich nicht mehr, wie ich allein die Miete aufbringen soll. Aber ich werde dann schon wieder eine neue Stellung finden. Wenn ich nur nicht solche Angst um Hilde haben müßte.«
»Verlieren Sie nicht den Mut, Fräulein Roth«, sage Dr. Norden. »Es wird sich schon alles aufklären, und Ihre Schwester müßte eigentlich selbst wissen, was sie tut.«
»Sie ist ein hübsches Schäfchen«, sagte Elisabeth seufzend. »Eigentlich bin ich froh, daß ich kein Typ bin, auf den die Männer fliegen.«
Nein, das war sie nicht. Sie würde es keinem leicht machen, obgleich sie sehr apart war. Aber Männer hatten ein Gespür dafür, ob ein Mädchen für eine Liebelei zu haben war, die nur ein Abenteuer bleiben sollte. Dafür war Elisabeth Roth gewiß nicht der Typ. Wenn sie auch manchmal unklar gesprochen hatte, so wußte Dr. Norden doch, daß sie intelligent und auch mißtrauisch war.
*
»Hast du schon mal was von einem Entbindungsheim Miranda gehört, Fee?« fragte Daniel Norden seine Frau, als sie nach dem Mittagessen ihren gewohnten Mokka tranken.
»Miranda? Ja, eine Annonce habe ich mal gelesen. Privates Entbindungsheim, sehr diskret, auch für uneheliche Mütter. Ein hochtrabender Name, wenn man ihn zu deuten weiß.«
»Wieso?« fragte Daniel geistesabwesend.
»Weil Miranda die ›Bewunderungswürdige‹ bedeutet. Aber was hast du damit zu tun?«
»Bisher nichts. Ich werde mich mal bei Schorsch erkunden, ob er mehr weiß.«
Schorsch, das war Dr. Hans-Georg Leitner, seines Zeichens Gynäkologe und Chefarzt einer hochangesehenen Frauenklinik. Ein Studienfreund von Daniel Norden, ein Freund im besten Sinne des Wortes.
»Es gibt jetzt mehr solche privaten Entbindungsheime«, meinte Fee sinnend. »Meistens werden sie von Hebammen geleitet, die mit Hausentbindungen nichts mehr verdienen können. Aber sie brauchen eine Zulassung, und meistens verstehen sie ja auch etwas von ihrem Beruf. Es wird halt immer häufiger, daß man Diskretion gewahrt wissen möchte. Manche Frauen scheuen eine Geburtenunterbrechung und geben ihre Kinder lieber zur Adoption frei. Ich weiß nicht, ob man damit sein Gewissen beruhigen kann, aber wenigstens werden damit Frauen glücklich gemacht, die sich nach einem Kind sehnen. Ob alles immer mit rechten Dingen zugeht, das ist eine andere Frage.«
»Sag mir deine Gedanken, Fee«, bat Daniel.
»Du kannst doch selbst kombinieren.«
»Aber ich möchte von dir hören, was du darüber denkst, und wie das so vor sich gehen könnte.«
»Da kommt halt ein Mädchen oder eine Frau daher, die sich entschlossen hat, ihr Kind zur Welt zu bringen, und sie sieht eine Chance, damit auch noch zu Geld zu kommen. Immerhin sind neun Monate ja nicht das reine Zuckerlecken, und wenn man dann noch eine lange Zukunft vor sich sieht und von einem Mann sitzengelassen wurde, ergreift man jede Chance, sich einen neuen Start zu verschaffen. Ich habe da neulich mal so einen Bericht über den Babyhandel in den Staaten gelesen. Da ist man erschüttert. Eine Adoption ist ja immer mit großen Schwierigkeiten verbunden, aber man kann auch krumme Wege gehen. Da gibt es genügend Interessenten, die bereit sind, beträchtliche Summen auf den Tisch zu legen, damit es gar nicht erst bekannt wird, daß es ein adoptiertes Kind ist. Die Frau, die keine Kinder bekommen kann, geht in ein solches Entbindungsheim, wenn eine Geburt in Aussicht steht. Ein uneheliches Kind wird zur Welt gebracht, aber es wird angemeldet auf den Namen des Ehepaares, das sich ein Kind wünscht.«
»Das ist kriminell«, sagte Daniel.
»Nicht für die Eltern, die das Kind haben wollen. Sie zahlen kräftig dafür und umgehen mit Hilfe des Geburtshelfers die Behörden. Es ist einfach ihr Kind. Basta!«
»Dann ist es doch eigentlich unwahrscheinlich, daß in solchen Entbindungsheimen auch Abtreibungen vorgenommen werden«, sagte Daniel.
»Ich könnte mir vorstellen, daß dafür Unsummen auf den Tisch gelegt werden müßten, aber nach dem amerikanischen Muster scheint es wahrscheinlicher, daß diese Mädchen überredet werden, ihr Kind zur Welt zu bringen. Sie bekommen freie Wohnung und Kost und das Versprechen, eine beträchtliche Starthilfe für ein neues Leben zu bekommen. Am meisten verdient dann allerdings das jeweilige Heim. So ist das in den Staaten. Aber da gibt es auch noch Organisationen, die es sich viele einfacher machen. Die stehlen Babys und verkaufen sie. Tu nicht so, als hättest du nie was davon gehört, Daniel.«
»Mir wird übel bei dem Gedanken«, erwiderte er.
*
Dr. Norden nahm sich die Zeit, zwischen zwei Krankenbesuchen zur Leitner-Klinik zu fahren, denn darüber wollte er mit seinem Freund Schorsch lieber persönlich sprechen.
Er hatte freilich vorher angerufen, denn Schorsch hatte ebenso wie er sehr wenig Zeit.
Daniel hielt sich auch nicht lange bei der Vorrede auf. »Was weißt du von dem Entbindungsheim Miranda?« fragte er.
»Daß es da äußerst diskret zugeht. Bisher habe ich noch nichts Nachteiliges gehört. Frau Renz gilt als sehr erfahrene Hebamme. Ich kann es solchen nicht verdenken, wenn sie ein Heim gründen, sofern sie die Mittel dazu haben.«
»Du meinst also, daß dort alles in Ordnung ist?«
»Du nicht?« fragte Schorsch irritiert.
»Mir ist da etwas Merkwürdiges zu Ohren gekommen, und ich kann nicht glauben, daß das pures Gerede ist.«
Er erzählte, was er von Elisabeth Roth erfahren hatte. Schorsch runzelte die Stirn.
»Illegaler Babyhandel? Ich kann es mir bei uns kaum vorstellen. Da sind unsere Behörden doch eigentlich sehr wachsam. Aber es passiert auch bei uns, daß werdende Mütter ihr Baby sofort zur Adoption freigeben. Es ist ihre Entscheidung.«
»Aber da geht doch alles den Rechtsweg. Die Adoptionen werden rechtlich durchgeführt, die Eltern vorher überprüft.«
»Selbstverständlich.«
»Ich werde mich jedenfalls mal nach dieser Frau Renz erkundigen«, sagte Daniel. »Falls du etwas in Erfahrung bringen solltest, laß es mich wissen.«
»Es müßte ein Zufall sein«, sagte Schorsch Leitner seufzend. »Ich habe soviel zu tun, daß ich mich um nichts anderes kümmern kann, Daniel. Man kann sich gewaltig in die Nesseln setzen, wenn man eine Kontrolle veranlaßt.«
»Es gibt ja eine Aufsichtsbehörde. Erkundigen kann man sich doch mal«, meinte Daniel.
»Wenn da was nicht stimmen sollte, sind bestimmt Vorkehrungen getroffen worden, um jeden Verdacht auszuschließen«, meinte Schorsch Leitner. »Sei bloß vorsichtig.«
»Na, mir kann man Konkurrenzneid doch nicht nachsagen. Ich werde es schon diplomatisch anfangen.«
Und er fing es diplomatisch an. Er hatte ja eine Ehefrau, die jederzeit bereit war, ihm Hilfestellung zu leisten. Fee war schnell dazu bereit, mal einen Ausflug mit ihren beiden Buben zu machen. Die kleine Anneka ließ sie in Lennis Obhut zurück. Sie konnte unbesorgt sein, daß ihr Baby gut betreut wurde, denn ihre Hilfe Lenni hätte ihr eigenes Leben eingesetzt, bevor den Norden-Kindern auch nur ein Härchen gekrümmt worden wäre.
Es war ein schöner sonniger Tag. Danny und Felix waren sehr einverstanden, ins Vorgebirge zu fahren. Allzu weit war es ja nicht bis zu dem Entbindungsheim Miranda.
Landschaftlich war es wunderhübsch gelegen und machte von außen her einen sehr seriösen, ja, sogar komfortablen Eindruck. Fee überlegte, daß es allerhand gekostet haben mußte, dieses Haus aufzubauen.
Sie hatte es von außen begutachtet und schnell überlegt, wie sie mehr erfahren könnte. Wie sie es anfangen sollte, wußte sie noch nicht so recht, aber ihr kam ein Gedanke, als sie eine hochschwangere junge Frau sah, die ein kleines Café betrat, das mitten im Ort lag. Danny und Felix hatten eben erklärt, daß sie jetzt Hunger hätten. Für Kuchen waren sie immer zu haben.
Also nahm Fee ihre beiden Söhne bei der Hand und betrat dieses Café auch. Die schwangere junge Frau hatte sich an einen Tisch gesetzt. Fee setzte sich mit ihren Kindern an den Nebentisch.
Als die beiden den Kuchen bekommen hatten, den sie haben wollten und auch die junge Frau am Nebentisch genußvoll ein Stück Torte aß, entschloß sich Fee zum Angriff.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie zum Nebentisch hinüber, »darf ich fragen, ob Sie vom Entbindungsheim Miranda kommen?«
Die junge Frau preßte die Lippen aufeinander. »Nein«, erwiderte sie abweisend. »Ich wohne hier.«
»Ich möchte nicht aufdringlich sein«, sagte Fee, »aber ich sollte mich für eine Freundin erkundigen, ob diese Frau Renz einen guten Ruf hat, und weil Sie selbst ein Baby erwarten, dachte ich, daß Sie mir vielleicht ganz objektiv Auskunft geben könnten.«
»Ich bin verheiratet und gehe ins Kreiskrankenhaus zur Entbindung«, erwiderte die junge Frau. »Aber wenn Ihre Freundin nicht verheiratet ist, kann sie bei der Renz auf Diskretion rechnen.«
»Welche Freundin meinst du, Mami?« fragte Danny. »Tante Jenny oder Tante Claudia? Aber Onkel Schorsch hat doch selber eine Klinik, wo man Babys bekommt.«
Fee errötete. Sie rechnete manchmal nicht damit, wie wachsam dieser Junge schon war. Die fremde junge Frau sah Fee nun forschend an.
»Ich würde in jedem Fall eine andere Klinik vorziehen«, sagte sie leise. »Man kann Anna Renz nichts nachsagen, aber hier am Ort entbindet keine bei ihr. Sie nimmt ja auch nur Privatpatienten. Da muß man schon mächtig verdienen.«
Fee schob ihren Stuhl näher heran. »Aber ein Arzt ist doch da auch zugegen?« fragte sie.
»Ach, der Dr. Urban, der hat doch sonst nichts mehr zu tun. Ich will ja nichts gesagt haben, aber von außen sieht alles hübsch aus. Und jeder kommt da nicht hinein.«
Mehr erfuhr Fee auch nicht, aber es genügte ihr. Sie beschloß, sich mal nach diesem Dr. Urban zu erkundigen und noch einmal ohne die Kinder hierherzufahren.
Immerhin hatte sie einen Anhaltspunkt, und darüber konnte sie sich mit Daniel unterhalten.
Sie hatten schnell in Erfahrung gebracht, daß Dr. Urban bereits siebzig Jahre alt war und seine Praxis schon vor fünf Jahren einem jüngeren Arzt übergeben hatte.
»Wir müssen vorsichtig vorgehen, Fee«, sagte Daniel warnend.
»Immerhin annonciert diese Frau Renz«, sagte Fee. »Man kann sich doch mal schriftlich erkundigen.«
»Aber nicht unter unserem Namen. Wenn wirklich was nicht stimmt, werden sie dort äußerst vorsichtig sein.«
»Dann muß eben Franzi herhalten«, sagte Fee.
Franzi war Kindermädchen bei Fees Stiefschwester Katja Delorme, zwanzig Jahre jung und intelligent genug, daß man ein Abkommen mit ihr schließen konnte. Katja Delorme, verwandtschaftlich mit Fee verbunden, da ihre Mutter Anne in zweiter Ehe Fees Vater Dr. Johannes Cornelius geheiratet hatte, hätte Fee, die für sie eine richtige Schwester geworden war, keine Bitte abschlagen können.
David Delorme, der berühmte Pianist und Professor an der Hochschule für Musik, war derzeit mal wieder auf einer kurzen Konzertreise.
Es machte Fee nicht viel Umstände, Franzi zu erklären, worum man sie bitten wollte. Nachdem Fee Franzi erklärt hatte, worum es ging, war sie sofort bereit, an das Entbindungsheim zu schreiben.
Fee diktierte ihr den Brief und ließ durchblicken, daß etwaige Kosten keine Rolle spielten, Diskretion allerdings vorausgesetzt würde.
Der Brief wurde abgeschickt, die Antwort traf schon zwei Tage später ein. Sehr diplomatisch war sie abgefaßt.
Eine persönliche Unterhaltung wäre angebracht, hieß es darin, und eine solche wäre am Samstag oder Sonntag möglich. Ein Anruf würde genügen.
Ein bißchen bange wurde es Franzi nun doch. »Sie werden feststellen, daß ich gar kein Baby erwarte«, meinte sie kleinlaut.
»Sie brauchen sich nicht untersuchen zu lassen, Franzi«, sagte Fee. »Sie sagen, daß eine Schwangerschaft bereits festgestellt ist, und Sie wollten sich nur erkundigen, ob eine diskrete Geburtenunterbrechung möglich sei. Sie sind doch ein intelligentes Mädchen und könnten sich ein bißchen umschauen.«
»Ihnen tue ich ja jeden Gefallen, Frau Dr. Norden«, sagte Franzi. »Schließlich haben Sie mir ja dazu verholfen, daß ich es hier so gut habe.«
»Aber Schwierigkeiten darf Franzi nicht haben«, schaltete sich Katja ein.
»Keine Angst, da passe ich schon auf, ich fahre mit ihr hin«, sagte Fee. »Aber wenn es da wirklich einen illegalen Babyhandel gibt, müssen wir doch etwas tun, um das zu unterbinden.«
»Das meine ich auch«, sagte Franzi. »So was ist doch hundsgemein.« Sie wollte unbedingt dazu beitragen, daß man den Dingen auf den Grund kam. Sie war jung und recht ansehnlich. Man konnte ihr zutrauen, daß sie in eine mißliche Lage gebracht worden war, obgleich Franzi weit davon entfernt war, sich solcherlei Schwierigkeiten einzuhandeln. Sie war irrsinnig stolz darauf, bei dem berühmten Künstler David Delome Familienanschluß zu genießen. Sie hatte in dem Haus eine wunderhübsche Zweizimmerwohnung, und auch bei Familienzusammenkünften war sie ganz selbstverständlich dabei, auch wenn die Delormes zur Insel der Hoffnung fuhren. Und das war für Franzi immer ein Erlebnis.
Franzi Neumayer fuhr also mit Fee Norden zum Entbindungsheim Miranda. Nicht direkt bis vor die Tür, weil Fee ja nicht in Erscheinung treten wollte. Franzi ging ein ganzes Stück zu Fuß.
Die Tür tat sich ihr nicht einfach auf. Durch eine Sprechanlage wurde gefragt, wer da sei.
»Franziska Neumayer«, erwiderte sie. »Ich habe mich telefonisch angemeldet.«
Nun ging die Tür auf, und Franzi betrat herzklopfend das wirklich schön hergerichtete Grundstück. Aber ihre Befangenheit schien ganz natürlich, und man schien daran gewöhnt zu sein. Sie wurde freundlich empfangen von einer Frau mittleren Alters, die sich als Anna Renz vorstellte.
»Sie brauchen nicht die geringsten Bedenken zu haben. Alles, was wir besprechen, bleibt unter uns, Frau Neumayer. Sie sind sicher, daß Sie schwanger sind?«
»Ja, ganz sicher«, erwiderte Franzi stockend.
»Sie waren bei einem Arzt?«
»Ja, in meiner Heimat«, erwiderte Franzi. »Aber ich möchte gleich hinzufügen, daß ich da meinen richtigen Namen nicht angegeben habe. Meine Eltern dürfen nichts davon wissen, daß ich ein Kind bekomme.«
Ja, leider gibt es solche Eltern immer noch«, sagte Anna Renz freundlich. »Zu mir können Sie Vertrauen haben. Aber machen wir es uns doch mal ganz gemütlich. Man muß sich ja erst kennenlernen.«
»Sie sind sehr nett«, sagte Franzi.
»Ich kann mich in Ihre Lage hineinversetzen. Dieses Heim habe ich ja aufgebaut, um unglücklichen jungen Mädchen das Gefühl zu geben, nicht verlassen zu sein. Wollen Sie heiraten?«
Das fragte sie übergangslos. Aber Franzi war von Fee gut vorbereitet worden.
»Er will nicht heiraten«, sagte sie leise. »Seine Familie ist dagegen. Er ist noch sehr jung. Aber meine Familie wäre auch dagegen, vor allem gegen ein uneheliches Kind. Ich habe aber Geld.«
»Sie wollen das Kind nicht behalten?« fragte Anna Renz. Sie war mittelgroß, hager und keineswegs ein mütterlicher Typ.
»Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist doch eine Sünde, werdendes Leben zu töten«, flüsterte Franzi. Das war auch ihre Überzeugung, aber es bereitete ihr doch Ungemach, weil dieses Thema sie ja nicht betraf.
»Sie haben die richtige Einstellung«, sagte Anna Renz. »Es gibt viele Frauen, die sich nach einem Kind sehnen, und es ist durchaus keine Sünde, solchen Frauen Glück zu vermitteln. Ich will Ihnen jetzt nichts einreden. Entscheiden müssen Sie selbst. Hier ist alles ganz legal. Wir vermitteln nur viel diskreter, als es bei Behörden der Fall ist.«
»Was vermitteln Sie?« fragte Franzi stockend.
»Adoptionen, meine Liebe. Wir suchen uns freilich nur die besten Familien aus. Sie können Ihr Kind hier zur Welt bringen, ohne daß Ihnen Kosten entstehen. Und Sie können sicher sein, daß es die bestmöglichen Startchancen bekommt. Niemand wird etwas davon erfahren. Wenn Sie später einen Mann finden, der Sie heiraten will, können Sie ganz sicher sein, daß er von Ihrem Vorleben nichts erfährt. Diese Regelung muß selbstverständlich auf gegenseitiger Vertrauensbasis beruhen.«
»Ich bin zu allem bereit«, sagte Franzi leise, »und was kostet mich das?«
»Nichts. Sie werden sogar noch eine Starthilfe bekommen. Sozusagen ein Geschenk von den Eltern, die das Kind als ihr eigenes zu sich nehmen. Sie sind berufstätig?«
»Nein«, erwiderte Franzi. »Ich habe noch genügend Geld, um über die Runden zu kommen.«
»Und wie weit sind Sie?« fragte Anna Renz.
»Im zweiten Monat.« Franzi hatte auch diesmal schnell geschaltet.
»Vom dritten Monat an können Sie hier aufgenommen werden. Sie haben alles frei und brauchen nur mitzuhelfen. Ganz leichte Arbeiten, Betätigung im Garten und in der Küche. Sie brauchen sich um nichts sonst zu kümmern. Wir schließen nur einen Vertrag auf Gegenseitigkeit. Sie verstehen schon, daß ich mich absichern muß, daß Sie mit meinen Bedingungen auch einverstanden sind. Schließlich könnte jemand kommen, der mir unlautere Absichten nachsagen könnte. Dabei will ich doch nur helfen.«
»Sie sind sehr gütig«, sagte Franzi stockend. »Dann könnte ich hier leben, bis das Kind geboren ist, und Sie garantieren, daß es in gute Hände kommt?«
»Sie machen sich Gedanken, das gefällt mir«, erwiderte Anna Renz. »Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, daß es viel schlimmere Folgen haben kann, wenn man eine Abtreibung vornehmen läßt, als wenn man mit dem Gefühl leben kann, andere Menschen mit einem Kind glücklich zu machen. Ich habe mir dies zur Lebensaufgabe gemacht, aber ich muß die Bedingung stellen, daß auch von seiten meiner Patientinnen das Zugeständnis gemacht wird, daß in jedem Fall Diskretion gewahrt wird. Ich werde Sie, wenn Sie einverstanden sind, mit Dr. Urban bekannt machen. Sie werden verstehen, daß wir nun völlig gesunde Patientinnen aufnehmen können.«
»Ja, das verstehe ich«, erwiderte Franzi zaghaft, denn nun sah sie die Schwierigkeiten drohend auf sich zukommen.
Liebend gern hätte sie die Flucht ergriffen, aber sie wußte genau, daß sie damit Anna Renz nur gewarnt hätte. Sie war ein wirklich intelligentes Mädchen, und im Anblick der Gefahr wollte sie nicht kapitulieren, sondern wenigstens noch soviel wie nur möglich herausbringen.
Anna Renz führte sie in ein hübsches Zimmer. »Dr. Urban wird gleich kommen«, sagte sie. »Ruhen Sie sich aus, entspannen Sie sich.« Sie machte eine kleine Pause. »Würden Sie eine Vorauszahlung in Höhe von zweihundert Mark leisten?«
Auch auf solches war Franzi vorbereitet. »Ja, selbstverständlich«, antwortete sie.
»Das regeln wir dann später«, erwiderte Anna Renz freundlich. »Ich lasse Ihnen jetzt einen Imbiß bringen.«
*
Fee war indessen zu Dr. Urban gefahren. Sie konnte nur staunen, denn er wohnte in einem ganz modernen Bungalow, der inmitten eines großen, mit alten Bäumen bewachsenen Grundstücks stand.
Ein junger Bursche arbeitete im Garten. Er maß Fee mit einem zweideutigen Blick.
»Kann ich Dr. Urban sprechen?« fragte sie.
»Der ist nicht da, aber wenn Sie einen Arzt brauchen, müssen Sie schon zu Dr. Heckler gehen. Dr. Urban hat keine Praxis mehr.« Er grinste. »Oder wollen Sie ins Miranda? Vielleicht ist Dr. Urban dort.«
»Ja, danke, dann werde ich dorthin fahren«, sagte Fee.
Er grinste noch frecher, und er kam näher. »So eine hübsche Frau wie Sie wird doch einen finden, der Sie heiratet«, sagte er anzüglich.
Fee maß ihn mit einem langen Blick. »So einfach ist das nun auch wieder nicht«, erwiderte sie, da sie festgestellt hatte, daß er ein bißchen einfältig dreinschaute.
»Ich kann Ihnen einen Tip geben, wenn Sie ein bißchen nett sind«, sagte er. »Ich heiße Sepp. Da drüben wird es manchen langweilig. Meine Freunde und ich sorgen schon für Abwechslung.«
»Das ist aber nett«, sagte Fee geistesgegenwärtig. »Wie können wir uns denn verständigen?«
»Ich bin morgens immer zwischen sieben und zehn Uhr drüben. Das pendelt sich schon ein«, erwiderte er. »Hoffe, daß wir uns bald treffen.«
Das ist ja eine tolle Sache, dachte Fee, aber sie war doch heilfroh, daß sie unbeschadet dieses Grundstück verlassen konnte.
»Auf bald, Sepp«, sagte sie.
»Will ich doch sehr hoffen.«
Gut, daß Daniel das nicht hört, dachte sie. Nun war sie doppelt gespannt, was sie von Franzi erfahren würde.
Franzi hatte ungefähr eine Viertelstunde zwischen Hangen und Bangen verbracht, dann erschien Dr. Urban.
Er sah keineswegs furchterregend aus, ein sehr alter Herr nach Franzis Ansicht. In väterlichem Ton redete er mit ihr, mitleidvoll und gütig.
»Wir werden es ganz kurz und schmerzlos machen, kleines Fräulein«, sagte er. »Sie brauchen gar keine Angst zu haben. Hier sind Sie gut aufgehoben.«
Und dann sprach er in salbungsvollem Ton weiter.
»Wie kann man denn so was Hübsches einfach im Stich lassen? Das ist doch eine schlimme Welt. Ist es nicht gut, daß es immer noch verständnisvolle Menschen gibt, die einem über die Schwierigkeiten hinweghelfen?«
»Ja, ich finde das sehr gut«, sagte Franzi stockend und wünschte doch nichts so sehr, wie wieder draußen zu sein aus diesem Haus.
»Ich war schon bei einem Arzt«, sagte sie schnell. »Ich möchte mich nicht mehr untersuchen lassen.«
»Ja, da kommen wir aber nicht drumherum. Darauf besteht die Anna. Muß alles seine Ordnung haben. Wir brauchen ja einen Garantieschein, kleines Fräulein.«
Jetzt kommt alles heraus, dachte Franzi, und ihr Herz begann angstvoll zu klopfen, als Dr. Urban sie untersuchte.
Aber er runzelte nur die Stirn und schüttelte den Kopf.
»Liebe Güte, Sie sind wohl noch von gestern«, sagte er konsterniert. »Keine Schwangerschaft feststellbar. Denken Sie etwa, daß der Klapperstorch die Kinder bringt? Es gibt ja Mädchen, die meinen, daß sie von einem Kuß schwanger werden, aber Anna würde so was nicht gefallen, kleines Fräulein. Da handeln wir uns beide Schwierigkeiten ein.«
»Ich bekomme kein Baby?« tat Franzi erstaunt.
»Soll ich Sie einmal gründlich aufklären?« fragte er freundlich. »Wie alt sind Sie eigentlich?«
»Zwanzig«, erwiderte sie wahrheitsgemäß.
»Und Sie haben einen festen Freund?«
»Ja, was man so fest nennt«, erwiderte sie.
»Glaubt wohl auch noch an den Klapperstorch?« fragte Dr. Urban gutmütig.
Franzi konnte ihm nicht böse sein. Sie wäre bereit gewesen zu schwören, daß er ein ehrlicher Mensch war.
»Haben Sie hier schon was bezahlt?« fragte er nun.
Franzi nickte. »Zweihundert Mark.«
»Na ja, eigentlich kommen Sie noch ganz gut weg«, murmelte er. »Aber wenn ich Anna jetzt sage, daß
kein Baby zu erwarten ist, könnte sie mißtrauisch werden.«
»Warum?« fragte Franzi naiv.
»Weil nur welche herkommen, die es genau wissen«, erwiderte er leise. »Sie glaubt nicht daran, daß es noch so viel Unschuld gibt. Sind Sie einverstanden, wenn ich sage, daß es höchstens sechs Wochen sind?«
Franzi nickte befangen. Erklären konnte sie sich nicht, warum er es so drehen wollte.
»Es ist besser so für Sie und für mich«, sagte er leise. »Kommen Sie nicht wieder hierher zurück, Fräuleinchen. Sie brauchen es ja auch nicht. Ein bißchen Verstand habe ich schon noch.«
Er ging hinaus, weil er Schritte gehört hatte. Nach ein paar Minuten kam er mit Anna Renz zurück.
»Na, es ist ja alles in bester Ordnung«, sagte Anna Renz. »Dann kommen Sie in sechs Wochen wieder. Es wird Ihnen hier gefallen. Sie werden keinem Gerede ausgesetzt.«
Franzi konnte gehen. Mit einem Händedruck wurde sie verabschiedet. Wenn man ganz unbefangen herkam, konnte man wirklich nicht mißtrauisch werden.
Franzi schaute sich mehrmals um, bevor sie zu Fee Norden in den Wagen stieg, aber sie konnte niemanden sehen.
»Uff«, stöhnte sie auf, »das war heikel! Bin ich froh, daß ich heil davongekommen bin, aber die zwei Hunderter bin ich los, Frau Doktor.«
»Die können wir verschmerzen, wenn Sie etwas in Erfahrung gebracht haben, Franzi«, sagte Fee.
»Ja, eigentlich muß man da immer doppelt denken«, sagte Franzi. »Einen Strick könnte man der Renz daraus nicht drehen. Sie ist nur bemüht, einem eine Abtreibung auszureden. Aber dieser Dr. Urban ist eigentlich ganz nett. Schon ein bißchen senil. Er hat gleich durchschaut, daß ich noch nichts mit einem Mann gehabt habe, aber er meinte, daß es gut wäre, wenn Frau Renz das nicht wüßte. Ich kann nicht glauben, daß er nur für Geld etwas Unrechtes tut. Dann wäre er nicht so nett gewesen. Ob sie ihn irgendwie in der Hand hat?«
»Vielleicht«, sagte Fee. »Haben Sie sonst etwas gehört oder gesehen?«
»Gesehen nichts, aber gehört schon. Da scheint gerade jemand ein Kind zu bekommen. Die Frau hat fürchterlich gestöhnt. Ist das eigentlich immer so schlimm, Frau Doktor?«
»Es kommt auf die Einstellung und vor allem auf die Vorbereitung an, Franzi. Erzählen Sie mir bitte, wie das Haus eingerichtet ist.«
»Bestens, kann man nur sagen. Ganz modern und sehr sauber, da gibt es nichts zu mäkeln. Und raffiniert ist die Frau Renz schon, das möchte ich sagen.«
»Wieso meinen Sie das, Franzi?«
»Sie redet so geschickt drumrum, daß man sie nicht festnageln kann. Wenn die was auf dem Kerbholz hat, kann man es ihr bestimmt schwer nachweisen. Die müßte man schon auf frischer Tat ertappen.« Sie machte eine kleine Pause und fuhr dann mit trockenem Humor fort: »Aber ich kann mir doch kein uneheliches Kind zulegen, um dahinterzukommen.«
»Nein, das bestimmt nicht«, sagte Fee lächelnd. »Man müßte ein Mädchen finden, das in solcher Lage ist, ihr Kind aber ganz gewiß nicht hergeben will.«
Franzi atmete schneller. »Da wüßte ich schon eins«, sagte sie, »die Christel Jakob vom Lebensmittelgeschäft. Das ist auch eine ganz Stille, die nichts sagen würde. Sie könnten sich da auch raushalten, wenn ich mit ihr rede. Es würde halt noch mal etwas kosten, denn diese Frau Renz macht bestimmt keine Zugeständnisse, wenn einer mal nicht zahlen kann. Soll ich mit der Christel reden, Frau Doktor?«
»Kannst du es auch raffiniert anfangen?« fragte Fee.
»So, daß sie es versteht«, erwiderte Franzi. »Sie ist fromm. Sie würde nichts tun, was Gott nicht gefällt. Spanisch kommt mir das schon alles vor, aber ich glaube, wenn jemand sich wirklich verstecken will, dann kann er es dort.«
*
Ja, das konnte man allerdings. Sandra Trento und auch Hilde Toth wollten sich verstecken, wenn auch aus verschiedenen Gründen. Beide meinten sie, gut aufgehoben zu sein in dem Entbindungsheim Miranda. Daß sie sich hier getroffen hatten, war kein Zufall. Kurt Fechner hatte Hilde die Adresse gegeben.
Allerdings wußte er nicht, daß Sandra sich hier schon angemeldet hatte. Er wußte von Sandra überhaupt sehr wenig, eigentlich nur, daß Götz von Hellbrink sich in sie verliebt hatte.
Wo sie dann geblieben war, wußte er ebenso wenig wie die Familie Hellbrink, die nur froh war, daß Sandra sang- und klanglos untergetaucht war.
Für Hilde und Sandra war es ein ziemlicher Schock gewesen, als sie sich im Garten trafen. Wie erstarrt waren sie stehengeblieben, aber sogleich war Anna Renz, die ihre Augen überall zu haben schien, bei ihnen gewesen.
»Wir wollen volle Diskretion wahren, meine Damen«, sagte sie, »und dazu gehört wohl auch, daß wir uns nicht mit vollem Namen vorstellen. Oder kennen Sie sich zufällig?«
Sandra war geistesgegenwärtig gewesen. »Nein, wir sind uns noch nicht begegnet«, sagte sie rasch. »Aber ein Gespräch wird uns doch erlaubt sein!«
»Selbstverständlich, Sandra«, erwiderte Anna Renz eilfertig.
»Man möchte sich ja gern mal unterhalten«, sagte Sandra. »Wir sind hier nicht in einem Gefängnis.«
»Aber gewiß nicht. Sie sollen sich in jeder Beziehung wohl fühlen«, sagte Anna Renz darauf.
Und dann hatte sie sich entfernt. Sandra hatte schnell geschaltet. »Wir treffen uns irgendwann, Hilde«, sagte sie. »Jetzt reden wir besser nicht miteinander.«
Anscheinend hatte es Anna Renz beruhigt zur Kenntnis genommen, daß sie nur wenige Worte wechselten, denn beim nächsten Zusammentreffen wurden Sandra und Hilde nicht gestört.
»Warum bist du hier, Hilde?« fragte Sandra leise.
»Ich bekomme ein Baby«, erwiderte Hilde. »Ich wollte es nicht haben, aber die Renz hat mich beschwatzt, daß ich es zur Welt bringe. Ich kann hierbleiben, bis das Kind geboren wird, und dann bekomme ich auch noch zehntausend Mark. Sie hat schon Adoptiveltern. Eigentlich finde ich das auch besser. Machst du es auch so, Sandra?«
»Aber nein, die Hellbrinks sollen nur nicht erfahren, daß ich ein Kind haben werde. Ich will Götz nicht in Schwierigkeiten bringen. Mit wem hast du dich eingelassen, Hilde? Ist Fechner der Vater deines Kindes?«
Hilde nickte. »Er hat gesagt, daß eine Heirat nicht in Frage kommt. Was soll ich denn tun, Sandra? Lis hat schon so viel für mich getan. Ich möchte nicht wissen, wie ihr jetzt zumute ist. Ich fürchte, wir beide haben sie schwer enttäuscht.«
»Aber ich werde mein Baby behalten«, sagte Sandra. »Ich gebe es nicht her, und du solltest es dir auch noch überlegen, Hilde.«
»Läßt Götz dich nicht auch sitzen?« fragte Hilde.
»Das ist mir jetzt egal. Ja, schau mich nur an. Seit sechs Wochen hat er mir nicht mehr geschrieben, und es wird nur noch zwei Wochen dauern, bis ich das Baby bekomme. Aber ich behalte es. Niemand wird es mir nehmen. Ich habe es mir hier nur ein wenig anders vorgestellt«, fügte sie sinnend hinzu.
»Aber es ist doch alles sehr modern«, sagte Hilde, »und das Essen ist auch gut. Was gefällt dir nicht, Sandra?«
»Daß man so interessiert ist, die Kinder zur Adoption zu vermitteln. Mich wollte Frau Renz doch auch überreden.«
»Das ist bestimmt in allen Entbindungsheimen so, wo nur eheliche Kinder geboren werden«, sagte Hilde. »Ich finde es wirklich gut, daß es so was gibt.«
*
Dieser Meinung war Dr. Norden auch, denn er war überzeugt, daß es sehr seriöse Entbindungsheime gab, aber im Fall Miranda teilte er Fees Bedenken.
Es vergingen nun einige Tage, bis Franzi berichten konnte, daß sie mit Christel Jakob gesprochen hatte und daß sie sich einig geworden wären. Christel hatte keine Angehörigen, und ihr Verlobter hatte eine Stellung in Westdeutschland angenommen. Er wollte erst eine Wohnung suchen und Christel dann nachholen. Dann wollten sie auch heiraten.
Christel ließ sich in das recht gewagte Spiel, in das Entbindungsheim Miranda zu gehen, nur ein, weil sie Dr. Norden kannte.
Er hatte alles wohl durchdacht und wollte nun ergründen, wie Anna Renz reagieren würde, wenn eine Patientin von einem Arzt offeriert wurde. Er rief bei ihr an.
»Dr. Norden?« wiederholte Anna Renz fragend seinen Namen. »Habe ich recht gehört?«
»Das haben Sie, Frau Renz. Ich wollte bei Ihnen anfragen, ob ich Ihnen eine Patientin schicken kann. Sie ist sehr gehemmt.«
»Wir sind derzeit sehr belegt«, erwiderte Frau Renz. »Unser Heim erfreut sich großer Beliebtheit. Aber wenn mich sogar ein so bekannter Arzt bittet, muß ich mir etwas einfallen lassen.«
»Ich würde Ihnen Frau Jakob persönlich bringen«, sagte er.
»Ist sie verheiratet? Eigentlich kommen nur unverheiratete werdende Mütter zu uns.«
»Nein, sie ist nicht verheiratet und bereits im siebenten Monat.«
Anna Renz schien zu überlegen. »Gut, bringen Sie mir die Patientin.«
Das überraschte ihn, und ihm kamen nun doch Zweifel, ob sein Mißtrauen gerechtfertigt war. Vielleicht hatte Elisabeth in der Sorge um ihre Schwester doch Gespenster gesehen, vielleicht hatte in Franzis Ohren alles so doppelsinnig geklungen, weil sie schon mit Vorurteilen belastet zu dem Heim gegangen war.
Allerdings gab zu denken, was Fee von jenem Sepp berichtet hatte.
Für Christel war es eine Beruhigung, daß Dr. Norden persönlich sie zu diesem Heim brachte. Das Tor tat sich ihnen auf. Dr. Norden ließ seinen Blick umherschweifen und konnte nichts Befremdliches feststellen.
Anna Renz empfing ihn und Christel mit ihrem liebenswürdigsten Lächeln. Ihr Empfangszimmer war komfortabel eingerichtet.
»Sehr hübsch ist das Haus«, stellte Dr. Norden fest. Sie lächelte geschmeichelt.
»Ich bin durch eine Erbschaft in die glückliche Lage versetzt worden, dieses Haus ausbauen und modernisieren lassen zu können«, erklärte sie. »Hausentbindungen gibt es heute ja kaum noch. In eine abhängige Stellung wollte ich mich nicht begeben, und hätte ich in meiner Jugend die Möglichkeit gehabt, Medizin zu studieren, hätte ich es getan. So tue ich nun auf meine Weise alles, um den werdenden Müttern, die sich noch immer innerhalb dieser Gesellschaft als Außenseiter betrachten müssen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, das Gefühl der Geborgenheit zu geben.« Sie wandte sich Christel zu und betrachtete sie abschätzend. »Sie werden sich über nichts zu beklagen haben«, fuhr sie fort. »Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, daß auch die Patientinnen untereinander auf Diskretion bedacht sind. Es sind einige junge Damen aus besten Kreisen hier. Selbstverständlich werden in der Betreuung keinerlei Unterschiede gemacht.«
»Wie viele Patientinnen haben Sie im Schnitt?« fragte Daniel beiläufig.
»Augenblicklich ein ganzes Dutzend. Selbstverständlich überschneiden sich die Geburten hier nicht, wie in einer großen Klinik. In etwas komplizierteren Fällen werde ich von Dr. Urban unterstützt. Er ist ein sehr zuverlässiger Arzt mit großer Erfahrung. Selbst ein sehr kritischer Arzt wird nichts auszusetzen finden«, fügte sie selbstbewußt hinzu.
An Selbstbewußtsein und Sicherheit mangelte es ihr gewiß nicht. Dr. Norden war überzeugt, daß ihr schwer beizukommen war. Und das sollte er bestätigt bekommen, als er sich dann noch unter vier Augen mit ihr unterhielt.
»Es ist ja so, daß manche ledige Mutter ihr Kind bald zur Adoption freigeben will«, sagte er. »Haben Sie da nicht mit Schwierigkeiten zu kämpfen?«
»Aber keineswegs. Es geht alles, wie auch in den Krankenhäusern, seinen rechtmäßigen Gang. Wir haben schon viele Babys vermitteln können, und dies zur beiderseitigen Zufriedenheit. Wissen Sie, Herr Doktor, gerade diese jungen Damen aus besseren Kreisen sind recht froh, wenn sie ihre Kinder weggeben können. Manchmal wird das auch von den Eltern arrangiert, wenn die Töchter noch nicht mündig sind. Es ist selbstverständlich, daß alles mit äußerster Diskretion abgewickelt wird. Ist Ihr Schützling auch daran interessiert, das Baby zur Adoption freizugeben?«
»Möglicherweise. Man weiß nie, ob sie im letzten Augenblick die Meinung nicht doch ändern, aber das werden Sie ja auch schon erfahren haben. Ich bin jedenfalls der Überzeugung, daß Kinder bei Adoptiveltern, die sich sehnlich ein Kind wünschen, besser aufgehoben sind als bei einer ledigen Mutter, die das Kind nur als Belastung empfindet.«
»Ganz meine Ansicht. Es wäre wunderbar, wenn ich mit Ihnen zusammenarbeiten könnte, wenn mein guter Dr. Urban sich nun doch zur Ruhe setzen muß. Sehen Sie, es kommen auch junge Frauen und Mädchen zu mir, die eine Geburtenunterbrechung wünschen, aber das muß ich freilich ablehnen. Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Wie stehen Sie dazu?«
»Ich bin kein Gynäkologe. Was die Einstellung der jeweiligen Frauen anbetrifft, ist das freilich auch eine rein persönliche Gewissensentscheidung, allerdings vertrete ich auch diesbezüglich den Standpunkt, daß es nicht gut für ein Kind ist, wenn es nicht mit Freude ausgetragen wird.«
»Und deshalb sollen es diese jungen Dinger so schön wie möglich bei mir haben«, sagte Anna Renz.
Was sollte man daran nun aussetzen? Sie zeigte Dr. Norden den Kreißsaal, und auch da war alles in bester Ordnung.
Sie zeigte ihm auch zwei Zimmer, in denen sich augenblicklich niemand befand. Sehr hübsch waren sie eingerichtet.
Anna Renz lächelte wohlgefällig, als er dies feststellte.
»Es mag ja manch einer Hintergedanken hegen, wenn ich immer wieder diese äußerste Diskretion betone«, sagte sie, »aber es geschieht im Interesse meiner Schützlinge, die keinen Wert darauf legen, während dieser Zeit mit Angehörigen konfrontiert zu werden. Probleme hat ja jede, wenn sie sich in ein solches Heim zurückziehen will. Es gehört sehr viel Taktgefühl dazu, jeder gerecht zu werden.« Sie sah ihn an. »Ich denke, wir haben viel gemeinsam, Herr Dr. Norden. Jedenfalls ist es erstmalig, daß ich einen Arzt kennenlerne, der sich so rührend um seine Patientin bemüht.«
»Und ich habe mich gefreut, Sie kennenzulernen, Frau Renz. Es ist ja möglich, daß ich Ihnen noch manche Patientin zuführe.«
»Obgleich doch bekannt ist, daß Sie mit Dr. Leitner befreundet sind«, sagte sie hintergründig. Aber Daniel zeigte sich dieser Bemerkung gewachsen.
»In einer solchen Klinik, das wissen Sie doch auch, kann unmöglich Diskretion gewahrt werden, schon wegen der vielen Schwestern nicht«, erwiderte er. »Und leider wird es dann manchmal auch schnell bekannt, wenn jemand sein Baby zur Adoption freigegeben hat. Das erscheint in unserer seltsamen Gesellschaft noch verwerflicher, als ein uneheliches Kind zur Welt zu bringen.«
Er hatte es sehr überzeugenden Tones gesagt, und er hoffte, damit ihr Mißtrauen restlos ausgeräumt zu haben. Sie schenkte ihm jedenfalls ein bedeutsames Lächeln.
Es fühlte sich jeder von ihnen als Sieger, aber Daniel mußte sich eingestehen, daß er nur positive Eindrücke mitnehmen konnte, abgesehen von der überheblichen Art der Anna Renz.
Was Christel nun in Erfahrung bringen würde, mußte abgewartet werden. Ob es ihr gelingen würde, mit Sandra Trento und Hilde Roth ins Gespräch zu kommen, stand in den Sternen.
Zuviel wollte Dr. Norden nicht riskieren, aber warum sollte er es nicht wagen, mit Dr. Urban zu sprechen?
Diesmal war nicht Sepp im Garten beschäftigt, als Dr. Norden sich vorstellte. Sein faltiges Gesicht war bleich geworden.
»Ich habe eben eine Patientin zum Entbindungsheim gebracht«, erklärte Daniel, »und da kam mir ein Gedanke.«
Dr. Urban begann zu zittern. »Welcher?« fragte er heiser.
»Dieses Haus ist erstklassig in Ordnung. Offengestanden wäre ich an einer Zusammenarbeit mit Frau Renz interessiert, falls Sie sich zur Ruhe setzen wollen. Ich habe ihr das zwar noch nicht gesagt, weil ich dachte,
daß ich erst mit Ihnen sprechen sollte. Es ist beachtlich, was Frau Renz da auf die Beine gestellt hat, aber mit einer Beteiligung wäre das Heim doch noch ausbaufähig.«
Dr. Urban sah ihn konsterniert an. »Sie würden ein solches Risiko eingehen?« fragte er.
»Ein Risiko? Ich sehe keines.«
Dr. Urban kniff seine Augen zusammen. »Sie sind ein bekannter Arzt«, sagte er. »Ihnen gehört die Insel der Hoffnung. Welches Interesse könnten Sie an einem Unternehmen haben, das im Zwielicht steht?«
»Im Zwielicht?« fragte Dr. Norden. »Aber was ich gesehen und gehört habe, klingt doch durchaus seriös.«
Dr. Urban fuhr sich mit dem Taschentuch über die Stirn.
»Ich bin ein alter Mann, Herr Norden. Anna ist meine Nichte. Ich habe nicht mehr viel zu verlieren, aber so verkalkt bin ich noch nicht, daß ich einem Kollegen zureden würde, da einzusteigen. Ich weiß nicht, womit Anna so viel Geld verdient, aber…« Er unterbrach sich und starrte Dr. Norden an.
»Sie wollen es nicht wissen, Herr Kollege«, sagte Daniel ruhig. »Sie könnten jetzt zu Frau Renz gehen und ihr sagen, daß ich sehr mißtrauisch bin, aber Sie werden es nicht tun.«
»Nein, ich werde es nicht tun. Gehen wir hinein. Wer weiß, wie lange ich noch lebe. Ich wollte doch nur immer das Schlimmste verhüten«, murmelte er. »Aber Anna ist schlau. Sie hat mich nie ganz eingeweiht. Gebraucht werde ich selten, wirklich ganz selten. Sie versteht ihr Handwerk, und sie bezahlt mich nicht. Das dürfen Sie nicht denken. Dieses Haus hier konnte ich mir bauen. Ich besaß genug Grund. Ich habe ihr das alte Haus überlassen, und das Grundstück für den Park zahlt sie mir monatlich ab. Ich meine mein gutes Auskommen, aber es ist kein Sündenlohn. Man kann ihr kein Unrecht nachweisen, Herr Norden. Diese Mädchen unterschreiben freiwillig. Es hat noch keines Anklage erhoben. Sie verschenken ihre Kinder gern.«
»Werden sie nicht dafür bezahlt?« fragte Daniel.
»Davon weiß ich nichts. Ich will auch nichts davon wissen. Ich bin ein alter Mann und will meinen Frieden haben. Zuleide tun kann ich niemandem etwas. Ich habe ein einziges Mal…« Doch da unterbrach er sich. Er starrte Dr. Norden blicklos an. »Wenn es an der Zeit ist, werde ich Sie um Hilfe bitten«, fuhr er nach Sekunden flüsternd fort, »und ich hoffe, daß ich nicht umsonst bitten muß.«
»Sie werden nicht umsonst bitten, Herr Kollege«, erwiderte Daniel Norden.
Das alte, faltige Gesicht belebte sich. »Warum sind Sie nicht früher gekommen?« fragte Dr. Urban heiser. »Mein Gott, warum begegnet einem erst an der Schwelle des Todes ein Mensch?«
»Sind Ihnen nicht viele Menschen begegnet, Dr. Urban?« fragte Daniel erschüttert.
»Geschöpfe ja, menschliche Geschöpfe, aber mit Sorgen beladen, der Hilfe bedürftig, nicht fähig zu begreifen, daß auch andere Hilfe brauchen, auch ein Arzt. Wer ahnt denn schon die Ängste, die seelische Not, all die Zweifel, mit denen man fertig werden muß, wenn man einmal vom Wege abgewichen ist?« Er sprach jetzt mehr zu sich selbst. Daniel hörte es, aber er beschloß, es für sich zu behalten und es zu vergessen. Er sah nur diesen alten Mann, das zerrissene Gesicht, die von Sorgen gebeugte Gestalt.
»Ich gebe Ihnen meine Karte, Herr Kollege. Wenn Sie nicht mehr weiter wissen, rufen Sie mich an.«
»Danke«, sagte Dr. Urban leise. »Ich danke Ihnen!« Und dann blickte er sich ängstlich um. »Sepp kommt bald zurück«, flüsterte er. »Es wäre gut, wenn er Sie nicht mehr sehen würde.«
Daniel verabschiedete sich schnell. Aber als er seinen Wagen besteigen wollte, kam Sepp auf seinem Motorrad daher. Im ersten Augenblick dachte Daniel nur daran, wie frech dieser Bursche mit Fee geredet hatte, aber er beherrschte sich.
»Was wollen Sie hier?« fragte Sepp auch ihn frech.
»Ich wollte Dr. Urban einen Besuch machen, aber er scheint nicht dazusein«, erwiderte Daniel geistesgegenwärtig.
Sepp kniff die Augen zusammen. »Er wird vielleicht schlafen, dieser senile Tattergreis. Kann ich ihm etwas ausrichten?«
»Nein, das erübrigt sich«, erwiderte Daniel eisig, aber dann besann er sich doch anders. »Oder sagen Sie ihm, daß ich sehr an einer Zusammenarbeit mit Frau Renz interessiert wäre. Mein Name ist Norden, Dr. Norden, Arzt von Beruf.«
Er stieg in seinen Wagen. Sepp blickte ihm mit törichtem Ausdruck nach. Das sah Daniel im Rückspiegel. Er war überzeugt, diesen Burschen richtig eingeschätzt zu haben. Er war geistig beschränkt. Aber ihn faszinierte die Ähnlichkeit, die er mit Anna Renz hatte, obgleich man sie gewiß nicht als geistig beschränkt bezeichnen konnte, doch in diesem Augenblick konnte er noch nicht ahnen, daß Sepp ihm eine unerwartete Hilfestellung leistete. Als er Sepps Blicken entschwunden war, schwang der junge Mann sich wieder auf sein Motorrad und fuhr zum Entbindungsheim Miranda.
»Was willst du jetzt schon wieder, Sepp?« fragte Anna Renz ungehalten. »Du weißt doch, daß du dich hier nicht so oft blicken lassen sollst.«
»Ich muß dir was sagen, Mama. Ein Herr wollte zu Onkel Urban, aber der hat mal wieder geschlafen. Es war ein feiner Herr, Dr. Norden, Arzt von Beruf. Das hat er gesagt, und ich soll Onkel Urban ausrichten, daß er an einer Zusammenarbeit mit dir interessiert wäre. Das mußte ich doch sagen.«
»Ja, es ist gut, es ist sehr gut, Sepp.« Und in Annas Augen glitzerte Triumph. Doch der erlosch, als Sepp sagte: »Dafür kriege ich doch eine Belohnung, Mama. Die Blonde möchte ich haben, die schöne Blonde, die neulich auch zu Onkel Urban wollte.«
»Welche Blonde?« fragte Anna mit zusammengekniffenen Augen. »Wann war sie bei Urban?«
»Neulich. Er war bei dir. So ganz silberblondes Haar hat sie. Sie wollte sich doch bei dir melden. Ihr Kind gibst du nicht weg, Mama, das behalten wir.«
»Du spinnst ja mal wieder«, sagte Anna hart. »Geh jetzt.«
Ein böser, haßvoller Zug legte sich um seinen Mund. »Ich spinne nicht«, zischte er. »Ich weiß, was hier vorgeht. Ich bin kein Depp wie Onkel Urban.«
»Du hältst deinen Mund, sonst bekommst du keinen Pfennig mehr«, fuhr sie ihn an. »Und das Motorrad nehme ich dir auch wieder weg.«
»Das darfst du nicht!« schrie er.
»Dann sei ein braver Junge«, sagte sie streng.
Er schwang sich wieder auf sein Motorrad und fuhr davon.
Annas Gedanken überstürzten sich. Wer war silberblond?
Sandra! Aber sie hatte das Haus nie verlassen und hatte Sepp nie gesehen. Oder doch?
Sie überlegte, dann ging sie zu Sandra ins Zimmer. Sie saß am Fenster und häkelte an einem Babyjäckchen.
»Alles in Ordnung, Sandra?« fragte Anna freundlich.
»Ja, es geht mir gut.«
»Da gibt es einen jungen Mann, der sich für Sie zu interessieren scheint. Ein netter junger Mann«, sagte Anna.
»Ich verstehe nicht«, erwiderte Sandra verwundert.
»Sie sind neulich nicht spazierengegangen?« fragte Anna.
»Im Garten, ja, aber ich weiß gar nicht, was Sie meinen.«
»Sepp hat großes Interesse für Sie. Auch für Ihr Baby, Sandra. Ich glaube, er würde Sie heiraten.«
»Sepp?« fragte Sandra. »Der junge Mann, der die Lebensmittel bringt?«
»Er ist doch sehr nett, und er ist auch nicht unvermögend«, sagte Anna. »Er könnte Ihnen etwas bieten, Sandra.«
Sandra blickte zum Fenster hinaus. »Sie meinen es sicher gut, Frau Renz«, sagte sie leise, »aber ich muß Ihnen ein Geständnis machen. Ich bin verheiratet.«
»Sie sind verheiratet?« wiederholte Anna fassungslos.
»Ja, und mein Kind soll den Namen seines Vaters tragen. Es würde ja doch bekannt werden.«
»Mit wem sind Sie verheiratet?« fragte Anna heiser.
»Mit Götz von Hellbrink«, erwiderte Sandra. »Seine Familie sollte nichts davon wissen. Wir haben heimlich geheiratet, bevor er nach Afrika geschickt wurde.«
»Aber er ist verschollen«, entfuhr es Anna.
»Verschollen?« wiederholte Sandra entsetzt. »Wieso verschollen?«
»Es stand doch in der Zeitung, daß er mit noch ein paar anderen von einer Safari nicht zurückgekehrt ist.«
Und dann hielt sie den Atem an, denn Sandra war aufgesprungen, rang nach Atem, ein unterdrückter Aufschrei kam über ihre Lippen, und dann sank sie ohnmächtig zusammen.
Anna Renz stürzte zum Telefon und rief Dr. Urban an. Momentan wußte sie selbst nicht mehr, was sie tun sollte.
Als Sandra zu sich kam, verspürte sie heftige Schmerzen, als würde ihr ganzer Körper auseinandergerissen. Von diesen Schmerzen war sie auch ins Bewußtsein zurückgeholt worden.
Sie erkannte Dr. Urbans Gesicht, das sich dicht über sie beugte.
»Jetzt ganz ruhig atmen. Wir werden es bald geschafft haben«, sagte er.
Sandra vernahm einen hysterischen Schrei, aber nicht sie selbst hatte diesen ausgestoßen.
»Paß auf sie auf«, vernahm sie dann Annas Stimme. »Es darf nichts passieren, Urban.«
Ihr war es, als würde sie über dem Boden schweben, aber dann kam wieder dieser fürchterliche Schmerz, und sie bäumte sich auf.
»Pressen«, sagte Dr. Urban. »So pressen Sie doch! Und tief durchatmen!«
Seine Worte wirkten suggestiv. Sie befand sich in einem seltsamen Zustand. Sie spürte Schmerzen, aber diese erstickten jeden Widerstand. Sie ließ sich einfach treiben, mitreißen. Sie schien auf Wolken zu schweben, als dieser wahnsinnige Schmerz dann plötzlich nachließ, und aus weiter Ferne vernahm sie Dr. Urbans Stimme: »Es ist ein Junge, ein prächtiger Junge! Anna, es ist überstanden.«
Sandras Sinne schwanden. Es war ihr, als würde sie sich von der Erde entfernen.
»Götz, ich liebe dich«, flüsterte sie, »ich werde dich immer lieben, immer, immer, immer…« Ihre Stimme verlor sich. Sie wußte nicht mehr, was um sie herum geschah.
»Das kam zu plötzlich«, sagte Anna Renz kalt. »Wir haben eine Frühgeburt. Diese Christel. Ich kann nichts riskieren. Dr. Norden hat sie hergebracht. Kümmere dich um sie, Urban!«
»Ruf Norden an«, sagte er. »Hier werde ich auch gebraucht. Sandra schwebt in Lebensgefahr. Es wird Schwierigkeiten mit der Nachgeburt geben.«
»Es ist ein Junge, ein prächtiger Junge. Ich kann ihn brauchen.«
»Brauchen?« fragte Dr. Urban.
»Kümmere dich um Christel«, sagte Anna scharf.
»Ruf Dr. Norden an«, sagte er aggressiv. »Du weißt hoffentlich, worum es geht.«
Zum ersten Mal duckte sie sich. »Ja, ich rufe ihn an«, sagte sie tonlos.
*
»Daniel, für dich, ein dringender Anruf«, sagte Fee zu ihrem Mann. »Sie hat keinen Namen genannt.« War da nicht doch ein Unterton von Eifersucht in Fees Stimme? Daniel Norden nahm den Hörer ans Ohr.
»Es ist gut, Frau Renz, ich komme«, sagte er, nachdem er ein paar Sekunden gelauscht hatte. »Ja, sofort!«
»Es scheint dort nichts auszusetzen zu geben«, sagte er gedankenvoll zu Fee, als er den Hörer aufgelegt hatte.
»Dann will ich nicht mehr Fee Norden heißen«, sagte Fee störrisch.
»Du willst nicht?« fragte Daniel hintergründig.
»Sei wachsam, Liebster. Mein Gefühl sagt mir…« Aber da war er schon an der Tür. »Gefühle können manchmal doch täuschen, Fee«, rief er ihr zu.
Er brauste mit Vollgas davon. Wenn ihm nur nichts passiert, dachte Fee, als sie den aufheulenden Motor hörte. Sie wußte, daß er mindestens zwanzig Minuten brauchen würde.
Daniel Norden schaffte es in fünfzehn Minuten, weil glücklicherweise kaum Gegenverkehr war. Er läutete Sturm, als er das Entbindungsheim erreicht hatte.
»Dr. Norden«, sagte er, als eine ihm fremde Stimme fragte, wer da sei. Das Tor tat sich auf. Dann taumelte ihm blaß Dr. Urban entgegen.
»Sie muß schleunigst in die Klinik. Lebensgefahr«, murmelte er.
Daniel dachte, daß es sich um Christel handle, und sein Gewissen schlug. Er war wie betäubt, aber er wählte schon die Nummer des Notarztes, die er im Gedächtnis hatte.
Nur im Unterbewußtsein hörte er klägliche Schreie und dann das Wimmern eines Babys.
Anna Renz blieb unsichtbar. Dr. Urban redete wirres Zeug. Dr. Norden blickte in ein ihm fremdes Gesicht, das blutleer und starr war.
»Das ist doch nicht Christel Jakob«, sagte er.
»Nein, nein«, murmelte Dr. Urban. »Sie darf nicht sterben, sie darf nicht sterben.«
Dann sackte er auf einem Stuhl zusammen und legte die Hände vor sein Gesicht. »Ich bin müde, müde«, murmelte er. »Nehmen Sie mir diese Last ab.«
Dann vernahmen sie das Martinshorn. Anna Renz stürzte herein. Sie starrte Dr. Norden an.
»Die Patientin muß in eine Klinik, Anna«, sagte Dr. Urban. »Hörst du? Sie verblutet sonst.«
»Gut, daß Sie da sind, Dr. Norden«, sagte Anna Renz. »Christel hat eine Frühgeburt. Wir haben einen schlechten Tag.«
Der Notarztwagen war da. »Bringen Sie die Patientin schleunigst zur Leitner-Klinik«, sagte Daniel zu dem fremden jungen Arzt. »Ich komme nach.«
Er hatte Christel in diese prekäre Situation gebracht. Er konnte sie jetzt nicht im Stich lassen. Was sich hinter seinem Rücken abspielte, konnte er nicht beeinflussen. Es ging lautlos vor sich.
Christel Jakob brachte ein Mädchen zur Welt, winzig war es und gehörte noch in den Brutkasten. Dafür sorgte Dr. Norden.
Anna Renz sagte vorwurfsvoll: »Das haben Sie auch nicht vorausgesehen, Herr Doktor. Es kam sehr überraschend, aber mich trifft keine Schuld.«
Schuldbewußt fühlte sich Dr. Norden. »Ich werde Christel auch in die Klinik bringen lassen«, sagte er. »Schließlich ist sie meine Patientin. Würden Sie mir jetzt bitte noch den Namen der anderen Patientin sagen?«
Bevor Anna Renz antworten konnte, wurde der von Dr. Urban ausgesprochen. »Sandra Trento.«
Dr. Norden war konsterniert, so bestürzt, daß er gar nicht nach dem Kind fragte.
Der Notarztwagen holte nun auch Christel und ihr Baby. Dr. Norden fuhr schleunigst zur Leitner-Klinik, wo man sich schon um Sandra bemühte.
Der erfahrene Gynäkologe Dr. Leitner hatte die Nachgeburt schon geholt und die Blutung eingedämmt.
»Was ist mit dem Baby?« fragte er.
»Ich werde gleich zurückfragen«, sagte Daniel. »Es ging alles so schnell.«
»Es mußte schnell gehen«, sagte Dr. Leitner. »Sie wäre sonst verblutet.«
*
»Sie wäre verblutet«, wehrte Dr. Urban Annas Vorwürfe ab.
»Du bist ein Stümper«, fauchte sie. »Dich kann man nicht mehr allein lassen. Man wird nach dem Kind fragen.« Und da läutete auch schon das Telefon.
»Ja, Dr. Norden?« fragte Anna. »Wie geht es Sandra? Das ist beruhigend«, fuhr sie fort, nachdem sie ein paar Sekunden gelauscht hatte. »Es ist ein Mädchen. Gesund und kräftig. Wir können es hierbehalten. Sie wollen es bei der Mutter haben? Gut, dann bringe ich es hin. Sie brauchen keine Sorge zu haben. Ich bin auf Babytransporte eingerichtet.«
Dr. Urban stand wie erstarrt. »Wieso sagst du, daß es ein Mädchen sei?« fragte er konsterniert.
»Es ist ein Mädchen«, sagte sie scharf. »Du bist ja schon so blind, daß du nicht mal mehr die Geschlechter auseinanderhalten kannst.«
»Anna«, sagte er warnend.
»Halt deinen Mund. Bring uns bloß nicht in Schwierigkeiten. Dieser Tag kostet mich genug Nerven. Aber Norden wird mir jetzt schon gefällig sein. Diese Frühgeburt hat ihn ganz schön geschockt. Und er hat das Mädchen selbst hierhergebracht.«
»Hüte dich, Anna«, sagte Dr. Urban tonlos. »Geh nicht zu weit.«
»Misch du dich nicht mehr ein«, sagte sie scharf. »Ich bringe das Mädchen jetzt zur Leitner-Klinik. Niemand kann mir etwas nachsagen. Niemand, hörst du? Kümmere dich um die Mölnik. Sie ist ganz schön hysterisch.«
Seine Gedanken arbeiteten fieberhaft, als sie mit dem Korb, in dem ein Baby schlummerte, hinausging.
»Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht«, murmelte er, »und es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch an das Licht der Sonnen.«
Und da stand Hilde Roth vor ihm. Lautlos war sie aus ihrem Zimmer gekommen. Entsetzt starrte er sie an.
»Ich will hier weg, Dr. Urban«, flüsterte sie angstvoll. »Ich habe Angst. Bitte, helfen Sie mir.«
Er nickte stumm und ergriff ihre Hand, die eiskalt war, und dann redete er leise auf sie ein.
Es war fast elf Uhr, als Anna mit dem Baby in der Leitner-Klinik erschien. Dr. Norden wartete in der Halle.
»Das ist aber wirklich ein kräftiges Baby«, sagte er irritiert.
»Es wird Sandra über den Schock hinweghelfen«, erklärte Anna Renz. »Ich kann mich nicht aufhalten, Dr. Urban ist ziemlich durcheinander. Sie werden das bestätigen können, falls es Schwierigkeiten geben sollte. Was Christel Jakob anbetrifft, sollten wir uns noch einmal unterhalten.«
Das klang sehr nach einer versteckten Warnung, vielleicht sogar Drohung, und Dr. Norden hatte auch das unbehagliche Gefühl, daß er sich da etwas eingebrockt hatte, was ihm ganz hübsch zu schaffen machen würde. Aber er mußte erst einmal mit Christel sprechen. Vielleicht konnte sie eine Erklärung geben, wie es zu dieser Frühgeburt gekommen war.
Anna Renz hatte sich schnell wieder entfernt. Nun betrachteten Dr. Leitner und Dr. Norden das Baby, das sie gebracht hatte.
»Merkwürdig«, sagte Dr. Leitner, »das Baby ist nicht erst ein paar Stunden alt.«
»Was meinst du?« fragte Daniel heiser.
»Schätzungsweise zwölf bis vierzehn Stunden, aber sie können doch nicht so lange auf die Nachgeburt gewartet haben, dann wäre diese junge Frau nicht mehr am Leben.«
»Es gibt ungewöhnliche Fälle«, sagte Daniel. »Es kann doch möglich sein, daß diese starke Blutung erst später einsetzte. Mit rechten Dingen geht es in diesem Heim nicht zu, Schorsch, davon bin ich jetzt überzeugt. Aber mit Christel habe ich mir anscheinend auch etwas eingebrockt.«
»Du wirst dich wundern«, sagte Schorsch. »Sprich mal mit ihr. Ich werde mich jetzt um Sandra Trento kümmern. Mit dem Baby ist alles in Ordnung. Da gibt es nichts auszusetzen. Gedanken können wir uns später machen.«
Christel lag in einem kleinen Zimmer. Ein anderes war nicht mehr frei gewesen, und Dr. Leitner war auch interessiert, daß sie allein blieb und nicht den neugierigen Fragen einer Mitpatientin ausgesetzt wurde.
Sie war schon wieder in einer erstaunlich guten Verfassung. Und sie schien noch gar nicht zu begreifen, daß etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war.
»Ich wußte nicht, daß alles so schnell gehen würde«, sagte sie. »Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich allein gewesen wäre.«
»Haben Sie sich irgendwie aufgeregt, Christel?« fragte Dr. Norden behutsam.
»Nein, gar nicht. Ich hatte nur so ein komisches Ziehen, und Frau Renz hat gesagt, daß das die Senkwehen wären. Die spüre man schon im siebten Monat. Aber sie hat mir noch eine Spritze gegeben, damit die Schmerzen nicht zu stark würden.«
»Ein Spritze?« fragte er verwundert.
»Ja, das habe ich Dr. Leitner auch schon gesagt. Zuerst habe ich mich dann auch ganz wohl gefühlt, aber dann wurden die Schmerzen plötzlich ganz stark, und mir wurde so komisch. Dann kam Frau Renz, und alles ging ganz schnell. Aber die Hauptsache ist doch, daß mein Baby lebt.«
»Ja, das ist die Hauptsache, Christel«, erwiderte Dr. Norden gedankenvoll.
»Und mir geht es ganz gut. Ich bin nur müde.«
»Dann schlafen Sie. Schlafen Sie sich richtig aus. Für das Baby wird schon gesorgt. Wie soll Ihre Tochter denn heißen?«
»Daniela. Es ist ein schöner Name, und ich habe Ihnen doch so viel zu verdanken. Wer hätte sich denn schon um mich gekümmert, wenn ich allein in meinem Zimmer gewesen wäre.«
Ein Frösteln kroch Daniel über den Rücken. Sie war ihm noch dankbar, und dabei konnte er sich nicht davon freimachen, daß er sie einer Gefahr ausgesetzt hatte.
*
Dr. Leitner verschränkte die Arme über der Brust. »Nun, was sagst du dazu, Daniel? Das ist doch interessant. Die Renz gab Christel eine Spritze, die die Wehen in Gang setzte. Sie hat sich dabei etwas gedacht.«
»Etwas Fürchterliches«, sagte Daniel heiser. »Wahrscheinlich rechnete sie damit, daß das Kind nicht lebensfähig sein würde, um es mir dann anzuhängen, daß ich Christels Zustand nicht richtig beurteilt habe.«
»Sie kann dir jetzt nichts mehr anhängen«, sagte Schorsch. »Sie wird sich hüten, den Mund aufzutun. Wir haben uns mit einer ganz widerlichen Geschichte zu befassen. Erzähle mir, wie du auf diese Idee mit Christel gekommen bist. Ich fürchte, du hast da in ein Wespennest gestochen.«
»Das fürchte ich auch«, sagte Daniel, aber er ahnte nicht, was sich nun in dem Entbindungsheim Miranda abspielte.
Schwester Bernadette kam Anna Renz, aufgeregt mit den Armen fuchtelnd, entgegen. In Worten konnte sie sich ja nicht ausdrücken, aber Anna hatte gelernt, ihre Gesten zu deuten.
Schnell begriff sie, daß sich hier etwas abgespielt hatte, was sie Kopf und Kragen kosten konnte. Hilde Roth war verschwunden, auch das Baby, das Sandra zur Welt gebracht hatte. Und auch Dr. Urban war nicht mehr anwesend.
Schwester Bernadette machte ihr begreiflich, daß sie bei Cornelia Mölnik gewesen sei, daß sie sich auf Befehl von Dr. Urban dorthin begeben hätte.
Anna Renz war einem Tobsuchtsanfall nahe. Mit zitternden Fingern wählte sie Dr. Urbans Nummer, aber es meldete sich niemand. Sie stieß wilde Flüche aus, die Bernadette glücklicherweise nicht verstehen konnte. Dann stürzte sie hinaus zu ihrem Wagen und fuhr zu Dr. Urbans Haus.
Sie läutete Sturm, und endlich wurde die Tür geöffnet. Mit verschlafenem Gesicht stand Sepp vor ihr.
»Wo ist Urban?« fauchte sie ihn an.
»Weiß ich nicht. Er ist doch vorhin zu dir gefahren«, erwiderte Sepp gereizt. »Warum läutest du Sturm?«
»Weil sich niemand am Telefon gemeldet hat, du Depp!« schrie sie ihn an.
»Sag nicht noch mal Depp zu mir«, sagte er wütend.
»Bei mir ist die Hölle los. Du mußt mir helfen«, lenkte sie ein. »Die Roth ist verschwunden, das Baby und Urban auch.«
»Warum?« fragte er töricht.
»Warum, warum, das weiß ich doch nicht. Heute ist alles schiefgegangen, aber wenn Norden mir das eingebrockt hat, wird er es büßen.«
Sepp kniff die Augen zusammen. »Du hast es auf die Spitze getrieben, Mama«, stieß er hervor. »Du hältst dich für superschlau, und wir sind alle Deppen. Du hast doch genug Geld gemacht. Du hättest längst Schluß machen können, anstatt dich mit diesen Mädchen und diesen widerlichen kleinen Schreihälsen herumzuärgern.«
»Du Klugschnack«, sagte sie böse. »Komm jetzt mit. Es ist noch nichts verloren. Ich halte niemanden fest. Jeder kann das Haus verlassen, wann er will, ob mit oder ohne Kind. Auf eigene Verantwortung freilich. Bernadette kann nichts sagen. Die drei Mädchen werden wir morgen früh heimschicken. Ich bin krank, das mußt du ihnen erklären. Und dann fahren wir weg. Soll Urban es ausbaden. Los, zieh dich an!«
Verdrossen folgte er diesem Befehl. Wenig später lag dieses Haus im dichten Dunkel.
*
»Sollte man nicht die Polizei einschalten?« fragte Fee, nachdem sie von ihrem Mann erfahren hatte, was geschehen war.
»Was soll ich vorbringen? Die Renz hat sich nicht widersetzt, als wir die beiden Mädchen in die Klinik brachten. Augenblicklich ist ihr gar nichts zu beweisen. Die Polizeibeamten würden ein erstklassig eingerichtetes Heim vorfinden und eine Frau, die auf alles vorbereitet ist, Fee. Sie ist verdammt schlau. Sandra Trento kann sich noch nicht äußern. Christel ist sogar überzeugt, daß das Bestmögliche für sie getan würde. Dr. Urban hatte einen solchen Schock, den er auch morgen noch nicht überwunden haben wird. Ihm kann ich doch nichts nachsagen. Er hat mich um Hilfe gebeten und die Renz auch.«
»Aber die Sache mit dem Baby«, wandte Fee ein. »Wenn man die Säuglinge nun vertauscht hat?«
»Dann wissen wir, wo wir einhaken können, und die Renz muß dafür geradestehen. Aber zuerst muß Sandra Trento gehört werden. Augenblicklich ist sie genauso in Sicherheit wie Christel Jakob. Und morgen früh werde ich Elisabeth Roth anrufen.«
»Heute früh«, berichtigte ihn Fee. »Es ist Mitternacht längst vorbei, Daniel. Aber vielleicht solltest du doch noch in dem Entbindungsheim anrufen.«
»Und was soll ich sagen?« fragte er müde.
»Du könntest dich ja nach Dr. Urbans Befinden erkundigen«, meinte Fee.
»Na schön«, sagte er.
Anna Renz meldete sich schnell. Daniel fragte, ob Dr. Urban den Schock überstanden hätte.
»Ja, recht gut«, erwiderte sie. »Er schläft. Es war natürlich aufregend. Er ist einfach zu alt. Wir sollten uns doch einmal unterhalten, ob wir nicht zusammenarbeiten können, Herr Dr. Norden. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre freundliche Hilfe.«
»Man kommt ihr nicht bei«, sagte Daniel seufzend. »Sie ist die Ruhe selbst. Jetzt sollten wir uns auch Ruhe gönnen, Fee.«
*
Dr. Norden hatte unruhig geschlafen, aber sein erster Gedanke am nächsten Morgen war, Elisabeth Roth anzurufen. Es war zwar erst sieben Uhr vorbei, aber da sie ja berufstätig war, mußte sie auch früh aufstehen.
Sie war sehr überrascht, als er sein Anliegen vorbrachte, daß sie doch nochmals versuchen möchte, ihre Schwester zu sprechen.
»Versuchen kann ich es ja, Herr Doktor«, meinte sie, »aber man hat mich einmal nicht hereingelassen, und das wird man wohl auch das zweite Mal nicht tun.«
»Sagen Sie doch, sie müßten Hilde in einer dringenden Erbschaftsangelegenheit sprechen, die keinen Aufschub duldet.«
»Ich versuche es«, versprach Elisabeth. »Zeit habe ich mehr als genug, denn wie erwartet habe ich meine Kündigung bekommen. Aber ich gehe vor das Arbeitsgericht.«
»Das ist recht«, erwiderte Daniel. »Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich an mich.«
Elisabeth war gegen neun Uhr beim Entbindungsheim. Sie läutete, nannte ihren Namen, und die Tür tat sich ihr auf. Sie war so überrascht, daß sie nur zögernd auf das Haus zuging.
Anna Renz hatte inzwischen ihre Entscheidungen getroffen, andere als jene, die sie impulsiv in der Nacht getroffen hatte.
Mit seinem primitiven Verstand, der aber einer gewissen Logik nicht entbehrte, hatte Sepp sie zu ganz nüchternen Überlegungen veranlaßt.
Sie begrüßte Elisabeth freundlich. »Fräulein Roth, Sie wollen Ihre Schwester besuchen?« fragte sie.
»Ja, das möchte ich«, erwiderte Elisabeth.
»Sie hat gestern das Haus verlassen.«
»Hilde ist nicht mehr hier?« fragte Elisabeth erstaunt.
»Nein, sie hat es sich anders überlegt. Ich konnte sie selbstverständlich nicht zurückhalten. Sie müssen verstehen, daß ich nur gut zureden kann. Ich zwinge niemanden, von seiner Entscheidung abzugehen. Ich nehme hier keine Abtreibungen vor, aber Ihre Schwester scheint sich zu einer solchen entschlossen zu haben. Ich finde solchen Entschluß immer bedauerlich, da man später Reue darüber empfinden kann. Übrigens hat sie noch einige Sachen vergessen, die Sie gern mitnehmen können.«
»Sie wissen aber nicht, wohin Hilde gegangen ist?« fragte Elisabeth.
»Nein. Ich hatte keine Veranlassung, sie zu fragen.«
»Wie war ihre seelische Verfassung?« fragte Elisabeth.
»Sehr gut. Es hat sie anscheinend schockiert, daß ich mich nicht zu einer Abtreibung bereit fand. Aber so etwas überlasse ich lieber den Ärzten. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß meine Schützlinge sehr glücklich waren, wenn sie ihr Kind dann im Arm halten konnten.«
»Alle? Waren sie alle glücklich?« fragte Elisabeth nachdenklich.
»Nun, einige haben ihre Kinder schon zur Adoption freigegeben. Aber die hatten dann doch die Genugtuung, eine andere Frau glücklich gemacht zu haben. Ich kann versichern, daß man da weit weniger Gewissensbisse hat. Es tut mir sehr leid, wenn Ihre Schwester doch anders dachte. Ich hatte eigentlich einen sehr guten Eindruck von ihr.«
Eins war Elisabeth klar. Dieser Frau war sie nicht gewachsen. Sie schien unangreifbar wie eine Festung. Elisabeth blieb nichts anderes übrig, als wieder zu gehen, von Unruhe erfüllt und von geheimer Angst getrieben, daß Hilde sich etwas angetan haben könnte.
Als sie zur Autobushaltestelle ging, kam ihr ein Wagen entgegen. Sie konnte die Insassen nicht deutlich erkennen, aber ihr schien es so, als wäre es dieses Ehepaar, dem sie neulich begegnet war. Sie blieb stehen und blickte dem Wagen nach. Er hielt vor dem Entbindungsheim. Die Frau stieg aus und läutete. Langsam ging Elisabeth zurück und versteckte sich hinter einem dichten Strauch.
Nun stieg auch der Mann aus, aber er ging nicht ins Haus. Minuten vergingen. Elisabeth kamen sie endlos vor, aber sie verharrte in ihrem Versteck.
Dann kam die Frau wieder heraus. Mit einem lauten Aufschluchzen sank sie dem Mann in die Arme. »Es war wieder vergeblich«, hörte Elisabeth sie sagen. »Das Kind ist tot geboren. Sie kann uns keine Zusage mehr machen. Nicht für die nächsten Monate.«
»Beruhige dich, Jane«, sagte der Mann. »Es ist wohl besser so. Ich hatte ein ungutes Gefühl.« Und was er dann noch sagte, konnte Elisabeth nicht mehr verstehen, denn sie hatten den Wagen bestiegen, der dann auch schnell davonfuhr.
Sie lief im Eilschritt zu dem Autobus, den sie gerade noch erreichte, und als sie wieder bei Atem war, ging es ihr durch den Sinn, daß sie Dr. Norden berichten mußte, was sie gehört hatte.
*
Dr. Norden war um diese Zeit schon in Aufregung versetzt worden. Er hatte gerade seine Praxis betreten, als Loni ihm aufgeregt sagte, er möge schleunigst zur Leitner-Klinik kommen.
Mit sorgenvollen Gedanken fuhr er auch sofort dorthin. Wenn bloß nichts mit Christel ist, dachte er.
Aber Christel schlummerte selig und süß. Sandra dagegen war schon kurz vor sieben Uhr erwacht.
Ihr erster Gedanke, obgleich sie noch benommen war, galt ihrem Kind. »Ich möchte mein Baby sehen«, sagte sie, bevor sie noch begriff, daß sie nicht mehr in dem Entbindungsheim Miranda war. Dessen wurde sie sich erst bewußt, als Schwester Marlies sagte, sie müsse erst Dr. Leitner holen.
»Wieso Dr. Leitner?« fragte Sandra. »Ist Dr. Urban nicht da?«
»Dr. Leitner wird es Ihnen erklären«, erwiderte Schwester Marlies diplomatisch.
Als Dr. Leitner kam, waren Sandras Nerven zum Zerreißen gespannt.
»Wo bin ich hier?« fragte sie erregt.
»In meiner Klinik«, erwiderte er ruhig. »Es ergaben sich einige Komplikationen bei der Geburt. Deshalb wurden Sie hergebracht.«
»Ich verstehe das nicht«, murmelte sie. »Was ist mit meinem Kind?«
»Sie können es gleich sehen«, erwiderte Dr. Leitner bedächtig. »Es ist eine hübsche, gesunde kleine Tochter.«
»Eine Tochter?« schrie sie auf. »Aber er hat doch gesagt, daß es ein Junge ist, ein prächtiger Junge. Ich habe es genau gehört.«
»Vielleicht haben Sie geträumt«, sagte Dr. Leitner. »Haben Sie sich einen Jungen gewünscht?«
»Götz hat sich einen Sohn gewünscht«, flüsterte sie. »Dann wird alles gut, hat er gesagt. Ich habe einen Sohn geboren. Ich habe nicht geträumt.«
Dr. Leitner setzte sich zu ihr und griff nach ihren Händen. »Frau Renz hat uns Ihr Baby gebracht«, sagte er sanft. »Es ist ein ganz besonders hübsches Mädchen. Sie werden sich freuen, wenn Sie es sehen.«
Sie entzog ihm ihre Hände. »Nein, nein«, rief sie abwehrend, »das kann nicht wahr sein. Dr. Urban hat gesagt, daß es ein Junge ist. Ich habe es deutlich gehört. Ein prächtiger Junge.«
»Sie dürfen sich jetzt nicht aufregen. Ich habe es schon manchmal erlebt, daß eine junge Mutter enttäuscht war, wenn sie statt eines Sohnes eine Tochter in den Arm gelegt bekam. Regen Sie sich jetzt nicht auf. Freuen Sie sich, daß Sie leben.«
Sandra schloß die Augen. »Ich könnte reich werden, wenn es ein Junge wird, hat sie gesagt«, murmelte sie. »Aber ich gebe mein Kind nicht her. Ich nicht. Ich bin mit Götz verheiratet. Sie war erschrocken, als ich es ihr sagte. Ich will mein Kind, meinen Sohn.«
Dann schwand ihr Bewußtsein, und Dr. Leitner war darüber sogar erleichtert. Er läutete nach der Schwester. »Eine Infusion«, sagte er.
Sie brachte die Flasche. »Dr. Norden wartet«, erklärte sie.
»Er soll hereinkommen«, sagte Dr. Leitner.
Und während er die Kanüle mit dem Schlauch verband, erklärte er Daniel Norden, was Sandra Trento eben gesagt hatte.
»Sie sagte, daß sie verheiratet sei«, erklärte er zum Schluß. »Mit einem Mann, der Götz heißt.«
»Götz von Hellbrink«, sagte Daniel staunend. »Sie hat gesagt, daß sie mit ihm verheiratet ist?«
»Genau das, und sie behauptet so bestimmt, daß sie einen Sohn zur Welt gebracht hat, daß ich es in Anbetracht der Umstände glaube. Da sind wir in eine merkwürdige Geschichte hineingeraten, Daniel.«
»Ich habe dich hineingezogen«, sagte Daniel beklommen.
Schorsch legte ihm die Hand auf die Schulter. »Wir werden in manches hineingetrieben, Daniel«, sagte er nachdenklich. »Das haben wir schon oft genug erfahren.«
Und dieser Überzeugung war Daniel dann auch, als Elisabeth Roth in seiner Praxis auf ihn wartete.
*
Wo Dr. Urban und Hilde sich aufhielten, wußte niemand, und daß sie das Baby bei sich hatten, ahnte nur Anna Renz. Allerdings mußte man jedoch sagen, daß auch sie nicht genau wußte, was geschehen war und ob sie zusammen waren. Anna glaubte, daß Hilde die Gelegenheit genutzt hatte, das Haus zu verlassen. Hilde war ihr schon während der letzten Tage ziemlich eigenartig erschienen. Daß sie das Baby mitgenommen hatte, glaubte Anna nicht, und Hilde wäre auf diesen Gedanken auch nicht gekommen.
Sie war bestürzt gewesen, als Dr. Urban das Baby in einen Korb legte und sie zur Eile trieb. Sie hatte Fragen gestellt, aber er hatte nur immer wieder »später« gesagt. Hilde hatte es sogar mit der Angst bekommen, als er sie dann in seinen Wagen drängte, denn er hatte auf sie einen sehr verwirrten Eindruck gemacht.
Aber als er dann den Wagen durch die Nacht steuerte, schwand ihre Angst. Er fuhr ganz konzentriert.
»Warum haben Sie das Baby mitgenommen?« fragte sie beklommen.
»Ich erkläre es Ihnen später«, erwiderte er.
»Wohin fahren Sie?« fragte Hilde weiter.
»An einen Ort, wo uns niemand finden wird.«
»Aber das Kind ist so winzig«, flüsterte sie.
»Ihm wird nichts geschehen. Säuglinge sind zäher, als man denkt«, erwiderte er. »Sandra wird uns dankbar sein, wenn sie ihr Kind wiederbekommt.«
»Sandra? Sie meinen, daß das Sandras Kind ist?« fragte Hilde atemlos.
»Ich meine es nicht, ich weiß es. Ich habe es in den Händen gehalten, und ich bin nicht blind. Es ist ein Junge, was Anna auch immer sagt.«
»Sandras Baby«, flüsterte Hilde.
»Sie kennen Sandra?« fragte Dr. Urban ruhig.
»Wir sind befreundet, aber ich hatte keine Ahnung, daß ich sie in diesem Heim wiedersehen würde.« Sie atmete jetzt schwer. »Wir haben zusammen gewohnt und in der Papierfabrik zusammen gearbeitet.«
»Weiß Anna, daß Sie befreundet sind?« fragte Dr. Urban.
»Nein. Wir haben uns nicht verraten.«
»Das ist gut«, sagte er erleichtert. »Sie wird sich jetzt den Kopf zerbrechen, wo das Baby ist und wo ich bin, aber von Ihnen wird sie annehmen, daß Sie ausgerissen sind.« Er lachte vor sich hin. »Sie meint, daß ich total verkalkt bin, aber sie täuscht sich. Ich kann immer noch klar denken. Ich habe Ihnen geholfen, Hilde, jetzt müssen Sie mir helfen. Wollen Sie das?«
»Ja.«
»Wir werden zu einem Bauernhof fahren. Sie werden sagen, daß es Ihr Kind ist. Alles andere können Sie mir überlassen. Sie tun das nicht für mich, sondern für Ihre Freundin Sandra, verstehen Sie. Sie würde sonst ihr Kind nie wiedersehen. Sie weiß vielleicht gar nicht, daß sie einen Sohn hat. Ich traue es Anna zu, daß sie die Nerven hat, ihr das Mädchen unterzuschieben.«
»Das Kind von Cornelia?« fragte Hilde bebend.
»Was wissen Sie davon?« fragte Dr. Urban.
»Ich weiß, daß sie gestern eine Tochter bekommen hat. Sie hat so geweint, und niemand ging zu ihr, und da bin ich in ihr Zimmer geschlichen. Sie hat mir alles gesagt.«
»Was hat sie gesagt?« fragte Dr. Urban.
»Daß ihr Kind weggegeben worden ist. Cornelia wollte es nicht, aber Frau Renz hat zu ihr gesagt, daß sie den Vertrag unterschrieben und schon sechs Monate im Heim gelebt hätte, ohne einen Pfennig zu bezahlen. Frau Renz hat zehntausend Mark von Cornelia verlangt, wenn sie das Kind behalten wollte, aber Cornelia hat kein Geld, und das wußte Frau Renz genau. Stimmt das wirklich, Dr. Urban?«
»Ja, es stimmt. Ich alter Narr habe Anna nur zu spät durchschaut. Sie ist ein raffiniertes Biest. Aber jetzt sind wir gleich da. Luise wird nicht viel fragen, wenn sie dabei bleiben, daß der Kleine Ihr Kind ist.«
»Ich bleibe dabei, Sie können sich darauf verlassen«, sagte Hilde.
»Warten Sie, bis ich mit Luise gesprochen habe«, sagte er eindringlich, als er den Wagen zum Stehen gebracht hatte.
Er ging auf das Haus zu, von dem nur die Umrisse in der Dunkelheit zu erkennen waren, aber bald wurde es hinter drei Fenstern hell.
Das Baby begann zu weinen, und Hilde beugte sich über den Korb. »Nicht weinen, Baby«, flüsterte sie. »Es wird ja alles gut.« Sie lauschte ihrer eigenen Stimme nach. Mit Verwunderung verspürte sie mütterliche Gefühle.
Ihre Hände umschlossen winzige Fingerchen.
Dann kam Dr. Urban zurück. »Es ist alles in Ordnung«, sagte er. »Luise wird sich um das Baby kümmern.«
Luise war eine stämmige, untersetzte Frau. Sie sah jetzt ein bißchen verschlafen aus, hatte aber doch frische rosige Wangen.
»Sie legen sich jetzt gleich hin«, sagte sie energisch zu Hilde. »Um das Kleine kümmere ich mich. Gottlieb, du schaust nach dem Mädchen.«
Mit Gottlieb war Dr. Urban gemeint, mit dem Mädchen Hilde.
In einem Zimmer, in dem es nach Kiefernholz roch und das mit Bauernmöbeln gemütlich eingerichtet war, sank die verwirrte Hilde in einen Lehnstuhl. Auch Dr. Urban setzte sich, nahm seine Brille ab und putzte sie umständlich.
»Luise ist eine Cousine von mir«, erklärte er. »Über Anna wollen wir kein Wort verlieren. Luise haßt sie wie die Pest, und Anna würde sich nicht hierher wagen. Sie sind also ganz sicher. Ich werde tun, was getan werden muß. Dann gebe ich Ihnen Nachricht.«
»Warum haben Sie das Baby mitgenommen? Warum haben Sie es nicht Sandra gebracht?«
»Es hätte die Gefahr bestanden, daß wir Anna in die Arme laufen. Sie ist zu allem fähig, das weiß ich jetzt. Es sind böse Dinge geschehen, aber denken Sie jetzt nicht darüber nach. Schlafen Sie.«
Er mußte sich auch ausruhen, bevor er zurückfuhr. Er fühlte sich schwach und elend, und als Luise zu ihm sagte, daß es besser gewesen wäre, wenn er sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt hätte, erwiderte er tonlos: »Ja, das wäre besser gewesen.«
*
Elisabeth machte sich Gedanken, wo Hilde sein könnte, Dr. Norden sorgte sich um Sandras Baby, denn nun konnte kaum noch ein Zweifel bestehen, daß ihr ein falsches Kind gegeben worden war.
Er beschloß, Anna Renz aufzusuchen, aber vorher wollte er sich noch bei den Hellbrinks erkundigen, ob sie Nachricht über den Verbleib ihres Sohnes bekommen hätten.
Freilich hielt er sich nicht für befugt, über Sandra zu sprechen, denn bis jetzt gab es noch keinen Beweis, daß sie mit Götz verheiratet war. Elisabeth schien von einer Heirat jedenfalls nichts zu wissen.
Leonore von Hellbrink zeigte sich erfreut über seinen Besuch. Sie schien sich erholt zu haben und erklärte auch sogleich lebhaft, daß sie Nachricht von Götz bekommen hätten, der mit einigen anderen Männern in die Hände von Aufständischen geraten war und lange Zeit krank gewesen sei.
»Es herrschen ja zeitweise schreckliche Zustände da drunten«, klagte sie, »und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte Götz nicht solchen Gefahren ausgesetzt werden dürfen. Aber in mancher Beziehung ist mein Mann unerbittlich. Es kann jedoch auch möglich sein, daß Götz selbst die Verbindung zu diesem Mädchen abbrechen wollte. Seine Familie bedeutet ihm zuviel, als daß er die Beziehungen zu uns gelöst hätte. Aber was stehle ich Ihnen die Zeit mit meinen Familienangelegenheiten.«
»Es freut mich, daß Sie sich nicht mehr um Ihren Sohn sorgen müssen, gnädige Frau«, sagte Dr. Norden höflich.
»Ich sorge mich immer noch, bis er wieder zu Hause ist.«
»Das wird hoffentlich bald sein«, klopfte Daniel vorsichtig auf den Busch.
»Ich denke in vierzehn Tagen. Sie werden dann schon dafür sorgen, daß Götz wieder ganz gesund wird.«
Daniel betrachtete sie forschend. Sie war eine schöne, noch jugendlich aussehende Frau. Wie würde es ihr wohl gefallen, Großmutter zu sein?
Aus irgendeinem Zimmer tönte nun eine erregte Stimme. »Das ist eine Frechheit, eine bodenlose Unverschämtheit. Das müssen Sie erst beweisen.«
Frau von Hellbrink zuckte zusammen. »Meine Tochter ist manchmal sehr unbeherrscht«, erklärte sie. »Sie scheint zu telefonieren.«
Aber dieses Gespräch schien beendet, denn mit zorniger Miene stürzte Carola von Hellbrink in das Zimmer, blieb aber wie versteinert stehen, als sie Dr. Norden gewahrte.
»Entschuldigung«, murmelte sie, »Mama, ich muß dringend mit dir sprechen.«
»Ich wollte mich ohnehin verabschieden«, sagte Dr. Norden. »Würden Sie es mich bitte wissen lassen, wenn Ihr Sohn zurück ist?«
»Ja, selbstverständlich«, erwiderte Leonore von Hellbrink.
Dr. Norden ging, aber es wäre höchst interessant für ihn gewesen, zu erfahren, warum sich Carola so aufregte und was sie ihrer Mutter nun berichtete.
»Da hat doch so eine Person angerufen und behauptet, sie würde ein Kind von Kurt bekommen, und sie könne es auch beweisen.«
»Vielleicht kann sie es beweisen«, sagte ihre Mutter kühl. »Ich halte nichts von diesem Fechner, das habe ich schon mehrmals gesagt. Aber diese Angelegenheit besprich mit deinem Vater.«
Aber es war nicht Hilde gewesen, die da angerufen hatte, sondern Anna Renz, die sich schon wieder mal etwas ausgedacht hatte, um sich dafür zu rächen, daß Hilde geflohen war. Es lag in ihrer Natur, ihrem Zorn damit Luft zu verschaffen, daß sie erschlichenes Vertrauen zum Schaden anderer ausspielte. Sie hatte sich, was die Hellbrinks anbetraf, noch mehr vorgenommen. Sie hatte schon wieder Oberwasser, weil sich der Tag so ruhig anließ, obgleich sie auf allerhand vorbereitet war.
Doch dann erschien Dr. Norden, und darauf war sie doch nicht vorbereitet gewesen. Sie zwang ein gequältes Lächeln um ihre Lippen.
»Nun sind wir ganz hübsch in Bedrängnis geraten«, begann sie mit einem bedeutungsvollen Unterton.
»Christel und ihrem Baby geht es gut«, erwiderte Daniel. »Es würde mich nur interessieren, was für eine Spritze Sie Christel gegeben haben.«
Ihre Augen verengten sich. »Spritze? Ich kann mich nicht erinnern.«
»Dann werde ich Ihrem durch die ereignisreiche Nacht anscheinend ermüdeten Gedächtnis ein bißchen auf die Sprünge helfen. Sie haben Christel eine Spritze gegeben, die die Wehen beschleunigte und zur Frühgeburt führte. Glücklicherweise entstanden Mutter und Kind keine Schäden.«
»Sie wollen also jegliche Verantwortung von sich abwälzen«, sagte sie empört.
»Was konnte ich eigentlich mehr tun, als die Patientin in ein Entbindungsheim zu bringen, in dem man doch auch mit Frühgeburten rechnen muß«, sagte Dr. Norden kühl. »Christel ist jedenfalls sehr froh darüber und macht niemandem einen Vorwurf.«
Annas Miene hellte sich auf. »Ich bin etwas nervös, verstehen Sie das bitte«, sagte sie.
»Das verstehe ich sehr gut. Wir werden jetzt über Sandra Trentos Baby sprechen. Besser gesagt, über Sandra von Hellbrinks Baby.«
Anna wurde bleich. »Aber ich habe es doch gebracht«, stotterte sie.
»Sie haben ein Mädchen gebracht, das mindestens zwölf Stunden vorher geboren war, Frau Renz. Sie können doch Ärzte nicht für dumm verkaufen.«
»Sie irren sich«, begehrte sie auf. »Es war sechs Stunden vorher geboren. Wir konnten nicht ahnen, daß die Nachgeburt so lange auf sich warten lassen würde. Dr. Urban hätte vorher etwas unternehmen müssen, aber er hielt mich hin. Ich habe den Fehler gemacht, daß ich ihm vertraute, das gebe ich zu, aber was Sie mir unterstellen wollen, ist infam.«
»Sandra hat einen Jungen zur Welt gebracht, und Sie haben uns ein Mädchen präsentiert.«
»Wer behauptet, daß sie einen Jungen zur Welt gebracht hat?«
»Sie selbst. Sie hat gehört, daß Dr. Urban sagte, es sei ein prächtiger Junge.«
»Das kann sie gar nicht gehört haben«, sagte Anna wegwerfend. »Wir mußten ihr einen Ätherrausch geben. Sie hat sich das nur eingebildet, weil sie sich einen Sohn wünschte, um die Familie Hellbrink versöhnlich zu stimmen.«
»Sie wußten also, daß sie mit Götz von Hellbrink verheiratet ist.«
»Sie sagte es. Den Trauschein hat sie mir nicht gezeigt. Sie ahnen nicht, welche phantastischen Lügen mir manchmal aufgetischt werden, Herr Dr. Norden. Ich glaube nur, was ich schwarz auf weiß sehe.«
»Kann ich Dr. Urban sprechen?« fragte er ablenkend.
»Sie können es versuchen. Vielleicht ist er zu Hause. Ich habe mich von ihm getrennt. Ich kann es mir nicht leisten, mich in Verruf bringen zu lassen.«
Man konnte sie wirklich nicht durchschauen. So raffiniert sie war, so kühl blieb sie auch jetzt.
»Sie können aber gern jedes Zimmer sehen, und Sie werden feststellen, daß es hier kein männliches Baby gibt«, sagte Anna spöttisch. »Sie können mit diesen netten jungen Damen sprechen, die mir voll vertrauen. Ich habe nichts zu verbergen.« Sie lachte auf. »Ich kann Sandra keinen Sohn herbeizaubern, wenn sie auch noch so gern einen haben möchte. Ich meine, sie sollte zufrieden sein, eine gesunde Tochter zu haben. Ich bestehe jetzt darauf, daß Sie sich hier umschauen, Herr Dr. Norden. Nicht ein einziges Baby ist derzeit im Hause.«
Und da er nicht wußte, was sich während der Nacht noch zugetragen hatte, war er unsicher geworden, als sie ihn durch die Räumlichkeiten geführt hatte. Allerdings sah er auch Cornelia Mölnik nicht. Sie war längst von Sepp in Dr. Urbans Haus gebracht worden.
Als Dr. Norden aber dort anläutete, erschien nur Sepp und erklärte ihm, daß Dr. Urban verreist sei. Und mit einem frechen Grinsen fügte er hinzu, daß ihn wohl das schlechte Gewissen weggetrieben hätte.
*
Dr. Norden machte nun seine Krankenbesuche. Schließlich war es wichtiger für ihn, sich um seine Patienten zu kümmern, als einem vagen Verdacht nachzugehen. Schlüssige Beweise gegen Anna Renz hatte er nicht, wenn auch sein Mißtrauen nicht ausgeräumt war.
Er konnte nicht wissen, nicht einmal ahnen, daß Dr. Urban inzwischen in der Leitner-Klinik darauf wartete, mit Dr. Leitner zu sprechen.
Er mußte sich gedulden. Dr. Leitner operierte. Schwester Marianne hatte Dr. Urban zum Chefzimmer geleitet und ihm ein Glas Wasser gebracht, um das er gebeten hatte.
Als sie nach einer Stunde in das Zimmer schaute, um ihm zu sagen, daß die Operation noch länger dauern würde, fand sie ihn zusammengesunken über dem Schreibtisch. Voller Entsetzen stellte sie fest, daß er tot war.
Unter diesem Schock wußte sie sich keinen anderen Rat, als Dr. Norden anzurufen.
Loni meldete sich. »Dr. Norden macht Krankenbesuche«, sagte sie. »Aber warten Sie einen Augenblick, ich glaube, er kommt gerade.«
Auch für Loni war es mal wieder ein aufregender Tag, denn Dr. Norden spurtete gleich wieder los, als Schwester Marianne ihm gesagt hatte, was sie eben entdeckt hatte.
Er konnte nur bestätigen, was Schwester Marianne festgestellt hatte. Dr. Urban war einem Herzschlag erlegen. Aber Dr. Norden entdeckte noch etwas. Dr. Urban hatte geschrieben, bevor er starb.
Sandra hat einen Sohn. Luise und Hil…
Doch nur bis dahin war er gekommen, dann hatten ihn die Kräfte verlassen. Jedenfalls schien er gespürt zu haben, daß es mit ihm zu Ende ging. Luise und Hil…, sollte das Hilde heißen? Dr. Norden überlegte. Hilfe oder Hilde, ging es ihm durch den Sinn. Aber wer war Luise?
Für Dr. Leitner war es nach der schweren Operation, die er hinter sich hatte, auch ein Schock, daß ein Toter aus seiner Frauenklinik abtransportiert werden mußte.
»Jetzt wirst du mir bald die Freundschaft kündigen«, sagte Daniel deprimiert.
»Schließlich wollte er mich aufsuchen und nicht dich«, erwiderte Schorsch Leitner. »Und er kam wegen Sandra. Er wollte mir sagen, daß sie einen Sohn zur Welt gebracht hat. Nun stellt sich uns die Frage, wer die Mutter des Mädchens ist und wo sich Sandras Sohn jetzt befindet.«
»Luise sollte wohl ein Hinweis sein, aber wer ist Luise?« fragte Daniel Norden. »Ich werde nochmals die Renz aufsuchen müssen.«
»Fang es mit aller Vorsicht an«, sagte Schorsch nachdenklich. »Warte ab, wie sie reagiert, wenn sie von Dr. Urbans Tod erfährt. Ich werde versuchen, Sandra zum Sprechen zu bringen.«
*
Fee Norden mußte an diesem Tag beim Mittagessen auf die Gesellschaft ihres Mannes verzichten. Er hatte sie nur kurz angerufen und ihr gesagt, daß er Krankenbesuche machen müsse, denn die wahren Gründe wollte er ihr lieber persönlich sagen.
Daniel traf Anna Renz beim Mittagessen an. Sie fragte ihn mit einem ironischen Lächeln, ob er sich nun auch überzeugen wolle, ob ihre Patientinnen ausreichend versorgt würden.
»Sie können gern mit mir essen, Herr Dr. Norden«, sagte sie anzüglich.
Aber ihr verging dann doch der Appetit, als er ihr berichtete, daß Dr. Urban gestorben sei.
»Er wollte Dr. Leitner aufsuchen, aber der war gerade bei einer schweren Operation«, erklärte er. »Er starb an einem Herzschlag, während er wartete.«
Er beobachtete Anna genau, während er dies sagte.
»Er hat nicht mehr mit Dr. Leitner gesprochen?« fragte sie rasch.
»Nein.« Er hörte, wie sie aufatmete. »Nun muß ich Sie fragen, ob er Verwandte hat«, fuhr er nach einem kurzen Schweigen fort.
»Es wird Sie vielleicht überraschen, aber ich bin seine Nichte.«
Dr. Norden gab nicht zu erkennen, daß er dies schon wußte. »Und sonst gibt es keine Verwandten mehr?« fragte er.
»Seine Cousine Luise«, erwiderte Anna. »Aber sie standen nicht mehr in Verbindung.«
»Sie muß aber benachrichtigt werden«, erwiderte Dr. Norden, der seine Überraschung zu verbergen verstand. »Wo wohnt sie?«
»Auf dem Land. Ich kann Ihnen die Adresse geben. Sie ist eine beschränkte alte Frau. Wir haben keinerlei Kontakt.«
»Und sonst hat er keine Verwandten?« fragte Dr. Norden gleichmütig.
»Nein. Anscheinend hatte er einen schnellen und leichten Tod. Seine Gesundheit hat mir sowieso schon Sorgen bereitet. Ich habe ja schon angedeutet, daß auf ihn kein Verlaß mehr war. Unsere Bekanntschaft begann wahrhaftig unter dramatischen Vorzeichen, Herr Dr. Norden, aber ich hoffe doch, daß Sie nun kein Mißtrauen mehr gegen mich hegen. Sie werden sich davon überzeugen können, daß mir niemand etwas nachsagen kann. Auch Sie als Arzt werden schon erfahren haben, wie schnell man ins Gerede kommen kann. Toten soll man nichts Schlechtes nachsagen, aber meine Nachsicht mit Onkel Gottlieb hätte mich doch arg in Schwierigkeiten bringen können. Ich will es ihm nicht mehr anlasten. Wenn Sie es übernehmen würden, Luise Urban zu benachrichtigen, wäre ich Ihnen dankbar. Sie war übrigens auch mal Hebamme, und sie hat es mir immer geneidet, daß ich in meinem Beruf erfolgreicher war als sie. Deshalb gibt es zwischen uns auch keine Verbindung mehr.«
Nur deshalb nicht? fragte sich Dr. Norden. Aber nun wußte er, wer Luise war und kannte ihre Adresse. Eine Überraschung löste die andere ab.
Telefon hatte Luise Urban nicht. Sie brauchte es nicht. Sollte er ihr telegraphisch den Tod ihres Cousins mitteilen? Aber anscheinend hatte sie ihm doch nähergestanden, als Anna Renz zugeben wollte, sonst hätte er wohl ihren Namen nicht aufgeschrieben.
Dr. Daniel Norden war so aus dem Gleichgewicht gebracht, daß er lieber doch erst mit seiner Frau sprechen wollte, die meist den richtigen Rat wußte. Aber als er nun endlich heimkam, wartete bereits die nächste Überraschung auf ihn in Gestalt von Elisabeth Roth, die vor Aufregung am ganzen Körper zitterte.
»Hilde ist bei einer Verwandten von Dr. Urban«, erklärte sie. »Sie hat mich angerufen. Sie hat gesagt, daß es bei Anna Renz nicht mit rechten Dingen zugehe. Und sie sorgt sich um Dr. Urban.«
»Mit Recht«, erwiderte Daniel dumpf. »Er ist an einem Herzschlag gestorben.«
»O Gott«, flüsterte Elisabeth.
»Hat Ihre Schwester etwas von einem Baby gesagt?« fragte Daniel.
»Nein, nur, daß sie bei Dr. Urbans Cousine ist und daß ich mich ihretwegen nicht sorgen müßte.«
»Bei Luise Urban?« fragte Dr. Norden.
»Ja, sie hat den Namen Luise erwähnt, mir aber keine Adresse gegeben.«
»Sie haben doch einen Führerschein«, sagte Dr. Norden.
»Ja, aber keinen Wagen.«
»Fee, würdest du Fräulein Roth deinen Wagen leihen?« fragte Daniel.
»Gern.«
»Dann fahren Sie zu dieser Adresse, Fräulein Roth. Bringen Sie Luise Urban schonend bei, daß ihr Cousin gestorben ist. Und reden Sie Ihrer Schwester eindringlich zu, alles zu sagen, was in der vergangenen Nacht im Entbindungsheim Miranda geschehen ist. Trauen Sie sich das zu?«
»Ja, gewiß. Ich möchte gern mit Hilde sprechen. Ich möchte auch wissen, wie es Sandra geht.«
»Ihr geht es soweit ganz gut«, erwiderte Dr. Norden. »Sie ist jetzt in der Frauenklinik von Dr. Leitner. Stimmt es, daß sie mit Götz von Hellbrink verheiratet ist?«
»Verheiratet? Nein, davon weiß ich nichts. Aber Sandra hat sich immer ausgeschwiegen, was Götz und sie anbetraf. Aber wenn sie tatsächlich heimlich geheiratet haben, warum wollte sie dann das Kind heimlich zur Welt bringen? Warum läßt er sie allein?«
»Er war eine Zeit verschollen. Die Familie hat jetzt erst wieder Nachricht von ihm. Er wird bald zurückkehren.«
»Auch zu Sandra?« fragte Elisabeth leise.
»Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn persönlich gar nicht. Aber jetzt kümmern Sie sich erst einmal um Ihre Schwester. Vielleicht weiß sie manches, was wir noch nicht wissen.«
Elisabeth sah Fee an. »Können Sie Ihren Wagen auch entbehren?« fragte sie verlegen.
»Aber sicher. Ich komme schon zurecht. Aber er hat manchmal seine Mucken. Man muß ihm dann gut zureden.«
»Ich werde versuchen, daß er auf mich hört«, erwiderte Elisabeth. »Vielen Dank einstweilen. Was würde ich nur ohne Ihre Hilfe machen!«
»Sie ist sehr nett«, sagte Fee, als Elisabeth davongefahren war. »Hoffentlich bekommt sie auch mal einen netten Mann.«
»Sie ist wählerisch«, sagte Daniel, »und fällt nicht auf schöne Worte oder Versprechungen herein.«
»Meinst du, daß Sandra auf solche hereingefallen ist?«
Er zuckte die Schultern. »Dazu kann ich mich nicht äußern. Ich kenne Götz von Hellbrink nicht. Aber wenn er so ist wie seine Schwester, war es sicher ein Reinfall. Jedenfalls ist Hilde Roth ganz gewiß an einen Filou geraten.«
»Und was hast du mit der Renz vor?«
»Ich habe überhaupt nichts mit ihr vor, mein Schatz. Wenn sich nicht jemand findet, der sich geschädigt fühlt, kann man ihr nichts anhaben.«
»Gar nichts?«
»Nein, gar nichts. Christel fühlt sich nicht geschädigt, und sie würde schon mir zuliebe den Mund halten. Wie Sandra reagiert, muß sich erst herausstellen. Wenn ihrem Sohn etwas geschehen ist, und sie ist felsenfest überzeugt, daß ihr Kind ein Sohn ist, kann ich mir vorstellen, daß sie die Renz zur Rechenschaft ziehen wird. Immerhin haben wir auch die schriftliche Aussage von Dr. Urban, daß es ein Sohn ist. Wir müssen jetzt abwarten. Es kommt jetzt auch auf Hilde Roth an.«
*
Hilde fühlte sich indessen bei Luise sehr wohl. Hier war Ruhe und Frieden. Luise war rauh, aber herzlich, doch mit dem Baby ging sie ganz behutsam um, und Hilde lernte schon, wie man mit einem so kleinen Wesen umgehen mußte.
»Sie haben wohl noch keinen Säuglingskursus mitgemacht?« fragte Luise, die ja meinte, daß Hilde die Mutter des Kindes sei.
Ihrem offenen, fragenden Blick wich Hilde aus. Sie hätte gern die Wahrheit gesagt, aber sie wollte Dr. Urban nicht in den Rücken fallen.
»Sie wollten das Kind wohl gar nicht haben«, sagte Luise, die ein feines Gespür für solche Situationen hatte.
»Nein, ich wollte kein Kind, aber jetzt denke ich anders.«
»Sie sind nicht verheiratet«, sagte Luise. »Hat der Kerl Sie sitzen lassen?«
»Ja. Ich war sehr naiv«, erwiderte Hilde.
»Da bist du nicht die einzige, Mädchen«, sagte Luise, unwillkürlich zum Du übergehend. »Aber manchmal kommt man besser ohne Mann aus. Schau, ich habe auch einen Buben zur Welt gebracht, und da war ich schon bedeutend älter als du, aber auch noch dumm und gutgläubig. Der Bursche wollte mich dann schon heiraten, aber ich hätte ihm alles überschreiben sollen. Da habe ich mir gedacht, daß es besser ist, wenn ich meinen Bastian allein aufziehe und er mal alles bekommt, was mir gehört. Er ist ein guter Junge geworden, hat einen feinen Gasthof und mag seine Mutter. Es hätte nur Ärger gegeben, wenn sich sein Vater hier breitgemacht hätte. Und du wirst den Kleinen auch allein aufziehen, Hilde. Wenn du nicht weißt, wo du bleiben sollst, hier kannst du bleiben. Dieses liebe Büble werden wir schon groß bringen.«
»Luise, ich muß Ihnen etwas sagen«, schluchzte Hilde auf. »Sie sind so gütig. Das ist nicht mein Kind. Ich erwarte erst eines. In sechs Monaten wird es soweit sein.«
»Es ist nicht dein Kind«, sagte Luise nachdenklich. »Warum hat mich der Gottlieb beschwindelt?«
»Dr. Urban war auch so gut zu mir. Er hat es überhaupt nur gut gemeint. Ich war bei Frau Renz im Entbindungsheim.«
»Bei der Anna, bei diesem Biest? Was hat sie wieder angerichtet, diese niederträchtige Person?«
»Es war eine schreckliche Nacht«, sagte Hilde leise. »Aber ich möchte lieber, daß Dr. Urban Ihnen alles erzählt.«
»Du redest jetzt. Der Gottlieb war ja eh’ durcheinander. Dem ist es durch und durch gegangen. Ich kenn’ ihn doch. Ich habe ihm immer gepredigt, daß er der Anna nicht helfen soll, aber weil ihm einmal Mutter und Kind unter den Händen gestorben sind, hat sie ihn in der Hand gehabt. Dabei hätt’ ihm niemand etwas anhaben können. Für Anna war es ein gefundenes Fressen. So schaut es aus bei denen. Gottlieb war ein guter Arzt. Er hat seinen Beruf geliebt, und seine Ehr’ ging ihm über alles. Dieses verdammte Weibsstück hat genau gewußt, wo er empfindlich zu treffen ist. Und jetzt redest, Madl, damit ich Bescheid weiß, wenn der Gottfried wiederkommt.«
Und da redete sich Hilde alles von der Seele, was sie bedrückte. Sie war froh, daß sie reden konnte, daß Luise zuhörte und ihr über die Wangen strich, wenn ihr immer wieder die Tränen kamen.
»Wird ja alles gut werden, Hilde«, sagte Luise, als das Mädchen aufweinend schloß. »Reg dich nimmer auf. Die Welt wird nicht untergehen darüber. Ich sag’s nochmals. Du kannst hierbleiben, und du wirst dich eines Tages freuen an deinem Kind. Kein Vater ist besser als ein schlechter.«
*
Inzwischen war Elisabeth bis zum Dorf gelangt, aber unweit des Gasthofes bockte Fee Nordens Wagen dann ganz rigoros, und sie brachte ihn kein Stück mehr weiter.
Die Tankstelle war noch weiter entfernt als der Gasthof. Also machte sie sich zu Fuß auf den Weg zu diesem.
Richtig einladend sah der aus, und es duftete verführerisch aus der Küche. Blitzsauber war die Gaststube, und der Wirt hinter dem Tresen war auch ein blitzsauberes Mannsbild.
Elisabeth war ganz verwirrt, als er sie so staunend anschaute.
»Der Wagen ist mir stehengeblieben«, sagte sie verlegen. »Meinen Sie, daß man bei der Tankstelle mal nachfragen könnte, ob was zu machen ist?«
»Freilich kann man das. Mein Freund ist der Besitzer. Er versteht es, mit Autos umzugehen. Wollen Sie gleich weiter?«
»Nein, ich wollte eine Frau Luise Urban aufsuchen«, sagte Elisabeth. »Aber dahin kann ich wohl zu Fuß gehen.«
»Zu meiner Mutter wollen S’?« fragte er staunend. »Ich bin Bastian Urban. Ja, was wollen S’ denn beim Mutterl?«
»Meine Schwester ist dort«, erwiderte Elisabeth stockend.
»Mei, o mei, was kann alles passieren, wenn man mal einen Tag nicht bei der Mutter gewesen ist«, sagte er. »Es ist noch ein ganz schönes Stückerl. Ich bring’ Sie hin, wenn Sie einen Augenblick warten, damit der Korbinian sich um die Gaststube kümmert. Und dann sagen wir auch gleich dem Berti Bescheid, daß er sich um Ihren Wagen kümmert. Recht so?«
»Sie brauchen sich meinetwegen aber nicht solche Mühe zu machen«, sagte Elisabeth.
»Ist doch keine Mühe, mach’ ich gern. Mutterl freut sich, wenn ich mich blicken lasse.«
Diesmal mochte es Luise nicht so ganz recht sein, noch dazu, weil er mit einer fremden jungen Dame kam.
Luise sah es vom Fenster aus. Sie war gerade dabei, dem Baby die Flasche zu geben.
»Hilde, schau mal raus«, sagte sie. »Mein Sohn kommt mit einem Mädchen. Das können wir jetzt nicht brauchen.«
So ganz wußte Hilde nicht, wie sie sich verhalten sollte, aber dann vernahm Luise einen Aufschrei. »Lis, mein Gott, Lis, wie kommst du hierher?«
Das Baby erschrak und begann zu weinen, und da lauschte Elisabeth erst einmal. Bastian aber auch.
»Es ist meine Schwester, Mutter Luise«, sagte Hilde erklärend. Bastian wußte nicht, was er denken sollte, aber wegschicken brauchte man ihn nun auch nicht mehr.
»Das Baby ist auch hier?« fragte Elisabeth.
»Hat der Gottlieb Sie geschickt?« fragte Luise rauh.
»Geschickt nicht«, erwiderte Elisabeth leise. »Dr. Norden meinte, daß ich Ihnen die Nachricht bringen soll. Keine gute Nachricht.«
»Man hat ihn doch nicht eingesperrt?« fragte Luise bestürzt.
»Nein. Dr. Urban ist gestorben«, erwiderte Elisabeth stockend.
Schweigen herrschte. Luise setzte sich. Sie hatte das Baby ins Körbchen gelegt. Es schlief nun wieder.
»Gott gebe ihm Frieden«, murmelte Luise. »Setzt euch. Willst auch bleiben, Bastian?«
»Wenn’s erlaubt ist.«
»Geh, red nicht so dumm daher, Bub! Wie ist die Elisabeth an dich geraten?«
Das war schnell erzählt, und dann mußte Elisabeth berichten, was sich in der Leitner-Klinik zugetragen hatte.
»Er wollte alles in Ordnung bringen«, sagte Luise gedankenvoll. »Er hatte genug. Nun kann Anna ihm auch nichts mehr anhaben. Bastian, du wirst dich kümmern, daß er ein anständiges Begräbnis bekommt. Hier auf unserem Friedhof soll er begraben werden. Aber Anna soll sich ja nicht blicken lassen.«
»Sie würde sich gar nicht hertrauen, Mutter«, meinte Bastian.
Elisabeth war aufgestanden und ging zu dem Babykörbchen. »Es ist Sandras Baby«, sagte sie leise. »Weißt du es, Hilde?«
»Ja. Frau Renz wollte es weggeben und…« Sie kam nicht weiter. Bastians Faust krachte auf den Tisch.
»So was kann Onkel Gottlieb doch nicht gutgeheißen haben«, sagte er zornig.
»Hat er doch auch nicht«, beschwichtigte ihn seine Mutter. »Was meinst, warum er das Baby hergebracht hat? Ausgeredet hat er sich ja nicht, aber Hilde hat mir inzwischen alles erzählt. Und ich werde dafür sorgen, daß Anna das Handwerk gelegt wird.«
»Sie haben Sandra ein anderes Baby gegeben, ein Mädchen«, sagte Elisabeth.
»Cornelias Tochter«, warf Hilde ein. »Sie wollte das Kind nicht mehr hergeben. Sie war ganz krank vor Kummer, und ich habe es dort einfach nicht mehr ausgehalten. Ich habe viel mitbekommen an diesem Tag und an diesem Abend, und dann hat mir Dr. Urban geholfen.«
»Und jetzt bleibt Hilde hier, bis sie ihr Kind hat, und meinetwegen später auch, wenn sie will«, sagte Luise energisch.
»Aber Sandra muß ihr Baby doch bekommen«, meinte Elisabeth.
»Das soll sie auch, aber es ist nicht gut, wenn das Würmchen so hin und her geschoben wird«, erklärte Luise. »Hier ist es gut aufgehoben. Elisabeth kann es ihr sagen. Es ist außerdem nicht gut für einen Säugling, wenn die Mutter nicht gut beisammen ist.«
»Meinst du nicht, daß das der Arzt entscheiden sollte, Mutter?« fragte Bastian.
Da hupte es draußen. »Das ist Berti, der bringt Ihren Wagen.« Bastian ging hinaus. Hilde sah ihre Schwester verblüfft an. »Du hast einen Wagen?«
»Frau Dr. Norden hat ihn mir geliehen.« Sie nahm Hilde in den Arm. »Es wird schon alles in Ordnung kommen«, sagte sie liebevoll. »Ich habe schon eine neue Stellung in Aussicht.«
»Sie haben dich auch entlassen?« fragte Hilde beklommen.
»Ich hätte da auch nicht mehr bleiben mögen, wenn ich Fechner jeden Tag hätte sehen müssen.«
»Mach mir ruhig Vorwürfe, ich habe sie verdient.«
»Was würde das jetzt noch nutzen?«
»Das meine ich auch«, mischte sich Luise ein. »Kein Mann ist besser als ein schlechter. – Na, was ist«, rief sie dann nach draußen, »warum kommt Berti nicht auch herein?«
Dann kam er schon, wohl gleichaltrig mit Bastian, ein bißchen größer, mit dichtem rostbraunen Haar, lustigen blauen Augen im sonnengebräunten Gesicht.
»Grüß Gott miteinand’«, sagte er. »Hast ja das Haus voll, Mutter Luise.«
»Ist mir schon recht, Berti. Aber der Bastian muß nach München fahren.«
»Ich habe schon von ihm gehört, daß Dr. Urban gestorben ist. Tut mir leid. Kann ich etwas tun?«
»Begraben werden wir ihn halt, was bleibt sonst noch zu tun«, sagte Luise. »Wird Korbinian zurechtkommen mit dem Gasthof?«
»Sixta kann ihm helfen«, sagte Bastian.
»Und wir helfen alle zusammen«, meinte Berti.
»Ich könnte ja auch etwas tun«, warf danach Hilde ein.
Es wurde noch eine Weile beratschlagt, dann meinte Bastian, daß sie jetzt doch nach München fahren sollten, damit alles schnell geregelt würde.
*
Ungeduldig warteten Daniel und Fee auf eine Nachricht von Elisabeth, aber dann stand sie selbst vor der Tür, und nicht allein.
Als sie Bastian Urban vorstellte, war Dr. Norden leicht irritiert, aber Elisabeth erklärte rasch, daß er der Sohn von Luise sei, und daß er sich um die Überführung Dr. Urbans in sein Heimatdorf kümmern wolle.
Dann aber wurde von Sandras Baby gesprochen. »Ich möchte es ihr selbst sagen«, erklärte Elisabeth. »Darf ich zu ihr?«
»Immerhin wird es Sandra beruhigen, daß ihr Kind in Sicherheit ist«, mischte sich Fee ein.
»Und bestens versorgt«, sagte Bastian. »Da können Sie sich ganz auf meine Mutter verlassen. Sie versteht sich darauf, Kinder richtig zu behandeln. Sie hat mich allein aufgezogen, und andere Kinder auch noch.«
»Das Baby hat die Strapazen gut überstanden?« fragte Fee.
»Sehr gut«, bestätigte Elisabeth. »Hat sich inzwischen etwas bei Frau Renz getan?«
»Ihr ist nicht beizukommen«, sagte Dr. Norden. »Wo kein Kläger, ist auch kein Richter.«
»Cornelia Mölnik will ihr Kind doch behalten«, sagte Elisabeth.
»Ich werde Anna den Marsch blasen«, sagte Bastian. »Verlieren wir also keine Zeit.«
Ihm war schon zuzutrauen, daß er den Worten schnell die Tat folgen lassen würde.
Daniel rief Schorsch Leitner an und fragte ihn, ob es zu verantworten sei, daß Elisabeth einen Besuch bei Sandra mache. Schorsch meinte, daß er vorher mit Fräulein Roth sprechen wolle.
Es kam nun einiges in Bewegung. Es war verständlich, daß Daniel, Fee und einige andere der Beteiligten voller Spannung auf den Fortgang der Ereignisse warteten.
Daß Götz von Hellbrink an diesem Abend vergeblich an der Wohnungstür läutete, hinter der er Sandra vermutete, wußte jedoch niemand. Frau Zeller war ausnahmsweise einmal bei einer Bekannten eingeladen.
Götz fuhr deprimiert zu seinem Elternhaus, noch gezeichnet von den Strapazen, die er erdulden mußte.
Bei den Hellbrinks herrschte Kampfstimmung. Carola hatte mit ihrem Vater über den Anruf gesprochen. Ulrich von Hellbrink wiederum hatte Kurt Fechner in die Zange genommen, denn gewisse Ahnungen waren ihm nun zur Gewißheit geworden. Auf Klatsch gab er nicht viel, aber so mancher Klatsch war doch an seine Ohren gedrungen, den er nun nicht mehr mit einer Handbewegung abtat.
Fechner hatte eine schlimme Stunde durchlebt. Und nun hatte Ulrich von Hellbrink seiner Tochter erklärt, daß eine Verbindung mit Fechner überhaupt nicht in Frage käme.
»Ich habe ihn entlassen«, erklärte er ohne Umschweife.
Carola war fassungslos. Sie wollte aufbegehren, aber ihr Vater schnitt ihr das Wort ab.
»Ich habe ihm auf den Kopf zugesagt, daß er ein Verhältnis mit Hilde Roth hatte und daß es Beweise gäbe, daß er der Vater ihres Kindes ist. Es hat ihn umgeworfen, mein liebes Kind. Ich habe mich lange genug von ihm an der Nase herumführen lassen. Ich habe drei tüchtige Sekretärinnen entlassen, weil ich seinen Einflüsterungen Gehör schenkte, und ich habe geduldet, daß er auch mit meiner Tochter ein Gspusi angefangen hat. Das Maß ist voll.«
»Das sind alles Intrigen, Papa«, heulte Carola los. »Das hat bestimmt diese Sandra ausgeheckt, weil sie Götz nicht bekommen hat. Das war doch eine Clique. Kurt muß mich heiraten.«
»Wieso muß er das? Meinst du nicht, daß du einen anständigen Mann findest?«
Carola schluchzte auf. »Ich bekomme auch ein Kind.«
Leonore von Hellbrink sank aufstöhnend in einen Sessel. Ihr Mann starrte Carola fassungslos an.
»Das ist stark«, sagte er heiser, »das ist zuviel. Dann heirate doch diesen verdammten Verführer, aber hier habt ihr nichts mehr verloren.«
»Sei nicht so hart, Ulrich«, flüsterte Leonore. »Bitte, laß uns vernünftig reden.«
»Vernünftig? Meine Tochter läßt sich mit diesem Filou ein, und ich soll vernünftig denken?«
»Du warst nicht dagegen«, stieß Carola hervor.
»Nicht dagegen, nicht dagegen«, polterte er, »ich bin halt noch von gestern. Ich kann es nicht glauben, daß man überhaupt keine Moralbegriffe mehr hat. Was habe ich da bloß großgezogen.«
Und mitten hinein in diesen dramatischen Höhepunkt platzte Götz.
Er hatte die erregten Stimmen schon vernommen. Das Hausmädchen Marie hatte ihm die Tür geöffnet und sich dann gleich wieder in die Küche begeben. Er stand nun in der Tür.
»Guten Abend«, sagte er.
Seine Mutter sprang auf und stürzte auf ihn zu, während sein Vater anscheinend an eine Halluzination glaubte.
»Götz, mein Junge!« rief Leonore aus, und in diesem Augenblick war alles andere für sie vergessen.
»Du bist wieder da«, sagte nun auch Ulrich von Hellbrink. »Gott sei Dank.«
»Es scheint hier noch andere Aufregungen zu geben«, sagte Götz. »Ihr wart ziemlich laut.«
»Wir wollen jetzt nicht darüber reden«, sagte sein Vater.
»Wir wollen zuerst über Sandra reden«, sagte Götz. »Was wißt ihr von ihr?«
»Ist dir das immer noch wichtig?« fragte sein Vater.
»Schließlich ist sie meine Frau.«
»Deine Frau?« Seine Eltern riefen es gleichzeitig, und Carola wich zur Tür zurück.
»Es soll keine Unklarheit mehr darüber herrschen«, sagte Götz. »Ich hätte schon damals keine Rücksicht auf euch nehmen sollen. Es war auch alles anders gedacht. Ich war länger fort, als vorauszusehen war. Inzwischen wird unser Kind bald zur Welt kommen, und ich weiß nicht, wo Sandra ist. In der Wohnung habe ich sie nicht angetroffen. Ihr werdet verstehen, daß es für mich von größter Wichtigkeit ist, sie zu finden.«
»Du hast sie geheiratet«, sagte sein Vater tonlos.
»Ja, ich habe sie geheiratet, ob es euch nun paßt oder nicht. Ich habe sie geheiratet, weil ich sie liebe, aber in diesen schrecklichen Monaten ist mir klar geworden, daß ich mir der Verantwortung nicht bewußt war, die man mit einer Heirat übernimmt. Sandra wollte nicht, daß es zu einem Bruch zwischen uns kommt. Sie dachte wohl auch, daß ihr versöhnlicher gestimmt seid, wenn ihr merkt, daß sie nicht auf den Namen und schon gar nicht auf Geld aus ist. Und ich dachte, daß ihr einsichtig werdet, wenn Carola ihren Willen durchsetzt und Fechner heiratet, doch was ich gehört habe, läßt darauf schließen, daß es dazu nicht kommt.«
»Das habe ich deiner Sandra zu verdanken«, sagte Carola aggressiv. »Sie hat üble Gerüchte in die Welt gesetzt, denen Papa glaubt.«
»Dafür wirst du dich bei Sandra entschuldigen«, sagte Götz gereizt.
»Bitte keinen Streit«, bat Leonore. »Es sind genug böse Worte gefallen, und wir müssen mit anderen Problemen fertig werden.« Sie zeigte sich in dieser Situation als die Stärkste und in erster Linie als Mutter. »Es sind Fehler von uns gemacht worden, aber auch von euch, und ich meine, daß wir versuchen, uns zu verständigen, damit nicht alles auseinanderbricht. Ich habe genug Angst um dich ausgestanden, Götz, und ich will auch nicht, daß Carola sich im Stich gelassen fühlt. Meinetwegen soll sie Fechner heiraten.«
»Aber sie wird dann damit auskommen müssen, was er herbeischafft«, sagte Ulrich von Hellbrink hart. »Ich mache keine Zugeständnisse.«
»Vielleicht bekomme ich gar kein Kind«, sagte Carola. »Ich habe das bloß gesagt.«
»Das ist ja das reinste Irrenhaus«, platzte Ulrich von Hellbrink heraus. »Komm, Götz, reden wir miteinander, bis sich deine Schwester besonnen hat, ob sie nun ein Kind kriegt oder nicht. Jedenfalls wird Fechner entlassen. Carola kann ihn ja fragen, ob er dann noch an ihr interessiert ist. Erpressen lasse ich mich nicht. Auch nicht mit einem imaginären Kind, das einen skrupellosen Vater und eine hirnlose Mutter hätte.«
Aufschluchzend fiel Carola ihrer Mutter um den Hals, als sie mit ihr allein war. »Es stimmt nicht, Mama«, flüsterte sie kläglich. »Kurt hat nur gesagt, daß Papa dann bestimmt nicht nein sagen würde.«
»Was bist du nur für ein törichtes Mädchen«, sagte Leonore.
»Aber er hat doch gesagt, daß man ihm was anhängen will und Sandra dahintersteckt. Sie ist mit den Roth-Schwestern befreundet. Ihr werdet schon noch erleben, daß alles von ihr eingefädelt worden ist.«
»Jedenfalls hat Götz sie geheiratet«, sagte Leonore leise, »und vielleicht sind wir im Unrecht. Götz hat sehr viel durchgemacht. Es ist ein bißchen viel auf uns eingestürmt. Wie wäre es, wenn du Fechner anrufen würdest, Carola?«
»Was soll ich denn sagen?«
»Daß dein Vater dich vor die Tür gesetzt hat und du bereit bist, mit ihm zu gehen.«
»Werft ihr mich hinaus?« fragte Carola tonlos.
»Aber nein. Wir können aber mal hören, wie Fechner sich dann verhält. Eine Probe aufs Exempel, Carola. Wenn er dich liebt, kann er das nun beweisen, und dann wird auch Papa versöhnlich gestimmt sein.«
»Dann rufe ich ihn jetzt an.«
Sie ging hinauf in ihr Zimmer, aber sie blieb nicht lange oben. Schwankend kam sie die Treppe herab, mit fahlem Gesicht und starrem Blick.
»Er hat gesagt, ich solle mich zum Teufel scheren, Mama«, flüsterte sie.
»Und daraus wirst du lernen, Carola«, sagte Leonore. »Er hat seine Maske fallen lassen. Meinst du nun immer noch, daß man euch mit Intrigen auseinanderbringen wollte?«
»Es ist so schwer, das zu verstehen.«
»Das wird Hilde Roth wohl auch denken. Ich glaube, wir haben allerhand gutzumachen, mein Kind.«
»Papa wird mir das nicht verzeihen.«
»Ach, denk das doch nicht. Er wird sich beruhigen. Er wird eine Zeit grollen, aber vielleicht sind wir bald Großeltern, und dann wird sich alles in Wohlgefallen auflösen. Wenn ich nur wüßte, wo sie ist.«
»Sandra?« fragte Carola.
»Wer denn sonst?«
»Warte doch erst, was Papa sagt.«
»Was meinst du, wie Götz zumute sein wird, wenn Sandra in eine Notlage geraten ist, auch durch unsere Mitschuld.«
Da fiel die Haustür ins Schloß, und gleich darauf kam Ulrich von Hellbrink mit düsterer Miene.
»Götz ist gegangen«, sagte er tonlos.
»Warum?« fragte Leonore erregt.
»Weil ich gesagt habe, daß es doch möglich sei, daß Sandra ihn auch nur mit dem Kind zur Heirat gezwungen haben könnte.«
»Das hat ja gerade noch gefehlt«, rief Leonore vorwurfsvoll aus, und dann lief sie hinaus. Aber Götz war nirgendwo zu sehen.
*
Elisabeth saß schon lange bei Sandra, und mit aller Behutsamkeit hatte sie ihr erklärt, was geschehen war und warum. Anfangs ungläubig hatte Sandra ihr gelauscht, aber als Elisabeth ihr beteuerte, daß es ihrem kleinen Sohn gutgehe, griff sie nach Elisabeths Hand. Tränen rollten über ihre Wangen, die Elisabeth sanft abtupfte.
»Dann habe ich wenigstens das Kind«, flüsterte sie. »Von Götz habe ich schon so lange nichts mehr gehört.«
»Vielleicht ist Post verlorengegangen«, sagte Elisabeth, die ihr keinen Schock zufügen wollte, denn ein solcher würde es sein, wenn Sandra erfuhr, daß Götz verschollen war. »Wir wollen froh sein, daß diese schreckliche Frau dir dein Kind nicht wegnehmen konnte, Sandra.«
»Ich habe meinen kleinen Götz noch nicht gesehen. Ich möchte ihn im Arm halten, Lis.«
»Das wirst du bald, er wird bestens versorgt. Sei jetzt nicht traurig. Es hätte viel schlimmer kommen können. Es ist schon spät, du mußt jetzt schlafen. Ich komme morgen wieder.«
Elisabeth dachte daran, daß Bastian noch zu ihr kommen wollte, wenn er mit Anna gesprochen hatte.
»Ich kann morgen auch zu den Hellbrinks gehen und ihnen alles sagen, Sandra«, murmelte sie.
»Nein, das nicht. Ich will nichts von ihnen. Wenn Götz sich für seine Familie entschieden hat, will ich ihn nicht mehr sehen. Dann wird er auch mein Kind nie zu sehen bekommen. Ich muß mir alles durch den Kopf gehen lassen, Lis.«
»Aber jetzt denkst du nur daran, daß du einen süßen kleinen Sohn hast. Luise Urban ist eine prächtige Frau.«
Regen strömte vom Himmel, als Elisabeth heimwärts lief.
Wie große Tränen perlte er über ihr Gesicht, als sie dann das Haus erreicht hatte und den Mann gewahrte, der vor der Tür stand. Aber es war nicht Bastian, es war Götz von Hellbrink.
Elisabeth starrte ihn an. Der Boden unter ihren Füßen schien zu schwanken.
»Herr von Hellbrink«, murmelte sie. »Sie sind hier?«
»Wo ist Sandra?« stieß er hervor. »Ich muß wissen, wo sie ist.«
Elisabeth nickte wortlos. Sie fuhr sich mit der Hand über die Augen. »Sie sind wirklich da«, sagte sie leise.
*
»Mir brauchst du keine Märchen aufzutischen, Anna«, sagte Bastian zur gleichen Zeit. »Du brauchst auch nicht Onkel Gottlieb alle Schuld zuzuschieben. Wir kennen dich.«
»Jetzt geht es wohl ums Erbe«, sagte sie höhnisch.
»Daran kannst nur du denken«, sagte er zornig. »Wir reden jetzt bayrisch miteinand, verstehst du! Ich war schon bei der Polizei. Sie werden dein feudales Entbindungsheim unter die Lupe nehmen. Sie werden schon herausfinden, wie viele Kinder für welche Summen du weggegeben hast. Damit wird ein für allemal Schluß gemacht. Wo ist Cornelia Mölnik?«
»Ich weiß nicht, wovon du redest«, zischte sie.
»Das weißt du sehr gut. Die Tochter, die sie geboren hat, ist in der Leitner-Klinik, aber der Sohn, den Sandra Trento geboren hat, Sandra von Hellbrink, wollte ich sagen, der ist bei uns. Und den bekommst du nicht.«
»Beweise solche Anschuldigungen erst mal«, sagte sie kalt. Es ging jetzt um alles. Sie mußte die Nerven bewahren.
»Onkel Gottlieb hat noch allerhand aufgeschrieben, bevor er gestorben ist«, fuhr Bastian sie an. »Und Hilde Roth hat manches zu sagen. Und dann ist da noch Elisabeth Roth, die gehört hat, wie die Amerikaner über den Preis gesprochen haben, den du für ein Kind verlangst.«
»Ich möchte nicht wissen, was Urban alles gequatscht hat, um sich reinzuwaschen. Mach, daß du wegkommst. Ich habe mit euch nichts zu schaffen.«
»Gelobt sei Gott dafür. Du wirst es verantworten müssen. Du kommst nicht mehr aus, Anna. Daß du es so schlimm treiben würdest, haben ja nicht mal wir gedacht.«
Und dann läutete es anhaltend. Annas Gesicht verzerrte sich, als Bastian die Tür aufriß.
»Nur herein, meine Herren. Vielen Dank, daß Sie so schnell gekommen sind. Das ist Anna Renz, Expertin für Babyhandel.«
»Staatlich geprüfte Hebamme und Leiterin dieses Entbindungsheimes«, kreischte Anna. »Mir ist nichts nachzuweisen, gar nichts!« Aber dann kam es zu einem dramatischen Höhepunkt, denn eine Stimme rief gellend um Hilfe und nur dürftig bekleidet kam eine weibliche Gestalt auf das Haus zugerannt.
»Ich will mein Kind wiederhaben, mein Kind… Diese Frau hat es mir weggenommen.«
Cornelia Mölnik hob flehend die Hände. »Ich will nur mein Kind wiederhaben«, schluchzte sie. »Ich heiße Cornelia Mölnik. Helfen Sie mir, bitte, helfen Sie mir.«
»Das Kind befindet sich in der Leitner-Klinik«, sagte Bastian beruhigend. »Nun steig mal herab von deinem hohen Roß, Anna.«
*
Elisabeth mußte lange warten, bis Bastian kam, und fast ebenso lange war Götz von Hellbrink schon in der Frauenklinik. Mit Sandra hatte er noch nicht sprechen können.
Dr. Leitner hatte ihr ein Beruhigungsmittel gegeben, und sie war eingeschlafen. Aber Götz konnte sie anschauen, und obgleich er todmüde war, nach all den Strapazen, die hinter ihm lagen, rührte er sich nicht von ihrem Bett.
Er konnte hören, wie Sandra im Traum flüsterte: »Ich liebe dich, Götz. Komm zurück, bitte, bitte, komm zurück.« Er konnte sich vorstellen, was sie gelitten hatte.
Ganz zaghaft griff er nach ihren Händen und hielt sie fest.
Als von fern her eine Kirchturmuhr Mitternacht schlug, öffneten sich Sandras Augen.
Sicher spürte sie seine Nähe mehr, als sie ihn sehen konnte im fahlen Licht der Nachtlampe.
»Götz«, flüsterte sie.
»Ich bin bei dir, Liebstes«, brachte er mühsam über die Lippen. »Ich bin wieder da.«
Und dann nahm er sie in die Arme, hielt sie fest umschlungen.
»Wir haben einen Sohn, Götz, mein Liebster.«
»Ja, ich weiß. Es wird alles gut, Sandra. Ich liebe dich.«
»Ich werde immer nur dich lieben, nur dich. Ich muß dir so viel sagen.«
»Pssst, mein Liebes, ich weiß fast alles. Ich habe mit Elisabeth gesprochen. Wir werden bald für immer zusammen sein, du, unser Kind und ich. Niemand wird uns trennen, ich schwöre es dir.«
Und als Dr. Leitner ins Zimmer blickte, ohne bemerkt zu werden, legte sich ein Lächeln um seinen Mund. Wenigstens dieses Kapitel konnte er als glücklich beendet abschließen.
Für ihn war es das wichtigste.
*
Weit nach Mitternacht war es, als Bastian an Elisabeths Tür läutete.
»Eigentlich ist es schon zu spät«, sagte er kleinlaut, »aber ich wußte nicht mehr, wohin ich gehen sollte.«
»Ich habe lange genug gewartet«, erklärte Elisabeth. »Ich habe mir schon große Sorgen gemacht, ob Sie nicht auch noch in eine Mördergrube geraten sind.«
»Ganz so schlimm scheint es nicht zu sein. Immerhin schlimm genug, aber das muß Anna ausbaden. Ich habe dafür gesorgt, daß Cornelia Mölnik noch in die Leitner-Klinik gebracht worden ist, damit sie endlich ihr Kind wiedersieht. Anna haben sie mitgenommen ins Untersuchungsgefängnis. Sepp hat sich aus dem Staub gemacht. Hätten Sie was Warmes zu trinken, Elisabeth? Es ist ein abscheuliches Wetter, aber der Stimmung angepaßt.«
»Tee mit Rum?« fragte sie.
»Gern.«
»Sie sehen recht mitgenommen aus.«
»Ist das ein Wunder? Anna ist ein zäher Brocken. Sie wird auch den Richtern das Leben schwer machen. Wie viele Frauen von dieser Sorte mag es wohl geben?«
»Meinen Sie, daß nur Frauen solcher Machenschaften fähig sind?« fragte sie nachdenklich. »Wenn es nicht Männer gäbe, die die Frauen nur als Amüsement betrachten, gäbe es keine unglücklichen Frauen, die in die Gefahr geraten, ein Kind weggeben zu müssen oder gar nicht erst zur Welt zu bringen.«
»Sie würden in solche Gefahr gar nicht erst kommen.«
»Woher wollen Sie das wissen, Bastian?«
»Ich brauch’ Sie nur anzuschauen, dann weiß ich es. Die Stadtleut’ haben halt schon keinen Riecher mehr. Ich würde umkommen in dem Trubel.«
Sie mußte lächeln. Ja, so gradheraus waren die Männer hier wirklich nicht mehr, und wenn Bastian Anna mit harten Worten titulierte, konnte sie es ihm auch nicht übelnehmen.
Er geriet dann ins Nachdenken. »Für die Hilde ist es schon gut, daß sie zu Mutter gekommen ist. Ist ja noch nicht alles verdorben, wenn sie den Lumpen vergessen kann. Gott hat mehr Liebe und Erbarmen, als je ein Mensch verschulden kann.«
Ganz ernst und besinnlich sagte er es, und Elisabeth sah ihn verwundert an.
»Meine Mutter hat den Spruch über ihrem Bett hängen«, sagte Bastian leise. »Schauen’s, Elisabeth, sie ist immer ein guter Mensch gewesen, und sie ist auch schmählich hintergangen worden.«
»Aber sie hat doch ein ganz großes Glück erlebt«, sagte Elisabeth verhalten. »Sie hat einen anständigen, tüchtigen, liebevollen Sohn.«
»Jetzt machen’s mich bloß nicht verlegen.«
»Was wahr ist, das muß wahr bleiben. Ich wünsche Hilde, daß sie auch einmal stolz auf ihr Kind sein kann.«
Er warf ihr einen langen Blick zu. »Ihnen wünsch’ ich viele Kinder, und gern tät ich der Vater sein, aber darüber können wir später mal reden, wenn Sie mögen, Elisabeth.«
Sie hatte ihm das Bett in Hildes Zimmer bereitet, und sie erlebte es, daß er ihr die Hand küßte, als er ihr müde eine gute Nacht wünschte. Das war bei einem solchen Naturburschen keine Höflichkeit, das war wirklich von Herzen kommend, und es zauberte ein glückliches Lächeln um Elisabeths Mund. Und auch ihr kam ein Spruch in den Sinn, der ihr einmal ins Poesiealbum geschrieben wurde. Kein Unglück ist zu groß, es hat ein Glück im Schoß! Und mit diesem Gedanken schlief sie nach dem aufregenden Tag ein, einem neuen entgegen, der schon angebrochen war.
*
Bei Dr. Norden klingelte schon früh das Telefon, als er noch mit Fee am Frühstückstisch saß.
Seufzend nahm er den Hörer ans Ohr. »Ach, du bist es, Schorsch. Erst mal guten Morgen. – Waaas? Dafür hättest du mich ruhig aus dem Bett holen können. Ich komme nachher vorbei. Ja, so bald wie möglich.«
Fee wartete gespannt darauf, zu erfahren, was Schorsch berichtet hatte. Und sie erfuhr, daß Götz von Hellbrink bei seiner jungen Frau weilte, und daß Cornelia Mölnik nun auch in der Leitner-Klinik war.
Grund genug zum Freuen war das schon, wenn auch manches andere noch ungeklärt war.
Daß in der Praxis schon zwei Polizeibeamte auf Daniel wartete, erfuhr sie zum Glück nicht. Loni war zwar maßlos aufgeregt, aber sie hatte doch die Nerven behalten und gesagt, daß Dr. Norden gleich kommen würde und daß sie ihn nicht erst anrufen müsse.
Ausfragen wollte man sie auch schon, was denn Dr. Norden mit der Frau Renz zu schaffen hätte.
»Ich weiß gar nicht, wer das ist«, erwiderte Loni.
»Sie haben noch nie was von dem Entbindungsheim Miranda gehört?«
»Gehört nicht, nur gelesen. Eine Annonce, aber was soll denn Dr. Norden damit zu tun haben?«
Und dann kam er, noch froh gestimmt über die guten Nachrichten, die Schorsch ihm mitgeteilt hatte.
Er bewahrte die Ruhe, als sich die Beamten vorstellten. Er bat sie in sein Sprechzimmer und warf Loni einen beruhigenden Blick zu.
Ja, freilich hätte er ein Mißtrauen gegen Frau Renz gehabt, aber er hätte ihr nichts nachweisen können, was ihn zu einer Anzeige berechtigt hätte, erklärte er, und daß er sehr genau Bescheid wisse, unter welchen Voraussetzungen eine Anzeige überhaupt entgegengenommen würde.
Frau Renz hätte ihn als Entlastungszeugen benannt, wurde ihm gesagt.
»Da muß ich passen«, erwiderte Daniel. »Entlasten kann ich sie nicht. Aber jetzt kann ich einige Frauen nennen, die meinen Verdacht bestätigen können.«
Man sagte ihm, daß Anna Renz nicht festgehalten werden könne, wenn keine stichfesten Anzeigen erstattet würden. Und man wollte auch wissen, was er über Dr. Urban sagen könnte.
»Nur, daß er alles getan hat, um das Schlimmste zu verhindern«, erklärte Dr. Norden.
»Ein Arzt kratzt dem andern nicht die Augen aus«, sagte der eine Beamte sarkastisch.
»Dr. Urban ist tot«, erwiderte Daniel ruhig. »Ich kann nicht beurteilen, ob er sich früher etwas zuschulden kommen ließ. Ich weiß nur, daß er ein Kind davor bewahrte, für eine Menge Geld verschachert zu werden, und daß er einer werdenden Mutter auf ihre Bitte half, aus dem Heim zu entkommen. Übrigens glaube ich nicht, daß Frau Renz ihm oder irgend jemandem sonst Einblick in ihre Abmachungen gestattet hat. Immerhin besteht dieses Entbindungsheim schon seit Jahren, und niemand hat sich bisher darum gekümmert, was dort vor sich geht. Auch nicht darum, was wohl doch in der Umgebung geredet wurde.«
Durch wen er darauf aufmerksam gemacht worden wäre, wurde er gefragt.
Er erteilte Auskunft, denn er konnte sicher sein, daß Elisabeth Roth kein Blatt vor den Mund nehmen würde.
Vorsichtshalber rief er sie aber doch rasch an, um sie darauf vorzubereiten, mit welch offiziellem Besuch sie rechnen müsse.
»Sie sollen nur kommen«, sagte Elisabeth.
*
»Wer kommt?« fragte Bastian, der sich gerade rasiert hatte.
»Die Polizei.«
»Nun werden Sie da auch noch reingezogen«, sagte er.
»Ich habe den Stein doch erst ins Rollen gebracht. Wußten Sie das nicht, Bastian?« fragte sie fast heiter.
»Nein, das wußte ich nicht.«
»Dann erfahren Sie es jetzt. Man wird sich allerdings wundern, wenn man Sie hier antrifft.«
»Soll ich verschwinden?«
»Es kommt darauf an, ob Sie sich noch mehr Schwierigkeiten einhandeln wollen.«
»Inwiefern?«
»Sie sind immerhin mit Anna Renz verwandt.«
»Erinnern Sie mich bitte nicht daran.«
»Andererseits sind Sie Luise Urbans Sohn, und sie hat meine Schwester aufgenommen, die wohl als eine Hauptbelastungszeugin gegen Anna Renz auftreten wird.«
»Wir haben noch immer jeder Gefahr ins Auge geblickt«, sagte er, ihr zublinzelnd. »Immerhin ist es für eine junge unverheiratete Frau peinlich, wenn ein unverheirateter Mann in ihrer Wohnung angetroffen wird.«
»Meinen Sie, es wäre weniger peinlich, wenn die Frau, wie auch der Mann, verheiratet wären?« fragte sie mit leisem Lachen.
»Sie wissen genau, was ich meine, Elisabeth. Ich will Sie nicht ins Gerede bringen.«
»Ich habe Ihnen Nachtasyl gewährt, sonst nichts«, erwiderte sie. »Übrigens tue ich nichts, was ich nicht auch verantworten kann. Aber der langen Rede kurzer Sinn, wir sitzen in einem Boot, Bastian.«
Er kam langsam auf sie zu. »Hoffentlich…« Er kam nicht weiter, denn es läutete.
»Na, dann«, sagte Elisabeth, aber in ihren Augen war keine Angst, sondern ein Lächeln.
*
»Sandra«, flüsterte Götz, der die ganze Nacht an Sandras Bett verbracht hatte.
Ihre kühle Hand strich über seine eingefallenen Wangen.
»Du bist so müde, Götz«, sagte Sandra. »Du siehst elend aus.«
»Es war eine elende Zeit ohne dich.«
»Warum hast du nicht mehr geschrieben?«
»Das erzähle ich dir später. Ich habe immer an dich gedacht. Immer nur an dich. Es hat mir Kraft gegeben, diese Zeit durchzustehen, Liebstes. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Du hast auch so viel durchgemacht.«
»Du bist so müde, Götz. Du mußt schlafen. Geh heim. Ich weiß jetzt, daß du wiederkommst.«
»Heim«, murmelte er. »Wir werden uns ein Heim schaffen, das nur uns gehört, Sandra. Eine Burg, die nur betreten darf, wer sich vor dir verneigt.«
»Liebster Götz«, sagte sie zärtlich, »so anspruchsvoll bin ich nicht. Ich wünsche mir nur, daß du immer zu mir zurückkommst. Und ich werde immer auf dich warten, zusammen mit unserem kleinen Götz. Ich möchte ihn endlich bei mir haben.«
»Ich werde ihn holen, Sandra.«
Sie blickte ihn aus verklärten Augen an. »Eigentlich ist es schön, wenn du ihn zuerst siehst, Götz. Ich wollte ihn dir schenken, als Beweis meiner Liebe. Sonst kann ich dir doch nicht viel geben.«
»Du selbst, ist das nichts?« fragte er. »Ich bin glücklich, daß wir einen Sohn haben, Sandra, aber ich bin noch viel glücklicher, daß ich dich nicht verloren habe.«
»Und ich bin glücklich, daß ich dich wiederhabe«, sagte sie. Ihre Lippen fanden sich zu einem langen, innigen Kuß. Ihre Herzen schlugen im gleichen Takt. Götz legte seine Hände um ihr Gesicht.
»Meine geliebte Frau«, sagte er zärtlich. »Bis zum Ende meines Lebens werde ich es dir danken, daß du nicht an mir gezweifelt hast.«
Hatte sie das nicht? Waren nicht schreckliche Zweifel in ihr gewesen, so schreckliche, daß sie selbst Anna Renz Glauben geschenkt hatte?
Sandra faltete die Hände, als Götz gegangen war. Herrgott, hilf mir, dachte sie. Götz darf nie erfahren, wie verzweifelt ich manchmal war. Aber geliebt habe ich ihn immer.
*
Leonore von Hellbrink atmete tief auf, als sie ihrem Sohn die Tür öffnete. Sie breitete ihre Arme aus, legte sie um seinen Hals. Sie weinte still in sich hinein.
»Ich habe Sandra gefunden, Mama«, flüsterte er. »Wir haben einen Sohn. Aber sonst habe ich nichts, womit ich Sandra Freude bereiten könnte. Gar nichts. Bitte, hilf mir.«
»Wo ist Sandra? Ich möchte zu ihr gehen. Ich möchte sie auch in Papas Namen um Verzeihung bitten.«
»Auch in Papas Namen?« fragte Götz.
»Er wird selbst mit dir sprechen, mein Junge, anders als gestern. Aber du mußt jetzt erst einmal schlafen.«
»Ja, schlafen, und dann muß ich unseren Sohn holen. Sandra ist in der Frauenklinik von Dr. Leitner. Sie hat sehr viel durchgemacht, Mama. Es darf ihr niemand mehr weh tun.«
»Es wird ihr niemand mehr weh tun. Ich verspreche es dir, Götz. Auch Papa denkt anders als früher.«
Sie brachte ihn zu seinem Zimmer, und er sank auf sein Bett. Sie zog ihm die Schuhe aus, aber das merkte er schon nicht mehr.
»Mein Sohn schläft«, sagte sie zu Marie. »Er darf nicht gestört werden. Ich habe seine Tür abgeschlossen. Ich muß jetzt etwas Wichtiges erledigen.«
Sie fuhr zur Leitner-Klinik, und da staunte man nicht schlecht, als sie ihren Namen nannte. Dr. Leitner mußte erst seine Zustimmung geben, bevor sie Sandras Zimmer betreten durfte.
Dann stand sie an Sandras Bett, und Sandra meinte zu träumen.
»Blumen und alles, was das Baby braucht, bekommst du später, Sandra«, sagte Leonore von Hellbrink. »Ich konnte jetzt nicht noch einkaufen. Ich wollte dir nur ganz schnell sagen, daß du zu uns gehörst, und daß wir dich bitten, uns zu verzeihen. Kannst du es?«
»Götz sieht so elend aus. War er krank?« fragte Sandra. »Ich bin doch gar nicht wichtig. Ich sorge mich so sehr um Götz, und unser Baby braucht ihn doch.«
*
Mit Tränen in den Augen stand Leonore von Hellbrink dann vor Dr. Leitner.
»Wo ist das Baby?« fragte sie. »Sandra braucht es. Lebt es überhaupt, ist es gesund, oder will man sie nur schonen?«
»Das Baby lebt und ist gesund, und es befindet sich in bester Obhut. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen, Frau von Hellbrink. Manches bedarf noch der Klärung. Gegen Frau Renz ist ein Verfahren anhängig.«
»Ich verstehe nicht«, sagte Leonore bestürzt. »Wer ist Frau Renz?«
Dr. Leitner war konsterniert. Also auch das wußte sie nicht. Er hätte besser gar nichts sagen sollen.
»Ich denke, Ihre Schwiegertochter wird es Ihnen selbst erklären. Es ist sehr viel auf sie eingestürmt.«
»Durch unsere Schuld. Sie wußte wohl nicht einmal, daß Götz so lange verschollen war. Es gibt keine Entschuldigung für uns, Herr Dr. Leitner.«
»Nun, ich denke, daß darüber bald nicht mehr gesprochen zu werden braucht. Wenn die junge Familie vereint sein wird, sind die Sorgen rasch vergessen. Sandra ist ein versöhnlicher Mensch. Sie liebt Ihren Sohn, gnädige Frau, und das hat sie unter Beweis gestellt. Daß sie in diese üble Affäre um Frau Renz verstrickt wurde, ist nicht ihre Schuld. Die Einzelheiten darüber werden Sie bald erfahren.«
Damit mußte sich Leonore vorerst zufriedengeben. Sie fuhr nach Hause. Götz schlief, und sie sorgte dafür, daß im Haus absolute Ruhe herrschte. Carola blieb ohnehin in ihrem Zimmer. Sie hatte genug nachzudenken über ihre Torheit, doch ihren Eltern blieb die Hoffnung, daß sie daraus gelernt hatte.
Elisabeth Roth wurde von Ulrich von Hellbrink höchstpersönlich angerufen. Er bat sie um eine Unterredung. Ja, er bat! Elisabeth war sprachlos, dann erst recht, als er ihr sagte, daß Fechner entlassen sei. Ihm wäre es sehr angenehm, wenn sie sofort kommen könnte.
Sie hatte Zeit. Bastian hatte ihr gesagt, daß er so gegen vier Uhr nochmals bei ihr vorbeischauen würde, bevor er wieder heimfuhr. Er hatte viel zu erledigen.
Elisabeth ging zur Fabrik, aber sie mußte immerzu an Bastian denken.
Wie energisch und zielbewußt er war, hatte sie erfahren, als er mit den Polizeibeamten gesprochen hatte. Bei ihm gab es keine Hintertürchen. Er hatte keinen Zweifel darüber gelassen, daß er und Elisabeth tatsächlich in einem Boot saßen, und daß er nicht geneigt war, dieses Boot zu verlassen und ihr die Schwierigkeiten überließ, es ans Ziel zu bringen.
Er hatte auch keinen Zweifel daran gelassen, daß er sie mochte. Er hatte sie auf die Stirn geküßt, als er gegangen war.
»Wenn ich diese Sache hinter mich gebracht habe, werden wir mal über uns reden, Elisabeth«, hatte er ohne Umschweife erklärt. »Einverstanden?«
Sie hatte nur zustimmend nicken können, denn gar zu plötzlich war da ein Mensch in ihr Leben getreten, den auch sie sehr mochte in seiner Ehrlichkeit und Natürlichkeit.
Aber nun mußte sie eine Entscheidung treffen, die ihren künftigen Weg bestimmen sollte. Darüber ließ Ulrich von Hellbrink keinen Zweifel.
Schon der Portier hatte sie freudig begrüßt. »Kommen Sie nun doch wieder, Fräulein Roth, wo der Fechner weg vom Fenster ist?« hatte er gefragt.
»Ich weiß noch nicht«, erwiderte sie.
Jeder grüßte sie freundlich, ja, herzlich, und auch der höchste Chef erhob sich von seinem Stuhl, als sie sein Allerheiligstes betrat.
»Ich bin Ihnen sehr dankbar, Fräulein Roth, daß Sie so bald gekommen sind«, begann er. »Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wir haben sehr viel zu besprechen. Ich möchte mich vorweg bei Ihnen dafür entschuldigen, daß ich der Kündigung durch Herrn Fechner zustimmte, ohne mich persönlich zu informieren. Ich war falsch unterrichtet und scheue mich nicht, dies einzugestehen. Wie ich Ihnen schon sagte, ist Herr Fechner fristlos entlassen worden. Es entspricht ja wohl der Wahrheit, daß er Ihrer Schwester Versprechungen machte, die er nicht einzuhalten gedachte.«
Elisabeth war noch immer verwirrt. »Das ist eigentlich die ganz persönliche Angelegenheit meiner Schwester«, erwiderte sie vorsichtig.
»Wäre sie denn jetzt bereit, Fechner zu heiraten?« fragte er, nun auch verlegen.
»Keinesfalls. Mehr möchte ich darüber aber nicht sagen.«
»Immerhin hat mich Herr Fechner um drei ausgezeichnete Mitarbeiter gebracht, darunter befindet sich auch meine Schwiegertochter.«
Elisabeth war völlig aus der Fassung gebracht. Er hatte »meine Schwiegertochter« gesagt.
»Sandra hat von selbst gekündigt«, sage sie leise.
»Unter dem Druck der Intrigen, die Fechner angezettelt hat«, erklärte er. »Ich leugne nicht, daß ich mich dadurch beeinflussen ließ, daß ich meinen Sohn nach Afrika schickte und durch meine Engstirnigkeit den Anlaß dazu gab, daß er Sandra heimlich geheiratet hat.«
»Sie wissen alles, Herr Hellbrink?« fragte Elisabeth stockend.
»Nicht alles, aber ziemlich viel. In meinem privaten Bereich werde ich noch viel gutzumachen haben. Was Sie betrifft, möchte ich Sie bitten, Ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. Eine Gehaltsaufbesserung sichere ich Ihnen zu. Ich bin auch bereit, Ihrer Schwester eine Unterstützung zu zahlen. Eine Wiedergutmachung scheint mir angebracht zu sein, wenn ich es so ausdrücken darf.«
Elisabeth verschlang die Hände ineinander und dachte wieder an Bastian.
»In meinem privaten Bereich hat sich auch etwas geändert, Herr von Hellbrink«, sagte sie leise. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir eine kurze Frist zubilligen würden, meine Entscheidung zu treffen.«
»Das ist selbstverständlich, aber Sie dürfen versichert sein, daß ich mich nicht scheue, Ihnen vor den übrigen Angestellten Genugtuung zu verschaffen.«
Ein flüchtiges Lächeln legte sich um Elisabeths Mund. »Das ist nicht nötig. Man kennt mich und man weiß, daß ich die Entlassung Herrn Fechner zu verdanken hatte«, erwiderte sie. »Aber ich darf wohl sagen, daß ich mich für Sie freue, daß Sie dessen Machenschaften noch rechtzeitig durchschaut haben.«
»Sie haben einen klaren Blick, der mir leider fehlte, Fräulein Roth. Es ist ja bekannt, daß Herr Fechner sich zum Ziel gesetzt hatte, meine Tochter zu heiraten. Sie sehen, ich bin ganz offen.«
»Ja, dann kann ich nur sagen, daß Ihr Sohn zu einer Frau wie Sandra zu beglückwünschen ist, und ich hoffe, daß Sie auch zu dieser Überzeugung gelangen.«
Hinterher bekam sie einen Schrecken, daß sie das so geradeheraus gesagt hatte, denn immerhin durfte sie nicht offene Türen einrennen, aber Ulrich von Hellbrink lächelte.
»Zu dieser Überzeugung bin ich schon gekommen«, erwiderte er. »Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören.«
»Ja, ich sage Ihnen morgen Bescheid. Es kam ein bißchen plötzlich.«
Alles kam zu plötzlich für die ruhige, stets bedachte Elisabeth. Und zu plötzlich stand dann auch Bastian wieder vor ihr, schon um zwei Uhr, statt um vier Uhr.
»Bin ich froh, daß ich das hinter mich gebracht habe«, sagte er aufseufzend. »Kann ich einen Kaffee haben, Elisabeth?«
»Gern«, erwiderte sie.
»Die Beerdigung ist am Donnerstag. Anna haben sie wieder auf freien Fuß gesetzt, weil keine Verdunkelungsgefahr besteht und sie einen festen Wohnsitz hat. Die wird der Polizei auch noch ein Schnippchen schlagen, aber das ist deren Bier. Uns wird sie nicht unter die Augen kommen. Sie weiß genau, daß ihr das schlecht bekommen wird. Sind Sie noch belästigt worden?«
»So kann ich es nicht sagen. Herr von Hellbrink hat mich angerufen. Er will mich wieder einstellen und bietet mir mehr Gehalt«, erwiderte sie möglichst gleichmütig.
»Und Sie haben angenommen?« fragte er erregt.
»Ich habe mir Bedenkzeit ausgebeten«, erwiderte sie.
»Wieviel bietet er Ihnen denn?« fragte Bastian heiser.
»Zweitausendachthundert. Ganz hübsch, nicht wahr?«
Er wurde noch blasser, sofern das überhaupt möglich war nach der Hetze des Vormittags.
»Das kann ich Ihnen nicht bieten, Elisabeth«, sagte er leise. »Eigentlich nur mein Herz und meine Hand, und was man verdienen kann in dem Gasthof zu gleichen Teilen.«
Sie hielt den Atem an. »Haben Sie sich das überlegt, Bastian? Ist es nicht zu impulsiv?«
»Wenn Sie nein sagen, muß ich mich damit abfinden, aber ich habe eigentlich den ganzen Vormittag an nichts anderes gedacht. Nicht daran, daß Onkel Gottlieb tot ist, auch nicht an Anna, nur daran, daß ich Sie kennengelernt habe, und daß ich Sie verehre.«
Es klang rührend. Heiß stieg es Elisabeth in die Augen.
»Und den Namen Elisabeth finde ich sehr schön«, fuhr er fort. »Der Gasthof wirft ganz schön was ab. Ich muß nur noch ziemlich viel abbezahlen. Aber in zwei Jahren habe ich es geschafft.«
Da legte sie ihm den Finger auf den Mund. »Bastian, über Geld wollen wir überhaupt nicht reden. Es ist doch so unwichtig, wenn man weiß, daß man zusammengehört und Vertrauen zueinander hat.«
Seine starken Arme legten sich um ihre zierliche Gestalt. »Du würdest ja sagen, Elisabeth? Aber auf dem Land ist es ganz anders als in der Stadt.«
»Ja, ganz anders«, sagte sie leise. »Da halten alle zusammen. Da hilft einer dem andern. Ich habe mir die Bedenkzeit doch nur ausgebeten, um zu hören, was du sagst, Bastian.«
Und da preßte er sie so fest an sich, daß ihr die Luft wegblieb.
»Ich nehme dich gleich mit, Elisabeth. Ich lasse dich nicht mehr los«, murmelte er zwischen zwei langen Küssen.
»Aber beim Autofahren mußt du die Hände schon freihaben«, lachte sie. »Ach du liebe Güte, wir haben ja gar keinen Wagen, wir müssen mit dem Zug fahren. Um so besser.«
Er küßte sie wieder. »Am Ende muß ich mich sogar noch bei Anna bedanken, weil ich dich ohne sie nicht gefunden hätte«, murmelte er dicht an ihrem Ohr.
»Kein Unglück ist so groß, es hat ein Glück im Schoß«, sagte sie leise. »Für uns ein ganz großes Glück«, fügte sie hinzu.
»Aber du darfst mir nicht böse sein, wenn ich mal einen vor die Tür setze, wenn er mehr als einen Schluck über den Durst getrunken hat, das passiert nämlich auch.«
»Ich würde dir sogar böse sein, wenn du es nicht tun würdest, Bastian. Gerauft wird bei uns nicht.«
»Das wird keiner wagen, den du anschaust, Elisabeth. Mein Gott, Vater im Himmel, was wird Mutterl sich freuen, wenn ich dich heimbringe.«
Wie seine Augen strahlten, wie sein Mund lachte, obwohl doch so viel Ungemach hinter ihm lag. Aber das Glück war größer als dieses.
*
Wieviel Dr. Norden von diesem dramatischen Geschehen wußte, ahnte Leonore von Hellbrink noch nicht.
Sie hatte augenblicklich nur den Wunsch, nicht untätig herumzusitzen, sondern etwas dazu beizutragen, damit Sandra ihr Baby bald im Arm halten konnte und sie ihr Enkelkind.
Sie konnte nichts anderes mehr denken. Wogegen sie sich noch vor Monaten gesträubt hatte, war vergessen. In ihr hatte sich in Blitzesschnelle eine einschneidende Wandlung vollzogen.
Sie hatte Dr. Norden vor ein paar Tagen gesagt, daß er Götz gesund machen würde, wenn er daheim sei, aber sie hoffte nun auch, daß Dr. Norden ihr raten könnte, was sie unternehmen sollte, um ihnen allen Erleichterung zu verschaffen.
Dr. Norden war nicht einmal überrascht, als Loni ihm sagte, daß Frau von Hellbrink dringend um seinen Besuch gebeten hätte.
Er wußte ja bereits, daß Götz heimgekehrt war. Und nach der Sprechstunde fuhr er gleich zu ihr.
»Götz ist daheim«, erklärte sie. »Er schläft und schläft, aber nicht nur seinetwegen möchte ich mit Ihnen sprechen, Herr Dr. Norden. Ich weiß, daß Sie auch menschliches Verständnis für Ihre Patienten haben, und das brauche ich jetzt auch. Götz hat heimlich geheiratet. Wir waren gegen diese Ehe. Ich möchte betonen, daß sich dies geändert hat.«
»Das freut mich«, erwiderte Dr. Norden.
Verwirrt schaute sie ihn an, doch dann fuhr sie schnell fort: »Sandra hat inzwischen ein Baby bekommen, aber das ist an einem unbekannten Ort untergebracht.«
»Ja, ich weiß«, erwiderte er.
»Sie wissen es?« fragte sie staunend. »Sie wissen mehr als wir.«
»Das, gnädige Frau, liegt an den Umständen«, erwiderte er ruhig.
»Rätselhafte Umstände!«
»Das kann man wohl sagen, aber doch wohl dadurch verursacht, daß die Ehe heimlich geschlossen wurde und Sandra die Eltern ihres angetrauten Mannes nicht in Anspruch nehmen wollte, wenn ich das so ausdrücken darf, ohne Sie verletzen zu wollen.«
Leonores Augen weiteten sich. »Sie können alles sagen, Herr Dr. Norden. Ich bin Ihnen nur dankbar. Ich will überhaupt nichts beschönigen, was uns als Schuld angelastet werden kann. Damit müssen wir fertig werden. Ich möchte nur vorausschicken, daß wir die Heirat unseres Sohnes billigen und für unser Enkelkind alles tun wollen, was nur menschenmöglich ist. Ich kann diesen Zustand der Ungewißheit nicht mehr ertragen. Götz hat Schreckliches durchgemacht und Sandra ebenso. Dieser Ungewißheit muß ein Ende bereitet werden.«
»Ich bin durchaus Ihrer Ansicht, Frau von Hellbrink. Ich freue mich, daß Sie so denken. Ich freue mich, daß Ihnen, aber auch den jungen Eltern, noch größere Schwierigkeiten erspart blieben.«
»Ich habe Sandra in der Klinik besucht. Ich habe auch mit Dr. Leitner gesprochen, aber er war zu klärenden Auskünften nicht bereit. Er sagte mir nur, daß das Baby in bester Obhut ist.«
»Das kann ich bestätigen.«
»Bitte, sagen Sie mir doch mehr«, flehte sie. »Ist es denn nicht möglich, daß das Baby zu seiner Mutter gebracht wird? Helfen Sie uns. Ich weiß bisher nicht einmal, wann es zur Welt gekommen ist.«
»Vor etwa achtzig Stunden, und die haben aufregend genug begonnen. Man darf so kleinen Menschlein nicht allzuviel zumuten. Aber ich denke, daß unter den nötigen Vorkehrungen ein Transport zur Leitner-Klinik zu verantworten ist. Das sollten aber die Eltern entscheiden.«
»Ja, da darf ich mich wohl nicht einmischen«, sagte sie leise. »Vielleicht ist Götz inzwischen in der Lage, sich dazu zu äußern.« Sie hatte lauschend den Kopf erhoben, und auch Dr. Norden hatte die Schritte vernommen.
In einen dunkelblauen Bademantel gehüllt, erschien Götz in der Tür.
»Entschuldige bitte, Mama, ich wußte nicht, daß du Besuch hast«, sagte er.
»Das ist Dr. Norden, mein Junge. Er ist besser informiert über Sandra als wir. Ich habe ihn eben um seine Hilfe gebeten, damit wir euer Baby heimholen können.«
Götz fuhr sich mit den Fingern durch das wirre Haar.
»Mein Kind darf keineswegs gefährdet werden«, sagte er rauh. »Ich möchte mich davon überzeugen, daß unser Sohn gesund ist, wie man es Sandra gesagt hat.«
Seine dunklen Augen waren durchdringend auf Dr. Norden gerichtet.
»Ich muß mich erst zurechtfinden«, fuhr er fort. »Welchen Rat geben Sie mir, Herr Dr. Norden?«
»Daß Sie sich davon überzeugen, daß alles für Ihr Kind getan wird, was Güte, Liebe und Hilfsbereitschaft zu tun in der Lage sind. Wie fühlen Sie sich, Herr von Hellbrink?«
»Noch ziemlich mies«, erwiderte Götz. »Ich gebe zu, daß mich diese Ungewißheit schlaucht. Diese Wochen waren grausam. Ich bin kein Held, Herr Dr. Norden. Ich hatte höllische Angst, meine Frau nicht mehr wiederzusehen. Ich hatte auch Angst, daß Sandra sich von mir verraten fühlen könnte und ganz allein sein würde. Ich möchte jetzt mein Kind sehen und es Sandra bringen.«
»Fühlen Sie sich kräftig genug, Herr von Hellbrink?« fragte Dr. Norden.
»Dazu schon. Es gibt doch nichts Wichtigeres.«
»Aber einen Vitaminstoß halte ich schon für angebracht«, sagte Dr. Norden. »Und ein Telefongespräch möchte ich auch noch führen.«
»Sie werden uns helfen?« fragte Leonore.
»Sehr gern.«
»Aber mehr wollen Sie nicht sagen?«
»Das werden Sie schon noch alles erfahren, von denen, die es besser wissen als ich.«
*
Dr. Norden hatte Elisabeth gerade noch telefonisch erreicht. Da Bastian der Wagen von Dr. Urban zur Verfügung stand, wollten sie es lieber doch vorziehen, mit diesem zu fahren, als die sehr umständliche Bahnfahrt mit mehrmaligem Umsteigen auf sich zu nehmen.
Dr. Norden wußte zwar nichts von Elisabeths persönlichen Motiven, Bastian zu begleiten, aber er war recht froh, sie als Vorhut einschalten zu können, damit Luise Urban darauf vorbereitet wurde, daß Sandras Baby abgeholt werden würde.
»Mutter wird nicht ganz einverstanden sein«, meinte Bastian dazu.
»Aber da die Beerdigung vor der Tür steht, wird sie sich nicht nur auf das Baby konzentrieren können«, meinte Elisabeth. »Immerhin halte ich es auch für richtig, daß diejenigen, die Verantwortung übernehmen sollten, die dafür zuständig sind.«
»Du bist sehr konsequent«, bemerkte Bastian.
»Ja, das bin ich. Damit mußt du dich abfinden.«
»Ich brauche mich nicht abzufinden, ich erkenne es an, allerliebste Elisabeth. Mutter läßt sich nur vom Gefühl leiten, bei dir ist es mit dem Verstand kompensiert.«
»Du kannst dich sehr geschickt ausdrücken, Bastian«, sagte Elisabeth lächelnd.
»Ich bin nicht von gestern, Herzallerliebste.«
»Sonst hättest du es auch nicht so weit gebracht«, erwiderte sie im gleichen neckenden Ton. »Aber damit wir uns einig sind, die Bücher werden von mir geführt.«
Er lachte leise auf. »Was bin ich froh darüber. Dazu fehlt mir das Talent. Aber falls du in die Verlegenheit kommen solltest, auch mal Bier einzuschenken, wenn Hochbetrieb ist, sei bitte auch so korrekt. Unsere Mitbürger nehmen es sehr genau.«
»Ich auch, und ich werde bestimmt niemanden vergraulen. Ich hoffe, daß du nichts an mir auszusetzen hast, Bastian.«
Er hielt schnell mal an und gab ihr einen langen Kuß. »Ich habe überhaupt nichts auszusetzen, Elisabeth.« Und sie spürte, wie gern er ihren Namen aussprach, wie er es geradezu genoß. Sie wollte sich gar nicht mehr daran erinnern, daß sie es oft bedauert hatte, daß man ihr diesen altmodischen Namen in die Wiege legte.
Es war schön, so an seiner Seite zu sitzen und einem neuen Leben entgegenzufahren, dabei nur ein gutes Gefühl zu haben und keine zwiespältigen Gefühle, ein Wagnis einzugehen.
»Bei uns wird alles seine Ordnung haben«, sagte Bastian, »wenn es mir auch verdammt schwer fällt. Aber zuerst wird geheiratet, und dann wird an Zuwachs gedacht. Du sollst es nicht so schwer haben wie Mutter. Passieren kann ja immer mal was.«
»Sag das nicht, Bastian«, flüsterte Elisabeth.
»Man darf die Augen nicht verschließen, mein Mädchen. Was täte denn Sandra, wenn ihr Mann nicht zurückgekommen wäre? Und an Hilde müssen wir auch denken. Leicht wird sie es nicht haben, wenn wir es ihr auch ein bißchen leichter machen können als Mutter es hatte. Gut wäre es schon, wenn sie einen anständigen Mann finden würde, der ihrem Kind auch ein guter Vater wäre. Ich weiß, wie es ist, wenn man keinen Vater hat, zu dem man aufblicken kann.«
Elisabeth lehnte mit einem beglückenden Gefühl den Kopf an seine Schulter, denn sie wußte, daß ihre Kinder einen Vater haben würden, zu dem sie aufblicken konnten. Sie wünschte sich viele Kinder, die Bastian ähnlich würden.
»Morgen muß ich Herrn von Hellbrink Bescheid geben«, sagte sie gedankenverloren.
»So ein kleines Ferngespräch können wir leicht verkraften«, meinte er. »Du kannst ihn ja zu unserer Hochzeit einladen.«
»Da bin ich aber sehr gespannt, was er erwidern wird«, erwiderte sie lächelnd.
»Du kannst es ja erfahren. Schuldig bist du ihm nichts. Und Mutter wird nichts dafür verlangen, daß sie sein Enkelkind versorgt hat.«
So etwas wäre Luise freilich nicht in den Sinn gekommen. Aber wehmütig war es ihr ums Herz, als sie den Kleinen in den Arm nahm.
»Nun muß ich dich schon bald wieder hergeben, mein Herzepoppel«, sagte sie leise, nachdem Elisabeth ihr erklärt hatte, daß Götz seinen Sohn holen wollte.
»Es wird dich hoffentlich noch mehr freuen, wenn du mal eigene Enkel im Arm wiegen wirst, Mutterl«, sagte Bastian.
»Wie lange muß dich darauf noch warten?« fragte sie.
»Frag Elisabeth. Meinetwegen können wir nächste Woche heiraten. Hoffentlich verschwendest du nicht zuviel Liebe an Hildes Kind.«
Luise konnte es nicht gleich begreifen, was er da gesagt hatte. Wie sollte sie auch? Bisher hatte Bastian noch nie ernstes Interesse für eine Frau gezeigt.
»Ihr wollt heiraten?« fragte sie mit zitternder Stimme.
»Gefällt dir das nicht?« fragte Bastian, während Hilde ihre Schwester völlig verwirrt anblickte.
»Gefallen tät’ es mir schon, aber ihr habt euch doch grad erst kennengelernt.«
»Ich hätte es auch nicht geglaubt, daß man es schon nach so kurzer Zeit so genau wissen könnte, Mutter Luise«, sagte Elisabeth leise. »Aber dein Sohn hat das Zeug, selbst den kritischsten Menschen zu überzeugen, wie gut es ist, ihn zur Seite zu haben.«
Luise legte das Baby in das Körbchen, das jedoch lauthals zu schreien begann.
»Jetzt bist mal stad«, sagte sie. »Ich muß meine Kinder in die Arme nehmen, dann kommst du wieder an die Reihe.«
Und dann hielt sie Bastian und Elisabeth mütterlich umfangen. »Das ist eine Freude«, murmelte sie. »Ich kann’s noch gar nicht fassen. Da könnt’ man doch gleich narrisch werden. Und der Gottlieb würde es uns nicht verübeln, wenn wir bald Hochzeit feiern. Nächste Woche, hast du gesagt, Bastian?«
»Sagen wir übernächste«, erwiderte er. »So lange kann ich schon noch warten. Herrichten muß ich ja auch noch einiges. Und Elisabeth kann doch bei dir bleiben, damit ja nicht erst ein Gerede aufkommt, Mutterl?«
»Recht ist es mir schon, aber warum sollen die Leut’ net reden, wenn zwei sich so lieb haben? Du liebes Herrgöttle, wo ist die Hilde?« fragte sie dann.
Hilde war hinausgelaufen. Was Glück, was wirkliche Liebe war, hatte sie plötzlich, ein bißchen zu schmerzhaft, begriffen. Es tat weh. Es machte ihr auch klar, welchen falschen Worten sie Glauben geschenkt hatte.
Selbst vor ihrer Schwester hatte sie Heimlichkeiten gehabt, als sie sich mit Kurt Fechner eingelassen hatte. Und sie hatte nicht begriffen, daß wahre Liebe keine Heimlichkeiten kannte.
Worte, nur Worte waren da gewesen und seine Gier, sie zu besitzen. Ja, er hatte sich für unwiderstehlich gehalten, und sie hatte sich noch geschmeichelt gefühlt, weil er ihr seine Aufmerksamkeit schenkte. Dabei war sein Blick auf eine andere gerichtet gewesen, auf die Tochter des Chefs, und sie war nur ein Zeitvertreib für ihn gewesen. Nicht mal ein Abenteuer, das ihn reizte. Töricht, wie sie war, hatte er sich ja gar nicht lange um sie bemühen müssen.
Blind von den Tränen, die ihre Augen füllten und über ihre Wangen rannten, lief Hilde weiter, immer weiter, weg von dem Haus, in dem sie Zuflucht gefunden hatte, in dem sie sich geborgen gefühlt hatte.
Aber nun war Elisabeth da, die von Luise wie eine richtige Mutter aufgenommen wurde. Elisabeth, die sich nie in eine Liebelei eingelassen hatte. Bastian wollte sie heiraten. Er kannte sie erst zwei Tage, und er wollte sie heiraten. Ja, eine Frau wie Elisabeth verschwendete keine Gefühle unnütz. Aber sie schenkte nur dann Gefühle, wenn sie auch erwidert wurden.
Ich darf es ihr nicht neiden, dachte Hilde. Was ich mir eingebrockt habe, muß ich auslöffeln.
Doch in diesen Minuten der Verzweiflung siegte nicht die Stimme der Vernunft. Hilde schämte sich, und sie hatte Angst vor der Zukunft, und sie wollte auch nicht auf die Stimmen hören, die ihren Namen riefen, immer und immer wieder. Sie lief weiter in den Wald hinein, immer weiter.
*
Berti, eigentlich Norbert Reiter, vernahm die Stimmen. Um diese Zeit mußte er sich immer die Füße vertreten, frische Waldesluft schnuppern, weglaufen von den Benzindämpfen, die er in seiner Tankstelle einatmen mußte. Eigentlich wäre er lieber Landwirt geworden wie sein Großvater, aber da sein Vater schon früh gestorben war und die Tankstelle eine Goldgrube war, wie man sagte, hatte er sie dann übernommen, um die Mutter und die Geschwister gut zu versorgen. Manchmal konnte man nicht das tun, was man wollte. Und natürlich hatte das auch seine guten Seiten, denn die Tankstelle war weit und breit die einzige und wirklich eine Goldgrube.
Aber mittags und gegen Abend brauchte Berti seinen Auslauf, und auch sein Hund Stoffel drängte danach. Stoffel war ein schöner weißer Hirtenhund, treu wie Gold, aber auch eigensinnig, wenn er Waldluft witterte. Ohne Erlaubnis wäre er jedoch diesem verlockenden Duft niemals gefolgt. Er wußte, wohin er gehörte und genoß ein wundervolles Hundeleben. Gewiß hörte auch er die vertrauten Stimmen, aber sie riefen einen Namen, den er noch nicht kannte, und so drehte er sich zu seinem Herrchen um und sah ihn erwartungsvoll an.
»Hilde! Hilde!« schallte es wieder durch den Wald.
»Such, Stoffel, such!« sagte Berti.
Stoffel wußte nicht, was er suchen sollte, aber nun rief auch Berti diesen Namen. »Hilde, Hilde!«
Aber Hilde war über eine Baumwurzel gestürzt, mit dem Kopf auf einen Stein geschlagen und rührte sich nicht. Sehen konnte man sie nicht, aber Stoffel schnupperte Blut.
Er raste los, und Berti folgte ihm mit großen Schritten, immer schneller werdend. Winselnd stand Stoffel neben der leblosen Gestalt, und als Berti in das bleiche Gesicht blickte, über das aus einer Stirnwunde Blut floß, wurde es ihm ganz schlecht.
»Hilde!« dröhnte Bastians Stimme durch den Wald. »Nicht weglaufen. Antworten Sie doch!«
»Bastian, hier bin ich, hier liegt sie«, rief Berti zurück. Dann kraulte er Stoffel den Kopf. »Such Bastian, Stoffel!«
Den Bastian kannte Stoffel, und er raste los. Berti beugte sich zu der stillen Gestalt herab. Ganz mechanisch fühlte er den Puls. Einen Erste-Hilfe-Kurs hatte er abgelegt. Ganz schwach spürte er diesen Pulsschlag.
»Madl, Madl«, murmelte er und schob seine Hand unter ihren Kopf.
Dann hörte er Stoffel bellen und gleich darauf schnelle Schritte. Bastian war da.
Worte wurden nicht viele gewechselt. »Ich trag sie heim«, sagte Bastian.
»Ich trag sie«, sagte Berti. »Ich habe sie gefunden. Was ist denn nur los mit dem Dirndl?«
»Heim geh ma«, sagte Bastian im gewohnten heimatlichen Dialekt. »Fragen kannst nacha.«
Berti fiel es nicht schwer, diese leichte Gestalt zu tragen. Er wunderte sich nur, daß sie so viel Blut verlor, und er wußte gar nicht, woran das lag.
Aber die Luise wußte es. Ihr Gesicht war ganz starr. »Leg sie in ihr Zimmer«, sagte sie.
»Hilde«, flüsterte Elisabeth angstvoll.
Bastian legte seinen Arm um sie. »Es wird schon wieder, Herzele«, sagte er zärtlich. »Wart erst, was Mutter sagt.«
Berti schaute ihn verstört an. »Ich rufe den Notarzt«, murmelte er.
Aber es vergingen nur ein paar Minuten, dann kam der Wagen, mit dem sie nicht gerechnet hatten in diesem Augenblick. Der Wagen mit Götz von Hellbrink und Dr. Norden. Und Leonore von Hellbrink steig auch noch aus.
»Sie kommen grad zurecht, Herr Doktor«, sagte Elisabeth leise.
»Wie gerufen«, murmelte Bastian.
»Ist etwas mit meinem Sohn?« fragte Götz erregt.
»Nein, mit Hilde«, sagte Elisabeth.
»Wenn ich nur alles verstehen tät«, warf Berti ein.
Mit lautem Weinen machte sich der kleine Götz bemerkbar.
»Das Kind, unser Kind«, rief Leonore erregt aus.
»Dem fehlt doch nix«, sagte Bastian.
»Kommen Sie«, bat Elisabeth nun mit erstickter Stimme.
Sie führte Götz und seine Mutter zu dem Körbchen. Daniel Norden folgte währenddessen Bastian.
Berti trottete hinter ihnen her. Stoffel blieb hängenden Hauptes vor der Tür sitzen. Er wußte auch nicht, was er von dieser Situation halten sollte. Aber ihm konnte man sie auch nicht erklären.
»Wir brauchen einen Krankenwagen«, sagte Dr. Norden.
»Kann Hilde denn nicht hierbleiben?« fragte Luise. »Ich kenn’ mich doch aus.«
»Haben Sie nicht schon Aufregungen genug, Frau Urban?« fragte Dr. Norden.
»Man kann das Dirndl doch jetzt nicht allein lassen«, sagte sie. »Elisabeth bleibt auch hier. Wenn Sie noch ein halbes Stünderl bleiben könnten, Herr Doktor, dann ist doch alles vorbei. Dann ist sie doch aller Ängste ledig. Gott hat es so gewollt. Niemand hat nachgeholfen, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Freilich verstehe ich Sie, Frau Urban.«
»S’ ist doch nur gut für das Dirndl«, sagte sie. »Das wird sie verwinden. Sie braucht’s nimmer mit sich herumzutragen.«
»Was meint Mutter Luise?« fragte Berti leise.
»Daß Hilde ein Kind bekommen hätt’«, erwiderte Bastian flüsternd. »Nun nimmer. Ja, es sollt’ so sein.«
*
Götz aber hielt sein Kind in den Armen. Für ihn war es das größte Wunder, das er je erlebt hatte.
»Mein kleiner Sohn«, sagte er zärtlich.
»Mein Liebling«, flüsterte Leonore. »Ist er herzig! Bist unser Schätzle, unser ganz geliebtes Herzenskind. Bitte, gibt ihn mir doch auch mal, Götz. Er muß seine Omi kennenlernen.« All die lieben Koseworte flüsterte sie, aber wer wollte schon darüber lächeln? Sie kamen doch aus übervollem Herzen. Und Götz konnte wieder lächeln.
»Stell dich nicht gar so an, Mama«, sagte er. »Sandra hat uns diesen Prachtjungen geschenkt, und sie hat ihn noch nicht mal gesehen.«
»Ich möchte ihn ihr bringen, Götz, bitte, laß mir diese Freude. Ich werde deine Sandra darum bitten, mir zu verzeihen. Ja, ich werde sie bitten und Papa wird vor ihr niederknien, ich schwör’ es dir.«
»Übertreib es nicht, Mama. Ich glaube dir ja, daß du dich freust. Aber Sandra will nicht, daß ihr nur demütig vor ihr in die Knie sinkt. Wir lieben uns. Wir waren bereit, unseren Weg auch allein zu gehen. Es ist gut, wenn ihr uns euren Segen gebt. Ja, es ist gut«, wiederholte er gedankenvoll. »Sandra wird glücklich sein.«
»Ja, sie wird glücklich sein«, sagte Elisabeth.
Leonore schaute sie an. »Sie sind Sandras Freundin«, sagte sie. »Elisabeth Roth. Mein Mann hat mit Ihnen gesprochen. Ja, er hat mir alles gesagt.«
»Aber ich kann sein Angebot nicht annehmen, Frau Hellbrink.«
Ein Schatten fiel über Leonores Gesicht. »Sie können ihm nicht verzeihen, wie aber soll dann Sandra verzeihen?«
»Es gibt doch nichts zu verzeihen«, erwiderte Elisabeth. »Ich habe ganz einfach einen Mann gefunden, der mir wichtiger ist als ein noch so gutes Stellenangebot. Ich bleibe hier bei Bastian, und eigentlich bleibt mir gar nichts mehr zu wünschen übrig, als auch solch einen süßen Sohn zu haben.« Sie lauschte nach draußen. »Ein Weilchen können Sie doch noch bleiben«, fuhr sie bittend fort. »Ich möchte gern nach meiner Schwester sehen.«
»Was mag mit ihrer Schwester sein?« fragte Götz.
»Hilde Roth, das Mädchen, das so schamlos von Fechner hintergangen worden ist«, sagte Leonore. »Wir sind blind und taub durch die Welt gegangen, Götz. Daß Carola auf ihn hereingefallen ist, müssen wir uns auch zuschreiben. Wir haben zuviel falsch gemacht, mein Junge.«
»Vielleicht eine ganze Menge«, sagte er, »aber zuviel nicht, Mama, das hast du bewiesen.«
Ja, sie hatte bewiesen, daß sie Herz besaß, daß sie eine gute Mutter war und nun eine zärtliche Großmutter wurde. Dr. Norden hatte es schon oft erlebt, daß ein Kind versöhnte und rührte, und auch vieles vergessen ließ, was nicht gut gewesen war, aber für Hilde war es besser, daß sie nun kein Kind bekommen würde, obgleich sie sich damit abgefunden hatte. Für sie war es besser, wenn sie nicht mehr an Kurt Fechner erinnert wurde, da ihr bewußt geworden war, wie flüchtig auch ihre Gefühle für ihn waren. Auch Luise sagte, daß es so wohl von Gott gewollt sei, und Elisabeth sprach dann am Abend noch lange mit Bastian darüber, als Dr. Norden mit Leonore, Götz und dem Baby die Heimfahrt angetreten hatte, denn Hilde konnte er unbesorgt in Luises Obhut zurücklassen.
»Ich habe es nicht verstanden, daß sie sich mit Fechner eingelassen hat. Es hat wohl ihrer Eitelkeit geschmeichelt, und es ist ihr längst bewußt geworden, daß es keine Liebe war.«
»Längst?« fragte Bastian, »ich glaube, es wurde ihr erst bewußt, als wir kamen.«
»Du darfst nicht sagen, daß Hilde es mir neidet, daß wir uns lieben, Bastian. Sie ist nicht neidisch. Ich glaube, daß sie sich vor sich selbst schämt.«
Sie wurde eingehüllt von seinen warmen, innigen Worten.
»Daß wir uns lieben, ist wunderschön, Elisabeth, und daß du es sagtest, macht mich sehr glücklich.«
»Du sollst es fühlen, liebster Bastian. Es kommt nicht auf die Worte an.«
Er nahm sie in den Arm. »Hilde wird sich fangen, mein Herzensmädchen. Sie ist nicht allein. Wir werden ihr helfen. Vor sich selbst braucht sie wirklich nicht davonzulaufen.«
Dann kam Berti noch mal. Ganz leise klopfte er ans Fenster.
»Wie geht es der Hilde?« fragte er. »Ich wollt’ nachfragen.«
»Sie schläft. Es geht ihr besser. Komm, trink noch ein Gläschen Wein mit uns.«
Auch Luise gesellte sich noch zu ihnen. Nach dem Schrecken wollte sie sich nun doch an dem jungen Glück freuen.
*
Übermächtig war die Freude in der Leitner-Klinik, als Sandra ihr Baby in den Armen halten durfte. Der Kleine hatte die Fahrt gut überstanden und entwickelte nun einen mächtigen Appetit. Sandra war überglücklich, daß sie ihm die Flasche geben durfte. Luise hatte genau aufgeschrieben, wann und was sie gefüttert hatte. Dr. Leitner hatte daran nichts auszusetzen. Daß das Baby in bester Verfassung war, verriet, wieviel Luise noch immer von ihrem Handwerk verstand.
Götz konnte sich nicht sattsehen an dem Bild, das Mutter und Kind boten. Auch ihm wurde es nun erst so ganz bewußt, was Liebe alles einschloß. Dieses Kind war lebendig gewordene Liebe. Es war gut, daß er nicht wußte, was Anna Renz mit ihm vorgehabt hatte. Dieses erste Beisammensein zu dritt stimmte sie dankbar und andächtig.
Es sollte durch keine kummervollen Gedanken getrübt werden.
Leonore war heimgefahren, um ihren Mann zu holen. Und auch er konnte dann seinen Enkel betrachten, der in sein Bettchen gelegt worden war.
Sandra wollte er am nächsten Vormittag seinen Besuch machen. Daß Elisabeth sich für Bastian entschieden hatte, verstand er.
»Wenn es nur ein so anständiger Mann ist, wie sie ihn verdient«, meinte er.
»Daran besteht kein Zweifel«, sagte Leonore. »Wir sollten überhaupt mehr aufs Land fahren, Ulrich. Wir haben viel Zeit vergeudet in dieser oberflächlichen Gesellschaft. Dieses seichte Geplapper kann einem doch nichts geben.«
»Götz und Sandra werden es ja ohnehin vorziehen, außerhalb der Stadt zu leben«, sagte er. »Und ich hoffe doch, daß sie uns oft gestatten, sie zu besuchen.« Und er warf einen letzten langen Blick auf den kleinen Götz. »Ein Prachtkerlchen«, sagte er gerührt. »Ich habe noch nie ein so hübsches Baby gesehen.«
Leonore lächelte in sich hinein, und sie dachte zurück. Damals, als ihre Kinder geboren wurden, war er zwar auch ein stolzer Vater gewesen, aber er hatte doch nicht so recht etwas mit den Kleinen anzufangen gewußt.
»Wie sich doch alles geändert hat«, sagte sie sinnend.
»Aber glücklicherweise sind wir noch jung genug, um uns hoffentlich noch recht lange an dem Nachwuchs zu erfreuen, Lori.«
Auch ihre Ehe hatte dieses Ereignis gut getan, das empfand Leonore mit inniger Freude. Fast dreißig Jahre waren sie nun schon verheiratet, und wenn sie ganz ehrlich miteinander waren, so mußten sie zugeben, daß es doch schon ziemlich lange ein oberflächliches Zusammenleben gewesen war, im Trott der Gewohnheit. Auch das war nun wieder anders geworden.
*
Bei den Nordens gab es keinen Trott. Sie lebten miteinander und füreinander, und Fee war froh und erleichtert, als ihr Mann endlich heimkehrte.
»Ja, da hat sich nun allerhand zusammengedrängt«, sagte er schmunzelnd. »Ein junges Paar ist glücklich vereint und kann sich an seinem Kind freuen. Ein anderes Kind wird nun doch nicht zur Welt kommen, und die flotte Carola wird jetzt heilfroh sein, daß sie mit einer vorgetäuschten Schwangerschaft nicht ins Unglück gerudert ist.«
»Wie das?« fragte Fee verblüfft.
»Frau von Hellbrink hat es mir erzählt, daß ihre exzentrische Tochter die Heirat mit diesem Fechner erzwingen wollte, indem sie vorgab, sie bekäme ein Kind. Sie hat es sich schnell überlegt.«
»Was sind die Mädchen doch manchmal blöd«, sagte Fee kopfschüttelnd.
»Hellbrink mag seine Fehler haben, aber da hat er doch die richtige Methode angewandt.«
»Welche?«
»Er hat gesagt, daß sie Fechner ruhig heiraten könne, auf seine Unterstützung dann aber nicht mehr zu rechnen brauche. Und siehe da, Herr Fechner ließ die Maske fallen und schickte die hübsche Carola zum Teufel.«
»Ziemlich schlimm«, meinte Fee. »Hoffentlich wird sie damit fertig.«
»Da ist Frau von Hellbrink unbesorgt. Sie ist überhaupt anders, als ich sie eingeschätzt habe.«
»Auch ein Dr. Norden kann sich täuschen«, sagte Fee neckend.
»Es kränkt ihn nicht, wenn etwas Gutes dabei herauskommt, mein Schatz. Am meisten aber freut es mich, daß die tapfere Elisabeth an einen so liebenswerten Mann geraten ist. Bastian gefällt mir sehr.«
»Mir auch. Die beiden geben ein gutes Gespann ab. Da wird keiner ausbrechen. Ich hätte es Dr. Urban vergönnt, daß er das noch erlebt hätte.«
»Für ihn ist es besser so, Feelein. Es wird noch viel im Dreck herumgewühlt werden, und ungeschoren wird auch sein Name nicht bleiben. Es ist nicht gut, die Augen vor dem zu verschließen, was man einfach nicht wahrhaben will. Man muß den Tatsachen ins Auge blicken und darf sich nicht um eine Verantwortung herumdrücken.«
»Er ist tot«, sagte Fee leise. »Da ist immer Sorge, Furcht, Hoffnung und zuletzt der Tod.«
»Du sprichst ein großes Wort gelassen aus«, zitierte er Goethe auf dieses Bibelwort.
Aber Dr. Urban hatte verhindert, daß Sandras Baby verkauft wurde, und das, so meinte Luise an seinem Grab, würde ihm vom göttlichen Gericht schon angerechnet werden.
Die irdischen Richter hätten ihm nichts anhaben können, und der einzige Fall, der Anna Renz nachweisbar angelastet werden konnte, war der Tausch von Sandras und Cornelias Baby. Aber Cornelia Mölnik hatte, wie alle anderen auch, die schriftliche Einwilligung gegeben, daß sie ihr Baby zur Adoption freigeben würde. Nur Sandra bildete eine Ausnahme, denn auch Hilde konnte nicht leugnen, daß sie dazu bereit gewesen war. Es meldete sich sonst niemand mehr. Alle hatten wohl Angst, in die Tretmühle der Ermittlungen zu geraten, und viele bereuten es auch nicht, ihr Kind weggeben zu haben.
Anna Renz konnte anführen, daß sie manche Adoption auf rechtlichem Wege vermittelt hatte. Sie erklärte auch, daß sie das Entbindungsheim ohnehin nicht mehr weiterführen wollte. Sie sagte, daß Dr. Urban den Babytausch vorgenommen hätte und daß er dann von Reue gepackt und sie selbst durch Christels Frühgeburt aus dem Gleichgewicht gebracht worden wäre. Man könne ihr schließlich nichts vorwerfen, weil sie ja Dr. Norden um Hilfe gebeten hätte, und von ihm wäre Christel ja höchstpersönlich in das Entbindungsheim gebracht worden.
Ja, da war Dr. Norden ganz hübsch in Bedrängnis geraten, aber Christel sagte aus, daß sie ihn darum gebeten hätte, sie in dieses Entbindungsheim zu bringen, und das war auch nicht zu widerlegen.
Anna Renz wurde zu einer Haftstrafe mit Bewährungsfrist und zu einer beträchtlichen Geldstrafe verurteilt, was sie wohl am meisten schmerzte, da Dr. Urban seinen gesamten Nachlaß testamentarisch Luise und Bastian zugesprochen hatte. Daran gab es nichts zu rütteln.
Sandra, Cornelia und Christel hatten ihre Kinder, und alle drei wollten nicht mehr an diese düsteren Stunden erinnert werden. Christel heiratete ihren Verlobten, Cornelia wurde von ihren Eltern aufgenommen, die auch von Gewissensbissen geplagt worden waren. Es war wahrscheinlich, daß so manches Kind, das Anna Renz für eine beträchtliche Summe weggegeben hatte, was ihr aber keineswegs nachzuweisen war, da sie sich längst ein Konto in der Schweiz zugelegt hatte, unter bedeutend glücklicheren Umständen aufwuchs, als es sonst der Fall gewesen wäre.
Fee Norden meinte jedenfalls, daß Daniel sich keine Gewissensbisse machen müsse. Sie sei es ja gewesen, die den Stein ins Rollen gebracht hätte.
Aber eigentlich war es Elisabeth gewesen, und sie sollte sich gewiß keine Vorwürfe machen. Der Mensch tut nicht alles aus sich selbst, er arbeitet auch dem Schicksal in die Hände. Es sollte sich erweisen, daß Elisabeth wohl vom Schicksal ausersehen worden war, im rechten Augenblick einzugreifen in das Rad, das dem Unglück hätte zusteuern können.
Wie Bastian es gewünscht hatte, warteten sie nicht lange mit der Hochzeit, und für Luise war es der schönste Tag ihres Lebens, als die beiden sich das Jawort gaben.
Hilde hatte das Tief überwunden. An Bertis Seite folgte sie dem Brautpaar, dem die Dorfbewohner freudig zuwinkten.
Herrliche Blumen und praktische Geschenke hatten die Hellbrinks geschickt, und das Festmahl in Bastians Gasthof ließ nichts zu wünschen übrig.
Die hübscheste Wirtin weit und breit würde Elisabeth sein, darüber waren sich alle einig, aber für Bastian galt es, daß sie die liebenswerteste Frau war, die ihm ein gnädiges Schicksal geschenkt hatte.
»Grad neidisch könnte man werden«, sagte Berti zu Hilde. »Aber vielleicht können wir es ihnen mal nachmachen, wenn genug Zeit vergangen ist.«
Da erging es Hilde so wie ein paar Wochen zuvor Elisabeth. Nicht so plötzlich war das Gefühl, aber Hoffnung blühte in ihrem Innern auf, und ihre Augen begannen zu leuchten. Die Last, die sie mit sich herumgeschleppt hatte, fiel von ihren Schultern.
Luise lächelte gütig, als sie ihnen zuschaute, wie sie den Walzer tanzten, und als Elisabeth dann ihren Brautstrauß in die Luft warf, fing Hilde ihn auf.
Volksbrauch war es, daß sie nun die nächste Braut sein würde. Immer traf es nicht zu, aber doch in diesem Fall, wenn auch noch Monate darüber vergingen.
Vorher noch sollte sich Luise an ihrem ersten Enkelkind freuen, das sich ganz pünktlich eingestellt hatte. Und welch größeres Glück konnte es für sie geben, als ihm ins Erdendasein zu verhelfen.
Wie hatte sie sich darauf gefreut. Wochenlang schon hatte sie ihre verarbeiteten Hände gepflegt, wie nie zuvor. Ganz weich und behutsam umfaßte sie das Baby, das sich da ins Leben drängte, ganz hübsch gewichtig, wie man es der zarten Elisabeth nicht zugetraut hätte, wie so manches andere auch nicht. Bis zuletzt hatte sie ihrem Mann geholfen. Sie ruhten sich beide nicht auf Onkel Gottliebs Erbe aus, das für andere Zwecke verwendet werden sollte. Eine neue Schule wurde nämlich im Dorf gebraucht, und die Kirche mußte renoviert werden. Ja, und an die Zukunft der Kinder mußte auch gedacht werden, denn bei dem einen sollte es nicht bleiben.
Der kleine Götz von Hellbrink, ganz die Mutter, wie die gesamte Familie beteuerte, tat bereits seine ersten Schritte, als die Hellbrinks kamen, um der Taufe Daniel Urbans beizuwohnen. Daß er den Namen seines Paten bekam, war abgemacht, wenn Bastian auch energisch erklärte, daß eine Tochter nur Elisabeth heißen dürfe. Hilde hatte sich abgewöhnen müssen, ihre Schwester Lis zu nennen, und auch Sandra war längst davon unterrichtet, daß Bastian ihren Namen nicht »verunstaltet« hören wollte.
Die Freundschaft hielt und hatte sich noch mehr gefestigt. Die Hellbrinks waren gern zu Gast im Dorf, und sie bauten sich dann auch ein Häuschen auf einem Grundstück, das Dr. Urban gehört hatte.
Selbst Carola fand Gefallen daran, diesen ländlichen Frieden zu genießen, da ihr nicht so schnell ein Mann begegnete, dem sie trauen konnte.
Sie trug wohl am schwersten an der Last der Vergangenheit, obgleich alle bemüht waren, sie diese vergessen zu lassen.
Die Hauptrolle im Leben ihrer Eltern aber spielte der kleine Götz. Der Tag, an dem er Omi und Opi sagte, wurde gefeiert, aber richtig froh lachen konnte Carola erst an dem Tag, als dieser niedliche kleine Junge ihr entgegenlief und Caro rief.
Da trug Sandra schon ihr zweites Kind unter dem Herzen. Dr. Leitner hatte es ihr bei der Untersuchung bestätigt. Und diesmal wurde sie vom ersten Tag der Gewißheit an umsorgt.
Manchmal war es sogar ein bißchen viel der Fürsorge, denn das Telefon in ihrem hübschen Haus, das sie mit Götz bewohnte, stand nicht still.
Jeden Morgen, kaum hatte Götz das Haus verlassen, rief schon Ulrich von Hellbrink an. »Wie geht es dir, Sandra?« fragte er. »Götz kann ruhig daheimbleiben, wenn du dich nicht wohl fühlst.«
»Ich fühle mich sehr wohl, Papa«, erwiderte Sandra dann.
Schon wenig später rief Carola an. »Mama kommt gleich, Sandra. Schreib nur alles auf, was ihr braucht, wir besorgen es schon. Kann ich am Nachmittag ein bißchen mit unserem Burschi spazierengehen?«
Dann war auch schon Leonore da. »Wie geht es dir, mein Herzenskind?« fragte sie.
»Bestens, Mama«, erwiderte Sandra. »Ihr seid rührend, aber mir fehlt es an nichts.«
»Sind wir dir lästig?« fragte Leonore.
»Aber nein, Mama. Es wäre nur gut, wenn Carola auch heiraten und ein paar Kinder in die Welt setzen würde, damit ihr euch um mich nicht immer so sehr sorgt.«
»Bei ihr sitzt der Schock viel tiefer, als wir dachten, Sandra. Zuerst waren wir ja froh, daß sie sich ganz aus diesen Cliquen zurückgezogen hat, aber jetzt verbringt sie ihre Zeit lieber mit dem kleinen Götz oder draußen auf dem Dorf.«
»Vielleicht ist sie gern auf dem Dorf, weil sie sich mit Bertis Cousin gut versteht«, sagte Sandra.
»Du glaubst das wirklich?«
»Ja, das glaube ich, aber Carola hat wohl ein bißchen Angst, daß ihr ihn nicht akzeptiert.«
»So ein Blödsinn«, sagte Leonore. »Über diese Vorurteile sind wir doch Gott sei Dank längst erhaben. Wir möchten nur glückliche Kinder um uns haben. Meinst du denn wirklich, daß sie sich mit Maximilian so gut versteht?«
»Sie ist gern mit ihm zusammen, mehr möchte ich nicht sagen. Du kannst doch mal mit ihr sprechen, Mama, wenn ihr draußen seid.«
»Und wenn ich wieder was falsch mache?«
»Du machst nichts falsch, Mama!«
*
Viel Zeit sollte nicht mehr verstreichen, bis Carola von Hellbrink die Frau des schlichten Landwirts Maximilian Werburg wurde. Sie war glücklich geworden, und Ulrich und Leonore von Hellbrink mußten ihre Zeit auch bald einteilen, um allen Enkeln gerecht werden zu können.
Ein bißchen zu jung fühlte sich Ulrich schon noch, um sich ganz aus dem Geschäft zurückzuziehen, aber die Hauptarbeit überließ er doch seinem Sohn Götz.
»Das haben wir nun von deiner Kuppelei, Sandra«, meinte der dazu. »Öfter sind wir jetzt auch nicht für uns.«
»Aber alle sind glücklich«, erwiderte Sandra lächelnd, »und das ist doch wunderschön.«
Es war besonders schön, wenn sie draußen waren auf dem Dorf und alle beisammen am großen runden Tisch in Bastians Gasthof. Dann sprachen sie auch manchmal von vergangenen Tagen, ohne trübsinnig zu werden. Ganz groß war die Freude, wenn die Nordens mit am Tisch saßen, während draußen die Kinder fröhlich herumtollten.
Aber sie vergaßen es nie, Blumen auf Dr. Urbans Grab zu bringen, der doch seinen Teil dazu beigetragen hatte, daß dieses junge Glück wuchs und gedieh.
Von Anna Renz und ihrem Sohn Sepp hörten sie nichts mehr. Das Entbindungsheim war von einer Ärztin übernommen worden, mit der Dr. Norden und Dr. Leitner gern zusammenarbeiteten, denn oft genug gab es junge Frauen, die dem Problem, Mutter zu werden, allein nicht gewachsen waren. Hier waren sie fortan gut aufgehoben, ganz gleich, wie ihre Entscheidung ausfiel, ihr Kind behalten oder auch zur Adoption geben zu wollen. Denn über eines waren sich die Ärzte ganz einig: Wenn alles mit rechten Dingen zuging, war den Kindern in den meisten Fällen eine glückliche Zukunft eröffnet, wenn sie ein liebevolles Elternhaus hatten, wobei aber auch nicht vergessen wurde, daß es zu jeder Zeit Mütter wie Luise gab, die die Kraft und den Charakter hatten, ihre Kinder allein zu aufrechten Menschen zu erziehen.
Bastian war der beste Beweis dafür. Er war, nach Elisabeths Worten, der beste Vater, den sich Kinder wünschen konnten. Aber das gleiche sagte auch Hilde von ihrem Berti, Sandra von ihrem Götz, Carola nicht viel später von ihrem Maximilian, wenn Fee auch überzeugt war, daß ihr Daniel der allerbeste Vater und Ehemann unter Gottes weitem Himmel sei. Aber Luise Urban dankte dem Herrgott jeden Tag, daß sie so viel Glück und Freude erleben und noch so vielen Kindern zum Erdendasein verhelfen durfte.
Selbst Carola vertraute sich ihr an, und einen schlüssigeren Beweis konnten ihre Eltern nicht erhalten, daß sie restlos und in sich selbst zufrieden geworden war in ihrer Ehe und mit ihrem Leben in dem hübschen Dorf.
Manchmal hielt Luise stumme Zweisprache mit ihrem guten Gottlieb, und dann war es ihr, als schaue er lächelnd vom Himmel herab, weil hier drunten auf der Erde alles so prächtig gedieh.