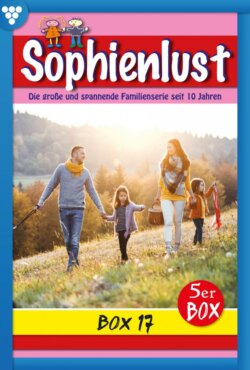Читать книгу Sophienlust Box 17 – Familienroman - Patricia Vandenberg - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Sie kommen, sie kommen!«, schrie Henrik von Schoenecker aus Leibeskräften. Er war auf einen Baum geklettert, um den Rolls-Royce auch ganz bestimmt als Erster zu erblicken. Denn für ihn und alle Kinder von Sophienlust war es hochinteressant, dass ein fünfjähriger Junge in einem Rolls-Royce ankommen sollte.
Henrik wusste das von seinem Vater. Alexander von Schoenecker hatte dieselbe Schule besucht wie der Vater von Bastian Schlüter. Bei einem Abituriententreffen waren die beiden einander vor Kurzem wiederbegegnet, nachdem sie sich zuvor vollkommen aus den Augen verloren hatten. Kurt Schlüter hatte Alexander von Schoenecker bei dem Wiedersehen erzählt, dass er für drei Monate auf Reisen gehen wollte. Was hatte da nähergelegen, als dass Alexander von Schoenecker sofort von Sohienlust berichtet und dem Schulkameraden von ehedem die Aufnahme seines Jungen angeboten hatte?
Während der große Wagen sich langsam dem Herrenhaus von Sohienlust näherte, versammelten sich die Kinder in der Nähe des Eingangs, um nur ja die Ankunft Bastian Schlüters nicht zu versäumen.
»Seinen Hund bringt er auch mit. Eine Dogge«, äußerte Dominik von Wellentin-Schoenecker. »Vati hat erzählt, dass es ein besonders wohlerzogener Hund ist.«
Der Lärm, den die Kinder gemacht hatten, war im Hause nicht unbemerkt geblieben. Denise und Alexander von Schoenecker, die beide von Schoeneich nach Sophienlust gekommen waren, um Alexanders Schulfreund mit seinem Sohn willkommen zu heißen, traten in dem Augenblick vors Haus, als der Rolls-Royce gerade vor der Freitreppe hielt. Es war ein imponierender Anblick.
Jetzt sprang ein livrierter Chauffeur aus dem Wagen und riss den Schlag auf. Ein ziemlich korpulenter Mann, den man gut und gern zehn Jahre älter als Alexander von Schoenecker geschätzt hätte, obwohl er doch gleichaltrig sein musste, stieg schwerfällig aus. Er würdigte die Gruppe von Kindern keines Blickes, sodass diese, die sonst die Gäste herzlich begrüßten, es nicht wagten zu lächeln oder gar zu winken.
Nun stieg Bastian Schlüter aus. Er war ein blasser kleiner Kerl mit kurz geschorenen Haaren. Ihm folgte die Dogge Wiking.
Es war vor allem das Verhalten des Tieres, das den Kindern von Sophienlust den Atem verschlug. Der Hund sprang nicht etwa aus dem Auto, sondern stieg langsam aus – jeder Zoll Würde und gutes Benehmen. Dann stolzierte er gemessenen Schrittes einen halben Meter hinter Bastian Schlüter her. Vater, Sohn und Hund wirkten alle drei zusammen wie aufgezogene Puppen.
»Willkommen, Kurt«, sagte Alexander von Schoenecker indessen laut und herzlich. »Denise, das ist also mein ehemaliger Schulkamerad Kurt Schlüter.«
Denise reichte dem dicklichen Herrn mit dem hochmütigen, blasierten Gesicht die Hand. Er gefiel ihr nicht. Aber darauf kam es jetzt nicht an. Es ging schließlich nicht um den Vater, sondern um den Sohn.
»Halte dich gerade, Bastian!«, zischte Kurt Schlüter seinem Sohn zu. »Sag anständig guten Tag.«
Der kleine Kerl reckte sich auf und verbeugte sich wie eine Marionette vor Denise und Alexander.
»Ich habe nicht viel Zeit, gnädige Frau«, verkündete Kurt Schlüter mit wichtiger Miene. »Vielleicht können wir die nötigen geschäftlichen Dinge sofort regeln. Mein Sohn darf wohl inzwischen bei den Kindern warten.«
Die drei Erwachsenen wandten sich dem Haus zu, während Henrik sich ein Herz fasste und auf den Jungen zuging. »Bist du Bastian?«, fragte er.
»Ja, ich bin Bastian Schlüter, der Sohn des Generaldirektors Schlüter.« Dabei warf der Junge seinem Vater einen ängstlichen Blick zu, als wollte er fragen, ob es so auch recht sei.
Die großen Kinder fingen an zu kichern. Deutlich konnte man dann Pünktchens Stimme vernehmen. »Der hat wohl eine mittelgroße Meise. Das interessiert uns doch überhaupt nicht.«
Vicky war so entrüstet, dass sie den erschrockenen Jungen grob anfuhr: »Was dein Vater ist, hat auf Sophienlust gar keine Bedeutung. Es ist uns schnuppe und wurscht. Das kannst du dir gleich hinter die Ohren schreiben. Wir sind hier alle dasselbe – Kinder von Sophienlust. Wem das nicht genug ist, der braucht gar nicht erst zu kommen. Überlege dir lieber noch, ob du mit eurem piekfeinen Chauffeur nicht lieber wieder zurückfahren willst. Deinen affigen Köter kannst du auch gleich mitnehmen. Der hat wohl einen Quirl verschluckt? Oder ist er etwa krank?«
Bevor der arme Bastian etwas erwidern konnte, war Denise schon umgekehrt und hatte ihren Arm um den kleinen Buben gelegt. Davon, dass der Generaldirektor rot anlief vor Ärger, nahm sie keine Notiz, aber Bastians Reaktion bereitete ihr Sorgen. Der Junge war ganz blass geworden.
»Vicky«, sagte Denise mahnend und sah das kleine Mädchen dabei vorwurfsvoll an, sodass Vicky beschämt die Augen senkte. Das Temperament war mit ihr durchgegangen. Zu spät fiel ihr ein, dass man Gästen gegenüber höflich sein musste, auch wenn einem nicht alles richtig erschien, was sie taten.
»Bastian wollte uns nur sagen, wie er heißt und was sein Vater ist. Jetzt wissen wir es, Vicky«, meinte Denise und strich dem Buben über das kurze Haar. »Er bildet sich bestimmt nichts darauf ein. So dumm ist Bastian nicht.«
Ein dankbarer Blick aus den treuherzigen braunen Jungenaugen traf Denise. Rasch ermutigte sie das Kind. »Du wirst dich schon mit ihnen vertragen, Bastian. Ich kümmere mich später noch um dich. Jetzt muss ich erst mit deinem Vater sprechen, weil er nicht viel Zeit hat.«
»Ja, gnädige Frau. Vati hat nie viel Zeit«, antwortete Bastian.
»Du brauchst nicht gnädige Frau zu mir sagen«, entgegnete Denise lächelnd. »Alle Kinder in Sophienlust nennen mich Tante Isi. Also bis später, Bastian.«
»Was für ein freches, vorlautes kleines Mädchen«, äußerte der Generaldirektor abfällig, bevor er mit den anderen Erwachsenen das Herrenhaus betrat.
Henrik streckte Bastian die Hand hin. »Willkommen in Sophienlust. Es wird dir bestimmt bei uns gefallen. Wir haben viele Tiere hier, und dein Hund wird sich sicher auch bald bei uns zu Hause fühlen. Wie heißt er denn?«
Henrik gab sich alle Mühe, den ungünstigen Eindruck, den Vickys spontane Äußerung hervorgerufen hatte, zu verwischen. Ihm imponierte der Rolls-Royce, wenn er auch das Verhalten der Schlüters und ihres Hundes reichlich verwunderlich fand.
»Wie heißt du, bitte?«, fragte Bastian höflich. »Der Hund heißt Wiking. Er ist ein gut erzogenes Tier und darf immer mit am Tisch essen.«
»Stimmt das?«, fragte Nick mit krauser Stirn. »Das gibt es doch gar nicht. Und wenn, dann ist es ziemlich unappetitlich.«
»Es ist gar nicht unappetitlich. Wiking wartet, bis seine Wurst in kleine Stückchen geschnitten ist. Dann nimmt er sie ganz manierlich vom Teller«, verkündete Bastian, dessen erschüttertes Selbstbewusstsein allmählich wiederkehrte.
»Na, wir werden es ja erleben«, entgegnete Angelika zweifelnd. »Außerdem bleibt die Frage, ob Tante Ma das duldet.«
Sofort füllten sich Bastians Augen mit Tränen. »Wenn mein Wiking nicht bei mir sein darf, fahre ich gleich wieder ab. Ihr habt ja sowieso gesagt, dass ich nicht bleiben soll, wenn’s mir nicht gefällt.« Das klang trotzig und zugleich angeberisch.
Pünktchen legte den Arm um den kleinen Jungen, fast genauso lieb und mütterlich wie zuvor Denise von Schoenecker. »Es wird schon irgendwie klappen, Bastian. Tante Ma ist unsere Heimleiterin und wahnsinnig nett. Vielleicht erlaubt sie es, wenn dein Hund wirklich so ein Wundertier ist.«
»Sie muss machen, was mein Vati sagt«, trumpfte Bastian auf. »Mein Vati hat nämlich alles zu bestimmen.«
Pünktchen verzog den Mund. »Ach, so ist das«, murmelte sie betreten. »Nun, wir werden es ja erleben.«
»Einstweilen können wir Bastian unsere Tiere zeigen. Wir haben nämlich Ponys auf Sophienlust. Interessiert dich das?«, mischte sich Nick ein, der sich für den Ablauf der Geschehnisse in gewisser Weise verantwortlich fühlte. Denn ihm war Sophienlust als Erbe seiner Urgroßmutter Sophie von Wellentin zugefallen. Er stammte aus der ersten Ehe seiner Mutter, die in zweiter Ehe Alexander von Schoenecker geheiratet hatte. Der Gutsherr von Schoeneich war verwitwet gewesen und hatte zwei größere Kinder, Sascha und Andrea, mit in die Ehe gebracht. Jetzt studierte Sascha in Heidelberg, Andrea aber war bereits verheiratet. Der jüngste Sproß der glücklichen Familie, deren Wohnsitz das unweit von Sophienlust gelegene Gut Schoeneich war, war Henrik, der nun schon die Dorfschule besuchte.
Nick war von Bastian Schlüter nicht sonderlich entzückt, aber er ließ es sich nicht anmerken, sondern gab sich alle Mühe, sich als vorbildlicher Hausherr zu zeigen. Je älter Dominik, genannt Nick, wurde, desto mehr wuchs er zur Freude seiner Eltern in seine künftige Aufgabe als Herr auf Sophienlust hinein. Doch im Augenblick wurde das Kinderheim – nach dem Willen der Erblasserin Sophie von Wellentin im ehemaligen Herrenhaus eingerichtet – noch von seiner Mutter mit Unterstützung der tüchtigen Frau Rennert geleitet. Die Verwaltung des Gutsbetriebes hatte dagegen Nicks Stiefvater Alexander von Schoeneich übernommen.
Die Erwähnung der Ponys machte den verwöhnten, affektierten Neuling ein bisschen neugierig. Einigermaßen einträchtig zog die Kinderschar los, um Bastian Schlüter Sophienlust zunächst einmal zu zeigen.
*
Die Unterhaltung, die sich zur gleichen Zeit im Biedermeierzimmer des Herrenhauses von Sophienlust abspielte, war für Alexander und Denise von Schoenecker nicht gerade erfreulich. Längst hatte Alexander sein spontanes Angebot an den früheren Klassenkameraden bereut. Kurt Schlüter lebte jetzt in Augsburg und besaß dort eine Fabrik. Er war zu großem Reichtum gekommen, doch das war ihm leider entsetzlich zu Kopf gestiegen. Schon die Art, wie er seinen Sohn dazu angehalten hatte, jedermann zu verkünden, dass er der Sprössling des Herrn Generaldirektors sei, wirkte auf so natürliche Menschen wie die von Schoeneckers abstoßend. Auch sonst hatte Alexander, der sich inzwischen eingehend über Kurt Schlüter erkundigt hatte, allerlei Ungünstiges zu hören bekommen. Doch er hatte die einmal gegebene Zusage nicht rückgängig machen wollen.
Jetzt also saß das Ehepaar von Schoenecker zusammen mit Kurt Schlüter im ehemaligen Wohnzimmer Sophie von Wellentins, deren Ölgemälde auf jeden Besucher von Sophienlust herabblickte. Dieses Zimmer war so geblieben, wie es zu Lebzeiten von Nicks Urgroßmutter gewesen war. Denise hielt manchmal mit dem Bild der alten Dame stumme Zwiesprache und holte sich auf diese Weise Rat und Kraft, wenn sie in einer ausweglosen Situation nicht mehr weiter wusste. Denn mit den Kindern hatten schon viele schwere Schicksale in Sophienlust Einzug gehalten, das gelegentlich auch in Not geratenen Erwachsenen Zuflucht bot.
Was Kurt Schlüter allerdings zu berichten hatte, das veranlasste Alexander von Schoenecker, seiner Frau einen schuldbewussten Blick zuzuwerfen. Nein, damit hatte er denn doch nicht gerechnet!
»Wir sind ja unter uns, und ich brauche kein Blatt vor den Mund zu nehmen«, begann Kurt Schlüter, nachdem man sich über Pensionspreis und Dauer des Aufenthalts von Bastian rasch einig geworden war.
»Selbstverständlich, Kurt, sprich dich nur aus«, warf Alexander ein. »Meine Frau legt Wert darauf, die persönlichen Verhältnisse unserer Kinder kennenzulernen. Das erleichtert ihr den Umgang mit einem neuen Kind, wie du dir gewiss vorstellen kannst.«
»Nun ja, ich sagte dir bereits, dass ich für drei Monate auf eine Weltreise gehen werde. Aber im Rahmen unseres Abituriententreffens fand ich keine Gelegenheit, dir die Einzelheiten zu erläutern. Schau, ich werde nicht allein reisen. Hoffentlich finden Sie das nicht schockierend, gnädige Frau.«
Denise lächelte ihn scheinbar unschuldig an. »Ich nehme an, Sie reisen mit Ihrer Frau, Herr Schlüter«, sagte sie. Dabei wusste sie genau, dass sie ihn damit ein bisschen in Verlegenheit brachte.
»Nein, nicht mit Angela. Wir beide haben uns leider völlig auseinandergelebt«, versetzte Kurt Schlüter betont kalt. Denises Frage war ihm nicht einmal peinlich. »Gerade Sie werden verstehen, dass man in einer gewissen gesellschaftlichen Stellung mit einem Bäckermeistertöchterlein nichts anfangen kann. Sie passt einfach nicht mehr in die Landschaft. Sie wird unsicher, wenn bei mir bekannte und berühmte Leute im Haus aus und ein gehen, ja, sie benimmt sich meist ganz unmöglich und bringt mich in die unangenehmsten Situationen. Es ging einfach nicht mehr mit Angela und mir. Das hat sie auch eingesehen. Allerdings sind wir bis jetzt nicht geschieden. Das muss in der richtigen Weise geschehen, damit es keinen Skandal gibt. So etwas kann ich mir in meiner Stellung natürlich nicht leisten. Sie verstehen doch, gnädige Frau, und du auch, Alexander?«
Weder Denise noch Alexander von Schoenecker antworteten darauf. Doch selbst das erschütterte den Herrn Generaldirektor nicht. Er fuhr fort: »Ich reise mit Hella von Walden, meiner Freundin. Sie stammt aus verarmtem Adelsgeschlecht und ist eine schöne Frau. Sowie die Sache mit Angela geregelt ist, werden wir heiraten. Aber erst einmal will ich drei Monate lang alles hinter mir lassen und mich gründlich erholen. Ich hatte entsetzlich viel Arbeit in den letzten beiden Jahren und habe eine Ausspannung dringend nötig. Hella wird mich begleiten und ablenken. Wenn wir wiederkommen, sehen wir weiter.«
»Wird Ihre Frau Bastian besuchen kommen?«, erkundigte sich Denise reserviert.
Kurt Schlüter schüttelte den Kopf. »Nein, sie weiß gar nichts davon, dass ich verreise, und soll es auch nicht erfahren. Dass ich Bastian hierherbringe, habe ich ihr ebenfalls nicht mitgeteilt, nur, dass der Junge sich in einem erstklassigen Heim befindet. Sie wird sich damit zufriedengeben, denn sie hat keine Zeit, sich um Bastian zu kümmern. Starrköpfig, wie sie immer schon war, lehnt sie jede finanzielle Unterstützung von mir ab und ist berufstätig – glücklicherweise nicht in Augsburg. Das wäre doch zu geschmacklos. Sie haust irgendwo in einem möblierten Zimmer und schmollt. Aber ich bin überzeugt, dass sie mir wegen der Scheidung keine Schwierigkeiten machen wird. Die Ehe mit ihr war ein Irrtum von beiden Seiten. Es fing schon damit an, dass wir jahrelang vergeblich auf Nachwuchs warteten. Dann endlich stellte sich Bastian ein. Aber er ist ein schwächliches Kind, hält sich schlecht und ist schwer zu erziehen. Ich mache mir Sorgen, wie er mal mein Nachfolger werden soll. Es sieht bis jetzt so aus, als hätte er dazu gar nicht das Zeug. Er hat zu viel von Angela. Aber das ist nun leider nicht zu ändern.« Kurt Schlüter seufzte, als sei er von einem schweren, ungerechten Schicksalsschlag betroffen worden.
Alexander von Schoenecker beendete die peinliche und unerfreuliche Unterredung. Fast unhöflich machte er Kurt Schlüter darauf aufmerksam, dass schon fast eine halbe Stunde verstrichen sei und dass er es doch eilig hatte.
Schon wenige Minuten später begleitete das Ehepaar von Schoenecker Kurt Schlüter zu seinem Rolls-Royce, der von Henrik und einigen anderen Jungen in der Zwischenzeit aus ehrfürchtiger Entfernung bestaunt worden war. Wegen des Chauffeurs, der steif wie eine ausgestopfte Schaufensterfigur hinter dem Steuer saß, trauten sich die Buben nicht näher heran. Sie schlossen sich schließlich den anderen Kindern an, die Bastian Sophienlust zeigten.
Kurt Schlüter verzog ein bisschen die Nase, als Bastian nach einigem Suchen ausgerechnet im Schweinestall entdeckt wurde, wo Nick ihm gerade eine Sau mit einem Wurf von vierzehn Ferkeln gezeigt hatte.
»Im Schweinestall warst du?«, wandte er sich an seinen Sohn. »Das ist auch nicht der richtige Aufenthalt für dich. Also, benimm dich hier so, wie es Herr und Frau von Schoenecker von dir erwarten können, mein Sohn. Ich werde dir von unterwegs Postkarten schreiben. Dann kannst du immer im Atlas nachsehen, wo ich bin. Wenn ich zurückkomme, werde ich fragen, ob du es noch weißt.«
Bastian verabschiedete sich von seinem Vater wie von einem fremden Herrn und mit dem Ernst eines Erwachsenen. Wäre das unkindliche Verhalten des kleinen Buben nicht so herzergreifend unnatürlich gewesen, hätte es fast lächerlich wirken können.
Denise griff unwillkürlich nach ihres Mannes Hand, als der Chauffeur den Wagenschlag geschlossen und am Steuer des Rolls-Royce Platz genommen hatte. Es ist überstanden!, dachte sie erleichtert. Doch wie wird es mit dem Jungen werden?
*
»Ich brauche aber ein Zimmer für mich allein«, erklärte Bastian etwas später Frau Rennert. »Mein Vati sagt, dass man sich nichts gefallen lassen darf. Ich mag den anderen Jungen nicht leiden. Außerdem schläft Wiking im Bett in meinem Zimmer – in seinem eigenen Bett natürlich.«
Frau Rennert kam aus dem Staunen nicht heraus. »Wie bitte? Ein Hund in einem richtigen Bett und dann noch in deinem Zimmer? Dies ist ein Kinderheim und kein Tierhotel, mein lieber Junge. Ein Tierheim haben wir in Bachenau bei Tante Andrea. Aber die Hunde haben dort ihre Körbchen und keine Betten wie Menschen. So etwas mögen Hunde nämlich gar nicht.«
»Mein Hund mag es aber. Wiking war extra in einer Schule und hat alles gelernt, was ein feiner Hund können muss. Vati hat viel Geld dafür bezahlt. Wiking isst manierlich am Tisch, bellt nicht laut und stört überhaupt nie. Sie werden es schon sehen.«
Frau Rennert legte dem Jungen die Hand auf die Schulter. »Du kannst mich Tante Ma nennen wie alle Kinder, Bastian. Aber die Sache mit deinem Hund müssen wir uns noch gründlich überlegen. Stell dir mal vor, jedes Kind würde einen Hund mit ins Schlaf- und Esszimmer bringen. Es wäre gar nicht auszudenken. Außerdem ist dein Wiking auch noch so riesengroß. Wenn er einmal richtig mit seinem Schwanz wedelt, wird er die Teller vom Tisch werfen oder sonst Schaden anrichten.«
»Du, Tante Ma, so etwas gibt es wirklich«, ließ sich von der Tür her Pünktchen vernehmen. Sie hatte die Szene bis jetzt schweigend verfolgt. Die schwarz-weiße Dogge, um die es ging, hatte währenddessen artig und still auf dem Fußboden gesessen und der Schule, von der Bastian gesprochen hatte, alle Ehre gemacht. »Ich hab’ da mal was in einer Illustrierten gelesen«, fuhr Pünktchen, die eigentlich Angelina Dommin hieß und diesen lustigen Spitznamen den Sommersprossen auf ihrer Nase verdankte, fort. »Es gibt in Deutschland ein Hunde-Internat, ›Schule der feinen Hunde‹ oder so heißt es. Dort lernen die Hunde von verrückten reichen Leuten, wie man vornehm bellt, graziös das Pfötchen gibt und in Hotels artig am Tisch sitzt und vom Teller frisst. Auch wie man im Bett schläft und im Auto sitzt, ebensodass man nicht mit dem Schwanz wedelt, wenn man sich als Hund freut, und so weiter. Richtig spleenig ist es, kann ich dir sagen.«
Bastian stampfte mit dem kleinen Fuß auf. »Mein Hund ist nicht spleenig. Du bist eklig, Pünktchen.« Aller guten Erziehung zum Trotz streckte er Pünktchen die Zunge heraus, was der wohldressierte Hund Wiking sicherlich nie getan hätte.
»Also, Pünktchen, wenn das stimmt, haben wir zwar einen Wunderhund in Sophienlust, aber wir werden trotzdem nicht dulden, dass er bei Bastian im Zimmer schläft. Frau Dr. Frey würde uns mit Recht vorwerfen, dass wir die einfachsten Grundsätze der Hygiene missachten. Wir sind tierlieb in Sophienlust, aber wir lassen den Tieren ihren eigenen Schlafplatz. Deshalb werde ich für diesen Riesenköter einen Korb unten im Wintergarten aufstellen. Du kannst mal zu Justus laufen und fragen, ob er etwas Passendes hat. Und Bastian wird mit Fritzchen das Zimmer teilen, ob es ihm nun passt oder nicht.«
Bastian war anderer Meinung. Doch Frau Rennert – im Umgang mit Kindern sehr erfahren – setzte ihren Willen durch. Immerhin wurde bereits an diesem ersten Tag deutlich, dass man mit Bastian Schlüter einen schwierigen Neuling aufgenommen hatte, der Frau Rennert, Denise und allen anderen im Heim noch manche Nuss zu knacken geben würde.
Schon beim Abendessen ergab sich das nächste Problem. Bastian erschien mit seinem Hund und nötigte das Tier auf einen Stuhl neben dem seinen. Alle waren so fasziniert, dass selbst Frau Rennert zunächst kein Verbot aussprach, sondern sich – genau wie die Kinderschar – auf die Zirkusvorführung freute.
»Was isst denn dein Hund?«, fragte Angelika Langenbach spöttisch.
»Eine Wurst oder ein Stück Fleisch. Habt ihr denn nichts für einen Hund in der Küche?« Hochnäsig, vermutlich so, wie sein Vater zu Hause mit den Dienstboten zu reden pflegte, stellte der Knirps diese Frage.
Nick, der mit seinem Bruder aus lauter Neugier zum Abendessen in Sophienlust geblieben war, erbot sich, bei Magda in der Küche ein Hundegericht zu holen. Allerdings bestand die Köchin darauf, dass Wiking einen Emailleteller erhielt und nicht vom gleichen Geschirr wie die Kinder aß.
Nun konnten die Kinder tatsächlich etwas Erstaunliches erleben. Sie wussten genau, dass jeder normale Hund sich sofort und gierig schmatzend auf sein Futter stürzte und es in wenigen Augenblicken verschlang. Nicht so Wiking. Er blieb angesichts der beiden prächtigen Schnitzel vollkommen ungerührt auf seinem Stuhl sitzen und wartete geduldig.
Triumphierend blickte sich Bastian im Kreise um. Er genoss es sichtlich, im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit zu stehen.
»Seht ihr, Wiking ist ein besonderer Hund«, sagte er stolz. Dann nahm er sein Messer und schnitt in das Fleisch kleine Stücke. »So, Wiking, nun guten Appetit«, erklärte er.
Jetzt begann die Dogge sehr manierlich Stückchen für Stückchen zu fressen. Es war kaum ein Laut zu hören dabei.
»Der könnte im Fernsehen auftreten«, meinte Vicky. »Trotzdem kommt es mir albern vor, wenn ein Hund sich nicht wie ein richtiger Hund benimmt.«
»Aber er darf immer mit am Tisch essen«, trumpfte Bastian auf.
»Ich fürchte, das wird sich bei uns nicht einrichten lassen, Bastian«, erklärte Frau Rennert. »Alle Kinder, besonders die Kleinen, gucken nur noch auf den Hund. Wir kommen gar nicht zum Essen, und wenn wir das Tischgebet sprechen, gehört Wiking auf den Fußboden oder eigentlich gar nicht ins Speisezimmer.«
Bastian zog einen Flunsch. Trotzdem ließ er sich Magdas Abendessen schmecken. Die Köchin hatte schon zu Lebzeiten Sophie von Wellentins auf Sophienlust gekocht, und ihre Küche erfreute sich bei allen Kindern der größten Beliebtheit. Auch bei Bastian fand sie Anklang. Es gab an diesem Abend Rührei mit Schinken und Bratkartoffeln, dazu einen bunten Salat.
Wenig später musste Bastian mit den anderen kleineren Kindern schlafen gehen, obwohl er laut protestierte und behauptete, zu Hause habe er immer noch im Fernsehen die Tagesschau und manchmal auch einen Krimi ansehen dürfen. Vor neun oder halb zehn sei er nie zu Bett gegangen.
»Du musst dich hier schon nach den anderen richten, Bastian«, erklärte Frau Rennert ungerührt. »Außerdem glaube ich, dass du bald nicht mehr so dünn und blass aussehen wirst, wenn du am Abend rechtzeitig ins Bett kommst.«
Bastian versuchte noch einmal seinen Kopf durchzusetzen, aber Frau Rennert hatte den längeren Atem. Sie verfrachtete den aufsässigen Neuling schließlich ins Bett – den Hund dagegen im Wintergarten in einen Korb, der mit einer schönen weichen Decke ausgepolstert worden war. Auch eine Schale mit Wasser stellte sie für Wiking hin, denn man war äußerst tierlieb in Sophienlust. Es gab allerlei Tiere hier. Weder Frau Rennert noch Denise noch Nick hätten genau sagen können, wie viele Katzen, Hunde, Meerschweinchen, Zwerghasen und Kanarienvögel sich zu diesem Zeitpunkt in Sophienlust befanden. Aber ein Hund wie die Dogge Wiking war tatsächlich noch nie dagewesen.
*
»Also, den Jungen habe ich erst einmal gut untergebracht. Alexander von Schoenecker ist mit mir zur Schule gegangen. Honoriger Mann. Das Heim ist in einem schlossartigen Herrenhaus eingerichtet. Man kann nichts dagegen einwenden. Ich hoffe, dass Bastian dort in meinem Sinne erzogen wird, Hella.«
Hella von Walden saß mit ihrem Freund Kurt Schlüter im teuersten Restaurant der Stadt. Soeben war Kaviar serviert worden. Als Nächstes sollte Räucherlachs folgen. Das ausgefallendste und anspruchsvollste Menü war dem Generaldirektor für seine vierundzwanzigjährige junge Freundin gerade gut genug. Er wollte sie verwöhnen und darüber hinwegtrösten, dass es mit der Hochzeit noch ein bisschen dauern musste. Denn bisher hatte sich Angela zu seinem Leidwesen der Scheidung widersetzt.
»Dann können wir also reisen, Liebster?«, flüsterte die hübsche Hella und schenkte Kurt Schlüter einen schmachtenden Blick.
»Ja, in ein paar Tagen. Ich habe bereits einen außerordentlich geschäftstüchtigen Mann gefunden, der mich während meiner Abwesenheit in der Fabrik vertreten wird. Nach so vielen Jahren brauche ich endlich einmal vollkommene Ruhe. Wir werden die ganze Welt sehen und wahnsinnig glücklich sein, Hellachen.«
»Ja, Liebster, ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Aber ich fürchte, dass ich nicht genug Garderobe habe für eine Reise mit dir.«
»Kein Problem. Wir fliegen als Erstes nach Paris. Dort werde ich dich einkleiden. Es ist selbstverständlich, dass du standesgemäß auftreten musst. Das ist es ja, was ich an meiner Frau immer vermisst habe. Sie hat einfach kein Gefühl dafür, dass es Verpflichtungen mit sich bringt, wenn man mit mir in der Öffentlichkeit erscheint. Du sollst die am besten angezogene Frau sein – wo immer wir uns aufhalten. Das verspreche ich dir, Hellachen.«
»Wäre es nicht einfacher, wenn ich mir schon jetzt einiges kaufte, Kurt? Es hält uns auf in Paris …«
»Wir haben Zeit. Paris wird unsere erste Station sein, und es wird mir ein besonderes Vergnügen bereiten, deine Kleider mit auszusuchen.«
Hella von Walden schwieg. Sie war mit dieser Regelung nicht ganz einverstanden. Zwar erfüllte ihr Kurt Schlüter jeden Wunsch, doch er gab ihr so gut wie nie Geld in die Hand. Und gerade darauf war sie aus. Sie wollte selbst über größere Summen verfügen und vor allem etwas auf die Seite bringen können. Doch leider schien Kurt Schlüter in dieser Beziehung vollkommen taub zu sein.
Auf den Lachs folgte ein Rehrücken, danach eine raffinierte Süßspeise und schließlich noch eine Käseplatte.
»Mokka, Hella?«, erkundigte sich Kurt Schlüter.
»Danke, nein, Liebster. Sonst kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe morgen einiges vor.«
Er nickte. »Ich denke, dass wir am Dienstag starten können. Ich rufe dich noch an.«
»Dienstag – wunderbar, Liebster. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Die ganze Welt zu sehen, das war schon immer mein heimlicher Traum. Aber ich hätte nie gedacht, dass er sich einmal verwirklichen lassen würde. Ich verdiene so viel Glück gar nicht, Kurt.«
Er küsste ihr rasch die Hand. »Du bist eine schöne Frau, Hella. Du und ich, wir passen zusammen. Wenn wir erst verheiratet sind, werden wir jedes Jahr eine große Reise machen. Du kannst dir die Ziele aussuchen.«
»Kurt, das hört sich an wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht«, flüsterte Hella von Walden. »Aber jetzt möchte ich nach Hause. Es ist schon reichlich spät geworden. Ich bin müde.«
»Wie du willst, Hella. Du hörst noch von mir. Wie gesagt – Dienstag, spätestens Mittwoch fliegen wir nach Paris.«
Kurt Schlüter zahlte und verließ mit seiner attraktiven Begleiterin das Restaurant. Der Rolls-Royce fuhr sofort vor, denn Henry, der Fahrer, der eigentlich Heinrich hieß, hatte die ganze Zeit aufmerksam die Tür beobachtet, damit sein Herr und Frau von Walden nur ja nicht warten mussten.
Wenig später setzte Kurt Schlüter Hella von Walden vor dem Appartementhaus ab, in dem sie – selbstverständlich auf seine Kosten – eine anspruchsvolle Dreizimmerwohnung hatte.
»Bei dir brennt Licht, Hella«, sagte Kurt Schlüter, als er am Haus in die Höhe blickte.
»Wirklich? Da muss ich wohl vergessen haben, es auszuschalten. Es ging so schnell. Außerdem finde ich es ganz nett, wenn man nicht in die stockdunkle Wohnung zurückkommt. Also, Kurt, bis bald.«
Er nahm ihre Hand und führte sie nochmals an die Lippen. Zu weiteren Zärtlichkeiten kam es nicht, denn Henry war ja dabei.
Hella wartete, bis der Rolls-Royce abgefahren war. Dann betrat sie das Haus und fuhr im Lift hinauf in ihre Wohnung, wo sie auf die Kingel drückte. Drinnen wurden Schritte laut. Ein Lächeln glitt über Hellas hübsches Gesicht. Sie dachte daran, dass Kurt Schlüter keinen Verdacht geschöpft hatte wegen der erleuchteten Fenster.
»Na, endlich! Ich dachte schon, du kommst überhaupt nicht mehr nach Hause.«
Der Mann, der die Tür öffnete, war nicht allzu groß, hatte schwarzes glattes Haar und eine olivfarbene Haut. All das bildete zu der blonden Hella mit ihren eisblauen Augen einen auffälligen Gegensatz. Er breitete die Arme aus und zog das Mädchen in seine Arme.
»Schön siehst du aus, Hella. Wie war’s mit dem alten Schlüter?«
Sie küsste ihn zärtlich. »Langweilig wie immer. Dienstag oder Mittwoch geht die Reise los, Hanko. Leider ist es mir nicht gelungen, ihm ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Er ist so knickerig, wie es nur reiche Leute sein können. Nur lumpige zweihundert hat er mir gegeben, damit ich ein paar Kleinigkeiten einkaufen kann. Es ist zum Davonlaufen.«
»Macht nichts, Hella. Eines Tages sahnen wir ab bei ihm. Im Augenblick habe ich noch etwas Betriebskapital. Du musst mir hierher telegrafieren, sobald eure Reiseroute feststeht. Dann können wir uns unterwegs verabreden. Wenn ich dich drei Monate lang überhaupt nicht sehen soll, halte ich das nämlich nicht aus.«
Er legte den Arm um ihre Schultern und führte sie ins Wohnzimmer, wo er es sich bei Whisky und Radiomusik gemütlich gemacht hatte.
Nach einer zärtlichen Umarmung sprachen die beiden wieder von Kurt Schlüter.
»Er ist ein dicker Geldsack, und er soll sich bloß nicht einbilden, dass ich ihn liebe«, kicherte Hella. »Übrigens glaube ich, er macht sich auch nicht viel aus mir. Aber es schmeichelt ihm, dass er eine Frau haben wird, die eine geborene von Walden ist! Außerdem meint er, dass ich mich auf dem gesellschaftlichen Parkett richtig bewege. Er selbst scheint sich da nicht so sicher zu fühlen, sonst würde er nicht krampfhaft nach jemandem wie mir Ausschau halten. Na, jedenfalls kommen sich unsere Interessen zunächst mal entgegen. Wie es weitergeht, wird die Zukunft zeigen. Gern heirate ich ihn nicht, Hanko. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, beiße ich halt in den sauren Apfel. Dass ich allein dich wirklich liebe, weißt du, mein Hanko.«
»Du bist ein kleines Luder. Hundertprozentig ist man bei dir nie sicher, woran man ist«, antwortete Hanko Borek lächelnd. »Jedenfalls bleibe ich so lange hier in der Wohnung, bis ich etwas von dir höre. Die zweihundert Mäuse brauchst du hoffentlich nicht selbst.«
»Ich habe nur noch hundert. Aber bis Paris wird das reichen. Kurtchen wird hoffentlich keine Abrechnung von mir verlangen. Wenn ich denke, was er für das Abendessen heute ausgegeben hat. Bloß mir gegenüber ist er so knauserig. Er kauft mir zwar das, was ich möchte, aber bares Moos rückt er einfach nicht heraus, das dicke Ekel.«
»Du schaffst es schon. Vor allem musst du erreichen, dass er ein Testament aufsetzt, das dich zur Erbin macht. Das kannst du schließlich verlangen, wenn er dir einerseits die Ehe verspricht, andererseits aber noch gar nicht von seiner Verflossenen geschieden ist. Mit dem Testament bist du finanziell erst einmal abgesichert. Alles weitere überlegen wir später. Um die Reise mit Schlüter könnte man dich beinahe beneiden. Aber vergiss nicht, dass du die Zeit gut nutzen musst.«
»Erstens würde ich lieber mit dir reisen als mit Schlüterchen, und zweitens vergesse ich ganz gewiss keine Minute, was wir vorhaben, Hanko. Ich bin doch nicht dumm. Es ist außerdem ziemlich gemein von dir, dass du sagst, ich wäre nicht zuverlässig. Ich bin dir treu wie Gold, und das weißt du ganz genau.«
Hella schmiegte sich zärtlich an Hanko. Er streichelte ihr Haar und lächelte über ihren Kopf hinaus ins Leere. Ja, die blonde Hella von Walden war ihm – Hanko Borek – hörig. Er selbst benutzte sie allerdings nur als Mittel zum Zweck. Als Mittel dafür, an die Millionen von Kurt Schlüter heranzukommen, und zwar um jeden Preis.
*
Während Hella von Walden und Hanko Borek Zärtlichkeiten austauschten, saß Kurt Schlüter in seiner prunkvollen Villa am Schreibtisch und addierte Zahlen. Das war seine Lieblingsbeschäftigung. Er tat es sogar noch nachts, denn er wollte ganz sichergehen, dass im Laufe seiner dreimonatigen Abwesenheit alles, aber auch alles genau nach seinen Weisungen und Plänen durchgeführt wurde.
Endlich kam er bei seiner Rechnerei zu einem Abschluss. Nun schloss er die Augen und dachte an seine Frau Angela, die sich so hartnäckig gegen eine Scheidung sträubte. Er dachte auch an seinen kleinen Sohn Bastian, der für seinen Geschmack viel zu weich und schwächlich war, und schließlich an Hella von Walden, die Frau, mit der er in Zukunft in der Gesellschaft glänzen wollte. Sie war seiner Ansicht nach die richtige Partnerin für einen Mann wie ihn. Sie würde die Feste in seinem Haus zu arrangieren wissen und auch Bastian so erziehen, wie es für den Sohn von Kurt Schlüter unerlässlich war. Bastian würde eine Erziehung erhalten, wie sie früher den jungen Adeligen auf den großen Gütern zuteil geworden war – eine Erziehung zu stahlharten Männern! Er durfte sich nicht mit Kleinigkeiten aufhalten, sondern musste stets die große Linie im Auge behalten und konnte sich Zimperlichkeiten nicht leisten.
Nun, Hella von Walden war sicherlich nicht zimperlich. Kurt Schlüter gab sich keinen Illusionen über dieses schöne blonde Mädchen mit den eisblauen Augen hin. Hella liebte wahrscheinlich nicht ihn, sondern nur sein Geld und seine Stellung in der Gesellschaft. Auch er selbst empfand für das Mädchen keine echte Zuneigung. Hella sah sehr gut aus und entsprach aufs Haar seiner Vorstellung von der Frau, die er an seiner Seite haben wollte, aber Liebe … Ach, Liebe gab es im Leben des Generaldirektors Schlüter schon lange nicht mehr. An die Stelle der Gefühle war das Bankkonto gerückt. Für sein Geld konnte sich Kurt Schlüter aus vollem Herzen begeistern – und immer wieder für sein gesellschaftliches Ansehen für die Rolle, die er in Wirtschaftskreisen spielte.
Bastians Vater klappte die Arbeitsmappe zu. Er löschte die Lampe auf dem Schreibtisch und begab sich zu Bett. Henry, der zugleich die Rolle des Butlers im Haus wahrzunehmen hatte, gähnte verstohlen und wünschte eine gute Nacht. Es wurde oft sehr spät im Haus des Generaldirektors. Trotzdem musste Henry am Morgen Punkt sechs wieder zum Dienst antreten. Denn Kurt Schlüter war nun einmal auch nicht zimperlich.
*
»Also, es geht nicht mehr, Andrea! Kannst du diesen unglücklichen Hund im Tierheim aufnehmen?«
Denise von Schoenecker saß ihrer hübschen, jung verheirateten Stieftochter gegenüber, die ihr soeben eine Tasse Tee vorgesetzt hatte. Andrea war mit dem Tierarzt Dr. Hans-Joachim von Lehn verheiratet. Neben der Praxis hatten die beiden ein Tierheim eröffnet, das nach ihrem Dackel getauft worden war. Es hieß Waldi & Co., das Heim der glücklichen Tiere! Der Untertitel war eine Parallele zu Nicks Bezeichnung für das Kinderheim in Sophienlust, das er das Haus der glücklichen Kinder nannte.
»Im Tierheim? Aber du hast mir doch eben erzählt, dass diese Dogge gewohnt ist, in einem Bett zu schlafen, bei Tisch zu essen und so weiter.«
Denise nickte. »Es ist unerträglich. Die Kinder finden den Hund ganz einfach lächerlich, und Bastian Schlüter, der das Tier mitgebracht hat, spielt sich fürchterlich auf mit seinem Hund. Ich sehe keinen anderen Ausweg, als den Jungen eine Weile von dem Tier zu trennen, sonst wird er sich in Sophienlust nie und nimmer einleben, sondern ständig mit Wiking herumstolzieren und den Hund kommandieren wie ein General. Das muss ja den Charakter eines Kindes auf die Dauer ruinieren. Was der Vater sich bloß dabei gedacht hat, dem Jungen diesen Hund zu schenken?«
Andrea hob die Schultern. »Wahrscheinlich wollte er seinem Sohn frühzeitig beibringen, wie man Untergebene behandelt«, spottete sie, denn ihre Eltern hatten ihr bereits von Kurt Schlüter erzählt und diesen nicht gerade als sympathischen Zeitgenossen geschildert. »Aber ich kann Wiking natürlich hier aufnehmen. Allerdings garantiere ich nicht dafür, dass er den gelernten Zirkusunsinn beibehält, den man ihm eingedrillt hat. Wahrscheinlich wird er bald mit Severin Freundschaft schließen und mit meiner schwarzen Dogge um die Wette aus dem Napf schmatzen, sobald das Futter nur in Reichweite ist. Dann wird es mit dem manierlichen Essen sehr bald vorbei sein.«
Andrea besaß eine bildschöne schwarze Dogge, die Severin hieß und von ihr einst gesund gepflegt worden war.
»Die Manieren des Hundes Wiking sind mir ziemlich gleichgültig. Ich könnte mir allerdings denken, dass Bastians Hund glücklicher wäre, wenn er sich nicht dauernd beherrschen und sozusagen gegen seine normalen Instinkte leben müsste. Man fragt sich manchmal, ob solche Dressuren nicht an Tierquälerei grenzen und verboten werden sollten.«
»Recht hast du, Mutti. Also, betrachten wir Wiking als einen notleidenden Hund und nehmen wir ihn im Tierheim Waldi & Co. auf. Hoffentlich nimmt es der kleine Junge nicht zu tragisch.«
Denise schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht. Er liebt den Hund nicht. Er ist bloß stolz darauf, dass er ein so außergewöhnliches Tier besitzt und alle damit tyrannisieren kann. Wenn wir aus Bastian einen normalen Jungen machen wollen, muss der Hund für eine Weile aus seiner Reichweite entfernt werden. Ich verliere sonst eines Tages noch die Geduld. Frau Rennert ist auch schon ganz nervös geworden.«
»Also gut, ich bin einverstanden, Mutti. Bringt mir das Wundertier. Ich habe Wiking ja neulich in Sophienlust schon bewundert. Besonders schön finde ich ihn nicht. Aber vielleicht hat er eine schöne Seele. Bei uns kommt es auf ein Tier mehr oder weniger nicht an.«
Das entsprach genau den Tatsachen. Im Tierheim Waldi & Co. gab es eine Braunbärin mit zwei Jungen, zwei Schimpansen, eine Ringelnatter, den alten Esel Benjamin, mehrere Hunde, vor allem Waldis Familie, und noch einiges mehr. Für die Dogge Wiking würde sich auch ein Platz finden, wenn auch nicht gerade am Esstisch der jungen Tierarztfamilie und auch nicht im Gastbett!
Mutter und Tochter plauderten jetzt noch eine ganze Weile über den kleinen Neuling in Sophienlust.
»Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein eitler, größenwahnsinniger Vater aus einem fünfjährigen Jungen einen so komplizierten kleinen Burschen machen kann«, seufzte Denise. »Wir haben kaum je mit einem Kind derartige Schwierigkeiten gehabt. Aber irgendwie wird es schon werden, denn Bastian kann ja selbst gar nichts dafür. Er ist bestimmt im Grunde ein herzensgutes Kerlchen und fühlt sich in seiner aufgezwungenen Rolle nicht einmal wohl.«
»Du siehst aber auch in jedem einen guten Kern – gleichgültig, ob es sich um einen Erwachsenen oder um ein Kind handelt, Mutti. Glaubst du nicht, dass es auch böse Kinder gibt?«
Denise schüttelte den Kopf. »Nein, Andrea, das glaube ich nicht. Es ist immer die Schuld der Erwachsenen, wenn ein Kind böse wird. Ich will Bastian ja auch nicht strafen, indem ich ihm den Hund fortnehme. Ich will ihm nur helfen, zu sich selbst zu finden.«
Andrea umarmte ihre Mutter. »Du bist eine wunderbare Frau, Mutti. Sicher schaffst du es mit Bastian Schlüter. Wie weit ich allerdings mit dem komischen Hund komme, müssen wir noch abwarten.«
Denise blickte auf ihre Uhr. »Es wird Zeit für mich, Andrea. Tut mir leid, dass ich Hans-Joachim versäume. Grüße ihn herzlich von mir. Wir erwarten euch am Sonntag in Schoeneich zu Tisch. Sascha will auch kommen übers Wochenende. Dann habe ich meine Familie endlich einmal wieder vollzählig um mich versammelt.«
»Wir kommen wirklich schrecklich gern, Mutti. Vielen Dank für die Einladung.«
Andrea begleitete ihre Mutter bis vors Haus, wo der Wagen stand. Denise küsste Andrea und streichelte ihr das dunkle Haar. »Leb wohl, mein Kind. Vielen Dank, dass du den Hund nehmen willst. Ich schicke morgen jemanden herüber. Wahrscheinlich lasse ich Bastian mitfahren, damit er sich das Tierheim ansehen und sich davon überzeugen kann, dass sein Hund gut und sachgemäß untergebracht ist. Sonst macht er uns sicherlich wieder eine Szene. Wie gesagt, unsere Nerven sind durch diesen kleinen Kerl schon fast verbraucht.«
Andrea lachte. »Aber er hat ein gutes Herz, nicht wahr, Mutti?«
»Ja, Kind, davon bin ich felsenfest überzeugt.«
Denise von Schoenecker steckte den Zündschlüssel ins Schloss und ließ ihren Wagen an. Wenig später fuhr sie in Richtung Sophienlust davon.
»Grüß Vati«, rief Andrea hinter ihr her.
*
Bastian war wütend. So wütend, wie man es einem Fünfjährigen kaum zugetraut hätte. Er trampelte mit beiden Füßen und schrie, bis er krebsrot und dann sogar blau wurde. Aber die Entscheidung war gefallen: Wiking sollte nach Bachenau ins Tierheim Waldi & Co.
»Du darfst selbst mit hinfahren und es dir ansehen«, legte sich Nick etwas unbehaglich ins Mittel, denn solche Szenen waren in Sophienlust durchaus nicht üblich. Wenn die Kinder auch keine Engel waren, so herrschte doch im allgemeinen eine freundliche Stimmung. Aber mit dem kleinen Bastian und seiner riesigen Dogge Wiking hatten Unruhe und Ärger Einzug in Sophienlust gehalten. Deshalb hatte Denise auch den Entschluss gefasst, den Hund für eine Weile ins Tierheim Waldi & Co. zu geben.
»Ich will das blöde Heim gar nicht sehen«, schrie Bastian.
»Angucken kannst du es dir doch wenigstens. Es gibt dort sogar ein Bärengehege wie in einem richtigen Zoo«, meinte Nick, der eigens mit seiner Mutter von Schoeneich herübergekommen war, um den Transport der Dogge nach Bachenau zu begleiten.
Denise legte sich ins Mittel und redete in ihrer sanften, gütigen Art dem kleinen Burschen zu, bis er sich endlich, wenn auch widerwillig, fügte.
Wiking kletterte artig in den Wagen. Er saß still und kerzengerade wie ein feiner Herr im Auto. Aber eigentlich wirkte er mehr wie ein ausgestopfter Hund. Das jedenfalls raunte Pünktchen Angelika Langenbach ins Ohr, als Denise und Nick ebenfalls einstiegen. Bastian zog ein saures Gesicht und hockte unglücklich neben seinem Hund. Sein Groll hatte sich noch nicht gelegt.
Die Fahrt dauerte nicht lange. Schon waren sie in Bachenau.
Andrea von Lehn hatte alles getan, um Bastian und seinen Hund würdig zu empfangen. Betti, ihr Hausmädchen, hatte Pflaumenkuchen gebacken und Kakao gekocht.
Wiking benahm sich vorbildlich wie immer und fing mit Severin und Waldi keinerlei Streit an.
»Er wird sich schnell bei uns eingewöhnen«, meinte Andrea zuversichtlich und tätschelte den mächtigen Kopf der Dogge. Dass sie ihren Severin viel schöner fand als Wiking, sagte sie natürlich nicht. Denn sie wollte Bastian nicht kränken. Stattdessen ließ sie von Betti die Tassen füllen und den Kuchen herumreichen.
»Ist meine große Schwester nicht eine prima Hausfrau, Bastian?«, fragte Nick strahlend. Er hatte sich gleich drei Stück Kuchen auf den Teller gelegt.
»Hm, das schon, aber Wiking soll nicht ins Heim.« Bastian hatte den langgestreckten Bau des Tierheims bisher nur aus der Entfernung gemustert, denn zunächst gab es ja Kuchen.
»Es wird dir schon gefallen«, entgegnete Andrea freundlich. »Unsere Tiere fühlen sich alle wohl. Du wirst dich wundern, was wir dir alles zeigen können.«
Bastian antwortete nicht, sondern stopfte sich den Mund trotzig voll Kuchen, den er dann mit Kako hinunterspülte.
Andrea blinzelte ihrer Mutter zu. Es war nun einmal beschlossen, dass Wiking ins Tierheim kam, also würde die Dogge auch hierbleiben, und wenn Bastian noch so viel Theater machte.
Der Junge fing auch bald damit an. Er wollte, dass Wiking an den Tisch geholt wurde und eine Wurst bekam. Doch Denise machte ihm klar, dass die Tiere erst am Abend ihr Futter erhielten. Außerdem hatte Wiking ja mittags in Sophienlust etwas erhalten. Wieder einmal gelang es dem erbosten Bastian nicht, den Kopf durchzusetzen.
Später führte Nick den Jungen zusammen mit Helmut Koster durch das Tierheim. Obwohl der Knirps es nicht recht zugeben mochte, machten ihm die beiden Schimpansen doch großen Spass. Sie waren noch jung und spielten wie übermütige Kinder miteinander. Aber auch das Liliput-Pferdchen gefiel Bastian. Er wollte gar nicht glauben, dass es nicht größer werden sollte. Die Ponys von Sophienlust wirkten dagegen wie richtige große Pferde.
Helmut Koster, der Tierpfleger, der den Widerstand des Jungen spürte, gab sich alle Mühe, Bastians Anteilnahme zu erwecken. »Siehst du, hier kann ich dir etwas besonders Interessantes zeigen«, erklärte er dem Jungen. »Unsere Henne Susi hat sich nämlich im Datum geirrt und noch einmal gebrütet, obwohl wir schon Pflaumen ernten und die Küken normalerweise gar nicht mehr aufwachsen können. Aber ich habe hier eine besondere Wärmeglocke konstruiert. Darunter können sich die Küken verkriechen, sobald es nicht mehr warm genug ist, besonders auch nachts. Ich denke, wir werden sie durchbringen.«
»Und wenn man den Strom abschaltet?«, fragte Bastian wissbegierig.
»Dann wird es zu kalt für die kleinen Küken. Dann werden sie krank oder gehen ein«, erklärte Helmut Koster. »Doch in ein paar Wochen werden sie kräftig genug sein, um mit den anderen Hühnern in den Stall zu gehen.«
»Hm, und wo schläft Wiking?« Bastian schien sich also doch damit abgefunden zu haben, dass der Hund im Heim bleiben sollte.
»Dort! Es ist ein schöner Korb mit einer Decke. Alle Hunde schlafen hier, und jeder hat seinen eigenen Korb. Nur die Dackelfamilie hat eine gemeinsame Schlafstätte. Die Dackel sind nicht zu trennen. Sie liegen wie die Würstchen in der Nacht beisammen.«
»Na ja.« Zufrieden war Bastian nicht. Aber er schimpfte wenigstens nicht mehr. Dann ging er noch einmal zum Affenkäfig und wurde nicht müde, den Schimpansen zuzusehen.
Beim Aufbruch gab es dann aber doch noch eine Szene, die nur dadurch zu beenden war, dass Andrea versprach, Bastian an einem der nächsten Tage noch einmal einzuladen.
»Sobald jemand nach Bachenau fährt, darfst du mitkommen, Bastian, und nachsehen, wie es Wiking geht«, redete sie dem Knirps zu. »Du siehst doch, dass er hier bei mir viel Gesellschaft findet und ganz bestimmt keine Langeweile haben wird.«
»Machst du wieder Kuchen, wenn ich komme, Tante Andrea?«, fragte Bastian.
»Wenn du Glück hast, haben wir Kuchen da. Wenn nicht, wird es vielleicht auch ein Honigbrot tun«, gab Andrea ruhig zurück. »Aber jetzt darfst du die arme Tante Isi nicht länger warten lassen.«
Bastian stampfte ein letztes Mal mit dem kleinen Fuß auf den Boden. »Wir hätten ja nicht zu fahren brauchen. Warum muss mein Wiking denn überhaupt hierher?«
Andrea zog es vor, die ungezogene Frage nicht zu beantworten. Sie nahm Bastian bei der Hand und führte ihn zu ihrer Mutter. »Hier kommt Bastian, Mutti. Wenn jemand von euch morgen oder übermorgen nach Bachenau fährt, dann möchte Bastian gern mitgenommen werden, damit er noch einmal nach Wiking sehen kann. Geht das?«
»Natürlich, Andrea. Der Oberförster kommt morgen bestimmt vorbei. Herr Bullinger macht das schon. Er holt Bastian auch auf dem Rückweg wieder ab.«
»Siehst du, Bastian, du hast großes Glück.«
Doch das finstere Gesichtchen des Jungen hellte sich nicht auf. Dafür bestand er jetzt trotzig darauf, vorn neben Denise zu sitzen. Um keinen weiteren Ärger zu haben, wurde ihm dieser Wunsch sogar erfüllt, und der allzeit freundliche Nicki begnügte sich mit dem Rücksitz.
»Das wäre für den Anfang geschafft«, seufzte Andrea erleichtert, als der Wagen abfuhr. Sie streichelte Wiking, der dem Auto nachblickte. »Bist ein guter Hund, Wiking. Es wird dir schon bei uns gefallen. Aber so fein wie bei der Familie Schlüter brauchst du dich jetzt nicht mehr zu benehmen. Jetzt kannst du mit Severin, Waldi, Hexe und ihren Kindern herumtollen, so viel es dir nur Spaß macht.«
*
»Genug für heute, Frau Schlüter«, sagte der Professor und klappte sein Buch zu.
Angela Schlüter arbeitete seit mehreren Monaten in Heidelberg bei Professor Fabricius als Privatsekretärin. Sie war froh, dass sie als junges Mädchen Stenografie und Maschineschreiben gelernt und anfangs ihrem Mann auch allerlei schriftliche Arbeiten abgenommen hatte. Aber seit er reich geworden war, gab es in seinem Betrieb nichts mehr für sie zu tun. Im Gegenteil, es war Kurt Schlüter jetzt sogar peinlich, wenn er daran erinnert wurde, dass seine Frau ihm einmal geholfen hatte, aus dem kleinen Betrieb ein riesiges Werk aufzubauen. Er tat so, als wäre er von Anfang an der reiche Mann gewesen, dem es auf einen Tausender nicht ankam.
Angela dagegen fürchtete sich vor dem vielen Geld. Sie hatte Kurt aus Liebe geheiratet. Solange sie ihr gutes Auskommen gehabt hatten, aber nicht im Geld geschwommen waren, war ihre Ehe glücklich gewesen. Damals war ihr Mann noch der gewesen, als den ihn auch Alexander von Schoenecker in Erinnerung gehabt hatte: ein zielstrebiger, selbstbewusster Mann, aber weder aufgeblasen noch größenwahnsinnig.
Jetzt zog Angela Schlüter das sauber getippte Blatt aus der Maschine und legte es auf den Stoß der anderen Blätter, die sie bereits nach dem Diktat des Professors geschrieben hatte. Sie war zu stolz und zu verletzt, um von ihrem Mann Geld anzunehmen. Nein, sie konnte ihren Unterhalt selbst verdienen, wenn er sie schon aus dem Haus trieb und nicht mehr mit ihr zusammenleben wollte!
Professor Fabricius klingelte. Seine Haushälterin – er war schon seit vielen Jahren verwitwet – erschien und brachte wie jeden Tag ein Tablett mit Tee und belegten Broten. Angela füllte die Tassen. Dieser Abschluss des Arbeitstages war nun schon zur Tradition geworden, ehe sie in ihr bescheiden möbliertes Zimmer zurückkehrte. Sie tat die Arbeit bei dem Professor ausgesprochen gern. Zwischen dem weißhaarigen alten Herrn, der an einem wissenschaftlichen Werk arbeitete, und ihr, hatte sich eine Art Vater-Tochter-Verhältnis entwickelt.
»Nun, Frau Angela, wollen wir heute noch einmal über Ihr Problem sprechen, oder ist Ihnen nicht danach zumute?«, fragte der Professor, nachdem die Haushälterin wieder gegangen war.
»Doch, ich bin Ihnen dankbar, Herr Professor. Sie sind der einzige Mensch, bei dem ich mich aussprechen kann. Manchmal kommt mir alles wie ein böser Traum vor.«
»Trotzdem glaube ich nicht, dass es viel Sinn hat, wenn Sie sich weiterhin der Scheidung widersetzen. Ihr Mann wird alle rechtlichen Mittel ausschöpfen und am Ende behaupten, dass Sie aus eigenem Antrieb weggegangen seien.«
»Aber er hat mich fortgeschickt, Herr Professor. Er kann doch nicht die Tatsachen auf den Kopf stellen.«
»Wenn jemand eine Scheidung erzwingen will, ist ihm leider jedes Mittel recht, liebes Kind. Er wird behaupten, Sie hätten ihn verlassen, und daraus lässt sich ziemlich leicht ein Scheidungsgrund konstruieren, bei dem er sogar Ihnen die Schuld in die Schuhe schieben kann. Da er Wert auf sein sogenanntes gesellschaftliches Ansehen legt, wird ihm das besonders willkommen sein. Also ist es besser, Sie gehen auf seine Forderungen ein und retten wenigstens eine ordentliche Abfindung für sich.«
Angela Schlüter machte eine müde Handbewegung. »Das Geld ist mir schrecklich gleichgültig, Herr Professor. Ich kann für mich immer genug verdienen. Millionen anderer Frauen müssen das auch. Das Geld hat unsere Ehe zerstört. Ich hasse es.«
»Trotzdem sollten Sie nicht auf das verzichten, was Ihnen zusteht, liebe Frau Angela. Sie könnten auch einmal krank werden und das Geld benötigen. Außerdem steht Ihnen nach dem Gesetz ungefähr die Hälfte des Vermögens Ihres Mannes bei einer Scheidung zu, denn alles ist ja erst im Laufe Ihrer Ehe, und zwar mit Ihrer Hilfe, erworben worden.«
»Wenn ich den Jungen bekäme, würde ich auf alles verzichten«, seufzte Angela. »Ich weiß jetzt nicht einmal, wo er sich aufhält. Kurt hat mir mitgeteilt, dass Bastian in einem Heim oder Internat sei, wo er standesgemäß erzogen würde. Aber er ist doch erst fünf Jahre alt und braucht in erster Linie Liebe. Früher waren wir glücklich mit unserem Kleinen, der uns erst nach so langen Jahren geschenkt wurde. Kurt war außer sich vor Stolz über seinen Stammhalter. Jetzt aber ist alles anders geworden, und aus Bastian soll ein kleiner Generaldirektor gemacht werden, noch ehe er lesen und schreiben kann. Es ist eine Tragödie, wenn man als Mutter nichts gegen so viel Unverstand und Grausamkeit unternehmen kann. Schon aus diesem Grund bin ich froh, dass ich arbeiten muss und keine Zeit zum Nachdenken finde, Herr Professor.«
Professor Fabricius schob ihr den Teller mit den leckeren Broten hin. »Essen Sie erst einmal ein bisschen. Ich denke, Sie sollten sich den besten Anwalt nehmen. Ich habe mich erkundigt und empfehle Ihnen Dr. Immerling. Er ist ein Experte auf dem traurigen Gebiet der Ehescheidungen und wird bestimmt dafür sorgen, dass Sie zu Ihrem Recht kommen.«
»Trotzdem wird Kurt erzwingen, dass er den Jungen behält und ich ihn höchstens einmal im Monat zu sehen bekomme. Sie kennen meinen Mann nicht, Herr Professor. Wenn er etwas durchsetzen will, erreicht er es auch gegen den besten Rechtsanwalt der Welt.«
Unendliche Mutlosigkeit und Resignation sprachen aus den Worten der unglücklichen Frau.
»Aber wenn es so bleibt wie jetzt, werden Sie den Jungen auch nicht wiedersehen«, entgegnete Professor Fabricius sanft. »Im Gegenteil. Sie setzen sich ins Unrecht. Besprechen Sie Ihren Fall doch einmal ausführlich mit Dr. Immerling. Er kann dann einen Brief an Ihren Mann aufsetzen. Möglicherweise lässt sich am Ende doch erreichen, dass Sie das Kind bekommen. Sie haben sich nichts zuschulden kommen lassen. Es ist Ihr Mann, der auf die Scheidung drängt.«
Angela seufzte. »Ich bin ziemlich am Ende. Auf die Dauer wird man ganz einfach zermürbt und fügt sich. Sie meinen also, dass ich Hoffnung hätte, Bastian für mich zu bekommen?« Ihre hellen Augen leuchteten sehnsüchtig auf. »Bastian ist ein liebes Kind. Ich fürchte, er ist schrecklich unglücklich und kann sich gar nicht erklären, wo seine Mutter geblieben ist. Ich weiß nicht einmal, was mein Mann ihm gesagt hat. Es ist eine schlimme Situation, in der ich mich befinde.«
»Die juristische Seite muss Dr. Immerling mit Ihnen klären. Die menschliche wäre, dass wir alles versuchen, um Ihnen Ihr Recht zu verschaffen und dem Kind die Mutter wiederzugeben. Liebe ist für ein Kind immer wichtiger als Geld und ein schönes Haus oder ein kostspieliges Internat.«
Angela rannen Tränen über die Wangen.
»Nicht weinen, Frau Angela, es kommt schon irgendwie in Ordnung – aber sicherlich nicht, wenn Sie den Kopf in den Sand stecken und gar nichts unternehmen.«
Angela Schlüter trank einen Schluck Tee und beruhigte sich etwas. »Sie haben sicherlich recht, Herr Professor. Ich werde mir die Adresse von Herrn Dr. Immerling notieren.«
»Nein, nein, wir rufen ihn gleich an und vereinbaren einen Termin. Verstehen Sie mich recht, Frau Angela. Ich will Sie nicht zur Scheidung drängen. ich bin ein alter Mann und meine wie Sie, dass der Mensch das, was Gott zusammengefügt hat, nicht scheiden sollte. Aber irgendetwas müssen Sie jetzt unternehmen, sonst kommt Ihr Mann zum Ziel, ohne dass Sie sich in irgendeiner Weise dagegen zur Wehr setzen können.«
Angela ließ den Professor, von dem sie wusste, dass er es aufrichtig mit ihr meinte, gewähren. Er hatte sich die Telefonnummer und Adresse von Dr. Immerling notiert und wählte die Nummer sofort. Wenig später war der Termin vereinbart. Noch am gleichen Abend nach sechs Uhr sollte Angela den Anwalt aufsuchen. Er wollte in der Kanzlei auf sie warten.
»Danke, Herr Professor«, flüsterte Angela Schlüter. »Dann werde ich jetzt rasch nach Hause fahren, um die Briefe meines Mannes herauszusuchen, die er mir in dieser Angelegenheit geschrieben hat. Ich nehme an, dass der Anwalt die Unterlagen benötigen wird.«
»Sehr vernünftig, Frau Angela. Ich sehe, Sie nehmen die Sache jetzt entschlossen in die Hand. Morgen müssen Sie mir erzählen, was Dr. Immerling gesagt hat.«
»Natürlich, Herr Professor.« Angela leerte ihre Tasse und stand auf.
»Viel Glück, mein gutes Kind. Wenn Sie sich mit Dr. Immerling beraten, brauchen Sie nicht gleich einen Entschluss zu fassen. Lassen Sie sich Zeit.«
»Ja, Herr Professor.«
Angela verließ das schöne alte Patrizierhaus des Professors und fuhr mit dem Bus nach Hause, um die Briefe ihres Mannes, um derentwillen sie schon viele Tränen vergossen hatte, herauszusuchen, und sich auf den Weg in die Rechtsanwaltskanzlei zu machen.
War dies der Anfang vom Ende? Gab es keinen Weg mehr zur Versöhnung zwischen Kurt und ihr? Würde sie ihren süßen kleinen Bastian für immer verlieren?
Angela Schlüter wusste genau, dass ihr Mann die junge, schöne Hella von Walden heiraten wollte. Sie wusste auch, dass er Bastian um jeden Preis behalten und zu einem Jungen genau nach seinen Idealen formen wollte. Würde der Anwalt in der Lage sein, sich gegen die eiserne Härte ihres Mannes durchzusetzen?
Angela Schlüter war so verzweifelt und zermürbt, dass sie wenig Hoffnung hatte. Trotzdem ging sie den Weg, den der wohlmeinende Professor ihr gewiesen hatte.
Kurt hat mich verstoßen, dachte sie, er liebt mich nicht mehr. Es ist sicher das Beste, wenn ich in die Scheidung einwillige. Es ist das Letzte, das ich noch für ihn tun kann. Vielleicht hat er dann wenigstens ein Einsehen und lässt mich meinen süßen kleinen Jungen ab und zu sehen.
Zugleich ahnte und fürchtete Angela, dass ihr Mann Bastian so erziehen wollte, dass er mit einer einfachen Frau, wie sie es geblieben war, nichts mehr zu tun haben wollte. Er sollte ein stolzer kleiner Prinz werden, dem Geld mehr galt als Mutterliebe. Das war Kurts Ziel.
Das Gespräch mit dem Rechtsanwalt dauerte sehr lange. Als Folge davon schrieb Dr. Immerling einen Brief an den Generaldirektor in Augsburg, in dem er ihm mitteilte, dass seine Frau sich der Scheidung nicht länger widersetze, sofern man zu einem gewissen gegenseitigen Einverständnis komme und das wohlverstandene Interesse des Sohnes Bastian gewahrt bleibe.
Dieser Brief hätte den Generaldirektor gewiss gefreut, wenn er noch in seine Hände gelangt wäre. Doch Kurt Schlüter war bereits seit drei Tagen in Paris, als der Brief in seinem Sekretariat eintraf. Da er strengste Anweisung hinterlassen hatte, dass seine private Post ungeöffnet aufbewahrt werden sollte, wanderte der wichtige Brief zunächst ungelesen in eine dicke Mappe, wo er mit anderen Schreiben auf die Rückkehr des Empfängers warten musste.
*
Bastian war nun schon zum dritten Mal im Tierheim Waldi & Co. Doch sein Zorn darüber, dass man ihm die Dogge Wiking entführt hatte, war immer noch nicht verraucht.
An diesem Tag hatte ihn Wolfgang Rennert, der Sohn der Heimleiterin und Hauslehrer von Sophienlust, im Wagen mitgenommen und beim Tierheim abgesetzt. Andrea von Lehn war nicht zu Hause, sie hatte ihren Mann auf ein Gut begleitet, dessen Besitzer mit der Familie von Lehn schon lange befreundet war. Deshalb hatte Andrea die Gelegenheit wahrgenommen, dort einen Besuch zu machen und Kaffee zu trinken.
Eigentlich kümmerte sich an diesem Nachmittag niemand so recht um Bastian, denn Wolfgang Rennert hatte wichtige Besorgungen in der kleinen Ortschaft zu erledigen, und Helmut Koster war im Garten beschäftigt. Betti aber hatte im Haus zu tun.
Bastian betrachtete wie immer die Schimpansen und lachte leise über ihre Späße. Magda, die Köchin von Sophienlust, hatte ihm ein paar Bananen für die beiden lustigen Burschen mitgegeben, die er nun stückchenweise an sie verfütterte. Für Wiking, der nicht von der Seite seines kleinen Herrn wich, hatte er Hundekuchen mitgebracht.
Wiking schien sich im Tierheim glücklich zu fühlen. Gemeinsam mit der schwarzen Dogge Severin pflegte er Andrea auf Schritt und Tritt zu folgen. Aber jetzt erinnerte er sich doch an seinen kleinen Herrn und leckte ihm sogar die Hand. Das war früher als »unfein« verboten gewesen, aber im Tierheim war so etwas erlaubt. Der kluge Wiking probierte es nun auch gleich einmal bei Bastian aus. Tatsächlich sagte dieser nicht »pfui«, sondern tätschelte seinen Kopf.
»Es ist blöd hier, nicht wahr, Wiking?«, schimpfte der Junge leise.
»Wau, wau«, antwortete Wiking, aber das konnte vieles bedeuten.
»Weißt du, man sollte ihnen einen Streich spielen, weil sie so gemein sind«, fuhr Bastian fort. »Aber was?«
Bastian war noch klein, aber alles andere als dumm. Außerdem hatte er von seinem Vater oft genug gehört, dass man sich nichts, aber auch gar nichts gefallen lassen dürfe. Allzu oft hatte Kurt Schlüter in Gegenwart des Jungen voller Stolz erzählt, dass er es diesem oder jenem Menschen heimgezahlt und sich für irgendetwas gerächt habe. Jetzt wollte sich auch Bastian rächen, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. Also sah er sich im Tierheim nach einer Möglichkeit um.
Sollte er die Braunbärin mit den Jungen rauslassen? Nein, das war vielleicht gefährlich. Sie würde ihn anfallen und beißen. Oder die Affen aus ihrem Gehege lassen? Na, so ganz traute Bastian den beiden wilden Schimpansen doch nicht. Sie schienen ziemlich kräftig zu sein und waren nicht viel kleiner als er selbst. Leider nicht!
Aber die Küken – diese albernen, kleinen Biester – ja, das war ganz einfach! Er würde den Strom abstellen, und dann würden die Küken krank werden oder vielleicht auch sterben. Das hatte Helmut Koster doch gesagt.
Bastian verließ die Schimpansen und ging zu dem kleinen Verschlag, in dem die Küken an diesem kühlen Herbsttag eifrig unter ihrer Wärmeglocke herumspazierten und piepsten. Ein bisschen musste er suchen, dann hatte er den elektrischen Schalter gefunden. Knips, schon war die Wärmeglocke ausgeschaltet. Und natürlich würde das zunächst kein Mensch merken.
»Ich zeig’s euch schon!«, flüsterte Bastian mit geballten Fäusten. »Ja, ich zeig’s euch. Vati wäre stolz auf mich, wenn er wüsste, dass ich mir nichts gefallen lasse.«
Bastian ging wieder zu den Schimpansen, als wäre nichts geschehen. Etwa eine halbe Stunde später erschien Betti und rief ihn. »Herr Rennert fährt zurück, Bastian. Hast du dich mit deinem Hund schön beschäftigt? Es gefällt ihm gut bei Tante Andrea.«
Bastian streckte ihr die Zunge heraus. »Es gefällt ihm überhaupt nicht«, gab er ungezogen zurück, folgte Betti aber doch zum Auto Wolfgang Rennerts, das vor der Tür wartete.
An diesem Abend zeigte sich Bastian in Sophienlust zum ersten Mal von einer etwas liebenswürdigeren Seite. Frau Rennert begann Hoffnung zu schöpfen, dass der schwierige kleine Junge, der ihnen so viele Nüsse zu knacken gegeben hatte, sich nun doch einleben würde.
In Wirklichkeit aber war es nur das Gefühl der Vorfreude auf seine Rache, das Bastian so sehr beschäftigte und ihm den Anschein von Freundlichkeit und Zufriedenheit gab.
Schon früh am anderen Morgen kam ein Anruf aus Bachenau. Andrea war am Telefon. Sie berichtete von dem Unglück, das geschehen war, und davon, dass Helmut Koster felsenfest überzeugt sei, dass nur Bastian der Übeltäter gewesen sein könnte.
Schweren Herzens informierte Frau Rennert Denise von Schoenecker. »Ich fürchte, er ist ein boshafter Junge, Frau von Schoenecker«, seufzte sie. »Was machen wir nur mit ihm? Wenn wir ihn jetzt zur Rede stellen, wird er wahrscheinlich auch noch lügen. Das macht die Sache schlimmer und schlimmer.«
»Ich rede mit ihm – nein, ich werde mit ihm zu Andrea fahren, Frau Rennert. Bitte, rufen Sie Andrea an und sagen Sie, dass man die Küken so liegen lassen soll, wie Helmut Koster sie vorgefunden hat. Wir sind in zwanzig Minuten drüben. Ich möchte keine Zeit verlieren.«
»Wie Sie wollen, Frau von Schoenecker«, erwiderte Frau Rennert. Sie hoffte dabei, dass Denise auch diesmal wieder den richtigen Weg finden werde, so schwer es mit Bastian auch sein mochte.
»Hast du den elektrischen Schalter bei den Küken abgedreht?«, hörte sie Denise den Jungen später fragen, denn die schöne Herrin von Sophienlust war sofort von Schoeneich herübergekommen.
Zur grenzenlosen Überraschung beider Frauen verlegte sich Bastian durchaus nicht aufs Schwindeln. Er sagte: »Ja, ich hab’s getan. Es ist, weil ich mir nichts gefallen lassen wollte. Sind die Küken jetzt tot?« Trotzig und ein bisschen stolz klang es.
Denise legte die Hände auf die Schultern des Jungen. »Du wirst dir gleich selbst ansehen, was du angerichtet hast, Bastian. Komm, wie fahren zum Tierheim.«
Unsicher schaute der Knirps zu ihr auf. »Ich will nicht, Tante Isi.«
»Darauf kommt es jetzt nicht an. Dein Hund Wiking ist ein liebes, braves Tier. Er kann gar nichts dafür, dass er von irgendwelchen Leuten abgerichtet worden ist wie ein Zirkustier. Aber du kannst sehr wohl etwas dafür, wenn du den armen Küken die Wärme wegnimmst, die sie unbedingt brauchten, um am Leben zu bleiben. Helmut Koster hat es dir neulich im Beisein von Nick erklärt, nicht wahr?«
»Ja, sonst hätte ich es gar nicht gewusst. Aber ich hab’ natürlich gedacht, dass sie … dass sie vielleicht bloß Schnupfen kriegen.«
»Wenn so kleine Küken sich erkälten, ist es im Allgemeinen um sie geschehen. Komm jetzt.«
Bastian ging mit gesenktem Kopf neben Denise her. Sie war ärgerlich auf den Buben, aber sie erkannte auch, dass er die Bosheit nur deshalb ausgeführt hatte, weil er sich nach Liebe sehnte. Deshalb legte sie sich die Frage vor, ob sie dem kleinen Bastian auch wirklich genug Liebe gegeben hatte.
Im Wagen saß Bastian wortlos neben ihr. Irgendetwas ging also in seinem Köpfchen vor. Denise hütete sich, den Gang seiner Gedanken zu stören. Er sollte sich ruhig mit dem Problem, das er heraufbeschworen hatte, ein bisschen herumschlagen.
Andrea erwartete den Wagen schon. »Guten Morgen, Mutti.« Mutter und Tochter umarmten einander, während Bastian ein bisschen verloren dabeistand. »So, Bastian, und jetzt wird Helmut Koster dir zeigen, was du angerichtet hast.«
Helmut Koster hatte ein ernstes, vorwurfsvolles Gesicht. Er nahm Bastian bei der Hand und führte ihn zum Kükenverschlag. Ach, es war ein schrecklich trauriger Anblick, der sich dem Jungen dort bot. Fast alle Küken waren tot. Nur ein einziges lebte noch.
»Es ist deine Schuld«, sagte Helmut Koster und räumte nun eilig die toten Tierchen weg, damit das eine überlebende Küken die Wärme voll genießen konnte und die kleinen Körper nicht allzu rasch in Verwesung übergingen unter der Wärmeglocke.
»Das arme Küken ist jetzt ganz allein«, schluchzte Bastian unvermittelt auf. »Hat es nicht Sehnsucht nach den anderen?«
»Natürlich hat es Sehnsucht, du dummer Bengel«, schalt Helmut Koster. »Jetzt kannst du mal sehen, was du angerichtet hast. Warum bloß? Die armen kleinen Tierchen haben dir doch nichts getan. Aber sie brauchten die Wärme.«
»Ich … ich wollte es eben, weil ich wütend war«, stotterte Bastian unter Tränen. »Zu mir ist doch auch keiner lieb. Mein Vati schickt mich nach Sophienlust, weil er verreisen will, und meine Mutti hat mich vergessen. Meinen Hund hat man mir auch weggenommen.«
Denise, die von der offenen Tür aus dem Gespräch zwischen dem Tierpfleger und dem Jungen gelauscht hatte, wischte sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel.
»Ihm fehlt Liebe«, raunte sie Andrea zu. »Trotzdem muss er diese Kur nun durchstehen. Er soll mit Helmut Koster eine Grube schaufeln, damit die Küken ein Grab erhalten. Oder bist du anderer Meinung?«
»Nein, nein, Mutti, du hast bestimmt Recht. Außerdem wird es Bastian erleichtern, wenn er jetzt etwas tun kann, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Solange er die toten Küken dort herumliegen sieht, wird ihn das quälen.«
Helmut Koster suchte eine große und eine kleine Schippe heraus. Ohne Widerspruch machte sich Bastian dann gemeinsam mit dem Tierpfleger an die betrübliche Arbeit.
Als die kleine Grube wieder geschlossen war, fragte Bastian: »Was macht das übrige Küken jetzt? Wer spielt nun mit ihm?«
»Ich weiß es nicht, Bastian«, antwortete Helmut Koster. »Jedenfalls werde ich mir große Mühe geben, es unter der Wärmeglocke großzuziehen, damit es so schnell wie möglich zu den anderen Hühnern in den Stall kann. Was hast du dir bloß gedacht, als du den Strom abgeschaltet hast?« Er schüttelte den Kopf. »Ausgerechnet heute Nacht hatten wir den ersten Frost. Sonst wäre es vielleicht gar nicht so schlimm ausgegangen.«
»Das … das konnte ich nicht wissen«, wagte Bastian sich zu verteidigen.
»Nein, das nicht. Aber wer hat dir gesagt, dass du die Wärmeglocke ausschalten sollst?«
Darauf fand Bastian beim besten Willen keine Antwort. Er verzog sich grußlos.
Denise wartete schon auf ihn. »Kakao und Kuchen gibt es heute natürlich nicht«, sagte sie ernst. »Wir fahren jetzt zurück. Leider werden wir den anderen nicht verheimlichen können, was du getan hast.«
»Sag’s ihnen lieber nicht, Tante Isi«, bat Bastian scheu.
»Dazu ist es bereits zu spät. Eins von den Kindern hat zugehört, als Frau Rennert mit mir telefonierte. Leider wurde dabei auch erwähnt, dass nur du derjenige gewesen sein konntest, der den Strom ausgeschaltet hat.«
»Dann sag’ ihnen doch, dass es nicht stimmt. Ich … tu’s bestimmt nicht wieder, Tante Isi«, verlegte sich Bastian aufs Handeln.
»Aber ich kann die Kinder doch nicht belügen, Bastian. Wenn du den Mut hattest, die Küken umzubringen, dann musst du nun auch zusehen, wie du mit den Folgen fertig wirst. Du solltest den anderen Kindern besser zu beweisen versuchen, dass du es nicht so böse gemeint hast, wie es jetzt aussieht.«
Mutlos setzte sich Bastian neben Tante Isi ins Auto und fuhr mit ihr nach Sophienlust zurück.
Leider erwies es sich zunächst als gänzlich unmöglich, mit den Sophienluster Kindern über die Sache mit den Küken zu reden. Es stand für sie fest, dass Bastian sehr böse sei. Kein Kind wollte mehr sein Freund sein.
Henrik, der sich anfangs viel Mühe mit Bastian gegeben hatte, war besonders erbost. »Er gehört gar nicht zu uns nach Sophienlust, Mutti«, beklagte er sich noch am Abend, als er längst in Schoeneich in seinem Bett lag und Denise mit ihm beten wollte. »Ich bin nicht mehr sein Freund. Niemand will mehr sein Freund sein, und Nick gibt ihm auch keine Reitstunden mehr. Vielleicht käme Bastian auf die Idee, die Ponys mit der Peitsche zu schlagen oder so. Kannst du nicht seinem Vater einen Brief schreiben, dass er Bastian so schnell wie möglich abholen soll?«
»Das geht leider nicht, denn sein Vater ist auf einer Weltreise.«
»Und seine Mutti, ist die tot?«
»Nein, aber sie kann auch nicht kommen.«
»Eine blöde Familie. Du, Bastian soll kein Bäumchen im Märchenwald erhalten. Wer Küken tot macht, gehört nicht zu uns.«
Denise nahm ihren Jüngsten fest in die Arme. »Bastian ist wahrscheinlich bloß unglücklich, Henrik. Ich weiß, dass das für dich schwer zu verstehen ist. Aber wir müssen ihn trotzdem lieb haben und ihm zeigen, dass wir uns Mühe mit ihm geben. Gleich morgen werde ich ihm von unserem Märchenwald erzählen und von unserem schönen Brauch, dort jedes Sophienluster Kind einen Baum pflanzen zu lassen, an dem ein Schildchen mit seinem Namen befestigt wird. Vielleicht freut Bastian das ein bisschen.«
»Er braucht sich nicht zu freuen. Die Küken haben sich auch nicht gefreut, als sie sterben mussten, Mutti«, schluchzte Henrik auf.
»Ja, du hast Recht. Es ist schwer zu begreifen, mein kleiner Junge. Trotzdem müssen wir immer wieder versuchen, Liebe zu geben. Es ist die Idee von Sophienlust.«
»Das verstehe ich nicht, Mutti. Am liebsten hätten wir Bastian heute alle gemeinsam verhauen. Aber Nick hat’s verboten.«
»Da hatte Nick ganz Recht, Henrik«, meinte Denise erschrocken. »So viele gegen einen, das wäre wirklich nicht fair gewesen. Doch jetzt wollen wir beten. Morgen ist wieder ein Tag, mein Sohn.«
Henrik faltete die Hände.
»… und hilf uns, dass wir Bastian verstehen lernen, damit wir ihn lieb gewinnen und er unser Freund werden kann. Amen«, schloss Denise ernst, nachdem ihr Sohn gebetet hatte.
Mit großen Augen schaute Henrik sie an. »Du meinst es also ganz ernst, wenn du sogar deswegen betest, Mutti?«
»Ja, Bastian ist ein unglückliches Kind. Doch in Sophienlust ist es unsere Aufgabe, unglückliche Kinder glücklich zu machen.«
Henrik rollte sich zusammen. »Vielleicht verstehe ich es, wenn ich so groß bin wie Nick, Mutti«, murmelte er, schon halb im Schlaf.
Denise küsste ihn noch einmal. »Ja, Henrik, dann wirst du es sicher verstehen«, flüsterte sie und verließ auf Zehenspitzen das Zimmer ihres Jüngsten.
»Bastian macht uns große Sorgen«, sagte sie später vor dem flackernden Kaminfeuer zu Alexander.
»Ich wünschte, ich hätte diesen Jungen nicht nach Sophienlust gebracht. Aber wie hätte ich ahnen können, dass aus seinem Vater ein so unsympathischer Zeitgenosse geworden ist und dementsprechend aus dem Sprössling ein so kompliziertes Kind?«
»Ach, weißt du, Alexander, vielleicht sollte es so sein«, erwiderte Denise und schmiegte sich in die Arme ihres geliebten Ehegefährten. »Bastian vermisst die Liebe. Deshalb ist er so aufsässig und beinahe boshaft geworden. Schuld daran ist sein Vater und möglicherweise auch seine Mutter. Letzteres kann ich nicht beurteilen. Ich kenne ja die Verhältnisse nicht. Auf jeden Fall müssen wir versuchen, dem armen kleinen Bastian zu helfen.«
Alexander küsste seine Frau. »Ach, Isi, wann wirst du jemals in einem Kind etwas Böses oder auch nur Abfälliges erblicken? Du schaust in jede Kinderseele wie in einen goldenen Topf hinein.«
»Bisher habe ich aber immer Recht behalten, Alexander. Oder willst du das etwa abstreiten?«
»Hm, nein. Aber Bastian ist wohl eine Ausnahme. So etwas wie die Geschichte mit den Küken ist doch einmalig bei uns. Oder willst du das abstreiten?«
»Jedes unserer Kinderschicksale war einmalig, Alexander. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, und ich bin froh, dass Bastians Vater so lange wegbleiben will. Das gibt uns wenigstens eine Chance. Der Hund ist übrigens inzwischen schon ganz normal geworden. Er kläfft jetzt genauso laut wie Severin und schmatzt mit den anderen Hunden um die Wette, wenn es Futter gibt, und sprüht vor Lebenslust, wie mir Andrea versicherte. Es ist tatsächlich Tierquälerei, wenn man einen Hund zu einer so unnatürlichen Haltung erzieht. Auf die Dauer wäre der arme Wiking wahrscheinlich gemütskrank geworden. Dein Freund Schlüter scheint geradezu perverse Ansichten zu haben.«
Alexander küsste seine Frau noch einmal. »Also, um die Wahrheit zu sagen, der Hund ist mir ziemlich egal. Auch in Bezug auf den Jungen werde ich einen Stoßseufzer der Erleichterung tun, sobald Kurt seinen missratenen Sprößling wieder abgeholt hat. Soll er doch sehen, wie er mit seinen Problemen fertig wird. Wenn ich allerdings an seine Frau denke, dann tut mir die arme Person von Herzen leid. Noch mehr stört mich, dass ich dir mit dieser ganzen Familie Schlüter nichts als Ungelegenheiten bereitet habe. Ich werde in Zukunft selbst keine Kinder mehr in Sophienlust aufnehmen, sondern das stets dir überlassen.«
»Ich bin ganz zufrieden, dass Bastian bei uns ist. Vielleicht bringen wir ihn auf irgendeine Weise wieder mit seiner Mutter zusammen. Sein Verhalten hat mir deutlich bewiesen, dass er sich nach Liebe sehnt. Den Hund liebt er nicht. Ich fürchte auch, vor seinem Vater hat er bloß Angst. An Henrik hatte er sich ein bisschen angeschlossen, aber unser Jüngster ist jetzt natürlich wütend wegen der toten Küken. Da müssen wir ein bisschen Geduld haben.«
»Sophienlust-Sophienlust-Sophienlust. Wann werden wir mal von etwas anderem reden, Liebste?«, seufzte Alexander mit gut gespielter Verzweiflung.
»Sofort, Alexander. Ich liebe dich, und ich habe Appetit auf eine Flasche Rotwein an diesem kalten Abend.«
»Wunderbar, Liebste. Also, ich hole den Wein, und du versprichst, dass wir heute Abend nur noch an uns denken.«
*
»Du, das ist Herr Borek. Ich habe ihn heute Mittag am Swimming-pool kennengelernt. Macht es dir etwas aus, wenn wir ihn mit an unseren Tisch bitten, Kurt?« Hella von Walden richtete diese Frage mit den unschuldigsten Augen an Kurt Schlüter, der nicht ahnte, dass sie Hanko Borek telegrafiert hatte, dass sie eine Woche in Kairo bleiben würden. Das war Zeit genug, um sich unauffällig zu treffen und kennenzulernen.
Hella von Walden und Kurt Schlüter waren bislang in Paris gewesen. Sie hatten alle Sehenswürdigkeiten der Stadt bewundert: Notre Dame, den Louvre, den Arc de Triomphe und natürlich auch den Eiffelturm. Außerdem hatte Hella in Paris die schönsten Kleider bekommen sowie eine sportliche Ausrüstung für Exkursionen, die im Programm der Weltreise vorgesehen waren. Es war eine Ausstattung, die einer Fürstin würdig war. Natürlich hatte sie entsprechend viel Geld gekostet. Mit ein paar kleinen Tricks war es Hella sogar gelungen, Kurt Schlüter zu überlisten und einige tausend Euro in ihrer Krokodilhandtasche verschwinden zu lassen. Dieses Kapital hatte sie inzwischen Hanko Borek zugesteckt, der es im nächsten Wechselbüro in ägyptische Pfund umgetauscht hatte, und dadurch nun in der Lage war, das teure Hotel in Kairo zu bezahlen.
»Nein, ich habe nichts dagegen«, antwortete Kurt Schlüter. »Er sieht sehr fremdländisch aus. Ist er Ägypter?«
»Nein. Er stammt aus Sardinien, aber er lebt schon seit vielen Jahren in Deutschland. Ursprünglich kommt die Familie allerdings aus der Tschechoslowakei, glaube ich. Der Name klingt jedenfalls so. Ich habe mich nicht so genau erkundigt.«
»Nun, es ist nicht wichtig, solange er deutsch mit uns sprechen kann. Ich habe keine Lust, den Abend mit fremdsprachlichen Übungen zu verbringen. Vielleicht ist er ganz nett.« Kurt Schlüter stand auf und bat Hanko Borek persönlich an seinen Tisch.
Hellas Freund bemühte sich, als Mann von Welt zu gelten.
»Aus Sardinien, sagte Frau von Walden? Nein, das stimmt nicht! Meine Vorfahren sind polnische Adelige. Aber wie das so ist, der Titel wurde irgendwann abgelegt. Sie wissen ja, wie es unserem Land im Laufe der Geschichte ergangen ist. Ich lege jedoch auf den Titel keinen Wert. Wichtig ist für mich nur, dass mir das Vermögen geblieben ist.« Er lachte sorglos und fröhlich. »Werden Sie sich morgen an dem Ausflug zu den Pyramiden beteiligen, Herr Generaldirektor?«
»Frau von Walden möchte schrecklich gern teilnehmen. Ich für mein Teil habe nicht so viel Lust, denn ich stelle mir das Ganze ziemlich anstrengend vor. Vielleicht übernehmen Sie den Schutz Frau von Waldens an meiner Stelle?«
Kurt Schlüter war dick und faul. Es bereitete ihm Unbehagen, wenn er sich körperlich zu sehr anstrengen musste oder gar ins Schwitzen geriet. Beides würde sich bei dem Ausflug zu den Pyramiden kaum vermeiden lassen.
Hella und Hanko tauschten einen verstohlenen Blick. Sie hatten kaum zu hoffen gewagt, dass sich das so einfach würde arrangieren lassen.
Kurt Schlüter war Hanko Borek geradezu dankbar, als er sich erbot, Hella am anderen Morgen zu begleiten. »Ich werde ausschlafen und mich dann an den Swimming-pool legen«, verkündete er. »Außerdem muss ich an meinen Sohn eine Postkarte schreiben. Das habe ich bis jetzt vergessen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Es war zu schön und aufregend mit dir, Hellachen.« Er nahm Hellas Hand und drückte seine dicken Lippen darauf, um Hanko Borek deutlich zu zeigen, dass diese Frau ihm gehörte, ihm ganz allein. Wie anders die Dinge in Wirklichkeit lagen, ahnte er nicht.
Kurt Schlüter bestellte teuren Wein, sodass die Stimmung stieg. Hanko Borek, der in allen Sätteln gerecht war, zeigte sich als liebenswürdiger Gesellschafter und hütete sich, Hella von Walden in irgendeiner Weise auffällig den Hof zu machen. Denn er wollte auf keinen Fall den Argwohn des Generaldirektors wecken.
Spät trennte man sich, und Kurt Schlüter meinte in bester Laune: »Sie müssen morgen beizeiten aufstehen, aber ich beneide Sie nicht darum. Hella ist ja eine Frühaufsteherin, wenn es darum geht, die Wunder der Welt zu erobern. Aber ich bin noch immer erholungsbedürftig, nach allem, was ich in den letzten Jahren hinter mich gebracht habe.«
Hanko Borek und Hella von Walden tauschten einen letzten Blick des Einverständnisses. Dann trennten sie sich.
*
Am anderen Morgen trafen sich die beiden beim Frühstück.
»Endlich sind wir den dicken Sack für einige Stunden los«, erklärte Hanko Borek lachend. »Wie weit bist du mit ihm?«
»Er ist Wachs in meinen Händen. Außerdem habe ich ihm gestern Abend wieder etwas Geld aus der Tasche genommen. Er merkt es bestimmt nicht. Es sind Dollars. Du kannst sie dir leicht einwechseln.«
»Du wirst immer besser, Mädchen. Den Flug nach Kairo hab’ ich schon raus auf diese Weise. Aber wichtig ist das Testament.«
»Warum eigentlich?«, fragte Hella mit einem Seufzer. »Soll ich wirklich warten, bis der Mops endlich stirbt? Er sieht zwar bereits jetzt mindestens zehn Jahre älter aus, als er ist, aber er wird uns trotzdem nicht den Gefallen tun, sich hinzulegen und die Schweinsäuglein zuzumachen, bloß damit ich sein Millionenerbe antreten kann. Außerdem ist da noch der Junge. Einen Teil erbt der unter allen Umständen.«
»Dann bleibt nichts anderes übrig, als dass du den lieben Kurt Schlüter heiratest. Auf diese Weise bekämst du nach seinem Tod Verfügungsgewalt über dein eigenes Erbe und über das des Jungen.«
»Du redest immer von seinem Tod.«
»Es könnte ihm doch etwas passieren, Hella!«
»Hör mal, allmählich kriege ich Angst.«
»Sei nicht kindisch. Wir werden uns nicht die Hände schmutzig machen. Irgendetwas wird uns schon einfallen. Deine Aufgabe ist es, ihn jetzt fein um den Finger zu wickeln und zu erreichen, dass er ein Testament macht, das dich zur Erbin einsetzt und der Frau, mit der er ja noch verheiratet ist, höchstens eine Abfindung zusichert. Schaffst du das vielleicht, wenn es ihm mal schlecht geht, nachdem er zu viel getrunken hat oder so? Du musst deine Phantasie etwas anstrengen, damit dir etwas einfällt.«
»Ich werde mein Möglichstes tun. Jetzt freue ich mich erst mal auf den Ausflug zu den Pyramiden. Kurtchen ist schön dumm, dass er im Bett geblieben ist. Aber es ist seine Sache. Auf diese Weise können wir zwei den lehrreichen Ausflug ohne ihn machen. Komm, es geht schon los.«
Die beiden schlossen sich den anderen Hotelgästen an, die in die bereits vor dem Eingang wartenden Busse einstiegen. Unterwegs hatten Hella und ihr sauberer Freund dann noch genügend Gelegenheit, ihren teuflischen Plan genauer zu besprechen. Am Abend aber lud der dankbare und ahnungslose Kurt Schlüter beide zu einem opulenten Essen ein, bei dem teurer Wein und französischer Sekt in Strömen floss.
*
»Es ist seltsam, er hat nicht geantwortet, obwohl er sich zuerst so gebärdete, als könnte es mit der Scheidung nicht schnell genug gehen«, sagte Angela Schlüter, die wieder einmal bei ihrem Chef, Professor Fabricius, saß, nachdem sie den ganzen Tag lang fleißig für ihn getippt hatte.
»Jetzt ist er am Zug. Sie müssen abwarten, ob Sie wollen oder nicht, liebe Frau Angela. Oder hat Ihnen der kluge Doktor etwas anderes gesagt?«
»Nein. Er hat vorsichtshalber eine Kopie des Briefes an die Privatwohnung geschickt. Einer der beiden Briefe muss ja in Kurts Hände gelangt sein. Offenbar ist es ihm im Augenblick nicht mehr so eilig. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Vor allem sorge ich mich um Bastian. Ich hatte meinen Mann durch den Anwalt bitten lassen, mir die Adresse des Internats mitzuteilen, in dem sich Bastian befindet. Der Anwalt meinte, es sei mein Recht, die Adresse zu erfahren. Kurt könne mir nicht verwehren, mit meinem Kind in Verbindung zu treten. Möglicherweise ist das der Grund, weshalb es mein Mann vorzieht, überhaupt nicht zu antworten.«
»Es muss sehr hart für Sie sein, Frau Angela.«
»Manchmal habe ich Angst, dass meine Nerven nicht durchhalten, Herr Professor. Aber Dr. Immerling hat mir ein bisschen Mut gemacht. Das Recht ist auf meiner Seite, denn aus einem der Briefe meines Mannes geht glücklicherweise einwandfrei hervor, dass ich ihn nicht aus freien Stücken verlassen habe, sondern auf seinen Wunsch hin aus dem Haus gegangen bin. Man könnte auch sagen, dass er mich verstoßen hat. Aber das hört sich gar zu dramatisch an, wenn es auch leider die bittere Wahrheit ist.«
»Haben Sie denn gar keine Möglichkeit, den Aufenthaltsort Ihres Sohnes selbst herauszufinden? Immerhin gibt es in Deutschland eine polizeiliche Meldepflicht, und das Internat wird dieser gesetzlichen Pflicht unter allen Umständen nachkommen.«
»Ja, mag sein. Aber ich weiß nicht, was mein Mann dort über mich erzählt hat. Es könnte sein, dass er verboten hat, Bastian mit mir sprechen zu lassen. Das wäre entsetzlich. Ich könnte es nicht ertragen.«
»Ja, das ist verständlich. Was tun wir also, Frau Angela?«
»Ich habe schon daran gedacht, mich einmal mit unserem Chauffeur und Hausdiener in Verbindung zu setzen. Mit ihm habe ich mich immer besonders gut verstanden. Ich glaube, er würde mir die Adresse des Internats sagen, wenn er sie kennt. Henry hat Bastian sicher im Wagen hingebracht. Also muss er auch wissen, wo sich das Heim befindet.«
»Nun, wäre das nicht eine Möglichkeit?«
»Vielleicht. Aber ich möchte weder den Jungen noch mich selbst einer peinlichen Situation aussetzen. Wie ich schon andeutete, fürchte ich, mein Mann hat irgendwelche Vorsorge getroffen, damit ich keinen Zugang zu meinem Sohn erhalte.« Angelas Stimme zitterte ein bisschen. Dass sie vor Kurt Schlüter, dem Mann, den sie vor vielen Jahren aus echter Liebe geheiratet hatte, jetzt Angst empfand, war nicht zu verkennen.
Dem alten Professor tat das Herz weh. Er wusste nicht, was für einen Rat er seiner Sekretärin geben sollte.
»Weiß denn der Chauffeur Henry wenigstens Ihre Adresse hier in Heidelberg, Frau Angela?«, erkundigte er sich zögernd.
»Ich glaube schon. Er hat mir einmal Sachen gebracht. Aber sicher bin ich nicht, ob er sich erinnert.«
»Würde er Ihnen nicht eine Nachricht zukommen lassen, falls es Ihrem kleinen Jungen nicht gut ginge?«
»Selbst dessen bin ich nicht sicher. Es ist möglich, dass er aus Furcht vor meinem Mann einen solchen Schritt nicht wagen würde.» Angela Schlüter schlug die Hände vors Gesicht, damit ihr Chef ihre Tränen nicht sehen sollte.
»Nicht weinen, Frau Angela! Dr. Immerling wird sich schon etwas einfallen lassen, sobald eine Antwort von Ihrem Mann eintrifft. Sie sind bis jetzt stark und geduldig gewesen. Nun müssen Sie tapfer weiter ausharren, so schwer es Ihnen auch fallen mag.«
»Ich bin nun schon so entsetzlich lange von Bastian getrennt. Ein Kind vergisst schnell. Außerdem muss ich fürchten, dass mein Mann den Jungen gegen mich aufgehetzt hat. Wie soll das nur enden? Muss ich mich damit abfinden, dass ich alles verdorben habe: Die Liebe meines Mannes, mein Glück und das Herz meines Kindes?«
Der alte Herr wusste keine Antwort darauf. Am traurigsten war für ihn die Erkenntnis, dass Angela Schlüter auch jetzt noch ein Gefühl der Zuneigung für ihren Mann zu haben schien, obwohl dieser sie so hart und schlecht behandelt und sie sogar regelrecht verstoßen hatte.
*
»Ich hab’ Kopfweh. Und in meinem Hals kratzt es, Schwester Regine.« Bastian saß missmutig in seinem Bett und wollte nicht aufstehen.
Schwester Regine, für das Wohl der Kleinen und Kleinsten in Sophienlust verantwortlich, sah den Jungen zweifelnd an. Er hatte schon des Öfteren Theater gespielt und geflunkert, sodass sie bei ihm nun nicht wusste, woran sie war.
»Echt, Tante Regine«, versicherte Bastian kläglich. Er redete Schwester Regine manchmal formell mit »Schwester« manchmal aber auch mit »Tante« an.
Schwester Regine legte ihre Hand auf die Stirn des Jungen, die sich tatsächlich heiß anfühlte.
»Ich werde das Thermometer holen, Bastian. Du kannst vorerst im Bett bleiben.«
Bastian ließ sich auf sein Kopfkissen zurückfallen. Er seufzte erleichtert, denn das Aufstehen war ihm wie eine unüberwindliche Aufgabe erschienen. Er fühlte sich wirklich schlecht.
Schwester Regine erschien mit dem Fieberthermometer und steckte es ihm in den Mund. »Schön unter die Zunge, Bastian. So ist’s recht.«
Bastian lag ganz still, während die Kinderschwester das Bett des anderen kleinen Jungen in Ordnung brachte. »Wenn du Fieber hast, bringe ich dich gleich hinüber ins Krankenzimmer, damit Fritzchen sich nicht ansteckt, Bastian«, erklärte sie dabei.
Nun, Bastian hatte tatsächlich nicht nur leicht erhöhte Temperatur, sondern beinahe neunundreißig Grad Fieber. Schwester Regine war ehrlich erschrocken und informierte sogleich Frau Rennert, die daraufhin mit der Ärztin telefonierte. Dr. Anja Frey versprach sofort zu kommen. Sie legte dabei eine merkwürdige Eile und Entschlossenheit an den Tag.
»Halsschmerzen, hohes Fieber, Kopfweh?«, hatte sie am Telefon wiederholt. »Ich bin in einer halben Stunde bei Ihnen. Legen Sie den Jungen ins Krankenzimmer, und lassen Sie die anderen Kinder nicht zu ihm.«
Nun, das war in Sophienlust sowieso eine Selbstverständlichkeit. Sobald ein Kind irgendwelche Krankheitssymptome zeigte, wurde es vorsichtshalber isoliert.
Schwester Regine machte das Krankenzimmer zurecht, das glücklicherweise ziemlich lange leergestanden hatte. Dann wickelte sie Bastian, der still und brav alles mit sich geschehen ließ, in eine Decke und trug den großen Jungen über den Flur ins andere Zimmer.
»Bin ich sehr krank, Schwester Regine?«, fragte Bastian. »Mir tun die Beine weh.«
»Es wird schon nicht so schlimm sein. Gleich kommt Frau Dr. Frey und untersucht dich. Dann kriegst du wahrscheinlich eine Spritze oder ein paar Tabletten.«
»Vor Spritzen hab’ ich Angst. Mein Vati mag auch keine Spritzen. Er hat nicht erlaubt, dass ich gepiekst werde.«
»Nun, das wollen wir Frau Dr. Frey überlassen. Dein Vati ist ja jetzt auch nicht hier. Wir können ihn also nicht fragen. Du willst doch aber sicher schnell wieder gesund werden, damit du wieder mit den anderen Kindern spielen kannst.«
»Ach«, seufzte Bastian aus tiefstem Herzensgrund, »die spielen ja doch nicht mit mir.«
»Das liegt nur an dir. Wenn du nett und freundlich wärst, würden sie bestimmt mit dir sprechen, Bastian. Aber du hast sie immer angefahren und mit deinem Hund Wiking angegeben. Das mögen die anderen Kinder nun mal nicht leiden.«
»Es ist schade«, rang es sich von Bastians Lippen. »Vati sagt immer, man darf sich nichts gefallen lassen. Aber ich glaube, dass man auch mal nachgeben muss.«
»Stimmt genau, mein Kleiner. Pass auf, wenn du wieder gesund bist, werden die Kinder gern mit dir spielen. Dann gibt dir Nick auch sicherlich wieder Reitunterricht. Du wolltest doch so gern reiten lernen.«
»Ja, Schwester Regine.« Die Stimme des Jungen hörte sich so kläglich an, dass die Kinderschwester ernstlich besorgt um ihn war.
Dr. Anja Frey traf fast gleichzeitig mit Denise von Schoenecker ein, die natürlich sofort von Schoeneich herbeigeeilt war, als sie gehört hatte, dass mit Bastian etwas nicht in Ordnung sei.
Die Ärztin ließ sich sofort zu dem kleinen Patienten führen und untersuchte ihn gründlich. »Ich bin nicht ganz sicher, aber es sieht beinahe wie Kinderlähmung aus«, sagte sie später zu Denise von Schoenecker und Frau Rennert. »Es wäre der zweite Fall hier in der Gegend, nachdem wir seit Jahren so gut wie niemals damit zu tun hatten. Es ist unbegreiflich, dass es immer noch Eltern gibt, die ihre Kinder nicht impfen lassen. Bei Bastian bin ich leider ziemlich sicher, dass er nicht geimpft ist. Ich habe ihn ausgefragt. Sein Vater scheint gegen die Schutzimpfung zu sein. Kann man die Eltern erreichen, um das wenigstens festzustellen?«
Denise war entsetzt. Einen Fall von Polio hatten sie noch nie in Sophienlust gehabt. »Könnte es nicht etwas anderes sein, als ausgerechnet Kinderlähmung, Frau Dr. Frey?«, fragte sie erschrocken.
»Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Im Laufe des Tages komme ich noch einmal her. Dann sehen wir vielleicht schon klarer. Die Krankheit verläuft ja meist ziemlich stürmisch. Auf jeden Fall halten Sie Bastian streng isoliert.«
»Glücklicherweise sind unsere Kinder gegen Polio geimpft«, meinte Frau Rennert mit einem Seufzer.
»Nun ja, einen absoluten Schutz bietet die Schutzimpfung leider auch nicht. Sie sorgt dafür, dass die Erkrankung im Ansteckungsfall leichter verläuft und im Allgemeinen keine Lähmungen zurückbleiben. Was mich bei Bastian stutzig macht, das ist neben den allgemeinen Symptomen eine verminderte Reaktion im linken Bein. Ich werde das heute Nachmittag noch einmal prüfen. Wenn mein Verdacht sich bestätigt, müssen wir Bastian ins Krankenhaus bringen. Bitte, versuchen Sie, die Angehörigen zu erreichen, damit wir eindeutig klarstellen, ob der Junge geimpft worden ist oder nicht.«
Nachdem Frau Dr. Frey in ihrem Wagen davongefahren war, setzte sich Denise unverzüglich mit der Sekretärin Kurt Schlüters in Augsburg in Verbindung. Die Auskunft, die sie erhielt, war mager. Ob Bastian gegen Polio geimpft sei, konnte die kühl wirkende Dame nicht sagen. Sie meinte jedoch, vielleicht wisse man es im Hause, und gab Denise die Telefonnummer der Privatvilla. Wo man Bastians Mutter erreichen könne, wollte oder konnte die Sekretärin leider auch nicht sagen.
In der Privatwohnung hatte Denise mehr Glück. Die Haushälterin wusste mit absoluter Sicherheit, dass Bastian überhaupt nicht geimpft war. Sein Vater sei ein Impfgegner und habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um sogar die gesetzlich vorgeschriebenen Impfungen bei seinem Sohn zu verhindern. Sie erinnere sich dessen genau, denn Frau Schlüter sei anderer Ansicht gewesen. Es habe deshalb mehrmals Streit gegeben zwischen dem Ehepaar. Insbesondere die Impfung gegen Kinderlähmung habe Herr Schlüter nur als Firlefanz und Manipulation der chemischen Fabriken, die das Serum herstellen, angesehen. Danach meinte die Haushälterin noch, die Anschrift von Bastians Mutter wisse wahrscheinlich Henry, der Fahrer. Sie bat Denise, eine Minute zu warten.
Denise wartete mit Herzklopfen. Es war ihr klar, dass sie die Mutter sofort verständigen musste. Auch wollte sie von ihr noch die Bestätigung haben, dass Bastian tatsächlich nicht geimpft war. Denise kam es fast unmöglich vor, dass ein Mann wie Kurt Schlüter wahrhaftig so kurzsichtig über eine derartig lebensnotwendige Maßnahme denken könne.
Henry kam selbst an den Apparat. »Ja, ich kenne die Adresse von der gnädigen Frau«, erklärte er bereitwillig und höflich. »Ich bin einmal mit dem Wagen bei ihr gewesen und habe ihr einige Koffer gebracht. Aber Sie werden sie dort nicht telefonisch erreichen, denn sie bewohnt ein möbliertes Zimmer und ist tagsüber berufstätig. Professor Faberius oder Fabricius oder so ähnlich heißt der Herr, bei dem sie arbeitet. In Heidelberg ist das. Vielleicht kann man die Adresse feststellen. Geht es unserem jungen Herren denn sehr schlecht?« Aus den Worten des freundlichen, biederen Mannes war ehrliche Besorgnis herauszuhören.
»Es geht ihm nicht gut, Henry. Würden Sie Frau Schlüter hierherbringen, falls sich das als nötig erweisen sollte?«
»Natürlich tue ich das. Das ist selbstverständlich. Herr Generaldirektor Schlüter ist ja nicht da. Aber das müsste er ja als Notfall anerkennen, nicht wahr?«
»Das glaube ich auch, Henry. Bleiben Sie am besten in der Nähe des Telefons. Ich versuche, den Professor in Heidelberg ausfindig zu machen.«
Denise hatte nun wenigstens ein Zipfelchen in der Hand. Frau Rennert erbot sich sofort, bei der Auskunft nach dem Professor in Heidelberg zu forschen, doch Denise war viel zu nervös, um zu warten. Sie tat es selbst. Kurz darauf sagte sie: »Fabricius heißt er. Die Nummer hat man mir gleich sagen können. Es ging ganz schnell. Trotzdem habe ich jetzt Hemmungen, die arme Mutter in Schrecken zu stürzen. Ich werde ihr wenigstens nicht gleich von der Polio etwas sagen.«
»Aber wenn Sie fragen, ob Bastian geimpft ist …«
»Richtig, dann wird sie sich ihr Teil denken. Es hilft nichts, wir müssen sie anrufen und in Kauf nehmen, dass wir sie erschrecken.«
Doch Denise schob den Anruf zunächst noch etwas hinaus. Sie zog einen weißen Kittel über und ging zu dem kranken Jungen, der still und apathisch in seinem Krankenbett lag.
»Na, mein Kleiner, wie fühlst du dich?«, fragte sie liebevoll und reichte ihm ein buntes Bilderbuch. »Hier, willst du dir das ansehen, damit es dir nicht zu langweilig wird?«
Bastian nahm das Buch zwar, klagte aber: »Tante Isi, ich mag mir nichts ansehen. Mein Kopf tut doch viel zu weh.«
Denise erkannte, aus dem sonst so trotzigen und aufsässigen Buben war ein regelrechtes Häuflein Elend geworden. Dass er schwer krank war, stand außer Zweifel. Der gütigen Frau krampfte sich das Herz zusammen. Aller Ärger, den ihr Bastian verursacht hatte, war mit einem Schlage bei ihr vergessen. Sie bangte sich um den Jungen, als handle es sich um eines ihrer eigenen Kinder.
»Dann lass es, mein Kleiner. Frau Dr. Frey kommt nachher noch einmal. Sie hat gesagt, du kannst Limonade trinken, so viel du nur willst. Willst du etwas zu trinken haben. Fieber macht Durst.«
»Ja. Tante Isi, ich hab’ Durst.«
Denise läutete und bat Schwester Regine, dem Jungen Limonade zu machen. »Nicht zu kalt, Schwester Regine«, mahnte sie.
»Ich weiß, Frau von Schoenecker«, entgegnete die gewissenhafte Schwester.
Bastian trank gierig, aber er klagte dabei immer wieder über Hals- und Kopfweh. Bei den letzten Schlucken fiel ihm das Glas fast aus den Händen. »Ich kann’s nicht halten, Tante Isi«, jammerte er, als diese eben noch rechtzeitig zugriff, um zu verhindern, dass das Glas zu Boden fiel und zerbrach.
»Du bist eben krank und schwach, mein Kleiner.«
»Waren die Küken auch krank, ehe sie starben, Tante Isi?«, erkundigte sich Bastian mit weinerlichem Stimmchen.
»Nein, nein, Bastian. Du darfst jetzt nicht mehr an die Küken denken. Sie haben bestimmt nichts gemerkt, sondern sind einfach eingeschlafen, als es ihnen zu kalt wurde unter der Haube. Aber das eine, das übrig geblieben ist, soll sich inzwischen gut erholt und gekräftigt haben, und schon mit den größeren Hühnern im Stall leben. Es ist also nicht mehr allein.«
»Ich will auch nicht allein bleiben. Werde ich bald gesund sein, sodass ich mit den anderen spielen kann? Fritzchen ist heute Abend bestimmt ganz traurig, wenn mein Bett leer bleibt.«
»Im Augenblick müssen wir vernünftig sein und dich allein unterbringen, damit sich die anderen Kinder nicht anstecken. Das willst du doch sicherlich auch nicht.«
»Nöö – es macht nämlich gar keinen Spaß, wenn man krank ist.«
»Na, siehst du. Und zunächst bleibe ich heute bei dir, wenn du das willst.«
»Ja, Tante Isi. Bleib hier und geh nicht fort.«
In den Kinderaugen stand unverkennbar die Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Liebe. Denise rückte sich den Stuhl etwas bequemer zurecht und richtete sich geduldig darauf ein, den Tag an Bastians Bett zu verbringen. Sie sprach nicht viel mit dem Jungen, und doch kam es ihr vor, als habe sich gerade jetzt eine Tür in dem verschlossenen und durch falsche Behandlung verhärteten Kinderherzen geöffnet.
Am frühen Nachmittag kam Frau Dr. Anja Frey noch einmal nach Sophienlust. Sie ordnete die sofortige Überführung des fiebernden Jungen ins Krankenhaus nach Maibach an.
Bastian weinte leise. Aber so ganz nahm er nicht wahr, was mit ihm geschah, denn das Fieber war weiter gestiegen, und seine Gedanken waren nicht mehr vollkommen klar.
Obwohl Alexander von Schoenecker dagegen war, begleitete Denise den traurigen Transport. Zuvor hatte sie das bis dahin hinausgeschobene Telefongespräch mit Bastians Mutter geführt.
Angela Schlüter bestätigte, was nun ohnehin schon so gut wie feststand, dass Bastian nicht gegen Kinderlähmung geimpft war. Außerdem erklärte sie sich ohne Zögern bereit, mit dem nächsten Zug zu kommen, um persönlich in der Nähe ihres Kindes zu sein. Als sie hörte, dass Henry sich sofort mit dem Wagen in Marsch setzen wollte, nahm sie dieses Angebot voller Dankbarkeit an.
In Sophienlust musste auf Anweisung der Ärztin alles gründlich desinfiziert werden. Es gab an diesem Tag viel Aufregung im Kinderheim. Niemand dachte mehr daran, dass man auf Bastian immer noch böse war wegen des üblen Streichs mit den kleinen Küken. Alle hatten Mitleid mit ihm und wünschten ihm von ganzem Herzen gute Besserung.
Dann setzte sich der traurige kleine Konvoi in Bewegung – voran der Krankenwagen, dahinter Denises Auto, in dem auch ihr Mann Platz genommen hatte, damit Denise die Rückfahrt in der früh einsetzenden Herbstdunkelheit nicht allein machen musste
*
»Natürlich müssen Sie sofort zu Ihrem Sohn, Frau Angela«, sagte Professor Fabricius. »Meine wissenschaftliche Arbeit kann warten. Ich werde neue Studien machen während Ihrer Abwesenheit. Wenn Sie dann zurückkommen, ist ein weiteres Stück des Manuskriptes vorbereitet.«
»Es bringt Ihnen also wirklich keine Ungelegenheiten?«
»Nein, gar nicht, Frau Angela. Mir erscheint jetzt nur wichtig, dass Sie in Ihre Wohnung fahren, Ihren Koffer packen und sich bereithalten, wenn der Chauffeur kommt. Müssen Sie noch in Augsburg anrufen? Sie können es gern von hier aus tun.«
»Danke, Herr Professor, das ist nicht nötig. Frau von Schoenecker wollte das für mich übernehmen. Sie muss eine reizende Dame sein. Das Kinderheim scheint ganz anders zu sein, als ich es mir nach den Andeutungen meines Mannes vorgestellt habe. Frau von Schoenecker muss man schon lieb haben, sobald man ihre Stimme hört. So hoffe ich, dass mein kleiner Bastian sich dort wenigstens etwas wohlgefühlt hat.«
»Das ist doch ein Trost in all der Aufregung. Und mit der Kinderlähmung wird man jetzt im Allgemeinen auch ganz gut fertig, Frau Angela. Im Krankenhaus kann Ihr Sohn, falls sich die Lähmung auf die Atmungsorgane ausdehnen sollte, behandelt werden, was ja nicht unbedingt der Fall sein muss.«
»Ich mache mir schreckliche Vorwürfe, Herr Professor. Es gab damals einen regelrechten Kampf zwischen meinem Mann und mir. Nicht einmal gegen Pocken ist Bastian geimpft worden. So nüchtern mein Mann sonst urteilt – mit dem Impfen steht er leider auf Kriegsfuß. Ich hatte nicht die Macht, etwas dagegen zu tun. Jetzt sage ich mir, dass ich gegen seinen Willen mit Bastian zum Arzt hätte gehen sollen, um ihn impfen zu lassen.«
»Man soll im Nachhinein nicht ›wenn‹ und ›hätte‹ sagen, liebe Frau Angela. Warten Sie, ich fahre Sie rasch in meinem Wagen zu Ihrer Wohnung. Dann gewinnen Sie Zeit zum Einpacken.«
»Hätten wir nicht wenigstens das Kapitel hier noch abschließen sollen?« Unschlüssig wies Angela Schlüter auf den Stapel beschriebener Blätter neben der Schreibmaschine.
»Das ist doch jetzt unwesentlich. Vor Ablauf von zwei oder drei Jahren wird dieser Text ohnehin nicht gedruckt werden. Vergessen Sie jetzt bitte meine wissenschaftliche Arbeit, und denken Sie nur an das, was Sie selbst und Ihren Sohn betrifft. Sie werden ihn bald wiedersehen und dann auch feststellen können, wo und wie er untergebracht ist. Das ist bei aller Sorge um seine Gesundheit doch ein Trost.«
»Ja, so ist es«, seufzte Angela Schlüter. »Ich hatte in diesen Tagen eine ständig wachsende Unruhe in mir. Es kommt mir vor, als hätte ich das Unglück schon gefühlt.«
»Mütter bleiben mit ihren Kindern immer durch ein unsichtbares Band verbunden. Es ist durchaus möglich, dass Sie es fühlten, als Ihr Sohn erkrankte. So, sind Sie nun fertig? Nein, nein, die Schreibmaschine kann ich später selbst einpacken.«
Mit sanfter Gewalt drängte Professor Fabricius Angela Schlüter hinaus und führte sie zu seinem alten, großen Auto, das er nur noch selten benutzte. In weniger als zehn Minuten brachte er sie zu ihrer Wohnung.
»Alles Gute, Frau Angela. Und vergessen Sie nicht, mir kurz Bescheid zu geben, wie es Ihnen und vor allem, dem Kleinen geht. Ich sorge mich nämlich ebenfalls.«
»Ja, Herr Professor, ich lasse von mir hören. Vielen Dank für alles. Sie sind so gut zu mir. Dabei lasse ich Sie jetzt von einer Minute zur anderen im Stich.«
»Papperlapapp! Gute Besserung für Ihren Jungen. Und eine gute Fahrt. Der Chauffeur ist doch zuverlässig?«
»Ganz und gar. Mit ihm kann man durch die rabenschwarze Nacht fahren, ohne sich sorgen zu müssen.«
»Umso besser.« Der Professor stieg wieder in sein altes Vehikel und fuhr davon.
Angela nahm den Schlüssel aus ihrer Handtasche und betrat das altmodische Mietshaus, in dem sie ein bescheidenes Zimmer hatte. Außer ihr wurde die ursprünglich große Patrizierwohnung noch von vier Studenten bewohnt. Die Wirtin war eine Witwe mittleren Alters, die immer in blassgrauen Kleidern herumlief, sich aber nur selten sehen ließ. Ein Telefon gab es in der Wohnung nicht – ein Umstand, der von den Mietern gelegentlich bedauert wurde.
Angela suchte ihr Zimmer auf und packte eilig ihren Koffer. Sie zog für die Fahrt das braune Kostüm an, das sie erst vor wenigen Tagen von ihrem Gehalt erstanden hatte. Dass sie gerade in diesem schlichten Schneiderkostüm besonders hübsch und anziehend wirkte, war ihr kaum bewusst.
Zwei Stunden später klingelte es. Angela ging an die Tür, ehe die Wirtin es tun konnte, denn der livrierte Chauffeur hätte die Gute vielleicht in Verwirrung gebracht. So etwas war in diesem Hause nicht üblich.
Henry hielt seine Schirmmütze in der Hand und grüßte stramm. »Guten Tag, gnädige Frau. Sind Sie so weit? Kann ich das Gepäck nehmen?«
Angela streckte ihm beide Hände hin. »Wie schön, Sie endlich wiederzusehen, Henry. Es kommt mir vor, als hätte ich Sie eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Bloß gut, dass Sie meine Adresse wussten und mich auch nach Sophienlust bringen können. Was sollte ich denn ohne Ihre Hilfe anfangen?«
Henry war etwas in Verlegenheit gebracht, denn im Hause des Generaldirektors war es eigentlich verpönt, seine Gefühle offen zu zeigen. Doch für die Hausfrau hatte er immer Sympathie empfunden, weil sie niemals so kalt und unhöflich war wie ihr Mann.
»Das ist doch selbstverständlich, gnädige Frau«, erwiderte er. »Der Herr Generaldirektor ist verreist. Er hat an alles gedacht, nur nicht daran, dass unser junger Herr krank werden könnte. Das ist eine schlimme Geschichte.«
»So, verreist ist er?«
»Ja, er befindet sich auf einer Weltreise. Mindestens drei Monate wollte er fortbleiben. Er ist für niemanden zu erreichen.«
Angela schöpfte tief Atem. Plötzlich verstand sie, warum der Brief von Rechtsanwalt Immerling unbeantwortet geblieben war.
»Dann wird ihm die Post auch nicht nachgeschickt?«, vergewisserte sie sich.
»Nein, gar nichts. Zu Hause in der Villa liegt schon ein dicker Packen. Aber im Betrieb sind es sicherlich noch mehr Briefe. Die Geschäfte nimmt jemand anderer wahr – ein Herr Dr. Frank. Ich glaube, der Herr Generaldirektor hält große Stücke auf ihn.«
»Nun, das soll nicht unsere Sorge sein. Mein Mann hat ganz gewiss einen tüchtigen und zuverlässigen Vertreter für sich ausgewählt. Mein Koffer steht hier. Mehr brauche ich nicht. Wenn es für Sie nicht zu anstrengend ist, können wir gleich losfahren.«
»Mir macht das nichts aus, gnädige Frau«, versicherte Henry treuherzig.
Aber als Angela im Wagen saß, stellte sie fest, dass Henry ohne Mittag zu essen abgefahren war und auch unterwegs nicht haltgemacht hatte. Sie bestand darauf, dass er am ersten Rasthaus an der Autobahn einkehrte und sich stärkte. Sie selbst begnügte sich mit einer Tasse Kaffee. Sie hätte keinen Bissen herunterbekommen.
Dann fuhren sie in rasend schneller Fahrt in Kurt Schlüters starkem Rolls-Royce über die Autobahn in Richtung Sophienlust. Henry brauchte nicht ein einziges Mal zu überlegen. Er war nicht nur ein ausgezeichneter Chauffeur, er verfügte auch über ein gutes Ortsgedächtnis und fand jeden Platz wieder, an dem er einmal gewesen war.
Sie erreichten Sophienlust, als es längst dunkel geworden war. Nur undeutlich war das schöne alte Herrenhaus zu erkennen.
Frau Rennert hieß Angela herzlich willkommen. Danach sagte sie: »Es geht Ihrem Jungen ganz leidlich, aber es steht nun fest, dass es sich um Polio handelt. Frau von Schoenecker, die mit ins Krankenhaus gefahren war, hat eben angerufen. Wir sind den ganzen Nachmittag und Abend damit beschäftigt gewesen, das Haus bis in den letzten Winkel zu säubern und zu desinfizieren. Unsere Hilfstruppen sind schon ganz erschöpft. Wo wollen Sie übernachten, Frau Schlüter? Frau von Schoenecker hat Sie eingeladen, entweder hier im Heim oder drüben bei ihr in Schoeneich zu wohnen.«
»Ich möchte Frau von Schoenecker gern so schnell wie möglich kennenlernen. Vor allem möchte ich wissen, was sie mir noch über meinen Jungen berichten kann. Vor morgen früh werde ich ihn wohl nicht sehen dürfen.«
»Nein, heute ist es bereits zu spät für einen Besuch in der Klinik. Das lassen wir bis morgen. Das Krankenhaus ist ausgezeichnet. Sie sollten sich nicht zu große Sorgen machen. Es ist ein Glück, dass unsere Ärztin sofort erkannt hat, dass es sich um Polio handelt. Unsere Sorge ist jetzt vor allem, dass sich hier im Haus keines der anderen Kinder angesteckt hat.«
»Ich verstehe«, murmelte Angela Schlüter bestürzt. »Sind die Kinder hier wenigstens geimpft?«
»Selbstverständlich. Trotzdem kann man eine Ansteckung nicht völlig ausschließen.«
Angela nickte mehrmals. Es kam ihr vor, als sei dies alles ihre Schuld.
In diesem Augenblick läutete das Telefon. Durch die geöffnete Tür des Büros konnte es Angela deutlich hören.
Frau Rennert entschuldigte sich und ging, um den Hörer abzunehmen.
»Es ist wunderschön hier, gnädige Frau«, flüsterte Henry, der auf Angelas Bitte mit ins Herrenhaus gekommen war. »Ich habe das schon festgestellt, als ich das erste Mal hier war. Das Heim ist in einem früheren Gutshaus untergebracht. Aber auch das Gut wird noch bewirtschaftet und sieht sehr gepflegt aus.« Henry stammte vom Lande und hatte einen sicheren Blick dafür, wie viele Wiesen und Felder versorgt und bestellt waren.
»Ja, es gefällt mir, Henry.«
In diesem Augenblick kam Frau Rennert schon zurück und berichtete, dass Denise von Schoenecker angerufen habe und Angela bitte, drüben in Schoeneich ihr Gast zu sein. Auch für den Fahrer sei eine Unterkunft vorbereitet.
»Können wird das annehmen?«, meinte Angela Schlüter schüchtern.
Frau Rennert lachte. »Sophienlust und Schoeneich sind gastfreie Häuser, Frau Schlüter. Es macht hier wie dort nicht viel aus, wenn Gäste übernachten. Im Gegenteil, wir freuen uns immer über Besuch – besonders unsere Kinder.«
Dann beschrieb sie Henry den Weg nach Schoeneich. »Sie können die Straße nicht verfehlen«, meinte sie. »Es ist die schmale Apshaltstraße, die gleich da drüben abbiegt. Der Weg führt am See vorbei, und dann sehen Sie schon die Lichter von Schoeneich. Es ist nur ein Katzensprung.«
Henry führte seine Herrin wieder hinaus. Die Kinder hatten sich diesmal scheu im Hintergrund gehalten und die Gäste nicht einmal aus der Entfernung betrachtet. Noch steckte allen der Schreck in den Gliedern, dass Bastian an einer so gefürchteten Krankheit litt und nicht einmal geimpft war.
*
Denise und Alexander von Schoenecker kamen dem Rolls-Royce sofort entgegen, als er sich dem Gutshaus von Schoeneich näherte. Hatte schon das schlossähnliche Herrenhaus von Sophienlust Angela Schlüter beeindruckt, so gefiel ihr Schoeneich mindestens genauso gut. Am besten aber gefiel ihr Denise von Schoenecker, die die unglückliche, um das Leben ihres Jungen bangende Mutter ganz fest in die Arme schloss.
»Wir sind froh, dass Sie da sind, Frau Schlüter. Den ganzen Tag lang haben wir uns um Bastian gesorgt. Er hat mehrmals nach Ihnen gefragt im Krankenhaus. Das ist erstaunlich, denn solange er gesund war, hat er fast nie von Ihnen gesprochen.«
Angela schlug die Augen nieder und seufzte. Alexander verbeugte sich vor ihr und zeigte dann erst einmal Henry, wo er den Rolls-Royce abstellen konnte.
Als er ins Haus zurückkehrte, fand er Angela und Denise bereits in den tiefen Sesseln am Kamin. Nick und Henrik hatten höflich guten Abend gewünscht und sich dann zurückgezogen, als ihre Mutter ihnen einen stummen Wink gegeben hatte. Die Kinder waren gewohnt, dass sie sich gelegentlich, ohne viel zu fragen, entfernen mussten, denn ihre Mutter hatte hin und wieder ernste Probleme zu besprechen, die nicht für die Ohren anderer bestimmt waren.
Nick war das manchmal nicht recht, denn er wollte immer alles genau wissen. Deshalb war er sogar hin und wieder ein bisschen neugierig. Doch in diesem Fall fügte er sich sofort. Polio, das war eine ernste Angelegenheit, und zunächst würde seine Mutter Frau Schlüter wohl alles erzählen müssen, was sich heute und in den Tagen zuvor ereignet hatte.
»Ob sie ihr auch das von den Küken steckt?«, fragte Henrik. »Ich finde, sie braucht es nicht zu wissen. Bastian ist jetzt genug gestraft, wo er so krank ist. Mir tut’s schon leid, dass ich in den letzten Tagen kein Wort mit ihm geredet habe.«
»Mutti erzählt ihr das gewiss nicht, Henrik«, tröstete Nick. »Denn Bastians Mutter hat doch jetzt bestimmt schreckliche Angst um den Kleinen. Kinderlähmung ist eine böse, böse Krankheit – und Bastian war nicht einmal geimpft.«
»Wird er dann lahm – weil es doch Kinderlähmung heißt?« erkundigte sich Henrik.
»Hoffentlich nicht, mein Kleiner. Wir wollen ihm beide die Daumen halten.«
»Nein, wir wollen beten, dass er gesund wird, Nick«, gab Henrik leise zurück. »Der liebe Gott hilft ihm bestimmt. Und nachher soll er mein Freund werden.«
»Recht hast du, Kleiner«, murmelte Nick. Obwohl er das mit dem Beten nicht gern zugeben mochte, nahm er sich doch ebenfalls vor, vor dem Einschlafen für Bastian zu beten.
Inzwischen hatte Angela Schlüter Denise von Schoenecker bereits erzählt, wieso Bastian wegen der Halsstarrigkeit seines Vaters nicht geimpft worden war. Denise versicherte ihrerseits, was Frau Rennert schon betont hatte: Das Kreiskrankenhaus sei ausgezeichnet, und Bastian befinde sich dort in der bestmöglichen Obhut und Pflege. Gleich morgen früh konnte Frau Schlüter sich selbst davon überzeugen.
Einen Imbiss lehnte Angela ab. Sie hat schon mittags nichts essen können, gestand sie. Die Angst mache es ihr unmöglich.
»Ja, das gibt es«, bestätigte Denise. »Aber vielleicht trinken Sie mit meinem Mann und mir einen Schluck Rotwein vor dem Schlafengehen. Dann werden Sie wenigstens etwas Ruhe finden.«
»Sie sind so freundlich zu mir. Dabei muss es Ihnen doch so vorkommen, als kümmerte ich mich gar nicht um meinen Jungen.«
»Es war sicherlich nicht Ihre Schuld, Frau Schlüter.«
»Mein Mann hat mich fortgeschickt, weil ich nicht mehr in das große neue Haus passte, wie er sagte. Danach hat er alles getan, um zu verhindern, dass ich Bastians jetzigen Aufenthaltsort erfuhr. Früher habe ich meinem Sohn jede Woche eine hübsche bunte Postkarte geschickt. Aber ich halte es für möglich, dass mein Mann ihm diese Karten gar nicht gegeben hat.«
Denise nickte. »Ja, das fürchte ich auch. Denn Bastian hat einmal geäußert, dass er von Ihnen vergessen worden sei. Das ist ihm sicher von seinem Vater eingeredet worden.«
Angela rannen Tränen über die Wangen. »Glauben Sie, dass man mir erlauben wird, den ganzen Tag bei meinem Jungen im Krankenhaus zu sitzen? Ich habe nur diesen einen Wunsch – immer bei ihm zu sein und ihm zu helfen, so weit das möglich ist.«
»Die Ärzte sind mir alle wohl bekannt. Ich werde zusehen, was ich für Sie tun kann, Frau Schlüter. Sie selbst sind natürlich bis auf Weiteres unser Gast, sofern Sie nicht auch nachts im Krankenhaus bleiben wollen oder müssen. Was ist mit Ihrem Fahrer?«
»Ich denke, ich muss ihn morgen, wenn er mich nach Maibach gebracht hat, zurückschicken, denn er hat ja in Augsburg bestimmte Aufgaben im Haus und im Garten. Wenn ich hier eine Fahrgelegenheit brauche, kann ich leicht ein Taxi nehmen. So groß sind ja die Entfernungen nicht.«
»Wir stehen immer zu Ihrer Verfügung, gnädige Frau«, mischte sich jetzt Alexander von Schoenecker ein. »Es gibt genügend Wagen hier und auch drüben in Sophienlust. Auf ein Taxi werden Sie in den seltensten Fällen angewiesen sein.«
Es wurde spät, ehe man sich an diesem Abend trennte. Angela hatte immer wieder nach Bastian gefragt, und Denise hatte ihr nicht verheimlicht, dass ihr Sohn sich bis jetzt noch nicht eingelebt hatte. Die schreckliche Geschichte von den Küken hatte sie der unglücklichen, von Angst geplagten Mutter allerdings erspart. In dieser Beziehung hatte Dominik Recht behalten.
Endlich zeigte Denise der Besucherin das Gästezimmer, das Marie hergerichtet hatte. Ein herrlicher Strauß Herbstblumen stand auf dem Tisch.
»Wie schön«, flüsterte Angela Schlüter. »Sie begrüßen mich wie einen lang erwarteten Gast – dabei bin ich nur die Mutter eines Jungen, der Ihnen nichts als Ungelegenheiten gemacht hat und der aus sträflichem Leichtsinn nicht einmal gegen Kinderlähmung geimpft wurde.«
»Machen Sie sich doch bitte wenigstens jetzt keine Vorwürfe mehr, liebe Frau Schlüter. Versuchen Sie zu schlafen. Morgen ist wieder ein Tag, und vielleicht geht es Bastian dann schon ein bisschen besser.«
»Aber wenn sich sein Zustand in der Nacht verschlechtert? Ich bin so nahe und kann doch nicht zu ihm«, seufzte Angela.
»Man würde hier anrufen, falls etwas Besorgniserregendes eintreten würde. Aber das wollen wir nicht hoffen. Versuchen Sie zu schlafen, denn Sie brauchen Kraft. Die Fahrt und die Aufregungen des heutigen Tages waren anstrengend für Sie, Frau Schlüter. Gute Nacht.«
»Gute Nacht, und tausend Dank für alles.«
Denise schloss die Besucherin noch einmal fest in die Arme. Dann erst ging sie auf den Zehenspitzen ins Zimmer ihres Jüngsten. Henrik war schon eingeschlafen, doch er blinzelte seine Mutter noch einmal an, als sie sich über sein Bett neigte.
»Ich habe für Bastian gebetet, Mutti. Dass er gesund wird und dass wir Freunde werden«, murmelte er schlaftrunken.
»Recht so, mein Bub«, flüsterte Denise und küsste ihren jüngsten Sohn innig.
Im Schlafzimmer wartete Alexander auf sie. Er zog sie an sich. »Hoffentlich gibt es keine Katastrophe mit der Kinderlähmung, Liebste«, flüsterte er und küsste sie innig. »Ich mache mir die ärgsten Vorwürfe, denn ich allein habe Kurt Schlüter veranlasst, seinen Sohn herzubringen. Stell dir vor, auch unsere eigenen Kinder sind in Gefahr.«
»Wir sind alle geimpft, Alexander. Im Gymnasium ist neulich auch ein Fall von Polio aufgetreten. Hundertprozentig kann man sich nicht schützen. Wir wollen auf Gott vertrauen und uns nicht mit unnötigen Vorwürfen plagen. Bastian war ein Kind in Not. Du hast Recht getan, ihn nach Sophienlust zu holen.«
*
Da die Lähmungen sich über den ganzen Körper ausgebreitet hatten, musste Bastian künstlich beatmet werden.
Es war ein erbarmungswürdiger Anblick. Der armen Mutter brach es fast das Herz, als sie – in einen sterilen Kittel gehüllt – das erste Mal das Sonderzimmer betrat, in dem ihr Sohn untergebracht war. Obwohl er sie nicht wahrnehmen konnte, saß Angela Schlüter geduldig von morgens bis abends am Krankenlager ihres Sohnes. Die Lähmungserscheinungen verstärkten sich zunächst und stürzten die unglückliche Mutter in große Angst.
Doch dann kam der Tag, als das Fieber endlich sank, das Beatmungsgerät entfernt werden konnte, und Bastian aus der Narkose erwachte.
Der behandelnde Arzt sagte, dass die schlimmste Gefahr vorüber sei. Die Krankheit sei nun im Abklingen.
»Wird Bastian gelähmt bleiben?« Das war die Frage, die Angela Schlüter keine Ruhe ließ. Doch darauf konnte ihr der Arzt zu diesem Zeitpunkt noch keine Antwort geben.
Der Junge blickte ihr mit großen müden Augen entgegen.
»Bastian, wie geht es dir denn?«, fragte Angela sanft und legte ihre kühle Hand auf die Stirn des Kindes.
»Ich war krank, Mutti, weil ich nicht geimpft bin, sagt der Doktor. Aber ich werde wieder gesund werden.«
Bastian schien sich gar nicht zu wundern, dass seine Mutter plötzlich da war. Erst nach ein paar Augenblicken fragte er schüchtern: »Wie hast du mich denn gefunden? Vati sagt, du hast mich ganz vergessen.«
»Ich habe dich gefunden, weil Tante Isi mich angerufen hat, Bastian. Wie kannst du nur glauben, ich hätte dich vergessen? Das hat Vati sicherlich gar nicht so gemeint.«
»Doch, er hat immer gesagt: ›Sie hat dich vergessen, sie denkt nicht mehr an dich. Und du musst sie auch vergessen. Wir bekommen eine neue Mutti, die ist viel besser als die alte‹.«
Angela wurde die Kehle eng. »Hat er das wirklich gesagt? Hast du es nicht vielleicht nur im Fieber geträumt, mein Schatz?«
»Ich … ich hab’ mich so nach dir gesehnt, Mutti. Aber ich durfte es Vati nicht sagen.«
»Und Sophienlust? Wie gefällt es dir da?«
»In Sophienlust ist es wunderbar, Mutti. Wenn ich nicht so bockig gewesen wäre, hätte ich jetzt schon einen richtigen Freund – Henrik von Schoenecker, Tante Isis Sohn. Aber jetzt ist er vielleicht böse auf mich.«
Angela schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht, Bastian. Ich habe Henrik schon kennengelernt, denn ich wohne in Schoeneich. Beim Frühstück vor der Schule hat mir Henrik viele Grüße an dich aufgetragen. Du sollst schnell wieder gesund werden, hat er gesagt, damit ihr zusammen spielen könnt. Nick, das ist wohl der größere Bruder, würde dir dann auch weiter Reitstunden auf dem Pony geben.«
»Hat er das wirklich gesagt, Mutti?«
»Natürlich. Woher sollte ich es sonst wissen? Die Kinder von Sophienlust lassen dich auch grüßen. Weißt du, wer noch?«
»Nein, Mutti. Woher sollte ich das wissen? Frau Rennert? Oder Herr Rennert, ihr Sohn? Oder Tante Carola oder Schwester Regine?«
»Die denken bestimmt alle an dich, aber besondere Grüße schickt dir jemand anders.«
»Vati?«, fragte Bastian scheu. »Ich denke, der ist auf der großen Reise mit der neuen Mutti? Er wollte mir immer Karten schicken. Aber bis jetzt ist erst eine einzige gekommen.«
»Vielleicht sind die Karten von Vati verlorengegangen. Hast du denn meine bunten Karten bekommen?« Es widerstrebte Angela, Abfälliges über ihren Mann zu äußern.
»Nein, Mutti. Ich hab’ schon lange nichts mehr von dir gehört.«
»Siehst du, und ich habe dir, solange du noch zu Hause warst, jede Woche eine Karte mit einem schönen Bild geschickt. Manchmal passt die Post nicht richtig auf, und dann geht etwas verloren.«
»Schade«, seufzte der kleine Patient. »Bleibst du jetzt hier, Mutti? Oder fährst du gleich wieder fort?« Angst flackerte in den Kinderaugen auf.
»Ich bleibe, bis du wieder gesund bist, mein Junge. Deshalb bin ich doch gekommen. Tante Isi hat mit dem Doktor geredet. Ich darf von früh bis abends bei dir sitzen. Nur in der Nacht, wenn du schläfst, fahre ich nach Schoeneich und schlafe dort. Aber du hast noch immer nicht erraten, wer dich ganz lieb grüßen lässt und dir baldige Besserung wünscht.«
»Ich weiß es nicht, Mutti. Du musst es mir schon sagen.«
»Henry. Er hat mich hergebracht.«
»Unser Henry, von zu Hause?«
»Ja, er ist nach Heidelberg gekommen und hat mich dann hierhergebracht. Es tut ihm schrecklich leid, dass du krank bist. Er hätte dich auch gern besucht. Aber leider ist das verboten, damit sich niemand ansteckt.«
»Hm – dann darf wohl auch aus Sophienlust keiner kommen? Auch Tante Isi nicht?«
»Nein, aber ich werde immer da sein. Das ist doch schon ein kleiner Trost, nicht wahr?«
»Es ist schön, Mutti. Ich hab’ Tante Isi lieb, aber dich hab’ ich am allerliebsten auf der ganzen Welt.«
»Wirklich, mein Junge, obwohl wir so lange getrennt waren?« Angela Schlüter kämpfte mit den Tränen.
»Du bist doch meine Mutti. Sag mal, brauchen wir denn wirklich eine neue Mutti? Ich mag gar keine. Aber Vati sagt, Frau von Walden wird meine Mutti. Er sagt auch, sie weiß viel besser, was für mich gut ist.«
»Vati meint es sicher gut. Aber vielleicht hat er sich das mit der neuen Mutti einfacher vorgestellt, als es ist. Zuerst musst du mal ganz gesund werden. Alles andere hat Zeit. Vorläufig bin ich bei dir.«
»Ich bin froh darüber. Als die Tür aufging, dachte ich, dass ich träume, Mutti.«
Angela las ihrem Jungen die Worte von den Lippen. Es war für sie ein erschütterndes, unbegreifliches Erlebnis, dass sie das Herz des Kindes nicht verloren hatte. In ihrer Seele klang alles, was Bastian sagte, wie Glockengeläute. Und irgendwo in ihrer Brust flüsterte ihr eine Stimme zu, dass doch nicht alles verloren sein könne, da ihr des Kindes Liebe noch gehöre.
*
Kurt Schlüter und Hella von Walden hatten in Jordaniens Hauptstadt Amman eine Hotelsuite gemietet. Es gefiel ihnen sehr gut in dieser Stadt. Die Höhe bekam Kurt Schlüter ausgezeichnet. Er hatte endlich das Gefühl, dass die Reise für ihn eine Erholung werde.
»Wir bleiben einige Zeit hier, Hellachen. Du bist doch einverstanden? Das Klima ist wunderbar, und es gibt bestimmt viel von alter Kunst hier zu bewundern, falls du dich dafür genauso interessierst wie in Kairo für das, was von den alten Ägyptern noch übrig geblieben ist.«
»Natürlich bleiben wir, wenn es dir gefällt, Kurt. Es ist überall schön mit dir. Hier gibt es auch ein sehr interessantes Publikum im Hotel.«
»Du beschäftigst dich andauernd mit den anderen Leuten. Genüge ich dir eigentlich nicht?«
Hella umarmte ihn zärtlich und küsste ihn. »Aber, Kurt, du bist doch nicht etwa eifersüchtig? Ich meine das ganz allgemein. Es ist doch nett, wenn man in einem internationalen Hotel interessante Leute trifft. Möchtest du ganz allein in diesem Riesenpalast wohnen?«
»Schon gut. Aber du musst mich ebenfalls verstehen. Du bist eine auffällig schöne Frau und sehr, sehr jung. Glaubst du, ich merke nicht, dass sich die Leute nach dir umsehen, wenn wir im Speisesaal oder gar am Swimming-pool erscheinen?«
»Ach, Kurt, das bildest du dir nur ein. Jeder wird angestaunt, der neu ankommt. Das hat mit Jugend oder Schönheit nichts zu tun.«
»Du bist viel zu bescheiden. Ich finde es sehr schmeichelhaft, dass du Aufmerksamkeit erregst. Manchmal kann ich den Tag, an dem du endlich meine Frau wirst und ganz zu mir gehörst, kaum noch erwarten.«
»Ich lege keinen Wert auf einen Trauschein, Kurt. So kleinlich bin ich nicht. Deine Liebe genügt mir. Ich habe Vertrauen zu dir.«
Er legte den Arm um ihre Schultern. Hella von Walden trug ein nilgrünes Abendkleid mit tiefem Ausschnitt. Eben waren sie vom Essen in ihre Zimmer zurückgekehrt. Später wollten sie noch eine Bar aufsuchen. Doch im Augenblick waren sie ins Plaudern gekommen.
Kurt Schlüter setzte sich in einen der bequemen tiefen Sessel des Wohnzimmers, das zu der Suite gehörte. Er zog das schöne Mädchen auf seine Knie und fragte: »Wollen wir uns eine Flasche Champagner heraufkommen lassen, Hella? Man muss ja nicht jeden Abend ausgehen.«
»Ach nein, Kurtchen, hier oben ist es mir zu einsam auf die Dauer. Wir plaudern noch ein Viertelstündchen und dann fahren wir weg, wie es geplant war. Das nette Ehepaar vom Nachbartisch wäre sicherlich gekränkt, wenn wir nicht mitfahren würden.«
»Na schön, fahren wir. Wir sind ja schließlich hier, um uns zu amüsieren.« Er streichelte ihr blondes Haar. »Ich liebe dich, Hellachen. Du bist eine wunderschöne Frau«, flüsterte er.
Sie warf ihm aus ihren eisblauen Augen einen kurzen Blick zu. Nein, du liebst mich nicht, Kurt Schlüter, dachte sie kalt. Du wirst eine gut aussehende Frau mit einem adeligen Namen heiraten. Das ist alles, was dir an mir gefällt. Du benutzt mich wie ein Aushängeschild oder ein Schmuckstück.
Doch das dachte Hella nur. Laut sagte sie: »Manchmal habe ich Angst, dass uns etwas zustoßen könnte, Kurt. Zum Beispiel auf dieser Reise.« Sie schmiegte ihre Wange in gut gespielter Zärtlichkeit an die seine. »Es passiert so vieles heutzutage. Zum Beispiel Flugzeugentführungen. Was dann?«
»Tja, ohne Risiko kann man nicht leben, Hellachen. Das ist nun mal so auf unserer schönen Welt.«
»Nun ja«, entgegnete sie zögernd. »Wenn ich auch keinen allzu großen Wert auf einen Ehering lege, so bleibt doch die Tatsache unbestreitbar, dass ich überhaupt nicht gesichert bin, sofern es das Unglück wollte, dass ich allein zurückbleibe, was der Himmel verhüten möge. Wenn schon, dann will ich mit dir sterben.«
»Nicht so dramatisch, Hellachen«, lachte Schlüter, der nicht an den Tod denken mochte. »Du meinst auch nicht das Sterben, sondern das Geld. Und irgendwo hast du Recht.«
Sie umarmte ihn stürmisch. »Halte mich nicht für materialistisch, Kurtchen. Aber ich hätte den Prinzen zu Leewenhirt heiraten können. Er hat mehrere Millionen, wie du weißt. Aber er gefiel mir ganz einfach nicht so gut wie du. Nun reise ich mit dir als deine Geliebte durch die Welt, doch ganz ohne irgendeine Sicherheit.«
»Ich könnte eine letztwillige Verfügung treffen, die dir den Hauptteil meines Erbes zusichert. Natürlich gehört die Hälfte meines Vermögens meinem Sohn. Eine Abfindung muss ich auch meiner Frau hinterlassen. Aber den Rest solltest du haben. Es ist natürlich Unsinn, denn der Fall wird nie eintreten. Aber es wäre nicht fair, wenn wir ein solches Testament aufsetzten. Du bekämest dann etwa zwei Millionen.«
»Es klingt schrecklich, wenn du von einem Testament sprichst. So hab’ ich das gar nicht gemeint«, behauptete Hella, verbarg aber nur mühsam ihr triumphierendes Lächeln.
»Ich werde es gleich morgen früh schreiben, Hellachen. Ein Testament, das dir Sicherheit bietet, falls mir etwas zustößt.«
Sie küsste ihn. »Du bist ein Engel, Kurt. Ich will ja gar nicht so viel haben. Wenn du mir ein kleinen Legat aussetzt, wäre das doch genug.«
»Du sollst meine zukünftige Frau sein. Also bekommst du den dir zustehenden Anteil. Ich werde mich hier mit einem deutschen Juristen in Verbindung setzen.«
Hella sprang auf. »Du bist so gut zu mir, Kurt. Wie soll ich dir nur danken?«
»Indem du meine Frau wirst, sobald ich die Scheidung erreicht habe. Wenn wir wieder in Deutschland sind, werde ich Angela unter Druck setzen. Sie kann sich auf die Dauer nicht sträuben, sondern muss einsehen, dass sie kein Recht hat, mir Schwierigkeiten zu bereiten. Bastian werden wir für die nächsten Jahre im Kinderheim Sophienlust lassen. Das scheint mir für den Anfang die beste Lösung. Später, wenn er seine Mutter endgültig vergessen hat, holen wir ihn zu uns. Er muss, sobald er größer ist, ganz unter meinen Einfluss kommen, denn die Verantwortung, die er später übernimmt, wird groß sein.«
»Ja, Liebster. Es ist wundervoll, dass du an alles denkst.« Sie blickte auf ihre Uhr. »Doch jetzt sollten wir gehen, Kurt. Es wird sonst zu spät. Wir wollen die anderen nicht warten lassen.«
Kurt Schlüter wäre lieber in seiner Suite geblieben, aber er erfüllte selbstverständlich den Wunsch seiner charmanten Begleiterin. Schließlich sollte sie sich amüsieren und bei guter Laune bleiben. Er gab sich keinen Illusionen darüber hin, dass es von Hella in gewisser Hinsicht ein Opfer war, diese Reise mit ihm ohne Trauschein zu unternehmen und nur auf sein Eheversprechen angewiesen zu sein. Dieses Versprechen blieb schließlich so lange fraglich, solange seine Ehe mit Angela nicht rechtskräftig geschieden war.
Kurt Schlüter stand auf und ging ins Bad, um sich etwas zu erfrischen. Wenig später verließ er mit Hella seine Suite, um im Lift hinunter in die Hotelhalle zu fahren. Dort wurden die beiden von dem anderen Paar schon erwartet. Es war jedoch noch ein Herr hinzugekommen. Hanko Borek stand lächelnd neben der rotblonden Dame aus London, die mit ihrem Mann den Orient bereiste.
»Was für ein Zufall«, sagte er lächelnd und küsste Hella die Hand. »Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir uns noch einmal treffen würden. Sie hatten mir doch mit keinem Wort verraten, dass Sie auch nach Amman wollen.«
Hanko Borek spielte seine Rolle vollendet. In Wirklichkeit hatte Hella ihm sofort telegrafisch eine Nachricht zukommen lassen, als festgestanden hatte, dass sie einige Zeit in Amman bleiben würden. Aber auch sie spielte die Überraschte. Da Hanko Borek sich mit den Engländern schon selbst bekannt gemacht hatte, bedurfte es keiner Frage mehr, dass er sie an diesem Abend begleiten würde.
Hella tanzte später mit Hanko auf der winzigen Tanzfläche der nur matt erleuchteten Bar.
»Der Dicksack hat endlich angebissen. Er macht ein Testament, das mir alles zuspricht, was nicht nach Recht und Gesetz seinem Sohn und seiner Eheliebsten zugebilligt werden muss. Es scheint ein ganz schöner Batzen zu sein. Morgen früh wird das Schriftstück aufgesetzt, Hanko«, raunte sie ihm ins Ohr, während der schwarzhaarige Südländer sie fest an sich drückte.
»Bist ein Prachtmädel, Hella. Ich hab’ ja gewusst, dass du es schaffen wirst. Sieh nur zu, dass der Generaldirektor heute Abend nicht zu müde wird und nicht zu viel trinkt, damit er morgen auch wirklich fit ist, um sein Testament zu machen.«
»Was soll dann eigentlich werden?«, fragte sie leise.
»Eins nach dem anderen, Hellachen. Hab’ erst einmal das Testament in der Tasche. Dann sage ich dir, was weiterhin passieren wird.«
»Manchmal bist du mir unheimlich, Hanko. Immerhin kannst du noch mal vierhundert Dollar von mir haben. Ich stecke das Geld morgen in dein Postfach beim Empfang. Zimmernummer?«
»Siebenundzwanzig, Schätzchen. Bist ein Goldkind. Hatte schon Sorgen, wie ich meine Rechnung bezahlen soll. Es ist ein verflixt teures Pflaster. Aber auf dich kann man sich eben immer verlassen.«
»Wenn ich bloß darum herumkäme, Schlüter heiraten zu müssen, Hanko. Er fängt an, mir mehr und mehr auf die Nerven zu gehen. Stell dir vor, dann muss ich doch auch noch die Mutti für den kleinen Jungen spielen. Das passt ganz einfach nicht zu mir. Er will ihn zu seinem Ebenbild formen! Ja, das hat er beinahe wörtlich gesagt. Er muss sich selbst wunderbar finden, der liebe, dicke, fette Kurt.« Jedes Wort von Hella war nackter Hohn.
»Ich werde versuchen, dass wir um die Hochzeit herumkommen, Hella. Die knappe Hälfte seines Vermögens reicht uns auch. So sieht es doch dann aus, nicht wahr?«
»Du weißt Bescheid wie ein richtiger Jurist«, staunte sie. »Es stimmt. Die Frau kriegt eine gesetzliche Mindestabfindung, der Junge die Hälfte, ich den Rest. Morgen macht er es dann amtlich.«
»Klasse, Hella. Wenn ich das nötige Kleingeld hätte, würde ich dir einen Brillanten in Erbsengröße kaufen. So musst du mit meiner Hochachtung vorliebnehmen.«
»Hochachtung? Darauf pfeife ich. Ich liebe dich, Hanko. Unsere Liebe ist das Einzige, das für mich zählt. Ich würde auch dann bei dir bleiben, wenn wir arm wären.«
»Aber reich zu sein ist besser. Nicht wahr?« Er lachte leise.
»Viel besser. Im Grunde genommen hasse ich schiefgetretene Absätze und Suppen aus der Tüte.«
»Wirst auch beides kaum je haben, mein Schatz. So, nun ist die Kapelle zu Ende mit dem Tanz. Mir reicht es auch im Augenblick. Geh zurück zu Kurtchen. Er sitzt gar so einsam am Tisch, denn die beiden Engländer tanzen ja geradezu leidenschaftlich gern. Sag ihm, dass wir über eine Fahrt nach Israel gesprochen hätten.«
Hella kehrte an Boreks Arm zu Schlüter zurück. Beide erzählten ihm von der geplanten Exkursion. Man könne fliegen, wenn man eine Maschine chartere. Das sei dann am wenigsten anstrengend und zeitraubend.
»Ja, ja, das sollte man wirklich gesehen haben«, meinte Kurt Schlüter und verbarg ein Gähnen hinter der vorgehaltenen Hand. Sofort erinnerte sich Hella an Hankos Mahnung und erklärte, dass sie jetzt schlafen gehen wolle.
»Morgen ist auch noch ein Tag. Werden wir uns wiedersehen, Herr Borek? Oder reisen Sie schon weiter? Wir bleiben nämlich noch eine Weile. Das Klima bekommt uns gut.«
»Ich bleibe auch noch. Ich bin doch eben erst angekommen, gnädige Frau.«
Kurt Schlüter führte Hella von Walden aus der Bar, während Hanko Borek mit dem englischen Ehepaar noch ausharrte, um nur ja bei Schlüter keinen Argwohn zu erregen.
»Du hättest dem dunkelhaarigen Herrn Borek nicht unbedingt zu sagen brauchen, dass wir länger bleiben wollen. Er sieht dich immer ganz verliebt an. Beinahe könnte man auf die Idee kommen, dass er uns – also dir – nachgereist ist.«
»Aber, Kurt, ich glaube wirklich, du neigst zur Eifersucht. Woher in aller Welt soll er denn gewusst haben, dass wir nach Amman wollten und länger bleiben werden, als ursprünglich geplant war? Er ist doch kein Hellseher. Das ist einfach ein Zufall. Aber wenn es dich stört, rede ich in Zukunft kein Wort mehr mit ihm, obwohl das unhöflich wäre. Denn er ist sehr nett.«
Sie nahmen ein Taxi und ließen sich zu ihrem Hotel zurückbringen. Als Hella endlich in ihrem luxuriösen Bett lag und Kurt Schlüters Schnarchen unleugbar davon Zeugnis ablegte, dass er fest eingeschlafen war, fragte sie sich, ob der Mann, dem sie die ganze Zeit lang Liebe vorgespielt hatte, etwa Verdacht geschöpft haben könnte.
Nein, beschwichtigte sie sich selbst. Es ist nicht möglich. Kurt hat bis jetzt nichts gemerkt, und wenn er morgen tatsächlich das Testament macht, dann steht fest, dass er mir vertraut.
Hella von Walden konnte jedoch nicht verhindern, dass ihr Herz stark klopfte. Es dauerte bis zum Morgengrauen, ehe sie endlich einschlief.
Am anderen Vormittag fuhr Kurt Schlüter mit Hella von Walden zu einem deutschen Rechtsanwalt, dessen Adresse er durch die Botschaft erfahren hatte. Er ließ sich wegen des Testamentes beraten, schrieb es dann sofort eigenhändig, setzte das Datum an die richtige Stelle und überreichte das Dokument Hella mit einem Lächeln.
»Hier, mein Schatz. Das ist der vorläufige Ersatz für den Trauschein. Wenn wir erst verheiratet sind, erübrigt sich dieses Papier, denn dann erbst du nach dem Gesetz sowieso fünfzig Prozent. Bis dahin ist auch die Abfindung für Angela geregelt.« Er küsste ihre Hand.
Hella zog ihn zu sich heran und legte die Arme zärtlich um seinen Hals. »Danke, Liebster. Du bist so fürsorglich. Es wäre wirklich nicht nötig gewesen, das Testament zu machen. Aber so bist du immer. Wahrscheinlich ist es das große Geheimnis deiner Erfolge im Leben und bei allen Geschäften, die du in die Hand nimmst. Dafür liebe und bewundere ich dich.«
Er küsste sie. »Schon gut, Hella«, sagte er leichthin. »Ich werde erst dann ruhig und zufrieden sein, wenn wir getraut sind. Es tut mir leid, dass diese Reise nicht unsere Hochzeitsreise geworden ist. Aber leider kam mir Angelas Halsstarrigkeit dazwischen.«
Hella spürte plötzlich mit erschreckender Deutlichkeit, dass er sie nicht liebte, dass er dieses Testament möglicherweise nur deshalb geschrieben hatte, um sie fester an sich zu binden. Das aber bedeutete, dass er ihr nicht traute. Deshalb nahm sie sich vor, auf der Hut zu sein.
Doch Hellas gute Vorsätze wurden über den Haufen geworfen, als sie in in der Hotelhalle Hanko Borek sah. Ihr Herz schlug wie rasend, als er ihr ein Zeichen machte.
»Schau, da ist Herr Borek«, sagte sie fröhlich zu Kurt Schlüter. »Wollen wir ihn begrüßen?«
»Können wir. Aber danach möchte ich mit dir allein zu Mittag essen und nicht in Gesellschaft von anderen Leuten«, knurrte Kurt Schlüter.
»Wir brauchen kein Wort mit Herrn Borek zu reden. So viel liegt mir nun auch wieder nicht an ihm«, säuselte Hella.
»Ach wo, wir wollen ihn ja nicht vor den Kopf stoßen. Ich möchte nur vermeiden, dass er zu unserem ständigen Begleiter wird.«
Hella ging auf Hanko Borek zu.
»Heute Mittag am Swimming-pool«, raunte er ihr zu, um sogleich laut fortzufahren: »Guten Tag, gnädige Frau. Ist das nicht ein wunderbarer Tag? Wie haben Sie den Vormittag verbracht? Der Flug nach Israel kann übrigens nicht vor Donnerstag stattfinden. Bis dahin werden genügend Teilnehmer zusammenkommen, wurde mir versichert.«
Kurt Schlüter, der Hella etwas langsamer gefolgt war, unterhielt sich nach kurzer Begrüßung ebenfalls mit Hanko Borek. Nach einer Weile trennte man sich, und Hanko Borek hielt sich bescheiden im Hintergrund, denn er hatte bereits gemerkt, dass Kurt Schlüter offenbar Wert darauf legte, mit seiner schönen blonden Begleiterin nicht allzu oft gestört zu werden.
Erst gegen zwei Uhr, als die Sonne am höchsten stand, kam es zu einem Treffen zwischen Hella und Hanko. Sie erschien im Bikini und sah atemberaubend hübsch aus. Hanko lag in der Badehose an einem entfernteren Platz und blinzelte ihr träge entgegen.
»Na, wie ist es gegangen?«, fragte er.
Sie ließ sich neben ihm auf das Badetuch fallen. »Alles in Ordnung, Hanko. Das Testament befindet sich bereits in meinem Besitz. Wenn er etwas macht, macht er es gründlich. Er ist ein guter Geschäftsmann.«
»Hm, das ist beinahe zu glatt über die Bühne gelaufen. Was tut er denn jetzt?«
»Er schläft den Schlaf des Gerechten. Kurtchen ist überarbeitet und hat diese Erholungsreise wirklich nötig. Deshalb stecke ich ihn mittags als fürsorgliche Frau immer ins Bett. Bis halb fünf, zum Tee, sind wir sicher, dass er nicht erscheint. Was meinst du, wie froh ich bin, dass du jetzt hier bist! An den anderen Tagen habe ich mich immer allein am Swimming-pool gelangweilt.«
Hanko lachte leise. »Als ob du lange allein bliebest, wenn du in deinem Mini-Bikini hier aufkreuzt. Erzähle mir bitte keine Märchen.«
»Du bist schrecklich, Hanko! Warum glaubst du mir nicht, dass ich nur dich liebe und das Spiel mit Kurt Schlüter nur deinetwegen spiele?«
»Doch, doch, ich glaub’s dir, Schätzchen. Aber meinetwegen darfst du zwischendurch ruhig mal einen kleinen Flirt riskieren. Der blonde Ami da drüben ist sicherlich steinreich und würde was springen lassen, wenn wir ihn nebenbei ein bisschen mit vernaschten.«
Hella sah Hanko ängstlich an. »Lieber nicht, Hanko. Kurt Schlüter ist argwöhnisch und eifersüchtig. Wir wollen keine Dummheiten machen. Außerdem hat derAmerikaner eine Freundin.«
»Na schön. Ich dachte nur, dass du ihn ein bisschen rupfen könntest, damit die Betriebskasse nicht leer wird.«
»Ich komme schon noch an Geld für dich heran. Kurt zählt auf der Reise glücklicherweise nie genau nach. Sonst müsste er allmählich gemerkt haben, dass ich ihm gelegentlich etwas wegnehme. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen dabei. Denn eigentlich ist es ja mein Geld«, erklärte Hella frech und sorglos.
Später tummelte sie sich mit Hanko im Wasser. Die beiden schwammen wie die Fische. Die anderen Hotelgäste, die sie beobachteten, fanden, dass es ein Paar sei, das gut zusammenpasse, er so dunkel, sie so hellblond. Die waren sogar so leichtsinnig, dass sie die formelle Anrede fallenließen, sich duzten und bei ihren Vornamen riefen.
Kurz nach vier verabschiedete sich Hella von Hanko.
»Ich muss zu meinem Tyrannen zurück«, erklärte sie. »Aber heute Abend unternehmen wir wieder etwas gemeinsam. Dafür sorge ich schon. Ein bisschen Spaß möchte ich auch haben.«
Hanko begleitete sie bis zum Hoteleingang, von dem aus es zum Schwimmbad ging. Dort umfasste er ihr Handgelenk. »Hella, würde es dir viel ausmachen, ihm etwas in den Wein oder in den Kaffee zu schütten?«, fragte er heiser und mit gesenkter Stimme.
Das blonde Mädchen wurde blass und zuckte zusammen. »Du meinst wirklich …?«
»Anders wird es kaum möglich sein, dass du die Erbschaft antrittst, Schätzchen.«
»Aber ich …«
»Keine Sorge, ich hab’ was da. Es ist geruch- und geschmacklos und wird ihn obendrein noch schmerzlos ins Jenseits befördern. Denk mal darüber nach, ob sich für dich eine Gelegenheit ergeben könnte, es unauffällig zu machen. In jedem Zimmer ist doch eine Privatbar.«
»Hanko, ich …«
»Psst, da kommt jemand.« Sie standen abseits des Swimming-pools, der Sicht der anderen Hotelgäste durch Buschwerk entzogen. Jetzt aber näherten sich Schritte aus dem Innern des Hotels.
»Wir reden noch darüber, Frau von Walden. Empfehlung an den Herrn Generaldirektor«, sagte Hanko Borek rasch formell und verbeugte sich dazu. Das war für den Herannahenden bestimmt, der niemand anders als Kurt Schlüter war. Ein wenig erschraken Hella und Hanko Borek nun doch. Hatte er etwas von ihrer Unterhaltung gehört?
»Oh, hier seid ihr?«, rief Kurt Schlüter aufgeräumt aus. »Ich habe herrlich geschlafen und wollte mich vor dem Tee eigentlich auch noch ins kühle Nass stürzen.«
»Ich war gerade auf dem Weg zu dir, Liebling. Wenn du schwimmen willst, warte ich natürlich.«
Auch die Herren begrüßten sich. Kurt Schlüter war sehr dick und bot im Badeanzug keinen besonders erfreulichen Anblick. Immerhin schaffte er einen eleganten Startsprung ins Becken, nachdem klar geworden war, dass Hella genug im Wasser gewesen war und ihr eben getrocknetes Haar nicht noch einmal nass werden lassen wollte. Zusammen mit Hanko Borek setzte sie sich an den Rand des Schwimmbassins und sah Kurt Schlüter zu, der prustend ein paar Runden schwamm.
»Ein Adonis ist er wirklich nicht«, flüsterte Hanko Hella zu.
»Sei still. Übers Wasser tragen die Stimmen manchmal mehr, als man annimmt.«
»Der schnauft doch wie ein Walross und kann kein Wort hören«, spottete Borek. »Sicher hat er zuvor auch nichts mitgekriegt.«
Etwa zehn Minuten später kam Kurt Schlüter patschnass, aber sichtlich erfrischt aus den Fluten und rubbelte sich mit dem mitgebrachten Handtuch trocken.
»So, in einer halben Stunde gibt es den wohlverdienten Nachmittagstee. Wollen Sie sich uns anschließen, Herr Borek?«
Diese freundlich ausgesprochene Einladung zerstreute die letzten Besorgnisse des Pärchens, dass Schlüter etwas von der gefährlichen Unterhaltung am Hoteleingang gehört haben könnte. Hella warf Hanko einen erleichterten Blick zu, während dieser sich verbeugte und erwiderte: »Vielen Dank, Herr Generaldirektor. Mit Vergnügen. Mir ist auch nach einem guten Tee zumute.«
»Sparen Sie sich den Titel, mein Guter«, sagte Schlüter jovial. »Ich heiße Schlüter. Das wissen Sie ja.«
»Ehre, wem Ehre gebührt«, meinte Hanko Borek. »Aber wenn Sie darauf bestehen, Herr Schlüter …«
»Wir sind doch schon beinahe Freunde geworden. Zuerst das Treffen in Kairo und jetzt hier in Amman. Da müssen wir doch zusammenhalten. Oder sind Sie anderer Meinung?«
»Nein. Bis gleich also. Ich muss mich nur duschen und umziehen.«
»Genau wie wir. Im Badezeug kann man schlecht im Teeraum erscheinen.«
Oben, im Schlafzimmer, sagte Kurt Schlüter zu Hella, die sich eben das strähnig gewordene Haar bürstete, um es zu einer raffinierten Frisur aufzustecken: »Ein reizender Mann, dieser Hanko Borek. Er wird mir immer sympathischer.«
»Noch gestern warst du gar nicht begeistert, dass er wieder hier aufgetaucht ist, Kurt. Du änderst doch sonst deine Meinung nicht so rasch.«
Kurt Schlüter zuckte die Achseln. »Es kommt wohl auf den Menschen an. Herr Borek gefällt mir. Ich habe nichts dagegen, dass er uns ein paar Tage lang hier in Amman und auch bei Ausflügen Gesellschaft leistet.«
»Na, immer braucht er uns auch nicht auf der Pelle zu sitzen, Kurt. Bist du nicht ganz gern zwischendurch mit mir allein?«, schmeichelte Hella, die besonders auf der Hut war.
»Das wird sich schon ergeben. Er ist wohlerzogen und höflich. Solchen Leuten braucht man glücklicherweise nicht erst mit dem Zaunpfahl zu winken. Sie merken selbst, wann die Zeit gekommen ist, sich zu verabschieden.«
Hella antwortete nicht. Sie wunderte sich nur ein wenig über die plötzliche Sinnesänderung Kurt Schlüters. Doch sie dachte nicht weiter darüber nach, denn jetzt war die wichtige Frage zu entscheiden, welches Kleid sie für den späten Nachmittag tragen sollte. Sie liebte ihren großen Koffer voller Kleider, eines immer schöner als das andere und fast alle aus den ersten Häusern von Paris. Schließlich entschied sie sich für ein durchsichtiges dunkelblaues Chiffonkleid mit Silberstickerei.
»Du bist schön wie ein Engel, Hella«, sagte Kurt Schlüter, und küsste ihr die Hand. »Das Blau passt besonders zu deinem blonden Haar, und deinen Augen gibt es eine unwahrscheinliche Farbe.«
»Danke, das war ein schönes Kompliment. Du bist nicht oft so charmant, Kurt. Ist es ein Zeichen dafür, dass du anfängst, dich zu erholen?«
»Weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich heute besonders stolz auf dich.«
Er bot ihr den Arm. So verließen sie ihre Suite und fuhren im Lift zum Teeraum, wo Hanko Borek sie schon erwartete. Er hatte einen besonders gut gelegenen Tisch reserviert. Man hörte leise Musik aus einem Lautsprecher, und sofort erschien ein Garcon, um sich nach den Wünschen der Gäste zu erkundigen. Schlüter bestellte Tee und leichtes Gebäck, außerdem ein paar Käsehäppchen für die Herren.
Er rieb sich die Hände.
»Ich fühle mich richtig wohl hier. Die Höhenluft scheint mir gutzutun. Es kommt mir vor, als könnte ich schon morgen nach Hause fliegen und meine Geschäfte wieder aufnehmen. Bis jetzt mochte ich nicht mal an Deutschland denken.«
»Willst du tatsächlich schon umkehren?«, fragte Hella ehrlich erschrocken.
»Keinesfalls, Hellachen. Unsere Reise ist fest gebucht und geplant. Ich pflege immer das durchzuführen, was ich mir vorgenommen habe. Nach dem verlängerten Aufenthalt in Amman wird sich alles um zwei oder drei Wochen verschieben. Das ist der einzige Unterschied. Meine Geschäfte sind geregelt. Ich will noch nichts davon hören oder sehen.«
Das Mädchen atmete erleichtert auf. »Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt, Kurt. Die Reise hat doch eigentlich gerade erst richtig angefangen, weil du dich nun endlich nicht mehr schlapp und überarbeitest fühlst.«
Der Tee wurde serviert. Hella knabberte an dem Gebäck, während die Herren sich an die kräftigeren Dinge hielten. Die Stimmung war heiter und gelöst. Da es draußen kühler wurde, strömten immer mehr Gäste in den Teeraum.
»Es ist wirklich schön hier. Finden Sie nicht?«, wandte sich Kurt Schlüter an Hanko Borek. »Werden Sie auch ein paar Tage zugeben?«
»Ich wollte sowieso zwei bis drei Wochen hierbleiben, weil ich einige Museen besichtigen will. Das ist nicht in ein paar Tagen getan.«
»So? Da wird Hella sicher gern mitkommen.«
»Ja, Kurt vielleicht. Es hängt davon ab, ob es dich interessiert.«
»Nein, du müsstest mit Herrn Borek allein gehen.«
»Kommt nicht infrage, Kurt. Entschuldigen Sie, bitte, Herr Borek. Das soll keine Unhöflichkeit gegen Sie sein. Aber ich mag Kurt keinesfalls so lange allein lassen. Auch den Flug nach Israel mache ich nur mit, wenn du ebenfalls dabei bist, Kurt.«
Wieder einmal tauschten Hella von Walden und Hanko Borek einen Blick. Nein, nein – so unvorsichtig würden sie nicht in eine Falle tappen! Es wurde ihnen allmählich klar, dass Schlüters Großzügigkeit gespielt war und dass er ihnen nicht hundertprozentig traute.
Trotzdem schloss Hanko Borek sich den beiden auch an diesem Abend an. Aber in einem unbeobachteten Augenblick warnte er Hella: »Sei vorsichtig, Hella. Wir müssen jetzt alles vermeiden, was ihn misstrauisch machen könnte. Sprich nicht mehr von dem Testament, aber verwahre es gut.«
»Ja, Hanko, und das andere …?«
»Später, es ist noch etwas zu früh.«
Mehr konnten sie im Augenblick nicht miteinander sprechen, denn jetzt tauchte Kurt Schlüter schon wieder auf. Er führte eine Engländerin höflich am Arm.
*
Kurt Schlüter hatte die am Nachmittag im Flüsterton geführte Unterhaltung zwischen Hella von Walden und ihrem Komplicen Hanko Borek durch ein seltsames Spiel des Zufalls doch Wort für Wort mit anhören können. Er war eben im Begriff gewesen, das Hotelgebäude zu verlassen, um sich zum Schwimmbad zu begeben, als er Hellas Stimme und die von Borek vernommen hatte. Besonders stutzig und hellhörig hatte es ihn gemacht, dass sie einander geduzt hatten. Also war er stehen geblieben und hatte gelauscht. Als er genug gehört hatte, hatte er sich ein wenig entfernt und war dann, absichtlich laut auftretend, zurückgekehrt, sodass sie ihn hatten hören müssen. Kurt Schlüter wusste also, dass Hella es nicht nur auf sein Geld, sondern auch auf sein Leben abgesehen hatte. Doch für ihn brach dadurch nicht gerade eine Welt zusammen, denn er war selbst kaltblütig und hatte sein riesiges Vermögen nicht immer auf anständige Weise erworben. Kleine Geschäftsleute, die in Schulden geraten waren, hatten dran glauben müssen. Einen hatte er sogar in den Tod getrieben, indem er ihm seine kleine Fabrik für einen Schleuderpreis abgejagt hatte, nur weil zwei Wechsel fällig geworden waren.
Nein, Kurt Schlüter war nicht über die Schlechtigkeit der Welt entsetzt, sondern vielmehr entschlossen, es der schönen blonden Hella mit ihren eisblauen Augen heimzuzahlen, und zwar gründlich. Er würde wachsam sein. Besonders dann, wenn sie ihm ein Getränk servierte. Auf der Reise war das einfach. Alles, was er aus den Händen der Kellner erhielt, brauchte er nicht zu fürchten. Aber was Hella ihm brachte, musste er mit Vorsicht genießen – am besten gar nicht. Nun, er würde den Spieß umdrehen und sie zwingen, das Gift selbst zu trinken. Er konnte zwei Gläser vertauschen oder auch offen damit drohen, dass er sie bei der Polizei anzeigen würde. Sie würde dann keine Wahl haben und gezwungen sein, das Gift selbst zu trinken. Auf ihn – Kurt Schlüter – würde niemals ein Verdacht fallen. Das Ganze würde wie eine Verwechslung aussehen, die der Verbrecherin selbst unterlaufen war.
Aber noch war es nicht so weit. Zunächst bereitete es Kurt Schlüter nur ein hämisches Vergnügen, das saubere Pärchen zu beobachten. Doch bereits am anderen Vormittag suchte er den deutschen Rechtsanwalt noch einmal auf und besprach sich eingehend mit ihm. Die Folge davon war, dass er im Beisein des Juristen ein zweites Testament aufsetzte und das erste für ungültig erklärte. Im Stillen dachte er, dass es möglicherweise übertriebene Vorsicht sei. Aber er musste immerhin damit rechnen, dass das Gift nicht tödlich wirkte. Dann wäre Hella immer noch im Besitz des gültigen Testaments gewesen, das ihr runde zwei Millionen sicherte.
Dem Anwalt erklärte Kurt Schlüter nur, ihm sei leider klar geworden, dass er einer Betrügerin aufgesessen sei. Er wolle kein Aufhebens von der Sache machen, wünsche aber, dass das in ihrem Besitz befindliche Testament sofort ungültig werde.
Nun, auch das hatte sich verhältnismäßig einfach verwirklichen lassen. Als Kurt Schlüter das Schriftstück unterzeichnet hatte, dachte er voller Hass: Was mag sie jetzt tun, das kleine Biest? Sie hat Pech gehabt, denn sie ist bei mir genau an den Falschen geraten. Sie selbst wird so sterben, wie sie es mir zugedacht hatte.
Allmählich steigerte sich Kurt Schlüter immer mehr in seine kalte Wut und Entschlossenheit hinein, den Anschlag mit gleicher Münze zu vergelten.
Als er ins Hotel zurückkam, sah er Hella von Walden und Hanko Borek an einem kleinen Tisch im Garten sitzen. Sie hielten sich bei den Händen. Selbst für einen unbefangenen Zuschauer und Beobachter war dies etwas mehr als nur das freundschaftliche Beisammensein von zwei Menschen, die sich zufällig auf der Reise kennengelernt hatten!
Doch Kurt Schlüter folgte seinem ersten Impuls, hinzugehen und beide zur Rede zu stellen, nicht. Erstens hätte das seine geplante Rache vereitelt und zweitens besaß er keinen greifbaren Beweis für die Freundschaft der beiden. Also warf er nur einen letzten verächtlichen Blick auf das Pärchen und holte sich dann am Empfang den Schlüssel zu seiner Suite. Wenig später ließ er sich in einen tiefen Sessel sinken und läutete nach einem Whisky.
»Eiskalt und ohne Soda«, erläuterte er knapp, als der Zimmerkellner erschien.
»Aber es befindet sich gekühlter Whisky in der kleinen Bar«, entgegnete der Kellner und wies auf die Bar, die in unmittelbarer Reichweite vom Sessel Kurt Schlüters stand und zur Standardeinrichtung der Luxusappartements gehörte. Man zahlte zum Schluss, was man von den bereitgestellten Getränken verbraucht hatte. Aber Kurt Schlüter war unsicher geworden. Bestand nicht die Möglichkeit, dass Hella eine der drei oder vier Flaschen bereits präpariert hatte? Deshalb wollte er unter allen Umständen Whisky aus den Hotelbeständen haben.
»Ich möchte Whisky von Ihnen serviert haben, und zwar sofort«, herrschte er den erschrockenen Zimmerkellner an, der es nur gut gemeint hatte. Denn Selbstbedienung aus der Privatbar war billiger als Zimmerservice.
»Sehr wohl, mein Herr«, murmelte der junge Mann und nahm sich vor, die kleine Bar im Zimmer der beiden Deutschen zu überprüfen. Vielleicht fehlte die richtige Whiskysorte. Man sollte als Kellner eben grundsätzlich den Mund halten und tun, was der Gast wünschte. Dann ging man Grobheiten aus dem Weg.
Doch zu seiner Überraschung gab ihm Kurt Schlüter ein gewaltiges Trinkgeld, als er mit dem Whisky auf einem Tablett zurückkehrte. Er hatte Eisstückchen in einer Schale danebengestellt, damit der Gast sich selbst etwas in den Whisky tun konnte, wenn er das wünschte.
»Vielen Dank, Herr Generaldirektor«, dienerte der Kellner und verließ die Suite. Dabei dachte er, dass es wirklich ein Kunststück besonderer Art sei, aus dem klug zu werden, was Gäste dachten und wünschten.
Kurt Schlüter trank nun von seinem unverdünnten Whisky. Es kam ihm dabei vor, als werde es auf einmal glasklar in seinem Hirn. Ich habe immer gewusst, dass sie nur mein Geld will, dachte er. Aber dass sie so weit gehen könnte, mich zu beseitigen, um am Ende nur mein Geld zu besitzen, nein, das hätte ich ihr nicht zugetraut.
Aber noch etwas wurde Kurt Schlüter bewusst: dass er, seit er nur noch an das gierige Zusammenraffen von Geld dachte, keinen einzigen wirklichen Freund mehr besaß. Selbst Alexander von Schoenecker, den er auf dem Abituriententag wiedergesehen hatte, zeigte ihm gegenüber eine gewisse Reserviertheit. Damals, als er in Sophienlust gewesen war, um seinen Jungen abzuliefern, hatte er absichtlich die Augen davor verschlossen, dass das Ehepaar von Schoenecker seine Verhaltensweise nicht billigte. Denise von Schoeneckers Frage, ob er mit seiner Frau verreise, klang ihm so deutlich im Ohr, als sei sie eben erst ausgesprochen worden.
Die Einzige, die immer zu mir halten wollte, war Angela, dachte Kurt Schlüter. Es fiel ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen. Ja, sie hatte nicht aufgehört, ihn zu lieben. Sie hasste obendrein das viele Geld, von dem sie annahm, dass es die Schuld an der Zerrüttung ihrer Ehe trage. So abgrundtief war ihre Abneigung gegen diesen zusammengerafften Reichtum, dass sie auf eine Unterstützung von seiner Seite verzichtete und sich ihren Lebensunterhalt lieber selbst verdiente. Sie mochte von dem bösen Geld nichts annehmen. Keinen Cent wollte sie.
Es ist zu spät, ging es dem reichen, müden Mann durch den Sinn. Gegen ein Flittchen wie Hella von Walden kann ich mich zur Wehr setzen und Hella bestrafen, wie sie es verdient. Aber das, was früher war, kann ich nicht zurückholen. Mit dem vielen Geld, das in mein Haus gekommen ist, ist das Glück hinausgegangen. So ähnlich hat Angela es auch ausgedrückt, als ich sie fortschickte. Warum habe ich sie eigentlich verstoßen?
Kurt Schlüter strich sich über die Stirn, auf der Schweißperlen standen. Seit ich die vielen Geschäfte im Kopf habe, habe ich mir keine Zeit mehr zum Nachdenken genommen, überlegte er weiter. Gesellschaftliches Ansehen und Geld hielt ich für die wichtigsten Dinge im Leben. Jetzt kommt es mir vor, als wäre mir verdammt wenig geblieben. Ich habe keine Zeit gehabt, mir alles richtig zu überlegen. Und Angela hat nur geweint. Sie wehrte sich ja nicht. Wenn sie sich doch wenigstens gewehrt und um unser Glück gekämpft hätte!
Kurt Schlüter schüttelte den Kopf. Nein, nein, er durfte Angela keine Vorwürfe machen. Es hatte zu jenem Zeitpunkt keinen Sinn gehabt, den Kampf mit ihm aufzunehmen. Auf ihre Weise hatte Angela es sogar versucht, indem sie seinem Begehren nach Scheidung ihr Nein entgegengesetzt hatte. Das hatte er ihr übel genommen. Aber ohne ihre Weigerung wäre er heute bereits mit Hella von Walden verheiratet und vielleicht schon – tot. Durch die Ehe wäre Hella automatisch seine Erbin geworden und hätte ihr das Gift besorgt, und sie hätte es ihm mit einem leckeren Paprikagericht oder im Kaffee serviert! Da jedermann wusste, dass er sich in den letzten Jahren überarbeitet und keine Ruhe gegönnt hatte, hätte es dann vielleicht geheißen, Herzinfarkt – wieder einmal die Managerkrankheit!
Kurt Schlüter schüttelte sich ein wenig. Er hatte plötzlich das Gefühl, dass ihn eine kalte Hand berühre. Unwillkürlich blickte er sich um. Aber er war allein im Wohnzimmer seines Luxusappartements, in dem der Duft von Hellas Parfüm hing.
Fast zwei Stunden vergingen so. Dann öffnete sich die Tür.
»Ach, hier bist du, Liebster«, vernahm Kurt Schlüter Hellas Stimme, deren falscher Ton seinen Ohren jetzt weh tat. »Ich habe lang mit dem Essen gewartet und dachte, dass du vielleicht aufgehalten worden bist in der Stadt oder Bekannte getroffen hast. So etwas kann ja mal vorkommen.«
»So? Ist die Essenszeit schon vorbei? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Aber ich habe auch keinen Hunger. Hast du mit Herrn Borek gespeist?«
»N-n-nein. Er saß an seinem Tisch und ich an meinem.«
»Natürlich, du musstest ja damit rechnen, dass ich jeden Augenblick kommen konnte«, warf er spöttisch hin und spürte dabei ihren unsicheren, forschenden Blick. Mochte sie sich ruhig ein wenig das Köpfchen zerbrechen!
»Willst du … willst du dich jetzt nicht schlafen legen wie jeden Tag? Ich möchte mich umziehen und schwimmen gehen.«
»Tu nur, was du vorhast. Ich ruhe mich nachher noch ein bisschen aus. Im Augenblick sitze ich ganz gut hier.«
»Soll ich dir noch einen Whisky einschenken? Herr Borek hat mir eine Flasche Gordon’s besorgt, als ich ihm erzählte, dass du den besonders gern magst. Er ist wirklich sehr aufmerksam.«
»Danke, im Augenblick habe ich genug. Stelle ihn nur dorthin. Dann kann ich die Flasche später aufmachen.«
»Wie du willst. Ich werde den Whisky ins Kühlfach tun, damit er schön kalt ist.«
»Danke. Sehr aufmerksam von dir.«
Spürte sie seinen Spott? Jedenfalls bemerkte er deutlich, dass ihre Hand zitterte, als sie das Barfach mit der elektrischen Kühlung öffnete und die Flasche mit dem Whisky hineintat. So also wird es gemacht, dachte er ergrimmt. Sogar meine Lieblingsmarke, die hier bestimmt schwer zu bekommen ist, haben sie aufgetrieben. Ich muss sagen, die Sache ist wirklich brillant ausgedacht, und sie haben den Vormittag gut ausgenutzt. Ich muss mir nachher die Flasche ansehen. Sie muss ja geöffnet und dann wieder verschlossen worden sein. Aber das ist wohl für einen Halunken wie Borek kein besonderes Kunststück.
Kurt Schüler schaute nicht einmal hin, als Hella sich auszog und in den Bikini schlüpfte. Das schöne blonde Mädchen war ihm vollkommen gleichgültig geworden. Sie jedenfalls würde nicht neben ihm in seiner prunkvollen Villa in Augsburg Gäste empfangen und als Hausfrau repräsentieren! Das war aber im Augenblick das Einzige, worin sich die heimlichen Gedanken der beiden deckten. Nur sah der Weg, der zur endgültigen Trennung führte, von Hellas Seite etwas anders aus als von der seinigen.
Nun, Kurt Schlüter wusste, er hatte den längeren Atem, weil er den teuflischen Plan seiner Geliebten und ihres Komplicen haargenau kannte und nun sogar annehmen konnte, dass sich das tödliche Gift in der Whiskyflasche befand. Wie plump das doch war! Dennoch gestand er sich ein, dass er wahrscheinlich darauf hereingefallen wäre, hätte er nicht das Gespräch der beiden am Swimming-pool belauscht!
Hella ging an ihm vorbei, streifte dabei mit einer scheinbar zärtlichen Bewegung seine Wange und beugte sich nieder, um ihn zu küssen: »Ruh dich nur schön aus, Liebster. Um halb fünf trinken wir wie immer Tee.«
»Danke, Hella.« Kurt Schlüter wendete den Kopf weg, denn er wollte ihren Kuss nicht. Sie war ihm plötzlich widerlich und unsympathisch geworden. Dass eine Frau sich so verstellen konnte? Dass sie monatelang Liebe heucheln und doch nur an sein Geld und obendrein an seine Ermordung denken konnte!
Er atmete befreit auf, als sie hinausgegangen war. Dann nahm er die Flasche aus dem Kühlfach der Bar und betrachtete sie aufmerksam. Wenn etwas hineingetan worden war, dann war es mit größter Geschicklichkeit und Vorsicht geschehen. Der Verschluss wirkte unberührt. Aber es war dieser englische Klappverschluss, der sich verhältnismäßig leicht öffnen und wieder verschließen ließ. Gordon’s eignete sich also offenbar besonders für den raffinierten Plan. Und das Gift?
Kurt Schlüter öffnete die Flasche und roch sehr vorsichtig daran. Nein, es ließ sich nichts feststellen. Geruchlos war das Gift zum mindesten, sofern es tatsächlich in diesem Whisky war. Geschmacklos? Nein, das wollte er lieber nicht ausprobieren, denn er legte keinen Wert darauf, schmerzlos in die Ewigkeit befördert zu werden.
»Heute Abend machen wir die Probe aufs Exempel, Hella«, sagte er leise, ehe er die Kleidung ablegte und sich auf das breite Bett legte. Er schloss die Augen und schlief sofort ein. Die Aufregung hatte ihn ermüdet. Er träumte, dass er mit Hella von Walden und Hanko Borek in einem Wagen fahre, der auf einen Abgrund zuraste. Es war ein beklemmendes, entsetzliches Gefühl, denn die Bremsen versagten. Es gab keine Rettung. Sie mussten alle drei in den Abgrund stürzen.
Schweißgebadet wachte Kurt Schlüter auf, als er zu stürzen glaubte. Die Erleichterung, dass er nur geträumt hatte, war grenzenlos. Dankbar und erschöpft lag er nun ganz still auf seinem Bett. Wieder dachte er an Angela und auch an Bastian. Oh, ich muss dem Kleinen endlich wieder eine Karte schreiben, überlegte er. Er sollte doch alle Städte auf dem Atlas aufsuchen. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich werde ihm schreiben, wo wir schon überall gewesen sind. Dann werden sie es ihm im Kinderheim sicherlich auf der Landkarte zeigen. Später muss er selbst die ganze Welt kennenlernen. Das gehört heute ganz einfach zu einer guten Erziehung.
Kurt Schlüter hatte plötzlich ein seltsames Gefühl in der Brust. Ob Bastian sehr geweint hätte, wenn ich von Hella von Walden vergiftet worden wäre?, fragte er sich. Ein Herzschlag auf der Reise, hätte es wohl geheißen. Der jähe Klimawechsel nach all den Anstrengungen ist ihm nicht bekommen. Wohl niemand hätte einen Verdacht geschöpft. Hella hätte ihr Erbteil kassiert, und Bastian wäre wahrscheinlich zu Angela zurückgekehrt. Sie ist ja seine Mutter, und unsere Ehe ist noch nicht geschieden. Ob Bastian wohl traurig gewesen wäre?
Diese Frage beschäftigte Kurt Schlüter am meisten. Ich selbst habe ihm verboten zu weinen, als Angela fortging, dachte er. Da hat der kleine Bursche sich zusammengerissen und wohl nur heimlich abends im Bett geweint. Nachher, als ich ihm noch verbot, von Angela zu sprechen, wurde er blass und still. Ob er auch meinetwegen weinen und blass werden würde?
Seltsam, dass es ihm plötzlich wichtig erschien, von seinem kleinen Jungen geliebt und entbehrt zu werden, falls ihm ein Unglück zustieße.
Hatte ihn der Whisky vom Mittag dazu gebracht oder der bedrückende Traum, dass er mit Hella von Walden und Hanko Borek im Wagen in einen Abgrund stürzte, dass er mit diesen beiden Verbrechern im gleichen Auto saß?
Kurt Schlüter rührte sich nicht. Er lag und grübelte. Seine Gedanken wanderten zurück in die Zeit, in der er noch ein kleiner Geschäftsmann gewesen war und eine glückliche Ehe geführt hatte.
*
»Von Vati ist die Karte? Lies sie mir vor, Mutti, bitte«, bat Bastian, der nun täglich massiert wurde, damit die leichten Lähmungserscheinungen, unter denen er litt, sich nach und nach besserten.
»Er schreibt, dass sie jetzt in Amman sind. Das liegt in Jordanien. Vorher war er in Ägypten und in Griechenland. Aber du kannst dir sicherlich nicht vorstellen, wo diese Länder sind.«
»Vati sagte, ich soll es mir auf der Landkarte zeigen lassen.«
»Das werden wir tun, wenn du gesund bist, Bastian. Jedenfalls ist Vati sehr, sehr weit weg und weiß gar nicht, dass du krank geworden bist.«
»Komisch, Mutti. Sonst sagte Vati immer, dass er alles wisse. Deshalb hätten die Leute auch Angst vor ihm, wenn sie ihm etwas verheimlichen wollten. Er hat mir erklärt, dass es wichtig ist, über alles Bescheid zu wissen.«
»Ja, trotzdem kann er nicht erfahren, dass du krank bist. Wir haben es ihm nicht mitteilen können, weil er seine Adressen nicht angegeben hat. Außerdem hat er ausdrücklich bestimmt, dass ihm keine Post zugeschickt werden soll.«
»Kennst du diese vielen fremden Länder auch nicht, Mutti?«
Lächelnd schüttelte Angela den Kopf. »Nein, Bastian, ich kenne sie nicht. Aber das schadet nichts. Du wirst wahrscheinlich die ganze Welt sehen, wenn du etwas größer bist.«
»Die neue Mutti auch?«
»Vielleicht, Bastian.«
»Wir brauchen sie wirklich nicht, die neue Mutti. Vielleicht kann ich das Vati sagen. Glaubst du, dass er auf mich hören würde? Er ist meist so streng. Ein Junge darf nicht weinen, darf sich nichts gefallen lassen und so, sagt er. Aber ich … ich mag mir nicht gefallen lassen, dass ich eine neue Mutti kriege. So! Das werde ich ihm sagen.«
»Du solltest dich nicht mit ihm streiten. Er kann böse werden, das weißt du doch.«
»Ich habe keine Angst, Mutti. Es ist so schön, dass du jetzt bei mir bist. Ich will, dass du immer bei mir bleibst. Das sage ich Vati einfach, wenn er wiederkommt.«
»Nun ja, Liebling, vielleicht. Zuerst musst du aber ganz gesund werden, das ist jetzt das Wichtigste. Der Doktor ist schon ganz zufrieden mit dir. Und ich habe glücklicherweise von Professor Fabricius unbegrenzten Urlaub bekommen.«
»Was für ein Professor ist das, Mutti?«
»Er ist ein reizender, alter Herr, für den ich nach seinem Diktat ein Buch geschrieben habe, bis plötzlich die Nachricht kam, dass mein kleiner Junge so krank geworden ist. Da hat der Herr Professor gleich gesagt, dass ich zu dir fahren soll und die Arbeit liegen bleiben kann. Inzwischen haben wir einander schon ein paarmal geschrieben. Er lässt dich sogar jedes Mal grüßen, obwohl er dich gar nicht kennt. Ich kann bei dir bleiben, solange es nötig ist.«
»Hm – hat Tante Isi damals angerufen, als ich krank wurde?«
»Ja, natürlich. Das habe ich dir doch schon erzählt. Aber damals warst du sehr krank und hast es deshalb wohl vergessen.«
»Wenn ich wieder gesund bin, dann musst du zu dem Professor zurück und wieder für ihn auf der Schreibmaschine tippen?« Die kleine Stimme zitterte jetzt weinerlich und ängstlich.
»Schon möglich, Bastian. Aber ich denke, dass das noch lange, lange Zeit hat. Tante Isi meint, dass ich zunächst bei dir in Sophienlust bleiben soll, sobald du aus dem Krankenhaus entlassen wirst.«
Die Kinderaugen strahlten auf. »Mutti, Sophienlust ist der schönste Platz der Welt. Glaubst du, dass ich meinen Wiking aus dem Tierheim holen darf, wenn er nicht mehr seine Wurst wie ein Mensch am Tisch isst und im Bett schlafen soll?«
»Das darfst du bestimmt. Es sind viele Kinder in Sophienlust, die ein Tier haben. Mit Wiking war es nur so schwierig, weil er wie ein Mensch behandelt werden sollte. Das ist Tante Isi ganz einfach auf die Nerven gegangen.«
»Ja, so etwas hat sie mal gesagt. Und ich war ziemlich bockig, weil Vati mir eingeschärft hatte, dass ich mir nichts gefallen lassen dürfe. Wahrscheinlich ist Wiking jetzt traurig, weil ich ihn nicht mehr besuche.«
»Henrik von Schoenecker war bei ihm. Er soll prächtig aussehen und immer mit der schwarzen Dogge Severin spielen. Ich glaube, er ist glücklich im Tierheim. Später holen wir ihn ab.«
»Ja, Mutti. Ich hab’ mich immer ein bisschen vor Wiking gefürchtet, weil er so klug dreinschaute und ganz anders war als sonst ein Hund. Wenn er jetzt wie ein richtiger Hund sein wird, mag ich ihn viel lieber.«
»Tante Isi sagt, er ist jetzt so wie jeder andere Hund auch. Aber vielleicht wird Vati entsetzt sein, weil er so viel Geld für die Dressur im Hunde-Internat ausgegeben hat.«
Bastian lachte ein bisschen. »Tante Isi muss es ihm sagen. Die hat es ja eingebrockt. Was man nämlich eingebrockt hat, muss man selber auslöffeln, sagt Nick.«
Nun musste auch Angela lachen. Der Vergleich passte so ganz und gar nicht zu Denise von Schoenecker. Andererseits musste sie ihrem kleinen Jungen Recht geben. Denise von Schoenecker war sicherlich in ihrer sanften, bestimmten Art die geeignetste Person, um Kurt klarzumachen, dass ein Hund eben ein Hund ist!
»Und jetzt lies mir bitte die Geschichte vom Wolf und den sieben Geißlein vor, Mutti«, bettelte Bastian.
»Hör mal, die habe ich heute schon viermal gelesen.«
»Aber ich mag sie so gut leiden, Mutti.«
Angela Schlüter ergab sich in das Schicksal aller Mütter und las die Geschichte, die sie schon auswendig wusste, zum fünften Male vor. Doch im Grunde genommen war sie glücklich bei dieser Beschäftigung. Für sie war die Zeit ganz einfach stehen geblieben, seit sie die Gewissheit hatte, dass Bastian gesund werden und nach menschlichem Ermessen auch keine Lähmungen zurückbehalten würde. Zuerst hatte sie sich mit den schrecklichsten Vorwürfen geplagt. Immer wieder hatte sie sich die Frage vorgelegt, ob es nicht möglich gewesen wäre, Bastian gegen den Willen seines Vaters vor der schlimmen Krankheit zu schützen. Nun war das Schicksal gnädig gewesen – dank dem sofortigen Eingreifen von Frau Dr. Anja Frey und der ausgezeichneten Pflege im Krankenhaus.
Auch an diesem Tage blieb sie bis zum Abend bei ihrem Sohn. Dann küsste sie ihn zum Abschied und verließ ihn. Diesmal war es Alexander von Schoenecker, der in der Kreisstadt zu tun gehabt hatte und sie um sechs Uhr vor dem Krankenhaus mit seinem Wagen erwartete.
»Sie tun so vieles für uns, Herr von Schoenecker«, sagte Angela, als der Wagen sich in Bewegung setzte. »Ich werde meine Dankesschuld nie abtragen können.«
»Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft sind Selbstverständlichkeiten. Sie haben gesehen, wie groß unser Haus in Schoeneich ist. Es macht wirklich nichts aus, wenn ein paar Wochen lang eine Person mehr dort wohnt. Bastian ist ein Sophienluster Kind, und Sie sind seine Mutter. Bitte, sprechen Sie nicht von Dank. Das bringt uns in Verlegenheit. Besonders meine Frau hört das nicht gern. Sophienlust ist ihr zur Lebensaufgabe und zum Schicksal geworden. Wir freuen uns mit Ihnen, dass es Bastian besser geht, und wir hoffen zuversichtlich, dass sich alle Lähmungserscheinungen beheben lassen werden.«
»Der Arzt ist ganz zuversichtlich, dass nur wenig oder nichts zurückbleiben wird. Bastian ist ein sensibles Kind. Für ihn wäre eine Behinderung eine schwere Belastung. Aber ich darf nicht klagen, denn jedes Mal, wenn die Ärzte mit mir sprechen, spüre ich, dass sie mir die Schuld geben. Bastian war ja nicht geimpft!«
»Was gewesen ist, kann man nicht ändern, liebe gnädige Frau. Ich nehme jedoch an, dass auch Ihr Mann heute anders darüber denken wird.«
Alexander von Schoenecker blickte starr geradeaus auf die Straße. »Darf ich Sie etwas fragen, Herr von Schoenecker?«, bat Angela.
»Natürlich, warum nicht? Aber ich bin nicht sicher, dass ich die richtige Antwort weiß.«
»Ich habe meinem Mann durch einen Anwalt mitteilen lassen, dass ich mich seinem Scheidungsbegehren nicht länger widersetzen will. Ich glaube, es hat keinen Sinn mehr. Kurt erreicht so und so, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Oder hätte ich mich wehren sollen? Aber ich werde nie mehr froh sein können, wenn ich erst ganz und gar von meinem Kind getrennt bin – und … und auch von ihm.«
»Ich kann Ihnen tatsächlich keine Antwort auf Ihre Frage geben. Aber von Ihrer Seite aus scheint Ihre Ehe heilbar zu sein, wenn ich das mal so ausdrücken darf«, erklärte Alexander von Schoenecker behutsam.
»Wenn er mich zurückholte, würde ich kommen und wieder da anfangen, wo wir aufgehört haben. Doch wenn Kurt sein großes Glück mit der anderen Frau gefunden hat, dann mag ich ihm nicht im Wege stehen. Deshalb habe ich mich schließlich einverstanden erklärt. Aber der Junge …«
»Vor einem Scheidungsprozess gibt es einen Sühnetermin. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und sprechen Sie sich gründlich mit Ihrem Mann aus. Sie haben nichts zu verlieren, aber vielleicht etwas zu gewinnen. Das wäre das Einzige, das ich Ihnen raten könnte.«
»Ja, ich will’s versuchen, wenn es soweit ist. Ich werde Kurt sagen, dass ich … dass ich ihn auch heute noch liebe und gern heimkehren würde, sofern er es wollte.«
*
»Trinken wir noch ein Glas. Es war ein netter Abend heute. Herr Borek war richtig lustig. Ich hätte mich vor Lachen kugeln können über ihn.« Der Vorschlag kam von Kurt Schlüter, der mit Hella von Walden eben in seine Hotelsuite zurückgekehrt war.
»Warum nicht? Soll ich dir einen Whisky mit Eis zurechtmachen? Es ist ja alles in der Bar. Wirklich, ein erstklassiges Hotel.«
Hella wählte ein Weilchen und griff dann entschlossen nach der neuen Flasche, die sie selbst mitgebracht hatte.
»Willst du von diesem Whisky?«, fragte sie.
»Wenn du mithältst?«, fragte er lauernd.
»Mir ist eher nach einem Kognak zumute. Sie haben hier ein Fläschchen Hennessy. Das wäre heute nach meinem Geschmack.«
»Du magst doch sonst Whisky so gern.«
»Kein Tag ist wie der andere. Willst du etwa auch lieber Kognak? Aber es wäre nett, wenn du Herrn Borek morgen erzählen könntest, dass der Gin von Gordon’s in Amman genauso schmeckt wie der in London oder Augsburg.«
»Natürlich probiere ich den Whisky. Das ist doch klar.«
Hella machte beide Getränke zurecht. Den Whisky goss sie in ein breites Becherglas, den Kognak in einen Schwenker.
»Voila, mein Herr, wohl bekomm’s!« Mit einem kleinen Knicks reichte sie ihm sein Glas.
»Ich hab’s mir anders überlegt. Wollen wir tauschen? Der Hennessy hat einen verlockenden Duft. Ich möchte lieber Kognak.«
»Aber ich sagte dir doch, dass ich heute keinen Whisky mag.«
Kurt Schlüter sah Hella ernst an. »Und wenn ich es von dir verlangen würde, Hella? Wenn ich zum Beispiel einen Preis von hunderttausend aussetzte – bloß so, aus Spaß und weil es eine Laune von mir ist? Würdest du den Whisky dann trinken? Du bist doch so an Geld interessiert.«
Unwillkürlich wich Hella einen Schritt zurück.
»Mir … mir ist heute nicht nach Whisky zumute, Kurt. Was soll der Unsinn überhaupt?«
»Ich will nur mal wissen, ob du es tatsächlich fertigbringst, mir das Zeug zu geben. Du würdest es nicht einmal für zehn Millionen trinken, nicht wahr, Hella?«
Sie warf den Kopf zurück, dass ihr helles Haar flog. »Nein, heute Abend nicht, Kurt. Du kannst mich doch nicht zwingen, Whisky zu trinken, wenn ich Kognak haben will. Bist du eigentlich betrunken?«
»Nein, mein Kind, ich bin sehr, sehr nüchtern. Ich weiß nämlich, dass diese Flasche Whisky vergiftet ist.«
Hella schwankte, aber sie fasste sich rasch wieder.
»Du bist wahnsinnig«, flüsterte sie.
»Ich bin normal und stocknüchtern, Hella. Zufällig habe ich euer Gespräch belauscht. Man könnte wieder anfangen, an den Schutzengel zu glauben. Du brauchst mir jetzt keine Märchen aufzutischen, ich weiß alles. Erst das Testament und dann etwas in den Kaffee oder in den Gin geschüttet! Geruchlos, geschmacklos – und schmerzlos geht’s ab ins Jenseits mit dem Störenfried, der sein Geld ganz gern noch ein paar Jahre selbst behalten wollte und so dumm war, zu glauben, dass die schöne blonde Hella von Walden seine Frau werden wollte.«
Hella hob die Hände. »Kurt, was redest du nur? Kein Wort davon ist wahr.«
»Wie erklärst du mir dann, dass du dich mit Herrn Borek duzt und er dich Schätzchen und Liebling nennt, wenn ihr allein seid? Heute sah ich euch sitzen und Händchen halten. Du kannst mir nichts mehr vormachen, Hella. Dein Spiel ist aus! Weißt du, warum ich heute morgen in der Stadt war?«
Sie sagte nichts, sondern starrte ihn nur an. Er konnte deutlich sehen, dass sie zitterte.
»Ich will dich nicht lange auf die Folter spannen, Hella. Ich habe mein Testament, das zu deinen Gunsten lautete, widerrufen. Selbst wenn du jetzt mit deinem Mordanschlag Erfolg gehabt hättest, wäre es nutzlos gewesen. Kein Cent wäre dir zugefallen, sondern alles meinem Sohn.«
»Aber ich … ich habe das Testament«, stammelte sie hilflos.
»Ja, das Papier, das ich gestern aufgesetzt habe. Aber das heutige Testament ist das gültige. Übrigens hast du dich mit diesem einen Satz verraten und schuldig erklärt. Wenn ich jetzt die Flasche zur Polizei bringe, werdet ihr beide den Rest eures Lebens im Gefängnis verbringen, fürchte ich.«
»Er war es, Kurt. Ich schwöre dir, ich habe es erst gestern erfahren …«
»Stimmt, denn ich habe zugehört, wie er dich fragte, ob du es tun willst. Aber du hast nicht lange gezögert. Außerdem hast du nie die Absicht gehabt, wirklich meine Frau zu werden. Wahrscheinlich hat er dir immer vorgeredet, dass sich dann schon ein Ausweg finden würde. Wenn du aber ein bisschen nachgedacht hättest, müsste dir klar geworden sein, dass es nur die eine Möglichkeit gab, mich aus dem Weg zu räumen. Es steht fest, du hattest es auf mein Geld und auf mein Leben abgesehen.«
Hella von Walden wollte nach der Whiskyflasche greifen, doch Kurt Schlüter war schneller. »Nein, nein, das ist ein Beweisstück, mein Herz. So einfach kommst du mir nicht davon. Du sollst nicht behaupten können, ich hätte mir das alles nur eingebildet! Ich werde das Zeug morgen in einer Apotheke oder in einem chemischen Institut analysieren lassen. Ich nehme an, dass das sogar in Amman möglich sein wird.«
»Willst du … willst du uns wirklich anzeigen?« Hella brach endgültig zusammen. Sie sank auf einen Stuhl und schlug die Hände vors Gesicht. »Bitte, Kurt, lass mich dir erklären …«
»Du brauchst mir nichts zu erklären, Hella. Ich weiß, wie weit man von der Geldgier getrieben werden kann. Ich war ähnlich in meiner Sucht, immer reicher zu werden und immer mehr Einfluss zu gewinnen. Auch ich habe so etwas Ähnliches getan, wie du es jetzt vorhattest. Nein, nein, es war kein Mord. Aber der Mann, dem ich die Fabrik für viel zu wenig Geld abjagte, hat sich vor Verzweiflung das Leben genommen. Also, sag endlich einmal die Wahrheit – ein einziges Mal.«
Hella schwieg. Doch sie atmete heftig.
»Ja oder nein, Hella. Wolltet ihr mich vergiften? Bist du deshalb so eifrig hinter meinem Testament hergewesen?«
Ihr Kopf sank noch tiefer auf ihre Brust. »Ja.« Dieses schreckliche Eingeständnis ihrer Schuld kam so leise wie ein Windhauch.
Kurt Schlüter antwortete nicht. Er stand auf und leerte zunächst das Glas und dann die Flasche in das kleine Spülbecken, das zur Zimmerbar gehörte. Dann drehte er den Wasserhahn auf und spülte zuerst die Flasche, dann das Glas und zuletzt das Becken gründlich aus.
»So, jetzt ist jede Spur und jede Gefahr beseitigt, Hella. Geh nun schlafen. Ich werde hier im Wohnzimmer auf der Couch übernachten. Morgen früh packt ihr eure Koffer. Ich will weder dich noch Borek jemals in meinem Leben wiedersehen. Ist das klar?«
Hella von Walden nickte nur. Sprechen konnte sie nicht. Sie wusste, ihr Traum vom großen Reichtum war vorbei.
Unausgekleidet warf er sich auf die breite Couch im Wohnzimmer der eleganten Hotelsuite. Er fühlte sich plötzlich müde. Zugleich überkamen ihn gewisse Bedenken, ob es richtig gewesen war, alles für mehr als drei Monate hinter sich zu lassen. Konnte er seinem Stellvertreter vielleicht ebenso wenig trauen wie Hella von Walden?, fragte er sich.
Aber so schrecklich wichtig erschienen ihm jetzt sein Geld und seine Betriebe nicht mehr. Er wollte nur heimkehren und machte sich dabei nichts vor. Nicht die Geschäfte waren es, die ihn heimtrieben, sondern die Sehnsucht nach Bastian!
Allmählich wurde Kurt Schlüter klar, dass er vieles falsch gemacht hatte in seinem Leben. Und immer wieder fiel ihm der Mann ein, der nach dem Verlust seiner Fabrik Selbstmord begangen hatte.
Ich werde mich nach der Familie erkundigen, überlegte er. Ich werde nicht ärmer, wenn ich meine Schuld eingestehe und der Witwe und den Kindern das zukommen lasse, was ihnen von Rechts wegen zusteht. Mein Prokurist mag das errechnen. Damit kann ich der Familie natürlich den Vater nicht zurückgeben. Aber sie wird wenigstens keine Not mehr leiden. Vielleicht war der Mann ohnehin depressiv veranlagt. Er befand sich ja auch ohne den Verkauf, das nur das Tüpfelchen auf dem i war, in einer verzweifelten Lage. Und daran traf mich keine Schuld. Er hatte tatsächlich schlecht gewirtschaftet. Aber ich habe seine Notlage ausgenutzt. Das werde ich, so weit es jetzt noch in meiner Macht steht, gutmachen.
Und Angela? Es war, als hätte jemand im Zimmer laut diese Frage ausgesprochen.
Angela, dachte Kurt Schlüter, ja, auch ihr gegenüber habe ich mich ins Unrecht gesetzt. Vielleicht verzeiht sie mir. Sie war immer sanft und freundlich.
Als es hell wurde, stand Kurt Schlüter auf. Er ging ins Bad, duschte und öffnete dann die Tür zum Schlafzimmer. Hella schlief nicht. Aus ihren eisblauen Augen sah sie ihn angstvoll an.
»Was willst du?«, fragte sie.
»Meine Sachen holen, meine Koffer packen und nach Deutschland zurückfliegen. Was du tust, interessiert mich nicht. Hier ist dein Flugticket. Ich schenke es dir.«
Er warf ihr das gelbe Heft, in dem noch viele unbenutzte Scheine waren, hin. »Und hier hast du etwas Geld, damit du nach Hause kommst. Ich will nicht, dass du hier auf der Straße landest. Aber ich rate dir, in Zukunft einer geregelten Arbeit nachzugehen. Dein Hanko Borek wird es niemals zu etwas bringen, weil er nicht arbeiten will. Er wird das Interesse an dir sofort verlieren, wenn du ihm kein Geld mehr einzubringen versprichst. Trenne dich von diesem Verbrecher und versuche, ein neues Leben anzufangen. Ich glaube, dazu ist es nie zu spät.«
Eilig raffte er seine Sachen aus den Schränken und stopfte sie achtlos in seine beiden Koffer.
»Leb wohl, Hella. Die Hotelrechnung bezahle ich bis einschließlich morgen. So hast du noch einen Tag zum Nachdenken. Es ist das Letzte, was ich für dich tue.«
»Danke, Kurt«, flüsterte sie, und dann, kaum vernehmbar: »Verzeih mir, bitte.«
Kurt Schlüter bekam noch einen Platz in der Abendmaschine. Er fühlte sich wie befreit, als er in der Kabine saß und den Sicherheitsgurt anlegen konnte. Dann hob der silberne Luftriese ab.
*
»Hier ist die Post, Herr Generaldirektor«, sagte die Haushälterin, die sich ihr Erstaunen über die unerwartete Rückkehr des Hausherrn nicht hatte anmerken lassen. Das Haus war in Ordnung. Sie hatte ihre Pflichten tadellos wahrgenommen. Henry hatte gerade im Garten umgegraben und stramm gegrüßt, als das Taxi gekommen war und er seinen Chef erkannt hatte.
»Ja, danke«, sagte Kurt Schlüter zu seiner Wirtschafterin. »Bringen Sie mir einen starken Kaffee, dann lese ich die Briefe. Ins Werk gehe ich erst morgen oder übermorgen. Man erwartet mich ja dort nicht. Ist irgendetwas Besonderes vorgefallen?«
Die Wirtschafterin schluckte einmal. »Doch, Herr Generaldirektor. Aus dem Kinderheim Sophienlust wurde angerufen. Bastian ist sehr krank geworden. Er hat Kinderlähmung.«
Entsetzt sprang Kurt Schlüter aus seinem Schreibtischsessel auf. »Mein Gott, er war nicht geimpft. Wie geht es ihm? Wissen Sie Näheres? Wann war das?«
Nun kam auch Henry nach kurzem Anklopfen herein. Er hatte sich zuerst die von der Gartenarbeit schmutzig gewordenen Hände gewaschen. Er und die Haushälterin berichteten dem Generaldirektor alles, was sie über den Hergang von Bastians Krankheit wussten.
»So, Sie haben also meine Frau zu Bastian gebracht. Das war gut. Aber wie es ihm jetzt geht, kann mir keiner sagen?«
»Die gnädige Frau hat letzte Woche eine Karte geschrieben«, erwiderte Henry. »Die Gefahr ist vorüber. Der Junge muss nicht mehr beatmet werden. Einige Lähmungserscheinungen scheinen zurückgeblieben zu sein.«
Kurt Schlüter fuhr sich mit der Hand über die Stirn, auf der kalter Schweiß perlte. »Ich war immer dagegen, dass er geimpft wurde. Wenn er jetzt für sein Leben gelähmt bleibt, ist es meine Schuld. Dass ich keine Ahnung hatte!« Er stöhnte leise.
Danach blätterte Kurt Schlüter ohne Interesse den Stoß privater Post auf seinem Schreibtisch durch. Da entdeckte er den Brief von Rechtsanwalt Dr. Immerling, Heidelberg. Es war ihm sofort klar, dass dies eine Nachricht von Angela sein musste. Ungeduldig und mit zitternden Fingern riss er den Umschlag auf. Nein, Angela widersetzte sich der Scheidung nicht mehr! Und gerade jetzt hätte er viel darum gegeben, wenn dieser Brief anders gelautet hätte.
Die Wirtschafterin kam mit dem Kaffee.
»Danke«, sagte er abwesend. »Ich werde gleich nach Sophienlust fahren. Henry soll mir einen Koffer für drei bis vier Tage herrichten. In einer halben Stunde.«
»Jawohl, Herr Generaldirektor.« Fragen wurden in diesem Haus vom Personal nicht gestellt. Aber die Wirtschafterin war erleichtert, dass Kurt Schlüter das einzig Richtige tat, und sofort zu seinem Sohn fuhr.
»Soll Henry Sie fahren?«
»Ja, das kann er tun. Ich bin müde von dem langen Flug. Er soll für sich selbst auch einen Koffer mitnehmen, denn es kann sein, dass wir ein paar Tage wegbleiben.«
Da die Anweisungen des Generaldirektors grundsätzlich sofort befolgt wurden, fuhr der Rolls-Royce nach genau dreißig Minuten vor dem Portal der Villa vor.
»Ich bin über Sophienlust zu erreichen, aber nur in privaten, wichtigen Angelegenheiten«, ordnete Kurt Schlüter bei der Abfahrt an. »Im Werk braucht wirklich niemand zu wissen, dass ich schon wieder in Deutschland bin.«
»Jawohl, Herr Generaldirektor.« Die Frau in ihrer adretten weißen Schürze knickste. Dann fuhr der schwere englische Wagen an.
»Sophienlust. Sie kennen ja den Weg, Henry.«
»Sehr wohl, Herr Generaldirektor.«
Es war heller Nachmittag, als sie in Sophienlust ankamen. Henrik, Pünktchen, Angelika und Vicky sowie ein paar andere Kinder, die zufällig draußen spielten, entdeckten den schwarzen Wagen, der vor einigen Wochen so großen Eindruck auf sie gemacht hatte, als erste.
»Heh, das ist doch Bastians Vater mit seinem Rolls-Royce«, stellte Henrik respektlos fest. Dann aber ging er artig auf den Wagen zu und sagte. »Guten Tag, Herr Schlüter.«
Kurt Schlüter stieg aus und reichte dem Jungen die Hand. Dann begrüßte er reihum die anderen Kinder. »Kann ich bitte Frau von Schoenecker sprechen? Wisst ihr, wie es Bastian geht?«, stieß er schließlich hervor und wirkte gar nicht mehr so steif und aufgeblasen wie bei seinem ersten Besuch.
»Meine Mutti ist bei Frau Rennert. Sie sind entweder in der Speisekammer oder im Büro. Ich will gern nachsehen. Kommen Sie doch mit ins Haus, Herr Schlüter«, erklärte Henrik höflich und gewandt. »Bastian geht es schon viel besser, aber er muss noch eine Weile im Krankenhaus bleiben. Seine Mutti ist bei ihm – von früh bis abends, jeden Tag. Nur in der Nacht schläft sie drüben bei uns in Schoeneich.«
»So, dann führe mich mal zu deiner Mutti, mein Junge«, bat Kurt Schlüter.
Kurt Schlüter und Henrik begegneten Denise in der großen Halle. Diese erkannte den Besucher sofort.
»Herr Schlüter! Sind Sie bereits von Ihrer Reise zurück? Das ist gut. Bastian wird sich bestimmt freuen, Sie zu sehen. Oder waren Sie schon bei ihm?«
Kurt Schlüter verbeugte sich tief. »Nein, ich bin gleich hierhergekommen, um zuerst mit Ihnen zu sprechen, gnädige Frau.«
»Soll ich eine Erfrischung bringen lassen?«, bot Frau Rennert an.
»Ja, bitte. Wir nehmen einen Tee und ein paar belegte Brote. Es ist Ihnen doch recht, Herr Schlüter? Ich nehme an, Sie wollen sich nicht lange aufhalten, sondern möglichst rasch nach Maibach ins Krankenhaus.«
»Sie sind sehr liebenswürdig. Natürlich habe ich das Verlangen, meinen Sohn zu sehen. Zunächst aber möchte ich von Ihnen hören, wie es ihm geht.«
Denise führte den Besucher in den Biedermeiersalon und informierte ihn dort über den Ablauf von Bastians Erkrankung.
Etwa eine Dreiviertelstunde später verließ Kurt Schlüter das alte Herrenhaus wieder. Henry, der sich inzwischen mit den Kindern unterhalten hatte und sogar ein paar Ehrenrunden mit ihnen im Rolls-Royce gefahren war, riss den Schlag auf.
»Nach Maibach zum Krankenhaus. Sie kennen ja den Weg, Henry.«
»Jawohl, Herr Generaldirektor.«
Kurt Schlüter drehte sich um und winkte den Kindern zu, die ihn ganz verdutzt ansahen und dann zurückwinkten.
»Viele Grüße an Bastian«, tönte es hinter ihm her.
»Was ich noch sagen wollte, Henry«, erklärte Kurt Schlüter, als das Herrenhaus nicht mehr zu sehen war, »nennen Sie mich doch bitte nicht immer Generaldirektor. Das klingt so bombastisch. Ich heiße Schlüter.«
»Jawohl, Herr Ge… Herr Schlüter.« Um Henrys Mund spielte nun ein Lächeln.
Zwanzig Minuten später klopfte Kurt Schlüter an Bastians Zimmertür im Krankenhaus. Angela saß neben dem Bett ihres Jungen und las ihm wieder das Märchen vom Wolf und den sieben jungen Geißlein vor.
»Aber das kleinste hatte sich im Uhrkasten versteckt …«
»Mutti, da kommt Vati!«, unterbrach Bastian sie.
Angela ließ das Buch sinken. Sie wurde vor Schreck so weiß wie Bastians Bettdecke.
Langsam kam Kurt Schlüter näher. »Angela, wie geht es ihm?«, fragte er heiser statt jeder Begrüßung.
»Schon viel besser, Vati. Nächste Woche darf ich anfangen mit Laufen und Turnen. Bis jetzt haben sie mich massiert. Der Doktor sagt, wenn ich mich tüchtig anstrenge, dann schaffe ich es und werde wieder ganz gesund.«
Bastian bekam heiße Wangen bei dieser Erklärung. So fiel es zunächst gar nicht auf, dass Angela noch kein Wort gesprochen hatte.
»Du, Vati, mein Wiking ist im Tierheim Waldi & Co.«, fuhr Bastian fort. »Aber er isst jetzt nicht mehr mit den Menschen am Tisch, sondern ist ein richtiger lustiger Hund wie die schwarze Dogge Severin von Tante Andrea. Bist du böse deswegen?«
»Nein, ich bin nicht böse, mein kleiner Junge. Ich kenne zwar Tante Andrea nicht, und weiß auch nicht, was das Tierheim Waldi & Co. ist. Aber das wirst du mir bestimmt noch alles erklären.«
Bastian war selig. »Fein, dass du nicht schimpfst, Vati. Ich bin nämlich sehr krank gewesen. Ganz lange. Aber Mutti ist gleich gekommen und hat immer bei mir gesessen. Du konntest es ja nicht wissen, weil du auf der großen Reise warst.«
»Nein, Bastian. Ich konnte es nicht wissen. Aber als ich heute nach Hause kam, bin ich gleich losgefahren, weil ich dich sehen wollte. Hast du Schmerzen gehabt? Geht es dir wirklich schon besser?«
»Ich hatte Kopfweh. Nachher konnte ich mich nicht mehr bewegen. Aber nun wird es bald gut werden, sagt der Onkel Doktor. Du, Vati, ich muss dir noch etwas sagen. Aber du darfst nicht böse werden.«
»Warum sollte ich böse werden? Ich freue mich doch, dass ich dich endlich wiedersehen kann.«
»Es … es ist wegen der neuen Mutti.«
Angela hob die Hand. »Nicht, Bastian, davon wollen wir jetzt nicht sprechen«, warf sie erschrocken ein.
»Doch, er soll sagen, was er will«, widersprach Kurt. Er sah dabei auf Angela, die noch immer regungslos auf dem Stuhl saß und das Märchenbuch auf den Knien hielt. Wie schön sie aussieht, dachte er. Dass ich das früher nicht sehen wollte!
»Also, was ist mit der neuen Mutti?«, ermunterte er seinen Sohn.
Bastian nahm all seinen Mut zusammen und erklärte mit fester Stimme: »Ich will sie nicht haben, Vati. Man braucht bloß eine Mutti. Und die haben wir doch. Mutti hat mich auch gar nicht vergessen. Das stimmt überhaupt nicht.«
Atemlos brach er ab. Nun bekam er es doch mit der Angst zu tun, dass er zu viel gesagt haben könnte. Doch sein Vater legte die Hand auf seinen blonden Kopf und entgegnete: »Recht hast du, Bastian. Ich habe die Frau, die beinahe deine zweite Mutti geworden wäre, fortgeschickt. Wir wollen jetzt beide Mutti fragen, ob sie mit uns nach Hause zurückkommt, sobald du wieder gesund bist.«
Das Märchenbuch fiel plötzlich zu Boden.
»Aber ich hatte dir einen Brief schreiben lassen – vom Anwalt«, stammelte Angela.
»Ist das so wichtig, Angela? Wenn du mir nur verzeihen kannst.«
Mit großen Augen schaute Bastian zu, wie sein Vati seine Mutti an den Händen in die Höhe zog und dann fest, ganz fest in die Arme schloss.
»Dann habt ihr euch also doch lieb«, erklang seine helle Kinderstimme neben den beiden.
»Ja, Bastian, wir haben uns lieb«, antwortete Kurt Schlüter. »Ich hatte es nur eine Zeit lang vergessen.«
»Und wenn ich gesund bin, dann fahren wir alle zurück nach Augsburg und nehmen Wiking wieder mit. Nicht wahr, Vati?«
»Ja, Bastian.«
Angela Schlüter legte den Kopf an ihres Mannes Brust. »Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben, Kurt«, flüsterte sie. »Ich wollte dir nur den Weg freigeben in ein neues Glück.«
»Es wäre ein Unglück geworden. Glücklicherweise hat das Schicksal mir im rechten Augenblick gezeigt, dass ich alles falsch gemacht hatte. Wir werden neu anfangen, und es wird so sein, wie es früher einmal war. Weißt du, was Frau von Schoenecker vorhin zu mir sagte?«
»Nein. Wie sollte ich das wissen? Sie ist eine gütige, kluge Frau. Sicher war es auch ein gutes Wort.«
»Ja, sie sagte: ›Wir leben, um zu lieben! Sagen Sie Ihrer Frau, dass Sie sie lieben – und alles wird sich wenden.‹«
»Ja, Kurt. Jetzt hat es sich gewendet. Das Glück kommt zu uns zurück. Denn wir leben, um zu lieben.«
– E N D E –