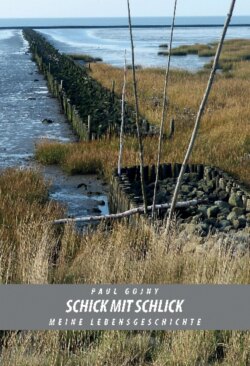Читать книгу Schick mit Schlick - Meine Lebensgeschichte - Buch II - Paul Gojny - Страница 5
Kapitel 1 - Die Kurbetriebe
ОглавлениеAufbau meiner Firmen
Am 1. Januar 1970 begann ich mit meiner Ausbildung zum Physiotherapeuten. Die Ausbildung begann mit einem dreimonatigen Pflegepraktikum in unserem Stadtkrankenhaus Cuxhaven. Eingeteilt wurde ich auf die Station 5.
Die ersten Tage waren für mich nicht so ganz einfach. Als Marineflieger, Flugingenieur und Hauptbootsmann mit immerhin schon 30 Jahren wieder ganz von vorne und ganz, ganz unten anzufangen, das war zugegebenermaßen auch für mich nicht ganz einfach. Dieses Praktikum bestand ja nicht nur aus Pillen verteilen und der Essensausgabe oder anderen ähnlichen angenehmen Aufgaben. Nein, es gehörte natürlich auch das Schleppen und Säubern der „Pfannen und Urinflaschen“ dazu. Aber was soll‘s, sagte ich mir. Du hast ein Ziel vor Augen, und diese Aufgaben gehören eben zur Erreichung dieses Zieles dazu.
Nach ein paar Tagen hatte ich mich an den Krankenhausbetrieb gewöhnt und verschiedene Dinge fingen an mir sogar Spaß zu machen. Mit den Arbeitskollegen auf der Station, mir fallen da die Namen Heinrich Reisen und Paul Strecker als Krankenpfleger und die Schwestern Johanna und Hildegard ein, verstand ich mich in kürzester Zeit sehr gut. Auch bei den Patienten kam ich sehr gut an. Für so manch einen Gefallen, den ich ihnen erwies, nannten sie mich dann „Bruder Paul“. Ein Zeichen, dass sie mich mochten und meine freundliche, gefällige Art zu schätzen wussten. Auch darauf war ich damals stolz.
Privat musste ich nun natürlich einiges umstellen. Jutta überraschte mich eines Abends, als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, mit einer riesengroßen Überraschung.
„Du, Paule, obwohl ich mir vorstellen kann, dass dir das, was ich dir jetzt sagen werde, gar nicht gefallen wird, ich bin schwanger, wir werden dann bald zu fünft sein. Ich weiß das schon seit ein paar Wochen, aber ich wollte dich im Moment, wo du so viele andere Dinge im Kopf hast, nicht auch noch damit belasten.“
Natürlich war ich im Moment perplex. Aber wirklich nur einen kleinen Augenblick, dann hatte ich mich schon wieder völlig im Griff. Ich nahm sofort mein Juttalein in den Arm und sagte ihr: „Mein Schatz, das ist doch klasse. Haben wir uns nicht immer drei Kinder gewünscht? Nun werden wir sie bald haben. Nun gut, der Zeitpunkt ist nicht gerade ideal, aber wir beide haben doch schon so viel, auch unter schwierigen Umständen, geschafft. Dann schaffen wir das auch noch.“
Dann drückte ich sie ganz fest an mich. Später erzählte sie mir noch, dass sie in der achten Woche wäre, dass mit dem Kind alles in Ordnung sei und dass es mit größter Wahrscheinlichkeit ein Junge werden würde.
Mein Freund Gustav Wittkowski hatte mir, nachdem er erfahren hatte, dass Willi und ich das Grundstück von der OFD bekommen hatten, sofort zugesagt, mir für mein neues Bauvorhaben die Baupläne zu erstellen. Natürlich fertigte er auch für meinen alten Kameraden und Freund Willi die Baupläne für sein Einfamilienhaus. Die Pläne wurden dann noch im Dezember 1969 zur Baugenehmigung eingereicht. Gustav Wittkowski war zu dieser Zeit schon pensioniert, so dass er nun viel mehr Zeit hatte, sich um alles, was mit den Bauvorhaben zusammenhing, zu kümmern, was er auch sehr gerne tat. So bekamen Willi und ich schon im Februar 1970 die Baugenehmigungen. Das hieß, wir konnten nun auch mit unseren Bauten beginnen.
Das Grundstück war von der Bundesvermögensstelle geteilt worden. Wir hatten uns so geeinigt, dass der Willi, von der (damals noch) Berliner Straße aus gesehen, die linke und ich die rechte Hälfte bekam. Deshalb war mein Baugrund, weil es ein Eckgrundstück war, von beiden Straßen erreichbar, das heißt, von der Berliner Straße, an der es lag, als auch von der damaligen B6, also der Hauptstraße, was für einen solchen Gewerbebetrieb wegen der Parkplätze besonders günstig war.
Noch im März fingen Willi und ich gemeinsam mit der Herrichtung unserer Bauplätze an. Im Krankenhaus hatte ich mich in die Frühschicht versetzen lassen. Deshalb musste ich zwar schon sehr früh anfangen, hatte dann aber den ganzen Nachmittag frei. Den verbrachte ich dann auf meiner neuen Baustelle, um zu arbeiten. Da wir uns gegenseitig halfen, schafften wir auch sehr viel. Die Grundstücke waren noch bewaldet, deshalb mussten wir mit den Holzfällerarbeiten anfangen.
Ende Februar hatte ich bereits die Fundamente für den nicht unterkellerten Teil des Gebäudes angelegt. Mitte März hatte ich schon alleine den kleinen Keller hochgemauert. Da Willi mir alle Ecken anlegte, er war ja wirklich ein sehr guter und schneller Maurer, ging diesmal alles ganz flott. Willi bekam dafür von mir für seinen Bau Wasser und Strom, den ich von meinem Haus zu unseren Baustellen provisorisch verlegt hatte.
Noch bevor ich mein Praktikum im Stadtkrankenhaus beendet hatte und bevor ich im Annastift in Hannover mit der Fachschule zum Physiotherapeuten begann, hatte mir, wie damals auch, die Firma Kaden die Kellerdecke in meinen Neubau eingezogen. Willis Bau lief beinahe parallel dazu. Auch er war mit dem Keller fertig. Im Übrigen hatten Willi und ich während unserer gemeinsamen Bauzeit auch sehr viel Spaß miteinander. Wir hatten zum Beispiel nur einen gemeinsamen Mischplatz mit nur einem Wasser- und Stromanschluss. Auf diesem stand meine alte, von Gustav geerbte Mischmaschine. Obwohl wir uns sehr bemühten, kam es immer wieder dazu, dass beide die Mischmaschine gleichzeitig benutzen wollten. Durch Hochwerfen einer Münze stellten wir dann den Erstbenutzer fest.
Unsere Pausenbude waren im Grunde genommen zwei etwa 1½ Meter voneinander entfernt stehende Lerchen, zwischen die wir in Sitzhöhe ein Stück Baubohle genagelt hatten. Das Besondere daran war, dass zwischen den beiden Bäumen unsere gemeinsame Grundstücksgrenze verlief, aber so, dass auf meiner Seite etwas mehr Platz zum Sitzen war. Fast jedes Mal, wenn wir uns dann dort zu einer gemeinsamen Arbeitspause niederließen, kam es dann immer von Seiten Willis zu einer üblen Grenzverletzung, und ich musste ihn dann wieder auf sein Grundstück zurückdrängen. Das ging aber meistens nur mit lautem Geschrei und Gelächter vonstatten. Einmal war der diesbezügliche Lärm so groß, dass unser Nachbar Gustav Wittkowski ganz aufgeregt zu uns herüberkam, weil er glaubte, wir hätten uns ernsthaft in die Haare bekommen. Als er dann mitbekam, dass wir wegen der „Grenzverletzung“ nur herumgealbert hatten, setzte er sich zwischen uns und wir tranken ein Nachbarschafts-Bier.
Auch nahmen wir beide es nicht ganz so tragisch und ernst, wenn einem von uns beiden mal der Zement oder der Mauersand ausging. Da wurde einfach, nach einem vorsichtigen Blick auf die Nachbarbaustelle, schnell mal mit der Schaufel in die Zementtüte des Nachbarn gefahren und man konnte weiterarbeiten. Da das aber beide Bauherren taten, glich sich das immer wieder aus und wurde nie ein ernsthafter Anlass zum Streit.
Der März 1970 ging dann auch sehr schnell zu Ende. Damit endete auch mein Praktikum im Stadtkrankenhaus Cuxhaven. Mir war natürlich bewusst, was für ein hohes Risiko ich damals einging. Nur wenn von nun an alles ohne irgendeine Verzögerung klappen würde, würde mein Plan aufgehen. Feststand, dass ich am 30.06.1971 aus der Bundeswehr entlassen werden würde. Ab dem Zeitpunkt wäre ich ohne Einkommen. Die Abfindung, auch Übergangsbeihilfe genannt, nach 12jähriger Dienstzeit wollte ich mir ja zur Finanzierung meines Unternehmens auszahlen lassen. Also musste mein Unternehmen, das „Altenwalder Kurbad“ (mit Therapie und Sauna) heißen sollte, am 01.07.1971 betriebsfertig sein. Nicht nur das, es musste von Anfang an laufen und Geld abwerfen, so dass meine dann fünfköpfige Familie davon leben konnte. Dass ich die Fachschule nicht bestehen könnte, daran wollte und durfte ich gar nicht denken.
Mit der Fachschule begann ich am 01.04.1970. Wir waren zu Beginn dreizehn Schüler. Mein bester Freund und Kumpel, mit dem ich mir ein möbliertes Zimmer teilte, war Egon Mentrup aus Georgsmarienhütte. Ein ganz feiner Kerl. Er war wie ich Zeitsoldat (Z12) gewesen. Er war Sanitäter beim Heer und sein letzter Dienstgrad war Stabsunteroffizier. Wir verstanden uns von Anfang an sehr gut. Nur, er war kein Schnelldenker und hatte doch merkliche Probleme beim Auswendiglernen der Lehrstoffe. Nach genau drei Monaten hatten wir eine Zwischenprüfung, die zwei unserer Schulkameraden nicht bestanden. Egon wäre um ein Haar auch dieser Prüfung zum Opfer gefallen, und zwar in Anatomie. Ein typisches Merkfach.
Zu Beginn unseres Lehrgangs musste ein Schul- oder Klassensprecher gewählt werden. Meine Klassenkameraden, übrigens waren es nach der Zwischenprüfung noch fünf Frauen und sechs Männer, hatten mich zu ihrem Klassensprecher gewählt. Als ich mitbekam, dass man meinen guten Freund und Zimmerkumpel auch durchfallen lassen wollte, bat ich die Schulleiter, Professor Hauberg und Herrn Dr. Klümper, um einen Termin. Bei diesem Termin legte ich als Schulsprecher mein Veto gegen den Rauswurf von Egon ein. Die Schulleitung zeigte sich in diesem Fall einsichtig. Sie gaben Egon noch eine Chance. Ich musste mich aber verpflichten, Egon zukünftig zu helfen, besonders in den Fächern Anatomie und Physiologie, was ich gerne tat, weil es ja auch für mich selbst immer einen guten zusätzlichen Lerneffekt dabei gab.
Die Ausbildung zum Physiotherapeuten machte mir sehr viel Freude. Dementsprechend gab ich mir auch Mühe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dort jemals einen Test schrieb, der schlechter als mit einer Zwei benotet wurde. Als Belohnung der Schulleitung für meine guten Leistungen durfte ich bei zwei schweren und großen Operationen, die Professor Hauberg und sein Oberarzt Dr. Klümper durchführten, zusehen. Dabei war ich zwar durch eine große Glasscheibe vom eigentlichen OP-Saal getrennt, aber doch nah genug, so dass ich das Geschehen auf dem OP-Tisch gut verfolgen konnte. Die eine OP war eine Morbus Bechterew, die andere eine neuartige Hüftgelenks-OP. Bei beiden Eingriffen konnte ich unvergessliche Eindrücke sammeln.
Die einzelnen Wochen während der Ausbildung in Hannover liefen folgendermaßen ab: Am Montag, früh am Morgen, setzte ich mich immer in meinen alten, schon in die Jahre gekommenen Opel Rekord, fuhr dann mit „Bleifuß“ nach Hannover-Anderten in die Schule. Um acht Uhr begann dann der Unterricht. In der Regel dauerte er bis 14 Uhr. Danach ging ich meistens mit Egon in eine Imbissbude, um zu Mittag eine Boulette oder eine Bratwurst zu essen.
Am Nachmittag lernten wir dann für unsere Ausbildung. Bei schlechtem Wetter machten wir das auf unserer Bude. Bei gutem Wetter bevorzugten wir, das heißt, im Sommer, die Natur. Wir fuhren dann an einen Baggersee nahe der Autobahn, an dessen Ufer wir eine Decke ausbreiteten und uns gegenseitig abfragten.
Am Freitagnachmittag nach Schulschluss fuhr ich immer nach Haus zu meiner geliebten Familie. Wenn ich dort so gegen 17 Uhr eintraf, zog ich mich sofort um, um noch auf meiner Baustelle ein paar Stunden zu Arbeiten. Auch dieser Bau wurde von mir mit den großen Hohlblocksteinen erstellt und somit ging es verhältnismäßig schnell.
In den ersten Wochen ihrer Schwangerschaft hatte mir Jutta noch auf dem Bau geholfen. Während ich mauerte, bediente sie die Mischmaschine und mischte mir den Mörtel zum Mauern an. Nun aber, wo Jutta kurz vor der Niederkunft war, ging das natürlich nicht mehr. Obwohl, wenn es nach ihr gegangen wäre, sie das auch noch getan hätte. Meine Jutta in der Hinsicht zu stoppen, das war wirklich nicht ganz einfach.
Der Bau war dann auch wunsch- und termingerecht Anfang November richtfertig. Da ich diesmal mit Hilfe der Kreissparkasse Land Hadeln, nicht zuletzt auch wegen der Auszahlung meiner Abfindung, besser, das heißt, großzügiger kalkuliert hatte, konnte ich verschiedene Gewerke meines Baus an Unternehmen vergeben. Es waren dies in erster Linie alle Elektrik-, Heizungsbau-, Klempner- sowie alle Installationsarbeiten. Nachdem diese Arbeiten erledigt waren, wurden von einer Bremerhavener Firma Kistner Fenster und Türen eingebaut.
Vor Wintereinbruch war der Bau dicht. Nicht nur das, wir konnten ihn auch schon heizen, was ein großer Vorteil für die nachfolgenden Gewerke war. Die Firma Kaden schickte mir dann auch pünktlich, wie bei der Auftragsvergabe vereinbart, ihre mir schon bekannte Putzkolonne unter der bewährten Führung von Wilhelm Ludders.
Willis Haus war aufgrund der Tatsache, dass er weiterhin an dem Dienstzeit beendenden Unterricht teilnahm und dadurch jeden Nachmittig auf seiner Baustelle arbeiten konnte, vier Wochen eher dicht. Jetzt hatte er Zeit, mir das Fliesenlegen in einem Kurzlehrgang beizubringen. Da die Saunaräume fast alle gefliest werden mussten, konnte ich mir durch das Selberfliesen entsprechend viel Geld einsparen. Einen vollen Samstag bemühte sich Willi, mir das Fliesen beizubringen. Dann ließ er mich wieder auf meinem Bau allein. Allerdings habe ich damals auch ein wenig getrickst. Von der Putzkolonne habe ich alle Wände putzen und alle Fußböden mit Estrich belegen lassen, so dass ich die Fliesen nur noch mit einem Spezialfliesenkleber auf die glatten Flächen aufkleben musste, was natürlich wesentlich einfacher war.
Nach dem ersten Tag, wo ich zur Vorsicht nur einen Nebenraum flieste, beherrschte ich das Fliesen nach Beurteilung des Bauingenieurs Wittkowski so gut, dass man meine Arbeit kaum von der eines Profis unterscheiden konnte. Langsam aber sicher wurde ich so nebenbei zu einem guten Bauarbeiter.
Unser neuestes Familienmitglied, unser Thomas, war in der Zwischenzeit gesund und munter zu Welt gekommen.
Von Mitte Dezember bis Anfang Januar machte unsere Schule Ferien. Für mich war das eine willkommene Zeit, um auf meinem Bau die noch fehlenden Räume zu kacheln. Noch in dem Weihnachtsurlaub wurde ich damit fertig.
Die bei der Firma Schober in Bremerhaven-Spaden bestellte Saunakabine wurde noch kurz vor Weihnachten eingebaut, was bedeutete, dass ich damit über eine Zeitreserve von drei Monaten verfügte. Also, bei Bestehen meines Examens würden wir pünktlich am 01.07.1971 eröffnen können. Bis auf die Malerarbeiten und die Arbeiten im gesamten Erfrischungsraum, waren wir tatsächlich noch im Jahre 1970 fertig geworden. Somit hatte ich noch ein halbes Jahr Zeit für die Restarbeiten. Wenn alles planmäßig verlaufen würde, und ich mein Staatsexamen zum Physiotherapeuten Ende März 1971 machen würde, könnte ich dann pünktlich am 01.07.1971 in die Selbstständigkeit starten.
Das letzte Vierteljahr auf der Schule ging mit den Vorbereitungen auf die Abschlussprüfung wie im Fluge um. Da auch die Schule wollte, dass möglichst alle noch vorhandenen Schüler das Examen bestehen sollten, gaben sich auch alle, inklusive des Lehrkörpers, entsprechend große Mühe, dieses Ziel auch zu erreichen. Sehr froh darüber, dass wir gut in der Zeit lagen, war ich, weil ich mich deshalb besonders intensiv auf mein Staatsexamen vorbereiten konnte.
In der letzten Woche im März war es dann soweit. Zuerst mussten wir die schriftlichen Examensarbeiten schreiben. Gut fand ich damals, dass wir gleich nach der Auswertung und Benotung die Ergebnisse erfuhren. In der schriftlichen Prüfung war keiner durchgefallen. Bei der mündlichen und praktischen Prüfung ging es also nur noch darum, sich um eine Note zu verbessern, was den Meisten auch gelang. Ich selber hatte eine glatte Zwei bekommen. Mein Stubenkamerad Egon Mentrub, der ja bei der ersten Zwischenprüfung große Probleme hatte, bestand sein schriftliches Examen mit einer glatten Drei. Ich wurde mit einer Zwei plus sogar Klassenbester, worüber ich mich sehr gefreut habe.
Die Zwei plus bedeutete aber noch viel mehr! Mit dieser Benotung bekam ich über den sogenannten zweiten Bildungsweg die Möglichkeit, Medizin zu studieren. Professor Hauberg bot sich sogar an, mir bei der Beschaffung eines Studienplatzes behilflich zu sein. Wieder einmal war ich mächtig stolz auf mich. Hatte ich doch wieder etwas erreicht, was man unter normalen Umständen nur mit einem verdammt guten Abitur erreichen konnte.
Natürlich wäre ich auch gerne Arzt geworden, schon deswegen, weil ich dadurch meinen älteren Geschwistern hätte zeigen können, was ich wirklich erreichen konnte. Sei es drum, dieses für mich so wunderbare Angebot konnte ich so oder so nicht annehmen. Ich hatte eine große Familie, die musste ich ernähren!
Der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr war verpflichtet mir eine Ausbildung zu bezahlen, was er mit der Ausbildung zum Physiotherapeuten ja auch getan hatte. Mehr wollten sie auf meine Nachfrage hin auch nicht tun.
Am 30. Juni 1971 ging meine Ausbildung zum Physiotherapeuten erfolgreich zu Ende. Somit hatte ich meinen vierten Beruf. Nun war ich nach dem Maschinenschlosser, Seemaschinisten und Flugingenieur selbstständiger Physiotherapeut. Das alles mit 31 Jahren.
Irgendwie hatte ich aber damals schon das Gefühl, dass ich immer noch nicht angekommen war. Aber was würde noch kommen? Es sei hier jetzt schon verraten, dass ein paar Jahre später wirklich noch WAS kam. Dieses WAS sollte nach meinem Dafürhalten, meine, nein, ich muss mich da verbessern, nicht nur meine, sondern unsere größte Lebensleistung darstellen. Ganz klar muss ich da, was ich auch sehr gerne tue, die ganz großen Leistungen meiner überaus tüchtigen Jutta miteinbeziehen.
Zunächst ging meine Lebensgeschichte nach dem Staatsexamen so weiter. Wieder zu Hause angekommen, machte ich zwei Dinge. Zum einen musste ich noch ein sogenanntes Anerkennungs-Berufspraktikum machen. Zum anderen waren da noch diverse Restarbeiten an meinem Betriebsgebäude zu erledigen. Beides musste ich irgendwie unter einen Hut bekommen, was mir auch gelang!
Pünktlich am 2. Juli 1971 eröffneten meine Jutta und ich unser „Altenwalder Kurbad“ mit Sauna und physikalischer Therapie. Wir begannen unsere Eröffnung mit einem kleinen Empfang um 11 Uhr. An diesem Empfang nahmen Freunde, Verwandte und auch die lokalen Größen aus der Politik teil. Es gab Sekt, Orangensaft und belegte Brötchen. Es erschien auch unser Dorfbürgermeister. Er überreichte mir vom Gemeinderat eine wunderschöne, etwa 34 Zentimeter hohe Keramikblumenvase. Dabei überbrachte er mir auch die Grüße des gesamten Gemeinderats.
Nachdem der offizielle Teil vorbei war, nahm er mich an die Seite und flüsterte mir wenig taktvoll in plattdeutscher Sprache ins Ohr: „Wenn du miene Meinung heurn wullt. Dat gaht nich goot mit dien‘n Kurbad in Olen Woolde. Wedden, in en holf Johr best du weder kapott.“
Natürlich war ich damals beleidigt und gekränkt. Was hatte ihn bloß veranlasst, so eine Taktlosigkeit von sich zu geben. Nach dem ich mich etwas gefangen hatte, sagte ich zu ihm: „Herr Bürgermeister, ich werde mit diesem Betrieb noch da sein, wenn von Ihnen schon lange keiner mehr spricht.“ Ich sollte recht behalten!
Nun musste ich diesen Betrieb zum Laufen bekommen. Eigentlich ging das schneller, als ich zu hoffen gewagt hatte. Die Sauna lief von Anfang gut. Die Cuxhavener, die sonst über Altenwalde hinaus nach Bremerhaven fuhren, die ich durch meine häufigen Besuche in der dortigen Sauna, fast alle kannte, kamen nun, wie von mir erhofft, sofort alle zu mir. Erstens mussten sie nun nicht mehr so weit fahren, und zweitens war meine Saunaanlage viel moderner und nach dem neuesten Stand der Technik von mir errichtet worden. Aber es war vor Allem eine sehr gemütliche Saunaanlage. Dieses wurde mir von allen Seiten bestätigt.
Zusätzlich war ein von mir angewandter Werbetrick sehr erfolgreich. Dem sich schnell bildenden Stammkunden-Kreis machte ich ein spezielles Angebot. Dabei dachte ich wieder an meine Großmutter. Die hatte mir bei irgendeiner Gelegenheit mal gesagt, was ich lange nicht richtig verstanden hatte: „Junge, merke dir fürs Leben: Was du mit den Händen zum Fenster hinauswirfst, das wird man dir mit der Schubkarre zur Tür wieder hereinfahren.“ Lange wusste ich nicht, was sie damit gemeint hat. Aber in dem Zusammenhang hatte ich es begriffen! Sie hatte nichts anderes gemeint als die schlichte Tatsache: Eine gewisse Großzügigkeit macht sich immer bezahlt.
So war es auch in diesem Fall. Meinen Stammkunden machte ich folgendes, großzügiges Angebot: Wenn sie aus ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis jemanden in meine Sauna mitbringen würden, hatte derjenige das erste Saunabaden frei. Das schlug ein wie eine Bombe. Die Sauna füllte sich von Woche zu Woche immer mehr. Dadurch wurden auch viele Sauna-Neulinge zu Sauna-Dauergästen. Vorsichtig geschätzt blieben von denen, die mein Angebot des kostenlosen Saunabadens genutzt hatten, etwa ein Drittel dabei und wurden Stammgäste.
Auch kamen von Beginn an viele Gäste aus meinem alten Geschwader. Der Fliegerarzt Dr. Ebel war selber Sauna-Fan und empfahl dem gesamten fliegenden Personal zur Körperertüchtigung das Saunabaden. Der Eintritt für ein Saunabad betrug DM 5,00 und eine 12er Saunakarte kostete DM 50,00.
Aber der ganz große Durchbruch kam wieder einmal durch eine Idee, die meine Jutta hatte. Wir hatten von Beginn an, streng nach Geschlecht getrennt, Badetage für Frauen und Badetage für Männer. Jutta, die immer von Sauna-Beginn um 14 Uhr bis 18 Uhr im Erfrischungsraum Saunadienst hatte und dadurch den meisten Kontakt zu den Sauna-Gästen hatte, überraschte mich eines Tages mit einem Vorschlag.
„Paul, was hältst du davon, hier bei uns in der Sauna einen Tag in der Woche Familien-Sauna einzuführen. Das soll heißen: Männlein und Weiblein zusammen.“
Das hielt ich damals in unserer doch überwiegend ländlichen Gegend für sehr gewagt. Es gab in Deutschland schon in den Großstädten das gemischte Saunabaden. Aber wie würde das bei uns auf dem Land ankommen?
Nach ein paar Tagen der Diskussion mit Jutta, entschloss ich mich dann doch, dem zu zustimmen. Aber um eventuellen „Wildwuchs“ vorzubeugen, wollten wir bei der Gemischt-Sauna die Kunden nur paarweise hereinlassen. Ein entsprechender Aushang wurde gefertigt und vierzehn Tage vor Beginn der Familien-Sauna in unserem Betrieb ausgehängt. Schon der erste gemeinsame Badetag wurde ein voller Erfolg. Die Sauna war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Sie hatte zunächst eine Kapazität von bis zu dreißig Personen. Da wir zunächst nur einen Familien-Sauna-Tag in der Woche eingerichtet hatten, reichte das bei weiten nicht aus. Schon nach wenigen Wochen mussten wir einen solchen zweiten Tag einrichten. Irgendwelche unangenehmen Situationen sexueller Art oder gar Übergriffe hat es in meiner Saunaanlage niemals gegeben.
Die Bäder- und Massage-Abteilung lief auch sehr gut an. Nur dass ich die auf eine ganz andere Art und Weise ins Laufen bringen musste.
Schon von Anfang an kam zu uns in die Sauna ein Ehepaar namens Ute und Kali Möller. Kali war der Sohn und Mitarbeiter des Inhaber-Ehepaars Möller der Firma Möller und Schade. Damals ein sehr bekanntes und sehr nobles Damen- und Herrenoberbekleidungsgeschäft in Cuxhaven.
Durch unseren Bau und durch den dadurch hervorgerufenen dauerhaften Geldmangel, waren Juttas und meine Garderobe so ziemlich abgetragen, so dass ich mich mit den noch verbliebenen Klamotten nirgends mehr, wo es darauf ankam, sehen lassen konnte. Heutzutage würden ja eine abgetragene Jeans und ein Sacco reichen. Das war damals aber noch ganz anders. Da machte mir mein, mittlerweile zum Freund gewordener Kali Möller von sich aus ein tolles Angebot.
„Weißt du was, Paul, ich habe da schon mal mit meinem Vater gesprochen. Wenn deine Jutta und du wollt, dann kommt doch mal zu uns ins Geschäft. Da werden wir euch ganz neu einkleiden. Das Ganze könnt ihr dann in monatlichen kleinen Raten, so wie es euch beliebt, abzahlen. Ute und ich würde euch dann auch selbst bedienen.“
„Mensch, Kali, das würdet ihr wirklich für uns tun?“
„Na klar“, sagte er. „Euer Laden läuft doch gut an. Da ist doch für uns gar kein Risiko drin. Also, abgemacht!“
Dann hielt er mir die Hand hin, in die ich kräftig einschlug. Schon am nächsten Morgen fuhren Jutta und ich in die Stadt zu Möller und Schade. Von Kali und Ute wurden wir bestens beraten. Aber wir kauften viel mehr ein, als wir eigentlich wollten. Wenn ich mich recht erinnere, kamen dann unterm Strich so rund DM 1000,00 heraus. Das wollte Anfang der siebziger Jahre etwas heißen.
Dennoch, als wir mit unserem Einkauf auf Pump fertig waren, bat uns der alte Herr Möller, also Kalis Vater, in sein Büro. Was mich damals wirklich verblüfte, er bat uns Platz zu nehmen, bot uns Kaffee und mir noch zusätzlich eine wunderbare, kubanische Zigarre an. Obwohl wir das alles auf Kredit gekauft hatten, bedankte er sich sehr herzlich für den guten Einkauf. Diesen Moment habe ich damals wirklich genossen und ihn niemals vergessen. Bis zum Schluss bin ich dafür mit meiner Jutta immer Kunde bei Möller und Schade geblieben. Ute und Kali gehören heute noch zu unserem engsten Freundeskreis.
Wie bekam ich aber dann den letzten Schub in meine physikalische Therapie? Als gewerbefreier Therapeut und Betrieb war es mir anfänglich verboten, über Annoncen zu werben. Das nannte man Werbung zu Lasten Dritter, also zu Lasten der Krankenkassen, was verboten war. Also musste ich mir etwas anderes einfallen lassen.
Eines Tages begann ich, alle Ärzte nach telefonischer Voranmeldung zu besuchen. Um einen guten Eindruck zu machen, musste ich natürlich gut und solide gekleidet sein. Bei den einzelnen Ärzten stellte ich dann mein gesamtes, in Hannover erlerntes physiotherapeutisches Programm vor. Diese Idee sollte sich als sehr gut und sehr erfolgreich erweisen. Damals konnte ich richtig beobachten, wie nach jedem Arztbesuch die Patientenanzahl zunahm. Nach kurzer Zeit war das Arbeitsaufkommen so groß, dass ich es nicht mehr alleine bewältigen konnte, obwohl ich täglich von morgens 6 Uhr bis abends 18 Uhr, also 12 Stunden am Tag, in meiner Praxis arbeitete und täglich bis zu 40 Behandlungen gab. Also musste ich den ersten Therapeuten einstellen. Es war der Hermann Pöhlmann. Ein ganz hervorragender und sehr gut ausgebildeter Therapeut.
Unser Arbeitstag sah damals wie folgt aus: Wir standen jeden Morgen um halb sechs auf. Bevor ich in den Betrieb ging, frühstückten wir immer gemeinsam. Wenn ich das Haus verlassen hatte, kümmerte sich Jutta um die Kinder. Unser Ältester, der Martin, war in dem Jahr eingeschult worden und wurde von Jutta anfänglich immer zur Schule gebracht. Aber schon bald war er so selbstständig, dass er ganz alleine in die Schule ging, was für meine Jutta eine große Entlastung war.
Jutta machte dann am Vormittag den Haushalt. Am Nachmittag ging sie dann rüber in den Saunabetrieb und öffnete dann immer um 14 Uhr die Sauna. Sie kassierte das Eintrittsgeld, machte Kontrollgänge durch die Saunen und wenn gewünscht, machte sie den Gästen in der Saunakabine auch einen Aufguss. Ihr Arbeitsplatz, wo sie sich meistens aufhielt, war der sehr gemütlich eingerichtete Erfrischungsraum. Hier gab es Fruchtsäfte aller Art oder eine frisch gebrühte Tasse Kaffee. Bei Herren-Sauna gab es auch ein gutes kühles Bier.
Jutta war bald bei den Saunagästen durch ihre immer gleichbleibende Freundlichkeit sehr beliebt. Sie war der unumstrittene Mittelpunkt der Saunaanlage. Wie sie das damals alles auf einmal geschafft hat, weiß ich auch heute noch nicht zu sagen. Natürlich hat sie dann noch ganz nebenbei unsere Kinder versorgt und mit dem Ältesten die Schularbeiten gemacht.
Ich selber habe täglich bis 18 Uhr in der Therapie gearbeitet. Danach zog ich meinen weißen Kittel aus und löste dann meine Jutta im Erfrischungsraum vom Saunadienst ab. Jutta ging dann mit den Kindern rüber nach Hause und erledigte die Buchführung oder die Krankenkassenabrechnung. Mein Saunadienst ging dann noch bis 22 Uhr. Um diese Zeit wurde dann offiziell die Sauna geschlossen. Sehr oft kamen die Gäste aber nicht pünktlich aus der Anlage raus. Auch blieben sie gerne noch eine halbe Stunde oder sogar länger an der Bar sitzen, um mit mir zu klönen. Gerne luden sie mich auch noch auf eine Flasche Bier ein, die ich aus zwei Gründen nicht abschlagen konnte. Erstens trank ich immer gerne eine Flasche Bier und zweitens konnte und wollte ich nicht auf den zusätzlichen Umsatz verzichten. Das wurde aber für mich langsam aber sicher zu einem Problem. Jeden Morgen musste ich doch sehr früh raus und zum anderen ging ich so fast jeden Abend leicht alkoholisiert ins Bett. Mir wurde sehr schnell klar, das konnte und durfte so nicht bleiben. Da aber schon die ersten monatlichen Umsatzabrechnungen, die mir meine Jutta vorlegte, sehr zufriedenstellend aussahen, beschlossen Jutta und ich bereits nach einem halben Jahr eine weitere Angestellte einzustellen.
Wir hatten damals schon ein sehr nettes Nachbarehepaar, es waren Anne und Rudi Klint. Sie hatten direkt rechts neben uns gebaut. Deren Kinder waren schon groß und aus dem Haus. Anne hatte Jutta schon des Öfteren gefragt, ob wir nicht für sie einen kleinen Job hätten. Nun beschlossen wir, Anne für unseren Erfrischungsraum und für die Sauna-Aufsicht einzustellen, worüber sie sich sehr freute. Nach kurzer Zeit stellte sich schon heraus, dass es eine gute Entscheidung war. Wir hatten zwar Anne bei uns eingestellt, doch von Anfang an arbeitete sich ihr Ehemann Rudi, der beruflich als Beamter beim Wetterdienst auf meinem alten Flugplatz in Nordholz tätig war, bei uns mit ein. Das hatte den großen Vorteil, dass die beiden sich mit Jutta je nach Bedarf immer ablösen konnten. Besonders für Jutta war das eine große Entlastung. Da aber auch der Rudi bereit war, mit mir den Spätdienst zu teilen, war das auch für mich ein großer Vorteil, so dass die Versuchung, „jeden Abend Bier zu trinken“ ab sofort halbiert war und ich auch ab und an wieder ausschlafen konnte.
Von da an ging es mit unserem kleinen Unternehmen, dem „Altenwalder Kurbad“, stetig bergauf. Nach etwa einem weiteren Jahr war es dann so weit. Wir platzten mit unserem kleinen Laden aus allen Nähten. Für die Abteilung „Physikalische Therapie“, wir nannten diese schlicht Bäder-Abteilung, hatte ich mich schon sehr früh um die Berechtigung beworben, Praktikanten für den Beruf des Masseurs und medizinischen Bademeisters auszubilden. Da ich nicht nur selber mein Staatsexamen gemacht hatte, sondern auch noch mit Hermann Pöhlmann einen ausgezeichneten Fachmann mit Ausbildungsberechtigung hatte, unser Betrieb darüber hinaus über die gesamte Palette der physikalischen Therapie verfügte, bekamen wir die erwünschte Berechtigung ohne Probleme. So stellte ich unseren ersten Praktikanten namens Rudi Seebörger ein.
Dadurch dass wir für drei Therapeuten nicht mehr genügend Behandlungskabinen hatten, begannen wir in zwei Schichten zu arbeiten. Das funktionierte aber auch nur sehr beschränkt. Die Patienten, die morgens vor der Arbeit oder abends nach Feierabend zur Behandlung kommen konnten oder wollten, gab es zwar, aber nicht in genügender Anzahl. Auch die Sauna platzte so langsam aus allen Nähten. An manchen Tagen konnten wir gar nicht alle Gäste aufnehmen, auch wenn mir das in der Seele wehtat. Wir mussten sie bitten, an einem anderen Tag wiederzukommen. Einige taten das. Aber viele auch nicht!
Wir hatten damals mit unserer Marktanalyse „Gold richtig gelegen“. In dieser Situation aber musste ich nun für Entlastung sorgen. Es gab nur einen Ausweg. Wir mussten bereits im zweiten Betriebsjahr anbauen. Meine Hoffnung war, dass mich meine finanzierende Bank dabei auch weiterhin unterstützen würde. Nach der Analyse der ersten zwei Jahresbilanzen und einer Besichtigung meines Betriebes durch den damaligen Bankdirektor, bewilligte mir das Geldinstitut einen weiteren Kredit zum An- und Umbau meines Betriebes. So musste nun mein alter und bewährter Freund Gustav Wittkowski wieder ran. Innerhalb kürzester Zeit erstellte er mir wieder die Baupläne dafür.
Dieses Mal konnte und wollte ich nicht selber bauen, das heißt, ich konnte aus Zeitgründen nicht selber Hand anlegen. Abzuwägen war von mir, wo konnte ich mehr Geld verdienen: in meinem weißen Kittel als Therapeut oder in der Maurerhose als Mauermann. Damals entschied ich mich für den weißen Kittel!
Unter meinen Sauna-Stammkunden war damals ein Herr Ernst Brauer. Er hatte kurz zuvor eine Baufirma gekauft. Auf meinen Wunsch hin, schrieb mein Architekt Gustav diesen Neu- und Anbau aus. An der Ausschreibung beteiligten sich vier Firmen. Die Firma meines Kunden Ernst Brauer machte ein Angebot, das lag nur knapp über dem des Preiswertesten. Da ich ihm aber als meinem Stammkunden den Auftrag gerne geben wollte, führte ich mit ihm ein vertrauliches Gespräch, indem er mir den Betrag, um den er teurer war, nachließ. Daraufhin bekam er von meinem Architekten den Auftrag. Es war eine gute Entscheidung. Die Firma „Brauer-Bau“ arbeitete an meinem An- und Umbau sehr zügig und sehr gut. Gustav Wittkowski war mit der Ausführung der Arbeiten sehr zufrieden. Nach genau sechs Monaten konnten wir den Neubau, der fast so groß war wie das erste Gebäude, in Betrieb nehmen. Die Bäder- und Massage-Abteilung war nun mehr als doppelt so groß. Nun konnten wir in der physikalischen Therapie so richtig loslegen. Auch einen Gymnastikraum hatten wir jetzt. Wir konnten jetzt sogar einen zweiten Praktikanten einstellen. Es war der Albert Hüllinghoff.
Hier möchte ich schon erwähnen, dass beide Erstpraktikanten, die in unserem „Altenwalder Kurbad“ ihr Berufsanerkennungspraktikum gemacht hatten, bei uns blieben. Da beide in ihrem Beruf sehr gut waren und auch über einwandfreie Charaktere verfügten, machte ich sie schon einige Jahre später zu Betriebsleitern und leitenden Therapeuten der von Jutta und mir neu geschaffenen Kurmittelhäuser Döse und Sahlenburg.
Im „Altenwalder Kurbad“ lief nach dem Anbau nun vieles besser, leider betraf das nur die Bäder-Abteilung. Unsere Sauna musste ich kurz darauf noch einmal umbauen und vergrößern.
Mein Bruder Gerhard, der in der Zwischenzeit sein Baustudium abgeschlossen hatte und nun selber Architekt und Bauingenieur geworden war, kam auf die Idee, meinen Bau, der ja von Gustav mit einem Flachdach entworfen worden war, mit einem Satteldach zu versehen. Unter diesem Dach wurde dann unser Büro, das mittlerweile auch immer größer wurde und außer meiner Jutta schon eine fest angestellte Kurbad-Sekretärin beschäftigte, eingerichtet. Für die Krankenkassenabrechnungen hatte Jutta eine Freundin, die Uschi Sievers, in Heimarbeit eingestellt. Unsere Sekretärin war auch eine Nachbarin, sie hieß Christa Schubert und war auch über 25 Jahre, also bis zu ihrer Pensionierung, bei uns. Sie war immer eine unglaublich engagierte und tüchtige Bürofachkraft, der Jutta und ich auch sehr viel beim Aufbau unseres Betriebes zu verdanken hatten.
Dadurch, dass ich dann unser Büro in den ersten Stock verlegte, bekamen wir auch in der Sauna mehr Platz. Wir bekamen durch den Umzug einen zweiten Umkleideraum und eine zweite kleinere Saunakabine dazu. Das brachte uns für den Moment doch eine gewisse Entlastung.
Später wurde die Saunaanlage dann doch noch einmal unter der Planung von meinem Bruder Gerhard umgebaut und erheblich modernisiert. Wir bauten einen schönen Wintergarten als Ruhezone und eine Dampfsaunakabine dazu. Draußen im Freiaustritt ließ ich ein schönes Schwimmbad errichten. Dieses war so konstruiert, dass es im Sommer als Freibad und im Winter durch eine schiebbare isolierte Überdachung als Hallenbad genutzt werden konnte. Geheizt wurde es durch eine Wärmepumpe, die die Abwärme der drei Saunakabinen dafür nutzte.
Der Sauna-Kundenstamm wuchs unaufhörlich. Wir hatten Kunden aus Otterndorf, Basbek und Hemmoor. Auch die Bremerhavener Sauna-Kunden wurden immer mehr. Lange hatte ich erkannt, dass ich meine Kunden irgendwie an meinen Betrieb binden musste. Aus diesem Grund gründete ich zuerst in meinem Erfrischungsraum, der wie eine wirklich gemütliche Kneipe eingerichtet war, einen Spar-Club. In diesen mussten die Club-Mitglieder monatlich DM 5,00 einzahlen. Wenn sie es aus irgendeinem Grund nicht taten, hatten sie für den entsprechenden Monat DM 2,00 Strafe zu zahlen. Zunächst hatte der Spar-Club etwa 50 Mitglieder. Zum Schluss waren es 120 Mitglieder mit zwei Sparschränken mit je 60 Sparfächern. In den Jahren darauf wurden in diesem Spar-Club namens „Nackedei“ insgesamt immer zwischen DM 10.000 - 15.000 angespart.
Der Präsident unseres Spar-Clubs war von Anfang an unser Saunafreund Uwe Weidhase. Der Kassierer und Schatzmeister war, bis zu seinem Ableben, mein Freund und alter Kamerad Willi Bergmann. Willi hatte mittlerweile auch die Marine verlassen und war zur Polizei übergewechselt. Er machte, wie er es geplant hatte, in Cuxhaven seinen Dienst. Mein Eindruck war aber, dass Willi sich innerlich niemals von der Marine gelöst hatte. Unsere Freundschaft war aber ungebrochen. Wo immer Willi mir helfen konnte, tat er es. Deshalb hat er sich auch an dieser Stelle ein besonderes Dankeschön verdient.
Einmal im Jahr wurde dann das angesparte Geld an die Club-Mitglieder ausgezahlt. Das geschah auf dem jährlich stattfindenden Saunafest. Dieses begann immer mit einem in Norddeutschland üblichen Grünkohlessen. Danach wurde dann mit Musik und Tanz bis in den Morgen gefeiert.
Da an dem Tag die gesamte Sparsumme an die Mitglieder ausgezahlt wurde, hatten alle genügend Geld in der Tasche, um ordentlich auf den Putz zu hauen. Mein Eindruck war, dass sehr viele von uns nur sparten, um sich das einmal im Jahr richtig erlauben zu können. Entsprechend war dann auch die Stimmung. Wir waren über viele Jahre so an die 200 Festteilnehmer. Bald schon wurde in Cuxhaven unser Fest „Sauna-Ball“ genannt. Diese in jeder Hinsicht wunderbaren Sauna-Spar-Club-Feste wird wohl niemand, der daran teilgenommen hat, je vergessen. Auch unserem jahrzehntelangen Spar-Club-Präsidenten Uwe Weidhase sei für die liebevolle Ausrichtung noch einmal herzlichst gedankt.
Dann hatten wir auch sehr bald so etwas wie einen Skat-Club gegründet. An den Herren-Sauna-Tagen wurde immer mindestens an zwei Tischen während Sauna-Gängen Skat gespielt. Es ging dann immer um eine Runde Bier, Fruchtsaft oder Selterswasser. Vor allem ging es dabei immer um die Geselligkeit.
Aus der Runde dieser Skat-Brüder wurde der Wunsch an mich herangetragen, doch einmal im Jahr einen sogenannten Preisskat zu veranstalten. Diesem Wunsch kam ich gerne nach. Wieder war es Willi, der selbst begeisterter Skatspieler war, der sich sofort zur Verfügung stellte, um mit mir gemeinsam diesen Skatabend zu organisieren. Da das sogenannte Preisgeld grundsätzlich nur zum Einkauf von Preisen zur Verfügung stand, bekam jeder einen Preis. Keiner musste so nach unserem Preisskat mit leeren Händen seiner besseren Hälfte gegenübertreten. Das heißt, jeder brachte einen Preis mit nach Hause, was garantierte, dass er auch beim nächsten Preisskat wieder dabei sein durfte. Der Hauptgewinn war ein von mir gestifteter Wanderpokal. Wer diesen drei Mal gewann, durfte ihn für immer behalten. Meines Wissens ist das aber nie passiert, was auch zeigte, dass bei uns alle Skatspieler auf einem einigermaßen gleich hohen Niveau spielten. Auch hier gab es unvergessliche schöne Skatabende unter Sauna-Freunden, denen heute noch viele aus der damaligen Runde nachtrauern.
Noch eine „Einmaligkeit“ hatten wir in meinem „Altenwalder Kurbad“ gegründet. Diese „Einmaligkeit“ war unser Sauna-Boßelclub. Die Initiative ging von unserem Sauna-Freund und Nachbarn Bruno Sievers aus. Bruno war dann auch ein paar Jahre der Präsident unseres Boßelclubs. Der Boßelclub gab sich auch eine Satzung. Diese besagte, dass wir in den Monaten Januar, Februar und März je eine Boßeltour machen mussten, an der jedes Mitglied mindestens an einer teilzunehmen hatte. Es entstanden dadurch unvergessene Touren durch unsere wundervolle Küsten-Winterlandschaft. Die Touren durch das Außendeichgelände waren für mich persönlich die reizvollsten. Für Nichtkenner: Wir bildeten in der Regel zwei Mannschaften. Jedes Mitglied der Mannschaft bekam eine Nummer. Gespielt wurde auf wenig befahrenen Straßen oder glatten Feldwegen in Deichnähe. Zunächst wurde eine Linie gezogen, von der es losging. Die Spieler mit der Nummer 1 warfen zuerst ihre mit einem Bleikern gefüllte Hartholz-Kugel (Boßelkugel). Irgendwann, jeder der Werfer hoffte natürlich, dass seine Kugel möglichst weit auf der Straße rollte, blieb die Kugel liegen. Genau an dem Punkt durften dann die Spieler mit der Nummer 2 weiterspielen. So ging das dann weiter, bis alle Spieler die Boßelkugel geworfen hatten. Wenn die letzten nummerierten Spieler geworfen hatten und die Kugeln liegen geblieben waren, hatte die Mannschaft gewonnen, deren Kugel am weitesten gerollt war. Diese bekam dann den Siegerpunkt.
Dann ging das Ganze wieder von vorne los. Die Mannschaft, die dann am Ziel, und das war meistens eine vorher ausgeguckte Kneipe, die meisten Punkte gesammelt hatte, war der Gesamtsieger. Aber ehe man am Ziel ankam, hatte man, je nach ausgesuchter Strecke, schon seine 10 bis 20 km in den Beinen. Damit dass auch jeder Mitspieler überstand und unterwegs keiner wegen übergroßen Durstes oder Hunger zusammenbrach, wurde ein kleiner Handwagen mit Essen und vor allem Trinken mitgeführt. Die entsprechenden Pausen wurden ebenfalls schon vorher festgelegt und genauesten eingehalten. Oder es taten sich zwei Spieler-Ehefrauen zusammen und überraschten dann irgendwo auf der vorher festgelegten Strecke ihre schwer arbeitenden Männer und Boßeler mit Ess- und Trinkbarem, wobei letzteres meistens mit ein paar Promille veredelt war.
In der Kneipe, trotz einiger Aufmunterungspausen unterwegs, völlig erschöpft angekommen, wurde dann zunächst immer die Siegerehrung abgehalten. „Oh weh“ den Siegern! Denn die mussten, einer alten Tradition folgend, den Verlierern sehr kräftig einen ausgeben. Das war manchmal so heftig, dass sich so manch ein wackerer Boßeler schon unterwegs überlegte, ob er denn überhaupt zu den Gewinnern gehören wollte.
Diese Boßeltouren waren großartige und unvergessliche Erlebnisse. Nach Bruno wurde dann ein ehemaliger Kamerad der Marinefliegerei, der Rainer Linke, zum Boßelclub-Präsidenten gewählt. Als solcher leistete auch er über viele schöne Jahre eine hervorragende Arbeit und trug dadurch auch zu unserem hervorragenden Zusammengehörigkeitsgefühl bei. Vergessen werden darf ich in dem Zusammenhang auch nicht meinen alten Freund und Kameraden Harald Joester. Er war der Protokoll- und Schriftführer unseres Boßelclubs. Seine Protokolle sind bis heute unerreicht und für immer unvergesslich. Durch seinen geschliffenen Humor und seinem gekonnten „Leute auf die Schippe nehmen“, machte er diese zu unvergesslichen Dokumenten. Also beiden an dieser Stelle einen aufrichtigen Dank meinerseits. Ihr habt dazu beigetragen, dass unser Sauna-Boßelclub unvergesslich bleibt.
Bald hatten sich auch sogenannte Tagesgruppen gebildet. Für jeden Tag in der Woche gab es dann eine extra Sauna-Gang. Sie nannten sich Montags-, Dienstag-, usw. -Sauna-Gang. Das Zusammengehörigkeitsgefühl in den einzelnen Gangs war sehr stark und ausgeprägt. All diese Gruppen hatten dann noch ihre eigenen Veranstaltungen in Form von Feiern oder Ausflügen.
Die Freitags-Gang, die ausschließlich aus Herren bestand, baute sich in Eigenleistung eine eigene Boulebahn im Vorgelände der Sauna. Platz war ja auf dem parkähnlichen Gelände reichlich vorhanden. Auf dieser Boulebahn wurden dann immer bei gutem Wetter einige Runden Bier ausgespielt. Auch das förderte den Zusammenhalt und erhöhte natürlich auch den Umsatz im Erfrischungsraum. All diese Gruppen und Clübchen machten in Cuxhaven unsere „Altenwalder Kurbad-Sauna“ immer bekannter und unter Saunagängern auch immer beliebter.
Ich bin auch heute noch fest davon überzeugt, dass die damalige Sauna mit allem, was dazu gehörte, das Fundament für all unsere späteren Unternehmungen war. Mit unseren, meine ich in erster Linie meine liebe Frau Jutta, aber auch schon einige Jahre später unsere drei Kinder Martin, Gabriele und Thomas. Alle drei sind sehr ordentliche Menschen mit ausgezeichnetem Charakter geworden und haben mich mit meinen immer neuen Plänen auf ihre Weise außergewöhnlich unterstützt.
Natürlich wären hier noch sehr viele Namen zu nennen und manch eine tolle Story zu erzählen. Das würde aber bei weitem den Rahmen meiner Lebensgeschichte sprengen. Deshalb bitte ich die eventuell Betroffenen und nicht Genannten, aber auch den Leser, an dieser Stelle um Entschuldigung.
Irgendwann machte ich mal wieder eine Analyse, um festzustellen, woher eigentlich die vielen Patienten in der physikalischen Therapie kamen. Mittlerweile waren wir vier ausgewachsene Therapeuten und zwei Hilfskräfte. Alle waren ausgezeichnete Fachleute und außergewöhnlich fleißig. Rudi Seebörger und Albert Hüllingoff waren längst mit ihrem Anerkennungs-Praktikum fertig. Trotzdem kamen wir nicht mehr gegen die anfallende Arbeit an. Wir mussten tatsächlich Patienten wegen Überfüllung abweisen. Das tat mir natürlich in der Seele weh.
Diese von Jutta und mir erstellte Analyse zeigte uns sehr deutlich, dass uns, besonders während der Sommermonate, die Kurgäste aus Cuxhaven-Döse und Sahlenburg entdeckt hatten. Ganz offensichtlich hatte sich bis dorthin, besonders bei den damaligen Bade- und Kurärzten, herumgesprochen, dass es in Altenwalde einen Kurbetrieb gab, der auch sehr gute Arbeit auf dem Gebiet der Badeheilkunde machte.
Um den Sahlenburger Kurgästen zu helfen, hatte ich mir auf Empfehlung des dort damals tätigen und sehr tüchtigen Badearztes, mit dem ich mich wegen unserer guten Behandlungserfolge ausgezeichnet verstand, einen VW-Bus gekauft. Mit diesem fuhr ich mehrmals am Tag nach Sahlenburg und holte dort vor der Praxis nach vorheriger Vereinbarung Kurgäste ab. Behandelte diese in Altenwalde und fuhr sie nach erfolgter Behandlung nach Sahlenburg zurück, um dann dort wieder neue Kurgäste aufzunehmen. Das machte ich etwa zwei Jahre lang. Da ich kein Taxiunternehmer war, war dieser Service natürlich kostenlos, d.h. er ging voll zu meinen Lasten. Damit konnte ich zwar für eine begrenzte Zeit den Kurgästen aus Sahlenburg helfen, aber auf Dauer ging das natürlich nicht. Den Döser Kurgästen war damit aber in keiner Weise geholfen. Die damalige kleine Bäderabteilung der Kurverwaltung in Duhnen war schon lange nicht mehr in der Lage, alle anfallenden Kurgäste zu behandeln. Also dachte ich mir, nutze die Chance und baue in Cuxhaven-Döse eine Kurmittelanlage.
Der Zufall führte mich damals mit einem Alfred Rath zusammen. Der hatte ein paar Jahre zuvor in unmittelbarer Strandnähe ein Hotel Garni mit Restaurant an der Nordheimstraße erbaut. Sein Restaurant lief aber nicht, weswegen er die Räume vermieten wollte. Als ich davon hörte, setzte ich mich sofort mit ihm in Verbindung, mit dem Ansinnen, von ihm diese freiwerdenden Räume zu pachten. Da auch Alfred Rath sich für sein Hotel von einer Kuranlage im Haus Vorteile versprach, wurden wir uns sehr schnell handelseinig. So wurden aus dem Restaurant sehr schnell sechs Massagekabinen inklusive Anmeldung und kleinem Ruheraum. Aus der Küche machte ich damals eine kleine Bäderabteilung mit einer Unterwasser-Massageanlage. Da auch die Stadt selber ein Interesse an so einer Kuranlage an diesem Standort hatte, war das entsprechende Genehmigungsverfahren ein Selbstgänger. Da jeder dieser Kurbetriebe einen leitenden Therapeuten brauchte, machte ich Rudi Seebörger zum leitenden Therapeuten und Betriebsleiter des kleinen Kurbetriebes Döse. Verstärkt wurde er durch zwei weitere neu eingestellte Therapeuten und einen Praktikanten. Als Kurbad-Sekretärin und Anmeldekraft wurde unsere Astrid Joester eingestellt und von Jutta eingearbeitet. Astrid war die Frau eines ehemaligen Kameraden aus der Marinefliegerei, der dort als Tactical Officer (TECO) geflogen ist. Sein Vorname war Harald. Beide sollten sehr bald zu unserem engeren Freundeskreis gehören.
Alles in Allem hatte ich auch in Döse bald ein hervorragend funktionierendes Team. Leider musste ich schon im ersten Jahr, das heißt, während der ersten Hauptsaison zur Kenntnis nehmen, dass auch dieser Betrieb bedingt durch das große Kurgastaufkommen viel zu klein geraten war. Noch im selben Jahr machte ich mich daran, ein neues viel größeres Kurmittelhaus zu planen. Da direkt neben dem Nordsee-Hotel, in dem wir Mieter waren, noch ein schmaler Streifen Bauland frei war und ein weiterer schmaler Streifen von der „Neuen Heimat“ hinzugekauft werden konnte, reichte es dann gerade, dort ein neues modernes und den damaligen Anforderungen entsprechendes Kurmittelhaus (KMH) zu errichten. Die Finanzierung übernahm damals meine neue Hausbank in Cuxhaven. Die Baukosten für das zweistöckige Gebäude betrugen ca. 1,2 Mio. DM. Die Banken hatten mitbekommen, dass der Bedarf da war und dass ich in der Lage war, solch gut funktionierende Kurbetriebe auf die Beine zu stellen. Also war die Finanzierung kein Problem.
Der Architekt für das KMH-Döse war der Schwager des Hotelbesitzers und der Verkäufer eines Teils des Baugrundstücks. Der Hotelbesitzer machte zur Bedingung, dass sein Schwager diesen Auftrag bekam. Da dieser ein erfahrener Architekt war, tat ich ihm den Gefallen. Die Bauzeit betrug etwa ein Jahr. Da Ernst Brauer immer noch zu unseren treuen Sauna-Kunden gehörte, bekam er ebenfalls den Auftrag für das KMH-Döse. Auch dort machte diese Baufirma wieder sehr gute Arbeit.
An dieser Stelle sei eingefügt, dass ich immer darauf geachtet habe, dass diejenigen, die mich Geld verdienen ließen, auch von mir bevorzugt behandelt wurden, wenn ich Aufträge zu vergeben hatte.
Auch da arbeitete ich nach einem, oft von meiner Großmutter angewandten Spruch: „Eine Hand wäscht die andere“.
Ein Jahr später, pünktlich zum Saisonbeginn, bezogen wir unseren Neubau, das neue „Kurmittelhaus Döse“. In diesem Haus blieben wir dann ca. zehn Jahre, dann sollte es wieder zu klein werden.
Aus einem anderen Grund, den ich mir selbst eingebrockt hatte, sollte ich nicht zur Ruhe kommen. Ein paar Jahre zuvor war ich aus verschiedenen persönlichen Gründen der CDU beigetreten. Ich sah das damals so: Es liegt in der Natur des Menschen nach mehr zu streben. Das heißt für mich, wenn der Mensch bereit ist mehr zu arbeiten und auch bereit ist, mehr Verantwortung auf sich zu laden, dann soll er, nein, dann muss er auch mehr Geld verdienen können als die anderen, die das nicht können oder wollen. Dieser Grundhaltung kam meiner Meinung nach damals die CDU am nächsten. Während die SPD mir damals so vorkam als seien sie die großen Gleichmacher. Alle müssen das Gleiche haben, allen muss es gleich gut oder schlecht gehen. Genau das konnte ich mir damals, als ich immer „Alles“ wagte und mit meiner Jutta nächtelang ohne Punkt und Komma, d. h. ohne Wochenende und ohne Urlaub arbeitete, nicht vorstellen. Mir ist natürlich bewusst, dass ich damals vieles in das Parteien-Denken hineininterpretiert habe, was in Wirklichkeit gar nicht drin war. Aber an meiner Grundeinstellung hat sich nichts geändert. Wer viel arbeitet, muss auch viel Geld verdienen, ohne dass ihm der Staat das Meiste wieder über die Steuern und Abgaben wegnimmt.
Aber warum kam wieder neue Unruhe in mein Leben? Als Parteimitglied der CDU war ich damals ganz schnell, ohne dass ich das überhaupt wollte, zum Ortsvorsitzenden des CDU-Ortsverbandes Altenwalde gewählt worden. Schon sehr bald danach kamen meine Parteifreunde auf mich zu und baten mich für den Gemeinderat Altenwalde zu kandidieren. Gut, sagte ich mir, wenn du schon von der Allgemeinheit lebst, und das tat ich ja, dann musst du auch der Allgemeinheit etwas zurückgeben. Ohne lange zu zögern, gab ich damals mein Einverständnis. Schließlich musste ich ja erst einmal gewählt werden. Das passierte aber prompt. Da Altenwalde Anfang der siebziger Jahre in die Stadt Cuxhaven eingemeindet wurden, saß ich auf einmal im Stadtrat von Cuxhaven. Das war eine Arbeit, an die ich mich erst einmal gewöhnen musste. Aber nach einer kurzen Einarbeitungszeit fühlte ich mich auch da ganz wohl und begann, konstruktiv mitzuarbeiten. Ich wurde ordentliches Mitglied im Kur- und Verkehrsausschuss. In zwei anderen Ausschüssen wurde ich Vertreter.
Ich war dann insgesamt neun Jahre im Stadtrat. Für mich war das eine außergewöhnlich lehrreiche Zeit, in der ich viele interessante Leute aus der Politik und der Wirtschaft Cuxhavens kennenlernen durfte. Zunächst war die Arbeit für mich erträglich und ich konnte das alles mit den immensen Aufgaben in meiner Firma vereinbaren, weil alle Sitzungen erst nach 18 Uhr begannen. Bald aber begannen diese Sitzungen schon um 16 Uhr und irgendwann um 14 Uhr. Manche Sitzungen, des Verkehrsausschusses zum Beispiel, wurden sogar schon am Vormittag (bei Verkehrsschauen) angesetzt, also einer Zeit, wo ich als Unternehmer dringendst in meinem Betrieb benötigt wurde.
Meine Jutta, der wirklich nichts zu viel war und die sich ansonsten so schnell über nichts beschwerte, sagte mir kurz vor Ablauf meiner 2. Legislaturperiode:
„Du, Paule, solltest du noch einmal auf die Idee kommen, dich für die Wahl zum Stadtrat aufstellen zu lassen, dann kannst du dir auch gleich eine neue Frau suchen. Du sagst zwei bis drei Mal in der Woche „Tschüss, ich muss ins Rathaus“, und ich kann dann sehen, wie ich mit dem Betrieb alleine klarkomme. Das mache ich nicht mehr mit!“
Das war eine klare Ansage. Da ich aber in meinem Leben auf Vieles verzichten konnte, nur auf mein Juttalein nicht, wusste ich natürlich, meine politische Laufbahn war am Ende! Eine weitere Kandidatur kam für mich nicht mehr in Frage.
Auf einer dieser politischen Sitzungen, ich glaube noch zu wissen, dass es eine Fraktionssitzung war, wurde ich von meinem älteren Parteifreund und dem ersten Bürgermeister der Stadt, Hans-Joachim Wegener, vertraulich angesprochen.
Er sagte mir: „Du, Paul, ich soll dir vom Oberstadtdirektor Dr. Eilers und vom Kurdirektor Hans Demgen einen Gruß bestellen. Beide würden dich gerne einmal vertraulich zu einem Gespräch in Sachen Kurbetriebe bitten. Wenn du möchtest, dann würde ich dich gerne zu diesem Gespräch begleiten.“
Dankend nahm ich dieses Angebot an. Hans-Joachim Wegener war für mich eine äußerst vertrauenswürdige Person. Von Beruf war er Oberstudienrat und in der Kommunalpolitik kannte er sich auf Grund seiner längeren Zugehörigkeit besser aus als ich. Außerdem war er mir sehr sympathisch.
Das Gespräch fand dann einige Tage später in der Kurverwaltung bei dem damals gerade frisch gewählten Kurdirektor Hans Demgen statt. Hans Demgen, den ich auch sehr sympathisch fand und der im Rathaus zu meinen besseren Freunden zählte, ließ uns Platz nehmen und bot uns Kaffee und Plätzchen an. An dem Gespräch nahm aber, für mich damals sehr überraschend, der Direktor eines hiesigen Geldinstitutes teil. Nach dem Austausch der üblichen Freundlichkeiten kam der Kurdirektor dann direkt zur Sache. Zunächst lobte er sehr ausführlich und umfangreich meine bisherige Arbeit in Cuxhaven im Zusammenhang mit dem Kurgastaufkommen. Natürlich hörte ich das sehr gerne und es machte mich auch ein wenig stolz. Doch nun war ich sehr gespannt, was die Herren eigentlich von mir wollten. Darauf kam Hans Demgen dann auch zu sprechen.
„Du warst ja schon in den letzten Jahren mit in der kommunalen Politik tätig und weißt deshalb auch, dass die vorher selbstständigen Gemeinden Altenbruch, Lüdingworth, Altenwalde mit Oxstedt, Berensch und Ahrensch sowie Sahlenburg in die kreisfreie Stadt Cuxhaven eingemeindet wurden.“
Die Spannung im Raum nahm zu, und ich wusste aber immer noch nicht, was die Herren von mir wollten. Deshalb fragte ich nun auch etwas ungeduldig: „Das weiß ich doch alles. Was kann ich daran noch tun?“
„Moment“, sagte Hans Demgen, „darauf komme ich jetzt sofort zu sprechen.“ Dann räusperte er sich noch einmal und suchte nach den richtigen Worten.
„Also, wie du ja auch weißt, ist Cuxhaven ein Nordseeheilbad. Genau genommen trifft das aber nur auf den Ortsteil Duhnen zu. Warum? Um das Prädikat „Nordseeheilbad“ zu bekommen, müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Unter anderem muss jeder Kurteil über ein Kurmittelhaus mit festgelegten und ortsgebundenen Heilmitteln verfügen. Das heißt für Cuxhaven mit Seewasser und Meeresschlick. Im Kurteil Duhnen betreiben wir selber als Kurverwaltung ein solches. In Döse haben wir nun auch dank deiner Initiative eines, wenn auch ein sehr kleines. Nur im neu dazugehörenden Sahlenburg, da haben wir noch keins. Dank deiner Aktivität durch den von dir eingerichteten Fahrdienst ist das höheren Orts nur noch nicht aufgefallen.“
Dann machte er eine Pause. Einer schaute den anderen an. Ich hatte immer noch nicht so richtig begriffen, was die anderen von mir wirklich wollten. Als es mir so langsam zu dämmern begann, fragte ich:
„Soll das etwa heißen, dass ich nun auch noch in Cuxhaven-Sahlenburg ein KMH bauen soll? Nee, Leute, das könnt ihr ganz schnell vergessen, da mache ich nicht mit. Wisst ihr eigentlich, wie viele Schulden ich mir mit dem KMH-Döse aufgeladen habe? Das muss ich erst einmal abbezahlen, dann können wir wieder miteinander über ein KMH-Sahlenburg reden. Aber nicht vorher und nicht jetzt!“
Nun meldete sich zum ersten Mal der Direktor des Geldinstituts zu Wort und sagte ein paar Sätze, die ich niemals vergessen habe. Die Versprechen, die diese Worte enthielten, sind niemals von irgendjemandem eingehalten oder eingelöst worden. Schon gar nicht von ihm selbst! Doch darauf werde ich noch zurückkommen.
Er fing an: „Lieber Herr Gojny.“ Später wusste ich, wenn ein Banker mit dieser salbungsvollen Anrede anfängt, ist äußerste Vorsicht geboten! Dann führte er weiter aus:
„Natürlich weiß ich, dass Sie auf Grund Ihres KMH-Neubaus in Döse Verpflichtungen haben. Die Darlehenshöhe spielt dabei doch nicht die entscheidende Rolle, sondern entscheidend ist, ob Sie den übernommenen Kapitaldienst auch bedienen können. Sie haben aber damit, soweit mir bekannt ist, noch keinerlei Probleme gehabt. Bisher haben Sie immer, und das gilt auch für die Sie finanzierende Bank des „Altenwalder Kurbades“, immer pünktlich den vereinbarten Zins- und Tilgungsbetrag gezahlt.“
„Natürlich“, sagte ich, „das soll auch so bleiben. Deshalb werde ich auch kein höheres Risiko mehr eingehen. Wenn ihr, das heißt die Stadt, ein Kurmittelhaus in Sahlenburg braucht, warum baut ihr das dann nicht selber?“
Hans Demgen antwortete mir: „Das geht leider nicht. Wir bauen doch gerade jetzt in Duhnen ein neues. Damit sind wir als Kurverwaltung am Limit. Als Teil der Kommune sind wir da sehr eingeschränkt und dürfen uns aus gesetzlichen Gründen nicht überschulden. Bei dir als Privatperson ist das natürlich ganz anders. Du musst nur einen Geldgeber finden, der dir das nötige Vertrauen schenkt und das Ganze finanziert. Da du offensichtlich bei dem hier anwesenden Geldinstitut unbegrenztes Vertrauen genießt, dürfte das für dich kein Problem sein.“
„Ja“, sagte ich, „das mag ja so sein, so lange alles gut läuft und bei mir genügend Geld verdient wird. Aber was ist, wenn wir mal eine schlechte Saison haben und bei mir nicht genügend Arbeit vorhanden ist und somit nicht genügend Geld reinkommt, so dass ich dann meinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann?“
„Lieber Herr Gojny, das ist doch dann auch kein Problem für Sie. Wir stehen doch als Ihr finanzierendes Geldinstitut dahinter. In einem solchen Fall würden wir dann zu Ihren Gunsten und mit Ihnen ein sogenanntes Zins- und Tilgungsmoratorium vereinbaren.“
„Was ist denn das?“, warf ich schnell ein.
„Das ist eine Vereinbarung über die Aussetzung des Kapitaldienstes und zwar so lange, bis Sie wieder flüssig sind. Das ausgesetzte Kapital, d.h. die eigentlich fälligen Zins- und Tilgungsraten werden dann hinten wieder drangehängt. Sie zahlen dann also nicht mehr, sondern nur die vorher ausgesetzte Zeit länger. Sehen Sie, wenn Sie der Stadt Cuxhaven einen so großen Gefallen tun, dann unterstützen wir Sie als hiesiges Bankhaus natürlich auch mit allem, was in unserer Macht steht. Dass wir Ihnen für das Objekt in Sahlenburg eine besonders günstige Finanzierung erstellen werden, versteht sich von selbst, lieber Herr Gojny.“
Nun nahm ich mir erst einmal eine gewisse Zeit des Überlegens. Dafür brauchte ich erst einmal einen kräftigen Schluck Kaffee. Dann schaute ich ganz gezielt und bewusst meinen Parteifreund und ersten Bürgermeister Hans-Joachim Wegener, zu dem ich das größte Vertrauen hatte, an und fragte ihn: „Hans-Joachim, du hast hier soeben alles mitverfolgt. Was würdest du denn an meiner Stelle machen? Ehe du mir antwortest, bedenke bitte auch, dass ich zu Hause eine Frau und drei kleine Kinder habe.“
Hans-Joachim setzte sich zunächst einmal auf seinem Sessel zurecht, in dem er seine beiden Beine übereinanderlegte. Dann zog er ein, zwei Mal an seiner wunderbar riechenden Zigarre. Nachdem er den Tabakqualm bedächtig in Richtung Decke blies, antwortete er mir genauso bedächtig:
„Mein lieber Freund Paul. Du solltest etwas systematischer an die Sache herangehen. Erst einmal stellen wir fest: Die Stadt und die Kurverwaltung brauchen dich. Ohne dein Mittun, kein Kurmittelhaus in Sahlenburg. Aber ohne Kurmittelhaus, kein Nordseeheilbad Cuxhaven-Sahlenburg. Das wäre eine Benachteiligung der Sahlenburger Bürger. Laut des geschlossenen Grenzänderungsvertrags ist das seitens der Stadt ein klarer Verstoß gegen diesen. Also muss ein KMH-Sahlenburg her. Das bedeutet, dass du bei diesem Spiel erst einmal gute Karten hast. Also dreht sich nun erst alles um das liebe Geld.“
Dann nahm der gute Hans-Joachim erst einmal wieder ein paar kräftige Züge aus seiner guten Zigarre. Als er den Qualm wieder gen Himmel geblasen hatte, sprach er in seiner bedächtigen Art weiter:
„Nun habe ich ja mitgehört, was Herr Graf hier eben ausgeführt und dir auch versprochen hat. Keine Frage, wenn das eingehalten wird, ist das insgesamt gesehen ein sehr gutes Angebot, bei dem dir eigentlich, auch unter widrigen Umständen, nichts passieren kann. Die Fragen, die meines Erachtens jetzt noch offen sind, kannst du, so glaube ich, nur gemeinsam mit deiner lieben Jutta klären. Ihr müsst euch fragen: Können wir das alles so organisieren, dass auch der dritte Betrieb bestens und in jeder Hinsicht mit betreut werden kann? Vor allem aber, wollt ihr überhaupt noch einen zusätzlichen Betrieb? Es muss ja auch noch ein wenig Zeit für euer Familienleben bleiben.“
Dann machte er wieder eine Pause und schloss seine kleine Rede: „Lieber Paul, als erster Bürgermeister dieser Stadt muss ich natürlich ein Interesse daran haben, dass Sahlenburg den Status Nordseeheilbad behält und ihn nicht verliert. Dazu brauchen wir aber das KMH-Sahlenburg. Also brauchen wir jetzt dich.“
Dann räusperte er sich und nach einer weiteren kleinen Pause sagte er: „Tu mir den Gefallen und denk im positiven Sinne darüber nach. Mehr können wir hier und heute nicht von dir verlangen.“
Ich versprach ihm und den beiden anderen Herren das auch wirklich zu tun. Aber ich erbat mir eine Woche Bedenkzeit. Beim Abschied von Herrn Graf sagte ich ihm noch:
„Bedenken Sie dabei bitte auch, dass das eine 100%ige Finanzierung sein muss und ein Grundstück dafür benötige ich dann auch noch.“
Herr Graf schüttelte mir zum Abschied die Hand und antwortete mir: „Herr Gojny, das lassen Sie mal alles unsere Sorge sein. Die Stadt will etwas von Ihnen, also wird man Ihnen beim Lösen der Probleme inklusive Grundstück auch helfen.“
Wir verabschiedeten uns dann sehr freundlich voneinander. Als ich von dieser denkwürdigen Sitzung nach Hause kam, berichtete ich alles haargenau meiner lieben Jutta, die über den Büchern saß. Wie immer wuselten die Kinder um sie herum. Jutta hörte sich das alles sehr aufmerksam an. Dann stand sie auf und sagte in ihrer typischen Art:
„Ich glaube, das Beste wird sein, dass ich erst einmal einen Kaffee koche. Beim Kaffeetrinken kann ich besser überlegen.“
Als der Kaffee, den wir in unserem mittlerweile sehr großzügig an- und ausgebauten Wintergarten tranken, vor uns stand, sagte Jutta:
„Vorweg grundsätzlich noch mal Eines. Ich habe bislang immer alle deine Entscheidungen mitgetragen und nach besten Kräften unterstützt. Das wird auch immer so bleiben. Das ist sicher mal wieder eine ganz schwierige Entscheidung. Da ganz offensichtlich das Ganze von deinen politischen Freunden, wie Hans-Joachim Wegener und anderen, unterstützt wird; die Finanzierung ganz offensichtlich zu günstigen Konditionen durch ein hiesiges Geldinstitut sichergestellt wird, klingt das alles doch gar nicht schlecht. Dadurch, dass du dich nicht mehr zur Wahl für den Stadtrat aufstellen lässt, bekommst du wieder mehr Zeit für uns und den Betrieb. Die lästigen Fahrten mehrmals am Tag nach Sahlenburg fallen dann auch noch weg. Also, mein Schatz, wie immer deine Entscheidung ausfällt, ich werde dahinterstehen!“
Ich war regelrecht verblüfft. Jutta hatte noch nie so lange argumentiert. Außerdem hatte ich mit sehr langanhaltendem Widerstand gerechnet. Spontan stand ich auf, ging um den runden Esstisch und nahm mein Juttalein ganz herzlich in die Arme. Dann sagte ich ihr:
„Okay, dann werden wir das machen. Wir haben bislang zwei gut laufende Betriebe miteinander aufgebaut, dann werden wir den dritten auch noch schaffen. Hoffentlich halten dann auch alle ihr Wort, wenn es mal nicht so gut läuft.“
Mit meinen heutigen Erfahrungen, die ich aber damals noch nicht ansatzweise hatte, wäre mir später so mancher Ärger erspart geblieben. So aber habe ich blind auf die damaligen Versprechen des Herrn Bankdirektor Graf vertraut und bin mehr als blauäugig an dieses Projekt, was ich eigentlich gar nicht geplant hatte, rangegangen.
Nachdem ich mir die Zustimmung von Jutta geholt hatte, rief ich meinen Parteifreund Wegener an und teilte diesem als Ersten mit, dass ich mich mit meiner Jutta entschlossen hatte, das KMH-Sahlenburg zu bauen. Zunächst hielten alle ihr Wort und hielten sich an die mir gegebenen Versprechen. Das Bankhaus von Herrn Graf machte mir ein günstiges Finanzierungsangebot über eine Summe von 2,5 Mio. DM. Ausreichend, um das von mir und meinem Bruder Gerhard, der für mich wieder einmal als Architekt arbeitete, geplante KMH zu errichten. Die Stadt selbst war Eigentümer eines geeigneten Grundstücks. Es war das Gelände auf dem während des Dritten Reichs die Baracken des Reichsarbeitsdienstlagers standen. Nach dem Krieg waren sie dann abgerissen worden. Das Gelände lag direkt an der Nordheimstraße in unmittelbarer Nähe des damaligen Dorfmittelpunktes. Schräg gegenüber hatte ein Arzt eine neue große und moderne Praxis gebaut. Da er auch Bade- und Kurarzt war, passte das alles sehr gut. Sein Vater, auf dessen Wunsch ich die Kurgäste immer von Sahlenburg nach Altenwalde zu den Kuranwendungen holte, war zu der Zeit leider schon verstorben.
Im Herbst 1980 war dann Baubeginn. Ausführende Firma war die damals sehr bekannte und gut arbeitende Baufirma Schacht.
Da ich mich doch noch aus verschiedenen Gründen entschlossen hatte, statt einer 100%igen Baufinanzierung eine „nur 80%ige“ zu machen, musste ich eine Eigenleistung von 20%, das heißt, Leistungen im Wert von ca. 400 bis 500 TDM erbringen. Das wiederum machte es notwendig, dass ich von Baubeginn an auf meiner neuen Baustelle in Sahlenburg mitarbeitete. Da ich unter Anleitung meiner alten Freunde, Gustav Wittkowski und Willi Bergmann, zu einem guten Bauhandwerker geworden war, konnte ich alle Fliesenlege-, Holzvertäfelungs- sowie alle Pflasterarbeiten selber machen. Damit ich nachweisen konnte, was ich da an Eigenleistung erbracht hatte, hatte mein Bruder Gerhard diese Arbeiten mit ausgeschrieben, aber mit dem Hinweis, dass diese Gewerke unter Umständen vom Bauherrn selber erbracht werden. Während dieser Bauzeit war ich also Unternehmer und Bauhandwerker zugleich. Für mich war das mal wieder eine knochenharte Zeit. Wie lautete noch der Spruch meiner Oma? „Junge, du kannst im Leben alles erreichen. Du musst es nur fest genug wollen!“
Meinen ältesten Sohn Martin muss ich hier noch ganz besonders erwähnen. Eines Tages, ich war gerade dabei, im Untergeschoß in der Bäderabteilung Fliesen zu verlegen, als plötzlich Martin, mittlerweile fünfzehn Jahre alt, neben mir stand und mich fragte: „Papa, kann ich dir hier mithelfen?“
„Natürlich, mein Junge, kannst du das. Aber nur, wenn dir deine Schule Zeit dazu lässt.“
„Ja, Papa, das tut sie, sonst wäre ich gar nicht hier. Ich würde, wenn ich mir dabei etwas Geld verdienen kann, jeden Tag zwei bis drei Stunden und an den Wochenenden auch mehr hier bei dir arbeiten.“
Dann zögerte er einen Moment, sprach dann aber mit einem unüberhörbaren Unterton von Trotz in der Stimme weiter. „Weißt du, Papa, ich will mir unbedingt ein Moped kaufen.“
Nun musste ich wirklich überlegen, was ich meinem Jungen antworten sollte. Einerseits war ich wegen der Unfallgefahr ein wirklicher Gegner dieser Zweiräder. Das wusste auch Martin. Aber andererseits war ich in dem Moment so stolz auf meinen Jungen und fühlte mich in die alte Zeit von Rühlertwist versetzt, wo ich mir ja auch das Geld für ein altes Fahrrad zusammenverdient hatte. Nun gut, die Zeiten hatten sich, Gott sei es gedankt, verändert. Damals war es ein Fahrrad, heute ist es eben ein Moped. Ich hatte durch das Fußbodenfliesen bis dahin auf den Knien gearbeitet. Nun streckte ich Martin die Fliesenkleber verdreckte Hand hin, die er ohne zu zögern ergriff, um mich dann hochzuziehen. Als ich dann auf meinen Beinen stand, gab ich meinem Martin nochmal die Hand und sagte ihm:
„Junge, du weißt, dass ich dir viel lieber ein paar Jahre später ein Auto kaufen würde, weil ich die nicht für ganz so gefährlich halte wie die Mopeds. Aber ich weiß ja, das dauert dir noch viel zu lange. Da ich hoffe, dass du auch mit einem Moped verantwortungsbewusst umgehen wirst, bin ich damit einverstanden.“
Von nun an, das werde ich nie vergessen, war Martin, mein ältester Sohn, immer an meiner Seite. Nicht nur dass er da war, er arbeitete wirklich sehr hart mit mir zusammen. Die Schule hat er dadurch auch nicht vernachlässigt. Manchmal tat er mir richtig leid. Ich erinnere mich an ein unvergessliches Ereignis. Es war am Heiligen Abend. Wir hatten den ganzen Vormittag im zukünftigen Bewegungsbad gefliest und es waren nur noch wenige Quadratmeter aufzubringen. Die wollten wir aber unbedingt fertigmachen. Mit letzter Kraft schafften wir beide das auch. Als wir dann zu Hause waren und geduscht hatten, mussten wir noch etwa eine Stunde warten, bis unsere liebe Jutta den Weihnachtskarpfen auf den Tisch brachte. Als der Karpfen dann auf dem Tisch stand, waren wir beide auf der Couch eingeschlafen.
Martin möchte ich an dieser Stelle für seinen einmaligen und für mich unvergesslichen tollen Einsatz danken. Natürlich hat er dann auch sein gewünschtes Moped erhalten. Irgendwann wurde dieses dann gegen einen VW Golf umgetauscht.
Da ich, wie schon erwähnt, bei diesem Bau sehr viele Eigenleistungen erbringen musste, dauerte das natürlich auch seine Zeit. Durch das große Bewegungsbad und andere aufwendige Installationen, wie Schlick- und Meerwasserbäder, sowie die damit zusammenhängenden Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen dauerte es bis zur Fertigstellung des KMH-Sahlenburg noch bis Anfang 1983. Wir brauchten damals zwei volle Jahre bis zur Inbetriebnahme. Es war dann aber auch ein sehr schönes, sich der Umgebung anpassendes Haus. Die Kureinrichtungen waren perfekt und funktionell gestaltet.
Zum leitenden Therapeuten und Betriebsleiter wurde von mir der bei uns schon einige Jahre arbeitende Albert Hüllinghoff berufen. Außer ihm arbeiteten noch vier weitere Therapeuten und drei Hilfskräfte im Sahlenburger Betrieb. Mit den Betrieben in Altenwalde, Döse und Sahlenburg, einschließlich der Reinigungs- und Verwaltungskräfte, arbeiteten dann schon ca. 25 Personen in unserem Unternehmen.
Die erste Saison mit nun drei Betrieben verlief dann auch sehr gut. Auch das KMH-Sahlenburg war ein voller Erfolg. Wir eröffneten es und 14 Tage später war es ausgebucht. Der Andrang von Kurgästen in Cuxhaven war überwältigend. Natürlich machten wir in unseren drei Betrieben, aber auch die Kurverwaltung in Duhnen, fachlich sehr gute Arbeit. Das sprach sich in Fachkreisen sehr schnell herum. Aber das konnte den überaus großen Andrang in Cuxhaven an Kurgästen auch nicht erklären. Die Krankenkassen selbst waren für den übergroßen Andrang verantwortlich. Mit der Werbung für die sogenannte „Offene Badekur“ jagten sie sich selbst die Mitglieder ab. Wenn ein Familienmitglied wegen seines geschädigten Rückens oder seiner angegriffenen Bronchien eine Vorsorge- oder Reha-Kur brauchte, schickten sie gleich die ganze Familie zur Kur. Hier wurde von den Krankenkassen selbst das Geld, also die Mitgliedsbeiträge, zum Fenster hinausgeworfen.
Mir machte die ganze Situation regelrecht Angst. Deshalb dachte ich auch schon seit geraumer Zeit darüber nach, wie ich mir ein, wirtschaftlich gesehen, zweites Standbein zulegen könnte. Ein Jahr später kam dann die von mir schon länger befürchtete Katastrophe. Das Wetter spielte in dem Jahr komplett verrückt. Es regnete praktisch das ganze Jahr. Das Wort Hauptsaison mag ich im Hinblick auf diesen verregneten Sommer gar nicht in den Mund nehmen. In Sahlenburg hatten wir während der ersten Saison, inklusive der Bewegungsbäder-Gruppen, bis zu 150 Behandlungen täglich. In der Saison danach waren es, wenn es gut lief, gerade mal 50. Mit den Erlösen konnte ich nicht einmal mehr die Mitarbeiter bezahlen, geschweige denn die Nebenkosten und den Kapitaldienst. Gott sei es gedankt, hatte ich das Altenwalder Kurbad wirtschaftlich von den anderen beiden Betrieben getrennt. Somit war das wegen seiner größeren Saison-Unabhängigkeit sicherer.
Nun marschierte ich zum ersten Mal zu meiner mich in Sahlenburg finanzierenden Bank, um an die mir gegebenen Versprechen des Bankdirektors Graf zu erinnern. Was ich dann von dort erfuhr, war niederschmetternd.
„Wie Sie ja wissen, lieber Herr Gojny, hat Herr Direktor Graf uns schon vor mehr als einem Jahr verlassen. Von einem solchen Versprechen ist uns leider gar nichts bekannt.“
Auch die Stadt konnte oder wollte mir nicht helfen. Spätestens da war mir klar, was für einen furchtbaren Fehler ich in meiner Gutgläubigkeit und Unerfahrenheit etwa drei Jahre zuvor gemacht hatte. Natürlich hätte ich mir die Zusagen des Herrn Graf sofort schriftlich geben lassen müssen! Darüber hinaus hätte ich mir von der Stadt eine Bürgschaft über die gesamte Bausumme geben lassen müssen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich noch zu dumm und unerfahren. Von da an lies ich mir alles, aber auch wirklich alles, was ich mit Banken besprach oder vereinbarte, schriftlich geben, was im Übrigen die Banken ausnahmslos auch immer taten. Durch diesen für mich schwerwiegenden Vorfall zeigte sich spätestens, dass mir doch eine solide kaufmännische Grundausbildung fehlte, die ich ab sofort immer mehr vermisste.
Auf alle Fälle setzte die Bank den Zins- und Tilgungsdienst nicht aus. Nein, sie machte aus meiner unverschuldeten Notlage noch ein weiteres Geschäft. Aus den von mir nicht erbrachten Zinsen machten sie einen neuen Kreditvertrag, der natürlich auch wieder verzinst werden musste. In der Praxis sah das dann so aus: Wenn ich in einem Jahr die Zinsen von DM 50.000 nicht zahlen konnte, wurde über diese Summe ein neuer zusätzlicher Kreditvertrag abgeschlossen, der dann natürlich wieder verzinst werden musste. Wenn ich dann kein gutes Folgejahr hatte, verschuldete ich mich auf diese Art und Weise immer mehr. Ein wahrer Teufelskreis. Und ich musste dafür noch dankbar sein, sonst wären zumindest meine beiden Kurbetriebe in Döse und Sahlenburg den Bach runtergegangen.
Dann gab es da noch etwas, was mir damals an den Kurbetrieben beziehungsweise an der physikalischen Therapie unglaublich „gestunken“ hat. Es waren die Preise, die wir von den Krankenkassen für unsere Leistungen erstattet bekamen. Die Krankenkassen selbst forderten von den Kurbetrieben sehr hohe Leistungsstandards. Sie waren aber nicht bereit, dann für die erbrachten Leistungen auch kostendeckende Preise zu zahlen. Da ich aufgrund der Größe meiner Betriebe selber mit den Krankenkassen verhandeln musste, kann ich ein Lied davon singen, wie es bei den sogenannten Vergütungsverhandlungen mit den Krankenkassen zuging. Einigermaßen fair ging es bei den Ersatzkassen zu. Die hörten sich zumindest noch meine Gründe für Erhöhungen, wie Lohn-, Strom-, Wasser-, Abwasser-, Versicherungskosten, usw. an. Aber soweit ich mich erinnere, hatten auch diese von irgendeiner übergeordneten Dienststelle genaue Order, wie weit sie einer Erhöhung der Preise zustimmen konnten. Zu echten Verhandlungen kam es deshalb, wie man es aus den Tarifrunden kennt, auch nicht.
Aber bei der Landeskrankenkasse, in deren Räumen die „Vergütungsverhandlungen“ immer stattfanden, gab es überhaupt keine Verhandlung. Die Herrschaften dort legten mir lediglich ihre vorher gefertigte Preisliste auf den Tisch, natürlich ohne sich anzuhören, warum und weswegen wir für unsere Arbeit mehr Geld bekommen mussten. Dann hieß es: „Friss, Vogel, oder stirb“. Das nannten diese Herrschaften dann Preisverhandlung. Da ich das aber mit mir nicht mehr machen lassen wollte, nahm ich zu einer solchen „Verhandlung“ einen Rechtsanwalt mit. Es war ein ehemaliger bekannter Landespolitiker. Er war Fachanwalt für Wirtschaft- und Sozialrecht. Schon seine bloße Anwesenheit schockte meine „Verhandlungspartner“. In der Sache selbst hat das auch nicht viel gebracht. Es gab dann auch wieder keine Preiserhöhung. Aber nun hatte ich einen Zeugen, und er hatte gesehen, was meine „Verhandlungspartner“ unter Preisverhandlungen verstanden. Zusammen mit dem Rechtsanwalt und einem weiteren Fachanwalt aus Gelsenkirchen klagte ich gegen diese Art der Verhandlung und setzte letztlich meine Preise vor dem Landessozialgericht durch. Auch dazu fiel mir wieder ein alter Spruch meiner Großmutter ein: „Wer sich als Pfannkuchen gibt, der wird auch als Pfannkuchen gefressen!“
Aber bezüglich meiner Kurbetriebe kam ich immer mehr ins Grübeln. Hatte ich auf das richtige Pferd gesetzt? War das auf Dauer die richtige Branche? Zusammen mit meiner Jutta traute ich mir damals noch viel mehr zu. Noch waren Jutta und ich jung genug, wir waren Anfang/Mitte 40, um noch etwas Neues und vor allem Anderes anzufangen. Im Hinterkopf hatte ich schon seit langem einen geheimen Plan. In meinen Praxen arbeiteten wir schon längere Zeit mit unserem ortsgebundenen Heilmittel „Nordseeschlick“. Zunächst ließ ich mir, noch bevor jemand anderer aus Cuxhaven, besonders aus der Kurverwaltung, auf die Idee kam, an der technischen Universität in München eine große Schlickanalyse machen. Diese kostete damals schon sehr viel Geld. Sie war aber unbedingt notwendig, um den hochwirksamen Nordseeschlick am Menschen anzuwenden. Das wollte ich tun, und zwar in Form von Einmal-Schlickpackungen. Das Ergebnis der Analyse war sehr gut und erlaubte mir, den sofortigen gefahrlosen Einsatz von Nordseeschlick am Menschen. Was ich nun noch für meine Kurbetriebe brauchte, war eine praktikable und kostengünstige Anwendungsmöglichkeit für Meeresschlick am Patienten. Zunächst schaute ich verstärkt auf den Bereich Schlickpackungen zur lokalisierten Anwendung am Körper. Auf einem Kongress für physikalische Therapie in Travemünde lernte ich einen Österreicher aus Salzburg kennen. Er besaß eine Firma, in der er zusammen mit seinem Bruder Jochen eine spezielle Einmal-Moorpackung herstellte. Was mich an diesem Packungssystem interessierte, war die außergewöhnlich günstige Art, diese Packung am Körper anzulegen. Die Packung bestand aus zwei Teilen. Der eine Teil war der Wärmeträger. Dieser bestand aus einer sehr kräftigen, aber weichen und anschmiegsamen Kunststofffolie. Dieser Wärmeträger wurde vor Gebrauch in einem heißen Wasserbad auf ca. 40° C erhitzt. Der zweite Teil war die eigentliche Packung. Sie bestand aus einer Folie, auf die eine ca. 10 mm dicke Moorschicht aufgetragen war. Darüber war ein hauchdünnes Vliestuch angebracht, das an den Rändern mit der untenliegenden Folie verschweißt war, so dass das Moor zwischen Folie und Vlies lagerte.
Die Größe der Packung war etwa 25 x 30 cm. Zwei solcher Packungen, nebeneinanderliegend, reichten für eine Rücken-Packung normalerweise aus. Angelegt wurde diese Art von Packung wie folgt: Auf der Massageliege wurde zunächst ein frisches Laken glatt ausgebreitet. Dann holte die Hilfstherapeutin den oder die heißen Wärmeträger. Die wurden nun auf die Packungs-Liege gelegt. Darüber kamen die eigentlichen Packungen mit der Folienseite nach unten. So gut vorbereitet, wurde nun der Patient mit der zu behandelnden Körperfläche auf die Packung gelegt und mitsamt der Packung in das darunterliegende Laken eingewickelt. Wenn Nacken und Knierollen zur bequemeren Lagerung untergelegt waren, wurde dann über dem Patienten noch eine flauschige Decke ausgebreitet.
Die Wirkung der Packung entwickelte sich folgendermaßen: Der Patient lag entspannt auf seiner Packung. Die Wärme stieg erst ganz langsam vom Wärmeträger durch die Packung und gelangte so mit ansteigender Wärme, der Fachmann sagt aszendierende Wärme, an den Körper und entfaltete so seine heilende und schmerzlindernde Wirkung. Durch das Gewicht des Körpers wurde der halbflüssige Schlick (oder Moor) durch das obenliegende Vlies gedrückt. Dadurch hatte das Naturpeloid direkten Hautkontakt. Bei anderen Packungsarten musste sich der Patient ganz direkt auf das heiße Peloid (Packungsmasse) legen. In dem Fall zieht sich die Haut schlagartig zusammen, d.h. sie macht dicht und kein Wirkstoff kann mehr eindringen und zur Wirkung kommen.
Bei dieser neuartigen Packungsart war das genau andersherum. Die einschleichende Wärme öffnete die Haut und mit ihr wurden die Wirkstoffe durch die Haut geschleust. Man kann somit von einem Schleusen-Effekt sprechen. Nach etwa einer halben Stunde wurde dann die Packung wieder abgenommen und die Haut von eventueller Verunreinigung mittels eines nassen Waschlappens befreit. Danach konnte der Therapeut sofort mit seiner Massagetherapie beginnen. Die Packung selbst wurde weggeworfen. Der Wärmeträger wurde abgewaschen und für die nächste Behandlung wieder auf 40°C erhitzt.
Diese Art der Packungsanwendung hat mich sofort begeistert. Vor allem aber glaubte ich, dass man diese Art von Packung auch als „Einmal-Nordseeschlickpackung (ENSP)“ herstellen könnte. Mit dem Österreicher, ein äußerst sympathischer Typ, kam ich darüber schnell ins Gespräch.
Er sagte: „Das Beste und Einfachste wäre, du kommst einmal mit ein paar Fässern frischem Nordseeschlick nach Österreich und wir probieren dort, ob wir auf meinen Maschinen auch Nordseeschlickpackungen herstellen können. Sollte uns das gelingen, machen wir einen Lizenzvertrag und du bekommst zum Fertigen der ENSP eine von meinen Herstellungsmaschinen nach Cuxhaven.“
Da ich immer ein Mann von guten Ideen war und vor allem wusste, wie man diese auch schnell umsetzen konnte, besorgte ich mir in Cuxhaven ein paar Plastiktonnen aus der Fischindustrie und reinigte diese sehr gründlich. Mit ein paar Freunden fuhr ich nach Spieka-Neufeld an den Deich und belud meine gesäuberten Heringsfässer mit frischem Nordseeschlick. Dann kamen diese gut verschlossen in meinen schon betagten Mercedes Sprinter. Und schon war ich mit meiner Jutta und voll beladen mit Schlick unterwegs nach Salzburg. Die Fahrt dorthin ging trotz des großen Übergewichts problemlos bis an die deutsch-österreichische Grenze. Der deutsche Zoll winkte uns so durch. Der österreichische Zoll wollte unbedingt wissen, was da in meinen blauen Fässern drin ist. Bereitwillig und ohne Furcht gab ich Auskunft: „Da ist Meeresschlick drin.“
„Was ist da drin?“, fragte mich der Zöllner wieder.
Mir begann das Ganze Spaß zu machen. Deshalb antwortete ich diesmal mit einem breiten Grinsen im Gesicht: „In den Fasserln ist frischer Nordseeschlick herrinnen, Herr Inspektor!“
Offensichtlich fühlte er sich nun von mir verschaukelt. Mit strengem Blick zeigte er nun mit dem Zeigefinger auf einen freien Platz hinter der Kontrollstelle. Dabei sagte er: „Fahren Sie da mal raus.“
Was ich dann, obrigkeitshörig wie ich nun einmal erzogen war, auch sofort tat. Als ich mein Fahrzeug auf der zugewiesenen Stelle einparkte, kamen sofort der mir nun schon bekannte Zöllner und ein anderer Kollege zu meinem Auto. Der andere führte einen Hund mit sich. Ich musste nun alle Türen meines Autos öffnen, damit der Hund auch überall ungehindert herumschnüffeln konnte. Trotz seiner sehr gewissenhaften Schnüffel-Inspektion fand er nichts. Der erste Zöllner wollte sich aber noch nicht zufriedengeben. Er sagte an mich gewandt: „Moment noch“, und verschwand in der Zollbude. Nach einem kurzen Moment kam er mit einer etwa ein Meter langen, dünnen Eisenstange wieder heraus und befahl mir, ziemlich barsch: „Fässer auf!“.
Bereitwillig stieg ich nun über die Schiebetür in mein Fahrzeug und öffnete meine sechs Schlickfässer. Nach dem Öffnen verbreitete sich sofort in meinem Auto ein angenehmer Duft nach Hafen, Seetang und Meer. Nach Cuxhaven eben!
Nachdem ich ausgestiegen war, kletterte der Zöllner in meinen Wagen. Dann steckte er in jedes Fass seine Eisenstange und stocherte und rührte damit in dem Schlick herum. Ich konnte mir die Frage nicht verkneifen: „Nach welchem Schatz suchen Sie eigentlich in meinem Schlick?“
Zu meiner Überraschung antwortete der Zöllner mir sogar: „Ich kontrolliere, ob da Schnaps oder andere Drogen versteckt sind.“
Worauf ich ihm antwortete: „Na, dann suchen Sie mal weiter.“
Irgendwie genervt, zog er nun plötzlich seinen Eisenstab aus dem Schlick. Dann murmelte er so etwas wie: „Hau bloß ab mit deinem Nordseeschlick.“
Auch wenn dieser „Grenzvorfall“ völlig bedeutungslos war, werde ich ihn nie vergessen.
Von der Grenze aus fragten wir uns zur Birkenstraße durch, wo der Österreicher seine Firma für Moorpackungen betrieb. Dort angekommen, konnte man nicht gleich mit den Versuchen der Packungen aus Nordseeschlick beginnen. Ein größerer Auftrag aus Deutschland, der erst noch erledigt werden musste, war der Grund. Wir mussten uns noch zwei Tage gedulden. Diese Zeit nutzten wir, um uns das herrliche Salzburger Land näher anzusehen. Am ersten Tag fuhren wir in einen wunderschönen, kleinen Ort am Fuße des Dachsteins namens Filzmoos. Dort waren Jutta und ich schon einmal mit unseren Freunden Inge und Franz Bochröder im Winter zum Skifahren gewesen. Dieser Ort hatte es uns angetan. Im Hotel Hanneshof, wo wir auch im Winter gewohnt hatten, wurden wir von dem Besitzerehepaar Berta und Bertl Mayer auf das Herzlichste empfangen. Wir blieben zwei Nächte und einen vollen Tag. Zeit genug, um auch unsere Freunde Brigitte und Walter Habersatter zu besuchen. Walter war einmal ein bekannter Skispringer. Seine Frau Brigitte war in Innsbruck ein paar Jahre vorher Olympia-Zweite geworden. Dadurch, dass sie als hohe Favoritin ins Rennen gegangen war, aber von der damaligen Konkurrentin Rosi Mittermaier, die bis dahin nicht so bekannt war, knapp geschlagen wurde, war die Rosi über Nacht sehr berühmt geworden. Brigitte und Walter haben uns später mehrfach in Cuxhaven besucht.
Nach zwei Tagen waren Jutta und ich wieder bei dem Moorpackungshersteller in der Birkenstraße, wo wir dann auch sofort mit den Versuchen zur Herstellung der Nordseeschlickpackungen begannen. Es sollte sich bald herausstellen, dass die Maschinen dieser Firma nur teilweise für die Herstellung der Schlickpackungen geeignet waren. Der „Dosierer“ war das Problem. Schlick genau zu dosieren, war offensichtlich schwieriger als Moor zu dosieren. Das veranlasste den Österreicher zu der unvergessenen Aussage: „Schlick is a Luder!“
Bei ihm haben wir uns so geholfen, indem wir den Moor-Dosierer einfach abschalteten, und ich ihn mittels einer großen Suppenkelle, deren Stiel zum Anfassen ich einfach geradegebogen hatte, ersetzte. Das heißt, bei jedem Arbeitstakt der Maschine klatschte ich eine vorher gefüllte Kelle mit Nordseeschlick auf das Laufband, genau an die Stelle, an der sonst der ausgeschaltete Moor-Dosierer das Moor ablegte. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit meinerseits, klappte das dann ganz gut. Wir fertigten auf diese, zugegebener Weise, etwas behelfsmäßige Art ungefähr 1000 Nordseeschlickpackungen, die ich dann auch gleich wieder mit nach Hause brachte. Festzuhalten bleibt, die ersten „Einmal-Nordseeschlickpackungen“ überhaupt wurden im österreichischen Salzburg hergestellt!
Noch bevor Jutta und ich wieder Richtung Norden fuhren, setzten wir gemeinsam mit dem Firmeninhaber den Entwurf eines Lizenzvertrages auf. Danach sollte diese Firma für jede von mir hergestellte und an andere Kurbetriebe verkaufte Meeresschlickpackung DM 0,10 erhalten. Der Firmeninhaber wollte mir dafür eine alte und natürlich sehr gebrauchte Abpackmaschine stellen. Allerdings musste ich mir die selber für die Herstellung von Schlickpackungen umbauen. Hierbei kamen mir meine früheren Berufe als gelernter Maschinenbauer, Schiffsingenieur und Flugingenieur sehr zugute. Schon unterwegs auf der Rückfahrt, die fast ausschließlich von Jutta bewältigt wurde, machte ich mir Gedanken, wie ich dieses, zugegebenermaßen nicht kleine, Problem lösen könnte. Aber weit vor Cuxhaven glaubte ich, die Probleme mit der Schlick-Dosierung alle gelöst zu haben. Zumindest erst einmal im Kopf und sehr theoretisch!
Der Österreicher schickte mir schon ein paar Tage später den Entwurf des Lizenzvertrages zu. Den ließ ich von meinem mittlerweile zum Freund gewordenen Rechtsanwalt und Notar, Hans-Peter Behn, überprüfen. Er hatte noch ein paar kleine Änderungen. Aber bald war dieser Vertrag unterschriftsreif.
Nun musste ich nur noch in Cuxhaven geeignete Räume finden, in denen ich die in Österreich erworbene Maschine unterbringen und die Packungen fertigen konnte. In der Kapitän-Alexander-Straße fand ich dann auch solche Räume. Diese waren sehr heruntergekommen und vergammelt, weil sie viele Jahre leer gestanden hatten. Dafür kosteten sie auch nicht viel. Im Keller stellten wir dann die aus Österreich gelieferte Abpackmaschine auf. Vorher hatte ich aber in meiner firmeneigenen Werkstatt mit Juttas Hilfe einen kompletten Schlick-Dosierer neu konstruiert und funktionsfertig gebaut. Durch Juttas Mithilfe und nicht zuletzt auch durch ihren Ideenreichtum habe ich das tatsächlich sehr schnell geschafft. Wieder einmal hatte ich Grund genug, auf meine Frau sehr stolz zu sein.
Zunächst fertigten wir nur die Packungen selbst. Die dazugehörigen Wärmeträger kaufte ich in Österreich ein. Nach ein wenig Werbung in anderen Nordsee-Kurorten, zum Beispiel durch einfache Flyer, konnte ich tatsächlich bald die Einmal-Meeresschlickpackungen auch an andere Kurbetriebe außerhalb Cuxhavens verkaufen. Das blieb den Behörden natürlich nicht lange verborgen. So fand ich dann eines Tages einen Brief von der Bezirksregierung Lüneburg in meiner Post. Darin stand zu lesen, dass ich in Form von Meeresschlick-Packungen ein zulassungspflichtiges Arzneimittel ungeprüft und ohne Zulassung auf den Markt brächte und das dass eine strafbare Handlung sei. Aber der Absender des Briefes, ein Dr. Schmehrsahl, meinte es offensichtlich auch gut mit mir. Er bat mich im selbigen Brief um einen baldigen Besuch. Dabei wollte er mit mir die Dinge besprechen, die notwendig waren, um schnell aus dieser Misere heraus zu kommen.
Nach kurzer telefonischer Terminvereinbarung fuhr ich schon ein paar Tage später zu dem leitenden Pharmazie-Direktor Dr. Schmehrsahl nach Lüneburg zur Bezirksregierung, auch wenn mir das damals nicht in den Kopf wollte, warum eine Schlickpackung aus naturbelassenem Schlick ein Arzneimittel sein sollte! Wenn dem so wäre, würde jeder Wattwanderer, der sich im Watt aus irgendeinem Grund mit Schlick einreibt, ein Arzneimittel zu sich nehmen.
Das Problem für mich war aber nicht die Tatsache an sich, nein, es waren die Vorschriften, die zu beachten waren, wenn man ein solches Arzneimittel (Schlickpackung) herstellte. So erfuhr ich von Herrn Dr. Schmehrsahl, der sich für die - für mich blöden - Gesetze, auf deren Durchsetzung er ja zu achten hatte, sogar entschuldigte. Das hatte aber zur Folge, dass ich nun zwei Apotheker oder zwei Chemiker einzustellen hatte. Die mussten dann bei der Herstellung der Packungen die Einhaltung der Arzneimittelherstellungs-vorschriften überwachen. Die beiden setzten sich aus einem Herstellungs- und einem Kontrollleiter zusammen. Natürlich mussten sie dafür extra ausgebildet sein und entsprechende Befähigungsnachweise bei der Bezirksregierung einreichen. Ein für mich sehr teures Vergnügen. Es sei jetzt schon erwähnt, dass später mit Gründung der EU dieser Blödsinn sofort abgeschafft wurde. Die Packung wurde dann zu einem einfachen Heilmittel heruntergestuft, was sie ja auch in Wirklichkeit war.
Des Weiteren erfuhr ich von Dr. Schmehrsahl, dass ich beim damaligen Bundesgesundheitsamt in Berlin einen Antrag für die Zulassung meiner Nordsee-Meeresschlickpackung zu stellen hatte. Diesem Antrag musste ich eine ganze frische Schlickanalyse eines staatlich anerkannten Labors beilegen. Beides reichte ich binnen kürzester Zeit in Berlin beim damaligen BGA ein. Nach etwa sechs Wochen erhielt ich eine für mich niederschmetternde Antwort. In dem Antwortschreiben stand in etwa zu lesen: „Ihrem Antrag kann leider nicht entsprochen werden, weil Ihre bei uns eingereichte Analyse des Labors Talpey, Bremen, nicht stimmen kann. In jedem natürlich gewachsenen Boden sind nachweisbare Spuren von Arsen enthalten. In der uns eingereichten Schlickanalyse gibt es aber keinen Hinweis auf Arsen“.
Also blieb für mich nur die Schlussfolgerung übrig, dass mir das BGA unterstellte, ich hätte eine manipulierte Analyse eingereicht. Ich war überrascht und verzweifelt zugleich. Zunächst rief ich im Labor Talpey an. Sie hielten eine fehlerhafte Analyse für ausgeschlossen. Nun war ich durch meine kommunalpolitische Tätigkeit mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Dr. Albrecht, bekannt. Nach mehrmaligen Versuchen, ihn im Ministerium zu erreichen, ist mir das tatsächlich gelungen. Nachdem ich ihm mein Problem genauestens geschildert hatte, sagte er:
„Herr Gojny, ich bin zufällig mit dem Vizepräsidenten des BGA gut bekannt und werde versuchen, für Sie bei ihm so schnell wie möglich einen Termin zu machen. Er ist mir noch etwas schuldig, deshalb glaube ich, dass das sehr schnell klappen wird. Zur Sache selbst will und kann ich mich nicht äußern, das müssen Sie mit ihm selber besprechen. Mein Büro wird Sie wegen des Termins dort bald anrufen. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei.“
Schon einige Tage später hatte ich den gewünschten Termin beim BGA. Darüber war ich sehr glücklich. Wie heißt es doch so schön: Beziehungen schaden nur dem, der keine hat.
Zwei Tage vor meinem Flug von Bremen nach Berlin, übrigens mein erster Flug, bei dem ich nicht selbst im Cockpit saß, holte ich noch schnell einen Eimer frischen Schlick aus dem Wattenmeer, brachte diesen nach Bremen ins Labor, um den Schlick noch einmal speziell auf Arsen untersuchen zu lassen. Noch bevor ich von Bremen abflog, holte ich mir den ganz frischen Untersuchungsbericht im Labor ab. Natürlich war auch dieses Mal kein Arsen nachweisbar.
Mit der taufrischen Analyse in der Aktentasche kam ich dann in Berlin an. Der Vizepräsident war ein ausgesprochen reservierter Mann, der auch nicht viele Worte machte. Kurz und knapp forderte er mich auf, ihm mein Problem zu schildern, was ich dann auch ebenso kurz und knapp tat. Am Schluss angekommen, öffnete ich meine Aktentasche und holte den neuesten Analysebericht hervor und übergab diesen dem Herrn Vizepräsidenten mit den Worten: „Herr Präsident, diesen habe ich heute Morgen erst aus dem Labor geholt.“
Er warf einen kurzen Blick darauf, schüttelte dann fast nicht sichtbar seinen Kopf, griff zum Telefon und wählte irgendeine Nummer. Als sich am anderen Ende der Leitung eine Stimme meldete, sagte er nur knapp: „Kommen Sie doch mal schnell zu mir und bringen Sie bitte die Akte Gojny, Stichwort Meeresschlickpackung, Bearbeitungsnummer... mit. Wir müssen uns über den Vorgang unterhalten.“
Dann legte er den Hörer wieder in die Gabel. Mich wieder anschauend, sagte er: „Herr Gojny, Sie können jetzt wieder nach Hause fahren. Was jetzt zu besprechen ist, möchte ich gerne mit dem Sachbearbeiter unter vier Augen besprechen. Haben Sie bitte Verständnis dafür. Schön wäre es, wenn ich die neueste Analyse hierbehalten könnte.“
„Natürlich“, beeilte ich mich zu sagen.
Dann stand er auf, gab mir über den Schreibtisch hinweg seine Hand und fügte noch hinzu: „Sie hören sehr bald von uns. Gute Heimreise!“
Noch ehe der Sachbearbeiter kam, stand ich wieder auf dem Flur. Da mein Flieger nach Bremen erst kurz vor 18 Uhr ging und ich nun noch genügend Zeit hatte, ließ ich mich mit einem Taxi zum Kudamm bringen, den ich dann, nachdem ich eine Currywurst gegessen hatte, ganz gemütlich rauf und runter schlenderte. Dabei ging mir noch einmal das kurze Gespräch, das ich beim BGA geführt hatte, durch den Kopf. Es war mir unmöglich zu sagen, ob das BGA nun aufgrund dieses Gespräches die Zulassung als Arzneimittel für meine Nordsee-Meeresschlickpackungen erteilen würde oder nicht. Mir war bewusst, dass ich im Moment nichts tun konnte, außer abzuwarten. Für mich war das schon eine blöde Situation. Die Aktion „Schlickpackung“ hatte uns schon eine Menge Geld gekostet. Wenn ich die Packung wieder vom Markt nehmen müsste, wäre dieses Geld in den Sand gesetzt und mit dem zweiten Standbein würde es sicher auch nichts werden. Aber trotzdem hatte ich irgendwie ein gutes Gefühl. Also abwarten.
Meine Geduld wurde aber nicht so lange auf die Probe gestellt. Nach etwa zehn Tagen erreichte mich ein dicker DIN A4 Brief aus Berlin. Mit zittrigen Händen öffnete ich diesen. Ganz oben auf lag ein Anschreiben, in dem sinngemäß zu lesen stand:
„Sehr geehrter Herr Gojny. Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass Ihnen mit Wirkung vom __.__.1981 die Zulassung für die Einmal-Meeresschlickpackung als Arzneimittel erteilt worden ist. Die Zulassung wurde Ihnen unter der Zulassungsnummer... erteilt.“
Darunter lag dann eine hoch offiziell aussehende Urkunde mit Banderole und Siegel. Vor lauter Freude darüber, habe ich damals in meinem Büro einen Freudentanz aufgeführt. Instinktiv fühlte ich wohl, dass nun für mich wieder ein neues Berufszeitalter anbrach. Denn mit dieser Urkunde der Zulassung meiner Einmal-Nordseeschlickpackung (ENP) zum Arzneimittel, deren Erfinder und Hersteller ich war, war ich auf einmal auch Pharmaunternehmer geworden. Es war mein fünfter Beruf: Maschinenschlosser, Seemaschinist, Flugingenieur, Physiotherapeut und nun auch noch Pharmaunternehmer. Die Schlickpackungen sollten aber nicht mein einziges Pharmaprodukt bleiben. Daraus sollte sich noch viel mehr entwickeln.
Doch nun zurück zu meinen Kurbetrieben. Wenn auch die folgenden Jahre wieder besser liefen und ich meinen Verpflichtungen meinen Hausbanken gegenüber nachkommen konnte, war mein Vertrauen in die Gesundheitsbranche doch mächtig angekratzt. Mir wurde immer klarer, das zweite Standbein, das ich mir wünschte, musste unbedingt her.
Dadurch, dass sich in den folgenden Jahren die Kurbetriebe vom Umsatz her wieder zufriedenstellend entwickelten, verkaufte ich auch mehr ENP. Hinzu kam, dass ich zusätzlich auch noch Natur-Moorpackungen herstellen konnte. Das Moor bezog ich aus der Nähe von Bederkesa, wo ich mittlerweile einen weiteren Kurbetrieb von der Gemeinde gepachtet hatte.
Da Bederkesa im Begriff war, ein Moorbad zu werden und in der Nähe von Bederkesa auch hervorragende Bademoore vorhanden waren, ließ ich wieder in München eine große Peloid-Analyse fertigen, die auch sehr gut ausfiel, aber auch sehr teuer war! Auch mit Hilfe dieser Analyse ist der Ferienort Bederkesa übrigens später zum Moorbad Bederkesa aufgestiegen. Gedankt hat es mir natürlich keiner.
Auf alle Fälle hatte ich dann auch ein sehr gutes, zu Badezwecken zugelassenes Moor, aus dem ich meine Moorpackung zu Heilzwecken fertigen konnte, die auch die Arzneimittelzulassung bekam. Das ließ meine Verkaufs- und Umsatzzahlen natürlich wachsen. Schlecht war nur, dass unser Packungs-Geschäft auch zu sehr von der Gesamtlage der physikalischen Therapie, von den Kuranwendungen, also von der Gesamtlage des Gesundheitswesens abhing. Für meine Begriffe und nach den Erfahrungen, die ich gemacht hatte, fummelte der Staat zu viel und ohne ausreichende Fachkenntnisse darin herum.
Seit 1971, seitdem ich dieser Branche beigetreten war, gab es nicht eine neue Bundesregierung, die nicht sofort im Gesundheitswesen neue Gesetze, in dieser Zeit wurden diese „Kostendämpfungs-Ergänzungsgesetze“ genannt, beschloss oder es zumindest versucht hat. Also dachte ich sehr oft darüber nach, wie mein zusätzliches wirtschaftliches Standbein aussehen könnte. Die Antwort auf diese Frage, die mich schon länger beschäftigte, sollte von ganz alleine kommen.
Eines schönen Sommertages, meiner Erinnerung nach war es 1980, war ich wieder einmal für einen ausgefallenen Therapeuten in unserem KMH Döse als Aushilfstherapeut tätig. Als ich die Behandlungskabine betrat, lag dort eine Patientin, die von ihrem Badearzt Schlickpackungen mit anschließender Massage des ganzen Rückens aufgrund eines Zervikalsyndroms (Schmerzen im Schulter-Nackenbereich) verordnet bekommen hatte. Nun war das bei uns damals so, dass die Patienten, die vor ihrer Massagebehandlung eine Packung zur besseren Wirkung dieser verordnet bekamen, von einer medizinischen Badehelferin eingepackt wurden. Der Patient verweilte dann ca. 30 Minuten in der angelegten Packung. Der behandelnde Therapeut kam dann erst unmittelbar vor der Behandlung in die Kabine, packte dann den Patienten wieder aus und begann, wie in diesem Fall, mit der Massage.
Als ich die Patientin, die ein auffallend hübsches Gesicht hatte, auspacken wollte, sagte sie ganz plötzlich: „Stopp, stopp, Herr Gojny. Ehe Sie mich jetzt auspacken, muss ich Ihnen noch etwas sagen.“
Mir viel sofort auf, dass ihr das Weitersprechen sehr schwer viel. Doch sie gab sich einen Ruck.
„Ich, ich sehe am ganzen Körper furchtbar aus. Ich leide nämlich an einer schlimmen Psoriasis (Schuppenflechte). Und, und massieren brauchen Sie mich auch nicht. Das, das wäre eine große Zumutung.“
Etwas verblüfft antwortete ich ihr: „Liebe Frau Schmidt, ich bin Therapeut und als solcher bin ich es gewohnt, kranke Menschen zu behandeln, auch wenn sie dann ab und an krank aussehen. Also werde ich Sie, wie Ihr Arzt verordnet hat, auch behandeln! Ein Autoschlosser kann doch auch nicht sagen: Das Auto ist kaputt, das repariere ich nicht.“
„Gut“, sagte sie. „Wenn Sie mich gleich ausgepackt haben, werden Sie verstehen, warum ich das eben gesagt habe.“
Ich habe es dann ein paar Minuten später verstanden. Als ich Frau Schmidt dann von der Packung befreit hatte und sie dann fast unbekleidet vor mir lag, war ich wirklich geschockt. Sie war wirklich am ganzen Körper, bis auf den Hals und das Gesicht sowie Hände und Füße, von einer ganz üblen und übelriechenden Schuppenflechte befallen. In meinem Beruf hatte ich schon sehr viele schlimme Erkrankungen zu Gesicht bekommen, aber so eine schlimme Hauterkrankung hatte ich niemals zuvor gesehen. Was ein ansonsten gut aussehender Mensch, wie es Frau Schmidt war, unter so einer üblen Schuppenflechte zu leiden und zu ertragen hat, das kann sich ein gesunder Mensch kaum vorstellen.
Nun aber hatte ich A gesagt, nun musste ich auch B sagen. Das heißt, Frau Schmidt wurde natürlich von mir massiert. Nach der dritten Schlickpackung und nach der dritten Schulter-Nacken-Massage konnte ich zu meiner großen Freude eine Beobachtung machen. Genau da, wo die Schlickpackung auf der Haut aufgelegen hatte und nur da, löste sich bei der Massage unter meinem Daumenballen, den ich bei der Massage besonders einsetzte, die hässliche kranke Haut und darunter kam eine glatte rosarote, neue Haut zum Vorschein. Da ich ganz sicher sein wollte, dass meine Beobachtung sich weiter bestätigt, sagte ich der Patientin noch nichts von dem für mich sensationellen Besserungserfolg. Eine weitere Behandlung wollte ich noch abwarten.
Am nächsten Tag aber dann, als sich meine Beobachtung wirklich noch sichtbarer bestätigte, konnte ich das nicht mehr für mich behalten. Nachdem Frau Schmidt die vierte Schlickbehandlung und von mir die vierte Schulter-Nacken-Massage erhalten hatte, war klar: In dem Bereich, an dem die große Rücken-Schlickpackung angelegen, also da, wo der Schlick mit der Haut in direktem Kontakt stand, war die Patientin erscheinungsfrei.
Zu meiner Patientin sagte ich: „Warten Sie einen kleinen Moment, ich bin sofort wieder da.“
Dann ging ich in die Nachbarkabine und holte von dort den großen Umkleidespiegel.
„So“, sagte ich, „liebe Frau Schmidt, jetzt habe ich eine Überraschung für Sie. Sehen Sie mal in den Spiegel.“
Als sie das tat, hielt ich ihr den zweiten Spiegel hinter ihren Rücken, so dass sie diesen in dem vor ihr hängenden Spiegel gut sehen konnte. Als sie ihren Rücken sah, war sie zunächst sprachlos. Dann sagte sie: „Das gibt’s doch nicht!“
Als sie richtig realisiert hatte, was sich da auf ihrer Haut tat, fing sie an zu weinen.
„Wenn Sie wüssten, was mir das bedeutet. “
Dann sprudelte es nur so aus ihr heraus. Sie erzählte mir, dass das mit der Schuppenflechte nach der Geburt ihres ersten Kindes, ihrer Tochter, angefangen hatte. Dass ihre Ehe daran zerbrochen ist und dass sie schon alles, wirklich alles getan hatte, um diese Geisel, wie sie es nannte, loszuwerden. Sie berichtete mir von unendlich vielen, erfolglosen Kuren. Nun hatte sie zum ersten Mal wieder so etwas wie Hoffnung.
Da wir zu dem Zeitpunkt noch keine Schlick-Vollbäder hatten, gab ich ihr in Anlehnung an die einige Jahre früher von mir im Wattenmeer gemachte Beobachtung den Tipp, doch bei Ebbe ins Wattenmeer hinaus zu laufen, um sich an einer geeigneten Schlickstelle am ganzen Körper mit Nordseeschlick einzureiben. Dann sollte sie sich in die Sonne legen und den Schlick am Körper antrocknen lassen. Wenn der Schlick dann angetrocknet war, sollte sie ihn in einem Priel wieder vorsichtig mit Seewasser abwaschen.
„Liebe Frau Schmidt“, sagte ich zu ihr, „das wird Ihnen helfen, da bin ich mir ganz sicher. Da der Nordseeschlick bei Ihnen sehr gut anschlägt, besteht die Hoffnung, dass Sie sich selber damit behandeln können, bis Sie erscheinungsfrei sind.“
Nur was dann passierte, damit hatte ich selber nicht gerechnet. Die gute Frau Schmidt kam nämlich von dem Tage an nicht mehr zu Behandlung. Mir tat das natürlich sehr leid, weil ich gerne erfahren hätte, was aus ihr und vor allem aus ihrer hässlichen Hauterkrankung geworden war. Aber nichts, sie blieb verschwunden! Die restlichen acht Behandlungen hatte sie glatt verfallen lassen. Schade, dachte ich, sie ist bestimmt schon längst abgereist. In diesem Fall sollte ich mich aber gewaltig täuschen.
An einem sehr heißen Sommertag, etwa vier Wochen, nachdem ich Frau Schmidt das letzte Mal behandelt hatte, stand ich vorne im Warteraum am Anmeldetresen bei Frau Joester, um zu sehen, wer mein nächster Patient war. Zufällig schaute ich durch das große Fenster auf unseren Parkplatz. Dort hielt gerade ein Taxi. Die rechte Tür öffnete sich und heraus stieg meine vermisste Frau Schmidt. Ich traute meinen Augen nicht. An ihrem außergewöhnlich hübschen Gesicht hatte ich sie sofort erkannt. Heute gebe ich das gerne zu, dass ich mich ein wenig in das hübsche Gesicht verliebt hatte.
Aber ansonsten hatte die junge hübsche Frau, die da jetzt aus dem Taxi stieg, nichts mehr mit der Frau Schmidt gemeinsam, die ich ca. vier Wochen zuvor kennengelernt und behandelt hatte. Diese Frau Schmidt kam auch bei großer Hitze immer völlig korrekt und hochgeschlossen gekleidet zur Behandlung. Da war nun aber eine junge Frau aus dem Taxi gestiegen, die sah total anders aus. Diese junge Frau kam in kurzer Turnhose, ärmellosem T-Shirt und Turnschuhen daher. Ja, als sie auf unsere Eingangstür zusteuerte, schien mir, als hätte sie auch ihren Gang verändert. Vorher ging sie schwer und schleppend. Nun kam sie leichtfüßig, ja tänzelnd daher. Ich sagte mir, mit der Frau ist ein Wunder geschehen. Schon wurde die Eingangstür aufgerissen und vor mir stand die von mir schon länger vermisste Frau Schmidt. Sie konnte es wohl selber kaum erwarten, mir ihre außergewöhnlichen Heilerfolge vorzuführen.
„Kucken Sie mal, Herr Gojny, wie ich jetzt aussehe. Das habe ich nur Ihnen zu verdanken.“
Indem sie das sagte, nein, es sprudelte aus ihr heraus, griff sie mit beiden Händen an den unteren Rand ihres T-Shirts und wollte sich dieses im Wartezimmer vor allen wartenden Patienten über den Kopf ziehen. Das konnte ich aber gerade noch verhindern. Sie war so unendlich froh und stolz auf das, was der „Nordseeschlick“ bei ihr bewirkt hatte. Daher war es auch nicht verwunderlich, dass sie der ganzen Welt zeigen wollte, was der Nordseeschlick bei ihr geschafft und sie wieder zu einer wunderschönen Frau gemacht hatte, so dass sie sich am liebsten vor allen Leuten auszogen hätte.
Ich nahm sie aber in eine freistehende Behandlungskabine mit, wo sie mir dann ihre unglaublichen Heilerfolge zeigen konnte. Da ich sie ja mit ihrer, fast den ganzen Körper bedeckenden, Schuppenflechte gesehen hatte, konnte ich das, was ich da jetzt sah, gar nicht glauben. Die Frau war, bis auf wirklich wenige Reste in den Knie- und Ellenbeugen und an den Haaransätzen, dort waren kleine rote Stellen, erscheinungsfrei. Selbst als nunmehr erfahrener Therapeut war ich wirklich überwältigt.
In dem Augenblick schoss es mir durch den Kopf: Schlick ist ein hochwirksames Therapeutikum. Schlick wirkt nicht nur bei Erkrankungen, die dem rheumatischen Formenkreis (Sehnen, Muskeln, Gelenke) zuzurechnen sind. Nein, es entwickelt insbesondere eine außergewöhnliche Heilkraft bei Hauterkrankungen. Daraus wollte und musste ich ab sofort etwas machen. Die Idee, der später von meiner Familie und mir geschaffenen Meereskosmetiklinie La mer war geboren.
Auf einmal wusste ich auch, wie mein zweites Standbein, aussehen sollte. Die darauffolgenden Jahre verliefen für meine Kurbetriebe noch sehr zufriedenstellend, was die Umsätze und Erlöse anging. Das von uns selbst erbaute KMH Döse wurde langsam aber sicher auch schon wieder zu klein. Die hiesigen Krankenkassen selbst, in diesem Fall die Geschäftsstelle der Landeskrankenkasse Cuxhaven, war es, die mich darauf hinwies, dass für den Andrang während der Saison dieses Haus mit seinen Kureinrichtungen den Anforderungen nicht mehr standhalten würde. Wenn ich nicht die Krankenkassenzulassung aufs Spiel setzen wollen, müsste ich diesen Zustand dringend zu ändern!
Ein alter Freund und ehemaliger Ratskollege, der von meinen plötzlich auftretenden Schwierigkeiten mit den Krankenkassen gehört hatte, baute gerade in der Nachbarschaft ein großes mehrstöckiges Appartementhaus. Diese Anlage war bereits im Bau und im Rohbau fertig war. Damit ich schnell aus diesen plötzlich auftretenden Schwierigkeiten herauskam, bot er mir an, in seinem Neubau, dessen Erdgeschoß eigentlich eine große Garage werden sollte, ein großräumiges Kurmittelzentrum zu errichten. Wir wurden uns sehr schnell einig, und die neue große und moderne Kuranlage im Nordseebad Cuxhaven-Döse ging in Planung. Da auch das Nordseeheilbad Cuxhaven ein großes Interesse daran hatte, dass auch der Kurort Cuxhaven-Döse über ein modernes Kurmittelhaus verfügte, gab es auch in bautechnischer Hinsicht keinerlei Probleme.
An der Nordseeküste sprach es sich langsam herum, dass es im Nordseeheilbad Cuxhaven jemanden gab, der ganz offensichtlich in der Lage war, Kurbetriebe auch unter den damals schon widrigen Umständen wirtschaftlich zu betreiben. Daher boten mir verschiedene Bade- und Kurorte ihre Kurmittelhäuser zur Pacht an. Der Reihe nach waren das damals: Helgoland, Wenningstedt, Bederkesa und Dorum. Zunächst wollte ich von diesen Angeboten gar nichts wissen. Hatte ich doch mit meinen drei in Cuxhaven ansässigen Kurbetrieben mehr als genug zu tun. Zumal in dieser Zeit der größte unserer Betriebe in Cuxhaven-Döse wieder mal kurz davorstand, in noch größere, modernere Räume umzuziehen. Aber dann ergab es sich, dass mir zwei gute Bekannte anboten, mit mir zusammen eine Kurmittelhausbetreiber-Gesellschaft zu gründen. So entstand die „Nordseekurbäder Verwaltungs GmbH (kurz: NKB)“ mit den Betrieben: KMH Helgoland, KMH Wenningstedt, KMH Bederkesa, KMH Dorum.
Jeder der Gesellschafter wurde mit einem Drittel an der Gesellschaft beteiligt. Ich selber übernahm als examinierter Therapeut die fachliche Leitung der Gesellschaft. Der zweite Gesellschafter war Diplom-Kaufmann und aufgrund seiner jahrzehntelangen kaufmännischen Erfahrung in einem großen Unternehmen bei Cuxhaven geeignet, die kaufmännische Leitung dieses Unternehmens zu übernehmen. Der dritte Teilhaber war und blieb stiller Teilhaber. Zunächst lief auch alles in allem innerhalb der NKB sehr gut und wirtschaftlich zufriedenstellend. Aber im Rahmen der damals nicht enden wollenden Wirkungen der Kostendämpfungs-Ergänzungs-Gesetze im Gesundheitswesen, wurden die Ergebnisse trotz aller in Frage kommenden Sparmaßnahmen immer schlechter.
Als die Mietverträge dann nach und ausliefen, wurden diese von uns auch nicht verlängert, sondern gekündigt. Über die NKB wäre an dieser Stelle noch so manch interessante Geschichte zu erzählen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb Helgoland, aber das würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, da ich ja meine Lebensgeschichte erzählen möchte und nicht die Unternehmensgeschichte der NKB.
Für mich selber bleibt die Erkenntnis, dass die NKB wohl nicht zu den besten Ideen meiner beruflichen Laufbahn als Unternehmer gehörte. Beinahe froh war ich damals darüber, dass die Auswirkungen der Gesundheitsgesetzgebung und die damit zusammenhängenden Sparmaßnahmen der Krankenkassen sich so heftig und negativ auf das Ergebnis der NKB auswirkten, so dass wir erst gar nicht darüber nachdachten, auslaufende Pachtverträge zu verlängern, auch wenn ich die verbleibende Restschuld des KMH Helgoland dann ganz alleine begleichen musste. Die beiden Partner der NKB konnten aus irgendwelchen Gründen von dem uns finanzierenden Bankinstitut nicht mehr in Anspruch genommen werden.
Aber zu dieser Zeit beschäftigte ich mich bereits mit meiner neuen Geschäftsidee und sehnte mich auch schon lange danach, endlich mal die Preise für unsere Leistungen und Produkte zu erhalten, die sauber kalkuliert und dadurch gerechtfertigt waren. An anderer Stelle erwähnte ich bereits, dass wir damals meines Erachtens für unsere Leistungen, die wir in unseren Kurbetrieben erbrachten, niemals kostendeckende Preise erhielten. Warum sich damals nicht alle Kurverwaltungen gemeinsam gegen die ständige Unterbezahlung der Kuranwendungen zu Wehr setzten, wird mir immer ein Geheimnis bleiben. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich als Privatunternehmer alle Verluste aus eigener Tasche zahlen musste, während die Kurverwaltungen immer zu irgendeiner Kommune gehörten und diese, also der Steuerzahler, die Unterdeckung ausglich.
Also löste ich mich damals innerlich schnell von der NKB und langsam aber sicher dann auch von der gesamten Branche. Auf alle Fälle hatte ich aus dieser Geschichte meine Lehren gezogen.
Hier fallen mir gleich zwei häufig von meiner Großmutter gebrauchte Zitate ein, die mir an dieser Stelle zu passen scheinen:
1. Kumpanei ist Lumpanei!
2. Man kann gar nicht alt genug werden, um nicht doch noch etwas hinzuzulernen!
Die durch die Aufgabe der NKB freiwerdende Zeit konnte ich gut für die Umsetzung meiner neuen Geschäftsidee und den Aufbau meiner Produktionsfirma gebrauchen.
Wie vorher schon erwähnt, war der Döser Betrieb zu klein geworden und sollte durch einen größeren ersetzt werden. Der Bau, in dem die neue Anlage installiert werden sollte, kam aus irgendeinem Grund ins Stocken, so dass er erst zwei Jahre später als geplant fertig wurde. Zu einem Zeitpunkt hätte ich wahrscheinlich keine Zustimmung zu dem neuen, viel größeren Kurbetrieb mehr gegeben. Aber die Verträge waren abgeschlossen und ich konnte nicht mehr zurück! Die Räume dafür bot mir, wie schon erwähnt, ein alter Partei- und Ratskollege an.
Irgendwann Anfang der 90iger Jahre waren die Betriebsräume des neuen Kurbetriebes, wenn auch verspätet, fertig. Es war ein schöner großzügiger Kurbetrieb geworden. Er beinhaltete alles, was zu einer modernen leistungsstarken Kuranlage gehörte. In der Hauptsaison hatten dort 16 Fachkräfte ihren Arbeitsplatz. Alle Mitarbeiter arbeiteten auch sehr gerne dort.
Da ich den alten Betrieb an meinen Sohn Martin, der sich mittlerweile auch als Krankengymnast erfolgreich selbstständig gemacht hatte, verkaufte, war die nun wahnsinnig hohe Miete von ca. DM 20.000 monatlich zunächst nicht das große Problem. Also wurde der neue Betrieb in Döse von Anfang an von mir subventioniert. Meine Mitarbeiter und ich taten natürlich alles Erdenkliche, um den Betrieb von Anfang an wirtschaftlich zu betreiben. Zum Beispiel belieferten wir uns selbst mit den vom „Altenwalder Kurbad“ gefertigten Schlick-Packungen zum Selbstkostenpreis.
Das Packungs-Geschäft war in der Zwischenzeit recht gut angelaufen. Was ganz besonders wichtig war: Es warf, im Gegensatz zu den Kurbetrieben, Gewinne ab. Dieses Geschäft gehörte damals noch zum „Altenwalder-Kurbad“, wurde aber von uns, um eine genaue Übersicht zu behalten, in der Buchhaltung als eigene Kostenstelle geführt.
Wenn es auch immer schwerer wurde, mit Hilfe des Packungs-Geschäftes brachte ich die Kurbetriebe irgendwie durch. Warum ich sie damals nicht schon schloss? Ich weiß es wirklich nicht. Aber es war falsch. Nach ein paar Jahren Abstand kann ich heute sagen, dass ich damals glaubte, die Kurbetriebe seien mein Lebenswerk, an dem ich mit der ganzen Leidenschaft meines Herzens hing. Zwei Dinge wurden mir damals klar:
Einen Betrieb aufbauen, der fachlich hochqualifizierte Arbeit abliefern soll und dabei auch noch wirtschaftlich arbeitet, das geht nicht, wenn die Krankenkassen von oben herab die Preise diktieren und dem Betreiber somit sämtliche Möglichkeiten der Eigenkalkulation genommen werden.
Und weiterhin wurde mir damals immer klarer: Ich brauchte das zweite wirtschaftliche Standbein! Eines, das ich mir selber ohne Einfluss von außen aufbauen konnte.
Dieses sollte sehr bald kommen und La mer heißen.