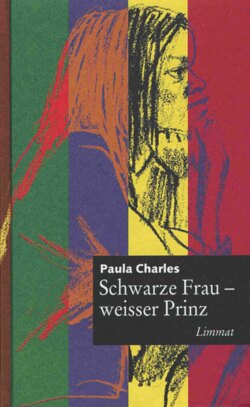Читать книгу Schwarze Frau, weisser Prinz - Paula Charles - Страница 6
Karibisches Mädchen
ОглавлениеIch sass vor dem kleinen Schindelhaus, inmitten halbhoher, von der heissen Sonne ausgedörrter Rosen. Der Wind blies sanft und warm durch den Cotton-Tree und die Kokospalmen, wiegte sie hin und her. Dies gab mir ein wohliges Gefühl der Verbundenheit. Die Sonne auf dem Nacken, fühlte ich mich eins mit der Natur, ich war bei mir.
Aus Granmas Radio klang Musik. Es stand in einer grünen Lederhülle auf ihrem Schrank, der aus England und darum etwas Besonderes war. Daneben ein weisses Häkeltuch, das ihre selten benutzte Brille enthielt, und ein in England aufgenommenes Foto meines Vaters. Er trug einen weissen Anzug, blickte mich direkt an – nie hätte ich ihm so in die Augen sehen können. Und aus dem Radio erklang eine wunderschöne Melodie, die ich bis heute nicht vergessen habe.
Es war eine samtene, männliche Stimme. Sie sang: «Paula, I give you my heart. Paula, I will wait for you. Good luck to Paul and Paula.» Ich war erst etwa neun Jahre alt, doch ich wusste bereits: Der Sänger sang diese Worte für mich. Ich hatte mir immer schon viele Gedanken gemacht, aber dieses Mal spürte ich, dass etwas in meinem Herzen und meiner Seele sich veränderte.
Es war etwas Spirituelles, ein sehr gutes, wissendes Gefühl: Diese Worte waren mein Leben; sie galten mir. Mein Gott, dachte ich, woher kannte er meinen Namen? Granma lag in ihrer Schlafkammer, vielleicht schlief sie, vielleicht träumte sie vor sich hin, träumte von früher, als sie ein junges Mädchen gewesen war wie ich. Was war aus ihr geworden, fragte ich mich, wie war ihr Leben? Warum hatte sie nie geheiratet? Oder war sie vielleicht doch verheiratet gewesen? Einmal hatte ich einen Ehering gesehen, der, in ein Taschentuch geknotet, in einer Schublade des Schranks versteckt war. Wer war mein Grossvater? Man erzählte sich, er sei ein Weisser gewesen. Oder war es mein Urgrossvater, über den man im Dorf redete? Ich kannte meine Herkunft nie wirklich, jeder erzählte eine andere Geschichte. Es hiess, mein Grossvater habe eine Plantage gehabt, mit vielen Sklaven und Sklavinnen – ich jedenfalls nenne sie Sklavinnen, weil ich nur von Leid und von Misshandlung der Frauen hörte. Man sagte, Granma sei eine der Frauen gewesen, mit denen er schlief. Sie bedeuteten ihm nichts, sie waren seine Arbeiterinnen und seine Erholung. Aber meine Grossmutter zog seinen blau-grünen Blick auf sich und fühlte sich auserwählt. Sie hatte zwei Kinder, einen Sohn – meinen Vater – und eine Tochter, von der sie uns Enkelkindern nie erzählte. Sie soll an Wahnsinn gestorben sein. Mein Vater starb später am Alkohol.
Gran war die zurückhaltendste Frau, die ich je getroffen habe. Du konntest in ihrem Verhalten und in ihrer Nachdenklichkeit Geheimnisse und Schmerz erahnen, aber nie zeigte sie ihre Gefühle.
Es gab viele alleinstehende Frauen in ihrem Alter, und ich hätte gerne gewusst, was mit ihren Männern geschehen war. Sie waren alleinerziehende Mütter gewesen und sind dann alte Frauen geworden, die in Grans kleiner, aus Brettern gebauter Küche zusammenkamen, in der nur etwa drei Personen auf der Bank Platz fanden, die gerade breit genug für ihr Hinterteil war. Sie rafften ihre französischen Kleider, schwangen den vorderen Teil unter ihren Hintern, um auf der abgenutzten Bank bequem zu sitzen. Denn es vergingen Stunden, bis sie sich wieder erhoben.
Wenn sie ankamen, wurden wir Kinder zum Spielen geschickt. Die Frauen wohnten nicht weit voneinander entfernt, aber sie trafen sich nur alle paar Wochen. Die meisten von ihnen gingen an Stöcken aus Ästen, von denen sie Blätter und Rinde mit einem stumpfen, rostigen Messer entfernt hatten. So spazierten sie über die Hügel, Schweiss an ihrem ergrauten Haaransatz. Sie gaben leise Laute von sich, sangen oder summten vor sich hin. Der Stock hinterliess seine Spuren auf den fussgestampften Wegen – im Dorf gab es keine Autos. Die Alten wurden über alle Massen respektiert, das spürte man. Wir mussten sie als erste grüssen. Egal was wir gerade taten, wir mussten alles liegen lassen und herbeieilen, wenn sie auftauchten. Du musstest ihre Taschen tragen und ihre Hände auf deinen Schultern ruhen lassen, damit sie Atem holen konnten. Das Gehen fiel ihnen schwer, ihre Füsse waren müde und wund, weil sie keine Schuhe hatten oder keine tragen wollten. Trotzdem sahen sie kräftig aus, bei aller Müdigkeit eines Lebens voller Arbeit auf den Plantagen und krummen Rücken vom Baumwollpflücken und Gemüsepflanzen in der heissen Sonne. Ich sah all die Furchen an Granmas Händen und Füssen und die Narben vom Schneiden der Bäume und Büsche. Die Frauen benutzten ihr farbiges Kopftuch, um ihr Gesicht abzuwischen. Sie sprachen von ihren Nöten und von den kleinen Freuden, die sie Tag für Tag erlebten. Ich konnte ihr Lachen hören. Dann wurde es ganz plötzlich Nacht, und sie mussten sich auf den Weg machen zu ihren dunklen Häusern. Ihre Familien begannen sich Sorgen zu machen. Es gab überall schwarze Magie, und die Grossmütter waren zu weit weg, um ihre Rufe zu hören. Doch sie kehrten zurück, müde, aber nicht hungrig. Und nichts war ihnen zugestossen.
Ich rückte näher an das englische Radio heran. Ich wollte den Mann sehen. Irgendwie kam es mir so vor, als ob ich ihn kannte. Und das Eigenartigste war: Ich wusste, er war weiss. Alles an ihm war rein. Ich versank in Träume, versuchte ihn mir vorzustellen, und die Musik ging mir durch den Kopf, drang in meinen Geist, und ein Gefühl von Sanftheit überkam mich. Aber ich bin so jung, dachte ich dann. Es ist nicht normal für ein Mädchen, sich wegen der Stimme eines Mannes gut zu fühlen. Ich genoss es, aber gleichzeitig fühlte ich mich schuldig. Ich wollte schnell erwachsen werden und dorthin gehen, wo der Sänger war. Vielleicht würde er mich umarmen und mich in seinen Armen wiegen. Warum habe ich keinen Vater, fragte ich mich, wo ist mein Daddy? Ich geriet in Panik beim Gedanken, dass Granma mein Verhalten bemerken könnte, während sie Pfeife rauchend in ihrer Hängematte ruhte. Ich fühlte mich gut, weil ich glaubte, dass jemand meine Gedanken verstand. Diese Stimme, die aus dem Kasten kam, klang persönlich.
Wir waren die einzigen im Dorf, die ein Radio hatten. So kamen alle zu uns, wenn Granma beschloss, sich etwas zu gönnen. Meistens jedoch waren die Batterien leer, und sie konnte sich keine neuen leisten. Wir versuchten beim Drehen der Knöpfe die Wörter zu verstehen, und es war ein grosses Wunder für uns, dass ein Mensch aus einer tragbaren Kiste heraus singen konnte. Es gab jeweils Streit zwischen uns Kindern, richtige Raufereien, weil wir nicht verstanden, wie das Radio funktionierte.
Wir hatten auch Mühe mit der Sprache, weil wir die meiste Zeit Patois sprachen. Wir gingen ja in die Dorfschule und erhielten nur das Mindeste an Bildung. Damals war mir nicht wirklich bewusst, dass wir arm waren. Es war soviel Hunger unter uns. Nicht nur nach Nahrung, sondern nach Tagen, an denen wir leben konnten, ohne zu sehen oder zu hören, dass jemand starb, weil keine Medizin zu bekommen war. Das einzige, was wir tun konnten, war beten.
Wenn ich Paul doch irgendwann einmal begegnen könnte, dachte ich. Ich wünschte, er würde nie aufhören zu singen und die Geschichte meiner Zukunft endlos wiederholen. Denn Granma würde das Radio vielleicht erst in einem Jahr wieder einschalten. Und dann brauchte sie Stunden, bis sie den Sender fand – falls sie ihn überhaupt fand. Wir durften das Radio nicht anfassen, durften höchstens, wenn wir Glück hatten, eines der wenigen in Ehren gehaltenen Geschenke polieren, die Vater ihr aus London geschickt hatte.
Für junge Mädchen in St. Lucia gehörte es sich nicht, Interesse an Jungs zu zeigen oder über sie zu sprechen. Dieses Thema war tabu. Sexuelle Gefühle wurden so sehr geheim gehalten, dass ich mich fragte, wie ich geboren worden war. Männer und Frauen zeigten einander nie in Gegenwart von Familie und Freunden ihre Gefühle. Irgendwie bedeutete dies Mangel an Respekt und eine zu grosse Ungezwungenheit. Dafür sprachen wir viel über die Kirche. Egal, wie du darüber sprachst, es war richtig und gesund. Wir sprachen über den nächsten Sonntag, wer im Chor singen sollte und was wir zur Kirche anziehen würden, zu welcher Frisur. Glaube an Gott und nicht an Sex!
Aber wie waren wir entstanden? Merkten die Erwachsenen nicht, dass es dafür immer zwei brauchte? Dass Sex Teil der schwarzen Rasse war, der menschlichen Rasse überhaupt? Nicht ein einziges Mal wurde über dieses Thema gesprochen. Was sie wohl heute von mir denken würden, wenn sie noch am Leben wären und wüssten, wie ich gelebt habe? Sie würden mich mit spiritueller Energie töten. Ich wäre erledigt, eine Schande für ganz St. Lucia.
Die Kirche hat viele der menschlichen Empfindungen verdorben, die Gott selber uns gegeben hat. Ich weiss nicht, welches ihre Idee von Gott und ihre Vorstellung von Moral war. Ich war eine eifrige Kirchgängerin, weil ich so erzogen worden war. Und insbesondere, weil wir arm waren, suchten wir nach einem neuen Weg zu einem besseren Leben. Wir hatten genug vom Leiden. Deshalb hiessen wir – wie überall in armen Ländern – die Missionare aus Europa mit dem wenigen, das uns geblieben war, willkommen. Doch durch sie wurden wir erst richtig arm. Sie nahmen unseren Zucker, unsere Baumwolle und unsere Früchte, unser Gold, unsere Diamanten und unsere Metalle und sogar unsere Natur und unsere Kraft. Wir glaubten ihnen dennoch.
Als ich ein kleines Mädchen war, so erinnere ich mich, suchten sie uns überall in den Dörfern. Es überraschte uns, dass sie unsere kleinen Dörfer überhaupt gefunden hatten. Meistens kamen sie in ihren besten Sachen, Kleidern und Autos. Viele von ihnen hatten die besten Häuser im besten Teil der Stadt. Aber wir waren zu naiv und hatten nicht genügend Wissen über diese christlichen Leute, um sie in Frage zu stellen. Und überhaupt, wer waren wir denn! In ihren Augen waren wir Bettler. Sie kamen, um uns Kraft zu geben, damit wir ihr Land reicher machten. Aber das wussten wir nicht. Wir nahmen alle so, wie sie waren. Wir wussten nicht, dass Missionare sehr gut ausgebildet waren – auch in Psychologie. Wir wussten nicht, dass sie unsere Kultur in Büchern studierten, bevor sie uns gegenübertraten. Wir fragten uns, wie sie überhaupt wussten, dass schwarze Menschen existierten. Sie waren für uns nette, andersartige, fremde Menschen, ihr Auftreten schien friedlich. Wir wussten nicht, dass sie sich bemühten, freundlich zu wirken, um uns ihre Bibel zu verkaufen.
Der Missionar kam zu uns. «Hello, Missis … em … Seewanese!» So hiess Granma offiziell, ansonsten nannte man sie Mades. Gran sass in ihrer kleinen Küche, mit ihren häuslichen Angelegenheiten beschäftigt. Mein Bruder und ich, ihre beiden Engel, waren an ihrer Seite oder zwischen ihren Beinen; wir klammerten uns immer irgendwo an sie. Sie zeigte dem weissen Christen ein grosses, breites Lächeln, als ob sie gerade Gott gesehen hätte. Oder war sie weiser? Wusste sie, dass sie betrogen wurde? «Willkommen», sagte sie zu ihm, «Paula, geh und hol einen besseren Stuhl für den Priester.» Der weisse Mann setzte sich und versuchte, es sich in Grans kleiner, stickiger Küche bequem zu machen. Er musste zumindest versuchen, sich wohl zu fühlen, wurde er doch von der Kirche dafür bezahlt, dass er die Leute überzeugte, die Bibel zu kaufen und ihre letzten Pennies der Kirche zu spenden.
Der Priester bemühte sich, eine Tasse von Grans Wasser zu trinken – Flusswasser, nicht chemisches oder, wie man es nannte, gereinigtes Wasser. Ihre einzige, schwarzbetupfte Tasse war etwa zehn Jahre alt und sah angeschlagen aus. Er hatte Diplomatie gelernt, also lächelte er und sagte, ihr Wasser sei genau das, was er gebraucht habe. Aber er wollte nur seine Botschaft verkaufen, dafür war er von weither angeflogen. Er wollte nicht wirklich ihre Armutsgeschichte hören und wechselte geschickt das Thema. «Also, Mrs. Seewanese, das Leben ist nicht allzu schlecht, aber Gott kann Ihnen mehr geben, wenn Sie zu ihm beten. Und deshalb sind wir hier, um Ihnen zuzuhören und mehr Kirchen bauen zu helfen, damit Sie dort um Hilfe beten können. Aber wir brauchen Geld.» Er öffnete seinen Koffer vor der sehr müden und verwirrten alten Lady, überreichte ihr Broschüren, die sie nicht lesen konnte, und viele schöne, glänzende Leder-Bibeln. Seine weisse Magie wirkte. Gran murmelte vor sich hin, schaute mit besorgtem Gesicht ihre Grosskinder an und dachte an die wenigen St.-Lucia-Dollars, die sie, in ein Tuch geknotet, versteckt hatte. «Was kann ich machen», sagte sie in Patois. Ihr Sohn war tot, ihre Tochter war tot, auch sie würde bald sterben, und was würde dann mit ihren kleinen Kindern passieren. Sie brauchte mehr Kraft, um uns durchzubringen. Der Priester hakte nach: «Mrs. Seewanese, es ist nicht viel Geld! Denken Sie an all die Hilfe, die Sie erhalten werden!» «Gut, ich kaufe.»
Ihre letzten paar Dollar lösten sich in Luft auf. Sie war wieder da, wo sie angefangen hatte, doch jetzt hatte sie sich mit diesem Buch Gott gesichert. Es blieb nun für immer an ihrer Seite – nicht so der Missionar. «Auf Wiedersehen, Kinder, bis bald in der Kirche», sagte er und schüttelte unsere kleinen Hände. Unsere Augen waren so weit offen wie seine Bibel. In diesem Moment war er für mich Gott. Er würde unser ganzes Leben verändern. Er sprang in seinen schweren Jeep, der speziell für unsere sandigen Strassen geeignet war, drehte die Scheibe hoch, während Ben und ich ihm die Autotüre aufhielten. Er drehte den Motor an, und das ganze Dorf rannte hinter ihm her, versuchte schneller zu sein als das Auto, das Staub auf unseren Gesichtern zurückliess. Das machte uns nichts aus: Ein englischsprechender weisser Mann war uns besuchen gekommen, weil er uns helfen wollte! Doch Grans Geld war weg. Und was würde geschehen, wenn sie krank wurde? Was war mit unseren Schulgeldern? Was, wenn wir hungrig waren? Lachte er auf dem Weg zurück in seine Paläste?
Sie machten Granma gar zur Kirchenältesten. So hatte sie zumindest das Gefühl, ihr würde geholfen. Doch sie benutzten nur ihre Kraft. Sie musste nach der Arbeit herumrennen, von der Farm und dem Dorf bis in die Stadt, um ihren eigenen Leuten für den weissen Mann das Wort Gottes zu verkaufen. Sie wusste nicht, dass sie sie reicher machte. Man erlaubte ihr nicht einmal, ihre Häuser zu betreten, weil sie nicht fein genug war, um mit ihnen zu essen. Sie war einfach eine aus dem Busch, und dort gehörte sie hin.
Granma blieb arm und wurde noch ärmer, aber sie wollte nicht zugeben, dass sie betrogen worden war. «Vielleicht braucht er das Geld für die Kirche», liess sie uns wissen. Die Kirche war der einzige Ort, an dem sie sich jede Woche ein paar Momente lang zugehörig fühlte. Doch das Geldkörbchen war bereits unter ihrer Nase, bevor sie überhaupt Platz genommen hatte, und der Priester erinnerte sich nicht mehr an sie. Aber sie war stolz, dass sie Gott näher war, und im Dorf wurde sie respektiert. «Hallo, Mades, wie geht's dir», hiess es, und oft gab uns jemand einen Penny für ein Eis. Am Montag war Gran mit vielen von ihnen wieder auf der Plantage, sie pflückten Baumwolle und summten die Lieder, die sie in der Kirche gelernt hatten. Die Missionare assen aus Silber, die Kirche bezahlte ihnen alles, mit Granmas Schweiss. Uns blieb eine Bibel, die wir nicht verstanden. Granma rührte sie kaum an, denn es war Gottes Wort. Wir waren jedoch immer noch hungrig.
Die Moral der weissen Christen bestimmte unser Leben, aber wir wussten nicht, dass sie selber diese nie praktizierten. Uns in St. Lucia war es nicht erlaubt, uns zu küssen und Händchen zu halten. Uns war nicht erlaubt, mit Müttern und Freundinnen über unsere sexuellen Gefühle zu sprechen. Wir hatten grossen Respekt vor diesen Christen. Es war ein Schock, als wir ihnen später in ihren Ländern begegneten. Was wir dort sahen, war widerlich.
Von Zeit zu Zeit erlaubte uns Granma, ans Meer zu gehen, unter der Bedingung, dass sie mitkam. Darüber war ich nicht immer glücklich, denn sie führte uns an den langweiligsten aller Strände. Sie konnte sich die Busfahrt zu den grossen, schönen Stränden, wo ich Gleichaltrige treffen und schöne Leute hätte anschauen können, nicht leisten. Vielleicht fühlte sie sich dort auch nicht willkommen in ihren selbstgenähten Pumphosen, die nicht zu einer alten Lady passten. Auch ich fühlte mich in dieser Art Unterwäsche nicht wohl.
Wir pflegten frühmorgens vor Sonnenaufgang aufzubrechen, um einen möglichst langen Tag am frischen blauen Meer zu haben. Ben und ich hatten das Privileg, britische Badeanzüge zu besitzen, die wir nur bei diesen seltenen Gelegenheiten, etwa zwei Mal im Jahr, tragen konnten. Vielleicht wünschte sich Granma, sie wäre jünger, um zumindest hinter uns her rennen zu können, wenn wir ungezogen waren. Aber sie war nicht nur alt, sie war müde und hatte nichts, nicht mal uns, denn eines schönen Tages würden wir sie oder würde sie uns für immer verlassen. Ben und ich hatten nur einander zum Spielen, und an diesem speziellen Strand gab es nur wenige Leute aus anderen Dörfern. Granma sass weit vom Wasser entfernt und weit weg von der Sonne. Schwarze setzen sich nicht in die Sonne. Wir waren immer erstaunt, dass die Weissen so viel Hitze ertragen konnten, bis sie sich häuteten oder wund waren.
Ben und ich liebten diese wertvollen Stunden. Wir hüpften ins Wasser, spielten und bespritzten uns. Meistens war Ben sehr grob, Salzwasser kam mir in die Augen. Wir durften nicht ins tiefe Wasser, Granma liess uns keinen Moment aus den Augen. Manchmal schloss sie sich uns an, kam langsam auf uns zu, hielt ihre handgemachte Unterwäsche ohne Oberteil fest. Sie nahm unsere Ärmchen, um uns für das nächste Jahr zu segnen. Sie gab uns je drei Handvoll salziges Meerwasser zu trinken, rieb uns Kopf und Gesicht mit dem heilenden Wasser ein, murmelte einige Worte. Dann brachte sie uns zurück ans Ufer und gab uns unter einer Palme etwas zu essen. Wir sassen einander gegenüber, assen das Sandwich aus Brot und Butter, und dieses Brot war etwas Besonderes.
Ich konnte in Granmas Gesicht lesen, dass sie stolz und glücklich war, uns bei sich zu haben. Wir waren ihre ganze Welt. Ich blickte ihr so tief in die Augen, dass sie beunruhigt aufschrie: «Paula, starr nicht so!» Dann baten wir sie, uns einen letzten Sprung ins Wasser zu erlauben. «Nein, sagte ich euch, Schluss, hört ihr!» «Ja, Granma», sagten wir enttäuscht. Es hatte in ihrer Familie genügend Tragödien gegeben, sie hatte Angst, wir könnten ertrinken. Mir wäre dies einige Jahre später beinahe passiert. Ich kann bis heute nicht schwimmen. Für viele Leute in St. Lucia war das Meer zum Heilen und Fischen da, oder einfach zum Anschauen und Träumen, aber nicht zum Schwimmen.
Die Sonne ging unter, wir packten unsere Sachen zusammen. Das Sandwich wickelten wir in braunes Papier, alles musste sauber sein. Granma wusch unsere Tassen, sie stützte sich dabei mit schmerzendem Rücken schwerfällig auf. Ben und ich bückten uns und halfen ihr wieder auf ihre schwachen Füsse. Sie lächelte mit ihren bräunlichen Zähnen, wovon etwa zehn übriggeblieben waren. Die schlechten Zähne hatte sie sich mit einem Flaschenöffner und mit Hilfe einiger Männer selbst gezogen. Ich erinnere mich an die Szenen, jeweils sonntags nach der Kirche auf dem Marktplatz. Zwei Männer hielten sie an den Armen fest, einer hielt ihre Beine, damit sie nicht vom wackligen Holzstuhl kippte. Meine alte Lady schrie vor Schmerz, aber keine Träne kam in ihre Augen. Die Leute standen um sie herum und wollten ihr in den Mund schauen. Man gab ihr etwas Rum, um den Schmerz und die Bakterien zu töten. Um sie herum der kleine Markt – Leute kauften frisches Rindfleisch und Schweinefleisch, Brot, Eiswürfel, süsse Kokosblocks, Cutcake, Fischplätzchen und die verschiedensten eisgekühlten Getränke. Solche Leckereien konnte sich Gran meistens nicht leisten, höchstens Kuh- oder Schweinefüsse für eine Suppe.
Vom Strand zurück ins Dorf brauchten wir bestimmt eine Stunde oder mehr. Es wurde dunkel, Autos ohne Licht brausten uns wie verrückt entgegen, und wir mussten vorsichtig sein, um nicht in den Strassengraben zu fallen.
Granma schützte uns, wir gingen hinter ihr im Dunkeln. Aus Furcht vor Geistern wagte ich nicht, hinter mich zu schauen. Die Busse fuhren so nahe an uns vorbei, dass ich um meine Füsse fürchtete. «Kommt schon, versucht etwas schneller zu gehen», sagte Gran, «wir müssen von dieser Seite der Strasse weg, es ist zu gefährlich.» Wir erreichten das kleine Dorf, das wir Städtchen nannten. Dort wohnte eine Tante mit ihren zwei Enkelkindern. Dort waren wir zumindest sicher; wenn wir wollten, konnten wir die Nacht über bleiben.
Als Granma starb, blieben Ben und ich alleine zurück, ohne Mutter, ohne Vater. Mutter war in England, und Vater war bereits gestorben, als ich zwei Jahre alt war. Ich fühlte mich verloren unter der karibischen Sonne, als wir zu Auntie Elle, Mutters Schwester, in eine bessere Wohngegend zogen, welche Granma verabscheut hatte.
Ich war in einem Alter, in dem die Dinge für mich langsam Sinn zu machen begannen. Die Kinder meiner Tante waren unbeschwerter – verwöhnt, könnte man sagen. Sie waren Stadtkinder, ich war für sie eine aus dem Busch, aber immerhin eine Puppe zum Spielen.
Es war eine traurige und harte Zeit für mich, bei meiner Tante Elle. Ben und ich wurden wie Dienstboten behandelt, gehörten nicht wirklich zur Familie. Aber ich muss zugeben, es gab auch einige interessante Momente, besonders was Jungs betraf. Ich tat beinahe alles für Aunties Kinder, nur um mit ihnen in die Stadt und an den Strand gehen zu können. Wir waren beinahe jeden Sonntag am Strand, mit Musik, Essen, Freundinnen – aus reichen Familien, würde ich sagen – und vielen Jungs. Wir waren alle jung, keine Erwachsenen in der Nähe. Auntie Elle war viel zu dick, erst recht für einen Badeanzug, nur selten kam sie doch mit. Man konnte sehen, dass Auntie eine sehr schöne Frau gewesen war, mit einer guten Figur, aber jetzt hing alles herunter, nur ihr Gesicht blieb jugendlich frisch, irgendwie unschuldig.
An diesem Strand hatte ich die Gelegenheit, etwas von einem anderen Leben zu sehen. Ich sah braungebrannte, glücklich aussehende Europäer am Sandstrand spielen. Ob sie ein Ferienhaus am Strand gemietet hatten? Oder gehörte es gar ihnen? Sie sahen makellos aus und so, als hätten sie keine Sorgen auf dieser Welt. Wir Armen dagegen hatten an unserem Sandstrand nur unser Lachen. Sie starrten uns an oder übersahen uns, ich fühlte mich wie in einem anderen Land und schmutzig. Ihre Badeanzüge sahen glänzend und teuer aus, ihre gebräunte Haut war wunderschön, verglichen mit unserer. Wir wussten nicht, dass sie stundenlang, mit Sonnenmilch eingecremt, an der Sonne gelegen hatten, um diese Farbe zu bekommen. Kein Dreck hatte diese seidigen Körper berührt, dachten wir, sie hatten in ihrem Leben nichts Schlechtes gesehen. Ihre Kinder spielten mit Bällen, für die unsereins einen Monatslohn hätte zahlen müssen – nur um sich eine Weile zu vergnügen! Sie hatten sogar mehr als einen Ball. Wir mussten uns unser Spielzeug selber machen; es machte Spass, das Ergebnis zu sehen und es mit dem ganzen Dorf zu teilen. Alle waren stolz auf uns, die Freude war unbeschreiblich.
Die Erwachsenen lagen auf ihren Tüchern oder in Liegestühlen, weit weg von uns. Sie luden uns nie zum Spielen ein, und wir verstanden nicht warum. Wir wollten eigentlich nicht immerzu hinsehen. Insgeheim fragte ich mich oft, woher diese Leute kamen. Ich wollte sie beriechen, sie spüren, sie kennenlernen. Ich wusste nicht, dass diese Leute so viel Hass gegen uns in sich hatten, dass sie einige von uns gar töteten. Ich wusste nicht, dass ich in ihren Augen ein Affe war. Ich wusste nicht, dass ich eine Schwarze war und damit zweitklassig. Allein schon ihnen nahe zu sein war wie das Paradies, wie eine andere Welt. Und diese Welt war perfekt, dort konntest du alles haben, was du wolltest. Wie war das nur möglich? Sie vergossen kein Blut, sie waren Gottes Volk, deshalb sahen sie so unberührbar aus.
Sie amüsierten sich, Jungs und Mädchen spazierten händchenhaltend dem Strand entlang. Sie packten ihre Getränke aus – ich hätte fürs Leben gern eine eisgekühlte Fanta gehabt. Sie packten ihr Picknickgeschirr aus: Porzellanteller, silberne Gabeln, nur für den Strand! Wir assen zu Hause meistens mit den Händen, und ich hätte gerne gewusst, wie es war, eine echte Silbergabel in den Händen zu halten.
Meistens sass unsere ganze Familie nahe am Ufer, aber dieses Mal waren Ben und ich allein. Aunties Kinder konnten alle schwimmen, wir wurden mit den Füssen im Wasser am Ufer zurückgelassen. Wir wuschen uns mit den Händen, gerade so, wie Granma es uns beigebracht hatte. Manchmal sprangen wir ins Wasser, obwohl wir uns vor den Wellen fürchteten und hofften, dass keine gefährlichen Fische unter unsere Füsse kamen. Mandy, die einige Jahre älter war, ihre Geschwister und ihre Freundinnen schämten sich wegen uns. Sie konnten den Gebräunten wenigstens zeigen, dass sie schwimmen konnten und nicht von den Bäumen kamen.
Da gab es einen Jungen, der meine Gedanken von Mandy ablenkte. Seine Haare waren tiefschwarz, er war gross und schlank, aber nicht zu mager, ganz mein Geschmack. Er kickte den Ball in unsere Richtung, zum Ufer hin. Er sah so unbeschwert aus, und ich wünschte, ich wäre wie er, hätte Eltern wie er. Ich hätte gerne mit ihm gespielt. Unsere Blicke begegneten sich, und ich wünschte, er würde mich umarmen. Ich hatte bereits die Figur einer jungen Frau, sah jedoch sehr naiv und sehr karibisch aus in meinem orangefarbenen englischen Bikini.
Mandys Geschrei ging mir durch und durch: «Paula, komm her!» – als ob sie meine Mutter wäre. Einige Minuten zuvor hatte sie versucht, mich zu ertränken. Sie wolle mich schwimmen lehren, hatte sie gesagt, und mich ins tiefe Wasser geführt. Ich schluckte Wasser. «Mandy, Mandy», schrie ich voller Panik, mit schreckgeweiteten Augen. Jeden Moment konnte es mit meinem jungen Leben zu Ende sein. Sie stand im tiefen Wasser und lachte mich aus. Ich tauchte unter, prustete, schlug aufs Wasser, strampelte mit meinem winzigen Körper nach allen Seiten. Sie hielt mich an meinen geflochtenen Haaren fest. «Du ertränkst mich», schrie ich. Sie schwamm um mich herum, drückte meinen Kopf unter Wasser. Alle schauten zu, ohne das Drama ernst zu nehmen. «Bitte, Mandy, lass mich!» Sie liess mich los. Ich stolperte ans Ufer. Es hatte nur einige Minuten gedauert, aber mir schienen es Stunden. Ich habe diesen Tag nie vergessen.
Da sie zwei Jahre älter war als ich, hatte sie das Recht mich zu schlagen, wie es ihr gefiel und wann sie wollte. «Was tust du da, Paula?» fragte sie, als sie auf mich zukam. Ich sass unter einer Kokospalme, mitten in der Schönheit Gottes. Die andern Kinder spielten mit jemandes Ball. «Was meinst du?» Ich zitterte ein wenig. «Haben wir dir nicht gesagt, du sollst keine Fremden anstarren und nicht mit ihnen reden!» Ich vermutete, sie wünschte sich, an meiner Stelle zu sein. «Ich habe mit niemandem gesprochen.» Sie schlug mir ins Gesicht: «Lüg mich nicht an! Ich habe dich gesehen.» «Er hat nur den Ball in meine Richtung gespielt.» Sie quetschte mein Ohr, machte klar, wer der Boss war, und hoffte, der gebräunte Junge sähe ihr zu. Ich fühlte mich beschämt und erniedrigt. Sie stiess mich vor sich her: «Nimm deine Kleider und geh in den Bus!» Ich hob meine ziemlich zerlumpten Kleider auf und setzte mich hinten in den Bus, während die andern sich amüsierten. Die Sonne brannte, Tränen liefen mir übers Gesicht. Ich hätte gerne nach meinem flüchtigen Freund gesucht, aber ich schämte mich, den Kopf zu wenden. Dann kamen Mandy und ihre Geschwister und Freundinnen. «Paula, was ist los mit dir? Warum weinst du?» fragte mein Bruder, der damals neun Jahre alt war. Ich erzählte ihm nichts, er hätte sie in Stücke gehauen, mit seinem Messer, so sehr hasste er sie und den Rest der Familie. Auch hatte er Granmas Tod nicht verwunden. Er war ein zorniger, karibischer Junge. In kürzester Zeit war der Bus voll. Die Fahrt war gut, aber ich wünschte, sie ginge in eine andere Richtung. Hatte er mich wirklich angesehen, oder war ich wieder in Phantasien? Wer weiss, vielleicht begegneten wir uns eines Tages wieder. Doch erst musste ich die Jahre des Nichtakzeptiertseins aushalten, bis zu dem Tag, an dem ich nach England zurückkehren würde. Wenn es doch nur so wäre!
Jungen und Mädchen blieben bei uns unter sich: Jungen spielten mit Jungen, Mädchen mit Mädchen, obwohl wir uns alle der Gefühle der anderen bewusst waren. Wir Mädchen kicherten, unsere Augen gross und glänzend vor Erregung. Wir sassen einander gegenüber, flochten lange Grashalme, sprachen im stillen einen Wunsch aus und liessen den Grashalm fliegen – hin zum auserwählten Jungen. Wir hofften, er würde kommen; manchmal klappte es, manchmal nicht. Jedenfalls gab es viele geflochtene Grashalme rund um unsere Schule.
Am Wochenende hatten wir meistens nichts anderes zu tun als zu träumen und zu grübeln, und wir Mädchen gingen saure Pflaumen oder Tamarinden pflücken. Die Tamarinde ist eine köstliche, süssaure Frucht mit einem länglichen Kern, die man pflückt, wenn sie braun wird. Wir lagen im Gras, saugten sie aus und warteten, bis die Sonne unterging.
«Paula», fragte Koretter, eine meiner Freundinnen, «was wünscht du dir, wenn du erwachsen bist?» Ich sass da, das Kinn in die Hände gestützt, und dachte lange und entspannt nach. Irgendwie konnte ich nur lächeln. Ich wusste nicht, womit beginnen und ob ich mich bei meinen Freundinnen gehen lassen sollte. Mit neun Jahren, nachdem Gran gestorben war, hatte ich gelernt, nie jemandem zu trauen, vielleicht nicht einmal mir selber. Und ausserdem wusste ich nicht, ob meine Wünsche nicht zu sehr Illusionen waren. Ich fühlte mich nicht als etwas Besseres, aber ich sah die Welt anders und wusste nicht, weshalb ich solche Gedanken hatte.
Meine St.-Lucia-Freundinnen hatten klare Träume ohne dunkle Streifen. Meine Träume jedoch hatten immer etwas mehr Szenerie und hellere oder dunklere Farben. Deshalb verriet ich ihnen nie meine Gedanken. Sie würden sie einfach nicht verstehen. Sie würden denken, ich wolle zuviel oder ich analysiere zuviel. Sie dachten nicht gerne zu genau über ihre Träume nach, die seit Generationen dieselben waren, von der Grossmutter an die Mutter weitergegeben. Ihre Träume waren nur ein bisschen realistischer als die der Vorfahren, weil es jetzt mehr Möglichkeiten gab, sie wahr werden zu lassen.
Koretter war ein Mädchen, das genau wusste, wohin sein Weg führte. Sie teilte allen ihre Träume mit. «Ich möchte meinen Schulschatz heiraten. Wenn er nur mit mir spazieren gehen würde, dann würde ich ihm von meinem Traum erzählen. Ich möchte seine Frau sein und ihm alles geben, was ein Mann sich wünscht, viele Kinder, ein Haus und einen Hof haben und zusammen alt werden.» Ich denke zurück an den Jungen, den sie im Auge hatte. Ja, er war schön – für sie, nicht für mich –, er war gross, aber er sah aus wie einer, dem eine Frau nicht genug war. Und überhaupt mochte ich seine Dreistigkeit nicht. Er hatte keine Manieren ihr gegenüber. Vielleicht wusste er, wie er ihr schmeicheln musste. Einige Frauen mögen es, wenn ein Mann grob ist, und er war grob. Sie war erst elf und lief ihm bereits hinterher. Ich hätte ihm am liebsten gesagt, er solle verschwinden, benahm er sich doch bereits wie ein König. Ja, er war ein kluger Kerl, er würde eine gute Ausbildung haben mit einem guten Verdienst. Aber sie würde mit ihm in die Hölle und in den Himmel geraten und wieder zurück. Und es schien mir, als hätte sie das bereits akzeptiert.
Wie konnte sie so bescheiden sein in ihren Träumen? Vielleicht, weil sie nirgendwohin konnte. Sie war, wo sie hingehörte, eine echte St.-Lucia-Frau. Sie war stolz auf ihr Land, auch wenn sie unter der Armutsgrenze lebte. Sie wusste, dass es ihre Bestimmung war, hier zu bleiben. Ich dagegen sah mich nicht als St.-Lucia-Mädchen, aber ich konnte ihr das nicht gestehen. Ich wollte weg, und sie sollte nicht wissen, warum. «Paula, hör auf zu sinnieren, es wird schon dunkel, meine Eltern werden mich suchen. Ich muss meine kleinen Schwestern waschen und zu Bett bringen.» «Koretter, ich weiss nicht, was ich träume. Ich müsste zu vieles erklären. Ich wünschte, ich wäre du. Wie kannst du dir nur so sicher sein?» «Ich bin sicher, das ist alles. Ich weiss, was ich will. Ich will nicht viel. Ich bin ein einfaches Mädchen.» Und was ist mit mir, fragte ich mich. Ich zuckte die Achseln, als wir den Hügel hinuntergingen. Es war sehr dunkel, nirgends ein Licht. Sie hatte keine Angst vor der Dunkelheit, ich jedoch schon. Warum wohl? Ich ging zu meiner Tante, und sie ging glücklich zu ihren Eltern.
Ich flirtete mit Jungs, träumte beinahe schon wie Koretter, doch es schien nie ganz zu gelingen. Warum war ich so unzufrieden? Was war falsch mit mir? Was wollte ich? Spielte ich, oder sah ich anders aus als meine St.-Lucia-Freundinnen? Stellte ich mich selber zu hoch? Oder war ich einfach ein Mädchen, das etwas wusste, was sie nicht wussten? Ich fühlte mich tiefgründig und etwas Besonderes – als ob ich aus irgendeinem wichtigen Grund auf diese Welt gekommen wäre. Aber wofür? Ich wollte es herausfinden.
Ich habe Koretter seit neunundzwanzig Jahren nicht gesehen. Ob sie noch immer ihren Traum vom Schulschatz träumt? Ich würde gerne eines Tages wissen, was aus ihr geworden ist. Für mich jedenfalls war es das Beste, dass ich nicht wusste, wohin meine Träume mich führten.