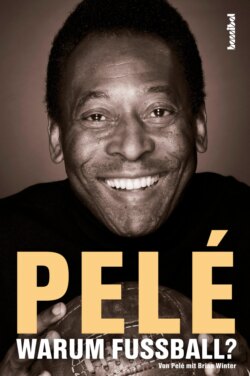Читать книгу Pelé - Warum Fußball? - Pelé - Страница 6
Оглавление- 1 -
„Gooooooooollllllllllll!!!!!!!!“
Wir lachten. Wir schrien. Wir hüpften auf und ab. Meine ganze Familie hatte sich in unserem kleinen Haus versammelt. Alle Familien im ganzen Land taten es uns gleich.
450 Kilometer entfernt kämpfte das mächtige Brasilien vor einem lautstarken Heimpublikum in Rio de Janeiro im Endspiel der Weltmeisterschaft gegen das winzige Uruguay um den Titel. Unser Team war der Favorit. Unsere Zeit war gekommen. Und in der zweiten Minute der zweiten Halbzeit entkam einer unserer Angreifer, Friaça, seinem Gegenspieler und schoss flach und scharf in Richtung Tor. Der Ball flog am Torwart vorbei ins Netz.
Brasilien – Uruguay 1:0.
Es war wunderschön – obwohl wir das Tor nicht mit eigenen Augen sehen konnten. Es gab kein Fernsehen in unserer kleinen Stadt. Um genau zu sein: Die allerersten Fernsehübertragungen Brasiliens fanden während genau dieser Weltmeisterschaft statt – aber nur in Rio. Also mussten wir uns, so wie die meisten Brasilianer, mit dem Radio begnügen. Meine Familie hatte ein gigantisches Gerät, das rechteckig war und runde Knöpfe sowie eine V-förmige Antenne besaß. Es stand in der Ecke unseres Wohnzimmers, in dem wir nun wie verrückt herumsprangen und johlten.
Ich war erst neun Jahre alt, aber ich werde dieses Gefühl nie vergessen: die Euphorie, den Stolz und die Vorstellung, dass meine beiden größten Lieben – Fußball und Brasilien – sich nun im Sieg vereinen würden. Ich erinnere mich an meine Mutter und ihr Lächeln. Und an meinen Vater, meinen Helden, der so rastlos in diesen Jahren war, getrieben von seinen eigenen zerbrochenen Fußball-Träumen, wie er plötzlich wieder jung war und von Freude überwältigt seine Freunde umarmte. Es sollte genau 19 Minuten lang so bleiben.
Wie Millionen andere Brasilianer musste auch ich erst noch eine harte Lektion lernen: Im Leben, wie im Fußball, ist nichts vorbei, bevor der Schlusspfiff ertönt.
Ach, aber wie hätten wir das auch wissen können? Wir waren ein junges Volk, eine junge Nation, die ein junges Spiel spielte.
Unsere Reise hatte gerade erst begonnen.
- 2 -
Vor diesem Tag, dem 16. Juli 1950, einem Datum, an das sich jeder Brasilianer wie an den Tod eines geliebten Menschen erinnert, wäre es schwer denkbar gewesen, dass es etwas gäbe, das unser ganzes Land zusammenbringen könnte.
Die Brasilianer wurden damals durch viele Dinge getrennt – die enorme Größe unseres Landes etwa. Unsere kleine Stadt namens Baurú, die hoch auf einem Plateau im Staat São Paulo liegt, schien eine ganze Welt von der glamourösen Strand-Metropole Rio, in der das entscheidende Spiel ausgetragen wurde, entfernt zu sein. Rio war ganz Samba, Tropenhitze und Bikini-Girls – eben das, was sich Leute in aller Welt vorstellen, wenn sie an Brasilien denken. In Baurú hingegen war es am Spieltag so kühl, dass Mama sich entschloss, den Ofen in unserer Küche anzufeuern – ein Aufwand, von dem sie sich erhoffte, dass er unsere Gäste vor dem Erfrieren bewahren würde.
Wenn wir uns schon weit weg von Rio fühlten, so kann ich mir nur vorstellen, wie es meinen brasilianischen Landsleuten im Amazonasgebiet, den riesigen Sümpfen des Pantanal oder der felsigen, kargen Sertão im Nordosten gegangen sein muss. Brasilien ist größer als die kontinentalen USA, und damals fühlte es sich sogar noch größer an. Damals konnten sich nur die Reichen Autos leisten. Es gab auch nur wenige asphaltierte Straßen, auf denen man mit ihnen hätte fahren können. Jemals etwas anderes als unsere Heimatstadt zu sehen, war ein vager Traum, der nur für wenige wahr wurde. Ich sollte erst mit 15 zum ersten Mal das Meer sehen, geschweige denn ein Mädchen im Bikini!
Aber in Wahrheit war es nicht nur die Geografie, die uns trennte. Brasilien, das auf vielerlei Arten ein reicher Ort ist, der mit Gold und Öl und Kaffee und Millionen von anderen Gaben gesegnet ist, kam einem oft wie zwei verschiedene Länder vor. Die Tycoone und Politiker in Rio hatten ihre Villen, ihre Pferderennbahnen und ihre Strandurlaube. Auf der anderen Seite hatte in jenem Jahr, 1950, als Brasilien zum ersten Mal die WM veranstaltete, gut die Hälfte der Bevölkerung nicht ausreichend zu essen. Nur jeder Dritte konnte gut lesen. Mein Bruder, meine Schwester und ich gehörten zu jener Hälfte, die üblicherweise barfuß ging. Diese Ungleichheit war in unserer Politik, unserer Kultur und unserer Geschichte verwurzelt – ich war ein Teil der erst dritten Generation meiner Familie, die als freie Menschen zur Welt gekommen war.
Viele Jahre später, nach meiner aktiven Karriere, traf ich den großen Nelson Mandela. Von den vielen Menschen, die ich kennenlernen durfte – darunter Päpste, Präsidenten, Könige und Hollywood-Stars – beeindruckte mich keiner mehr als er. Er sagte: „Pelé, hier in Südafrika gibt es viele unterschiedliche Menschen, die viele verschiedene Sprachen sprechen. In Brasilien gäbe es so viel Reichtum und nur eine einzige Sprache, Portugiesisch. Wie kommt es, dass dein Land nicht reich ist? Warum ist dein Land nicht geeint?“
Ich konnte ihm damals keine Antwort geben und habe auch heute nicht wirklich eine. Aber während meines 73-jährigen Lebens konnte ich den Fortschritt verfolgen. Und ich denke, dass ich weiß, womit es anfing.
Die Menschen können den 16. Juli 1950 verfluchen, so viel sie wollen. Ich habe Verständnis dafür. Aber ich glaube, dass wir Brasilianer uns an diesem Tag auf unsere lange Reise zu einer größeren Geeintheit begaben. Damals versammelte sich unser ganzes Land um das Radio, feierte und litt gemeinsam. Zum ersten Mal als eine Nation.
An jenem Tag begannen wir, die wahre Kraft des Fußballs zu begreifen.
- 3 -
Meine frühesten fußballerischen Erinnerungen drehen sich um spontane Spielchen auf unserer Straße, die zwischen kleinen Backsteinhäusern und Schlaglöchern auf der Fahrbahn stattfanden. Ich schoss Tore, lachte wie ein Verrückter und rang nach kalter, schwerer Luft. Wir spielten stundenlang, bis unsere Füße wehtaten, die Sonne unterging und unsere Mütter uns nach Hause riefen. Keine schmucke Ausrüstung, keine teuren Trikots. Nur ein Ball – oder eben etwas Ähnliches. Darin liegt viel der Schönheit dieses Spiels.
Fast alles, was ich mit dem Ball anstellte, lernte ich von meinem Vater, João Ramos do Nascimento. Praktisch jeder in Brasilien kannte ihn auch unter seinem Spitznamen – „Dondinho“.
Dondinho stammte aus einer Kleinstadt im Staat Minas Gerais, was auf Deutsch „Allgemeine Minen“ bedeutet. Dort wurde in den Kolonialzeiten der Großteil von Brasiliens Gold gefördert. Als Dondinho meine Mutter Celeste kennenlernte, leistete er gerade seinen Wehrdienst ab. Sie ging damals zur Schule. Sie heirateten, als sie gerade mal 15 war. Mit 16 war sie mit mir schwanger. Sie gaben mir den Namen „Edson“ nach Thomas Edison, da 1940, als ich geboren wurde, die elektrische Glühbirne erst kürzlich Einzug in ihre Stadt gehalten hatte. Sie waren davon so beeindruckt, dass sie sich mit meinem Namen vor dem Erfinder verneigen wollten. Obwohl sich herausstellte, dass sie einen Buchstaben ausgelassen hatten, gefällt mir mein Name sehr.
Dondinho nahm seinen Dienst in der Armee sehr ernst, aber sein Herz gehörte dem Fußball. Er war über einen Meter achtzig groß, ein Hüne für brasilianische Verhältnisse, und sehr versiert am Ball. Er war besonders kopfballstark. Einmal gelangen ihm während eines Spiels unglaubliche fünf Treffer per Kopf. Das dürfte wohl noch immer ein nationaler Rekord sein. Jahre später erzählten sich die Leute, nicht ganz ohne zu übertreiben, dass der einzige brasilianische Tor-Rekord, den Pelé nicht innehat, von seinem Vater gehalten wird.
Es war sicher kein Zufall. Ich bin sicher, dass Dondinho einer der besten brasilianischen Spieler hätte sein können. Er bekam nur nicht die Chance, es unter Beweis zu stellen.
Als ich geboren wurde, spielte mein Vater auf halbprofessioneller Ebene in einer Stadt in Minas Gerais namens Três Corações, was „Drei Herzen“ bedeutet. Ehrlich gesagt verdiente er nicht sehr gut dabei. Ein paar der großen Clubs bezahlten damals ganz gut, aber die große Mehrheit tat das nicht. Fußballspieler waren mit einem gewissen Makel behaftet – so wie auch Tänzer, Künstler oder jeder andere Beruf, dem Menschen aus Liebe und nicht wegen des Geldes nachgehen. Unsere junge Familie zog von Stadt zu Stadt, von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck. Einmal lebten wir ein ganzes Jahr im Hotel, aber nicht in einem sehr luxuriösen. Später scherzten wir, dass es ein Null-Sterne-Resort für Fußballer war – genauso wie für Handelsreisende und Penner.
1942, kurz vor meinem zweiten Geburtstag, sah es so aus, als würden sich die Entbehrungen bezahlt machen, als würde Dondinho der Durchbruch gelingen. Er erhielt ein Angebot von Atlético Mineiro, dem größten und reichsten Verein in Minas Gerais. Es wäre ein Fußball-Job gewesen, mit dem er die ganze Familie hätte ernähren können, vielleicht sogar mehr als das. Mein Papa war 25, er hatte seine Karriere also noch vor sich, aber in seinem ersten Match gegen São Cristóvão, einem Team aus Rio, ereilte Dondinho ein Schicksalsschlag. Er krachte in vollem Tempo gegen einen gegnerischen Verteidiger namens Augusto.
Das war nicht das Letzte, was man von Augusto hören sollte. Er erholte sich und setzte seine Karriere fort. Traurigerweise war dieser Vorfall aber auch so etwas wie der Höhepunkt in der Spielerlaufbahn meines Vaters. Sein Knie war irreparabel beschädigt. Es waren die Bänder, vielleicht der Meniskus. Ich schreibe „vielleicht“, da es damals noch keine Kernspintomographie gab. Eigentlich gab es damals auch noch gar keine nennenswerte Sportmedizin in Brasilien. Wir wussten oft nicht, was nicht mit uns stimmte, und schon gar nicht, was wir dagegen hätten tun können. Wir packten einfach Eis auf unsere schmerzenden Körperteile, lagerten sie hoch und hofften auf das Beste. Ich muss wohl nicht hinzufügen, dass Dondinhos Knie nie mehr wirklich heilte.
Da er nicht in der Lage war, ein zweites Spiel zu bestreiten, verlor Dondinho seinen Platz im Kader und wurde zurück zu Três Corações abgeschoben. Damit begannen unsere eigentlichen Wanderjahre, eine Phase, in der meine Familie permanent kämpfen musste, um über die Runden zu kommen.
Sogar wenn es uns relativ gut ging, war es hart. Dondinho war nun oft zu Hause, um sein Knie zu schonen. Er hoffte, dass es wieder irgendwie zusammenwachsen würde und er zurück zu Atlético könnte bzw. sich vielleicht eine andere lukrative Option auftäte. Ich kann ihn gut verstehen. Er hielt diesen Weg für die beste Möglichkeit, seiner Familie ein gutes Einkommen zu bieten. Aber wenn es ihm nicht gut genug ging, kam fast gar kein Geld herein. Und natürlich gab es im Brasilien der 1940er-Jahre auch keine soziale Absicherung. In der Zwischenzeit gesellten sich noch mehr hungrige Mäuler zu uns, mein Bruder Jair und meine Schwester Maria Lucia. Die Mutter meines Vaters, Dona Ambrosina, und der Bruder meiner Mutter, Onkel Jorge, zogen auch zu uns.
Meine Geschwister und ich trugen gebrauchte Kleidung, die manchmal auch aus Getreidesäcken genäht war. Für Schuhe reichte das Geld nicht. An manchen Tagen bestand das einzige Mahl, das uns unsere Mama bieten konnte, aus einem Stück Brot und einer Banane. Dazu vielleicht ein bisschen Reis und ein paar Bohnen, die Onkel Jorge von seiner Arbeit bei einem Gemischtwarenhändler mitbrachte. Nun, damit ging es uns im Vergleich zu sehr vielen Brasilianern ziemlich gut – wir gingen nie hungrig ins Bett. Unser Haus war nicht klein und stand auch nicht in einem Slum – oder einer Favela, um das brasilianische Wort zu benutzen. Aber das Dach war undicht, und Wasser rann während jedes Sturms auf unseren Fußboden. Und dann war da noch die ständige Unruhe, die wir alle, auch die Kinder, verspürten, da wir nicht wussten, woher die nächste Mahlzeit kommen würde. Jeder, der in Armut gelebt hat, kennt diese Unsicherheit, diese Angst, die, sobald sie erst einmal in deine Knochen gekrochen ist, dich nie mehr loslassen wird. Ganz ehrlich, manchmal spüre ich sie heute noch.
Die Dinge wendeten sich zum Besseren, als wir nach Baurú übersiedelten. Papa bekam einen Job in der Casa Lusitania – einem Gemischtwarenhandel, der demselben Mann gehörte, der auch den BAC, den Baurú Athletic Club, besaß. Dieser Club war einer von zwei halbprofessionellen Vereinen in der Stadt. Unter der Woche arbeitete Dondinho als Bote, kochte und servierte Kaffee und verteilte die Post. Was eben so anfiel. Am Wochenende war er der Star-Angreifer des BAC.
Auf dem Feld zeigte mein Papa, wenn er fit war, ansatzweise die Genialität, die ihn einst beinahe bis fast ganz nach oben gebracht hatte. Er schoss viele Tore, womit er BAC zu einem Meistertitel der halbprofessionellen Liga in São Paulo verhalf. Er hatte auch ein gewisses Charisma, eine elegante und fröhliche Art, die er trotz der Rückschläge, die er als Fußballer hinnehmen musste, stets behielt. So ziemlich jeder in Baurú wusste, wer er war. Er war sehr beliebt. Egal, wo ich hinging, kannte man mich als Dondinhos Sohn – ein Titel, auf den ich heute ebenso stolz bin, wie ich es damals war. Aber die Zeiten waren immer noch schwierig. Ich erinnere mich, dass ich mir schon damals dachte, es sei unnütz, berühmt zu sein, wenn man kaum genug zum Überleben verdient.
Vielleicht hätte sich Dondinho nach einer anderen Beschäftigung umsehen können. Aber der Fußball kann sowohl großzügig als auch grausam sein. Diejenigen, die sich von ihm verzaubern lassen, können sich nie mehr wirklich lösen. Als Dondinho merkte, dass sein eigener Traum nicht mehr wahr werden würde, begann er, sich mit Herz und Seele in den Dienst des Traumes eines anderen zu stellen.
- 4 -
„Du glaubst also, dass du was draufhast?“
Ich starrte auf meine Füße und lächelte.
„Kick den Ball hier hin“, sagte er, während er auf einen Fleck an unserer Hausmauer zeigte.
Wenn es mir gelänge zu treffen, was üblicherweise der Fall war, würde er kurz grinsen, nur um dann ganz abrupt wieder ernst zu werden.
„Sehr gut! Jetzt mit dem anderen Fuß!“
Volltreffer!
„Jetzt mit dem Kopf!“
Volltreffer!
So ging das viele Stunden, manchmal bis spät in die Nacht, nur wir zwei, er und ich. Das waren die fundamentalsten Grundlagen: dribbeln, schießen, passen. Wir durften in der Regel nicht auf das örtliche Spielfeld, also nutzten wir die Plätze, die sich uns boten. Das waren unser winziger Innenhof und die Straße, in der sich unser Haus befand, die Rubens-Arruda-Straße. Manchmal erzählte er mir Geschichten von Spielen, die er bestritten hatte. Dann zeigte er mir Tricks, die er gelernt oder selbst erfunden hatte. Gelegentlich erzählte er mir auch von seinem älteren Bruder, einem Mittelfeldspieler, der aber schon mit 25 gestorben war – eine weitere vielversprechende Karriere eines Nascimentos, die nie zur vollen Blüte hatte reifen dürfen.
Meistens ließ er mich fußballerische Grundlagen trainieren. Rückblickend waren einige seiner Übungen ziemlich witzig. So band er etwa den Ball an den Ast eines Baumes und ließ mich stundenlang mit dem Kopf dagegenspringen. Aber das war ein Kinderspiel im Vergleich zu Dondinhos Methode, mir beizubringen, einen Ball richtig ins Tor zu köpfen. Er schnappte sich den Ball und donnerte ihn mir mit voller Wucht immer wieder gegen die Stirn. Er schrie: „Nicht blinzeln! Nicht blinzeln!“ Sein Ansatz war, dass ich lernen müsse, die Augen offen zu halten, um den Ball gut platzieren zu können. Er befahl mir sogar, mir den Ball selbst gegen den Kopf zu knallen, wenn ich alleine sei. Nun, das tat ich dann auch. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie albern das ausgesehen haben muss. Allerdings hielt Dondinho das für sehr wichtig – und er hatte recht. Diese Übung sollte mir später sehr zugutekommen.
Dondinho wollte, dass ich mich neben dem Kopfballspiel auf zwei Fertigkeiten besonders konzentriere: Erstens sollte ich den Ball während des Dribbelns ganz eng am Körper führen und zweitens auf meine Beidfüßigkeit achten.
Warum betonte er diese Dinge? Vielleicht wegen der kleinen Plätze, auf denen wir kickten – den Straßen, Gassen und Höfen von Baurú. Aber womöglich auch, weil meinem Vater auffiel, wie klein und schmächtig ich war. Als Erwachsener sollte ich lediglich einen Meter siebzig groß werden, und es zeichnete sich damals schon ab, dass ich eher kurz geraten würde. Also würde ich ganz anders als Dondinho über keinerlei körperliche Vorteile auf dem Spielfeld verfügen. Da ich meine Gegenspieler weder umrennen noch höher als sie würde springen können, musste ich lernen, den Ball zu einer Verlängerung meines Körpers zu machen.
Dondinho brachte mir alle diese Dinge bei, wobei man anmerken muss, dass dies für ihn durchaus riskant war. Denn meine Mutter verabscheute die Vorstellung, dass ihr ältester Sohn ein Fußballer werden könnte. Und wer konnte ihr das verdenken? Für Dona Celeste war Fußball eine Sackgasse. Es war ein Weg, der in die Armut führte. Sie war eine starke Frau, die stets über uns wachte. Sie bewahrte stets einen klaren Kopf in einem Haushalt voller Träumer. Sie wollte, dass ich in meiner Freizeit für die Schule lernte, damit ich es später zu etwas brächte. Damals wie heute war sie der gute Engel auf unseren Schultern, der uns ermutigte, das Richtige zu tun. Sie wollte ein besseres Leben für uns. Deshalb rügte sie mich jedes Mal scharf, wenn sie mich beim Fußballspielen erwischte. Mitunter nicht nur verbal!
Obwohl sie es nur gut meinte, konnte meinen Vater und mich nichts bremsen. Was hätte sie tun sollen? Wir waren beide infiziert. Und schließlich kam der Zeitpunkt, als Dona Celeste aus dem Haus kam, uns beim Kicken sah, ihre Hände in die Hüften stemmte und resignierend seufzte:
„Wunderbar. Dein ältester Sohn! Komm bloß nicht angerannt, wenn er später hungert statt Medizin oder Recht zu studieren!“
Dondinho legte daraufhin einen Arm um sie und lachte.
„Sorge dich nicht, Celeste. Bis er seinen linken Fuß nicht unter Kontrolle hat, gibt es nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest!“
Der Elternteil, dessen eigene sportlichen Ambitionen zum Scheitern verurteilt waren und der nun eine Tochter oder einen Sohn trainiert, damit sie seine Träume erfüllen, ist eine alte Geschichte – und eine tückische obendrein. Manche Kinder lehnen die Belastung ab, die mit diesen Erwartungen verbunden ist. Andere wiederum drehen angesichts des Drucks einfach durch. Manche wollen nie wieder gegen einen Ball treten.
Ich war da anders, weil ich Fußball einfach liebte. Ich genoss es, den Ball an meinem Fuß und die Sonne in meinem Gesicht zu spüren. Ich schätzte das Gemeinschaftsgefühl eines Teams und die Elektrizität, die durch meine Venen schoss, wenn ich ein Tor erzielte. Aber am meisten liebte ich es, Zeit mit meinem Papa zu verbringen. Während all dieser Stunden, die wir trainierten, dachte Dondinho wohl nie daran, dass ich reich oder berühmt werden würde. Damals zumindest noch nicht. Er liebte einfach nur das verdammte Spiel – und wollte seinem Sohn diese Liebe vermitteln.
Er hatte Erfolg damit. Und ich muss anmerken, dass diese Liebe nie nachgelassen hat. Sie sitzt tief in mir drin, so wie eine Religion oder eine Sprache, die man von klein auf erlernt. Mein Papa ist nicht mehr bei uns. Allerdings kann ich bis heute nicht die Liebe für das Spiel von meiner Liebe zu meinem Vater trennen.
- 5 -
Im Laufe meines Lebens sollte ich die Ehre haben, in beinahe jedem herausragenden Stadion der Welt auflaufen zu dürfen – darunter das Maracanã in Rio, Camp Nou in Barcelona und sogar das Yankee Stadium in New York City. Aber meine ersten Auftritte absolvierte ich auf der geweihten Erde des „Rubens-Arruda-Stadions“, welches eigentlich kein Spielfeld im herkömmlichen Sinne war, sondern vielmehr die staubige Straße vor unserem Haus in Baurú. Die Kinder aus der Nachbarschaft waren meine ersten Kontrahenten. Alte Schuhe dienten uns als Torpfosten. Die Häuser lagen jenseits der Spielfeldbegrenzung – jedenfalls meistens. Und wenn ein verirrter Schuss eine Straßenlaterne oder ein Fenster in Mitleidenschaft zog, so rannten wir wie die Irren davon, obwohl die Schuld meistens an mir hängenblieb, da ich weithin als der größte Fußballnarr unserer Gruppe galt. Das war der Nachteil daran, Dondinhos Sohn zu sein.
Unsere Spiele unterstrichen meine Behauptung, dass Fußball die Menschen wie keine andere Aktivität zusammenbringe. Für andere Sportarten wie Baseball, Cricket oder American Football braucht man allerlei Ausrüstung und streng organisierte Teams. Das war nichts für arme, chaotische Kinder aus einem Ort wie Baurú. Für Fußball brauchten wir bloß einen Ball. Man konnte eins gegen eins oder elf gegen elf spielen – es war derselbe Spaß.
In meiner Nachbarschaft fanden sich zu jeder erdenklichen Tageszeit mindestens sechs bis zehn Kinder, die spielen wollten. Unsere Mütter waren in der Nähe, damit sie ein Auge auf uns haben konnten. Allerdings gab es nicht viel, worüber sie sich in dieser brasilianischen Kleinstadt der 1940er hätten Sorgen machen müssen – es gab keine Autos, kaum Gewaltverbrechen, und jeder kannte jeden.
Also fand praktisch ständig irgendein Match im Rubens-Arruda-Stadion statt, wenn nicht der Schiedsrichter – also meine Mutter – das Spiel unterbrach.
Eine andere Sache, die den Fußball so toll macht, ist, dass buchstäblich jeder mitspielen kann. Es ist egal, ob jemand klein, groß, stark oder geschickt ist, solange man laufen und schießen kann. Daher zogen unsere Partien alle möglichen Kinder an. Jede unserer Mannschaften war eine Miniaturausgabe der Vereinten Nationen: Da waren syrisch-, portugiesisch-, italienisch-, japanischstämmige Kinder und natürlich viele Afrobrasilianer wie ich.
Auf diese Weise stellte Baurú auch ein gutes Abbild von Brasilien dar, das so viele Immigranten aus der ganzen Welt aufgenommen hatte. Es war ein echter Schmelztiegel, nicht weniger vielfältig als die USA. Nicht viele Ausländer wissen etwa, dass São Paulo die größte japanische Community außerhalb Japans beherbergt. Baurú lag 350 Kilometer von São Paulo entfernt und war gefühlt eine Million Mal kleiner, aber auch zu uns kamen Immigranten, die auf den Kaffee-Plantagen außerhalb der Stadt Arbeit suchten. Meine Nachbarn hatten Nachnamen wie Kamazuki, Haddad und Marconi. Der Fußball ließ uns über etwaige Unterschiede zwischen uns hinwegsehen, und nach den Spielen ging ich mit zu ihnen nach Hause, um mit ihnen Yakisoba, Kebbe oder auch nur brasilianische Bohnen zu essen. Es war eine tolle Art, die Welt kennenzulernen, und weckte in mir schon früh den Wunsch, mich mit anderen Kulturen zu beschäftigen, wozu ich in den folgenden Jahren oft genug die Möglichkeit bekommen sollte.
Ich konnte es kaum erwarten, mit dem Spielen anzufangen, daher war ich auch derjenige, der in der Regel die Teams einteilte. Eine komplizierte Angelegenheit. Warum? Nun ja, ich will nicht unbescheiden klingen, aber die Trainingseinheiten mit Dondinho fingen an, sich auszuzahlen. Und das wurde zu einem Problem. Meine Mannschaft gewann ihre Spiele mit Resultaten wie 12:3 oder 20:6. Manche Kinder, sogar solche, die älter als ich waren, begannen sich zu weigern, gegen uns anzutreten. Also versuchte ich, sie zu beruhigen, indem das Team, in dem ich spielte, in Unterzahl gegen sie auflief. Als auch das nicht mehr half, stellte ich mich für die erste Halbzeit als Goalie ins Tor, damit der Spielstand vorerst ausgeglichen blieb. Erst in der zweiten Hälfte kam ich in der Offensive zum Zug. Die Entscheidung, mich damals so oft zwischen die Pfosten zu stellen, würde im Verlauf meines Lebens noch auf seltsame Weise Nachhall finden und mir schließlich auch meinen Spitznamen einbringen – denjenigen, unter dem mich die ganze Welt kennt.
Die brasilianischen Spitznamen sind eine lustige Sache – beinahe jeder hat einen, manche haben aber auch drei oder vier. Damals kannte man mich noch als „Dico“ – meine Familie nennt mich sogar heute noch so. Mein Bruder Jair war als „Zoca“ bekannt. Wenn Zoca und ich nicht gerade Fußball spielten, erlebten wir mit unseren Freunden viele Abenteuer in der ganzen Stadt – der Bahnhof etwa befand sich nur wenige Blocks von unserem Haus entfernt. Wir hingen dort herum, um uns die Leute anzusehen, die aus São Paulo oder sonst wo eintrafen. Es war unser Fenster zur weiten Welt. An anderen Tagen fischten wir im Fluss, direkt unter einer Eisenbahnbrücke. Freilich konnten wir uns keine Angelruten mit Spulen leisten, deshalb liehen wir uns runde, mit Holz eingefasste Siebe, um mit ihnen die Fische aus dem Wasser zu schöpfen. Oft liefen wir mit unseren Freunden in den Wald, der die Stadt umgab, um dort frische Mangos und Pflaumen von den Bäumen zu pflücken oder um Vögel zu jagen. Eine dieser Vogelarten hieß Tiziu, was kurze Zeit dann auch einer meiner Spitznamen war. Tizius sind nämlich schwarz, klein und schnell.
Natürlich war nicht alles nur Spiel und Spaß. Aufgrund unserer finanziellen Situation musste ich bereits mit sieben einer Teilzeitarbeit nachgehen. Mein Onkel Jorge borgte mir etwas Geld, wovon ich mir ein Schuhputz-Set kaufte. Dieses bestand aus einer kleinen Box, in der ich ein paar Bürsten aufbewahrte, und einem Ledergurt, damit ich sie mir umhängen konnte. Zuerst übte ich mit den Schuhen von Freunden und Verwandten, aber sobald ich meine Technik ausgefeilt hatte, lief ich zum Bahnhof, um dort Schuhe zu polieren. Ein paar Jahre später arbeitete ich auch in einer Schuhfabrik. Eine kurze Zeit lang lieferte ich Pastels, köstliche frittierte brasilianische Teigtaschen, die üblicherweise mit Hackfleisch, Käse oder Palmherzen gefüllt sind, für eine syrische Frau, die in unserer Nachbarschaft lebte und sie zubereitete, an einen Verkäufer. Er wiederum verkaufte sie dann an die Passagiere einer der drei Straßenbahnlinien, die durch unsere Stadt führten.
Mit nichts von alledem ließ sich viel Geld verdienen. Baurú war so arm wie das restliche Brasilien. Oft schien es, als gäbe es mehr Schuhputzer als Schuhe. Egal, wie viel ich einnahm, ich gab alles pflichtbewusst meiner Mutter, die davon Essen für uns kaufte. Wenn es uns mal etwas besser ging, gab sie mir ein paar Münzen, damit ich am Sonntag ins Kino gehen konnte.
Dann war da noch die Schule. Ich muss gestehen, dass meine schulischen Leistungen leider nicht mit meiner Performance auf dem Spielfeld Schritt halten konnten. Meine Begeisterung für Fußball machte mich zu einem schwierigen und aufmüpfigen Schüler. Manchmal verließ ich einfach das Klassenzimmer, um im Schulhof mit einem zusammengeknüllten Stück Papier zu dribbeln. Meine Lehrer gaben ihr Bestes: Sie versuchten mich zu disziplinieren, indem sie mich auf getrockneten Bohnen knien ließen. Hin und wieder stopften sie mir Papierkugeln in den Mund, damit ich aufhörte zu quasseln. Ein Lehrer stellte mich mit dem Gesicht zur Wand in die Ecke. Dort musste ich die Arme von mir strecken, so wie die Christus-Statue in Rio. Ich weiß noch, dass ich einmal ziemlichen Ärger bekam, weil ich unter das Pult der Lehrerin gekrabbelt war und einen Blick unter ihren Rock riskiert hatte.
Mit der Zeit entmutigte mich die Schule. Es gab so viele andere Dinge zu tun. Ich muss leider zugeben, dass ich nur mehr sporadisch in der Klasse auftauchte. Das war damals typisch für mich. In den späten Vierzigern ging überhaupt nichts. Nur jedes sechste Kind schaffte es in die Oberschule. Trotzdem soll das nicht als Ausrede gelten. Später sollte ich es bereuen, in der Schule nicht besser aufgepasst zu haben, und musste mich gehörig ins Zeug legen, um dieses Defizit wieder wettzumachen.
Ich konzentrierte meine nicht unbeträchtliche Energie auf das Fußballfeld. Dort mussten wir nicht über Armut, unsere Eltern oder tragische Ereignisse nachdenken. Auf dem Platz war niemand arm oder reich, dort konnten wir einfach nur spielen. Wir verbrachten unsere Tage damit, über das Spiel zu sprechen und es zu leben. Selbstverständlich hatten wir noch keine Ahnung, dass Fußball dem größten Spektakel, das je in Brasilien stattfinden sollte, bald eine Bühne bieten würde.
- 6 -
Seit jeher hält kaum etwas die Menschen so in Atem wie die Weltmeisterschaft. Das Turnier versammelt alle vier Jahre Länder aus der ganzen Welt, um einen Monat lang zu spielen und zu feiern. Es ist eine Riesenparty, zu der die ganze Welt eingeladen ist. In den letzten 56 Jahren war ich bei jeder einzelnen, entweder als Spieler, Fan oder „Botschafter des Fußballs“, zu dem ich ernannt wurde. Aus Erfahrung kann ich besten Gewissens behaupten, dass es nichts Besseres gibt. Natürlich sind auch die Olympischen Spiele großartig, doch finden dort für meinen Geschmack zu viele verschiedene Wettkämpfe statt. Bei der Weltmeisterschaft dreht sich alles nur um Fußball. Es ist ein Turnier, das einem berauschenden Höhepunkt, dem Endspiel um die Krone im Fußball, entgegenstrebt.
Die Weltmeisterschaft ist mittlerweile eine solche Institution, dass es beinahe so scheint, als hätte es sie schon immer gegeben. Doch als 1950 die WM in Brasilien ausgetragen wurde, war sie noch ein relativ junges Konzept und stand mehr oder weniger auf wackligen Beinen. Die erste WM hatte 1930, also 20 Jahre zuvor, stattgefunden. Der Franzose Jules Rimet, der Präsident der FIFA, also des Weltfußballverbandes, entschloss sich, den immer beliebter werdenden Sport in die Auslage zu stellen. Sein Plan war es, alle vier Jahre ein Turnier zu veranstalten, das genau zwischen zwei Olympischen Sommerspielen stattfinden sollte. Er hoffte, dadurch das Ansehen der Nationalmannschaften zu stärken und außerdem einen Beitrag zur globalen Eintracht leisten zu können. Leider gab es damals nur männliche Auswahlmannschaften – etliche Jahrzehnte später hatte schließlich jemand die brillante und längst überfällige Idee, auch Weltmeisterschaften für Frauenteams auszutragen.
An den ersten paar Weltmeisterschaften nahmen so unterschiedliche Teams aus Ländern wie Kuba, Rumänien und Niederländisch-Indien, dem heutigen Indonesien, genauso teil wie die bereits etablierten Supermächte des Fußballs, Brasilien und Italien. Die Weltmeisterschaft wurde immer prestigeträchtiger und zog immer mehr Zuschauer an, und 1938, als die WM in Frankreich stattfand, pilgerten zehntausende Menschen zu den Spielen. Jedoch kam es im Vorfeld des Turniers zu einigen schicksalsträchtigen Ereignissen. So musste das Team aus Österreich in letzter Minute seine Teilnahme absagen, da das Land drei Monate zuvor von Deutschland annektiert worden war. Die besten österreichischen Spieler wurden in die deutsche Auswahl berufen, die allerdings bereits in der ersten Runde vor einem feindlich gesinnten, mit Flaschen werfenden französischen Publikum ausschied. Es sollte leider nicht das letzte Mal bleiben, dass die Politik auf das Spiel übergriff.
Als im Jahr darauf der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde die Weltmeisterschaft – wie so viele andere Dinge – lange auf Eis gelegt. Der Krieg endete 1945, aber weite Teile Europas waren verwüstet. Der Wiederaufbau stand im Mittelpunkt, und es sollten noch Jahre vergehen, bis jemand es für möglich hielt, ein weiteres globales Fußballturnier zu organisieren. Für 1950 aber schien die Zeit reif, einen neuen Anlauf zu wagen, doch brauchte man ein Land, das den Krieg unbeschadet überstanden hatte und die entsprechende Infrastruktur bieten konnte. Somit kam Brasilien ins Spiel.
Als sich Brasilien bereiterklärte, die WM 1950 auszutragen, mussten einige Länder absagen, da ihnen schlicht die finanziellen Mittel fehlten, Teams nach Südamerika zu entsenden. Damals konnte man noch nicht so einfach um die halbe Welt jetten, eine Flugreise von Europa nach Brasilien konnte an die 30 Stunden dauern, während der man oft zwischenlanden musste. Das geteilte und besetzte Deutschland wurde von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Gleiche galt für Japan. Schottland und die Türkei sagten kurzfristig ab. Letztlich kamen nur sechs Teams aus Europa, neben Südamerika die Hochburg des Fußballs. Das war natürlich sehr schade für sie – aber umso besser für Brasilien. Wir jagten immer noch unserem ersten Titel hinterher und dachten, dass er überfällig wäre. Nun, da die Konkurrenz überschaubar war und das Turnier auch noch bei uns zu Hause stattfand, war eigentlich alles angerichtet.
In Baurú, so wie auch überall sonst in Brasilien, waren alle im WM-Fieber. Vielleicht gar nicht so sehr wegen der WM an sich, aber wegen des bevorstehenden Titelgewinns. Ich war gerade erst neun, aber alt genug, um mich von der Stimmung anstecken zu lassen. Ich erinnere mich an die selbstbewussten Worte meines Vaters, die er immer wieder sprach, während wir vor dem Radio saßen und der Berichterstattung folgten: „Der Titel gehört uns, Dico!“
Meine Freunde unterhielten sich über Feiern und Paraden und stritten sich darüber, wer die Trophäe tatsächlich mit eigenen Augen sehen würde. Wir trugen unsere Spiele auf der Straße aus und stellten uns dabei als Weltmeister vor. Eigentlich war es ziemlich verblüffend, dass, egal wohin ich ging, niemand auf die Idee kam, Brasilien könnte das Turnier nicht als Sieger beenden.
- 7 -
Eine neue Form der Energie rollte durch Brasilien. Jeder konnte es spüren. Die Menschen waren beschwingt von dem Verlangen, die Welt zu beeindrucken, was auch für abgelegene Orte wie Baurú galt, wo die WM nicht viel greifbarer als ein Gerücht war. Daher beschlossen wir Spieler von der Rubens-Arruda-Straße, ein Zeichen zu setzen und uns selbst zu einer ordentlichen Mannschaft – wie dem brasilianischen Nationalteam oder Dondinhos BAC – zusammenzuschließen. Wir brauchten eine ordentliche Ausrüstung – Trikots, Hosen, Schuhe und Strümpfe. Und selbstverständlich benötigten wir einen besseren Ball als den, den wir uns aus zusammengerollten Socken gebastelt hatten.
Die Sache hatte nur einen Haken. Wir waren komplett blank.
Ich schlug vor, die Mittel dafür aufzubringen, indem wir unsere Fußballaufkleber verkauften. Diese Sticker waren damals total angesagt – sie ähnelten Baseball-Karten –, und jeder von ihnen zeigte einen anderen Spieler und lieferte zusätzlich noch ein paar Daten zum jeweiligen Akteur. Ich dachte, wenn wir unsere Sammlungen zusammenlegen und uns auf die echt berühmten Teams aus Rio und São Paulo konzentrieren würden, dass diese Sammlung, in ein Album geklebt, tatsächlich etwas wert sein könnte. Unser Ziel war es, jemanden zu finden, der dieses Album gegen einen Lederball eintauschen würde.
Der Plan wurde rasch angenommen. Trotzdem waren wir noch meilenweit von unserem ehrgeizigen Ziel entfernt. Ein Junge namens Zé Porto schlug vor, dass wir die Differenz, die uns fehlte, dadurch wettmachen könnten, indem wir vor dem Kino und dem Zirkus geröstete Erdnüsse verkauften. Eine tolle Idee. Aber woher sollten wir die Erdnüsse nehmen. Wie sich herausstellte, hatte Zé Porto auch für dieses Problem bereits eine Lösung parat. Er grinste listig und regte an, die Erdnüsse aus einer der Lagerhallen an der Eisenbahnstrecke zu klauen.
Bei einigen von uns machte sich angesichts dieser Idee ein mulmiges Gefühl breit. Ich erinnerte mich, wie meine Mutter mir eingebläut hatte, dass Diebstahl eine der schlimmsten Sünden wäre. Ich spürte, dass die anderen Jungs das Gleiche dachten. Aber Zé Porto war ziemlich überzeugend. Er sagte, dass wir einfach einen der Frachtwaggons aufbrechen könnten, wenn es uns nicht gelänge, in die Lagerhallen zu kommen. Wer würde denn schon ein paar Tüten mit Erdnüssen vermissen?
Ergänzend sagte er: „Abgesehen davon, wer nicht dabei ist, ist ein großer Schisser!“
Nun, gegen diese Argumentation kamen wir nicht an. Also gingen wir alle wie auf Eierschalen runter zum Bahnhof. Als einer der inoffiziellen Anführer wurde ich von den anderen, zusammen mit einem weiteren Jungen, dazu auserkoren, in den Waggon zu steigen, um die Erdnüsse zu klauen. Ich hatte Bedenken, aber ich war bereit, alles für den Fußball zu geben.
Als wir in den Waggon kletterten, konnte ich vor meinem inneren Auge meine Mutter sehen, die mit verschränkten Armen traurig den Kopf über uns schüttelte. Allerdings war es nun zu spät, umzukehren. Wir schnitten die Säcke auf, und vor uns ergoss sich eine Flutwelle aus Erdnüssen auf den Holzboden. Wir steckten sie hektisch in unsere Taschen, unsere Hemden und den rostigen Eimer, den wir mitgebracht hatten. Schließlich – mir kam es vor, als wäre eine halbe Ewigkeit vergangen – flüchteten wir mit unserer Beute vom Tatort und eilten zu unserer Gruppe. Anschließend rannten wir nach Hause, lachten und schrien vor Begeisterung – und Erleichterung.
Wir rösteten die Nüsse und verkauften sie, wie wir es geplant hatten, und kauften uns vom Gewinn unsere kurzen Hosen. Als wir erkannten, dass die Trikots unser Budget überstiegen, und keiner von uns das Glück mit einem weiteren Diebstahl erneut herausfordern wollte, einigten wir uns eben auf farblich aufeinander abgestimmte Leibchen. Nun hatten wir allerdings noch immer keine Stutzen oder Schuhe, aber wir waren zu aufgeregt, um uns deswegen den Kopf zu zerbrechen. Zuerst nannten wir uns Descalsos – die Schuhlosen, bis wir herausfanden, dass es bereits mehrere Teams in Baurú gab, die sich aus exakt den gleichen Gründen für exakt denselben Namen entschieden hatten.
Stattdessen wählten wir den Namen Sete de Setembro, nach der Straße, die meine Straße kreuzte, die wiederum nach dem Datum der Unabhängigkeit Brasiliens, dem 7. September, benannt war. Nun, da wir unsere Ausrüstung und ein paar echte Asse in unseren Reihen hatten, begannen wir, uns extrem ernst zu nehmen. Zu unseren Spielen liefen wir einer nach dem anderen auf das Feld – nun ja, die Straße – und gaben uns sehr andächtig, so wie wir uns das vom Team meines Vaters abgeschaut hatten. Wir organisierten Spiele gegen andere Mannschaften aus der Gegend und gingen zumeist als Sieger vom Platz, wobei wir unseren Gegnern manchmal zweistellige Debakel zufügten. Ich baute verschiedene abgefahrene Tricks in mein Spiel ein, hielt den Ball mit dem Kopf in der Luft oder tändelte ihn von einem Knie zum anderen. Mitunter lachte ich närrisch über die glücklosen Kicker aus den Nachbarschaften, an denen ich pfeilschnell vorbeijagte, um ein weiteres Tor zu schießen.
Eines Abends kam Dondinho aus dem Gemischtwarengeschäft nach Hause und wirkte sichtlich aufgebracht. Als wir mit dem Abendessen fertig waren, sagte er, dass er sich mit mir unterhalten müsse – und zwar unter vier Augen.
Er sagte: „Ich bin heute an der Straße vorbeigegangen, in der du und deine Freunde gespielt haben, und ich habe gesehen, was du gemacht hast.“
Meine Augen müssen gestrahlt haben vor Freude. Womöglich hatte er einen meiner neuen Tricks gesehen?
Aber er sagte: „Ich bin stinksauer auf dich, Dico. Ich habe gesehen, wie du diese anderen Jungs verspottet hast. Du solltest ihnen mehr Respekt entgegenbringen. Dein Talent? Du hast gar nichts getan, womit du es dir verdient hättest. Es war Gott, der es dir geschenkt hat! Die anderen Jungs sind vielleicht nicht mit dem gleichen Talent gesegnet wie du, aber was soll’s? Das gibt dir nicht das Recht, dich als etwas Besseres zu fühlen.“ Er fuhr fort: „Du bist nur ein Junge.“ Er hob mahnend den Zeigefinger und erklärte mir, dass ich noch nichts erreicht hätte: „Wenn sich das eines Tages geändert haben sollte, dann darfst du feiern. Aber selbst dann bleib bescheiden!“
Ich stand unter Schock. Ich wollte davonlaufen und mich in meinem Zimmer, das ich mit Zoca teilte, verstecken. Aber es war wie immer ein ausgezeichneter Rat, den mir Dondinho gab – diese Unterhaltung sollte mir für viele, viele Jahre im Gedächtnis bleiben. Und wie sich herausstellen sollte, hätte ganz Brasilien diese wertvolle Warnung bitter nötig gehabt.
- 8 -
Als die Weltmeisterschaft schließlich Fahrt aufgenommen hatte, stoppten unsere nachbarschaftlichen Spiele, damit wir dem Turnier unsere ganze Aufmerksamkeit schenken konnten. Und lange schien es, als wäre unsere atemlose Begeisterung gerechtfertigt. Brasilien gewann das Eröffnungsspiel in Rio in überzeugender Manier mit 4:0 gegen Mexiko, bei dem Ademir zwei Treffer beisteuerte. Er war ein Spieler von Vasco da Gama, den alle „Kiefer“ nannten, weil er so ein markantes Kinn hatte. Das nächste Spiel war eine viel nüchternere Angelegenheit. Im Pacaembu-Stadion in São Paulo endete die Begegnung mit der Schweiz 2:2. Doch der darauf folgende 2:0-Sieg gegen Jugoslawien ließ alle wieder ruhig schlafen – Brasilien war praktisch im Vorübergehen in die Finalrunde vorgestoßen.
Von da an war es, als hätte man ein Monster von der Kette gelassen. Brasilien demolierte ein ziemlich gutes schwedisches Team mit 7:1. „Kiefer“ allein schlug ganze vier Mal zu. Vier Tage später demütigte unser Team Spanien auf ähnliche Weise. Die Partie endete 6:1, und fünf verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Die brasilianische Auswahl trat geschickt und gut ausbalanciert auf. Die Defensive stand gut, und im Angriff konnte man sich auf treffsichere Optionen verlassen. Sie spielten vor einem Anhang, der sie mit Gesängen, Konfetti und der ganzen Liebe, die man von einem Heimpublikum erwartet, nach vorne trieb. Und plötzlich stand Brasilien, scheinbar ohne Mühe und noch weniger Spannung, nur mehr ein Spiel entfernt vom Titel. Vielleicht hatte Dondinho ja recht – der Pokal würde uns gehören.
Im entscheidenden Spiel traf man auf den erhofften Gegner, Uruguay: ein Land der Schafhirten, das mit seinen sandigen Stränden im Norden an Brasilien grenzt. Uruguay hatte gerade einmal etwas mehr als zwei Millionen Einwohner – bei uns lebten allein in Rio de Janeiro schon mehr Menschen. Und im Gegensatz zu Brasilien waren sie mit großer Mühe durch die Finalrunde gestolpert. Sie hatten nur ein 2:2 gegen Spanien erreicht und im Spiel gegen Schweden erst fünf Minuten vor dem Schlusspfiff das 3:2 erzielt.
Wir konnten außerdem mit der bestmöglichen Ausrichtungsstätte für dieses Spiel aufwarten: dem brandneuen Maracanã-Stadion in Rio, das speziell für diese Weltmeisterschaft erbaut worden war. Durch seine ehrfurchtgebietenden Ausmaße und seine architektonische Verspieltheit erinnert es mehr an einen Kaiserpalast als an ein Stadion. Es war viel Geld in diese Spielstätte investiert worden, da dort schließlich das Heimteam zum Champion gekrönt werden sollte. Die brasilianische Regierung hatte über 10.000 Arbeiter angeheuert, und als das Stadion fast fertig war, testeten sie die Standfestigkeit, indem sie die Ränge füllten und imaginäre Tore bejubelten. Zum Glück hielten alle Stützen und Träger der Belastung stand. Als das Maracanã schließlich stand, war darin Platz für fast 200.000 Zuschauer. Es war somit das größte Stadion der Welt, größer noch als der Hampden Park im schottischen Glasgow, der 40.000 Zuschauer weniger aufnehmen konnte.
Die brasilianischen Medien und Politiker überschlugen sich förmlich vor Lob für das Maracanã und im weiteren Sinne Brasilien selbst. Die Zeitung „A Noite“ etwa schrieb: „Brasilien hat nun das größte und perfekteste Stadion der Welt, das dem Können seines Volkes und dem Fortschritt in jedem erdenklichen menschlichen Betätigungsfeld zur Ehre gereicht. Endlich verfügen wir über eine Bühne epischen Ausmaßes, in der die ganze Welt unser Prestige und unsere sportliche Größe bewundern kann.“
Und diese Form der Übertreibung war noch gar nichts im Vergleich zu der Begeisterung, die am Spieltag herrschte. Karnevalsumzüge ergossen sich durch die Straßen von Rio, und die unmittelbar bevorstehende Krönung Brasiliens zur weltbesten Mannschaft wurde besungen. Viele nahmen sich den Tag frei und deckten sich voller Vorfreude auf die wilden Feiern, die nach dem Spiel stattfinden würden, mit Bier und Snacks ein. Eine Zeitung druckte sogar ein Foto unseres Teams auf der Titelseite und ließ sich zu der Schlagzeile hinreißen: „Das sind die Weltmeister!“
Als das brasilianische Team auf das Spielfeld lief, durfte es sich über ein ausverkauftes Haus freuen. Geschätzte 200.000 Menschen – bis heute ein Weltrekord für ein Fußballspiel – waren ins Stadion geströmt. Noch vor dem Spiel wurden den Spielern goldene Uhren überreicht, in die eine Widmung eingraviert worden war: „Für die Weltmeister.“ Und dann ergriff auch noch der Gouverneur von Rio de Janeiro das Wort und richtete sich an das Team, die Zuschauer und die Nation:
„Ihr Brasilianer, die für mich bereits die Sieger dieses Turniers sind … Ihr Spieler, die ihr in wenigen Stunden von euren Landsleuten umjubelt werdet … Niemand in irdischen Sphären kann euch das Wasser reichen … Ihr seid jedem Gegner überlegen … Ich verbeuge mich bereits jetzt vor euch und eurem Triumph!“
Inmitten all dieser Ausschweifungen gab es nur eine warnende Stimme. Allerdings kam die aus einer beunruhigenden Richtung.
„Das ist hier kein Schaulaufen. Es ist ein Spiel wie jedes andere – nur viel schwerer“, informierte Brasiliens Trainer Flávio Costa die Reporter noch vor dem Spiel. „Ich fürchte, die Spieler werden aufs Feld laufen, als wäre der Stern für den Titel bereits auf ihre Trikots genäht.“
- 9 -
All dies fordert eine Frage heraus: Mensch, Brasilien, was sollte dieser ganze Hype?
Waren wir etwa so naiv? Dämlich?
Oder ging es um noch etwas anderes?
Eine Sache habe ich im Lauf der Jahre gelernt – und manchmal auf die harte Tour. Das Geschehen auf dem Spielfeld ist nur ein Teil der ganzen Geschichte. Das trifft nicht nur auf Brasilien zu, sondern auf alle Länder der Welt. Man muss auch einen Blick hinter die weißen Linien der Spielfeldbegrenzung riskieren – die Leben der Spieler, die Teams an sich und, sehr oft zumindest, die politische Situation des jeweiligen Landes in Betracht ziehen, um zu verstehen, was wirklich vor sich geht.
Während der Weltmeisterschaft 1950 war es ganz besonders offensichtlich, dass der Sport nur ein Teil des großen Ganzen war. Zum ersten Mal, aber sicher nicht zum letzten Mal, sahen die brasilianischen Politiker das Turnier als eine goldene Möglichkeit, den Ruf unseres Landes aufzubessern – und natürlich auch ihren eigenen. Zu dieser Zeit wurde Brasilien nämlich noch vielerorts, in Europa und den USA zumindest, als rückständige Bananenrepublik wahrgenommen, in der Cholera und die Ruhr an der Tagesordnung waren und hauptsächlich Indianer und unkultivierte Ex-Sklaven lebten. Wenn sich das barsch und politisch unkorrekt anhört, dann nur, weil es das auch war. Allerdings war es eine Sicht der Dinge, die sogar viele brasilianische Würdenträger teilten, etwa der Bürgermeister von Rio de Janeiro, der erklärte, dass die WM die Möglichkeit biete zu beweisen, dass wir keine „Wilden“ seien. Brasilien könne sich mit den reichen Ländern der Welt messen – und sie sogar übertrumpfen.
Das war natürlich eine grob einseitige Sichtweise, da Brasilien mit seinen vielen positiven Eigenschaften in Wirklichkeit schon seit langem als charmanter Eigenbrötler existiert hatte. Tatsächlich ist auch die Geschichte unserer Unabhängigkeit eine, in der es um Verlockung und Verführung geht. Anders als der Großteil Südamerikas wurde Brasilien nicht von den Spaniern, sondern von den Portugiesen kolonialisiert. 1808 floh die portugiesische Königsfamilie vor Napoleons Truppen aus Lissabon und verlegte ihren Hof nach Rio de Janeiro. Somit waren sie die ersten Royals, die jemals eine ihrer Kolonien betraten und sogar dorthin zogen. Es sagt schon etwas aus, dass auch einige Vertreter der Königsfamilie – darunter Pedro I, der Sohn des Prinzregenten – sich entschieden zu bleiben, nachdem Napoleons Heerscharen keine Gefahr mehr darstellten.
Warum? Nun, ich war schon sehr oft in Lissabon, und es ist eine echt coole Stadt. Aber in Rio gibt es Strände voller Pulversand, wie Halbmonde geformte Buchten, üppig bewaldete Berge und wunderschöne, gastfreundliche Menschen. Pedro I konnte jeden Vormittag von seinem Palast aus eine kurze, von Palmen gesäumte Straße hinunterspazieren, um schnell mal in die Flamengo-Bucht zu hüpfen. Von dort konnte er dann den Anblick des Zuckerhuts genießen. Als ihm seine königlichen Verwandten 1822 schließlich einen Brief schrieben, in dem sie seine Rückkehr nach Portugal forderten, tat er das einzig Logische – er teilte ihnen mit, dass sie sich zur Hölle scheren sollten: „Fico!“ Er würde bleiben. Und so erlangte Brasilien seine Unabhängigkeit ohne jegliches Blutvergießen. Das genaue Datum war der 7. September, der Tag, nach dem sich meine erste Fußballmannschaft benannte. Der Tag ist auch heute immer noch als Tag des „Fico“ bekannt. Es ist eine nette Geschichte und keine Übertreibung. Schließlich muss man nicht ein Monarch sein, um Brasilien genießen zu können. Viele Millionen von Einwanderern zog es nach Brasilien, sie waren von den Möglichkeiten und Menschen verzaubert und beschlossen, sich niederzulassen. Aber die Geschichte von Pedro I gibt auch Aufschluss darüber, warum unsere Volksvertreter 1950 so aufgeregt waren. Seit der Unabhängigkeit war über ein Jahrhundert vergangen, aber politisch lag immer noch einiges im Argen. Seit „Fico“ war Brasilien von einer Krise in die nächste getaumelt und musste eine Reihe von Revolutionen, Staatsstreichen und regionalen Unruhen über sich ergehen lassen. Nur zwei Jahrzehnte zuvor hatte sich São Paulo vergeblich gegen die Regierung in Rio erhoben. Im Zweiten Weltkrieg kämpften brasilianische Soldaten tapfer auf der Seite der Alliierten für die Demokratie – um nach dem Krieg in eine Diktatur heimzukehren.
Als die Weltmeisterschaft nach Brasilien kam, bewegten wir uns langsam nach vorne, doch unsere Rolle in der modernen Welt schien noch immer unklar. „Brasilien war ein Land ohne Ruhm, das gerade eine Diktatur hinter sich gelassen hatte und noch unter den Nachwehen der Regierungszeit des Präsidenten Dutra litt“, schrieb Pedro Perdigão in seinem Buch über die WM 1950. Anders gesagt: Unsere Politiker hatten das Gefühl, etwas unter Beweis stellen zu müssen. Und sie zählten auf den Fußball, der ihnen dabei helfen sollte.
Außerdem spielte ein weiterer Abschnitt der brasilianischen Geschichte eine wichtige Rolle vor dem Turnier von 1950. Es ging um ein Kapitel, das der Familie Nascimento besonders am Herzen lag.
Auf Grundlage der Recherchen, die Journalisten im Verlauf der Jahre unternommen haben, nehmen wir an, dass unsere Vorfahren entweder aus dem heutigen Angola oder Nigeria stammten. Der Name Nascimento wiederum gehörte zu einer Farmer-Familie im Nordosten Brasiliens. Meine Vorfahren gehörten also zu den 5,8 Millionen Sklaven, die nach Brasilien verschleppt worden waren. Das sind schätzungsweise 20 Mal mehr, als in die USA verschifft wurden. Zeitweise gab es in Brasilien sogar mehr Sklaven als freie Menschen. Brasilien gehörte auch zu den allerletzten Ländern, die die Sklaverei abschafften. Dies geschah erst 1888 – über zwanzig Jahre, nachdem der Amerikanische Bürgerkrieg geendet hatte.
Die Sklaverei hatte also einen enormen Einfluss auf die Geschichte unseres Landes.
Fernando Henrique Cardoso, ein anerkannter Soziologe, der in den Neunzigern des vorigen Jahrhunderts Präsident von Brasilien wurde (und als solcher für ein paar Jahr mein Boss!), nannte es einst „die Wurzel der Ungleichheit in Brasilien“. In der Folge gab es bei uns keine Rassentrennung, wie sie etwa in den USA üblich war, weil sich die Menschen bei uns im Laufe der Zeit, nun ja, vermischten. Daher wäre es sehr schwer gewesen, festzulegen, ob nun jemand weiß oder schwarz war, und wer auch immer es tat, musste mit ernsthaften Kopfschmerzen rechnen. Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Weißen und Schwarzen waren auch rar. Besonders als ich aufwuchs, hieß es regelmäßig, dass es sich bei Brasilien um eine „ethnische Demokratie“ handele. Sports Illustrated schrieb einst, dass ich glücklicherweise an einem der wenigen Orte auf der Welt lebe, wo die Hautfarbe keinen Effekt auf das Leben eines Menschen habe.
Allerdings war das nicht die ganze Wahrheit. Die befreiten Sklaven und ihre Nachkommen hatten ein schwereres Leben als die meisten anderen zu bewältigen. Obwohl es keine offizielle Diskriminierung gab, hatten schwarze Brasilianer oft keinen Zugang zu Schulen, Krankenhäusern und anderen Dingen, die einem das Leben erleichtert hätten. Die Armut, in der ich aufwuchs und die auch meine Eltern in ihrer Kindheit erlebt hatten, ist meiner Meinung nach auch ein Resultat unserer Geschichte, obwohl dies nicht immer offensichtlich war. Die Sklaverei war jedenfalls kein weit entferntes oder gänzlich abstraktes Konzept für meine Familie. Die Eltern meiner Großmutter Dona Ambrosina, die bei uns lebte, waren selbst noch Sklaven gewesen. Unsere Familie war stolz auf ihren Weg, und ich selbst war – und bin es immer noch – stolz, schwarz zu sein. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass in Brasilien damals wie heute Menschen mit dunklerer Haut ärmer sind als Menschen mit hellerer Haut.
Deshalb war Brasilien auch 1950 noch ein Land mit einer vorwiegend armen und mitunter verzweifelten Bevölkerung, die oft nicht genug zum Leben hatte. Dieses Bewusstsein verunsicherte brasilianische Politiker seit jeher. Vielleicht hilft es auch zu verstehen, warum die Hype-Maschinerie rund um die Weltmeisterschaft so hochtourig betrieben wurde. Letztlich wollten die Beamten in Rio nicht nur die Welt davon überzeugen, dass der Fortschritt nun Einzug hielt in Brasilien – sie wollten das auch mit aller Kraft vor allem ihrem eigenen Volk vermitteln.
Jahre später war es uns ziemlich peinlich, wie wir uns 1950 benommen hatten. Allerdings glaube ich, dass Dondinho nur wiederholte, was er im Radio gehört hatte, wenn er sagte: „Der Sieg ist unser!“ Solche Worte kamen aus dem Mund von Politikern – manchmal sogar in Form von direkten Befehlen an die Medien. Ganz Brasilien erlag dieser Propaganda, und sie wirkte sich auf unglückliche Weise auch auf die Vorstellung auf dem Rasen aus – und war etwas, das ich in meinem Leben immer wieder und wieder und wieder miterlebt habe.
- 10 -
Als unsere Freunde und Verwandten in unser Haus strömten, stellte ich meinem Vater noch eine Frage.
„Papa?“
„Ja, Dico?“
„Kann ich dich zu den Feiern in der Stadt begleiten?“
Aus dem Augenwinkel heraus konnte ich erkennen, dass meine Mutter heftig den Kopf schüttelte. Aber mein Vater tat so, als könnte er sie nicht sehen.
„In Ordnung“, sagte er mit einem Lächeln. „Nicht lange, aber ein Weilchen.“
Außer mir vor Freude begab ich mich zum Radio, um so gut es ging, dem Spielverlauf zu folgen. Das gewaltige Publikum im Maracanã brüllte vor Begeisterung. Der Radio-Ansager stellte nacheinander die einzelnen Spieler des brasilianischen Teams vor. Es war eine beeindruckende Truppe – eine Mischung aus begnadeten Spielern und bunten Persönlichkeiten. Da war etwa Zizinho, mein persönlicher Liebling, ein Mann, den viele mit Leonardo da Vinci verglichen, weil er ein solcher Künstler auf dem Spielfeld war. Barbosa, das Ass zwischen den Pfosten, hatte im Turnierverlauf nur vier Mal in sechs Spielen hinter sich greifen müssen. Und dann gab es da noch Ademir – den „Kiefer“! Nicht zu vergessen: Bigode, ein linker Außenverteidiger, der damals für Flamengo, einen der größten Clubs in Rio, spielte und der mit einem mächtigen Applaus von den Rängen willkommen geheißen wurde.
Schließlich verkündete der Ansager den Namen des Kapitäns dieser Auswahl von 1950. Es handelte sich bei ihm um einen gefürchteten Verteidiger und mitreißenden Anführer, der immun gegen die Nervosität rund um große Spiele zu sein schien. Möglicherweise hatte das auch damit zu tun, dass er, bevor er als Fußballer Karriere machte, bei der brasilianischen Bundespolizei gearbeitet hatte. Er war nicht unbedingt torgefährlich, als Abwehrrecke konnte er bei 297 Einsätzen für seinen Club Vasco da Gama exakt null Treffer verbuchen. Aber in der Defensive war er wie ein Fels in der Brandung und hatte eine beruhigende Wirkung auf seine Mitspieler, was ideal war für ein Endspiel wie das bevorstehende.
Der Name des Kapitäns? Augusto.
Genau, jener Augusto, der acht Jahre zuvor mit meinem Vater auf dem Spielfeld in Minas Gerais zusammengestoßen war.
Das nennt man wohl Schicksal – der eine Mann erholt sich und führt Brasilien beim Spiel um den Titel aufs Feld, während der andere zurück nach Baurú muss, da sein Knie im Eimer ist, wo er der Übertragung des Spiels im Radio lauscht.
Falls Papa damals eifersüchtig war, so hat er es nie gezeigt. Ich nehme an, dass er einfach nur auf einen brasilianischen Triumph hoffte.
- 11 -
Die erste Hälfte war ein einziger brasilianischer Sturmlauf. Unsere herausragende Offensive mit ihren fünf Angreifern, die vom schrecklichen „Kiefer“ angeführt wurde, schoss ein ums andere Mal auf das Gehäuse der Urus. Zuschauer, die vor Ort waren, behaupteten, dass es nach der ersten Hälfte gut und gerne 2:0 oder sogar 3:0 hätte stehen müssen. Doch Uruguays Torwart Roque Máspoli schaffte es irgendwie, jeden Schuss bravourös abzuwehren, obwohl er auch sehr viel Glück hatte, wie manche berichteten. Roque schien auch in seinem späteren Leben das Glück für sich gepachtet zu haben: Gleich zwei Mal gewann er die staatliche Lotterie seines Landes. Also war der 16. Juli 1950 nicht der einzige Tag in seinem Leben, an dem die Kugel für ihn richtig rollte.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang es Friaça endlich, Máspoli zu überwinden. Während sich Mama und Papa umarmten, sprinteten meine Freunde und ich hinaus auf die Straße und liefen durch die Nachbarschaft. Überall wurden Feuerwerke gezündet, und meine Ohren waren von einem süßen Summen erfüllt. Im Maracanã selbst warfen die Menschen mit Konfetti um sich und zündeten auch dort ein Feuerwerk. Die Euphorie war auf ihrem Höhepunkt, das landesweite Fest hatte begonnen.
Als meine Freunde und ich zurück ins Haus kamen, war die Feier bereits in vollem Gange. Mein Vater und seine Freunde tranken Bier, unterhielten sich über ihre Spiele für BAC und hörten nur mehr mit einem Ohr dem Kommentator im Radio zu.
Und plötzlich, fast nebenbei, hörten wir, wie der Mann von Radio Nacional verkündete:
„Tor für Uruguay!“
Moment mal. Was?
„Tor für Uruguay!“
Der Kommentator sagte später, dass er sich wiederholte, weil er gewusst habe, dass ihm seine Zuhörer beim ersten Mal nicht glauben würden.
Bei uns herrschte Totenstille, als wir seiner Schilderung des Treffers folgten.
„Gutes Kombinationsspiel des uruguayischen Angriffs, das zum Ausgleichstreffer führt“, verkündete der Radiomann mit plötzlich gedämpfter Stimme. „Bigode lässt sich von Ghiggia überrumpeln. Der flankt flach zur Mitte. Eine ideale Flanke. Schiaffino kommt über links und schießt ein!“
Brasilien – Uruguay 1:1.
Nun gut, das war eigentlich noch kein Grund zur Panik. Bei der WM 1950 musste jeder gegen jeden spielen, weil so wenige Teams am Turnier teilnahmen. Und so hätte Brasilien im letzten Spiel bereits ein Remis zum Titel gereicht. Es waren noch 20 Minuten zu spielen. Unser Team hatte im bisherigen Turnier durchschnittlich weniger als einen Gegentreffer pro Spiel hinnehmen müssen. Sie würden doch wohl jetzt nicht noch einen weiteren zulassen?
Jedoch passierte etwas Eigenartiges in dem Moment, als Uruguay den Ball ins Netz bugsierte. Das Publikum im Maracanã spürte es, und auch wir im weit entfernten Baurú konnten es fühlen. Es war, als würde das ganze Selbstvertrauen und all der Hype sich plötzlich ins Gegenteil verkehren, als würde Luft aus einem Ball entweichen. Wir hatten uns in so luftige Höhen gepusht, dass ein Fall von dort oben nun fatale Folgen haben würde – und ganz plötzlich starrte ganz Brasilien in den Abgrund.
Ich blickte flüchtig rüber zu Dondinho, der sich mit weit aufgerissenen Augen in einen Stuhl fallen ließ.
Im Maracanã hatte es 200.000 Menschen die Sprache verschlagen.
Trainer Costa sagte später, dass die Stille seinen Spielern eine Mordsangst eingejagt habe.
Das kleine Uruguay, dieser aufmüpfige Underdog, hatte Blut geleckt.
- 12 -
Im Fußball besagt die Größe eines Landes oder der Spieler überhaupt nichts aus. Herz, Begabung und harte Arbeit sind die einzigen Dinge, auf die es ankommt. Meine Güte, ich hätte das besser als jeder andere wissen sollen.
Irgendwie hatten wir vergessen, dass Uruguays fußballerische Tradition mindestens so reich wie unsere eigene war, wenn nicht sogar noch reicher. Auf der ganzen Welt war diese Mannschaft berühmt für ihren „garra charrua“, was so viel bedeutet wie Mumm und Kampfgeist. Außerdem spielten bereits ab dem frühen 20. Jahrhundert Spieler afrikanischer Abstammung auf ihrer Seite – viel früher als bei anderen südamerikanischen Nationen wie etwa Brasilien. Uruguay hatte bereits zwei Goldmedaillen im Fußball bei Olympischen Spielen gewinnen können und darüber hinaus auch schon einen Weltmeistertitel auf der Habenseite. 1930 hatte Uruguay das erste WM-Turnier, welches damals auch in Uruguay ausgespielt wurde, für sich entschieden. Auch da fehlten, so wie bei der Endrunde 1950, einige der wichtigsten Mannschaften. Die Welt steckte tief in der Weltwirtschaftskrise, und viele Mannschaften aus Europa konnten sich die Reise schlicht nicht leisten. Deshalb behaupteten manche Leute, der Sieg Uruguays sei reiner Dusel gewesen. Sie hätten es besser wissen sollen.
Als die uruguayische Mannschaft zum entscheidenden Spiel in Rio anreiste und merkte, dass man sie lediglich als Statisten bei der brasilianischen Krönungszeremonie abtat, machte sie genau das, was man von einem Team mit eigenen Titelambitionen erwarten durfte – sie lehnte sich gegen ihre Rolle auf. Die Spieler waren total heiß und trainierten mit außergewöhnlicher Intensität. Und in genau dieser überschäumenden Rage erkannten die Trainer und Funktionäre dieser Mannschaft ihre große Chance.
Am Morgen des Spiels besorgte Manuel Caballero, der uruguayische Konsul in Rio, zwanzig Exemplare jener Tageszeitung, die Brasilien schon vorzeitig als „Weltmeister“ ausrief. Er brachte sie ins Hotel Paissandu, wo die uruguayische Delegation Quartier bezogen hatte. Als die Mannschaft vor dem Match noch eine Mahlzeit zu sich nahm, legte Caballero den Spielern die Zeitungen auf den Tisch und verkündete: „Mein Beileid, ihr habt schon verloren.“
Die Spieler schrien und stöhnten. Einer von ihnen, der als sehr emotional geltende Eusebio Tejera, stand auf und schlug gegen eine Wand.
„Nein, nein, nein! Sie sind keine Weltmeister!“, rief er. „Wir werden sehen, wer der neue Champion sein wird!“
Einem anderen Bericht zufolge schnappte sich daraufhin der Kapitän der Urus, Obdulio Varela, die Zeitungen und trug sie in die Toilette. Er breitete sie auf dem Boden aus, und alle Spieler urinierten auf die Bilder ihrer brasilianischen Gegner.
Als später an diesem Tag im Maracanã die erste Halbzeit torlos geendet hatte, witterten sie die Sensation. Brasiliens Unantastbarkeit war verflogen. Sogar als wir gleich zu Beginn der zweiten Hälfte in Führung gingen, verstärkte das die uruguayische Wagenburgmentalität nur noch. Obdulio hob den Ball aus dem Netz und schrie eine ganze Minute lang sowohl den Schiedsrichter als auch das Publikum an. Er wollte den Ball gar nicht mehr loslassen. Als er ihn schließlich zurück auf den Rasen legte, damit es weitergehen konnte, wandte er sich an seine Kameraden:
„Wir werden hier gewinnen – oder sie werden uns töten!“
Gut, das war natürlich etwas überspitzt formuliert, doch er war sicher nicht die erste Person an diesem Tag in Brasilien, die sich zu einer Übertreibung hatte hinreißen lassen. Sein Team reagierte mit jenem Offensivdruck, den sich Obdulio erhofft hatte – und so folgte kurz darauf der Ausgleichstreffer. Wenig später war es Alcides Ghiggia, ein herausragender Rechtsaußen, der sich knapp zehn Minuten vor dem Schlusspfiff alleine vor dem gegnerischen Tor wiederfand.
- 13 -
Die Stimme im Radio informierte uns: „Ghiggia passt den Ball zurück … Julio Pérez spielt den Ball tief auf den Rechtsaußen … Ghiggia läuft auf das Tor zu … er schießt. Tor. Tor für Uruguay! Ghiggia! Uruguays zweiter Treffer. Uruguay geht 2:1 in Führung … 33 Minuten sind in der zweiten Hälfte gespielt.“
- 14 -
Womöglich spürte ich unsere bevorstehende Niederlage. Vielleicht erschreckte mich die Stille in unserem Wohnzimmer. Oder weil ich nur ein Kind war, verließ ich das Haus, um mit meinen Freunden zu spielen, bevor Uruguay zum zweiten Mal zuschlug. Wir droschen den Ball halbherzig durch die Gegend und feierten unsere eigenen Treffer. Aber wir wussten, dass die Dinge im Haus schlecht standen.
Kurze Zeit später schlurften die Freunde meines Vaters ins Freie. Ihre Gesichter sprachen Bände. Nun wusste ich natürlich, was Sache war. Ich legte den Ball auf den Boden, holte tief Luft und ging zurück ins Haus.
Dondinho stand mit dem Rücken zum Zimmer und starrte aus dem Fenster.
„Papa?“
Er drehte sich um, und Tränen rollten über seine Wangen.
Ich war fassungslos. Ich hatte Papa noch nie weinen gesehen.
„Brasilien hat verloren“, krächzte er, als würde es ihm Mühe bereiten, diese Worte auszusprechen. „Brasilien hat verloren.“
- 15 -
„Niemals habe ich in meinem Leben Menschen so traurig erlebt wie die Brasilianer nach dieser Niederlage“, erinnerte sich Alcides Ghiggia, der Schütze des Siegtreffers, viele Jahre später. Mit etwas weniger Mitgefühl fügte er hinzu: „Nur drei Menschen vermochten es, das Maracanã zum Schweigen zu bringen – der Papst, Frank Sinatra und ich.“
Als der Schlusspfiff erklang, brachen Tausende Menschen auf den Tribünen in Tränen aus. Gott weiß, wie viele es in ganz Brasilien waren. Die Stimmung war so am Boden, dass sogar die uruguayischen Spieler, die auf Jules Rimet, den Präsidenten der FIFA und Vater der Weltmeisterschaft, warteten, damit er ihnen die wohlverdiente Trophäe überreichen konnte, nur noch in ihre Kabine laufen wollten. „Ich weinte mehr als die Brasilianer“, sagte Schiaffino, der das erste Tor erzielt hatte, „weil ich sehen konnte, wie sehr sie litten.“
Vor dem Stadion steckte eine wütende Menschenmenge einen Stapel Zeitungen in Brand – darunter wohl auch Exemplare, in denen Brasilien voreilig zum Weltmeistertitel gratuliert wurde. Das Stadion wurde nicht niedergebrannt, aber eine Statue des Bürgermeisters, die der vor dessen Toren hatte aufstellen lassen, wurde niedergerissen. Der abgeschlagene Kopf der Figur wurde in den nahegelegenen Fluss geworfen. Ein paar Stunden später schlichen die brasilianischen Spieler benommen aus der Arena. Viele wankten in umliegende Bars, wo manche von ihnen die nächsten paar Tage verbringen sollten. Friaça, der das brasilianische Tor geschossen hatte, wurde von einer Gruppe Fans erkannt. Sie begannen ihm die Namen der siegreichen uruguayischen Spieler hinterherzurufen: „Obdulio!“, „Ghiggia!“ Wie er selbst sagte: „Ich wusste, dass mich diese Rufe mein ganzes restliches Leben verfolgen würden.“
Und tatsächlich sollte der Schmerz in den nächsten Wochen und Monaten nur noch schlimmer werden. So laut der Hype auch gewesen sein mochte, das Wehklagen war noch lauter. Es war wie nach einem Krieg, den Brasilien verloren hatte und in dem viele Menschen gestorben waren. Die Niederlage wurde nicht nur den Unzulänglichkeiten von elf Spielern, sondern den Mängeln eines ganzen Landes angekreidet. Es war der Beweis, dass Brasilien zur Rückständigkeit verdammt war. Manche murrten, dass Brasilien nie die WM gewinnen und nie bei irgendetwas Großem würde mithalten können.
Sogar einige sehr seriöse Leute vertraten diese Ansicht. Der berühmte Anthropologe Roberto DaMatta bezeichnete die Niederlage als vielleicht größte Tragödie in Brasiliens neuerer Geschichte, da sie jeden davon überzeugt habe, dass wir eine Nation von Verlierern seien. Noch schlimmer, die Schmach ereignete sich genau dann, als das Land es wagte, sowohl im Sport als auch in puncto globalem Ansehen von internationaler Größe zu träumen. Wir hatten etwas riskiert, und es war auf schreckliche Weise schiefgelaufen. Jahre würden vergehen, bevor unser nationales Selbstvertrauen sich erholen würde. „Jedes Land hat seine unabänderliche nationale Katastrophe, so etwas wie Hiroshima“, schrieb Nelson Rodrigues, ein brasilianischer Sportjournalist. „Unsere Katastrophe, unser Hiroshima, war die Niederlage gegen Uruguay 1950.“ Ein anderer Journalist, Roberto Muylaert, verglich die grobkörnigen Schwarzweißaufnahmen von Ghiggias Siegtor mit dem Filmmaterial, das den Anschlag auf Präsident John F. Kennedy festhielt. Er meinte, dass beide „die gleiche Dramatik … den gleichen Bewegungsablauf und Rhythmus … die gleiche Präzision eines unaufhaltsamen Geschosses“ abbilden würden.
Einige Spieler des Teams von 1950 sollten noch Großartiges für ihre Vereinsmannschaften leisten, aber traurigerweise sollte nie einer von ihnen den Weltmeisterpokal in die Höhe stemmen. Viele grübelten noch auf ihrem Sterbebett über die entgangene Chance nach. Mein Lieblingsspieler Zizinho sagte, dass er seine Silbermedaille in der Ecke eines seiner Trophäenschränke aufbewahre und sie anlaufen lasse, bis sie schließlich schwarz sein würde. „Ich poliere sie nicht“, meinte er Jahre später. „In Brasilien ist es nichts wert, Zweiter zu werden. Da scheidest du besser auf dem Weg ins Endspiel aus.“ Und wenn er auch vergessen wollte, so ließen es doch die Menschen nicht zu. Jahrzehntelang musste Zizinho an jedem 16. Juli den Hörer neben das Telefon legen. „Ansonsten klingelt es den ganzen Tag“, murrte er. „Leute aus ganz Brasilien wollen von mir wissen, warum wir das Spiel um die Krone verloren haben.“
So schlimm das alles klingen mag, so gab es doch eine Gruppe von Spielern, denen man noch weniger verzeihen wollte – den schwarzen. In seinem berühmten Buch Der Neger im brasilianischen Fußball schrieb der Journalist Mário Filho, dass viele Brasilianer die Niederlage auf die „rassische Unterlegenheit“ unseres Landes zurückführten. Das war eine so alte wie abstoßende Theorie, keine Frage, aber es wurde alles nur noch schlimmer, da – rein zufällig – die zwei „Schwärzesten“, die damals für Brasilien aufliefen, unmittelbar in die Entstehungsgeschichten der beiden uruguayischen Treffer verwickelt gewesen waren. Bigode, der Verteidiger, der Schiaffino beim ersten Tor hätte decken sollen, wurde noch jahrelang als „Feigling“ beschimpft. Er zog sich zurück und vermied jeden Kontakt zu seinen Freunden aus dem Team von 1950, da er fürchtete, jemand würde das Spiel ansprechen. Und Barbosa, der Torwart … Mann, den Kerl traf es am härtesten.
Ich traf Barbosa oft in späteren Jahren. Er lebte in Rio und spielte noch bis 1962 auf Clubebene, bis er sich im relativ hohen Alter von 41 vom aktiven Sport verabschiedete, nachdem er viele Titel gewonnen hatte. Aber egal, was er auch tat, nie konnte er den Schuldzuweisungen, dem Hohn und dem Zorn entfliehen. Jahrzehnte später, 1994, wollte er das brasilianische Team auf ihrem Trainingsgelände in Teresópolis besuchen, weil er die Mannschaft vor der WM in den USA mit einer inspirierenden Rede verabschieden wollte, doch man verweigerte ihm den Zutritt, da man glaubte, er würde ihr „Pech“ bringen. Bevor er im April 2000 starb, sagte er zu mir und anderen: „In diesem Land ist die gerichtliche Höchststrafe 30 Jahre Gefängnis. Ich bin kein Verbrecher und habe bereits länger büßen müssen.“
Die Wahrheit ist, dass Brasiliens Niederlage nicht Barbosas Schuld war, auch nicht die eines anderen Spielers. Zizinho sagte, dass das überhebliche Geschwätz der Zeitungen „die größte Waffe war, die man seinem Gegner in die Hand drücken kann“. Trainer Costa fasste es am besten zusammen, indem er die Niederlage mit der allgemeinen Hurra-Stimmung der Fans, der Presse und des Verbandes begründete. Es war der Hype, der Brasilien das Genick brach. Jeder, der das Spiel zu seinem Vorteil zu nutzen versuchte, besonders die Politiker, haben sich ihren Anteil an der Niederlage redlich verdient. Sie weckten unverhältnismäßige Erwartungen, und als sich herausstellte, dass das brasilianische Team sie nicht erfüllen konnte, war es verloren.
„Es war nicht das zweite Tor, das uns den Sieg kostete“, sagte Costa. „Es war das erste.“
Von solchen Vorwänden wollten viele Menschen aber nichts wissen. Und leider haben uns die Gespenster dieses Spiels im Maracanã noch immer nicht ganz verlassen. Barbosa sagte einmal, dass der schlimmste Tag in seinem Leben nicht der 16. Juli gewesen sei, sondern ein absolut gewöhnlicher Nachmittag zwei Jahrzehnte später, als ihn eine Frau mit ihrem kleinen Sohn in einem Geschäft erkannte.
„Sieh ihn dir an“, sagte die Frau und zeigte auf Barbosa. Sie sprach so laut, damit sie jeder hören konnte. „Das ist der Mann, der Brasilien zum Weinen gebracht hat.“
- 16 -
Moment mal. Sagte ich nicht, dass der verspielte WM-Titel 1950 eine gute Sache für Brasilien gewesen sei?
Ich bitte vielmals um Verzeihung.
Ja, es gab viele schreckliche Folgen. Für Barbosa und viele andere Menschen gab es nie eine gute Seite an der Sache. Aber für andere bot dieser Tag die Möglichkeit, viel zu lernen – etwas, das uns als Volk prägte und sich in den kommenden Jahrzehnten noch auf vielerlei Arten positiv auswirken sollte.
Sich ums Radio zu versammeln und zusammen zu leiden, verschaffte uns Brasilianern eine gemeinsame Erfahrung. Zum ersten Mal in unserer Geschichte hatten sowohl die Reichen als auch die Armen etwas gemeinsam, etwas, worüber sie mit jedem auf der Straße, beim Bäcker oder im Büro diskutieren konnten, egal, ob sie in Rio, Baurú, São Paulo oder tief im Amazonasbecken lebten. Wir nehmen diese Dinge nun als selbstverständlich an, aber damals war es sehr wichtig, einen gemeinsamen Nenner zu finden, was es hieß Brasilianer zu sein. Wir waren einander nun nicht mehr fremd. Und ich glaube, dass wir das von da an nie mehr wirklich waren.
Nicht weniger wichtig war, dass wir auch ein bisschen dieser strahlenden Unschuld, dieser Unbeschwertheit, man kann es auch Naivität nennen, einbüßten, die während dieses Nachmittags im Juli und den Monaten zuvor so offensichtlich gewesen war. Sie sollte natürlich nicht ganz verlorengehen. Aber danach waren wir alle ein wenig reifer geworden. Wir würden nicht mehr so leicht alles akzeptieren, was uns Politiker und Medien uns weiszumachen versuchten. Dies führte in den folgenden Jahren zu beträchtlichen Konsequenzen, sowohl was die Politik als auch unsere Kultur anging.
Abschließend: Für eine Generation von angehenden Fußballern wie mich war der 16. Juli 1950 ein enormer Ansporn. Während mein Vater weinte und meine Mutter ihn zu trösten versuchte, schlich ich mich ins Schlafzimmer meiner Eltern. Dort hatten sie ein Bild von Jesus an der Wand aufgehängt. Ich brach in Tränen aus und wandte mich an ihn.
„Warum ist das passiert?“, schluchzte ich. „Warum ist uns das passiert? Warum, Jesus, werden wir bestraft?“
Ich bekam natürlich keine Antwort. Doch als meine Verzweiflung nachließ, machte sie Platz für etwas Anderes – etwas Tiefsinnigeres und Milderes. Ich trocknete meine Tränen, ging ins Wohnzimmer und legte meine Hand auf den Arm meines Vaters.
Woher das, was ich nun sagen sollte, kam, dafür habe ich, ehrlich gesagt, keine Erklärung. Vielleicht war es nur eines dieser Dinge, die ein Neunjähriger sagt, damit es einem Elternteil bessergeht. Allerdings war es in Anbetracht von allem, was später passieren sollte, schon sehr interessant.
„Es ist schon gut, Papa“, sagte ich zu ihm. „Ich verspreche dir, eines Tages werde ich die Weltmeisterschaft für dich gewinnen.“