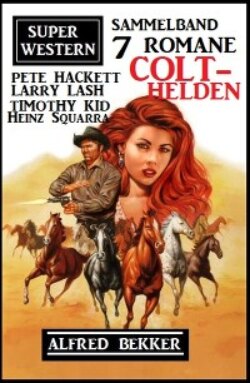Читать книгу Colt-Helden: Super Western Sammelband 7 Romane - Alfred Bekker, Frank Rehfeld, Karl Plepelits - Страница 6
Stadt der Halunken Ein Western von Heinz Squarra
ОглавлениеDas Leben der Bewohner von Montrose, einer kleinen Stadt in Texas, ist hart. Der Boden bringt den Farmern karge Ernten. Als Jay Durango und Rio Shayne, die Männer von Rancho Bravo, mit einem Schwerverletzten in die Stadt kommen und um Hilfe bitten, werden sie Opfer eines heimtückischen Plans. Die Bürger von Montrose beschuldigen sie, einen Mann ermordet und beraubt zu haben. Der Galgen wartet schon, und die beiden Männer stecken verdammt tief in der Klemme! Eine wilde Jagd auf die angeblich Schuldigen beginnt – und ihr Leben hängt an einem seidenen Faden ...
*
Ein tiefes Brummen schallte durch den dunklen Wald.
»Jeff, zurück, der Bär ist vor dir!«, rief Jay Durango warnend.
Unterholz brach. Schemenhaft tauchte ein großes, dunkelbraunes Tier zwischen den Douglasfichten auf.
Jay Durango feuerte aus der Winchester, konnte aber wegen des Halbdunkels nicht zielen. Die Mündungsflamme zuckte ins Zwielicht. Die Kugel fuhr klatschend in einen Stamm und riss Rinde ab.
Jeff Logan, der junge Cowboy, der seit gut zwei Monaten zur Crew von Rancho Bravo gehörte, dachte gar nicht daran, vor dem gewaltigen Grisly die Flucht zu ergreifen. Aus nächster Nähe feuerte er aus dem Revolver und traf das Tier.
Ein fürchterlicher Laut schallte in das Wummern des Echos. Der Bär versetzte dem Cowboy einen Hieb, dass der förmlich aufgehoben wurde und gegen den nächsten Baum flog. Äste fielen auf den Boden. Jeff Logan stürzte schreiend auf den Moosteppich.
Jeff feuerte wieder.
Der Bär zuckte abermals getroffen zusammen, wankte und tauchte hinter den Büschen unter.
»Hilfe!«, rief der Cowboy gepresst.
Das Knacken entfernte sich.
Jay lief zu dem Cowboy, kniete und legte das Gewehr ab.
»Hier!«, stieß Jeff mit verzerrtem Gesicht hervor. Mit zitternder Hand deutete er links auf das Hemd. Der Stoff war aufgerissen, die Haut darunter ebenfalls. Blut rann auf den Boden.
Vom Grisly konnte Jay nichts mehr hören. Aber von links näherte sich Hufschlag. Ein Pferd schnaubte.
»Jay, wo seid ihr?« rief Rio Shayne, der weißblonde Cowboy.
»Hier, Rio!« Jay richtete sich auf.
Shayne tauchte aus dem Wald, als käme er aus einer finsteren Höhle. Er saß etwas geduckt im Sattel, wodurch seine hünenhafte Gestalt kleiner wirkte, als sie war. Neben sich führte er die beiden anderen Pferde. Er hielt an und sprang ab. »Verdammt, ich habe ihn hier herüber getrieben.«
»Das war ja auch richtig«, erwiderte Jay. »Aber Jeff wagte sich zu weit vor.«
Shayne ging in die Hocke und schaute sich die beträchtliche Verletzung des Kameraden genau an. »Du hast mehrere Rippen gebrochen, Jeff. Und die stehen nach innen.«
Jay wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Er bereute es schon, die Jagd, zu der sie vor fünf Tagen von der Ranch aufbrachen, bis hierher in die Nähe des Nueces River ausgedehnt zu haben. Nun lagen rund vierzig bis fünfzig Meilen zwischen ihnen und Rancho Bravo. So weit konnten sie Jeff kaum transportieren. Geld besaß er aber auch nur noch sehr wenig. Rio ging es kaum besser. Und Jeff, das wusste er, trug keinen roten Cent mehr in der Tasche mit sich herum. Trotzdem mussten sie versuchen, einen Arzt aufzutreiben.
Durango ging zu seinem Pferd. Er führte mehrere Binden mit sich. Doch als er sie aus der Satteltasche zog, wandte Rio sich gerade um und schüttelte den Kopf.
»Wenn wir ihm die Brust bandagieren, tut es ihm noch mehr weh. Die gebrochenen Rippen stehen nach innen. Weißt du, was das heißt?«
Jay schob die Binden in die Satteltasche zurück.
Rio trat näher. »Sie können ins Herz stechen«, flüsterte er. »Hast du gesehen, wie sehr er blutet?«
»Ich bin nicht blind«, erwiderte Jay ungehalten über diesen Vortrag und immer noch ärgerlich. »Wir brauchen so schnell wie möglich einen Doc.«
»Dann müssten wir versuchen, Montrose zu erreichen.«
»Wie weit ist das?«
»Ungefähr zwanzig Meilen südlich. Dort gibt es vielleicht einen Doc. Mindestens einen Barbier, der sich an sowas vielleicht heranwagt.«
»Vielleicht«, sagte Rio. »Aber das ist für ihn eine gewaltige Strecke.«
»Weißt du was Besseres?«
»Nein.«
»Also dann.« Jay zog sein Messer. »Bauen wir eine Schleppbahre und verlieren wir keine Zeit mit dem Aufbruch. «
Rio ging bei dem Stöhnenden erneut in die Hocke, während Jay hinter den Pferden verschwand.
»Ich war ... ein ... Dummkopf!«, stieß der junge Cowboy hervor.
Rio grinste unglücklich.
Jay benutzte sein Messer wie eine Hacke, als er möglichst kräftige Äste für eine Schleppbahre von den Bäumen trennte. Rio hörte die Geräusche.
Jeff wollte sich auf die Seite wälzen, weil er meinte, dann weniger Schmerzen aushalten zu müssen. Doch er fiel mit einem Schrei zurück.
»Du musst ganz still liegen, mein Junge, sonst bohren sie sich immer tiefer in den Körper.«
Jay schleifte zwei sechs Yard lange Äste heran und ließ sie bei den Pferden fallen. Rio half ihm, eine Decke dazwischen so zu befestigen, dass die Bahre für den Verletzten breit genug wurde und nicht von den Ästen reißen konnte. Danach gingen sie zu Jeff.
»Jetzt beiß die Zähne zusammen«, sagte Jay.
Sie hoben ihn an den Schultern und Beinen hoch und trugen ihn auf die Bahre, Jeff lief dabei der Schweiß in Strömen über das Gesicht. Wie ein winziger, bleicher Strich standen die Lippen in seinem Gesicht, so sehr presste er sie zusammen, um Schmerzenslaute zu unterdrücken.
»So, schon passiert.« Rio lächelte zuversichtlich, obwohl er es keineswegs war.
Sie hoben die Enden vorn hoch und befestigten die Bahre mit den Steigbügelriemen am Sattel von Jeff Logans Pferd. Jay ging zurück, schaute sich die Verletzung noch einmal an und überlegte ernsthaft, ob er versuchen sollte, die gebrochenen Rippen mit seinem Messer zu finden und aus den inneren Wunden zu ziehen, in die sie sich gebohrt haben mussten.
Rio schien seine Absicht zu durchschauen und schüttelte den Kopf, als sich ihre Blicke trafen. »Dafür braucht man bessere Kenntnisse, als wir sie haben. Und Instrumente. Mindestens ein sehr schmales Messer.«
»Also, dann reiten wir jetzt.« Jay ging zu seinem Pferd und saß auf.
Rio schaute sich noch um. »Komisch, dass der verletzte Bär abgehauen ist. Meistens sind sie unheimlich aggressiv, wenn ihnen was weh tut.«
Jay ging nicht darauf ein. Er nahm das andere Pferd am Zügel und ritt langsam durch das Halbdunkel.
Rio kam ihm nach.
»Tom Calhoun reißt uns die Köpfe ab, wenn er das zu Ohren kriegt«, sagte Jay brummig.
Der Waldsaum kam in Sicht. Mit jedem Yard, den sie weiter vordrangen, nahm die Helligkeit im Gehölz zu.
»Wir haben nicht mal die Beute der letzten drei Tage aus der Jagdhütte mitgenommen!«, schimpfte Rio.
»Wir können uns keinen Umweg leisten«, sagte Jay und blickte sich um. »He, wir müssen Jeff besser festbinden. «
Jay zügelte die Pferde und saß ab. Shayne löste schon sein Lasso vom Sattel.
Jeff öffnete stöhnend die Augen. »Wo sind wir?«, hauchte er.
»Noch nicht sehr weit. Aber wir schaffen das schon.«
Sie griffen rechts und links zu und schoben ihn auf der Schleppbahre höher. Jeff Logan brüllte.
»Schon vorbei«, murmelte Shayne. Er band dem Verletzten die Beine fest.
Ein paar Minuten später befanden sie sich wieder unterwegs. Jay ritt voran und verließ den Wald.
Die Sonne stand im Westen hinter den Bergen jenseits des Nueces River und vergoldete die Felsgiganten im Osten. Bis nach Rancho Bravo würde es mit dem Verletzten einige Tage dauern.
Shayne ritt an seine Seite.
»Wir haben keine Wahl, Jay. Nur in Montrose können wir schnell sein.«
»Morgen früh, schätze ich.«
Jay nickte, während er auf das von Buschland überwachsene Hügelgelände vor sich schaute. Im späten Sonnenlicht leuchteten die welken Blätter der Scrub- und Sagebüsche wie rote, gelbe und violette Blumen und wetteiferten in ihrer Pracht mit den Prärieanemonen in den Talsenken, wo die Erde fruchtbarer war und das Gras höher sprießen ließ.
Sie ritten weiter. Shayne hielt anfangs ständig Ausschau, weil er immer noch fürchtete, der Bär könnte unvermittelt auftauchen und sie angreifen. Doch im Lauf der Zeit verlor sich seine Sorge.
»Vielleicht liegt er irgendwo und stirbt«, murmelte er. »Komisch ist jedenfalls, dass er einfach abgehauen ist.«
Im Westen versank die Sonne. Der Himmel färbte sich von Süden bis Norden hinter dem Fluss purpurn. Auf dem Boden verwischten die Schatten. Die gnadenlose Tageshitze verlor sich schnell. Als das Abendrot in der Ferne verglühte und die Nachtschwärze von Norden herankroch, fröstelte Jay für einen Moment.
*
Das Buschwerk raschelte plötzlich vor ihnen. Die Pferde scheuten und wollten rückwärts.
Ein Wolfsrudel, mindestens sechs Tiere, brach aus dem Sagegestrüpp und floh nach Osten.
Jay riss das Gewehr aus dem Scabbard und repetierte es.
Doch die Tiere wollten sie nicht angreifen.
Shayne feuerte dennoch. Seine Kugel warf Erde in die Luft. Der Palomino unter seinem Sattel tänzelte ervös.
Hinter dem Gestrüpp tauchte die Meute unter.
»Nun gib schon Ruhe!«, schimpfte Rio auf sein Pferd. Er musste die Zügel hart anziehen, um den Worten Nachdruck zu verleihen. »Ob er durch die Büsche taumelt?«
»Ziemlich langsam sind wir«, sagte Jay versonnen. »Das Tempo könnte er schon mithalten.«
»Ich sehe nach.« Rio wollte sein Pferd nach Westen lenken.
»Nein, du bleibst hier!«, befahl Jay barsch.
»He, was ist denn los? Das Jagen ist mein Handwerk, Vormann. Und das weißt du genau!«
»In den Büschen siehst du ihn bei Nacht erst, wenn er vor dir steht. Ein Verletzter reicht mir!«
Schimpfend schaute Shayne auf Logan, der das Bewusstsein verloren hatte. Er stieg ab, trat neben die Schleppbahre und sagte: »Er blutet immer noch. Ich glaube, den bringen wir nicht bis in die Stadt.«
Das Rascheln in den Büschen verklang. Von Westen konnten sie nichts hören. Wenn der Bär tatsächlich die Flucht der Wölfe veranlasste, so näherte er sich ihnen jedenfalls nicht.
»Los, wir reiten weiter.«
»Er blutet immer noch. Hast du es nicht gehört?«
»Hier können wir schlecht bleiben.« Jay trieb die Pferde an.
Unwillig schnaubten die Tiere und wollten nicht weiter. Er musste mit den Sporen nachhelfen, um sie in Bewegung zu bringen.
Rio stieg auf seinen Palomino und ritt hinterher.
Sanft fiel das Gelände vor ihnen ab. Das Buschwerk wurde dichter. Im silbernen Mondlicht schien es mitunter, als stünden Mauern in ihrem Weg.
Im Tal lichtete sich das Gestrüpp. Jay erkannte ein paar dürftige Maisreihen und dahinter zwei Hütten und einen Korral.
»Das soll offenbar eine Farm sein.« Shayne ritt wieder an die Seite des Vormanns. »Aber von dem bisschen Mais können die Bewohner sicher gerade selbst ihr Brot backen.«
Sie folgten dem Maisfeld und hielten vor den Hütten an. Die beiden Holzgebäude duckten sich flach an den Boden und maßen mit den Satteldächern eine Höhe von nur knapp drei Yard. Der Korral auf der anderen Hofseite besaß ebenfalls nur geringe Ausmaße. Jay erkannte darin zwei Pferde, zwei Maultiere, eine Ziege, die angebunden stand und ein paar magere Longhorns.
»Hallo?«, rief der Vormann.
Im Schatten hinter der ersten Hütte wurde ein Gewehr repetiert.
Jay wurde erst da bewusst, dass er die Winchester noch in der Hand hielt. Er schob sie sofort in den Scabbard.
»Was wollt ihr?«, fragte eine barsche Stimme.
»Wir sind mit einem Verletzten unterwegs. Es geht ihm nicht sehr gut, Mister.« Jay war klar, dass ihre Annäherung bemerkt wurde.
Hinter der zweiten Hütte trat ein Mann aus dem Schatten. Sie mussten demnach mindestens zwei sein. Der Farmer war nur mit Hemd und Hose bekleidet und trug einen alten Zylinder auf dem Kopf. Das Gewehr hielt er an der Hüfte angeschlagen. »Woher kommt ihr denn?«
»Von der Jagd am Nueces River, Mister. Ein Bär griff unseren Partner an.«
Auch der zweite Mann hinter der ersten Hütte trat in den Hof, behielt aber Abstand.
Der andere blieb neben Jays Pferd stehen. Langes Silberhaar hing unter dem speckigen Zylinder hervor. Das Gesicht wurde von einem struppigen Vollbart beinahe völlig verdeckt. Nur die lange Nase ragte wie der Schnabel eines Geiers aus dem Gestrüpp hervor.
Der zweite Mann sah genauso aus. Unverkennbar schien es sich um Brüder zu handeln, von denen der ältere bald sechzig sein musste und der andere nicht viel jünger.
»Sieh ihn dir an, Jewy«, sagte der jüngere neben der Hütte.
Der Mann mit dem Zylinder ging zur Schleppbahre, beugte sich zu Logan hinunter und brummte etwas Unverständliches vor sich hin.
»Wie weit ist es zur nächsten Stadt?«, fragte Jay.
»Vier Meilen.«
»Den hat es ganz schön erwischt. Hat eine mit der Tatze gefangen, was?«
»Ja«, entgegnete Jay. »Gibt es in der Stadt jemanden, der ihm helfen könnte?«
»Sie haben einen Barbier, der sich als Quacksalber versucht, wenn es sein muss. Aber ob der ihm helfen kann ...«
Der zweite Farmer überwand sein Misstrauen, ließ das Gewehr sinken und näherte sich ebenfalls, um den Verletzten in Augenschein zu nehmen. »Den bringt ihr doch nicht lebend bis Montrose. Der stirbt euch unterwegs.«
»Könnten wir ihn vielleicht hier lassen und den Barbier holen?«, fragte Jay.
»Wir haben nicht sehr gern Blut in der Hütte. Das lockt die Wölfe an. Aber eine knappe Meile in Richtung zur Overlandstraße findet ihr ein verlassenes Farmhaus. Boris, gib ihm einen Schluck Whisky, damit er es noch eine Meile durchhält!«
Der jüngere Farmer lief zur Hütte, öffnete die Tür und ging hinein. Eine Petroleumlampe wurde angezündet.
Jay stieg ab und vertrat sich die Beine. Er bemerkte, wie der Farmer ihn und Rio musterte.
Der andere brachte eine grüne, dickbauchige Flasche und gab dem Verletzten daraus zu trinken. Jeff erwachte dabei aus der Bewusstlosigkeit, aber er sah nicht aus, als würde er etwas von dem begreifen, was vorging.
»So, das kostet einen halben Dollar«, erklärte der Mann mit dem Zylinder.
Jay schaute ihn verblüfft an.
»Hier gibt es nichts umsonst, Mister. Wir haben selbst nicht genug.« Der Mann streckte die Hand aus und winkte mit den Fingern. »Lasst es euch von dem anderen zurückgeben, falls er noch mal auf die Füße kommt.«
Jay blieb nichts weiter übrig, als zu bezahlen. Der Farmer nahm den halben Dollar, putzte die Münze am Ärmel, biss darauf und betrachtete sie.
»In Ordnung, scheint echt zu sein. Wollt ihr Proviant?«
»Was wir haben, reicht noch einige Tage«, gab Jay zurück. Er stieg auf.
»Dann bedankt euch wenigstens!«, schimpfte der andere.
»Wieso, wir haben doch bezahlt?« Jay schaute den Mann scharf an. »Und ich denke, viel mehr, als der übliche Preis ist.«
»Was der Preis ist, bestimmt der Verkäufer immer selbst.« Der Farmer grinste, wobei sich die scharf gekrümmte Nase zu röten schien und der struppige Vollbart zuckte.
»Vielleicht hättet ihr uns den Preis erst sagen sollen«, wandte Rio ein.
»Ihr konntet ja danach fragen, wenn es für euch wichtig ist.«
»Gute Nacht«, sagte Jay, weil es sinnlos war, mit diesen beiden alten Teufeln zu streiten. Er trieb die Pferde an und ritt über den Hof. Die Enden der Bahre kratzten laut durch den Sand.
»Halsabschneider«, sagte Rio verdrossen. »Denen sollten wir als Aufpreis noch ein paar Ohrfeigen verpassen.«
*
Die beiden alten Männer standen auf die Gewehre gestützt am Haus und schauten den Reitern und dem Verletzten auf der Bahre nach.
»Ob sie bei der Hütte bleiben?«, fragte der jüngere.
»Wird ihnen kaum was anderes übrigbleiben.« Der ältere Mann lehnte das Gewehr an die Wand, packte die auf der Bank stehende Flasche, entkorkte sie und trank einen gewaltigen Zug.
Der andere nahm ihm die Flasche ab und trank ebenfalls.
»Sah wie ein Revolvermann aus, was Boris?«
»Genau.« Boris schlug den Korken mit dem Handballen in den Flaschenhals.
»Einem Kerl wie dem traut man jede Schlechtigkeit zu, Boris.« Der ältere Bruder grinste auf einmal teuflisch.
»Was meinst du, Jewy?«
»Ich frage mich schon lange, wem man es in die Schuhe schieben könnte, wenn irgendwas Verrücktes in dieser Gegend passiert.«
Hinter dem Buschwerk im Südosten der kümmerlichen Farm verschwanden die Reiter mit der nachgeschleppten Last am dritten Pferd.
»Die pfeifen doch auf dem letzten Loch«, erzählte Jewy weiter. »Die haben einen Verletzten, der möglicherweise über den Jordan geht. Aber das kann noch seine Zeit dauern. Die brauchen Geld. Und wenn sie morgen nach Montrose kommen, werden die Narren dort merken, dass die Kerle Geld brauchen. Das lässt sich leicht nachkontrollieren, indem man zufällig auch in dem Nest auftaucht.«
»Ich weiß immer noch nicht, was du meinst.«
»Wirklich nicht? Mach dir nichts daraus, du hattest schon als Kind Schwierigkeiten damit.«
Borris fluchte grimmig.
»Morgen müsste McClure, der fahrende Händler, wieder in dem Nest aufkreuzen. Gestern sah ich ihn im Westen, als ich unsere Fallen am Creek kontrollierte. Er klapperte dort die Farmen ab. Vielleicht kam er schon am Abend in der Stadt an.«
»McClure, der sich gelegentlich damit brüstet, viel Geld zu haben.« Borris begann zu grinsen.
»Na endlich, Boris!« Jewy schlug seinem Bruder auf die Schulter. »Den hab ich im Visier, seit er hier herumgondelt. «
»Immer auf dem gleichen Wege, was?«
»Genau. Aber dafür ist ein Sündenbock nötig.«
Die beiden alten Teufel kicherten. Boris rieb gar die Hände aneinander.
»Bist du ganz sicher, dass man die Kerle wirklich verdächtigt?«
»Da kann man noch ein bisschen nachhelfen, damit es leichter geht. Aber ein paar Fremde sind allemal verdächtig.«
»Ein Revolvermann sowieso!«, setzte Boris hinzu.
»Da geht es bei den Leuten doppelt so fix, einen Strick zu holen.« Jewy nahm sein Gewehr in die Hand und ging in die Hütte.
Boris folgte ihm mit seiner Waffe und der Whiskyflasche. Er schloss die Tür.
Jewy stand unter der Lampe und legte das Gewehr auf den Tisch.
In der ärmlichen Hütte, die sie allein bewohnten, standen aus rohen Brettern gezimmerte Möbel, die leicht verrieten, wie wenig Geschick die beiden alten Kerle besaßen.
»Wann kam dir der Gedanke?«
»Gleich, als ich den Verletzten sah und wusste, dass sie ihn nicht bis in die Stadt bringen würden. Jedenfalls vielleicht nicht. Da greifen solche Burschen zu, wenn es um ihren Partner geht. Das sind die geborenen Sündenböcke, Boris!«
*
Die Hütte war kleiner als das Wohnhaus der Farm, die hinter ihnen jenseits der Büsche und Hügel lag. Der Anbau war bereits zusammengefallen. Vom Maisfeld standen nur noch ein paar Stauden, die aber mussten im Frühjahr selbst nachgewachsen sein. Jay schätzte, dass das Anwesen schon vor mindestens einem Jahr aufgegeben wurde. Warum, lag auf der Hand. Der Boden war hier nicht besser als bei den Brüdern. Und wie immer ein Farmer sich hier abrackerte, auf einen grünen Zweig konnte ihn die Parzelle nie bringen.
Vom Korral standen auch nur noch ein paar Zaunreste. An einen davon banden sie die Pferde.
Jay ging zur Hütte, während Shayne den Verletzten losband.
Durango öffnete die Tür, neben der sich ein Fenster mit zerschlagener Scheibe befand. Im einfallenden Mondschein erkannte er wüst übereinander liegende Trümmer von Möbeln.
»Kannst du was sehen?«
»Nicht viel.«
Shayne brachte eine Kerze, zwängte sich am Vormann vorbei und brannte das Talglicht drinnen an. »Schönes Durcheinander.«
»Ein Wunder, dass die Bude noch steht.« Jay räumte die Trümmer nach den Seiten und grub so einen noch intakten Tisch und eine Pritsche mit Fellen darauf heraus.
»Und hier wollen wir bleiben, bis Jeff wieder fit ist? Weißt du, wie lange das dauern kann?«
»Wenn er über den Berg ist, reitet einer von uns zur Ranch. Das ist in ein paar Tagen.«
»Oder auch nicht.« Shayne stellte das Talglicht auf den Tisch und ging hinaus.
Jay folgte ihm. Sie trugen den Verletzten auf der Schleppbahre herein und legten ihn damit auf die Pritsche. Dann erst schnitt Jay die langen Stangen ab, brachte sie hinaus und warf sie neben die Hütte. Sie sattelten ihre Pferde ab, brachten die Decken und Sättel hinein und richteten sich auf dem schmutzigen Boden ein.
»Hast du das Gestrüpp gesehen, wie es den Hof auffrisst?«, fragte Shayne. »Hinten ist es schon bis an der Ruine des Anbaus.«
»Und in einem Jahr wächst es überall, auch hier drin. Schlaf jetzt endlich!« Jay wälzte sich auf die Seite und schloss die Augen.
»Ich wollte eigentlich sagen, wenn sich hier einer anschleicht, sehen wir ihn erst, wenn er vor uns steht.«
»Wir haben nichts, weswegen es sich lohnen könnte, uns überfallen zu wollen, Rio.«
»Hoffentlich wissen das die Halunken, die uns hier zufällig in den nächsten Tagen bemerken könnten!«
Jay antwortete nicht mehr, weil der Disput sonst vielleicht bis zum Morgengrauen weitergeführt würde.
Der Verletzte bewegte sich unruhig auf der knarrenden Pritsche.
Jay vermochte nicht einzuschlafen. Mehrmals wollte er aufstehen, sein Pferd satteln und losreiten, um den Barbier zu holen. Aber immer wieder sagte er sich, dass es kaum möglich sein würde, aus der fremden Stadt jemanden in der Nacht hier heraus zu holen. Sie würden ihn für verrückt erklären.
Schließlich erhob er sich doch.
Shayne schlief nicht, setzte sich auf und stülpte den Hut aufs weißblonde Haar.
»Ich reite jetzt los, Rio. Bleib du bei ihm.«
»Soll ich dir sagen, was der Barbier dir erzählt?«
»Nein, ich weiß es doch. Trotzdem muss ich es versuchen.« Jay trug Sattel und Campdecke hinaus und sattelte den braunen Hengst.
Shayne folgte ihm. »Es ist noch finster, wenn du die Stadt erreichst. Und um ganz ehrlich zu sein, ich würde mit einem wildfremden Menschen auch nicht bei Nacht und Nebel in die Wildnis reiten. Du verpasst gar nichts, wenn du erst ein paar Stunden schläfst!«
Jay zog den Sattelgurt fest, band den Zügel los und saß auf. »Dann bis später.«
Shayne zuckte mit den Schultern, kehrte in die Hütte zurück und schloss die Tür.
*
Montrose bestand aus genau fünfzehn Häusern. Ein paar davon waren Lagerschuppen, eins der Mietstall und eins verfallen. Sie reihten sich rechts und links der Overlandstraße auf, die ohne Bogen durch den Ort führte.
Wie erwartet lag noch tiefe Nacht über dem Land, als Jay in den Ort ritt. Der Braune lief langsam und wurde dennoch von verschiedenen Leuten gehört. Türen klappten.
»Wer ist das?«, fragte jemand unter einem weit nach unten gezogenen Vordach.
Jay hielt an und blickte hinüber. Sehen konnte er niemand. »Ich bin Jay Durango und brauche dringend den Barbier für einen verletzten Kameraden!«
Männer mit Gewehren im Anschlag betraten die Fahrbahn. Manche trugen Hemden und Hose wie die beiden Farmer im Buschland, einer hatte einen alten Militärmantel übergezogen, zwei kamen in langen, grauen Nachthemden ins Mondlicht.
Von der anderen Seite näherten sie sich ebenfalls. Und die Straße herunter kam einer, der noch die Hosenträger über die Schultern und die Jacke überzog. Ein Stern steckte an seiner Brust.
Sie kreisten das Pferd ein.
»Ein Freund von mir wurde am Nueces River von einem Bären angegriffen und liegt schwerverletzt in einer Hütte im Norden. Ein Paar Farmer machten uns auf das verlassene Haus aufmerksam.«
»Die Zattigs, was?«, fragte der Marshal.
»Keine Ahnung, wie sie heißen.«
»Was fehlt ihm denn?« Ein kleiner weißhaariger Mann schob sich in den Vordergrund. »Ich bin Keach, der Barbier, der auch Zähne zieht.«
»Seine Zähne sind in Ordnung, Mister Keach. Ein paar Rippen gebrochen, die sich nach innen gestellt haben.«
»Dafür brauchen Sie einen richtigen Arzt. Wo es so was gibt, wissen wir hier aber nicht. Vielleicht in Fort Worth.«
»Es geht ihm sehr schlecht«, sagte Jay.
»Also gut, ich sehe ihn mir an. Lassen Sie fünf Dollar da. Ich komme dann hinaus.«
Jay saß ab und kramte das verlangte Geld zusammen. Er besaß immer noch ein paar Dollar.
Der Barbier nahm die fünf Dollar und steckte sie ein.
»Könnten Sie nicht sofort mitreiten?«
»Ich weiß, wo die Hütte ist, und werde sie finden.«
»Er ist bewusstlos und blutet sehr stark.«
»Wann geschah das Unglück?«
»Am Spätnachmittag.«
»Dann spielen ein paar Stunden keine Rolle mehr. Sie müssen das verstehen. Wenn ich nicht lange genug geschlafen habe, zittern mir die Hände. Das wäre sehr schlecht für Ihren Freund.« Der weißhaarige Mann wandte sich ab.
Jay blickte auf den Stadtmarshal. Er war ein mittelgroßer, bulliger Mann mit einem quadratischen Schädel und angegrauten Borstenhaaren.
»Er kommt bestimmt«, versprach der Mann.
»Können Sie ihn nicht dazu ...«
»Ausgeschlossen«, unterbrach der Marshal den Vorman barsch. »Vor zwei Stunden hat Keach seinen letzten Whisky getrunken. Konnten Sie die Fahne nicht riechen?«
»Nein.«
»Na ja, er stand vielleicht ein bisschen weit weg von Ihnen. Nein, der braucht den Schlaf.«
Jay schaute sich in der Runde um. Ein paar Männer grinsten verstohlen. Es konnte keinen Zweck haben, noch lange Worte zu verlieren.
»Ich werfe Keach aus dem Bett, sobald die Sonne aufgegangen ist«, versprach der Marshal. »Und ich bringe ihn selbst hinaus.«
»Danke, Marshal.« Jay saß auf. Der Kreis lichtete sich. Er lenkte den Braunen nach Norden und ritt langsam durch die Stadt.
»Ein Revolvermann – so einer ist das«, sagte jemand und spuckte in den Sand. »Irgenwelche Satteltramps, die es mal im Wald am Fluss mit der Jagd versuchen wollten.«
»Um ein paar schnelle Dollars zu machen«, stimmte ein anderer Mann zu. »Und deswegen werden ehrbare Leute dann nachts aus den Federn geworfen.«
Der Marshal wandte sich ab und lief die Straße hinauf.
Seine Frau schaute aus einem Fenster der Büchsenmacherei, die James Cobb in seinem Hauptberuf betrieb. »Wer war das?«
»Irgendein Fremder. Hat einen Verletzten auf der aufgegebenen Farm liegen.«
»Diese Sattelstrolche sollten sich schämen, mitten in der Nacht hier aufzutauchen.«
*
Barbier Keach sah sehr besorgt aus, als er aus der Hütte trat.
Marshal Cobb lehnte bei den Pferden an einem Stück des noch stehenden Korralzauns.
Jay kam hinter dem Barbier her, der seine schwarze Tasche ans Sattelhorn hängte. Shayne blieb in der Hütte und blickte auf das spitz gewordene Gesicht von Jeff Logan. Der Barbier hatte ihn nach der Behandlung verbunden, aber das Blut tränkte den weißen Stoff in der Herzgegend.
»Und?«, fragte der Marshal.
»Ich weiß nicht. Hat verdammt viel Blut verloren. Er müsste vor allem ein schmerzstillendes Mittel kriegen. Sonst dreht er durch, wenn er zu sich kommt. Aber mir ist das Zeug ausgegangen. Sie kriegen es im Store. Savage hat davon noch. Das weiß ich.«
Jay nickte. »Dann reite ich mit Ihnen.«
Barbier Keach blickte an Jay vorbei auf Shayne an der Tür. Der hünenhafte, weißblonde junge Mann hatte etwas Wildes an sich, was Keach gar nicht gefiel.
Jay sattelte seinen braunen Hengst und ritt wenig später mit den beiden Männern auf der Overlandstraße nach Süden. Als sie die Stadt erreichten, stand die Sonne schon fast im Zenit und glühende Hitze lag über dem Hügelland.
Vor dem Store stand ein kurzer Planwagen. Zwei Maultiere waren in die Sielen gespannt. »McClure’s Drugstore« stand auf der grauen Plane.
Der Barbier hielt vor seinem Haus.
Jay zügelte sein Pferd ebenfalls. »Vielen Dank, Mister.«
Keach schüttelte den Kopf. »Warten Sie damit, bis Ihr Freund auf den Füßen steht. Aber sagen Sie nicht, es wäre meine Schuld, wenn das nicht geschieht.«
»Kann man für ihn nichts weiter tun?«
Keach schüttelte den Kopf und schob seine Melone in den Nacken. Das Sonnenlicht fiel auf sein zerfurchtes Gesicht. »Nein. Er braucht Ruhe, damit sich neues Blut bilden kann. Sollte er aber schon zuviel verloren haben, wird er wohl ....« Der Mann brach vieldeutig ab.
»Trotzdem besten Dank.« Jay ritt mit dem Marshal weiter. Vor dem Saloon sah er die beiden Farmer wieder. Bei Tageslicht sahen sie noch abgerissener aus als während der Nacht.
Jay hielt an.
»Stand die Hütte noch?«, fragte Jewy Zattig.
»Ja. Vielen Dank für den Tipp.«
»Wie geht es Ihrem Freund denn?«
»Den Umständen entsprechend.«
»Er lebt also noch?«, wollte Jewy Zattig wissen, während er an den Fußweg trat.
»Ja, er lebt noch.«
»Na also, dann kommt er irgendwann schon wieder auf die Beine. Nur die Guten sterben jung!«
Boris lachte krächzend. Sein Bruder wandte sich um und schob ihn vor sich in den Saloon.
Der Marshal stieg bereits bei seinem Haus ab und führte das Pferd in den Hof.
Jay ritt zum Store weiter, saß neben dem Planwagen ab, führte den Braunen zur Zügelstange und band ihn daran fest. Als er den Drugstore betrat, sah er zwei Männer hinter den deckenhohen, vollgestapelten Regalen an einem kurzen Tresen. Auch hinter der Tafel erhoben sich noch einmal Regale über die gesamte Breite des Hauses. Nur die Tür war ausgespart. Wie durch einen Tunnel ging es in den Flur dahinter.
Die beiden Männer blickten dem Eintretenden entgegen.
»Guten Tag«, sagte Jay, lief an den Regalen vorbei und blieb an der Ecke des Tresens neben einem aufgebockten Rumfass stehen. Eine kleine Waschschüssel und ein paar Gläser auf einem Lappen verrieten, dass der Krämer auch Gäste bewirtete.
»Und?«, fragte der Mann hinter dem Tresen unwirsch. Er war ein großer Mann wie ein Hüne und hatte Schultern von der Breite eines mittleren Kleiderschrankes. Dazu einen kantigen Schädel auf einem dicken Hals, der in einem Stiernacken auslief, schwarzes Haar, finstere Brauen und bernsteinfarbene Augen. Wie ein Spieler trug er ein weißes Rüschenhemd, gestreifte Röhrenhosen und eine doppelreihige schwarze Jacke. Eigentlich sah er nicht wie ein Händler aus, allerdings verriet Jay bereits vor dem Laden ein Schild, dass er auch Fuhrunternehmer war. Im Hof neben dem Haus standen auch ein paar abgestellte Frachtwagen. Das lange Gebäude dahinter schien der Stall zu sein.
»Der Barbier schickt mich. Sie hätten ein schmerzlinderndes Mittel.«
»Laudanum, Mister. Es senkt das Fieber, ist gut gegen Zahnschmerzen und sonstige Wehwehchen.« Der Mann grinste, sah deswegen aber nicht freundlicher aus.
»Sicher meint er das.«
»Ich hab gar nichts anderes.« Der Mann griff unter den Tresen und legte eine kleine Tüte darauf. »Jedes mal eine Messerspitze, wenn der Patient brüllt. Und vor allem muss man ihn darauf aufmerksam machen, dass er was gegen den Schmerz bekommt. Die moralische Wirkung ist ungeheuerlich. «
Der andere Mann grinste nun ebenfalls von einem Ohr bis zum anderen. Er zählte mindestens fünfundsechzig Jahre, war mittelgroß und gedrungen, grauhaarig und stoppelbärtig. Falten und Runen zeichneten sein Gesicht und ließen ihn älter wirken. Er trug ein graues, derbes Hemd ohne Kragen, ausgebeulte, zerschlissene Hosen, ’ Schaftstiefel, eine fadenscheinige Jacke und einen schweißdurchtränkten Schlapphut.
»McClure, junger Freund.« Der Mann tippte an seinen Hut. »Hab schon gehört, was Ihnen widerfuhr. Werde mal vorbeischauen, ob Sie noch etwas brauchen.«
»Ich glaube nicht, dass wir etwas brauchen.« .Jay blickte den anderen Händler an. »Was kostet es?«
»Vierzig Cent. Kaum der Rede wert.«
Jay atmete auf und bezahlte. Der Händler stellte ihm ein Glas voll Whisky hin und gab dann das restliche Geld heraus.
»Der Whisky ist inbegriffen. Immer, wenn man bei mir was kauft.«
»Danke.« Jay steckte das Kleingeld wieder ein. Er war so ziemlich blank und hoffte, dass das Pulver ausreichte, bis sie daran denken könnten, Jeff weiter zu transportieren. Dabei überlegte er aber schon, ob er nicht Rio bei dem Verletzten allein zurücklassen und zur Ranch reiten sollte, um den Boss zu verständigen und einen Wagen zu holen.
Das war sicher besser. Sie würden dann früher aufbrechen können.
»Also, ich kriege dann zweitausendfünfhundert Bucks«, erinnerte McClure. »Und den obligaten Whisky hab ich auch noch nicht.«
Der Mann hinter dem Tresen schenkte ein zweites Glas voll und stellte es dem fahrenden Händler hin. Dann öffnete er die Kasse und brachte ein Bündel Banknoten zum Vorschein.
McClure hustete scharf und stellte sich gerade. Mit funkelnden Augen starrte er den anderen böse an.
»Ist was, McClure?«
»Steck das Teufelszeug wieder ein, verdammt! Seit fünfzig Jahren nehme ich nur Hartgeld und gebe auch nichts anderes aus. Ich will Silberdollars!«
»Ich würde mich langsam mal umstellen.« Der schrankbreite Stadthändler steckte das Geld wieder weg.
»Denke gar nicht daran. Auf die komischen Zettel kann jeder drauf drucken, was er lustig ist. Und wenn man mal Pech hat, verbrennt der Plunder!«
»Man muss mit der Zeit gehen.«
»Ich nicht!«, schimpfte der fahrende Händler.
Hiram Savage entnahm seiner Kasse Silberdollars und zählte sie in Reihen auf den Tresen.
Jay trank den Whisky und ließ das leere Glas ins Spülwasser fallen. »Herzlichen Dank, Mister.«
»Sonst keine Wünsche?« Savage hielt inne und blickte auf.
»Nein, danke.« Jay wandte sich ab.
»Ich schaue mal bei euch vorbei!«, rief McClure ihm nach.
»Das wird nicht nötig sein.« Durango verließ den Store.
Savage zählte weitere Reihen Silberdollars auf den Tresen. »Den Umweg kannst du dir schenken. Der pfeift auf dem letzten Loch.«
»Kann man nie wissen.«
»Tramps sind das, McClure. Die leben von der Hand in den Mund und sind dabei meistens verdammt hungrig.«
Draußen band Jay sein Pferd los und zog den Sattelgurt nach.
Die Menschen der kleinen Stadt beobachteten ihn. Er spürte es, obwohl er sie nicht alle sehen konnte.
Vor dem Planwagen scharrten die Maultiere im Sand.
Jay stieg auf und ritt die Straße hinunter. Er spürte die Blicke im Nacken noch, als er schon jenseits der Häuser der Straße nach Norden folgte.
»Schneller!«, rief er dem Braunen zu und gab ihm die Sporen.
Das Pferd streckte sich. Rechts und links der ausgefahrenen Straße wurde das vorbeifliegende Buschwerk dichter. Staub wehte hinter den Hufen in die Höhe.
*
Jay Durango erreichte die halbverfallene Hütte am Nachmittag. Rio Shayne trat ihm entgegen. Jay zügelte den Hengst und sprang ab.
»Wie geht es Jeff?«
»Unverändert, würde ich sagen. Der Verband ist durchblutet. Hast du das Zeug?«
Jay nickte. »Aber wenn ihm das hilft, glaube ich an die Wunder, von denen mir erzähl wurde, als ich noch Kind war.«
Sie betraten die Hütte. Jay blickte auf das spitze Gesicht Logans. Die bleichen Lippen des Partners bewegten sich, seine Augen waren geschlossen. Die schwarzen Ränder darum hatten Jeffs Aussehen stark verändert. Er ähnelte sich kaum noch.
»Ich reite nach Rancho Bravo«, sagte Durango. »Der Boss muss wissen, was passiert ist. Einen Wagen brauchen wir auch. Und mein Geld ist praktisch alle.«
»Hast du ihnen gesagt, dass wir zu dieser Ranch gehören?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
Jay wandte sich um. »Warum sollte ich?« Auf dem Tisch öffnete er die kleine Tüte, zog das Messer, reinigte es an der Hose und nahm die Spitze voll von dem weißen Pulver. »Wasser!«
Sie flößten Jeff das Pulver und Wasser ein. Der Verletzte hustete und spuckte die Hälfte wieder aus.
»Du wirst mindestens vier Tage unterwegs sein«, maulte Rio.
Jay schob das Messer hinter den Gürtel. »Aber dann bin ich zurück und habe einen Wagen und Leute dabei. Ist das nicht besser, als wenn wir in vier Tagen immer noch allein hier herumsitzen?«
Rio fluchte verdrossen, weil es ihm nicht behagte, dass er so lange allein bei dem Verletzten bleiben sollte, dem er überdies nicht zu helfen wusste. »Und wenn er mir unter den Händen stirbt?«
»Dann würde es auch nichts ändern, wenn wir beide hier sitzen.«
»Warte wenigstens bis morgen.«
Jay hob den Kopf. »Warum denn das?«
»Vielleicht ist es gar nicht ....« Rio brach ab und biss sich in die Unterlippe.
»Ach so.« Jay schaute auf das spitze Gesicht Logans. Vielleicht erlebte der Cowboy den nächsten Tag wirklich nicht mehr und der ganze Aufwand erübrigte sich.
»Es wird sowieso bald Nacht«, setzte Rio hinzu. »Es dürfte auf ein paar Stunden auch nicht ankommen. Außerdem wird deinem Gaul die Pause gut tun. Seit wir vom Nueces weg sind, bist du beinahe ununterbrochen geritten.«
»Ich könnte dein Pferd nehmen.« Jay lächelte dünn. »Das ist ausgeruht. «
»Ich glaube nicht, dass er es überlebt. Die innere Blutung ist nicht gestoppt.«
Jay schob Logans Hemd zur Seite und sah den roten Verband. Der Fleck besaß die Größe einer Hand, so dass die linke Brustseite davon völlig bedeckt war.
»Also gut, dann warte ich bis morgen.«
*
Die beiden Farmer holten ihre Pferde aus dem Mietstall.
Vor dem Saloon stand Fee, ein alt gewordenes Saloonmädchen mit blond gefärbten Haaren. Als sie ins Sonnenlicht trat, offenbarte das Kattunkleid mit den silbernen Pappsternen daran seine ganze Schäbigkeit.
Die beiden Zattigs stiegen auf die Pferde und winkten dem Mädchen mit dem faltigen Gesicht.
»Geht zum Teufel, ihr Geizkragen!«, schimpfte Fee mit rauer Stimme.
Jewy Zattig warf noch einen Blick auf den Planwagen des fahrenden Händlers, der inzwischen an der Ecke des Saloons im Schatten stand. Dann trieb er sein Pferd an.
Boris folgte dem Bruder. Sie ritten aus der Stadt, verließen die Straße und hielten zwischen hohen Sagebüschen an.
»Absteigen, sonst kann man uns vom Karrenweg aus sehen.« Jewy ging sofort mit gutem Beispiel voran.
Auch sein Bruder kletterte aus dem Sattel. Er dachte noch an McClure, den ziehenden Händler, der zuletzt bei ihnen am Tresen des Saloons stand. »Wieviel Geld hat er?«
»Genug.«
»Bist du sicher, dass es glatt geht?«
»Aber klar. Hast du denn nicht gehört, wie verächtlich sie von dem Fremden redeten? Den schickt uns der Himmel.«
»Wenn wir den Zaster eines Tages anfangen auszugeben, riechen sie doch noch Lunte.«
Jewy grinste den Bruder herablassend an. »Wir geben den Zaster nicht aus. Nicht hier. Wir leben bis zum Winter wie die ärmsten Teufel der Welt weiter und werden nie vergessen, entsprechend zu jammern. Und so ganz nebenbei fangen wir an, von der Aufgabe der Farm zu reden. Das fällt überhaupt nicht auf, zumal wir nicht die ersten sind.«
»Ja, das könnten sie schlucken.« Boris grinste.
»Dann gehen wir weit weg. Und dort, wo wir das Geld ausgeben, erzählen wir eine fantastische Geschichte. Von einer Ölquelle, die wir auf unserem miesen Land fanden und verkauften.«
Die beiden Halunken lachten schallend.
Ihre Geduld wurde noch auf eine längere Probe gestellt. Als die Sonne jedoch tief nach Westen gesunken war, hörten sie Peitschenknallen. Die Plane des Wagens ließ sich bald über dem Buschwerk erkennen.
»Na also!«, frohlockte Jewy und rieb die Hände aneinander. »Er nimmt immer den gleichen Weg. Und er fährt auch glatt am Abend los, um die Bucks fürs Übernachten zu sparen.«
»So ein verdammter Geizhals!«
»Das kannst du laut sagen!«
Der Wagen rollte hundert Yard von den lauernden Farmern entfernt vorbei und entfernte sich rasch.
Jewy führte sein Pferd an den Rand der Straße und beugte sich zur Seite. So sah er den leicht schaukelnden Wagen wieder.
Boris tauchte neben ihm auf. Sie stiegen auf die Pferde und folgten dem Gefährt mit großem Abstand.
Als der Wagen die Straße verließ, pfiff Jewy durch die Zähne. »Merkst du was?«
»Er fährt zu der verlassenen Hütte, die nicht mehr verlassen ist«, erwiderte der jüngere Bruder.
»Genau. Will den Kerlen noch versuchen, was anzudrehen. Der lässt aber auch nichts aus.«
»Schlecht für unseren Plan, was?«
»Aber nein, Boris. Das ist gut. Sehr gut sogar. Die Radrinnen sehen sie morgen noch. Die Cowboys sind danach zehnmal so verdächtig wie vorher. Haben hier bei McClure genau gesehen, was der mit sich herumschleppt!«
*
Jay trat vor Rio aus der Hütte, als der Wagen im verwahrlosten Hof der aufgegebenen Farm anhielt.
»Hallo, da bin ich!«, rief der Händler. Ein kicherndes Lachen folgte den Worten.
»Ist der verrückt?«, flüsterte Rio hinter Durango.
»Kein bisschen.«
McClure stieg ab, zog den alten Schlapphut vom Kopf und schlug den Staub damit von der Kleidung. »Na, ist euch eingefallen, was ihr noch gebrauchen könntet?«
»Wir haben kein Geld.« Jay lehnte sich neben der Tür an die Hüttenwand.
»Aber, aber, Mister, einen Notdollar hat doch jeder noch!« Der Händler kicherte wieder. »Wie geht es dem Freund?«
»Ziemlich schlecht.«
»Ich hab noch ein anderes Pülverchen, mit dem schon verblüffende Wirkungen erzielt wurden. Aus getrockneten Blättern von den Kiowas gerieben. Konnte bei Savage nur nicht davon erzählen, weil er das übelgenommen hätte. War schließlich sein Laden, in dem wir standen.«
»Ich glaube, dass alle eure Pülverchen nur einem helfen«, murmelte Rio. »Und zwar dem, der sie verkauft!«
»Nana, junger Mann, keine Beleidigungen!«, schimpfte der fahrende Händler grollend. »Ich verkaufe nur echte Sachen! Das Pulver kriegt ihr von mir für einen halben Dollar.«
»Ich glaube, Sie hören nicht zu, wenn andere reden«, erwiderte Jay schleppend. »Wir haben kein Geld.«
McClures stoppelbärtiges Gesicht zog sich in die Länge. »Kann ich den Jungen mal sehen?«
Rio trat zur Seite.
McClure ging hinein. »Teufel, der sieht aber gar nicht gut aus. Dem würde mein Pulver bestimmt helfen, Jungens!«
Jay blickte auf die Büsche, die vom letzten Sonnenlicht wieder in bunten Farben beleuchtet wurden und einen goldenen Schimmer wie einen Heiligenschein bekamen.
»Der gefällt mir wirklich nicht.« McClure trat aus der Hütte. »Dem würde meine Medizin bestimmt helfen.«
»Soll ich ihm auf meine. Art nochmal sagen, dass wir kein Geld haben?«, fragte Rio.
»Verschwinden Sie, Mister«, sagte Jay. »Wir kaufen nichts, weil wir kein Geld mehr haben.«
»Also schenken kann ich euch meine Ware nicht!«, schimpfte McClure. »Ihr denkt wohl, ich will mich aus lauter Menschenfreundlichkeit an den Bettelstab bringen?«
»Er geht mir auf die Nerven, Jay!«
»Mir auch.«
Drohend schob sich Rio an den miesen Händler heran, der partout nicht einsehen mochte, dass kein Geschäft abgewickelt werden könnte.
»Ich bin extra von der Straße abgebogen!«
»Hau ab!« Rio stieß den Mann mit der Schulter an. »Los, zieh Leine, Krämerseele!«
»Und beschimpfen lasse ich mich auch nicht!« McClure stieß Rio den Ellenbogen in den Leib.
Der Cowboy krümmte sich im jähen Schmerz zusammen. In der nächsten Sekunde schmetterte er dem Händler die Faust gegen das Kinn.
McClure brüllte, taumelte zurück und stürzte vor dem Wagen zu Boden. Sein Gesicht sah verschoben aus. Er kniete und spuckte zwei Zähne aus.
Rio schaute maßlos verblüfft auf Jay. »Ich hab doch kaum hingelangt?«
»Seine Zähne sind lang wie bei einem alten Pferd und stecken kaum noch im Kiefer«, erwiderte Jay.
Fluchend erhob sich der Mann. »Das werdet ihr mir büßen, Halunken! Das zahle ich euch heim!«
»Bleib hier!« Jay hielt Rio fest, als der hinter dem schimpfenden Krämer her wollte.
McClure kletterte auf den Bock und nahm die Peitsche. »Spitzbuben! Mördergesindel!«
Die Peitsche knallte. Die Maultiere zogen an.
»Banditengesindel!«, brüllte der Händler mit einem pfeifenden Unterton hinten durch den Wagen. Dann knallte die Peitsche wieder. Der Wagen walzte das Dickicht nieder und verschwand hinter einer Staubwolke. Die Geräusche entfernten sich.
Jay betrat die Hütte.
»Ob sein Kiowapulver doch was genützt hätte?«, fragte Rio, den leise Zweifel zu plagen schienen.
»Blödsinn.«
*
Die beiden Zattigs hockten noch im Gestrüpp hinter dem verfallenen Korral und schauten in den Staub, der durch die Dämmerung zog und das verfallene Haus zusätzlich verhüllte.
»Hast du das gesehen?«, flüsterte Boris.
»Ich bin nicht blind. Aber wir können damit nichts gegen sie anfangen.«
»Wieso nicht?«
»Weil wir nicht sagen dürfen, dass wir sie beobachtet haben.« Jewy schüttelte den Kopf. »Bei dir schreitet die Verkalkung in jüngster Zeit erschreckend rasch voran, Bruder.« Jewy kehrte um. Zweihundert Yard entfernt standen die Pferde. Er stieg auf und ritt nach Osten, um die Straße zu erreichen.
Den Wagen hörten sie erst wieder vor sich, als die Dunkelheit bereits über das Land sank. Eine Meile mochten sie sich von der verfallenen Farm entfernt haben.
»Jetzt?«, fragte Boris.
»Noch ein Stück.«
»Aber bald ist es nicht mehr weit bis zu Wolters Farm. Er wird die Schüsse hören!«
»Soll er ja auch.«
Boris begriff gar nichts mehr.
Jewy grinste überlegen. »Er wird was hören und nachsehen. Und dann reitet er in die Stadt und alarmiert den Marshal. Bis der Tag wieder graut, sind die Leute der Stadt da und machen, wenn wir Glück haben, kurzen Prozess. Hauptsache, die Kerle selbst hören die Schüsse nicht.«
Noch eine halbe Stunde folgten die Zattigs dem Planwagen, dann hielt dieser an.
»Was ist jetzt?« Boris sprang sofort ab.
»Er scheint ein bisschen schlafen zu wollen.« Jewy blickte sich um. Er glaubte, dass sie weit genug entfernt waren, um den Überfall riskieren zu können, ohne dass die Cowboys etwas hörten. Hohes Buschwerk und ein paar Hügel lagen zwischen ihnen und der aufgegebenen Farm. Und Louis Wolters Farm konnte nicht mehr fern sein.
»Weiter, Boris. reiß dich zusammen! « Jewy zog die Sharps 52 aus dem Scabbard und spannte den außenliegenden Hammer.
Boris stieg auf, nahm den Remington-Karabiner zur Hand und repetierte ihn.
Sie ritten langsam zwischen den Fahrrinnen weiter. Die Hufe schlugen in den Sand. Boris’ Pferd schnaubte.
»Ist da jemand?«, rief die keifende Stimme des fahrenden Händlers. »Halt, nicht näherkommen!«
Die beiden Zattigs hielten an. »Hier ist Jewy Zattig, McClure. Wolltest du nicht noch mal bei uns vorbeischauen?«
»Zattig?« Das Gesicht des Händlers war hinten unter der Plane wie ein heller Fleck zu erkennen. »Nein, nicht, dass ich wüsste.«
»Aber wir wollten was kaufen«, wandte Boris ein.
»Warum habt ihr das nicht getan, als ich bei euch war?« Nacktes Misstrauen ließ sich heraushören.
»Da sprachen die Umstände dagegen«, erklärte Jewy.
»Was redest du denn für dummes Zeug, zur Hölle?«
»Wir können dich doch nicht auf unserer Farm in die Hölle schicken, McClure, alter Halsabschneider!« Boris lachte krächzend. Dann drückte er ab.
Ein Feuerstrahl fuhr dem Händler, von einem Donnern begleitet, entgegen. Die Kugel bohrte sich in seine Brust. Er schrie. Seine Arme stießen zur Plane hinauf.
Jewy drückte ebenfalls ab.
McClure wurde noch einmal getroffen, stieß einen zweiten, abgerissenen Schrei aus und stürzte hinten über die Bordwand.
Das Krachen verlor sich in der Wildnis.
Jewy stieg ab und beruhigte sein Pferd. »Sieh nach, ob es ihm reicht, Boris!«
Der jüngere Zattig sprang kichernd vom Pferd. »Hat der blöd aus der Wäsche geguckt, Jewy!«
Den älteren interessierte das nicht. Er lief am Wagen entlang und kletterte auf den Bock.
Boris wälzte den steif hinter dem Wagen liegenden Händler auf den Rücken. »Nein, der hat keine Sorgen mehr, Jewy.«
Mit einer abgeschabten Satteltasche in der Hand stieg Jewy Zattig vom Bock. »Dann nichts wie weg. Wir reiten zuerst zum Creek, damit sie keine Spuren finden.«
Boris beugte sich über den Toten. »Sieh mal, dem fehlen zwei Zähne, Jewy. Die hatte er in der Kneipe noch im Mund.«
Jewy schaute nun doch auf den Toten.
»Die muss der Kerl ihm aus der Futterluke geschlagen haben, als sie rauften. Lässt sich anders nicht erklären.«
»Dann liegen sie sicher noch vor der Hütte im Sand.« Ein sattes Grinsen überzog Jewy Zattigs Gesicht. »So was übersieht der tüchtige Marshal bestimmt nicht. Los, ab geht die Post!«
Sie stiegen auf die Pferde und ritten ins Dickicht westlich der Straße. Das Knacken brechender Äste entfernte sich.
*
Graue Nebelschwaden zogen über das Buschwerk und den verfallenen Korral.
Jeff Logan stöhnte so laut, dass Jay davon erwachte. Er erhob sich und trat ans Fenster.
Rio schaute auf. »Was ist?«
»Ich weiß nicht.« Jay blickte hinaus. Wie Watte schwebte der Nebel über den Büschen. »Aber irgend etwas muss los sein.«
Rio kniete und kroch neben Jeff Logan. »Wie geht es dir, alter Junge?«
Der Verletzte reagierte nicht darauf.
Rio stand auf. »Ich hab ehrlich keine Lust, ein paar Tage mit ihm allein hier zu warten. Vor allem, er kann mir unter den Händen sterben, Jay. Ich habe keine Hoffnung, dass er in drei bis vier Tagen noch lebt.«
»Also gut, dann bleibe ich hier und du reitest nach Rancho Bravo«, erwiderte der Vormann.
Eins der Pferde am Zaun gegenüber schnaubte.
Rio öffnete die Tür.
Auch die beiden anderen Tiere wurden unruhig.
»Da stimmt doch was nicht.« Der ehemalige Scout trat über die Schwelle. »Ist da jemand?«
Die aufgehende Sonne drückte die Nebelfelder auf den Boden und verdichtete sie noch einmal kurz. Die Wipfel einzelner Krüppelkiefem und Cottonwoods traten über den Schwaden klar ans Licht. Dann stachen die waagerechten Sonnenstrahlen wie ein Goldhauch darüber hinweg, und in der jähen Hitze lösten sich die grauen Felder binnen zwei Minuten völlig auf.
Zwischen den Büschen hielten Reiter. Auf einmal waren sie klar zu erkennen. Der Stadtmarshal mit dem funkelnden Stern an der Jacke gab seinem großen Tier die Sporen.
»Vorwärts!«, rief der Mann barsch.
Rio trat rückwärts in die Hütte. »Die wollen was von uns, Jay!«
»Den Eindruck habe ich auch«, entgegnete der Vormann sarkastisch.
Von vorn und von rechts und links ritten sie mit angeschlagenen Gewehren näher.
Jay Durango griff zum Colt, ließ ihn jedoch wieder los. Gegen die vielen Männer besaßen sie keine Chance, was immer diese von ihnen wollten.
»Dreizehn Mann«, murmelte Rio. »Das bedeutet nie etwas Gutes!«
Jay schob den Partner zur Seite und trat aus der Hütte. »Hat es einen bestimmten Grund, dass ihr halb in der Nacht schon so weit reitet, Leute?«
»Und ob es den hat!«, rief der Marshal grollend. »Hebt die Hände hoch!«
»Warum denn?« Rio kam nun ebenfalls wieder in den Hof.
»Blöde Fragen stellen können die jedenfalls«, sagte jemand.
»Ein paar Meilen von hier entfernt wurde der fahrende Händler McClure ermordet«, erklärte der Marshal. »Auf der Straße nach Norden.«
»Ermordet und ausgeplündert«, setzte der Drugstorebesitzer Savage hinzu. »Davon habt ihr natürlich keine Ahnung, was?«
»Allerdings nicht«, sagte Jay, dem es kalt über den Rücken rann.
»Ihr habt euch eingebildet, es könnte lange dauern, bis man ihn findet«, fuhr der Marshal fort. »Viel Verkehr ist auf der Straße schließlich nicht. Aber der Platz war schlecht gewählt.«
»Was ein Fremder nicht wissen kann!« Der bullige Schmied lachte polternd. »Da gibt es ganz in der Nähe eine Farm. Und dort hörte man die Schüsse.«
»Ich hab Ohren wie ein Luchs!« Der kleine Farmer stellte sich in den Steigbügeln auf.
»Und mir fiel in meinem Store schon auf, wie der Kerl auf McClures Geld schielte!«
»Ach so«, sagte Jay. »Da wurde also jemand überfallen, und ihr habt auch gleich ein paar Verdächtige.«
»Wir konnten die Spuren von zwei Pferden finden«, erläuterte der Stadtmarshal. »Sie führten von der Straße nach Westen, ließen sich natürlich nur bis zum ausgetrockneten Creek verfolgen. Nun müssen wir feststellen, wo die Dollars von McClure geblieben sind. Sicher eine Menge Geld.«
«Allein zweieinhalbtausend Bucks von mir«, erinnerte Savage. »Und wenn ich mich recht erinnere, sagte er, dass er hier noch einmal vorbeischauen wollte!«
»So?« Marshal Cobbs Augen zogen sich zusammen. »Hat er das getan?«
»Nein!«, stieß Rio sofort hervor.
Cobb stieg ab. Der mittelgroße, bullige Sechziger kam vor die Pferde, das Gewehr weiterhin an der Hüfte angeschlagen. »Er war also nicht hier?«
»Hören Sie schwer?«, schmimpfte Rio.
»Wir müssen die Hütte durchsuchen«, entschied der StadtMarshal. »Und natürlich auch das Dickicht in der Nähe.«
»Wenn Sie meinen.« Jay zuckte mit den Schultern.
Cobb winkte zwei Männern, die ebenfalls absaßen und an Jay vorbeigingen. »Und drei suchen draußen«, sagte der Stadtmarshal.
Weitere Reiter saßen ab, ließen die Zügel auf den Boden fallen und verschwanden neben dem langsam verfallenden Haus, an dem die Wildnis nagte. Sie schlugen das laut raschelnde Gestrüpp auseinander und suchten den Boden ab.
»Passt auf, ob irgendwo frisch gegraben wurde!«, rief ihnen der Händler aus der Stadt nach.
In der Hütte wurde das primitive Mobilar umgeworfen und die Pritsche mit dem Verletzten darauf von der Wand gezogen. Mit seinem Gewehr klopfte einer der Männer die Dielen ab.
Jay fragte sich, ob es nicht doch klüger gewesen wäre, mit dem Verletzten auf der Schleppbahre langsam weiterzuziehen, nachdem der Barbier Jeff kaum geholfen hatte. Doch gleich darauf sagte er sich, dass sie von den Reitern eingeholt worden wären. Und vielleicht müsste deren Verdacht dann noch schwerwiegender ausfallen.
»Nein, hier ist nichts.« Der erste Mann trat aus der Hütte.
Der andere folgte dichtauf und schüttelte den Kopf.
»Was ist mit dem anderen, lebt er noch?«, wollte der Barbier wissen.
»Ja, der lebt noch.«
»Habt ihr ihn auch gründlich durchsucht?«
»Selbstverständlich.«
»Marshal!«, schallte es an der Hütte vorbei.
Das Dickicht prasselte. Keuchend erreichte einer der Sucher den Hof und zeigte eine abgeschabte Satteltasche.
Jay zog den Kopf ein. »Das gibt es doch nicht«, murmelte er entsetzt. Sein Blick fiel auf Rio.
Stadtmarshal Cobb nahm dem Mann die Tasche ab, öffnete sie und drehte sie so herum, dass alles herausgefallen wäre, befände sich noch etwas darin.
»Leer«, konstatierte der Händler.
Cobb hielt ihm die Tasche hin. »Gehörte sie McClure?«
»Ja, Marshal.«
»Kein Irrtum möglich?«
»Nein, bestimmt nicht.« Savages bernsteinfarbene Augen leuchteten auf.
Der Marshal warf die Tasche dem Mann zu, der sie aufhob. »Aber wo sind die Bucks? Mehrere tausend Dollar Hartgeld?«
»Die man vergraben kann«, sagte der Händler. »Mindestens für eine Weile.«
Die anderen Männer des Suchtrupps kehrten ebenfalls zurück.
Cobb sah nachdenklich aus.
»Wir würden doch nicht so verrückt sein, die Tasche hinter die Hütte zu werfen«, sagte Jay. »Damit ihr sie gleich finden müsst, wenn ihr hier aufkreuzt.«
Cobb blickte überlegend in den Sand, trat einen Schritt vor und beugte sich nieder. »Was ist denn das?« Er griff zu, richtete sich auf und zeigte einen Zahn.
Hiram Savage stieg ab, kam vor die Pferde und ließ sich den braunweißen Stummel geben.
»Da liegt doch noch einer!« Der Barbier stieg ab und kam ebenfalls vor die Pferde. Doch Stadtmarshal Cobb bückte sich schneller und hob auch den zweiten Zahn auf.
»Und hier sehe ich Wagenspuren, die nicht alt sein können!« Barbier Keach streckte den Arm aus. »Ich glaube, die lügen uns die Hucke voll, Marshal. McClure war hier. Und ein paar Zähne fehlten der Leiche auch.«
»Gestern in der Stadt noch nicht.« Händler Savage gab den ausgeschlagenen Zahn zurück.
»Habt ihr dafür eine Erklärung?« Stadtmarshal Cobb steckte die Zahnstummel ein.
»Ja, er war hier«, gab Jay zu. »Wollte uns unbedingt etwas verkaufen. Irgendein Mittel von den Kiowas, das besser sein sollte als das Pulver aus dem Store.«
Sie stiegen alle ab und bildeten rechts und links der Hütte vor den Pferden Mauern.
»Er war hier, und ihr habt sein Geld gesehen«, stellte Savage fest. »Und das musstet ihr natürlich abstreiten.«
»Lügen haben kurze Beine«, orakelte der Barbier und kicherte erfreut. »Der Tote wird von einem Mann samt dem Wagen in die Stadt gebracht. Dort werde ich feststellen, dass die Zähne in McClures Gebiss gehörten. Einfache Sache!«
»Er wollte uns unbedingt etwas verkaufen«, sagte Jay noch einmal. »Um jeden Preis.«
»Das hättest du besser gleich zugeben sollen!« Savages Augen strahlten.
»Wo ist es?«, fragte der Marshal barsch.
»Wir sind ihm nicht gefolgt.«
Von beiden Seiten schoben sich die Mauern dichter heran.
»Die verheizen uns, Jay!« Rio trat rückwärts.
»Schön die Hände über die Köpfe!«, befahl der Stadtmarshal. Rio wirbelte herum, stieß das Gewehr zur Seite und setzte dem verdatterten Mann die Faust ans Kinn. Er sprang vorbei und wollte zwischen die Pferde.
Ein Schlag mit einem Gewehrlauf in den Nacken beendete Rios Fluchtversuch. Er stürzte zwischen die erregt tänzelnden Pferde. Die Gewehrmündung presste sich in seinen Rücken.
»Noch eine Bewegung, dann hörst du den Knall nicht mehr!«
Jay trat zurück und stieß neben der Tür gegen die Hüttenwand. Ein Fluchtversuch erschien ihm sinnlos. Auch wenn die Männer nicht schossen, um sich nicht gegenseitig den Garaus zu machen, konnte er den Ring nicht durchbrechen.
»Wo ist es versteckt?«, fragte Cobb schroff.
Rio wurde an Händen und Füßen gefesselt und zu den abgesattelten Pferden am Korral geschleift. Jay sah noch immer keine Lücke. Im Gegenteil, der Kreis schloss sich noch.
Rio wurde auf sein Pferd geworfen. Seine Arme, der Kopf und die Beine hingen beiderseits des Tieres nach unten.
»Wir müssen eben alles richtig auf den Kopf stellen«, sagte der Händler. »Irgendwo werden die Bucks schon auftauchen.«
»Hier findet ihr nichts. Der Kerl ist weggefahren, und wir verließen die Hütte nicht mehr.«
Sie grinsten ihn an.
»Ich schätze, wir binden ihn erst mal«, schlug der Marshal vor. »Dann suchen wir in aller Ruhe weiter. Hände vor!«
Jay verspürte noch immer keine Lust, sich kampflos zu ergeben. Aber zugleich erschien ihm ein Fluchtversuch so sinnlos wie vorher der von Rio.
»Stehst du auf den Ohren?«, brüllte Savage ihn an.
Da warf er sich der Mauer doch entgegen, entriss dem Marshal das Gewehr, besaß aber zu wenig Raum, um mit dem Kolben um sich schlagen zu können. Sie hielten den Schaft fest und entrissen ihm die Winchester. Eine Faust kam von Savage wie ein Hammer auf ihn zu. Er wurde getroffen und knallte mit dem Hinterkopf gegen die Wand. In seinem Gehirn schien etwas zu explodieren. Er schwankte. Da versetzten sie ihm schon die nächsten Schläge. Seine Knie gaben nach. Er taumelte gegen einen der Kerle und wurde zur Seite gestoßen. Wie Rio landete er auf dem Gesicht.
»Genug«, sagte der Marshal scheinbar weit entfernt.
*
»Zur Hölle, das gibt es nicht!«
Jay lag wie Shayne quer über dem Pferderücken und sah den leuchtenden Sand unter sich, das Unkraut und einen Pfahl von Zaunrest.
»Irgendwo muss es sein!«, schimpfte der Marshal verbittert. »Die haben es doch nicht weggeworfen.«
Der Sand knirschte. Jay sah den langen Schatten eines Mannes. An den Haaren wurde sein Kopf angehoben. Er erkannte den Händler, der wütend dreinschaute.
»Wo ist es?«
Er gab darauf keine Antwort, weil es ihm sinnlos erschien, sie von der Wahrheit überzeugen zu wollen. Die ausgeschlagenen Zähne, Rios Lüge, dass der fahrende Händler gar nicht hier gewesen wäre, das allein überzeugte die Männer mehr als tausend andere Argumente, die man vielleicht hätte finden können.
Fluchend stieß der schrankbreite Händler Jay zurück. Er rutschte über den Sattel, wurde losgelassen und stürzte in den Sand. Das Pferd schnaubte.
Trotz der gefesselten Hände gelang es Jay, sich zu setzen. Er kroch zurück, weil sie schon wieder eine drohende Mauer mit vorgereckten Gewehren bildeten. Fuchsteufelswild sahen sie aus.
Jay stieß gegen den Zaunrest und konnte nicht weiter.
Zwischen den Gewehren ging der Stadtmarshal in die Hocke. »Wir lassen dich nicht mehr laufen, soviel musst du wissen. Aber vielleicht rechnen wir es dir an, wenn du redest!«
»Anfängen könnt ihr mit den Dollars sowieso nichts mehr!«, verriet der Barbier. »Dafür sorgen wir, mein Junge!«
»Wir haben es nicht!«
»Ihr bildet euch ein, dass wir euch laufen lassen müssten, wenn wir nichts finden«, verkündete der Marshal. »Ohne Beweis keine Anklage. So habt ihr euch das doch ausgedacht, was?«
»Wir haben es nicht«, sagte Jay wieder.
»Wer einem wie dir glaubt, betrügt die eigene Großmutter«, sagte der Händler.
Mehrere nickten zustimmend. Allein dieses Vorurteil würde sie noch dazu bringen, jegliche Hemmungen zu verlieren.
Der Barbier beugte sich neben dem Stadtmarshal herab. »Wenn du es sagst, baumelt ihr nur einmal! Und falls der Strick reißt.. .« Er brach vieldeutig grinsend ab.
»Marshal, ein Reiter!«, rief ein Wächter an der Hütte.
Cobb und der Barbier richteten sich auf. Der Kreis schob sich auseinander.
Aus dem Dickicht westlich der halb verfallenen Farmhütte ritt Jewy Zattig.
»Ach der.« Cobbs Haltung entspannte sich.
Der krummrückige Reiter, dem das lange Silberhaar unter dem speckigen Zylinder hervorhing, zügelte seine Mähre und stützte die Hände auf das Sattelhom. »Hallo! Was ist denn hier los? Wollt ihr die alte Farm wieder flott machen? Der Boden taugt doch nichts, Leute. Boris und ich reden manchmal auch schon davon, dass es klüger wäre, hier gar nicht erst Wurzeln zu schlagen.«
Cobb verließ die anderen und ließ die Gewehrmündung nach unten sinken. »McClure wurde ermordet.«
»Der fliegende Händler?«, staunte der Farmer.
»Ja, der.«
»Hier?« Zattig blickte sich um. »Wo ist er denn? Was ist mit seinem Wagen?«
»Nicht hier, sondern auf der Overlandstraße. Ein paar Meilen nördlich von hier.«
»Ach so. Von denen? Ich sage ja immer, einem Fremden darf man nicht über den Weg trauen. «
»Was machst du denn hier, Zattig?«, wollte der Marshal wissen.
»Wollte eben mal nachsehen, wie es dem Jungen geht, dem der Bär eins versetzte.«
»Er lebt noch«, sagte der Barbier. »Jedenfalls noch ein wenig. Der war aber auch nicht beteiligt.«
»Hatte McClure denn viel Geld?« Zattig legte den Kopf schief.
»Mindestens fünftausend Dollar«, wandte der Händler aus der Stadt ein. »Das weiß ich mit Sicherheit. Es können aber auch siebentausend, achttausend Dollar oder noch mehr gewesen sein.«
»McClure?« Zattig grinste und schüttelte den Kopf.«
»Ausgeschlossen. Der erinnerte mich noch immer an einen, der vom Betteln sein Dasein fristet. Mit soviel Geld hätte er ja wie der Herrgott in Frankreich leben können. Alt genug, um aufzugeben, war er auch längst. Nein, nein, das müsst ihr schon einem erzählen, der die Hosen mit der Zange anzieht!« Zattig kicherte, als habe er einen Witz gehört und könnte sich darüber prächtig amüsieren.
»Er besaß auf jeden Fall mehr als fünftausend Bucks allein an barem Geld« erklärte Savage mit Nachdruck.
»Und was anderes interessierte die Lumpenhunde nicht!«, setzte der Barbier wissend nickend hinzu.
»Hätte ich nie für möglich gehalten«, murmelte der Farmer erschüttert. »Damit wäre er ja praktisch ein reicher Mann gewesen. Wieso setzte er sich noch dem Risiko aus, auf der Straße überfallen, meuchlings ermordet und gefleddert zu werden?«
»Warum rackern die meisten Leute, bis sie ins Gras beißen?«, fragte der Marshal brummig zurück.
»Jaja, das sage ich zu Boris auch immer wieder.« Zattig seufzte. »Wir sollten aufgeben. Einfach alles hinwerfen, das sowieso nichts einbringt. Aber jedes Jahr versucht man es noch einmal von vorn. Dabei taugt der Boden noch nie für was anderes, als zur Rinderzucht, falls er überhaupt zu etwas nutze ist.«
»Sie wollen ernsthaft aufgeben?«, fragte der Marshal gespannt.
Zattig zuckte mit den Schultern. »Richtig entschlossen dazu bin ich natürlich nicht, Marshal. Aber halb entschlossen dazu bin ich wiederum schon seit Jahren.« Ein unglückliches Grinsen entstellte das Gesicht des Farmers. Er schaute sich um. »Können die Dollars denn hier irgendwo sein?«
»Ausgeschlossen. Wir haben alles abgesucht.«
»Dann haben die Kerle es vielleicht östlich der Straße vergraben!«, vermutete der Farmer.
»Gut möglich. Aber auf Verdacht können wir nicht alles absuchen. Die lachen sich ja krank über uns.«
»Wir holen es schon aus ihnen heraus!«, versicherte der schrankbreite Händler. »Nur abwarten.«
»Und der Verletzte?«, fragte Zattig. »Sollen Boris und ich uns um ihn kümmern?«
»Den nehmen wir mit«, entschied der Marshal. »Geht nicht anders zu machen. Los, Leute, setzt die Schleppbahre zusammen.«
Mehrere Männer betraten die Hütte.
Jay war heilfroh, dass das Auftauchen des Farmers die Aufmerksamkeit von ihm ablenkte. Sicher hatten sie hier schon anfangen wollen, auf ihre Art etwas aus ihm herauszuholen, wovon er nichts wusste.
»Also wenn ich gar nicht helfen kann ...?« Zattig brach ab und schaute mit gefurchter Stirn auf den Marshal.
»Haltet die Augen offen, Zattig.«
»Warum?«
»Könnte ja sein, die haben noch ein paar Kumpane.«
»Vielleicht Indianer?« Zattig beugte sich über den Pferdehals.
Die Männer starrten sich an.
»Daran dachten wir noch gar nicht«, gestand der Händler.
»Nein, Unsinn, die sind allein«, wandte der Barbier ein. »Sonst hätten sie doch den Verletzten nicht hierher geschleppt. Sie waren einfach abgebrannt. Und da kam ihnen dieser Halsabschneider in die Quere und wurde frech, weil sie keinen Zaster hatten und nicht kaufen konnten, was er los sein wollte. Wir kannten ihn doch alle!«
»Aber das ist noch lange kein Grund, ihn umzubringen und auszuplündern!«, schimpfte der Marshal.
»Sage ich ja auch gar nicht. Aber so kam das alles. McClure. wird ganz schön auf den Putz gehauen haben. Na ja, dann sagten sich die Jungens, hinterher und nichts als drauf. Vielleicht meinten sie sogar, McClures Schicksal würde keinen Menschen interessieren!«
Der Barbier wandte sich um und schaute Jay mit funkelnden Augen an. »Falsch geraten, mein Junge! Wir kümmern uns um jeden feigen Mord. Grundsätzlich.«
»Werft ihn wieder aufs Pferd!«, befahl der Stadtmarshal.
Jay wurde auf die Beine gezogen und quer über sein Pferd geworfen.
Jeff Logan wurde aus dem Haus getragen. Im Hof stellten sie die Schleppbahre ab.
»Der ist fertig«, verkündete der Farmer. »Fragt ihn doch mal aus.«
»Blödsinn, der nimmt doch nichts mehr auf«, sagte der Barbier. »Hängt die Bahre an. Und vergesst die Sättel der Halunken nicht, die verrotten hier nur!«
»Dann will ich nicht länger stören.« Zattig tippte an den alten Zylinder, wendete seine Mähre und ritt nach Westen zurück. Rasch tauchte er in den aufziehenden Dunstschleiern unter.
*
Jay Durango wurde es immer elender. Die Sonne brannte ihm in den Nacken. Blut stieg in seinen Kopf. Zudem wirbelten die Pferdehufe immer neuen Staub auf, der ihm das Atmen erschwerte. Manchmal begann sich in seinem Kopf bereits alles in wilden Kreisen zu drehen. Er meinte Feuerschweife und Funkenflug sehen zu können.
»Halt!«, rief der Barbier irgendwo in dem Zug des Aufgebots.
Jays Pferd wurde angehalten.
»Was ist los, Keach?«
»Der Junge ist tot, Marshal.«
Jay war es, als würde eine Nebelwand vor ihm zerissen. Überdeutlich hörte er von einer Sekunde zur anderen jedes Geräusch.
»Der hat den Transport nicht vertragen«, meldete sich der Barbier abermals. »Hätte ich euch vorher sagen können.«
»Sollten wir ihn da draußen liegenlassen?«, schimpfte der Stadtmarshal aufgebracht. »Ist es vielleicht unsere Schuld, dass wir die Lumpenkerle verhaften mussten?«
»Wahrscheinlich wäre er da draußen auch gestorben«, sagte der Barbier. »Aber genau wissen kann man es natürlich nicht.«
»Und nun?«, fragte der Händler.
»Am besten, wir beerdigen ihn gleich«, schlug der Schmied vor. »In der Stadt kostet es Geld.«
»Kein Wunder, da hab ich auch die ganze Arbeit damit!«, maulte der Schreiner.
Sattelleder knarrte. Die Männer entfernten sich auf dem Weg zurück, den sie kamen. Jay meinte zu hören, wie sie ein Grab aushoben.
Nach ungefähr einer halben Stunde näherten sich die Schritte wieder. Jay wurden die Fesseln an den Füßen abgenommen. Sie zogen ihn über das Pferd. Er kam mit den Füßen auf und drohte dennoch umzufallen, so benommen war er noch.
Rechts und links standen je zwei Männer mit Revolvern in den Händen und finster verkniffenen Gesichtern.
»Keine Mätzchen«, drohte der Marshal. »Uns genügt einer, um zu erfahren, wo die Bucks sind. Einen können wir leicht entbehren. Vorwärts jetzt!«
Mit gefesselten Händen lief Jay von vier Revolvern bedroht an den Pferden vorbei. Dahinter, zwischen Scrubbüschen, die bald darüber hinwegwachsen würden, hatten sie ein Grab ausgehoben.
Jeff Logans Leiche lag daneben auf der Decke. Die Stangen waren abgeschnitten. Man hatte sie achtlos ins Gestrüpp geworfen.
»In Ordnung, das reicht!« Stadtmarshal Cobb stieß Jay zur Seite. »Holt jetzt den anderen!«
Jay protestierte nicht, weil das zwecklos bleiben würde.
Sie eskortierten ihn zurück, banden ihm die Füße zusammen und warfen ihn über das Pferd.
»Hör zu, wir brauchen nur einen von euch, um die Bucks zu finden«, erklärte der Marshal an Rio gewandt, den sie indessen vom Pferd zogen und von den Fußfesseln befreiten.
»Hab ich schon gehört.«
»Dann ist ja alles klar. Zeigt ihm den Toten noch mal. Keiner wird uns nachsagen, dass wir Unmenschen wären.«
»Dummköpfe seid ihr«, gab Rio zurück. »Hirnverbrannte Narren, die das Geld nie finden werden!« Er lachte schallend.
Jay hörte, dass sie ihn dafür niederschlugen. Rio musste verrückt sein, sich wieder mit ihnen anzulegen, wo er doch wirklich keine Chance gegen sie besaß.
»Weiter!«, kommandierte Marshal Cobb. »Und macht es bei ihm kurz!«
Jay hörte sie weitergehen.
»Du kannst von Glück reden, dass unser Marshal so human ist«, sagte einer. »Wir hätten euch Strolche schon aufgeknüpft. Soll doch aus McClures Geld werden, was will. Uns gehört es doch nicht. Und wir kriegen auch nichts davon. Cobb wirft es der Kasse des Gouverneurs in den Rachen, wenn sich kein anderer Erbe findet.«
Es dauerte nicht lange, dann brachten sie Rio Shayne zurück und warfen ihn wie Durango über das Pferd, fesselten ihm die Beine und gaben immer neue Drohungen von sich.
Jay hörte, wie sie das Grab zuschaufelten. Er fragte sich, ob Jeff je eine Chance hatte, die Verletzung zu überleben, oder ob der Blutverlust von Anfang an zu hoch war. Er wusste es nicht. Sicher würde das für immer ein Geheimnis bleiben. Aber direkt getötet hatten ihn diese Männer, weil sie ihn transportieren mussten. Weil er allein da draußen nicht liegen konnte. ,
Das Pferd bewegte sich und wirbelte neuen Staub mit den Hufen auf, die Durango ins Gesicht trafen. Die Übelkeit überkam ihn abermals und begann seine Gedanken zu verwirren.
*
Jay saß auf einem Stuhl im spartanischen Office des Marshals, das schmal wie ein Handtuch war und rohe Bretterwände auf drei Seiten besaß. Die vierte Seite bestand aus einem Eisengitter. Es reichte vom Boden bis zur Decke. Dahinter befand sich eine Zelle, in der vier einfache Holzpritschen standen. Ein Lichtschacht führte nach draußen.
Jays Blick kehrte ins Office zurück. Vor ihm thronte der Marshal hinter einem Schreibtisch. Und hinter ihm standen zwei Männer mit Colts in den Händen. Sie schienen noch hier in erheblicher Sorge zu sein, dass er ihnen entwischen konnte.
In der geräumigen Zelle erhob sich Rio Shayne von einer der primitiven Pritschen und trat ans Gitter.
Cobb brannte sich eine Zigarre an und rieb das Schwefelholz zwischen den Fingern aus. Er blies Jay den Qualm entgegen und rollte die Zigarre von einem Mundwinkel in den anderen. »Wir müssen es wissen, egal, wie wir es aus euch herausholen.«
Jay schenkte sich die Mühe, den Mann davon überzeugen zu wollen, dass er auf der falschen Spur saß. Cobb würde sich davon nicht überzeugen lassen. Zu fest saß ihnen allen schon in den Köpfen, wie das mit dem Mord auf der Overlandstraße vor sich gegangen sein musste.
Dennoch sagte er: »Kalkulieren Sie gar nicht ein, dass ein paar Wegelagerer den Wagen gesehen und überfallen haben könnten?«
Cobb. nahm die Zigarre aus dem Mund. »Du hast kalkuliert, dass wir dir das schließlich abnehmen müssten, wenn wir die Bucks nicht finden. Aber das ist falsch. Versehentlich nahmt ihr ja auch die Tasche mit. Die habt ihr vermutlich erst weggeworfen, als wir schon in der Nähe waren. Da ist euch sozusagen in letzter Minute noch was gedämmert!«
Jay lehnte sich zurück. Die Mündung eines Revolvers berührte seinen Nacken und ließ ihn fösteln. »Hätten wir den schmierigen Kerl überfallen, wären wir mit dem Geld abgehauen!«
»Eben nicht.« Cobb klemmte die Zigarre wieder zwischen die Lippen. »Weil ja noch der Verletzte in der Hütte lag.«
Einer der Wächter gähnte demonstrativ. »Wollen wir ihn nicht endlich so durch die Mangel drehen, dass ihm die Worte von selbst aus dem Mund fallen? «
»Schlage ich auch vor!«, stimmte der andere prompt zu.
Marshal Cobb überlegte. »Wir haben keine Befugnis, jemand zu foltern, nur weil er uns etwas verschweigt. Ihr müsstet die Gesetze eigentlich kennen!«
»Was heißt denn hier foltern, Marshal. Ein bisschen nachhelfen, nichts weiter. Hier, so!«
Jays Kopf wurde an den Haaren nach hinten gerissen.
Der andere Kerl trat vor und zielte mit dem Revolver auf sein Gesicht. Er grinste teuflisch und spannte den Hammer. »Na, du Hund, singst du jetzt?«
»Aufhören!« Der Marshal sprang empor und verlor die dicke Zigarre aus dem Mund.
Jay wurde losgelassen. Der zweite Mann trat zur Seite.
»Auf einen Halunken wie den achtet ohnehin niemand, Marshal. Ich würde sagen, wir hängen ihn auf und lassen den anderen dabei zusehen. Der redet dann. Wollen wir wetten?«
Cobb nahm die Zigarre vom Tisch und setzte sich. »Sperrt ihn ein. Ich muss darüber nachdenken.«
»Blödsinn, die Zeit verstreichen zu lassen!« .
»Sage ich doch!« Der zweite Mann fuchtelte noch mit seinem gespannten Revolver herum.
»Sperrt ihn ein!«, herrschte Cobb sie an. »Noch bin ich der Marshal von Montrose!«
Jay stand auf. Der eine Kerl ging an ihm vorbei und schloss die Zelle auf, während der zweite ihm die Mündung des Colts in den Rücken bohrte.
Marshal Cobb hüllte sich in eine blaue Qualmwolke, die sein heftiges Paffen rasch vergrößerte.
»Marsch, Rothaut!«
Jay ging in die Zelle, scheppernd schlug hinter ihm die Tür zu.
»Darf man fragen, ob es hier irgendwann mal was zu essen gibt?«, erkundigte sich Rio.
»Das könnte euch so passen, von uns auch noch durchgefüttert zu werden!« Die Stimme des kleinen Kerls klang keifend.
»Selbstverständlich kriegt ihr auch was zu essen«, sagte der Marshal barsch.
»Was kriegen die?«
»Wir werden unsere Gefangenen nicht verhungern lassen, auch Mörder nicht!«
Jay setzte sich auf eine Pritsche, starrte die Dielen an und fragte sich, wie sie aus diesem Teufelskreis noch einmal hinauskommen könnten. Dann hatte er eine Idee, stand auf und kehrte ans Gitter zurück. »Wir kommen von einer Ranch im Osten. Von Rancho Bravo, Marshal.«
Cobbs Gesicht sah abwartend aus. »Na und?«
»Kennen Sie die Ranch?«
»Ich kann nicht jede Ranch in Texas kennen, verdammt. Nein, auch nicht Rancho Bravo.«
»Aber die ist von hier nur vierzig Meilen entfernt!«
»Ist mir doch egal.«
»Was soll denn jetzt kommen?« Der kleine Kerl kicherte. »Was willst du uns jetzt für einen Bären aufbinden?«
»Wir gehören zu dieser Ranch. Ich bin dort Vormann.«
Der Marshal grinste, und die beiden anderen brachen in lautes Gelächter aus.
»Damit rückst du jetzt heraus?« Cobb rollte die Zigarre in den anderen Mundwinkel.
»Es sind nur vierzig Meilen«, sagte Jay noch einmal mit Nachdruck. »Schicken Sie einen Reiter nach Rancho Bravo. Er kann in drei Tagen wieder zurück sein!«
»Wen dem wirklich so wäre, sagt es über den Raubmord absolut nichts aus«, erklärte der kleine Kerl, der noch mit dem schweren Revolver herumfuchtelte.
»Eben«, stimmte der Stadtmarshal zu. »Aber wir sind keine Narren, Durango, oder wie du sonst heißen magst. Außerdem bringt es euch nichts, wenn wir euch drei Tage Luft verschaffen.«
»Sie müssen das nachprüfen!« Rio rüttelte an den Gitterstäben. »Das ist Ihre Pflicht!«
»Meine Pflichten kenne ich besser als du!«, brüllte der Stadtmarshal den hünenhaften Mann in der Zelle an. »Darüber müsst ihr Galgenvögel mich nicht aufklären. Ihr kriegt etwas zu essen, wie es sich gehört. Und bis morgen fällt mir etwas ein, wie wir weiterkommen!«
»Verdammte Bande!«, stieß Rio unbeherrscht hervor. »Vielleicht habt ihr ihn selbst umgebracht und sucht nur ein paar Dumme, auf die ihr es schieben könnt!«
Cobb nahm die Zigarre aus dem Mund. Der kleine Kerl zielte mit dem Revolver auf Shayne. Der dritte Mann zog die schon weggesteckte Waffe wieder.
»Hör auf, Rio«, murmelte Jay.
»Hol ihn heraus, Marshal!«, verlangte der Kleine. »Das lassen wir uns nicht bieten!«
Rio trat zurück.
»Hol ihn heraus!«, schimpfte der kleine Kerl. »Der kriegt von mir die passende Antwort.«
»Morgen reden wir weiter. Über alles wird morgen gesprochen.« Cobb paffte heftig an der Zigarre und kämpfte damit die Versuchung nieder, wie die anderen Rache nehmen zu wollen für die Anschuldigung, die ihn tief traf.
Und Jay wusste, dass Rios hitzige Art sie immer tiefer in den Schlamassel trieb, in dem sie bereits steckten.
»Gehen wir!«, befahl der Marsahl. »Ich verständige den Keeper, dass er für die beiden eine Suppe kochen soll.«
Widerstrebend verließen die Männer das Office. Der Stadtmarshal blieb noch zurück und blickte in die Zelle.
»Und, haben sie ausgepackt?«, fragte draußen jemand.
»Denen wachsen doch Haare auf den Zähnen!«, maulte der eine.
»Verdächtigt haben sie uns!«, rief der Kleine keifend. »Wir hätten das alte Schlitzohr umgebracht, sagt der eine.«
Cobb schüttelte den Kopf. »Komische Typen seid ihr schon.« Dann folgte er den anderen. Die Tür klappte zu.
*
»Dummkopf«, sagte Jay.
Rio setzte sich auf eine Pritsche. »Könnte doch ganz gut möglich sein, oder?«
»Ausgeschlossen.«
»Warum?«
»Weil das zu viele sind, als dass sie sich auf die Dauer trauen könnten. Der Marshal ist doch kein Schwachkopf. Außerdem bleibt nicht viel, wenn sie es teilen. Ein paar hundert Dollar für jeden.«
»Da sind noch die beiden Farmer, Jay!«
Durango blickte auf. »Ja, die standen gestern vor dem Saloon.«
»Und die wissen unter Garantie, dass es sich lohnen würde, diesen komischen Halsabschneider zu fleddern!«
Jay stand auf. »Die könnten ihm gefolgt sein. Oder sie lauerten an dem Weg, den er nehmen würde. Sicher kannten sie diesen Weg.«
»Und warfen uns dann die Tasche ins Gestrüpp«, setzte Rio hinzu. »Wer weiß, wie lange die schon auf eine Gelegenheit warteten, zu Geld zu kommen und anderen was in die Schuhe zu schieben.«
Jay lief in der Zelle hin und her.
»Die sitzen jetzt vielleicht in ihrer Hütte, zählen die Bucks und lachen sich halbkrank über diese Spießer!«
»Gut möglich, Rio. Aber wenn wir dem Marshal jetzt damit kämen, meint der auch nur, wir würden etwas von uns abwälzen wollen. Außerdem würden die Reiter bemerkt, wenn die wirklich dahin ritten. Und da wäre nichts zu finden.«
»Das müssten wir selbst nachprüfen können.«
»Du sagst es.« Jay lehnte sich gegen das Gitter. »Aber wie?«
Rio blickte über die Wände, stand auf und klopfte sie ab. Er kletterte zum Lichtschacht hinauf und sah die im Westen über Wald und Hügeln stehende Sonne.
Da knarrten die Fußwegbretter vor dem Office, die Tür wurde geöffnet und ein Mädchen im verwaschenen Kattunkleid, mit aufgenähten Pappsternen daran, trat ein.
»Hallo, ich bin Fee!«, rief das Saloonmädchen mit rauer Stimme. Es versetzte der Tür einen Tritt, dass sie herumschwang und zuknallte. Die Fensterscheibe rasselte.
»Hallo«, sagte Jay lahm.
Fee schaute sich um, trat dann dicht ans Gitter und sagte: »Siebentausend, wenn nicht noch viel mehr, schätzen die Leute die Beute! Wieviel ist es wirklich?«
»Haben sie dich geschickt?«, fragte Jay zurück.
»Offiziell soll ich euch fragen, ob ihr Bohnensuppe oder Maisbrot und Käse haben wollt. Aber inoffiziell hoffen sie wirklich, dass ich eher was erfahre.« Das Mädchen mit dem Faltengesicht lachte krähend.
»Sag Ihnen, wir nehmen die Bohnensuppe.«
»Gut. Du heißt Jay?«
»Ja. Und er Rio.«
Fee nickte Shayne zu. »Warum seid ihr denn mit dem Zaster nicht auf und davon? Wegen des Verletzten in der Hütte?«
»Sag ihnen, wir wollen die Bohnensuppe!«, wiederholte Jay barsch.
»He, nun dreh doch nicht gleich durch! Lass uns in Ruhe darüber reden, Mann, Jay! Ich sitze hier ziemlich auf dem Trocknen. Meine Zeit ist um. Doug gibt mir sozusagen das Gnadenbrot. Weil er keine Frau hat und hofft, ich würde ihn nehmen. Aber soll ich bis an mein Lebensende in diesem Nest sitzenbleiben? «
»Was will sie eigentlich, Jay?« Rio näherte sich dem Gitter.
»Keine Ahnung.«
»Die Hälfte für mich Jay!«
»Und?«
»Ich hole euch heraus. Cobb ist doch nur im Nebenberuf Marshal. Weil er als Büchsenmacher sowieso kaum Arbeit hat. Und er wohnt nicht hier. Nachts ist kein Mensch im Office. Normalerweise jedenfalls nicht. Er wird einen Nacht-Marshal hierher setzen. Irgendeinen alten Mann, der am Tage nichts tut und sich die Nacht um die Ohren schlagen kann. Sie befürchten nicht, dass euch jemand helfen könnte.«
»Ich weiß immer noch nicht, was das werden soll«, sagte Rio.
»Sie will uns helfen. Für die Hälfte der Beute.«
Rio tippte sich an die Stirn. Jay stieß ihm den Ellenbogen in die Rippen.
»Lass sie doch mal ausreden!«
»Na endlich!« Fee rollte gelangweilt mit den Augen. »Ihr dürft mich natürlich nicht aufs Kreuz legen wollen.«
»Nein, das tun wir nicht!« versprach Jay.
»Na also, jetzt kommen wir doch langsam auf den Grund der Sache. Was habe ich für Garantien?«
»Unser Wort«, erwiderte Jay Durango prompt.
»Das ist nicht viel wert, was?«
»Lass dir etwas anderes einfallen. Wir stecken ziemlich im Dreck und sind für Angebote dankbar.«
Fee überlegte und trat von einem Bein aufs andere. »Ich werde einen Colt haben und ihr keinen. So müsste es gehen. Und wenn ich meinen Anteil habe, trennen wir uns. Wie ihr zu Waffen kommt, müsst ihr dann eben selbst sehen.«
»Einverstanden«, entgegnete Jay und nickte. »Du hast nichts zu befürchten. Wir prellen keinen, der ein guter Kumpel ist.«
»Ihr habt auch den Verletzten nicht im Stich gelassen«, bestätigte das Saloonmädchen. »Wäre das nicht gewesen, hätte ich euch sowieso kein Angebot gemacht.«
»Du bist großartig und denkst haarscharf nach!«, lobte Jay das offensichtlich ziemlich eitle Mädchen.
»Also, bis heute Nacht.« Fee zog sich zur Tür zurück.
»Und denke an die Bohnensuppe!«
»Ist gemacht, Jay. Den Männern erzähle ich, dass es Essig war.« Sie lachte mit ihrer rauen Stimme, dass es klang, als würde steinhart gewordener Käse über ein Reibeisen gezogen.
»Bis später, Fee!«
Sie winkte und verließ das Office. Die Tür knallte heftig zu und die Fensterscheibe rasselte.
»Stimmt bei dir noch alles?«, fragte Rio zweifelnd.
»Ich denke schon.«
»Wenn die nun den Männern sagt, wir hätten immerhin zugegeben, die Beute zu haben?«
»Das sagt sie nicht.«
»Und wenn doch?«
»Dann ändert sich für uns auch nichts. Davon sind die sowieso felsenfest überzeugt. Aber Fee täuscht uns nicht. Die träumt von einer Stange Geld und hat schon genug erlebt, um sich nicht mehr in kleinliche Gewissenskonflikte zu verstricken.«
»Hoffentlich.«
»Sie wird ein bisschen dumm dreinschauen, wenn sie begreift, dass es nichts als unseren Dank dafür gibt. Aber wir müssen jetzt nehmen, was wir kriegen können. Sonst hängen die uns auf oder bringen uns anders um, Rio!«
»Hoffentlich geht das nicht auch noch schief«, murmelte Shayne. »Ich befürchte nämlich, dass wir uns in einer ausgemachten Pechsträhne befinden. Der ganze Jagdausflug war ein Schuss ins Dunkle.«
Jay erfüllte neue Hoffnung.
»Wenn das klappt, müssen wir auf schnellstem Weg nach Rancho Bravo und den Boss benachrichtigen.«
»Damit die wahren Mörder inzwischen Zeit finden, sich mit der Beute abzusetzen, wie?«
»Was denn, du willst hier bleiben?«
»Ich will jetzt wissen, wer uns das einbrockte. Ob die Zattigs oder andere Wegelagerer. Und ich will, dass die Leute in diesem Nest erfahren, was für Greenhorns sie sind. Wie sehr sie zum Narren gehalten wurden!«
»Also gut, einverstanden. Kann allerdings ohne Waffe mehr als riskant werden.«
»Das müssen wir auf uns nehmen. Wir haben uns sehr verdächtig gemacht, Rio. Die ausgeschlagenen Zähne, deine Behauptung, McClure wäre nicht mehr bei der Hütte gewesen, dein Fluchtversuch, meiner noch dazu ... Das sind ehrlich viele Momente, die gegen uns sprechen. Viel mehr als die Tasche hinter der Hütte.«
»Aber die können nur die Zattigs hingeschmissen haben. Das wussten andere Zufallswegelagerer nicht, wie man es auf uns lenken könnte.«
Fee tauchte schon wieder auf, öffnete die Tür und rief: »Mit der Suppe, das geht klar. Dauert noch ein bisschen.« Sie kniff ein Auge zu.
Jay lächelte. »Die ist richtig aufgekratzt von der Aussicht, reich zu werden. Ein paar tausend Dollar müssen ihr wie ein Vermögen vorkommen.«
»Kein Wunder, wenn sie hier nicht das Salz in die Suppe verdient.«
*
Der Marshal trat ein, räusperte sich und umging den Schreibtisch. Er setzte sich in den abgeschabten Ohrensessel dahinter und schlug ein Bein über das andere.
Jay und Rio blickten ihn schweigend an. Keiner von ihnen zeigte noch Lust, Cobb von etwas überzeugen zu wollen.
Schließlich brachte Fee einen Topf, in dem Bohnensuppe dampfte.
Cobb ließ erst noch zwei Männer herein, die ihre Waffen zückten, bevor er die Zelle aufschloss und Fee hineinließ.
»Schön sitzenbleiben!«, befahl Cobb. »Erst isst das Halbblut, dann der andere!«
Jay bekam von dem Mädchen den Topf und aß die Hälfte der Suppe. Dann war Rio an der Reihe.
Fee verließ die Zelle mit dem leeren Topf. »Das sind doch ganz ordentliche Jungens, Marshal. Sehen nicht aus wie Mörder.«
»Mördern sieht man ihr Handwerk nur selten an«, maulte der Marsahl, schloss zu und zog den Schlüssel ab. »Erledigt. Schickt mir jemanden, der den Nacht-Marshal spielt.«
Fee und die Männer gingen hinaus. Die Tür wurde geschlossen. Cobb setzte sich hinter den Schreibtisch. Er hatte nicht die Absicht, sie an diesem Spätnachmittag noch mit Fragen zu traktieren und tüftelte offenbar auch noch an dem Konzept, nach dem er vorgehen wollte, um zu erfahren, was ihn interessierte und was er für Tatsache hielt.
Wenig später betrat ein alter, gebeugter Mann das Office. Er hustete stark, trug altes Cordzeug und hatte ein Gesicht wie spröde gewordenes Leder.
»Du kannst dir zwei Dollar verdienen, Ben.«
Der Mann grinste freundlich. »Kann einer wie ich gut vertragen, Marshal. Savage zahlt mir keinen müden Cent, gibt nie einen Whisky aus und ist überhaupt bis an den Hals zugeknöpft. Dabei habe ich zehn Jahre lang sein schwerstes Fuhrwerk kutschiert und einen Haufen Geld für ihn verdient.«
»Das geht mich nichts an.« Cobb erhob sich. »Du hast nichts zu befürchten. Die haben keine Komplizen. Es ist nur, dass jemand hier sitzt.«
»Gut, Marshal.«
»Komm um neun, wenn es dunkel wird.«
Der alte Ben wandte sich ab und verließ das Office.
Cobb lief auf und ab, blieb mitunter stehen und schaute in die Zelle. Manchmal schien es, als wollte er doch weiter in sie dringen, um ihnen das scheinbare Geheimnis zu entlocken.
Schließlich ging er hinaus.
»Sie hat nichts verlauten lassen«, murmelte Rio. »Komisch.«
»Wieso, Rio?«
»Weil sie eigentlich einen netten Eindruck macht.«
»Du meinst, es passt nicht dazu, dass sie sozusagen zu unserer Komplizin werden will? «
»So ist es.«
»Sie findet keinen Job mehr und weiß es. Und die Leute hier wissen es auch und werden sie entsprechend hochnäsig behandeln. Wenn nicht noch schlimmer. Da kann ein Mann zum wilden Tier und eine Frau zur verschlagenen Schlange werden.«
*
Dem alten Ben sank der Kopf auf die Brust. Ein lauter Schnarchlaut entfuhr ihm. Sein Kopf zuckte empor, er öffnete die Augen und blickte blinzelnd gegen die Lampe.
Der Docht war ziemlich weit heruntergebrannt, so dass es beinahe dunkel im Office war. Aber dem Mann fehlte es schon so sehr an Aktivität, dass er sitzenblieb. Alsbald fielen ihm die Augen wieder zu und sein Kopf sank nach unten.
Jay und Rio lagen wach auf ihren Pritschen und beobachteten den Kampf des Nachtmarshals mit seiner Natur.
Lautlos bewegte sich die Türklinke nach unten. Ein Spalt bildete sich. Ein Revolver schob sich ins Halbdunkel. Darüber tauchte Fees Gesicht auf.
Der Nacht-Marshal schnarchte.
Das Mädchen trat über die Schwelle, schob die Tür zu und erreichte den Schreibtisch. Fee trug noch das alte Kattunkleid mit den Pappsternen darauf. Sicherlich besaß sie kein anderes mehr, was Jay als Indiz dafür wertete, dass sie beruflich in der Tat das Ende erreicht haben musste.
»Mister Cohler«, sagte das Mädchen leise. Der Revolver in ihrer Faust war auf den Mann gerichtet und wackelte nicht. Eiserne Entschlossenheit zeichnete auch ihr Gesicht und ließ es bedeutend weniger faltig erscheinen.
Der Mann schnarchte. Das Kinn schlug auf die Brust.
»Mister Cohler«, sagte Fee etwas lauter.
Da zuckte der Schläfer zusammen, sein Kopf flog förmlich empor und er starrte entsetzt auf die Waffe.
»Erschrecken Sie nicht«, sagte Fee. »Und schreien Sie nicht um Hilfe. Ich möchte nicht auf Sie schießen müssen.«
»Fee, auch das noch auf meine alten Tage!«
»Wir müssen beide zusehen, wo wir bleiben, Mister Cohler. Keiner versteht Sie besser als ich. Aber begreifen Sie auch meine Lage. Die Jungens versprachen mir die Hälfte der Beute. So ein Angebot wird mir kaum noch einmal gemacht.«
Endlich schien der Nacht-Marshal seine Lage voll erkannt zu haben. Seufzend hob der die Hände. »Nicht schießen, Fee. Ich weiß, wie verzweifelt Sie sind.
»Dann gibt es ja nichts weiter zu besprechen, Mister Cohler. Nehmen Sie mit der linken Hand den Schlüssel aus der Lade und schließen Sie die Zelle auf!«
»Sie bringen sich in Teufels Küche, Fee!«
»Da bin ich schon lange. Es kann nur noch besser werden. Ich möchte wirklich nicht schießen!«
Der Mann erhob sich, ließ die linke Hand sinken und öffnete die Schublade. Er zog den Schlüssel heraus, trat mit einer erhobenen Hand ans Gitter und schloss die Tür darin auf.
Jay und Rio erhoben sich.
»Was für ein abgekartetes Spiel!«, jammerte der Nacht-Marshal, dem Cobb vergessen hatte, einen Stern an die fadenscheinige Cordjacke zu stecken.
»Umdrehen!«, befahl Jay. »Rio, ein paar Stricke und einen Knebel für Mister Cohler.«
Shayne verließ die Zelle. »Großartig, Fee, du bist ein Schatz!«.
»Ich fühle mich elend wie noch nie«, bekannte das Saloonmädchen.
Rio fand im Spind neben dem Gewehrständer ein paar Stricke und einen einigermaßen sauberen Lappen. Damit fesselten sie den Mann an Händen und Füßen und knebelten ihn.
Als sie die Zelle verließen, lag Cohler auf einer der Pritschen, unfähig, um Hilfe zu rufen.
Fee trat zurück und bedrohte sie mit dem Colt. »Die Waffe behalte ich. Wie verabredet.«
Rio blickte auf den vollen Gewehrständer.
»Lass das!« Jay schob den Partner vor sich hinaus.
Fee folgte ihnen und schloss die Tür. Die Lampe über dem Schreibtisch flackerte.
Auf der Straße war niemand. Auch hinter den Fenstern konnten sie nirgendwo Lichtschein sehen, nicht einmal im Saloon.
»Wie spät ist es?« Jay schaute über die Schulter.
»Drei. In zwei Stunden wird es hell. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Eure Pferde stehen im Mietstall. Ich nehme das eures Freundes, der keins mehr braucht. Dann können sie mir nicht noch anhängen, einen Gaul gestohlen zu haben.«
»Gut, er soll dir gehören«, stimmte Jay zu. Er übernahm die Führung. Sie huschten an den Wänden entlang und duckten sich unter den Fenstern. Das Tor zum Mietstallgelände stand offen. An das barackenähnliche Gebäude war eine kleine Hütte angebaut. Dahinter schloss Buschwerk das Anwesen ab.
»Der Stallmann schläft.«
Jay erreichte die Tür des Stalles. Ein Balken lag quer davor in Eisenkrampen. Er hob ihn aus und legte ihn an die Wand.
Rio öffnete und drang ins Dunkel ein. Leise schnaubten die Pferde.
»Hoffentlich schläft er fest genug«, sagte das Mädchen. »Beeilt euch ein bisschen!«
Sie suchten nach ihren Pferden, befreiten sie von den klirrenden Ketten, drängten sie in den Gang und suchten in der Schwärze nach ihren Sätteln. Rio nahm den erstbesten, der ihm in die Hände fiel, nachdem er merkte, dass er seinen so doch nicht fand.
»Macht doch ein bisschen schneller!«, drängte das Saloonmädchen nervös. »Das dauert ja Stunden!«
»Dreh nicht durch, Schatz, wir sind so gut wie weg!« Rio schob das Pferd gegen die Wand. »Los, mach schon Platz.«
Fee blickte hinaus. Den Colt hielt sie immer noch in der Hand. »Das muss doch etwas schneller gehen.«
Jay führte das erste Pferd hinaus. »Da nimm.«
Fee zielte auf ihn. »Versuch nicht, mir den Revolver abzunehmen. Mir kann etwas passieren, was ich wirklich nicht will.«
»Ist doch schon gut.« Jay kehrte in den Stall zurück, brachte sein Pferd und schwang sich in den Sattel.
Fees Tier schnaubte.
Rio tauchte auf. Sein Pferd stieß mit dem das Mädchens zusammen. Das andere Pferd keilte aus. Rios Hengst wieherte und wollte auf die Hinterhand steigen.
»Los, weg!«, brüllte Shayne.
Da öffnete sich die Hüttentür hinter dem Stall. »Was soll denn der Lärm mitten in der Nacht? He, wer ist denn das?«
»Vorwärts!«, befahl Jay.
Sie ritten alle drei zugleich los, trieben die Pferde noch im Hof zum Galopp an und zwangen die Tiere zum Sprung über das Buschwerk.
Der Stallmann lief in die Hütte, holte sein Gewehr und feuerte hinter den Reitern her. Die Kugel pfiff durchs Dickicht und fetzte Zweige von den Sagebüschen.
Fluchend repetierte der Mann sein Gewehr, hastete durch die sich ausbreitende Pulverdampfwolke und schoss abermals.
Doch die Reiter sah er schon nicht mehr. Die Nacht hatte sie aufgenommen. Nur das Dröhnen der Hufe erreichte noch den Hof.
»Alarm!«, brüllte der kleine Mann, hastete zur sSraße, repetierte das Gewehr erneut und schoss in die Luft, obwohl die Männer bereits von allen Seiten gelaufen kamen.
»Die Banditen!«, brüllte der Stallmann. »Und das Flittchen aus der Kneipe! Bedankt euch bei Doug Egger, der das Mädchen unbedingt behalten musste, obwohl wir so was hier nicht brauchen!«
Der Marshal lief im flatternden Nachthemd wie ein Geist als erster in den Stall. Er brannte die Lampe an, schaute in jede Box und ging hinaus.
»Drei Pferde haben sie mir gestohlen!«, jammerte der Stallmann. »So ein Gesindel!«
»Dir fehlt kein einziges Pferd«, stellte der Stadtmarshal richtig. »Es sind die drei Gäule, die ihnen gehörten.«
»Die ich durchfüttern musste.«
Marsahl Cobb ging nicht weiter darauf ein. »Beeilen wir uns! Vielleicht holen wir sie noch ein.«
»Die müssen die Bucks ausgraben, bevor sie sich absetzen können«, verkündete der Schmied.
*
Sie standen im dichten Buschwerk, hielten den Pferden die Nüstern zu und lauschten auf den trommelnden Hufschlag, der durch die Nacht hallte.
Jay ließ seinen Hengst los. »Vorbei.«
Da verklang das Trommeln, und das Echo verlor sich im unübersichtlichen Buschland.
»Jetzt suchen sie nach Spuren«, flüsterte Rio.
»Der Stallmann hat uns alles verpatzt!«, schimpfte Fee.
»Zu spät«, sagte Jay gelassen. »Spuren hätten sie gleich hinter dem Stallgelände suchen müssen. Jetzt finden sie nichts mehr von unseren Pferden.«
Fee trat etwas zurück. Den schweren Revolver hielt sie ständig in der Hand. Das Misstrauen den vermeintlichen Raubmördern gegenüber erfüllte sie immer noch.
Jay tat, als würde er es übersehen.
»Warum reiten Sie denn nicht weiter?« Fees Nervosität ließ sich nicht übersehen. Und vielleicht wäre es leicht möglich gewesen, ihr die Waffe abzunehmen, noch dazu, dass Durango davon ausging, dass sie nicht die Nerven besaß, wirklich zu schießen.
Da ritten die Männer weiter und entfernten sich.
»Sie mussten nur beraten, was sie tun sollen.«
Die Geräusche entfernten sich nach Norden.
»Was haben die vor, Jay?«, wollte Rio wissen.
»Ich nehme an, sie reiten erst mal dahin, wo der Überfall geschah und versuchen, noch einmal die Spuren aufzunehmen, die sie am Morgen fanden.«
»In der Hoffnung, uns dabei zu erwischen, wie wir die Bucks ausgraben, was?«
»Ja.« Rio lachte, blickte dabei auf das Saloonmädchen und wurde jäh ernst.
»Was hat er denn?«, fragte Fee.
Jay lehnte sich gegen den Sattel. Er ging davon aus, dass sie hier keine Gefahr mehr befürchten mussten, weil die Leute der Stadt sie schon viel weiter weg von Montrose wähnten.
»Warum sagst du denn nichts?«, stieß das Mädchen hervor. »Warum lachte er so blöd?«
»Er amüsiert sich über die Männer, Fee.«
»Und warum?«
»Weil die so gewaltig auf dem Holzweg sind«, sagte Rio und lachte abermals.
Die Verwirrung des Mädchens nahm zu. »Ist es nicht logisch, dass sie annehmen, wir würden das Geld holen?«
»Für das, was sie denken, schon«, gab Jay zu. »Nur ist das völlig falsch.«
Fee trat näher und zielte mit dem Colt auf den Vormann. »Was wollt ihr mir denn jetzt vorgaukeln?«
»Nichts, Fee. Die Männer irren sich. Das ist alles.«
»Ihr wollt das versteckte Geld nicht holen?«
»Nein.«
Fee spannte den Hammer des schweren Revolvers. »Jetzt wollt ihr mich verschaukeln, was?«
Jay schüttelte den Kopf. »Wir haben kein Geld versteckt.«
»Kein Geld … versteckt?«
»Nein.«
»Aber ...« Fee wusste nicht, was sie dazu sagen sollte.
»Wir haben den fliegenden Händler auch nicht überfallen und umgebracht. Er kam zu der Hütte, wollte uns unbedingt etwas verkaufen und bekam von Rio zwei Zähne ausgeschlagen. Das ist alles richtig. Aber dann fuhr er weg. Und wir sahen ihn nie wieder. Als man uns in die Stadt brachte, müssen sie ihn schon beerdigt gehabt haben.«
Eine volle Minute herrschte völliges Schweigen zwischen ihnen. Dann hob Fee den Colt höher, so dass Jay undeutlich die Mündung sehen konnte.
»Ihr wollt mich ausbooten!«, schrie sie heiser. »Du hast versprochen, dass ich die Hälfte von der Beute kriege!«
»Ich habe eigentlich nur bestätigt, was du sagtest, aber es nie selbst ausgesprochen, Fee«, erwiderte Jay. »Und ich gebe zu, dass es nicht die feinste Art war, dich in dem Glauben zu lassen, wir wären Mörder und Straßenräuber. Aber uns glaubt niemand. Du auch nicht. Und wir brauchen dringend Hilfe.«
»Da nahmen wir, was sich anbot«, setzte Rio hinzu.
»Ihr verdammtes Lumpenpack lügt mir die Hucke voll!«, rief Fee grollend. Sie trat zurück.
Jay und Rio schwiegen und schauten sie an. Dem Mädchen brach der Schweiß aus.
»Ehrlich, das war nicht sehr fair von uns«, sagte Jay schleppend. »Aber was du vorhattest, finden die Leute in Montrose bestimmt auch nicht sehr nett.«
»Ihr wollt mich austricksen. Nicht mit mir, Freundchen. Wir reiten jetzt dahin, wo die Bucks versteckt sind. Und ich kriege meinen Anteil und verschwinde!«
Sie ließen ihre Worte wieder in der Nacht verhallen.
»Wir sind nichts weiter als Cowboys einer Ranch im Osten hinter den Bergen«, erklärte Jay schließlich. »Wie wir es dem Marshal sagten. Und wir waren am Nueces River auf der Jagd. Um den Speiseplan der Ranch anzureichem.«
»Und ich hab McClure eine angesetzt, dass ihm die Zähne aus dem Mund fielen.« Rio kicherte. »Nichts weiter.«
Fee trat wieder näher. Ihr durchbohrender Blick schien erforschen zu wollen, was die Wahrheit sein könnte, ob das, was sie hörte, oder das, was sie dachte.
Rio grinste sie freundlich an. »War ehrlich verdammt nett von dir, dich so für uns ins Zeug zu legen. Das vergesse ich dir auch nie, Fee. Mein Wort darauf!«
Das Saloonmädchen ließ den Colt langsam sinken.
»Trotzdem ist es wohl besser, wenn du dich in dem Nest nicht wieder sehen lässt, Fee.« Jay ging auf sie zu, nahm ihr den Colt aus der Hand und steckte ihn in die Satteltasche ihres Pferdes. »Wir können dir leider auch gar nichts mitgeben, was deinen nächsten Start erleichtern würde. Du siehst ja, wir stehen selbst mit leeren Händen da und sehen ziemlich alt aus.«
»Alle sind Narren«, murmelte Fee. »Und ich muss genauso blind wie die Männer gewesen sein.«
»Zu unserem Glück«, entgegnete Rio freundlich grinsend. »Die hätten uns glatt aufgeknüpft.«
Fee griff nach dem Steigbügel.
»Aber sie werden euch weiterjagen. Und mich noch dazu!«
»Du solltest weit wegreiten«, sagte Jay. »Das Pferd gehört dir. Es ist nicht gestohlen.«
»Wer weiß, ob sie anderen gegenüber davon reden, dass sie von einem Mädchen in die Pfanne gehauen wurden«, sagte Rio. »Würde ich doch stark anzweifeln.«
»Ich auch«, stimmte Jay zu. Er hob Fee auf und setzte sie in den Sattel. »Viel Glück. Du hast uns vielleicht das Leben gerettet. Sollten wir uns noch mal begegnen, kannst du auf uns rechnen, wenn es an etwas fehlt.«
»Halunken«, sagte Fee. Aber sie lächelte dabei, wenn auch recht unglücklich.
Jay schlug dem Pferd auf die Hinterhand. Das Tier trug das weißblonde Mädchen durch das raschelnde Buschwerk und tauchte in der Nachtschwärze unter.
»Die hat es doch noch schneller begriffen, als ich dachte.«
»Und gar nicht sehr tragisch genommen, Rio. Sie ist an Unglück gewöhnt.«
Eine Weile konnten sie den sich nach Süden entfernenden Hufschlag noch hören, dann wurde es wieder still.
»Und nun?« Rio zog den Sattelgurt nach.
»Wenn wir uns beeilen, müssten wir es vor Tagesanbruch noch zu den Farmern schaffen. Es kann sonst niemand gewesen sein.«
»Du vergisst den anderen Strohkopf. Diesen Wolter, der den Toten gefunden haben will.«
»Nein, Rio. Der wusste doch nichts von uns. Die Tasche wurde hinter der Hütte im Gestrüpp abgelegt, um uns in den Verdacht zu bringen, die Straßenräuber zu sein. Das konnte nur jemand tun, der genau Bescheid wusste. Im übrigen bin ich sicher, dass der Ort des Überfalls gründlich ausgewählt wurde. Wir sollten die Schüsse nicht mehr hören können. Wohl aber dieser Farmer.« Jay saß auf. »Versuchen wir es!«
Rio schwang sich ebenfalls in den Sattel, gab dem Pferd die Sporen und sprengte an Jay vorbei.
Sie galoppierten durch das Buschland, mussten die Pferde jedoch immer wieder zügeln, Ausschau halten und auf Geräusche achten, um nicht unversehens in eine Falle der suchenden Posse zu geraten.
Als sie drei der vier Meilen zur Zattig-Farm zürückgelegt hatten, kündigte ein grauer Streifen im Osten die Dämmerung eines neuen Tages an.
Jay zügelte seinen Braunen. »Zu spät. Wir müssen einen Bogen schlagen.«
»Und dann?«
»Durch das Maisfeld könnten wir uns anschleichen. Selbstverständlich ohne die Pferde.«
»Ziemlich riskant, was?«
»Allerdings.« Jay lenkte sein Pferd nach Westen.
*
Dort, wo die Spuren den Hang hinunterführten und im ausgetrockneten Creek weiter nach Westen verliefen, zügelte Stadt-Marshal Cobb seinen Grauen und wartete auf das Aufgebot.
»Die können sich doch nicht in Luft aufgelöst haben«, knurrte der Schmied.
»Hier waren sie nicht«, gab Cobb zurück. »Wir hätten neue Spuren finden müssen.«
»Dann sind sie offenbar direkt dahin, wo das Geld versteckt liegt«, vermutete Barbier Keach. »Die wollen keine Zeit verlieren, Marshal. Kann man sich ja auch denken.«
Cobb ritt weiter. Im Morgengrauen verloren sich die Spuren bald auf dem Gestein der trockenen Rinne. Der Stadt-Marshal hielt sich nicht damit auf, alles in der Runde abzusuchen, weil er sicher war, damit nur die kostbare Zeit zu vergeuden.
Im Galopp ließ er den Grauen durch das Bachbett laufen. Das Aufgebot galoppierte hinter ihm her.
Noch vor dem ersten Hügel lenkte der Marshal den Grauhengst aus der Rinne und zügelte ihn.
Nebelfetzen hingen zwischen den flachen Erhebungen und hüllten das Dickicht ein.
»Ja, hier irgendwo müsste es sein«, murmelte der Barbier, der sich nachdenklich über das stopplige Kinn rieb. »Sie mussten schließlich nach Süden zurück, um schneller als wir bei der Hütte sein zu können.«
»Wir sollten eine Kette bilden, nach Süden reiten und alles absuchen«, schlug der schrankbreite Schmied vor. »Mehr können wir ohnehin nicht mehr tun.«
Cobb nickte, verteilte die Leute und ritt dann ungefähr in der Mitte zwischen ihnen südwärts. Alle zwanzig Yard suchte ein anderer Mann das Gestrüpp ab.
Die Sonne ging auf und warf strahlenden Glanz über die Wildnis. Die Nebelschwaden lösten sich auf.
Eine Stunde ritten die Männer suchend in breiter Kette nach Süden, dann gaben die ersten auf und kehrten zu dem Marshal zurück. Die anderen ließen sich nicht nötigen und folgten ihnen. Sie sahen lustlos aus.
»Ich möchte wissen, für wen wir das alles tun«, maulte der Barbier, der die Stimmung übersah und schon immer gesagt hatte, was er wirklich dachte.
»Das frage ich mich allerdings auch«, stimmte Hiram Savage, der Drugstorebesitzer zu. »Obwohl McClure mir eigentlich recht nützlich war. Er transportierte manches für mich von Pueblo heran, was meine Wagen nun selbst holen müssen, was allemal teurer wird.«
Cobb blickte über das Gestrüpp hinweg. Dunst senkte sich über das Land. Ein Flimmern stand vor den Hügeln und den Waldgebieten im Westen vor dem Colorado River.
»Von hier aus ist es nicht mehr weit zu den Zattigs«, wandte ein Mann ein. »Wir sollten sie fragen, ob sie was hörten.«
Cobb nickte. Da er selbst keine bessere Idee hatte, ritt er weiter nach Süden hinunter.
*
Jay und Rio ließen ihre Pferde zwischen Sagebüschen und Cottonwoods zurück. Sie befanden sich noch rund eine halbe Meile von der Farm entfernt und konnten nur die Dächer der beiden Hütten in der flimmernden Luftspiegelung erkennen. Jay glaubte fest, dass sie unbemerkt bis hierher gelangten.
Sie schlichen durch das Buschwerk, erreichten das reichlich lichte Maisfeld und gingen in die Hocke. Der Hof der Farm blieb ihnen noch verborgen, und so hatten sie auch die Zattig-Brüder bisher nicht gesehen und wussten nicht, wo sie sein mochten.
Jay richtete sich vorsichtig auf, glitt zum Feld hinüber und zwischen die Stauden. Er musste geduckt gehen, so kümmerlich wuchs der Mais in diesem Sommer.
Rio befand sich links von ihm und glitt wie eine Schlange durch die Reihen. Es dauerte nicht lange, dann vermochten sie den Hof und den Rest des Anwesens zu überschauen. Die Hüttentür stand weit offen. Im Korral steckten die Pferde und Maultiere mitten in der Umzäunung die Köpfe zusammen. Die Sättel hingen über der Fenz, der flache Ranchwagen stand ein Stück dahinter. Seine Deichsel war nach oben gestellt.
Die Farm erweckte den Eindruck tiefen Friedens.
Jewy Zattig trat aus der Hütte, setzte sich davor auf die Bank und streckte die Beine aus. Er zog eine Maiskolbenpfeife aus der Tasche, stopfte sie, schob den speckigen Zylinder in den Nacken und klemmte die Pfeife zwischen die Zähne. Auf der Bank rieb er ein Schwefelholz an und setzte den Tabak in Brand.
Sein etwas jüngerer Bruder tauchte auf und lehnte sich an die Wand.
»Ist heute Sonntag?«, fragte Rio flüsternd.
»Ich weiß nicht.«
»Es sieht aus, als wäre Sonntag und die Zattigs gläubige Leute, denen ein solcher Tag heilig ist.«
Jay sah, wie die beiden alten Männer sich zufrieden angrinsten. Jewy lachte glucksend.
Da erschallten Geräusche. Zuerst klang es wie ein Raunen, das eine nahende Bö verursachte, dann wurden die Geräusche lauter und härter.
Die beiden Männer bei der Hütte hörten es. Jewy sprang auf und hastete zur Hüttenecke.
»Wer ist es?«, rief Boris erschrocken.
Dahin war der geruhsame Farmfrieden.
»Der Marshal mit seinem Haufen.«
»Verdammt, was wollen die denn?«
»Das gefällt mir gar nicht!«, schimpfte Jewy, klopfte die Pfeife an der Wand aus und zog sich den speckigen Zylinder in die Stirn.
Jay sah die Reiter von Norden kommend auftauchen. Marshal Cobb besaß mehrere Längen Vorsprung und zügelte sein Pferd vor dem Farmer.
Jewy Zattig trat zurück. »Was ist denn passiert, Marshal, dass ihr so früh am Morgen schon von Norden kommt? «
»Die Halunken sind uns durchgebrannt.«
»Was?« Zattig trat noch weiter zurück. »Machen Sie keine Witze, Cobb. Das kann brandgefährlich für uns werden.«
Der Stadt-Marshal stieg ab und trat vor das Pferd. Den Zügel behielt er kurz in der Hand.
Die anderen stiegen ebenfalls ab und bildeten einen Halbkreis vor den abgerissenen Brüdern.
»Ihr habt nichts Verdächtiges gehört?«, erkundigte sich der Stadtmarshal, der die beiden scharf nacheinander anschaute.
»Absolut nichts.« Jewy rückte nervös an seinem alten Zylinder herum. »Die nehmen Rache an uns.«
»Wieso an euch?«
»Na ja, weil ich doch dazukam, als sie verhaftet wurden.«
»Die beiden holen ihr Geld und kratzen die Kurve.«, sagte der Barbier. »Damit sind die genug beschäftigt.«
»Und der dritte?«
»Der hat solche Sorgen nicht mehr«, sagte der Marshal barsch. Er ging an den Zattigs vorbei und schaute in die Hütte.
Jewy wandte sich um. »Suchen Sie was? Hier haben die beiden den Zaster bestimmt nicht versteckt!«
Cobb kehrte zu den anderen zurück.. »Wir können nichts weiter tun, als den US Marshal zu verständigen. Reiten wir zur Stadt zurück.«
Die Männer stiegen sofort auf.
»Wenn wir noch was von den Kerlen bemerken, verständigen wir Sie sofort», versprach Boris. »Oder wir nehmen sie selbst fest, wenn es sich einrichten lässt.«
»Wieso konnten die beiden denn entwischen?«, wollte Jewy noch wissen.
»Fee«, erwiderte der Marshal nur.
Aber Keach setzte hinzu: »Die sollte für dich bei den beiden spionieren und hat dir was gehustet, Cobb.«
Verstohlen grinsten die Männer.
»Vergiss das nicht, dem US Marshal mit zu melden.« Barbier Keach trieb sein Pferd an, galoppierte über den Hof und entfernte sich nach Südosten.
Boris Zattig kicherte. »Das ist wirklich ziemlich komisch, Marshal, wenn man so ’reingelegt wird.«
»Halt’s Maul, Boris!«, befahl Jewy. »Das kann jedem mal passieren. Sie haben bestimmt das Richtige versucht, Marshal Cobb. Aber wer keine Verantwortung trägt und nichts herausfinden muss, der kann ja auch keinen Fehler machen. Dieser Narr!«
Die Reiter verließen bereits den Farmhof in einer lang auseinandergezogenen Kette.
»Seid vorsichtig«, sagte der Stadtmarshal. »Und haltet die Augen offen.« Er schnalzte mit der Zunge und ritt den anderen nach.
*
Jewy nahm den Zylinder ab und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Boris sank auf die Bank vor der Hütte und bekreuzigte sich.
Jewy stülpte die speckige Kopfbedeckung auf das lange Silberhaar.
»Der Marshal ist so blöd wie ein Ofen.«
»Hast du ihn deswegen so hofiert?«
»Nein, Boris. Dann wäre ich ja genauso vernagelt wie er. Ich wollte, dass er so bleibt. Wenn man einem Zucker um den Mund schmiert, bekommt er den faden Beigeschmack nicht mit.«
Wie Teufel grinsten die beiden sich an.
»Aber dass diese Kerle frei sind, gefällt mir gar nicht.« Jewy Zattig wurde ernst.
»Denkst du, die riechen den Brei vielleicht?«
»Woher soll ich das wissen, Boris? Ausgesprochen dämlich sahen sie allerdings nicht aus. Aber ich hatte eine solche Panne nicht einkalkuliert.«
»Das Mädchen, Jewy! Das hat in Montrose keinen müden Dollar mehr verdienen können.«
»Und die beiden schlauen Halunken müssen ihr vorgegaukelt haben, da wäre ein Vermögen zu verdienen!« Jewy fluchte und spuckte in den Sand.
»Wir sollten den Zaster ausgraben und verschwinden!«, schlug Boris vor.
»Keine Panik! Wenn wir jetzt abhauen, merkt der Stadt-Marshal doch noch was. Wir müssen monatelang jammern, am besten noch das Maisfeld anzünden und die Sonne dafür verantwortlich machen. Dann schlucken die Leute, dass wir hier aufgeben mussten. Dann merkt keiner was. Nur nicht zu plötzlich.«
»Dann wollen wir es wenigstens ausbuddeln.«
»Warum?«
»Wenn die Kerle etwas riechen und hier herumschnüffeln, könnten sie die Stelle finden, an der frisch gegraben wurde.«
Jewy sah nachdenklich aus, zog den Zylinder erneut vom Kopf und musste sich wiederum den Schweiß vom Galgenvogelgesicht wischen.
»Wir können es im Haus verstecken. Das ist sicherer. Unter den Dielen. Der Herd lässt sich zur Seite bewegen. Darunter würde niemand das Holz aufhacken!«
»Gut.« Jewy setzte den Zylinder auf. »Das ist vielleicht in der Tat besser, Boris. Hol den Spaten!«
Der jüngere Zattig wandte sich dem Schuppen zu.
Jay Durango blickte zu Rio hinüber und flüsterte: »Wir sind genau im richtigen Moment gekommen.«
Rio nickte. »Wenn wir nur Waffen hätten, um die beiden angreifen zu können!«
»Nein, das ist doch nicht unsere Sache. Da winden die sich doch noch heraus und erzählen dem Marshal, wir hätten die Beute mitgebracht. Das überlassen wir Cobb.«
Jewy wandte sich um und blickte aus zusammengekniffenen Augen zum Maisfeld herüber.
Jay kam der Verdacht, er könnte zu laut gesprochen haben. Er hielt den Atem an und versuchte, sich noch tiefer an den Boden zu ducken.
Da kehrte Boris aus dem Schuppen zurück. Er brachte einen kurzstieligen Spaten mit und kicherte, als er seinen Bruder erreichte.
»Was hast du denn, setzt dir die Sonne zu sehr zu?«, schimpfte Jewy.
»Ich sehe immer noch die doofen Gesichter der Stadtfräcke, Jewy. Die beiden standen beinahe auf dem Zaster! « Boris kicherte wieder.
Jewy nahm ihm fluchend den Spaten ab und umging die Hütte.
Jay konnte den Kerl nicht mehr sehen. Auch der andere verschwand aus seinem Blickfeld. Er hörte Büsche rascheln. Der Spaten fuhr in den Sand. Dann wiederholte sich das Rascheln.
»Nimm du den Spaten!«, kommandierte Jewy.
Zwei Minuten später tauchten die beiden wieder auf. Boris trug den kurzen Spaten. Jewy hielt einen Leinensack, zweimal so groß wie eine Hand, in den Fingern. Als er ihn spielerisch wog und dabei schüttelte, ließ sich das Klimpern der Silbermünzen bis ins Maisfeld vernehmen.
Die beiden tauchten in der Hütte unter.
»Zurück, Rio!«, flüsterte Jay.
Geduckt schoben sie sich rückwärts durch die Staudenreihen und erreichten das Feldende. Doch erst jenseits der Büsche durften sie es wagen, zu ihrer vollen Größe emporzuwachsen.
Die Pferde fanden sie noch dort vor, wo sie beide zurückließen.
Jay nahm den Braunen am Zügel und führte ihn weiter von der Farm weg. Rio kam ihm mit dem anderen Tier nach.
»Und nun?«
»Wir brauchten ein Gewehr. Wenigstens einen Revolver.«
»Um den Marshal bedrohen zu können?«
»Genau. Für andere Argumente ist er ja leider bisher noch nicht zugänglich. «
»Der wird Augen machen, wie eine Kuh wenn es donnert!«, versicherte Rio. »Ich meine, wenn er die Silberdollars unter dem Herd sieht.«
Jay stieg auf und ritt durch das Dickicht weiter von der Farm weg.
Rio holte ihn ein. »Aber der Marshal soll eine Frau haben. Der wohnt nicht allein in seinem Haus.«
Durango dachte bereits daran.
»Die schlägt in der Stadt Krach, Jay. Und dann haben wir wieder die ganze Horde auf dem Hals.«
»Die kämen aber zu spät. Wenn Cobb das Geld gesehen hat, ist die Sache für uns ausgestanden, Rio. Die Frau muss uns also nicht unbedingt behindern, wenn wir mit dem Marshal nur genügend Vorsprung gewinnen.«
»Du meinst, wir müssen sie binden wie den Nachtwächter?«
»Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.«
»Und Waffen?«
»Nachts soll niemand im Office sein.«
Rio zügelte sein Pferd. »Du spinnst doch!«
»Angst?« Jay lächelte scharf.
»Es wäre einfacher, zur Ranch zu reiten und mit Verstärkung zurückzukehren.«
»Das dauert mit jetzt zu lange. Niemand weiß, was den Zattig-Brüdem morgen einfällt. Ob sie so gelassen bleiben, wie sie jetzt noch sind. Nein, das müssen wir schnell klären. In der nächsten Nacht!«
*
Jay schob sich an der Wand entlang. Sein Ärmel kratzte über die rohen Wandbretter. Er sah den aus dem Saloon fallenden Lichtschein und mehrere Männer drinnen am Tresen. Als er einen Blick um die Ecke werfen konnte, atmete er auf.
Im Office brannte kein Licht. Wie erwartet hielt sich der Stadt-Marshal nicht darin auf.
Jay schob sich zurück, glitt hinten um die Ecke und erreichte die schmale Hintertür. Er schaute sich um und meinte Rio und die Pferde bei den Büschen im Mondschein schemenhaft zu sehen. Bestimmt war der hünenhafte Partner noch aufgeregter als er selbst. Jay lächelte darüber.
Die Tür besaß innen einen Riegel, der sich jedoch von außen nicht betätigen ließ. Dafür saß er nicht sehr fest, so dass die Tür zwei Fingerbreit bewegt werden konnte.
Jay griff in den Falz, stemmte einen Stiefel gegen die Wand und zog an der Tür. Das aufgesetzte Fugenbrett brach ab. Durango strauchelte, vermochte sich jedoch zu fangen. Er klemmte das Brett quer in die Fuge und benutze es als Hebel. Der Riegel platzte von der Tür und schlug drinnen dumpf auf den Boden. Die Tür sprang auf. Im Mondschein erkannte Jay eine kleine Kammer, gerade groß genug für das Bett und einen Gang daneben.
Jay trat ein, erreichte die Verbindungstür und stand einen Augenblick später im leeren Office. Die Tür der Zelle war nicht mehr geschlossen worden. Auf dem Tisch lagen die Stricke, die er selbst dem Nacht-Marshal angelegt hatte.
Im Spind neben dem Waffenständer fand Durango wie erwartet seinen Colt und den von Rio. Die Patronengurte waren um die Waffen gewickelt. Er schnallte seinen um, legte den anderen auf den Schreibtisch und entnahm dem Schrank auch ihre Gewehre.
Aus dem Saloon gegenüber trat eine Gestalt. Laut knarrten die schwingende Türflügel.
»Gehst du schon, Tobe?«, rief eine, von Whisky heisere Stimme.
Der Mann auf der Veranda erwiderte nichts, wandte sich ab und lief die Straße hinunter.
Rasch verließ Jay hinten hinaus das Office und lehnte das abgerissene Brett als Sicherung gegen die Tür.
Rio atmete auf, als Jay ihn erreichte. Er nahm seinen Waffengurt und schnallte ihn um. Durango schob die Gewehre in die Scabbards.
»Für den Marshal müssten wir noch ein Pferd haben, Jay!«
»Das schaffen wir nicht. Den nehmen wir auf unseren Pferden mit. Einer von uns. Aber vielleicht besitzt er selbst einen kleinen Stall.«
»Das denke ich eigentlich auch, Jay. Hier wird doch keiner dem Stallmann zu Einkünften aus der eigenen Tasche verhelfen.«
»Das sehen wir gleich.« Jay führte seinen Braunen an den Büschen entlang weiter.
»Das vorletzte Haus muss die Büchsenmacherei sein!«
Jay blieb stehen, blickte auf die schemenhaften Gebäude, führte das Tier ins Dickicht und wartete, bis Rio ihn erreichte. Mit den Zügeln banden sie die Tiere zusammen, lockerten die Colts in den Halftern und traten erneut aus dem Schutzwall.
Es musste bereits Mitternacht sein. In den Häusern brannten keine Lampen mehr. Nirgendwo bewegte sich etwas.
»Gehen wir.« Jay schritt den Häusern entgegen. Das Risiko, von einem Beobachter hinter einem Fenster zufällig gesehen zu werden, mussten sie auf sich nehmen.
Der Hof war nach hinten nicht abgeschlossen. Selbst das Buschwerk der beginnenden Wildnis wies Lücken auf. In der Tat sahen sie einen kleinen Stall im Hof neben der schmalbrüstigen Werkstatt, auf der ein Blechschild verriet, dass sie richtig waren.
Rechts und links der Hoftür blieben sie am Haus stehen. Jay versuchte, die Tür mit der Klinke zu bewegen, doch das misslang.
Rio ging zum Fenster, presste die Hände gegen das untere Teil und vermochte es nach oben zu drücken. Die Halterung am Rahmen schnappte in eine Feder und hielt die Fensterhälfte fest.
Jay schwang sich hinauf und kletterte über den Sims. Er kam in der Küche an. Im Herd glühte es noch dunkel unter der Asche. Hitze erfüllte den Raum.
Rio kletterte geräuschlos herein.
Jay trat an den Tisch, während Rio an den abgehenden Türen lauschte.
»Hier drin schnarcht einer!«
Jay zündete die. Lampe an und hängte sie von der Kette. Er trat zu Rio, die Lampe in der linken Hand, öffnete die Tür und stieß sie auf. Die Tür schwang heftig kreischend herum. Der Lichtschein erfasste den Marshal und seine Frau, die beide erwachten und im Doppelbett in die Höhe fuhren. Die Frau stieß einen spitzen Schrei aus.
»Keine Bewegung und absolute Ruhe!«, befahl Rio.
»Mein Gott, die Banditen!«, rief die Frau entsetzt.
»Ich dachte ...« Cobb brach ab.
»Sie dachten, wir wären mit der Beute über alle Berge, Marshal, nicht wahr?«
»Ja«, gab Cobb zu.
»Haben Sie den US Marshal bereits verständigt?«
»Nein. Das muss schon warten, bis die nächste Postkutsche dahinfährt.«
Jay nickte. »Was für ein Glück für Sie.«
»Wieso?«
»Weil Sie sich unsterblich blamiert hätten. Wir reiten jetzt dahin, wo das Geld ist. Und dann werden Sie sehen, dass nicht jeder Fremde unbedingt ein schlechterer Mensch sein muss als diejenigen, die man gut zu kennen meint. Los, aufstehen! Und machen Sie uns keine Schwierigkeiten, sonst erfahren Sie die Wahrheit nie mehr.«
Cobb gehorchte und hob die Hände.
Rio ging in die Küche und in den Flur hinaus. Er kehrte zurück und warf ein Seil und ein Messer auf das Bett. »Binden Sie ihre Frau und stecken Sie ihr einen Knebel in den Mund. Aber bitte ein bisschen ordentlich!«
Cobb schaute Jay an.
»Was soll das alles heißen?«, rief die Frau. »Sie werden dich umbringen, James!«
»Wenn wir das wollten, wären nicht solche Umstände nötig«, sagte Rio gepresst. »Nun bewegen Sie sich schon, Marshal. Sonst wird’s verdammt ungemütlich.«
Der Mann nahm Seil und Messer vom Bett und ging zur anderen Seite hinüber.
Jay und Rio bedrohten den Mann mit den Colts.
»Woher habt ihr Waffen?«
»Sie gehören uns«, erwiderte Jay. »Ich war so frei, sie zu holen.«
»Sie haben eingebrochen!«
»Richtig, Marshal. Vergessen Sie nicht, was Sie tun sollen.«
Cobb blickte auf seine Frau. »Sie werden mich töten, wenn wir nicht gehorchen, Mattie. Leg dich auf den Bauch.«
»Sie wollen dich verschleppen und irgendwo in der Wildnis meuchlings ermorden, James!«
»Wir hassen Umstände«, sagte Jay barsch. »Solche Umstände, wie Sie vermuten, Madam, und solche, wie Sie sie uns machen, Marshal!«
»Mattie, komm, sei ein Schatz!«, bettelte der Stadt-Marshal. »Es wird schon nicht so schlimm werden.«
Jammernd legte sich die Frau zurück und rollte herum.
»Die Hände nach hinten, Mattie!«
»Machen Sie das ordentlich, sonst binde ich die Stricke noch mal fest!«, drohte Rio.
Cobb fesselte die Frau und knebelte sie anschließend mit einem Taschentuch und dem Rest des Stricks. .
Rio ging vor den Betten vorbei, wackelte drohend mit dem Revolver und dirigierte Cobb damit in die Ecke, wo Jay ihn wieder bedrohen konnte. Rio kontrollierte die Arbeit des Stadtmarshals.
»Gut, das hält. Gehen wir, Mister!«
Jay trat rückwärts in die Küche und am Tisch vorbei zur Tür. Der Schlüssel steckte innen. Er drehte ihn um und verließ rückwärts auch das Haus.
Cobb folgte mit erhobenen Händen. »Wisst ihr eigentlich, was darauf steht, einen Marshal zu entführen?«
»Wir werden dann dreimal gehenkt, wenn es nach euren Köpfen geht«, erwiderte Jay gleichmütig.
»Los, weiter!« Rio stieß dem Mann den Colt in den Rücken. »Wir gehen zum Stall, Marshal.«
Im Hof blieb Cobb stehen. Die Situation war gefährlich, weil der Lichtschein von der Straße aus gesehen werden konnte. Und wenn jetzt einer der Nachzügler den Saloon verließ und die Straße herunterkam, würde ihr ganzer Plan platzen.
»Wo ist das Mädchen?«, fragte der Marshal.
»Wir haben Fee weggeschickt.«
»Und was war der Preis?«
»Die Hälfte der Beute, Marshal. Das hatte Fee so festgesetzt. Später begriff sie dann schneller als Sie jetzt, dass es keine Beute gab. Nicht bei uns.«
»Los weiter!« Rio stieß mit der Revolvermündung und brachte den Marshal damit weiter hinter Jay her, der immer noch rückwärts lief und den bulligen Mann seinerseits in Schach hielt.
»Moment, Rio!« Jay stieß mit dem Rücken gegen den kleinen Stall.
»Stehenbleiben!«
Cobb verharrte. Jay schob den Colt in die Halfter, öffnete die Tür und zog den Revolver wieder. Er betrat den Stall. Rio schickte den Marshal weiter.
»Es scheint zu klappen!«, frohlockte er. »Aber es ist kaum zu glauben.«
»Los, Marshal, stehen Sie nicht herum, als wollten Sie bedient werden!«, fuhr Jay den mittelgroßen Mann an.
Cobb trat neben das Pferd und sattelte es. Im letzten Augenblick, als er schon zugriff, erkannte Jay ein Schimmern und wusste, dass es von der Kolbenplatte der Winchester im Scabbard herrührte. Er sprang vorwärts.
Cobb riss das Gewehr heraus und wollte herumwirbeln. Da setzte Jay ihm den achtkantigen Lauf des Revolvers auf den Kopf. Der Mann verlor das Gewehr, taumelte gegen die Trennwand und stürzte ins Stroh.
»Der hat Haare auf den Zähnen!«, schimpfte Rio.
Jay hob das Gewehr auf und schleuderte es neben den Futterkasten.
»Fällt dir eigentlich auch auf, dass er noch im Nachthemd ist?« Rio kicherte. »Das sieht vielleicht komisch aus.«
»Hol ihm was anderes.«
»Warum?«
»Weil er uns das ankreidet, wenn wir ihn so bloßstellen. Und das nützt uns nichts.«
Rio verließ den Stall und überquerte den Hof.
Jay suchte ein Lasso. Er fand auch ein Messer, schnitt eine Fessel zurecht und legte sie auf die Futterkiste.
Rio brachte ein Hemd, eine Hose, Stiefel, die derbe Jacke mit dem Stern und den Hut Cobbs. Sie zogen ihn an. Er erwachte dabei, wollte Rio angreifen und kassierte einen Kinnhaken.
»Sag es, wenn dir das Fell juckt, Marshal. Halunken sind nicht pingelig!«
Jay fesselte dem Marshal die Hände.
»Wollen wir ihn nicht quer über den Gaul werfen, wie er es mit uns machen ließ?«
»Wollen wirklich genauso mies sein, Rio? «
»Am liebsten wäre ich es.«
»Ich nicht.« Jay stieß den Mann gegen die Krippe und führte das Pferd hinaus.
»Komm, Marshal, der Ritt geht los!«
Rio bedrohte den Sternträger, bis der auf seinem Pferd saß. Jay führte das Tier hinten hinaus. Sie erreichten die eigenen Pferde, gaben Cobb den Zügel in die gefesselte Hand und saßen selbst auf.
*
Der Mond stand tief im Süden. Sein fahler Lichtschein verglomm langsam. Die Dunkelheit wurde intensiver.
Entsprechend spät tauchte die Farm vor ihnen auf. Sie zügelten die Pferde. Rio hielt Cobbs Pferd mit an.
»Hier ist das Geld, nach dem Sie suchen«, erklärte Jay. »Bei den feinen Brüdern Zattig!«
Cobb blickte ihn prüfend an. »Sie müssen das nicht glauben, Marshal. Wir nahmen Sie ja mit, um es Ihnen zu zeigen. Aber es ist besser, Sie wissen schon alles, wenn Sie anfangen zu begreifen, dass es so und nicht anders wahr. Also wir kamen zuerst hierher, und die Zattigs sagten uns, wo wir eine leere Hütte finden könnten. Hinter dieser Hütte fanden Ihre Leute später eine leere Tasche, die man als die von McClure erkannte. Und wir sollten so dumm gewesen sein, so ein gefährliches Beweisstück hinter das Haus geworfen zu haben. Der oder die, die das veranlassten, müssen gewusst haben, dass in Montrose nicht lange gefackelt und der Verstand nicht strapaziert wird. Das wiederum konnte nur jemand sein, der die Leute genau kennt und zugleich wusste, wo wir uns befanden. Der Farmer Wolter schied deswegen aus, er wusste von uns zu diesem Zeitpunkt nichts. Blieben die Zattigs und die Leute der Stadt selbst. Aus der Stadt war es kaum einer. Der wäre die ganze Nacht unterwegs gewesen. Das hätte wohl doch jemand bemerkt.«
»Haben wir das kapiert, Mister?«, fragte Rio.
»Als Sie gestern hier auftauchten, steckten wir da drüben im Maisfeld«, fuhr Jay fort. Er nickte über den Hof hinweg. »Und kaum sind Sie mit Ihrem Haufen weg gewesen, haben die Zattigs das Geld aus dem Versteck geholt.«
»Ihr habt förmlich darauf gestanden!«, rief Rio. »Am Beginn der Büsche war es in einem Beutel verscharrt. Jewy hat gesagt, den würden sie nun unter den Dielen im Haus verstecken. Und zwar unter dem Herd, den man bewegen könnte.«
Cobb schaute wieder auf Jay. Noch immer war kein einziges Wort über seine Lippen gekommen.
»Wenn wir das Geld jetzt dort finden, haben Sie den Beweis, wer McClure ermordete. Die Zattigs haben vielleicht seit Jahren auf eine Gelegenheit gewartet, ihn über den Jordan zu schicken und es anderen anzulasten. Und ohne Fee wäre der verschlagene Plan sicher auch aufgegangen. Also, Marshal, steigen wir ab!«
Cobb gehorchte und trat vor die Pferde. Noch waren seine Hände gefesselt, so dass er ihnen nicht sehr gefährlich werden konnte. Ob er ihren Worten Glauben schenkte, ließ sich auf seinem Gesicht nicht ablesen.
»Die Zattigs waren immer hier«, fuhr Jay fort. »Denen konnten wir die Beute also nicht ins Haus schmuggeln.«
»Noch dazu, wo wir doch keine Waffen besaßen, Marshal!«
Cobb standen die Lippen wie ein Strich im Gesicht. Offenbar wehrte er sich gegen die Einsicht, einen gewaltigen Bock geschossen zu haben und von ein paar gerissenen Farmern hereingelegt worden zu sein.
Jay und Rio nahmen ihn mit über den Hof und erreichten die Tür.
»Melden Sie sich!«, flüsterte Jay und schlug mit dem Revolver gegen die Tür.
Drinnen rumorte etwas. Jewy Zattig fluchte lästerlich. »Wer ist denn da, verdammt?«
»Marshal Cobb«, sagte der Mann aus der Stadt tatsächlich.
Jay atmete tief durch. Bei Cobb schien das Eis gebrochen zu sein, auch wenn er sich noch zierte, das zuzugeben.
»Was wollen Sie?«
»Das sage ich euch, wenn die Tür offen ist, Zattig!«
»Was will denn der?«, fragte Boris leiser, aber immer noch laut genug, um draußen verstanden zu werden.
»Du hörst doch, dass er es nicht sagt.« Jewy fluchte wieder, stieß irgendwo an und brüllte, als wäre er schwerverletzt worden. Dann schabte Eisen über das Holz, und der Riegel schnappte aus der Sperre.
Jay schob die Tür mit der Schulter auf, drang in die Hütte ein und bedrohte den alten Zattig. Der Kerl hob unaufgefordert die Hände.
»Verdammt!« Boris packte einen Schemel und schleuderte ihn Durango entgegen. Der Vormann sah es undeutlich und duckte sich.
Das Wurfgeschoss streifte über seinen Kopf, schlug draußen in den Sand und zerbrach.
Jewy wollte sich nach dem Gewehr umdrehen.
Jay ließ den Colt fallen, riss den Mann am Ärmel herum und hieb ihm die Faust auf den Punkt. Mit rudernden Armen flog der Kerl zurück und knallte gegen die Wand.
Jay hob den Revolver auf.
Inzwischen ergriff Boris den Tisch und schleuderte ihn zur Seite. Aber Rio war schon bei ihm und warf ihn hinter seinem Bruder her. »Dort bleibt ihr stehen, bis ich was anderes befehle!«
Jay zündete die Lampe an. Sie schwang an einem verbogenen Draht hin und her und ließ Schatten durch die Hütte tanzen.
»Was soll das bedeuten?«, schimpfte Jewy wild. Er war mit Unterhemd und Unterhose wie sein Bruder bekleidet. Das weiße Haar hing wie eine Mähne um seinen Kopf.
»Teufel, der Marshal ist gefesselt!«, rief Boris.
»Dem müssen wir leider mit ein bisschen Gewalt auf die Sprünge helfen«, erklärte Jay. »Jetzt rücken wir mal den Herd zur Seite. Aber nur einer von euch!«
Die beiden rührten sich nicht.
»Jewy!« Rio winkte mit dem Colt zum gemauerten Herd.
Die beiden alten Teufel sahen bleich aus.
»Der Herd ist gemauert, das sieht doch ein Blinder!«, wagte Jewy mit krächzender Stimme einzuwenden.
»Aber doch nicht aufs Holz.« Rio schüttelte den Kopf. »Los, der bewegt sich, wenn du richtig schiebst. Versuch es mal.«
»Sind die beiden verrückt, Marshal?«
Rio packte Jewy und stieß ihn gegen den Herd. »Wir halten jetzt keine Reden, Freundchen!«
Jewy Zattig taumelte gegen die Wand.
»Lässt sich der Herd bewegen?«, fragte Cobb schleppend. »Sehr groß ist er eigentlich nicht.«
»Die beiden sind nicht dicht in den Köpfen.«
»Mit dem Holz verbindet sich der Mörtel aber wirklich nicht«, sagte der Stadt-Marshal. »So einfach das ist, so schwierig hat man es, darauf zu kommen. Willst du es nicht versuchen, Jewy?«
»Ich frage mich, was der Quatsch soll.«
»Sie behaupten, McClures Geld wäre darunter versteckt.«
Boris zitterte. Hörbar schlugen seine Zähne aufeinander. Schweiß perlte ihm auf der Stirn.
»Hilf deinem Bruder!«, befahl Cobb.
»Wir haben McClure nicht auf dem Gewissen!«, stieß Boris hervor. »Großes Ehrenwort!«
Cobbs Gesicht verzog sich zu einem müden Grinsen. »Ihr habt uns schön an der Nase herumgeführt. Wirklich prachtvoll ist euch das gelungen. Aber alles hat irgendwann ein Ende. Bindet mich los, ich rücke den Herd weg!«
Jay holte ein Messer aus dem schmalen Spind hinter der Tür und befreite den Stadt-Marshal. Cobb ging zum Herd und schob ihn mit Gewalt zur Seite. Er bückte sich, entfernte mit den Fingern das eingesetzte Bodenbrettstück und griff in das Loch darunter.
Als er den Sack mit den klimpernden Münzen aus der Hand fallen ließ, rannte Jewy ihn um. Rio ging dazwischen, zog Jewy hoch und setzte ihm die Handkante gegen den Hals. Der Kerl schrie und strauchelte.
Boris fand den Weg zur Tür frei und rannte los.
Jay sah ihn zu spät und griff ins Leere.
Draußen schwang sich Boris auf das Pferd des Marshals.
»Rio, bleib hier!«, rief Jay und rannte hinter dem flinken Farmer her. Er konnte ihn nicht mehr einholen.
Boris sprengte in die Nacht hinaus.
Jay schwang sich auf seinen braunen Hengst und galoppierte hinterher. Er zog das Gewehr aus dem Scabbard und feuerte. Doch das konnte Boris Zattig nicht mehr beeindrucken. Er schlug auf das Pferd ein und schlug einen Haken. Mitten durch das Maisfeld erreichte er das Buschland, das er wie seine Tasche kannte.
Als er den dritten Haken schlug und Jay hinterher wollte, lief der Braune ins Dickicht und verfing sich darin. Jay wurde ausgehoben und über den Hals des Pferdes geschleudert.
Boris preschte davon.
Jay erhob sich. Die Schulter und der Arm schmerzten ihn, und er hinkte, als er zurückging und dem Tier half, sich aus dem Buschwerk zu befreien. Aber er wollte nicht aufgeben, stieg in den Sattel und nahm die Verfolgung wieder auf.
*
Jewy saß zusammengesunken auf einem Schemel und blickte die Dielen an. »Alles sah so einfach aus«, murmelte er kopfschüttelnd. »Diese blöde Gans aus der Kneipe.«
Cobb zählte das Geld auf dem Tisch und hörte gar nicht hin. Die Silbermünzen formten sich unter seinen Händen zu funkelnden Türmen und wurden zu einer ganzen Kette.
» Achttausendzweihundertdreißig «, sagte der Stadt-Marshal. »Ganz schön für zwei.«
Jewy blickte auf. »Jahrelang sprachen wir davon, den alten Trottel zu erleichtern. Aber der Verdacht wäre immer gleich auf uns gefallen. Nie hätten wir hoffen dürfen, dass Gras darüber wächst und wir mit dem Geld verschwinden könnten.«
Cobb räumte das Geld über die Tischkante in den Beutel zurück, den er darunter hielt. Er schnürte ihn zu und legte ihn auf den Tisch. Sein Blick fiel auf Rio Shayne, der an der Wand lehnte. Den Revolver hatte er in den Halfter gesteckt.
Vom Hufschlag konnten sie längst nichts mehr hören.
»McClure wurde von zwei Kugeln getroffen«, sagte der Stadt-Marshal. »Aus zwei Gewehren, wie ich annehme. Ihr seid beide seine Mörder, Jewy!«
»Das blöde Weib«, knurrte Zattig, der dem Marshal offenbar nicht zugehört hatte und den am Geschehen auch nur interessierte, dass sein Plan nicht aufging.
»Wir warten, bis dein Freund zurück ist«, wandte Cobb sich an Rio. »Dann reiten wir zur Stadt.«
*
Jay zügelte den Braunen am Saum des Waldes. Vor ihm brach das Unterholz zwischen den Kiefern. Boris Zattigs Vorsprung schmolz wieder dahin. Da er auch keine Waffe an sich bringen konnte, sah Durango keine große Gefahr für sieh.
»Weiter!«, rief er dem Hengst zu und trieb ihn an.
Der Braune trug ihn in das Gehölz hinein.
Da erreichte ein scharfes Wiehern seine Ohren. Der Verfolgte stieß einen Schrei aus. Ein tiefes Brummen übertönte die anderen Laute.
Jay dachte augenblicklich an den verletzten Bären, riss das Gewehr aus dem Scabbard und repetierte es.
Da der nächste Schrei.
Der Braune bockte. Jay wusste, dass er ihn nicht weiterbringen würde, sprang ab und hastete vorwärts.
Das Bersten von Ästen, ein neuer Knurrlaut und Zattigs Geschrei verrieten, wo Durango suchen musste. Ein paar Herzschläge später erreichte er eine kleine Lichtung und sah im Morgengrauen, wie das gewaltige Tier den Farmer festhielt, an sich zog, ihn biss und zur Erde schleuderte.
Jay feuerte. Die Kugel traf den bereits verletzten Kodiakbären und ließ ihn zusammenzucken. Durango repetierte, feuerte wieder und ging dabei rückwärts.
Die Bestie ließ von dem am Boden liegenden Opfer ab. Schwankend verfolgte sie den neuen Gegner.
Jay schoss und traf das gewaltige Tier diesmal zwischen die Augen. Es schwankte stärker, kam nicht mehr vorwärts und drohte nach der Seite zu kippen.
Schuss um Schuss jagte der Vormann aus der Winchester, und jede Kugel traf den Leib des Tieres, aus dem das Blut in Strömen floss. Und doch näherte sich das fast brüllende Tier ihm immer weiter und schlug mit den Pranken um sich.
Die letzte Kugel fuhr der Bestie in den aufgesperrten Rachen. Sie stoppte, taumelte rückwärts wie betrunken und brach zusammen.
Aus dem Wald hallte das Wummern der Schüsse zurück.
Jay ließ die Winchester sinken. Pulverdampf und Schweiß brannten ihm auf der Haut. Er wartete darauf, dass der Kodiakbär sich wieder erheben würde, aber das Tier schlug nur um sich, versuchte zwar, auf die Füße zu kommen, besaß aber keine Kraft mehr dafür.
Jay umging den geschlagenen Gegner. Als er Boris Zattig richtig sehen könne, wurde ihm übel. Der Mann sah sich kaum noch ähnlich. Gesicht, Arm und Hüfte waren verletzt. Er wollte etwas sagen, formte auch noch Worte, nur auszusprechen vermochte er sie nicht mehr.
Der Farmer war am Ende.
*
Als sie die Stadt erreichten, stand .die Sonne bald im Zenit. Die Menschen säumten die Straßenränder und liefen mit zum Office des Marshals hinauf. Dort erst hielt James Cobb an. Zwischen ihm und Jay saß Jewy Zattig gefesselt auf seinem Pfred. Boris hatten sie auf der Farm beerdigt, weil ihn der Kodiakbär so fürchterlich zurichtete.
Alle Leute sahen, dass etwas anders war, als sie vermutet hatten. Und alle blickten abwartend auf den Marshal.
»Zattig und sein Bruder«, sagte Cobb, zog den Beutel aus der Tasche und warf ihn dem Drugstorebesitzer zu.
»Was?«, fragte der Schmied.
»Begreift ihr es etwa immer noch nicht?«, herrschte Cobb die Menge an. »Die beiden haben für uns eine gewaltige Komödie vorbereitet. Und wir Idioten stolperten prompt in die Falle und wollten zwei völlig unschuldige Fremde verheizen!«
»Dann können wir jetzt wohl was essen.« Jay stieg ab.
Rio folgte seinem Beispiel. Sie führten die Pferde zum Saloon hinüber, banden sie an der Zügelstange fest und betraten die Kneipe.
Cobb saß ab, zog Zattig vom Pferd und bugsierte ihn ins Office. Ein Teil der Männer folgte ihm, die anderen mussten vor der offenstehenden Tür warten.
Während der Stadt-Marshal Zattig einsperrte und von den Fesseln befreite, erzählt er zusammenhängend, was er inzwischen wusste.
Drugstorebesitzer Hiram Savage stellte den Geldbeutel auf den Schreibtisch.
Cobb setzte sich hinter das ramponierte Möbel. »Sind wir vernagelt gewesen. Das mit der leeren Tasche hinter der Hütte hätte uns doch etwas sagen müssen.«
»Wieso, die konnten sich der Tasche wirklich so entledigt haben, weil sie zu spät darauf kamen, sie noch zu besitzen«, widersprach der schrankbreite Schmied.
»Eben«, stimmte Savage zu.
»Peinliche Sache für uns«, wandte der Barbier ein.
Sie blickten ihn alle an.
»Wegen des dritten Burschen, Marshal. Die beiden werden nun in der nächsten Stadt alles brühwarm erzählen und behaupten, wir hätten ihren Partner umgebracht.«
Cobb erhob sich unendlich langsam und stemmte die Fäuste auf den Tisch. »Rede ruhig weiter, Keach!« Seine Augen zogen sich zusammen.
»Wir haben jeder eine Menge zu verlieren. Und wenn sie uns als Mörder anklagen, leiden unsere Familien auch mit darunter. Oder denkst du, die Frauen und Kinder allein können hier leben? Wovon denn?«
Der Schmied nickte. Andere schlossen sich an.
»Wen interessiert schon ein toter Fremder«, sagte der Schreiner im Hintergrund.
Zattig trat ans Gitter. »Legt sie um und lasst mich frei! Wir müssen jetzt zusammenhalten. Die Bucks teilen wir!«
Cobb schien ihn nicht zu hören. Er starrte die Leute an.
»Wir müssen an uns denken«, sagte Keach eindringlich. »Jeder ist sich selbst der nächste, Marshal. Vor allem die Frauen und Kinder müssten den Irrtum vielleicht ausbaden. Du hast auch eine Frau! Und eine Existenz!«
Cobbs Gestalt sank in den lädierten Sessel zurück.
»Zuerst schaffen wir mal die Pferde weg, bevor die Kerle Lunte riechen«, schlug der Barbier vor. »Habt ihr alle die Schießeisen dabei? Gegen so viele Männer haben die keine Chance!«
Die Menge wandte sich ab.
Cobb saß zusammengesunken hinter dem Schreibtisch.
*
»Jay!« Rio sprang auf.
Draußen wurden die Pferde weggeführt. Die Menge stürmte den Saloon mit Colts in den Fäusten.
Durango begriff, schleuderte dem ersten Mann sein volles Whiskyglas entgegen und rannte, hinter Rio her durch den halbdunklen Raum. Sie konnten durch die Hintertür entwischen, rannten um den stinkenden Müllhaufen herum und am Lagerhaus vorbei.
Drei Reiter sprengten neben dem Saloon entlang und näherten sich.
Jay zog den Colt, schoss hinter sich und rannte dabei weiter. Auch Rio feuerte.
Ein Mann wurde in die Schulter getroffen und brüllte, als würde er aufgespießt.
Durango bleib stehen, wandte sich um und feuerte den Colt leer. Ein Reiter sprengte heran, jagte vorbei und warf die Lassoschlinge nach dem Vormann. Die Arme wurden Jay gegen die Hüften gepresst. Das Seil straffte sich, riss ihn um und schleifte ihn ein paar Yard über den Boden.
»Greift euch den anderen!«
Jay sprang auf, bekam einen Tritt gegen das Kinn und fiel stöhnend nach der Seite. Sie zerrten ihn hoch, schleppten ihn zurück, am Saloon vorbei, über die Straße und ins Office hinein.
Cobb saß immer noch hinter dem Schreibtisch und schien in Gedanken weit weg zu sein.
Die Zelle wurde aufgeschlossen und Jay hineingestoßen. Er taumelte noch bis zu einer Pritsche, dann fiel er kraftlos darauf.
Wenige Minuten später brachten sie Rio und sperrten ihn ebenfalls ein. Dann standen sie wieder auf der einen Schreibtischseite und draußen, und der Marshal saß wie vorher da.
»Das muss sein«, sagte Keach barsch. »Wegen unserer Familien und weil wir hier nicht weg können.«
»Wollen wir sie einfach aufknüpfen?«, fragte der Schreiner, den auf einmal Zweifel zu plagen schienen.
Auch andere sahen nun weniger zuversichtlich aus.
Der schlaue Barbier erkannte das. »Wir werden es in aller Ruhe besprechen, Leute. Los, gehen wir hinüber in die Kneipe. Da ist mehr Platz als hier.«
Die Menge zog ab. Nur der Marshal saß immer noch hinter seinem Schreibtisch und schien die Welt, in der er schon so lange lebte, nicht mehr zu begreifen.
Jay fühlte sich wieder besser, setzte sich auf die Pritsche und schaute zu dem Mann hinaus.
Rio stand am Gitter. Zattig saß auf einer anderen Pritsche.
»Ist es wegen Jeff, Marshal?«, fragte Shayne.
James Cobb blickte endlich einmal auf und zur Zelle herüber.
»Den Spießern geht jetzt die Muffe!«, freute sich Zattig. »Weil ein Richter vielleicht' meinen könnte, der Cowboy hätte das überleben können, wäre er in der Hütte liegengelassen worden. Und sie fürchten, man wird es als Mord auslegen!«
Cobb stand auf. »Eigentlich geht das alles auf dein Konto, Zattig!«
Der Farmer zog den Kopf zwischen die Schultern. »So wird es der Richter aber kaum sehen. Zumindest darauf verlassen kannst du dich auf keinen Fall, Marshal!«
Cobb trat an die Tür und schaute in den Staub hinaus.
Der Schmied brachte die Frau des Marshals. »Sagen Sie es ihm, Madam. Erklären Sie ihm, wie wir das sehen!«
»James, ich bin entsetzt«, murmelte die bleiche Frau. »Sie werden vor allem dich als den Marshal dafür verantwortlich machen!«
»Natürlich, wen denn sonst!« Der Schmied lachte polternd auf. »Er vertritt schließlich das Gesetz. Wir waren nur dabei, um ihm behilflich zu sein.«
»James, das ist schlimm!«, rief die Frau.
»Geh nach Hause, Mattie.« Cobb drehte sich um, trat ins Office und schloss die Tür. Er setzte sich wieder hinter den Schreibtisch.
Schließlich tauchte der Barbier auf. »Willst du es nicht mit uns besprechen, Marshal!«
»Es wird nichts anders, wenn alle besoffen sind. Sagtest du nicht selbst, der Cowboy hätte keine Chance, seine Verletzung zu überleben?«
»Kann schon sein, dass ich es sagte, Marshal. Aber er lebte noch, als wir ihn mitnahmen. Und ich bin kein Arzt. Was ich gesagt habe, wird vor Gericht keine große Rolle spielen. Die jubeln das einfach hoch. Wenn der Richter was gegen uns hat, sind wir geliefert. Es wäre am Besten, wenn die Geschichte insgesamt nicht ruchbar wird.« Keach schaute in die Zelle. »Wenn die Burschen einfach weg sind.«
»Jay, wie findest du die?«, fragte Shayne, ohne sich umzuschauen.
»Aasgeier!«
»Aber mich lasst ihr ’raus!«, verlangte Zattig.
»Ja, dich lassen wir frei, Jewy. Das Geld kriegst du natürlich nicht. Und verschwinden wirst du ebenfalls. Benson holt schon ein Pferd für dich.«
»Bin ich noch der Marshal?«, wollte Cobb wissen.
»Nur, wenn du mit in den Saloon gehst und akzeptierst, was die Mehrheit von uns beschließt.«
»Du meinst, wenn ich das gesetzlose Spiel mitmache?«
»Wir müssen nach unseren eigenen Gesetzen leben, Cobb. Das ist in der Wildnis so.«
»Vielleicht spielt ihr das mit dem Verletzten viel zu hoch«, murmelte der Marshal. »Er überstand den Transport nicht, das war alles. Dafür können wir geradestehen.«
»Nein, nein, Cobb. Das legen die uns anders aus.«
Der Schreiner erschien mit einem gesattelten Pferd vor dem Store. »Was ist, Keach?«
»Der Marshal will nicht.«
Benson winkte über die Straße.
Die Männer kamen herüber. Ohne Eile schob sich einer nach dem anderen ins Office. Cobb trat hinter den Schreibtisch. »Was ihr tun wollt, ist ein Verbrechen!«
»Schließ auf!«
»Nein.«
Die Männer zogen die Colts und bedrohten den eigenen Marshal.
»Wir regeln das auf unsere Art«, erklärte der Barbier.
Vier Mann umgingen den Schreibtisch und drängten den Marshal mit vorgehaltenen Waffen in die Ecke. Keach holte den Schlüssel. Die anderen kamen ihm zu Hilfe und bedrohten nun ihrerseits Jay und Rio, während der Farmer freigelassen wurde.
Keach schloss die Zelle zu und zog den Schlüssel ab. Sie eskortierten Zattig hinaus.
»Das ist ja unglaublich«, sagte Rio. »Hier herrscht das Faustrecht, Jay!«
»Merkst du es auch schon?«
Der Marshal wurde immer noch von ein paar Männern bedroht, die sich aber inzwischen zurückzogen und das Office verließen.
Zattig saß auf dem Pferd und trieb es an. Kaum war er aus dem Blickfeld Jays verschwunden, brüllte der Schmied: »Halt, Zattig! Das geht so nicht!«
Der Reiter musste denken, sie wären anderen Sinnes geworden und wollten ihn erneut einsperren. Er schlug auf das Pferd ein und brüllte es an.
»Halt, oder wir schießen!«, rief Keach.
Der trommelnde Hufschlag verschluckte den Ruf.
Gewehre entluden sich. Ein Pferd wieherte. Das Knattern der Waffen erfüllte die Stadt.
Dann war es still.
»Das gibt es doch gar nicht«, sagte Rio. »Die sind ja wie Banditen. Marshal, sag mir, dass es so was nicht gibt!«
Cobb zog den Colt und verließ das Office. »Ihr seid alle verhaftet!«, rief er.
»Die haben den Mörder einfach abgeknallt«, sagte Rio, der es immer noch nicht fassen konnte.
»Auf der Flucht erschossen, werden sie sagen. Und aufgefordert, anzuhalten, wurde er wirklich.«
»Cobb, wirf den Colt weg!«, befahl der Barbier. »Ich habe dir gesagt, wir regeln es auf unsere Art.«
Der Stadt-Marshal trat zurück und hieb die Tür zu. Als die anderen heranstürmten, feuerte er durch das Fenster. Klirrend zerbarst die Scheibe. Scherben wurden auf die Straße geschleudert.
Cobb griff nach dem Schlüssel und schloss die Zelle auf. »Haut ab und seht zu, dass sie euch nicht schnappen!«
Jay trat an den Spind und fand ihre Waffen wie erwartet wieder darin. Er warf Rio den einen Patronengurt zu, schnallte den anderen um und griff nach zwei Gewehren.
»Cobb mach uns keinen Ärger. Das müssen wir gemeinsam durchstehen. Denk an unsere Existenz!«
Cobb feuerte über die Köpfe der Menge hinweg. Dreimal entlud sich der Colt.
Die Männer warfen sich draußen in den Sand und erwiderten das Feuer.
Aber sie zielten nicht zu hoch. Ihre Kugeln trafen die Tür und wimmerten durch das Fenster.
»James!«, schrie die Frau des Marshals irgendwo. »Ihr wollt ihn töten! Mörder!«
Cobb schoss seinen Revolver leer. Aber er zielte noch immer nicht auf die wildgewordenen Männer seiner Stadt, sondern über sie hinweg.
Sie dankten es ihm mit einem weiteren Kugelhagel.
Die Frau schrie etwas in das Dröhnen der Waffen hinein , aber es ging unter.
James Cobb zuckte getroffen zusammen und taumelte gegen die Wand.
»Weg hier!« Rio stürzte in die Kammer und hinten hinaus. Niemand stellte sich ihm in den Weg. Offenbar rechneten sie nicht damit, dass der Stadt-Marshal die Zelle aufgeschlossen haben könnte.
»Vorwärts!«, brüllte der Barbier, der inzwischen zum geistigen Führer der vermeintlich ums nackte Überleben kämpfenden Horde geworden war.
Mit Gebrüll, das ihnen selbst Mut zusprechen sollte, stürmten sie das Office. Jay verließ es gerade noch schnell genug hinten hinaus.
Der Marshal kniete, richtete die Waffe auf die Eindringlinge und drückte ab.
Barbier Keach wäre kaum noch dazu gekommen, sich aus dem Weg zu werfen, aber Cobbs Revolver gab nur ein Klicken von sich.
Keach stieß den Verletzten zur Seite. Stöhnend fiel Cobb um. Dann sah der Barbier die offenstehenden Türen in der Kammer und hinten aus dem Haus. »Die Schufte sind weg, Cobb rollte stöhnend auf den Rücken. Seine Jacke wies an der Hüfte einen Riss auf.
»Ihr habt ihn umgebracht!« Cobbs Frau verschaffte sich mit Ellenbogenstößen Zutritt zum Office und kniete neben dem Stadt-Marshal nieder.
Keach stürmte durch die Kammer.
Jay und Rio erreichten gerade das Buschwerk hinter dem Mietstallgelände.
»Da sind sie!« Keachs Revolver entlud sich.
Vom Stall schossen zwei Männer aus Gewehren.
»Das schaffen wir nicht!«, sagte Rio.
Jay feuerte hinter sich, repetierte das Gewehr und jagte die nächste Kugel in den Hof. Pochend wurde die Stalltür getroffen. Sie liefen hinter den Gebäuden weiter und drangen in den Store ein, weil dessen Tür einen Spalt offen stand. Rio verriegelte die Tür von innen.
Durch den schmalen Flur erreichten sie den Drugstore, der mit seinen Regalen und Warenstapeln mannigfaltige Deckung bot. Rio suchte nach Patronen. Im zweiten Regal wurde er fündig und stellte mehrere Kartons auf den Tresen.
Jemand warf sich gegen die Hintertür.
Jay schoss durch den Flur. Das Krachen rüttelte an den Wänden.
Ein zweiter Anprall ließ Riegel und Türbänder scheppern.
»Zur Straße!«, kommandierte Keach. »Die nageln wir fest.«
Jay lud seine Winchester nach und repetierte sie.
Hinter dem Haus wurde auf die Tür geschossen.
»Hört auf damit, hier ist alles sehr stabil!«, schimpfte Savage, der Besitzer des Drugstore. »Ross und Bruce, verschanzt euch und lasst sie hier nicht heraus!«
Schon erreichten die Leute die Straße. Als Rio sie sah, schoss er quer durch die Handlung. Jay unterstützte ihn dabei. Die große Fensterscheibe vor den Auslagen und die kleinere in der Tür wurden von den Kugeln zerrissen. Wie sturmgepeitschte Regenschauer flogen die Splitter zur Fahrbahn.
Pulverrauch hüllte die beiden Männer im Drugstore ein. Hinter dem Tresen und dem Rumfass daneben gingen sie in Deckung.
Draußen zog sich die Bande zur anderen Straßenseite zurück.
»Jetzt sitzen sie in der Mausefalle!«, frohlockte der Barbier.
»Und mein Geschäft geht dabei zum Teufel!«, jammerte Savage lauthals.
»Mach dir nichts daraus, Hiram, das kriegen die alles mit aufgebrummt. Die machen wir fertig!«
»Hörst du den?«, fragte Rio. »Die dichten eine ganz neue Geschichte zusammen!«
Jay feuerte mehrere Schüsse hinaus, was die Gegner dazu bewog, sich hinter die Ecken der gegenüberliegenden Häuser zu schieben.
Der penetrant stinkende Schwarzpulverdampf wallte durch den Store und zog träge zu den zerschossenen Fenstern hinaus.
Auf der anderen Straßenseite krachte ein Gewehr. Haarscharf pfiff Jay die Kugel am Kopf vorbei und zerfetzte eine Whiskyflasche im Regal hinter ihm. Scherben spritzten umher. Whisky lief vom Regalbrett. Jay schob sich weiter zur Seite.
Dann feuerten sie alle auf einmal.
Jay und Rio duckten sich hinter den Tresen. Die Wände, Regale und Kisten wurden getroffen. Ein Projektil prallte von einer Axt ab und pfiff als Querschläger fürchterlich quarrend durch den Store.
Jay richtete sich auf und jagte in rasender Folge mehrere Schüsse hinaus. Wer sich gerade aus der Deckung wagen wollte, zog sich augenblicklich zurück.
»Was soll das denn bedeuten?«, staunte Rio.
»Es war der erste Versuch, einen Sturm vorzubereiten.« Jay schob sich gegen die linke Regalwand. »Wir müssen aufpassen. Wenn sie erst mal hier drin stehen, sind wir erledigt!«
»Ich sehe überhaupt keinen Weg mehr, der uns aus dem Nest führen könnte.«
Jay Durango blickte über die Regale hinweg. Gebündeltes Presspulver und Lunten in Ringen lagen in einem langen Fach. Geduckt lief er hinüber und hinter das Regal, das ihn zur Straße hin deckte.
Rio feuerte, als ein Mann vor dem Haus gegenüber von einer Ecke zur anderen rannte. Die Kugel verfehlte die Gestalt jedoch. Klatschend traf sie die Wand.
Eine heftige Salve kam als Antwort zurück. Selbst hinter dem Regal musste Jay in die Hocke gehen, um unverletzt zu bleiben. Doch nach ein paar Sekunden brach das Knattern ab. Wie Polster schwebten draußen die Pulverdampfwolken über der Straße.
Jay richtete sich an einem Pfosten auf und sah eine unveränderte Lage. Mit einem im Regal liegenden Küchenmesser schnitt er eine kurze Lunte zu, verband sie mit einem Presspulverpäckchen, zündete sie an, wartete ein paar Sekunden und schleuderte sie danach durch das zerschossene Fenster.
Das Wurfgeschoss beschrieb einen Bogen über der Straße. Rauch und Funken markierten den Weg. Es schlug in den Sand, rollte noch ein kleines Stück und explodierte. Ein fürchterliches Krachen rüttelte an den Häusern. Die Druckwelle ließ Scheiben klirren und zerfetzte zwei im Haus gegenüber. Sand und Rauch standen wie eine Wand zwischen den beiden Straßenseiten.
Sofort fühlten sich die Männer der Stadt animiert, einen neuen Feuerüberfall zu starten.
Jay und Rio kauerten auf dem Boden. Jay hatte ein zweites Presspulverpäckchen und die Lunte mitgenommen und bastelte die nächste Ladung zusammen.
Rio lachte. »Wenn du etwas weiter wirfst, reißt es die Bude gegenüber auseinander!«
Das Gewehrfeuer flackerte ab.
»Achtung, die greifen an!«, schrie Rio erschrocken.
Durch Staub und Pulverdampf drangen die Männer jäh vorwärts und hätten Jay mit diesem Manöver glatt überrumpelt. Er sprang auf, feuerte von der Hüfte aus und hebelte das Gewehr so schnell er konnte durch.
Auch Rio schoss.
Der Drugstorebesitzer wurde getroffen und brach zusammen. Keach streifte eine Kugel am Bein, was ihn zu einem Luftsprung veranlasste. Die anderen kehrten bereits um und tauchten hinter den grauen und braunen Schwaden unter. Keach hastete hinterher. Savage kroch rückwärts, blieb dann jedoch in einer Radrinne liegen, wo sein Gesicht in den Sand schlug.
Jay hob das zweite Pulvergeschoss auf, brannte die Lunte an und warf es nach links hinaus. Es landete weit von dem Liegenden entfernt auf der Straße, rollte noch zwei Yard und explodierte mit einem neuerlichen Donnerschlag.
»Aufhören!«, brüllte jemand. »Die nehmen uns die ganze Stadt auseinander!«
Rio lachte aufgekratzt. »Das kann euch blühen!«, schrie er laut hinaus.
»Savage scheint tot zu sein«, sagte jemand.
»Ihr Schurken habt meinen Mann angeschossen!«, meldete sich Mattie Cobb. »Will sich der Barbier denn nicht endlich um ihn kümmern?«
»Das wird für die Leute langsam zum totalen Chaos«, stellte Jay fest. »Leider beschafft es uns keine Pferde.«
»Ein Glück, dass wir im Store sind«, erwiderte Rio.
»Warum?«
»Sieh dich doch um, was hier alles herumsteht. Lauter Dinge, die die Leute brauchen. In jedem anderen Haus würden sie uns vielleicht die Wände anzünden.«
»Ach so meinst du das.« Jay bastelte für alle Fälle eine weitere Sprengladung zusammen.
»Hört ihr mich, ihr zwei Lumpenhunde da drin?«, rief der Barbier. »Wir haben beschlossen, euch verschwinden zu lassen.«
Rio schaute fragend zu Jay herüber. »Was ist das für ein neuer Trick?«
»Woher soll ich das wissen.« Jay blickte in die Wolke aus Rauch und Staub hinaus. Keiner der Männer ließ sich darin sehen.
»Habt ihr verstanden?«
Rio tastete sich an der Wand entlang nach vorn. »In Ordnung, bringt die Pferde. Dann werden wir sehen, was ihr vorhabt.«
»Ihr könnt abhauen. Es geht nicht, dass unsere ganze Stadt in die Luft fliegt. Also, wir bringen die Pferde gleich. Schießt nicht auf den Mann, der sie vor den Store stellt.«
Rio schaute zu Jay herüber. Der Vormann zuckte mit den Schultern.
»Ich hab keine Ahnung, was die bezwecken, Rio. Aber dass sie plötzlich so große Angst um ihre Häuser haben sollen, kann ich auch nicht glauben.«
»Da steckt eine größere Gemeinheit dahinter. Bestimmt hoffen sie, uns leicht abknallen zu können, wenn wir die Deckung verlassen!«
»Mal abwarten.«
*
Der Stallmann sah ängstlich aus und versuchte, neben den Pferden zu gehen, um sie als Deckung zu benutzen. Vor dem Store ließ er die Zügel los und hastete zur anderen Seite.
Staub und Qualm waren weitgehend abgezogen. Die lauernden Männer an den Hausecken verrieten sich durch die Gewehre, deren Läufe in der Sonne schimmerten.
»Worauf wartet ihr noch?«, rief der Barbier. Er stand im Haus gegenüber im Dunkel hinter der gesprengten Fensterscheibe.
»Denkt ihr, wir hätten Stroh in den Köpfen?«, rief Rio.
»Was wollt ihr denn noch? Schwingt euch auf die Gäule und haut ab!«
»Kämen wir denn bis in die Sättel?«, fragte Jay laut. »Oder wollt ihr uns nur aus dem Store locken?«
»Die trauen uns nicht«, sagte der Schmied. »Weil wir hier herumstehen und sie abputzen könnten. Vielleicht sollten wir uns zum anderen Stadtende zurückziehen.«
»Also gut«, erwiderte Keach so laut, dass Jay und Rio ihn wieder verstanden.
Die ersten Gewehrläufe verschwanden von den Ecken. Auch der Mann im Haus gegenüber zog sich zurück und schien das Anwesen hinten hinaus zu verlassen. Der Schmied und der Schreiner tauchten am übernächsten Gebäude auf und gingen rückwärts die Straße hinunter.
»Die können mir doch nicht weismachen, dass es auf einmal so billig abgehen soll!« schimpfte Rio.
Jay verfolgte das Rückzugsmanöver ebenfalls mit äußerstem Misstrauen. Doch es gab schließlich keinen Zweifel, dass mindestens der weitaus größte Teil der Männer diese Stadthälfte verließ, denn sie waren zu sehen, als sie sich im Westen sammelten.
Das Gebiet um den Store wirkte bis zum Saloon verlassen. Nur der Tote lag draußen im Straßenstaub, und die beiden Pferde standen vor dem Drugstore. Die Frau des Marshals schimpfte, weil sich noch immer niemand um Cobb kümmerte. Aus dem Saloon trat ein alter, gebeugter Mann und sagte: »Sie sind alle weg.«
Jay blickte auf die Pferde. Es handelte sich um ihre eigenen Tiere und Sättel. Die Gurte sahen festgeschnallt aus. Nichts deutete auf eine Unregelmäßigkeit hin, die eine rasche Flucht beeinträchtigen könnte.
Rio wagte sich auf der einen, Jay auf der anderen Seite bis dicht an die vordere Wand.
»Klemmt euch die Gäule zwischen die Beine und haut ab!«, rief der alte Mami. »Wir wollen euch vergessen!«
Jay stieg in die Auslagen des Fensters. Sein Blick glitt an den Hausfronten entlang nach Westen, zurück und neuerdings nach Westen.
Rio erreichte die Tür, das Gewehr an der Hüfte angeschlagen und jede Sekunde bereit, zu schießen.
Nichts rührte sich, kein Gewehrlauf schob sich vor. Nur der alte, gebeugte, aber unbewaffnete Mann beim Saloon stand noch da. Selbst wenn er einen verborgenen Revolver bei sich führte, mussten sie ihn nicht fürchten. Er stand zu weit entfernt.
»Irgend etwas ist faul«, murmelte Rio. »Auch wenn wirklich kein Schütze in der Nähe lauert.
Jay trat weiter vor und stieg auf den Fußweg. Das Hemd klebte ihm zwischen den Schulterblättern auf der Haut. Auch über das Gesicht und den Hals lief ihm der Schweiß.
Rio trat heraus und schaute sich auf dieser Seite um. »Nichts. Keiner da. Hast du jetzt eine Erklärung dafür?«
»Nein.« Jay ging bis zur Fußwegkante weiter und stieg die beiden Stufen hinunter.
Nicht weit entfernt lag der Leichnam des Farmers am Straßenrand. Sie konnten ihn erst jetzt sehen.
Jay erreichte den braunen Hengst und griff mit der linken Hand nach dem schleifenden Zügel. Rio trat zwischen die Tiere.
»Ist dein Sattel wirklich fest, Rio?« Jay musste danach fragen, weil er das zweite Tier vorher so genau nicht sehen konnte.
»Ja.«
»Dann los!«
Sie schwangen sich in die Sättel und trieben die beiden Pferde an. Die Hufe trommelten auf den harten Sandboden und warfen neue Staubfontänen in die Höhe.
Kein einziger Schuss wurde hinter ihnen abgefeuert. Unbehelligt galoppierten sie aus der Stadt.
*
Um den Barbier standen die Männer. Keach grinste. Ein paar begannen zu lachen.
»Die hauen wir in die Pfanne«, sagte der Barbier. »Das wird uns ein bisschen Mühe kosten, ist aber nötig.«
Die aufwirbelnde Staubwand verschluckte die beiden Reiter.
»Schnell, satteln wir die Pferde!«
Sie liefen gemeinsam zum Mietstall.
Mattie Cobb tauchte im Hof auf, als Keach als erster die Baracke verließ.
»Mörder!«, rief die Frau. »Ihr habt den Storebesitzer auf dem Gewissen.«
»Wir sind alle erwachsene Leute und wissen, was wir zu tun haben!«, stieß Keach barsch hervor.
»James liegt im Office in seinem Blut!«, herrschte die Frau ihn mit blitzenden Augen an. »Ihr habt ihn niedergeschossen.«
»Er muss von allen guten Geistern verlassen sein, unsere Existenz, vielleicht unser Leben zu gefährden.«
»Genau!« schimpfte der Schmied, der sich schon in den Sättel schwang. »Den Denkzettel hat er nötig gehabt. Und sagen Sie ihm gleich, dass wir einen anderen zum Marshal machen, wenn wir zurückkehren. Der Stadt-Marshal hat unsere Interessen zu vertreten. Nur unsere Interessen.«
»James vertritt das Gesetz, hat er eben noch zu mir gesagt.«
»Hier ist Gesetz, was uns dient!«, brüllte Keach die bleiche Frau an. Er saß ebenfalls auf und sprengte an Mattie Cobb vorbei, bevor sie ihm in den Zügel fallen konnte.
Hilflos stand die Frau auf der Straße. Rechts und links an ihr galoppierte die Meute vorbei. Staub hüllte sie ein.
Erst als die Reiter die Stadt hinter sich ließen, wagten einige Frauen, den Kopf aus den Häusern zu strecken. Die erste trat heraus, kam auf die Straße und umarmte die konfuse Mattie Cobb. »Lass uns nach dem Marshal sehen, Mattie.«
»Er verliert sehr viel Blut!«
»Das bringen wir schon hin, Mattie.«
Noch ein paar Frauen traten hinzu, machten der Frau des Stadtmarshals Mut und gingen mit ihr zum Office hinauf.
Cobb lag in der Tat in seinem Blut, aber die Verletzung erwies sich als nicht sehr schlimm. Nur der Schmerz peinigte ihn sehr.
Fachkundig untersuchte die Frau des Schreiners Cobb und sagte: »Wir werden die Wunde auswaschen, mit Salbe bestreichen und verbinden. In ein paar Wochen spüren Sie kaum noch etwas davon, Mister Cobb.«
»Savage ist übler dran«, ließ eine andere Frau wissen. »Den werden wir beerdigen.«
»Die Cowboys sind unschuldig!«, stieß der Stadt-Marshal hervor.
Kalte Abweisung trat auf die Züge der Frauen.
»Ist es euch wirklich so egal?«
»Wir müssen an unsere Kinder denken«, sagte die Frau des Schreiners kühl. »Ihre Zukunft können wir nicht hinter die von zwei dahergelaufenen Tramps stellen.«
»So ist es!«, stimmte die Frau des Schmieds zu.
Und alle anderen nickten.
»Dafür wird euch alle der Teufel holen!«, stieß der Marshal gepresst hervor. »So etwas geht nicht gut. Wenn die Cowboys ihre Ranch erreichen, geht es euch schlecht.«
»Ihre Ranch?«, fragte die Frau des Schmieds.
»Ja, ihre Ranch.«
Die Frauen wechselten verstörte Blicke.
»Das sind keine Tramps, um die sich kein Mensch kümmert. Das dachten nur wir. Es sind Cowboys von einer großen Ranch im Osten.«
»Dann machen die Männer vielleicht einen Riesenfehler«, flüsterte Madam Watson aus der Schmiede. »Die gehen doch davon aus, dass es dahergelaufene Halunken sind.«
»Mein Gott, steh uns bei!« Die Frau des Schreiners faltete die Hände und schaute zur Decke. »Es ist doch nur wegen der Kinder. Was können die armen Kleinen dafür!«
*
Jay zügelte sein Pferd und schaute zurück.
»Was ist los?« Rio hielt ebenfalls an, wandte sich um und stellte sich in den Steigbügeln.
Jay meinte unter der Sonne im Westen dünne Staubschleier zu erkennen. »Sie sind hinter uns her.«
Rio lenkte das Pferd herum.
Von Sekunde zu Sekunde ließ sich der Staub deutlicher erkennen. Schon hörten sie Hufschlag.
»Aber warum das?«
»Vielleicht, um hier zu erledigen, was sie in ihrer Stadt nicht zuwege brachten.«
»Glaubst du das wirklich?«
»Es ist jedenfalls eine Erklärung für alles. Keine gute, weil wir schnelle Pferde besitzen. Aber jedenfalls eine Erklärung.«
Das Trommeln der Hufe schwoll an.
»Weiter!« Jay gab seinem Pferd die Sporen.
Sie sprengten weiter nach Osten, aber die Verfolger blieben ihnen auf den Fersen.
Am Abend erreichten sie die Ausläufer der Brasada. Von einer Hügelkuppe aus sahen sie den Pulk. Trotz der großen Entfernung jagten ihnen die Männer aus Montrose ein paar Kugeln nach.
»Die wollen, dass wir reiten, bis die Pferde umfallen«, vermutete Rio.
»Das ginge ihnen kaum besser.« Jay schaute noch auf die Verfolger, dachte aber an den weiten Weg, der bis zur Ranch noch vor ihnen lag. Ohne Rast würden die Pferde sie dahin nicht tragen können.
»Hast du noch was zu essen in der Satteltasche? «
Jay öffnete die Tasche und zog einen schmutzigen Lappen von roter Farbe heraus.
»Was ist denn das?«, staunte Rio. »Gehört der dir?«
»Nein.« Jay warf den Lappen weg und zog weitere aus der Tasche, die er hinter dem ersten herwarf.
Die Verfolger schossen wieder. Eine Kugel pfiff hörbar vorbei.
»Die wollen uns auf Trab halten«, sagte Rio. »Was das heißen soll, weiß der Teufel.«
Jay zog eine Silbermünze aus der Satteltasche.
Rio beugte sich herüber. »Was ist denn das?«
Jay schaute in die Tasche und sah, dass die nun freigelegte untere Hälfte damit ausgefüllt war. »Die Beute. Jetzt begreife ich das Spiel.«
Rio lenkte sein Pferd dichter heran, um den Inhalt der Tasche auch sehen zu können.
»Die stellen uns irgendwo wie Banditen, die McClure überfielen. Mit der Beute. Und das kann so gut wie in der Wildnis auf einer Farm, einer Ranch oder auch in einer Stadt sein.«
»Vorausgesetzt, wir hätten da nicht gute Bekannte, die uns so ein Verbrechen nicht zutrauen, was?«
»Dass wir von einer Ranch kommen, nahmen die uns nicht ab und haben sie vielleicht auch längst wieder aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Die halten uns für Satteltramps.« Jay überlegte. »Bis San Angelo müssten es die Pferde durchhalten.«
»Und weiter?«
»Dort kennen wir die Leute und den Marshal und könnten den Spieß umdrehen. Damit rechnen die ja nicht. Sie glauben, wenn wir in einer Stadt von ihnen gestellt würden, machen alle Leute mit gegen uns. Ein paar gezielte Schüsse, dann gilt nur noch, was diese Halunken erzählen. Und alles wäre erledigt!«
Die Verfolger schossen wieder.
Jay warf das Silbergeld in die Tasche, sprang ab, hob die Lappen auf und steckte sie. ebenfalls in die Tasche. Er saß auf. »Dann mal los. Mitternacht könnten wir dort sein!«
Sie galoppierten über die Hügelkuppe hinweg und schlugen die neue Richtung nach Südosten ein.
*
Marshal Tate Clayburn zwirbelte seinen Schnurrbart, wischte über den Weißblechstern an der Jacke und verließ den Schutz des Vordaches.
Barbier Keach aus Montrose hob die Hand und zügelte sein Pferd. Im Schritt näherte er sich mit seinen Leuten der Stadtmitte. Er grinste erfreut, weil er die beiden gesattelten Pferde vor dem Saloon sah. Im Haus brannte Licht. Die anderen Hütten lagen in tiefer Dunkelheit im silbernen Mondschein.
»Hallo«, sagte der Marshal.
Die Reiter hielten bei ihm an.
»Wir sind hinter zwei Banditen her«, erklärte Keach. »Aufgebot aus Montrose.«
»Banditen?«
»Kann man wohl sagen.« Keach schaute zu den Pferden hinüber. »Die ermordeten einen fahrenden Händler und brachten achttausend Dollar Silbergeld an sich. Zwei Satteltramps. Hergelaufene Halunken. Ein Mann von uns wurde auch noch umgebracht, als wir sie in Montrose stellen wollten. Sie werden uns sicher Amtshilfe leisten, Marshal?«
Türen öffneten sich vor und hinter den Reitern. Männer mit Gewehren in den Händen betraten die Straße. Die Gewehre wurden repetiert und zielten auf die Leute aus der anderen Stadt. Und aus dem Saloon kamen Jay und Rio, ebenfalls mit Gewehren bewaffnet, die auf die Reiter zielten.
»Sind das die Kerle, Durango?«, fragte der Marshal.
Keach zog den Kopf ein. Der Schmied fluchte.
»Ja, Marshal. Das sind die Kerle, die ihren eigenen Marshal niederstreckten. Und das alles nur, damit nie jemand erfahren sollte, wie unser Cowboy Jeff Logan zu Tode kam.«
»Das sind Banditen!«, stieß Keach mit schriller Stimme hervor.
Marshal Clayburn trat zurück. »Jay Durango ist der Vormann von Rancho Bravo, Mister. Dürfte schwer sein, seinen Boss Tom Calhoun davon überzeugen zu wollen, dass er ein Mörder und Wegelagerer ist.«
Jemand lachte hinter den Reitern.
»Aber das werden wir natürlich alles gerichtlich klären. Morgen verständigen wir den US-Marshal und das Distriktsgericht. Bis zu Ihrem Prozess muss ich Sie bitten, mit meinem Jail Vorlieb zu nehmen.«
»Zur Hölle, wir haben uns selbst eine Falle gestellt!«, brüllte der Schmied.
Keach trieb sein Pferd an.
Jay ließ sein Gewehr fallen, sprang vom Fußweg, erreichte den Reiter noch, sprang an dem Pferd empor und riss Keach aus dem Sattel. Das Tier galoppierte weiter. Keach und Jay landeten im Staub, rollten durch den Sand und sprangen gleichzeitig auf. Jay nahm genau Maß und legte alle seine Kraft in den Schlag, der Keach gegen die Stirn traf.
Wie ein vom Sturm entwurzelter Baum fiel der Barbier aus Montrose um.
»Keiner bewegt sich!«, befahl Marshal Clayburn den Reitern. »Hände hoch und einer nach dem anderen absteigen. Euch werden wir schon zeigen, dass das Gesetz das Papier wert ist, auf dem es geschrieben steht!«
Keachs wilde Horde gehorchte. So wie sie abstiegen, wurden sie entwaffnet und vom Marshal eingesperrt.
Keach bewegte sich, rollte auf den Rücken und sah Jay groß wie einen Riesen über sich.
»Hallo, Mister Keach«, sagte Durango schleppend. »Ihre Freunde warten schon im Jail auf Sie!« Er bückte sich, packte den schurkischen Barbier und zog ihn auf die Füße. »Das hattet ihr euch ein bisschen falsch ausgedacht.«
»Der verletzte Cowboy wäre sowieso gestorben!«
»Ja, das ist gut möglich. Aber darum wird es nun höchstens noch am Rande gehen.«
ENDE