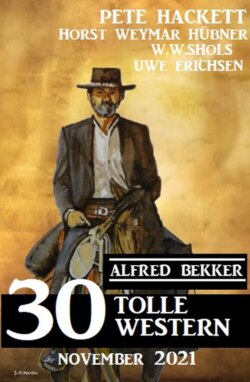Читать книгу 30 tolle Western November 2021 - Pete Hackett - Страница 54
Band 106 Marshal Logan und der Trail des Verderbens
ОглавлениеU.S. Deputy Marshal Wayne Garfield verhielt auf dem Kamm einer Bodenwelle seinen Braunen und ließ seinen Blick schweifen. Das Land vor ihm lag im Sonnenglast. Kniehohes Gras bewegte sich im heißen Südwind. Der Wind brachte auch den feinen Staub des Llano Estacado mit sich, der alles puderte.
Garfield befand sich auf der alten Poststraße, die nach Vega und von dort aus nach Amarillo führte. Die Strapazen eines langen Ritts standen ihm ins eingefallene, stoppelbärtige Gesicht geschrieben. Seine Augen waren entzündet, die Lider gerötet. Staub und Schweiß verklebten seine Poren. Staub war auch unter seiner Kleidung gekrochen und hatte an bestimmten Stellen seine Haut wundgescheuert. Die Hitze setzte Mensch und Tier zu.
Von den beiden Banditen, denen Garfield folgte, war weit und breit nichts zu sehen ...
Das Pferd trat auf der Stelle, schnaubte und peitschte mit dem Schweif. Vor Garfield lag das gewundene Band der von Radspuren zerfurchten und von Pferdehufen aufgewühlten Poststraße. Hier und dort wuchs ein Busch. Der Marshal hakte die Wasserflasche vom Sattel, schraubte sie auf und trank einen Schluck von dem brackigen Wasser. Dann schüttete er etwas von dem Wasser in die Krone seines Hutes und ließ das Pferd saufen.
Garfield ritt weiter. Die Hufe pochten dumpf und rissen kleine Staubfontänen in die heiße Luft. Die Sonne stand wie eine zerfließende Scheibe aus Weißgold am Südhimmel. Die Konturen der Hügel ringsum verschwammen. Die Wildnis mutete wie ausgestorben an. Auf den Hügelkuppen erhoben sich hier und dort ruinenartige Felsen.
Seit fast einer Woche war Garfield unterwegs. Die beiden Banditen, denen er folgte, hießen Lee Warner und Dave Halleran. Sie waren Mörder. In New Mexiko waren auf jeden von ihnen fünfhundert Dollar ausgesetzt; tot oder lebendig.
Garfield wusste, dass sein Stern in Texas nichts galt. Dennoch hatte er die Grenze überschritten. Er hatte sich fest vorgenommen, die beiden Outlaws zu stellen und nach New Mexico zurückzubringen, wo auf sie der Henker wartete.
Meile um Meile zog der Marshal dahin. Dann schälten sich die Häuser einer Stadt aus dem Sonnenglast. Der Wind trieb Staubfahnen über die Dächer. Bald zog Garfield zwischen die ersten Häuser. Sie waren wie die Perlen an einer Schnur zu beiden Seiten der Straße errichtet, die auch die Main Street bildete. Das verwitterte Ortsschild hatte Garfield verraten, dass er Vega erreicht hatte. Einige Passanten waren zu sehen. Die meisten Menschen befanden sich in der Kühle ihrer Behausungen. In einer Gassenmündung spielten vier Kinder. Hunde lagen in den Schatten und dösten.
Garfield ritt mitten auf der Main Street. Das Pferd ging mit hängendem Kopf und zog müde die Hufe durch den Staub. Beim Saloon standen zwei verstaubte und verschwitzte Pferde am Holm. Ein entschlossener Zug kerbte sich in Garfields Mundwinkel. Er hatte Warner und Halleran eingeholt. Die Jagd war zu Ende.
Garfield hielt auf einen hohen Schuppen zu, auf dessen Giebelseite mit großen Lettern die beiden Worte Livery Stable gepinselt waren. Er durchritt das breite Galgentor, hielt vor dem Stalltor an und saß ab. Über die Schattengrenze unter dem Stalltor schritt der Stallmann, ein bärtiger Oldtimer, dessen Kiefer sich bewegten, als kaute er etwas.
»Hallo, Stall«, grüßte Garfield und zog die Winchester aus dem Scabbard.
Der Stallmann spuckte einen Strahl Tabaksaft zur Seite aus und sagte: »Sie tragen einen Stern, und an Ihnen klebt der Staub der Felsenwüste. Vor einer Stunde kamen zwei Kerle hier an, die ähnlich mitgenommen aussahen. Sind Sie hinter den beiden her?«
Garfield nickte. Er war ein wortkarger Mann. »Versorgen Sie das Pferd und reiben Sie es gut ab. Wahrscheinlich bleibe ich die Nacht über in der Stadt.«
Der Stallbursche nickte. »Es sind zweibeinige Wölfe, Marshal. Ich sah sie vorbeireiten. Sie sollten die beiden nicht auf die leichte Schulter nehmen.«
»Das tue ich ganz sicher nicht.« Garfield hebelte eine Patrone in die Kammer der Winchester. Einen Sekundenbruchteil lang stand das metallische Geräusch des Durchladens in der Luft. Dann schwang der Marshal herum und setzte sich in Bewegung. Staub rieselte von seinen Schultern. Leise klirrten seine Sporen.
Als ihn noch zwanzig Schritte vom Saloon trennten, trat ein hochgewachsener Mann auf den Vorbau. Der obere Teil seines Gesichts lag im Schatten der Hutkrempe. Seine Augen glitzerten. Er war mit einem langen Staubmantel bekleidet und hielt sein Gewehr mit beiden Händen schräg vor der Brust. Beim Geländer hielt er an. Seine Kiefer mahlten. Von ihm ging eine stumme, aber absolut tödliche Drohung aus.
Garfield hatte angehalten. Sein Blick saugte sich an dem Burschen auf dem Vorbau fest. Er kannte das Gesicht vom Steckbrief. Es war Lee Warner. Unwillkürlich schaute der Marshal nach links, dann nach rechts, und da erklang es auch schon hinter ihm: »Du hast also nicht aufgegeben, Sternschlepper!« Die Stimme klang heiser.
Garfields Schultern strafften sich. Jähe Anspannung ergriff von ihm Besitz. Schlagartig war er hellwach. Stille folgte den Worten des Banditen. Die Atmosphäre schien plötzlich vor Spannung zu knistern wie vor einem schweren Gewitter.
Völlig überraschend schlug Garfield das Gewehr auf Warner an. Den Kolben hatte er sich unter die Achsel geklemmt. Sein Zeigefinger lag um den Abzug. »Wenn dein Kumpan schießt, werde ich noch genug Zeit finden, um abzudrücken, Warner. Lass das Gewehr fallen.«
»Ich glaube, du verkennst etwas, Sternschlepper«, versetzte Lee Warner mit schleppender Stimme. Er tauchte unter dem Geländer hindurch und sprang auf die Straße.
Hinter Garfield erklang kehliges Lachen.
Der Marshal handelte. Er schoss auf Warner und wirbelte herum. Doch Warner hatte sich in dem Moment, als Garfield abdrückte, bewegt. Die Kugel verfehlte ihn. Schüsse peitschten. Die Detonationen verschmolzen ineinander und stießen durch die Stadt wie eine Botschaft aus der Hölle. Dann schwiegen die Waffen. Der letzte Knall verhallte zwischen den Gebäuden. Pulverdampf verwehte.
Garfield lag im Straßenstaub. Die beiden Banditen gingen auf ihn zu. Der Staub knirschte unter ihren Sohlen. Die Gesichter zeigten nicht die geringste Regung. Die Augen blickten kalt und hart. Bei Garfield hielten sie an. Halleran schob seinen Fuß unter die reglose Gestalt und drehte sie auf den Rücken. Das Hemd über der Brust des Marshals saugte sich voll Blut. Garfields Lider zuckten. Die dünne Schicht aus Staub und Schweiß in seinem Gesicht war gebrochen.
»Der braucht nichts mehr«, kam es mitleidlos von Warner.
»Verschwinden wir«, knurrte Dave Halleran und ließ seinen Blick in die Runde schweifen. Die wenigen Passanten, die die Straße und die Gehsteige bevölkerten, waren stehengeblieben und starrten auf die beiden Banditen.
Sie gingen zu ihren Pferden, banden sie los und saßen auf. Sattelleder knarrte, die Gebissketten klirrten leise. Eines der Pferde wieherte. Sie trieben die Tiere an und verließen im Trab die Stadt.
*
Es klopfte an die Tür. Sheriff Duncan O'Leary blickte von der Kladde auf, in die er soeben Eintragungen machte und rief: »Herein.«
Die Tür wurde geöffnet, ein Mann betrat das Office. Er hielt seinen Stetson in den Händen. Seine Haare waren graumeliert. Er murmelte einen Gruß und sagte: »Guten Tag, Sheriff. Mein Name ist John Malcolm. Ich bin heute mit zwei Fuhrwerken in Amarillo angekommen. Auf den Fuhrwerken befinden sich Waffen und Munition für Fort Cobb im Indianer-Territorium.«
»Nehmen Sie Platz« sagte O'Leary und legte den Federhalter zur Seite. Und als Malcolm saß, fragte er: »Was führt Sie zu mir?«
»Wir sind zu sechst. Und bis jetzt hatten wir kein Problem. Aber für den Rest des Weges nach Fort Cobb brauchen wir unbedingt einen Führer, einen Scout, der sich im Indianerland auskennt. Kennen Sie so einen Mann, Sheriff. Ich wäre bereit, hundert Dollar zu bezahlen.«
O'Leary nagte an seiner Unterlippe und dachte nach. Dann nickte er und sagte: »Ja, ich glaube, ich kenne einen Mann, der sie führen kann. Ich spreche mit ihm. Wo stehen die Fuhrwerke?«
»Im Hof des Mietstalles an der Straße nach Vega. Wir möchten so bald wie möglich aufbrechen. Vielleicht kann sich der Mann noch heute bei mir vorstellen.«
»Ich spreche mit ihm.«
Malcolm erhob sich und sagte: »Vielen Dank, Sheriff. Schicken Sie ihn zu mir.«
John Malcolm verließ das Office. Es war die Zeit des Sonnenuntergangs. Die Schatten wuchsen schnell über die heiße Fahrbahn und stießen gegen die Häuser auf der anderen Straßenseite. Von irgendwo her erklangen helle Hammerschläge. Ein Hund bellte.
Die Schritte des Wagenbosses riefen auf den Gehsteigbohlen ein dumpfes Echo wach. Er bog in eine Seitenstraße ab und erreichte schließlich den Mietstall. Zwei Reiter näherten sich von Westen. Die Reitergestalten warfen lange Schatten voraus. Die Sonne schien auf dem hügeligen Horizont zu stehen. Es war noch immer heiß. Aber die Konturen der Häuser und Hügel waren scharf und klar.
Malcolm ging in den Wagen- und Abstellhof des Mietstalles. Am Rand des Hofes standen die beiden Conestoga-Schoner. Die fünf Männer, die mit Malcolm gekommen waren, lungerten herum und rauchten. Es waren bärtige Burschen und jeder von ihnen hatte einen Revolvergurt umgeschnallt. Gewiss eine scharfäugige und hartbeinige Mannschaft.
»Und?«, fragte einer.
»Der Sheriff kennt einen Mann, der in Frage kommt«, sagte Malcolm. »Er wird ihn uns schicken. Warten wir ab.«
Die beiden Reiter lenkten ihre Pferde in den Hof. Die sechs Burschen bei den beiden Fuhrwerken beobachteten sie. Lee Warner tippte an die Krempe seines Hutes. Beim Tor saßen die beiden ab und führten die Pferde hinein. Stallgeruch stieg ihnen in die Nasen. Der Stallmann saß auf einer Futterkiste und fettete seine Stiefel ein. Jetzt erhob er sich.
Lee Warner fragte: »Was sind das für Leute im Hof? Auswanderer?«
Der Stallmann übernahm die Zügel des Pferdes. »Nein. Sie befördern Waffen und Munition nach Fort Cobb im Indianerland und suchen einen Scout. Der Wagenboss heißt John Malcolm.«
Die beiden Banditen schnallten ihre Satteltaschen los, legten sie sich über die Schulter und angelten die Gewehre aus den Scabbards. »Wir bleiben die Nacht über in der Stadt«, erklärte Warner. »Wo kann man hier billig schlafen?«
»Im Boardinghouse. Sie finden es an der Front Street.«
Sattelsteif gingen Warner und Halleran aus dem Stall, in dem es schon ziemlich düster war. Sie gingen zu den Männern hin, die mit den Fuhrwerken gekommen waren. Beim Gehen schlugen die Schöße der zerschlissenen Staubmäntel gegen ihre Beine. »Wir suchen John Malcolm«, gab Warner zu verstehen.
»Das bin ich.« Malcolm fixierte die beiden Banditen. Sie sahen heruntergekommen aus. »Sie scheinen einen harten Ritt hinter sich zu haben.«
»Wir kommen von New Mex herüber«, antwortete Warner. »Die Felswüste war die Hölle. Sie suchen erfahrene Scouts für den Weg nach Fort Cobb?«
»Das ist richtig.«
»Auch wir wollen ins Indianerland. Was dagegen, wenn wir uns Ihnen anschließen?«
»Wir werden morgen Früh aufbrechen.«
»Mein Gefährte ist ein erfahrener Spurenleser. Wir haben beide Erfahrung mit den Apachen gesammelt. Ich glaube, wir wären die richtigen Männer für Sie.«
Malcolm schaute skeptisch drein. »Die Cheyenne und Comanchen sind anders als die Apachen.«
»Mag sein. Dennoch bin ich sicher, dass wir Sie nach Fort Cobb führen können.«
Malcolm kniff die Augen leicht zusammen. »Niemand begibt sich freiwillig ins Indianerland. Werden Sie vom Gesetz gesucht?«
Warner lachte auf. »Nein. Wir wollen nach Fort Smith. Und der kürzeste Weg ist durchs Territorium. Wie ich schon sagte: Wir bringen einiges an Erfahrung mit.«
»Ich überlege es mir«, versprach Malcolm.
Die beiden Banditen wandten sich ab und verließen den Hof. Die Sonne ging unter. Der Himmel im Westen erglühte in einem intensiven Rot. Wolkenbänke hatten sich vor den Sonnenuntergang geschoben. Von Osten her wurde es grau. Die Männer, die die beiden Fuhrwerke nach Fort Cobb bringen wollten, zündeten ein Feuer an und einer stellte ein eisernes Dreibein auf, von dem ein Kessel hing. Sie kochten sich ihr Abendessen selbst. Das Holz knackte in der Hitze. Funken sprühten. Die Dunkelheit nahm zu. Es gab Eintopf, in das der Koch gepökeltes Fleisch geschnitten hatte. Die Fuhrwerker saßen auf Kisten oder auf den Deichseln der Fuhrwerke und löffelten den Pampf aus Gemüse und Fleisch. Licht- und Schattenreflexe huschten über sie hinweg.
Sheriff Duncan O'Leary kam und trat in den Feuerschein. Er heftete den Blick auf John Malcolm und sagte: »Ich hatte Pech, Malcolm. Der Mann, der sie führen sollte, hat sich ein Bein gebrochen. Sie werden sich selbst nach einem Scout umsehen müssen. Versuchen Sie's in den Saloons. Es tut mir leid.«
Malcolm stocherte in seinem Essen herum. »Machen Sie sich keine Gedanken, Sheriff. Vorhin kamen zwei Kerle hier an. Sie boten sich an, uns zu führen. Nun werden wir wohl ihre Dienste in Anspruch nehmen müssen.«
»Dann hat sich das Problem ja von selbst erledigt«, versetzte O'Leary. »Ich wünsche Ihnen eine gute Reise.«
»Danke, Sheriff.«
O'Leary schwang herum und schritt mit ausholenden Schritten davon.
Steve Sanders, einer der Fuhrwerker, wandte sich an Malcolm. »Mir gefallen die beiden nicht. Sie sehen aus wie Sattelstrolche.«
»So sehen Männer eben aus, die tagelang im Sattel gesessen haben«, antwortete Malcolm. »Nach drei Tagen im Indianerland werden wir auch nicht besser aussehen.«
Eine knappe Stunde später kamen Warner und Halleran. »Haben Sie es sich überlegt?«, fragte Warner.
»Wir nehmen Ihr Angebot an«, erwiderte Malcolm. »Wenn der Morgen graut, brechen wir auf. Ist das in Ordnung?«
»Wir werden da sein.«
*
Joe und ich kamen von einem Einsatz im Norden des Panhandle zurück. Wir brachten zwei Banditen in die Stadt, die wir am Canadian gestellt hatten. Vor dem Sheriff's Office zügelten wir die Pferde und saßen ab. Auch die beiden Gefangenen mussten absteigen. Wir hatten ihnen die Hände gefesselt. Ich wies mit dem Kinn zur Tür. »Dort hinein.«
Die beiden setzten sich in Bewegung. Es waren heruntergekommene Gestalten, in deren Gesichter Niedertracht und Verworfenheit geschrieben stand. Ich dirigierte sie in das Büro von O'Leary. Der Sheriff saß hinter seinem Schreibtisch. Sein grauer Wolfhund lag neben dem Schreibtisch am Boden. Im Raum war es düster. Das Messingpendel der Uhr an der Wand schlug rhythmisch hin und her. Joe betrat hinter mir das Büro. »Hallo, Duncan«, grüßte ich. Wolf, der graue Hund, erhob sich und kam heran. Ich kraulte ihn zwischen den Ohren. Das Tier fiept leise.
»Hi, Logan. Die beiden Galgenvogelgesichter kommen mir bekannt vor.«
»Dunhill und Sheppard. Sperr sie ein. Wir haben sie am Canadian erwischt, als sie ein gestohlenes Maverick zerlegten. Aber das gestohlene Rind fällt wohl kaum ins Gewicht bei den Verbrechen, die den beiden zum Vorwurf gemacht werden.«
»Ihr sorgt dafür, dass mein Gefängnis nicht leer wird«, knurrte O'Leary. Früher einmal ritt er für das Bezirksgericht als Deputy Marshal. Dann kandidierte er für das Sheriffsamt und wurde gewählt.
Wir halfen O'Leary, die beiden Banditen hinter Schloss und Riegel zu bringen. O'Leary sagte: »Heute brachten einige Männer aus Vega einen U.S. Deputy Marshal aus New Mex nach Amarillo zum Arzt. Zwei steckbrieflich gesuchte Banditen haben ihn in Vega niedergeknallt. Die beiden waren auch in Amarillo. Sie haben sich als Scouts verdingt und führen zwei Fuhrwerke, die Waffen und Munition geladen haben, nach Fort Cobb.«
»Der Marshal kommt aus New Mexico?«, fragte ich.
»Ja. Dort sind Lee Warner und Dave Halleran jeweils fünfhundert Bucks wert.«
»In Texas werden sie nicht gesucht?«
»Jetzt schon, nachdem sie einen Marshal zusammengeschossen haben. – Der Wagenzug ist heute Morgen aufgebrochen. Ich habe den Richter informiert.«
Wir verließen den Bau. Im Büro des Richters brannte Licht. Wir gingen in das Gerichtsgebäude. Auch Simon Calispel, der Sekretär des Richters, war noch anwesend. Die Lampe, die über seinem Schreibtisch von der Decke hing, brannte. »Ah, Logan und Hawk. Geht nur hinein.«
Ich klopfte gegen die Tür, der Richter forderte uns auf, einzutreten. Die Laterne warf düstere Schatten in sein schmales Gesicht. Seine Haare glänzten wie reines Silber. Er begrüßte uns, dann forderte er uns auf, Platz zu nehmen, und dann sagte er: »In Vega wurde ein U.S. Deputy Marshal aus New Mexico niedergeschossen. Die beiden Banditen sind mit einem Wagenzug auf dem Weg ins Indianerland.«
»O'Leary hat uns alles erzählt«, sagte ich. »Reitet schon jemand auf der Fährte der Kerle?«
»Nein. Es war kein Marshal verfügbar. Hiermit übertrage ich Ihnen den Job, den beiden Banditen zu folgen und sie zu verhaften.«
»Wir reiten morgen früh«, sagte ich.
Als der Morgen graute, brachen wir auf. Der Morgendunst war Vorbote der kommenden Hitze. Die Sichel des Mondes stand im Westen. Die Menschen in Amarillo schliefen noch. Wir ritten nach Osten. Am Abend zuvor hatten wir noch den U.S. Deputy Marshal beim Doc besucht. Er befand sich nicht mehr in Lebensgefahr, es würde aber einige Zeit vergehen, bis er wieder aufs Pferd steigen konnte. Er hatte uns die Steckbriefe der beiden Banditen überlassen.
Die Sonne ging auf. Der Himmel färbte sich von grau nach blau, die Natur erwachte zum Leben. In den Büschen zwitscherten die Vögel. Die Banditen hatten vierundzwanzig Stunden Vorsprung. Mit den Fuhrwerken kamen sie nicht schnell voran.
Wir schonten unsere Pferde. Vor uns bohrte sich der Weg, der nach Shamrock führte, zwischen die Hügel. Gegen Abend erreichten wir den McClellan Creek. An seiner Quelle beschlossen wir zu lagern. Nachdem die Pferde getränkt und abgesattelt waren, aßen wir. Es gab Dörrfleisch und trockenes Brot. Dazu tranken wir Wasser.
Am Morgen ging es weiter. Über dem Fluss hingen Nebelschwaden. Der Himmel im Osten hatte sich gelb verfärbt. Das Licht kündete den Sonnenaufgang an ...
*
Sie befanden sich im Indianerland. Lee Warner und Dave Halleran ritten voraus. Es gab keinen Weg mehr. Wildnis umgab sie. Die Hügel waren zum teil bewaldet. Die Wälder erstreckten sich weit in die Ebenen hinein. Jeder der Conestoga-Schoner wurde von vier Pferden gezogen. Auf dem Bock saßen jeweils zwei Männer. John Malcolm und Steve Sanders folgten dem Zug. Die Sonne wanderte höher und höher und verwandelte das Land in einen Glutofen. Beim Atmen füllten sich die Lungen wie mit Feuer. Die Luft flirrte.
Als sich Lee Warner einmal im Sattel umwandte, sah er im Westen eine Rauchsäule zum Himmel steigen. Sie wurde unterbrochen, um sich gleich darauf erneut zu erheben. Der Rauch ballte sich am Himmel und zog träge nach Osten.
Rauchsignale!
Lee Warner biss die Zähne zusammen, dass die Backenknochen in seinem hohlwangigen Gesicht hart hervortraten. »Die Rothäute haben uns entdeckt«, knirschte er. »Und sie machen ihre Vettern auf uns aufmerksam.«
Sie hielten die Pferde an. Dave Halleran vollführte eine halbe Drehung im Sattel und stützte sich mit dem rechten Arm auf der Kruppe seines Pferdes ab. Soeben erhob sich wieder die dunkle Rauchsäule. »Verdammt!«, fluchte er. »Sie haben uns schneller entdeckt, als uns lieb ist.«
Lee Warner zerrte sein Pferd herum und ritt zu John Malcolm hin. Er wies nach Westen. »Die Roten wissen, dass wir durch ihr Gebiet ziehen.«
Malcolm und Sanders blickten in die angegebene Richtung. »Das gefällt mir ganz und gar nicht«, murmelte Malcolm. Er mahlte mit den Zähnen. »Was tun wir?«
»Wir ziehen weiter«, sagte Warner. »Nehmt aber vorsichtshalber die Gewehre in die Hände. Ich rechne mit einer bösen Überraschung.«
Warner zog sein Pferd um die rechte Hand und ritt wieder nach vorn. Malcolm und Sanders zogen die Gewehre aus den Scabbards und repetierten. Malcolm trieb sein Pferd an und kam auf eine Höhe mit dem hinteren Fuhrwerk. »Nehmt die Gewehre zur Hand, Kirby. Die Indsmen haben uns bemerkt.« Der Wagenboss ritt weiter und holte den vorderen Wagen ein. »Wahrscheinlich erleben wir bald eine böse Überraschung, Herb. Haltet die Waffen bereit.«
Die beiden Banditen ritten an der Spitze des Zugs. Ihre Augen waren unablässig in Bewegung. Sie sicherten ununterbrochen um sich. Und dann sah Dave Halleran auch vor ihnen Rauchzeichen zum Himmel steigen. Auch Lee Warner sah sie und zügelte. »Das Kommunikationssystem der Wildnis funktioniert wieder einmal vorzüglich«, presste er zwischen den Zähnen hervor.
Die Fuhrwerke holten auf und wurden angehalten. Das Rumpeln, Poltern und Quietschen endete. Die Rauchsäule weit vor ihnen riss ab. Der Rauch am Himmel zerflatterte. Dann erhob sie sich aufs Neue.
»Sie haben uns zwischen sich«, murmelte Lee Warner bedrückt. »Zur Hölle mit diesen roten Teufeln.«
John Malcolm und Steve Sanders überholten die Fuhrwerke und zerrten bei den beiden Banditen ihre Pferde in den Stand. John Malcolm war nervös. »Am besten wäre es, wir würden nach Süden oder Norden ausweichen«, sagte er.
»Dadurch entgehen wir ihnen auch nicht«, versetzte Lee Warner. Sein Pferd scharrte mit dem Huf. Die Unruhe seines Reiters schien sich auf das Tier übertragen zu haben. »Ziehen wir langsam weiter«, murmelte Warner. »Wahrscheinlich kommen sie mit der Abenddämmerung.«
Sie folgten – dem eisigen Wind ihrer Gedanken ausgesetzt - den Windungen zwischen den Hügeln. Die Sonne hatte längst den Zenit überschritten. Die Nerven der Männer waren zum Zerreißen angespannt. Die Gefahr konnte hinter jedem Hügel lauern, der Tod war allgegenwärtig. Schließlich stand die Sonne weit im Westen. Die Schatten waren lang. Sie befanden sich auf einer staubigen Ebene, die ringsum von Anhöhen begrenzt war. Im Osten erstreckte sich ein langgezogener Hügel. Und auf den Kamm dieses Hügels trieben nur vier Reiter ihre Pferde. Nebeneinander verhielten sie. Die Sonne brach sich auf den Läufen ihrer Gewehre. Sie hatten sich Federn in die Haarschöpfe auf ihren Hinterköpfen gesteckt und trugen farbige Tücher um die Stirnen. Regungslos saßen sie auf ihren Pferden.
Der Wagenzug hatte angehalten.
»Fahrt die Fuhrwerke nebeneinander«, ordnete Lee Warner an. »Wir binden die Pferde zwischen den Wagen an und suchen unter den Fuhrwerken Schutz. Vorwärts!«
Dann standen die beiden Wagen so, wie Warner es wollte. Sie banden ihre Reittiere an den Rädern fest. Dann krochen sie unter die Schoner und warteten. Die vier Reiter von der Kuppe des Hügels zogen ihre Mustangs herum und verschwanden. Der kalte Hauch des Todes schien über die Ebene zu streichen.
Und dann kamen die Indianer. Sie stoben im Osten und Westen zwischen den Hügeln hervor und jagten über die Prärie. Die Hufe ihrer Pferde schienen kaum den Boden zu berühren. Lange, schwarze Haare flatterten im Reitwind. In das Hufgetrappel mischte sich spitzes, abgehacktes Kampfgeschrei.
»Vergeudet nur kein Blei!«, rief Warner. »Lasst sie herankommen!«
Einer der Fuhrwerker verlor die Nerven und drückte ab. Ein Pferd wurde getroffen und ging vorne zu Boden. Der Reiter wurde durch die Luft katapultiert und überschlug sich am Boden. Andere Pferde rasten in das Hindernis hinein, und im Nu bildete sich ein Knäuel ineinander verkeilter Menschen und Pferdeleiber.
»Feuer!«, brüllte Warner.
Die Gewehre dröhnten. Weitere Pferde gingen zu Boden. Krieger wurden aus den primitiven Sätteln gerissen. Dann war das Gros der Indianer auf zwanzig Schritte heran. Sie feuerten, schrien und jagten ihre Pferde im Kreis um die beiden Fuhrwerke herum. Die Weißen schossen die Rohre heiß. Krieger sprangen von den Pferden und griffen – den Tomahawk schwingend -, zu Fuß an. Das hochträllernde Geschrei brachte die Nerven der Weißen zum Schwingen. Ihre Gesichter waren schwarz vom Pulverschmauch. Pulverdampf stieg nebelhaft in die Höhe. Einer der Männer bäumte sich auf, dann fiel er auf das Gesicht und rührte sich nicht mehr. Zwei der Pferde, die die Pferde zogen, lagen tot am Boden.
Die beiden Kriegergruppen hatten sich vereint. Jetzt drehte der Pulk ab. Die Horde stob nach Osten. Ein Krieger schnellte aus dem hohen Gras in die Höhe und rannte hinter seinen Brüdern her. Lee Warner zielte sorgfältig und schoss ihm eine Kugel zwischen die Schulterblätter. Die Kriegshorde verschwand. Stille senkte sich über das Szenarium – eine Stille, die fast noch schrecklicher anmutete als das Krachen der Schüsse vorher.
Im Gras lagen tote und verwundete Krieger sowie reglose Pferde. Einer der Indianer versuchte davonzukriechen. Ein Schuss sprengte die lastende Stille und er fiel aufs Gesicht.
»Haben wir sie verjagt?«, fragte John Malcolm hoffnungsvoll.
»Ich weiß es nicht«, murmelte Lee Warner, der neben dem Wagenboss unter dem Fuhrwerk lag. »Ein halbes Dutzend von ihnen sind draufgegangen. Aber es sind immer noch über zwanzig Krieger, die uns die Hölle heißmachen können.« Warner schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube nicht, dass sie verschwunden sind. Die Toten haben ihren Kampfgeist höchstens noch angestachelt.«
Unter dem anderen Wagen ertönte eine Stimme: »Gary hat's erwischt. Die Hölle verschlinge diese roten Bastarde.«
Sie krochen unter den Fuhrwerken hervor. Die Anspannung stand ihnen in die maskenhaft starren Gesichter geschrieben. Der Fuhrwerker, der ums Leben gekommen war, wurde unter dem Wagen hervorgezogen.
Lee Warner war vor die Wagen getreten und spähte nach Osten. Über dem Horizont begann sich der Himmel grau zu verfärben. Jeder Zug seines Gesichts drückte Sorge aus. Er drehte sich um und schaute nach Westen. Die Sonne war zu einem Viertel hinter den Hügeln versunken. Plötzlich schnellte ein Krieger in die Höhe. Warner konnte das Weiße in seinen Augen sehen. Das Gesicht war vom Hass verzerrt. Das Kriegsbeil schwingend griff der Indianer an. Blitzschnell zog Warner den Colt. Die Waffe brüllte auf, eine handlange Mündungsflamme stieß aus dem Lauf, die Kugel fällt den Krieger. Mit geisterhaftem Geraune verebbte die Detonation. Warner ließ den Revolver einmal um den Zeigefinger rotieren, dann versenkte er ihn im Holster. Er kehrte zwischen die Wagen zurück.
»Was sind das überhaupt für welche?«, fragte einer der Fuhrwerker.
»Wahrscheinlich Cheyenne«, antwortete Warner. »Bevor es Nacht wird, werden sie noch einmal kommen. Seht dort.«
Hinter dem Hügel im Osten stieg ein Rauchsignal in den Himmel.
»Sie fordern Verstärkung an«, murmelte Dave Halleran. »Hölle, sie werden uns hier festnageln und warten, bis sie stark genug sind, um uns zu überrennen.«
»Wenn es finster wird, fahren wir weiter«, knurrte Warner. »Wir weichen nach Süden aus und wenden uns dann wieder nach Osten.«
Die Sonne versank. Die Dämmerung senkte sich auf das Land. Alles mutete grau in grau an. Am Westhimmel begann der Abendstern zu schimmern. Von Norden her begann sich der Himmel violett zu verfärben.
Die Indianer griffen wieder an. Wie eine Horde Teufel brachen sie zwischen den Hügeln hervor. Ihr Geschrei ließ die Seelen der Weißen erbeben. Die Erde schien unter den wirbelnden Hufen zu erbeben. Die Verteidiger der Wagen begannen zu feuern. Hundert Yards vor den Fuhrwerken teilte sich die Gruppe. Die eine Horde donnerte links an den Wagen vorbei, die andere auf der rechten Seite. Der Lärm war infernalisch. Pferde wieherten schrill und trompetend. Dann waren die Krieger vorbei und sammelten sich westlich der Wagen. Und sogleich griffen sie wieder an. Sie benutzten dieselbe Taktik wie eben. Herb Farrow bekam eine Kugel in die Schulter. Seine Zähne knirschten übereinander, der Schrei, der sich in seiner Brust hochkämpfte, erstickte in der Kehle.
Da peitschten auf dem Hügel weiter westlich Gewehre. Als hätte sie die Faust des Satans heruntergerissen stürzten zwei Krieger von den Pferden. Wütendes Geheul brandete hoch. Eine kleine Gruppe Krieger löste sich aus dem Kampfverbund und stob nach Westen, von wo es ihnen entgegenpeitschte. Ein Pferd brach zusammen, ein Krieger warf die Arme in die Höhe und stürzte rücklings vom Pferd.
Die Weißen unter den Fuhrwerken schöpften wieder Hoffnung. Heißes Blei pfiff aus den Rohren ihrer Waffen. Die Indianer bemerkten, dass sie sich gewissermaßen in der Zange befanden und flohen. Wieder blieben tote und verwundete Krieger sowie tote und sterbende Pferde zurück.
Es wurde still. Einige Zeit verstrich. Schließlich trieben zwei Reiter ihre Pferde auf den Kamm im Westen. Im Galopp jagten sie den Abhang hinunter und auf die Fuhrwerke zu. Die Sterne an ihren Westen funkelten im letzten Licht des Tages.
»O verdammt!«, entfuhr es Dave Halleran, als er erkannte, dass es zwei Gesetzesmänner waren, die sich ihnen näherten.
Lee Warners Backenknochen mahlten.
Die Fuhrwerker und die beiden Banditen krochen unter den Wagen hervor. Herb Farrow presste die linke Hand auf seine zerschossene Schulter. Blut sickerte zwischen seinen Fingern hervor. In seinem bleichen Gesicht tobte der Schmerz.
Lee Warner starrte den beiden Reitern entgegen. Ihre Gesichter waren nicht zu erkennen. Sie hatten das letzte Licht des Tages im Rücken und trugen breitrandige Hüte.
Dann waren die beiden heran. Sie parierten die Pferde. John Malcolm sagte: »Sie hat der Himmel geschickt. Lange hätten wir den roten Halsabschneidern wohl nicht mehr standgehalten.«
Einer der Ankömmlinge ließ seine Stimme erklingen: »Ich bin Bill Logan. Das ist mein Kollege Joe Hawk. Wir reiten für das Distriktgericht in Amarillo.«
*
Mit meinem letzten Wort richtete ich das Gewehr auf Lee Warner. »Rühren Sie sich nicht, Warner«, warnte ich, hob mein linkes Bein über das Sattelhorn und ließ mich vom Pferd gleiten. »Dasselbe gilt für Sie, Halleran.«
Jetzt sah ich, dass das Gewehr Warners wie zufällig auf einen der Fuhrwerker gerichtet war. Sein Finger krümmte sich um den Abzug. Der Bandit sagte: »Selbst mit einer Kugel im Kopf werde ich noch die Zeit finden, Malcolm ein Stück Blei zu verpassen.«
Halleran schlug das Gewehr auf mich an und sagte: »Die Kugel für dich befindet sich bereits im Lauf, Logan. Und sollte dein Kollege abdrücken, fahren wir zusammen zur Hölle.«
Ich schielte zu Joe hinüber. Er hatte das Gewehr auf Halleran gerichtet. Ein böses, raubvogelhaftes Grinsen kerbte sich in Warners Mundwinkel. »Lasst die Waffen fallen. Macht schon. Oder muss ich Malcolm ein Stück Blei in die Figur knallen?«
Ich wusste, dass John Malcolm der Wagenboss war. Ich durfte sein Leben nicht gefährden. Daher nahm ich die Winchester aus dem Anschlag und stieß sie in den Scabbard. »Rechnen Sie sich eine Chance aus, Warner?«
Auch Joe holsterte sein Gewehr.
»Bring die Pferde, Dave«, gebot Warner, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Ihr beide – absitzen!«
Wir stiegen von den Pferden.
»Und jetzt geht los. Vorwärts, schwingt die Hufe.«
Joe und ich marschierten los. Als wir ungefähr hundert Yards von den Fuhrwerken entfernt waren, blieben wir stehen. Die beiden Banditen schwangen sich auf ihre Pferde und ritten nach Norden davon. In dem Moment stoben die Indianer mit wildem Geschrei aus einer Hügellücke, fächerten auseinander und jagten in breiter Front auf die Wagen zu.
Die Banditen hämmerten ihren Pferden die Sporen in die Weichen. Drei – vier Indianer lösten sich aus der Angriffsformation und galoppierten hinter den Banditen her. Joe und ich begannen zu laufen. Die Fuhrwerker waren unter die Schoner gekrochen und feuerten auf die Angreifer.
Warner und Halleran erreichten vor den Cheyenne die Hügel und ritten in einen der V-förmigen Einschnitte. Joe und ich zogen unsere Revolver und rannten so schnell wir konnten. Als die Krieger auf dreißig Yards heran waren, erreichten wir den Schutz der Fuhrwerke. Wir rissen unsere Gewehre vom Boden in die Höhe, stießen die Revolver ins Holster und gingen in Deckung. Schuss um Schuss jagte ich aus dem Lauf. Die Krieger stoben zu beiden Seiten an den Fuhrwerken vorbei und sammelten sich außer Gewehrschussweite. Wieder hatten einige den Angriff mit dem Leben bezahlt. Es war erstaunlich, mit welchem Fanatismus sie ihr Leben aufs Spiel setzten.
Sie palaverten miteinander. Dann ritten sie nach Westen davon.
»Für heute haben wir wohl Ruhe vor ihnen«, rief Malcolm.
Ich kroch unter dem Wagen hervor und ging zu einem Pferd hin, das die Vorderbeine gegen den Boden stemmte und verzweifelt versuchte, hochzukommen. Es rollte mit den Augen und wieherte gequält. Ich setzte dem Tier die Mündung der Winchester an den Kopf und drückte ab. Es kippte mit dem Krachen des Schusses zur Seite.
Die Indianer ritten zwischen die Hügel im Westen. Die Dunkelheit nahm zu und die Natur verlor ihre Farben. Wir schirrten die toten Pferde aus und ersetzten sie mit den Reittieren von Malcolm und Sanders. Der tote Fuhrwerker wurde auf eines der Fuhrwerke gelegt. Herb Farrow wurde verbunden.
Es war eine klare Nacht. Myriaden von Sternen funkelten. Wolkenschatten zogen über das Land. Über den welligen Horizont im Osten schob sich die Mondsichel. Fledermäuse zogen ihre lautlosen Bahnen durch die Dunkelheit auf der Jagd nach Beute.
Ich sagte zu Joe: »Führe du den Zug nach Süden und dann wieder nach Osten. Ich folge Warner und Halleran.«
»Ist das nicht gefährlich?«
»Auch nicht gefährlicher als mit den Wagen zu reiten.«
»Wie du meinst. Wir treffen uns dann in Fort Cobb.«
»Vielleicht hole ich euch vorher schon ein.«
Der kleine Zug setzte sich in Bewegung. Die Achsen der Fuhrwerke quietschten in den Naben. Rumpeln vermischte sich mit dem Pochen der Hufe. Ich stieg auf mein Pferd und folgte der Spur der beiden Banditen nach Norden. Sie zeichnete sich deutlich im hohen Gras ab. Dort, wo sich die vier Krieger auf die Fährte der beiden gesetzt hatten, wurde sie noch deutlicher. Nach einer Meile etwa bog die Spur nach Osten ab.
Und dann stieß ich auf einen toten Cheyenne. Ich saß bei ihm ab. Die Fährte war im Mond- und Sternenlicht deutlich auszumachen. Sie führte auf die Hügel im Osten zu. Dort mussten die Banditen auf die Indianer gewartet haben. Spuren zweigten ab. Sie verrieten, dass die Indianer nach allen Seiten geflohen waren. Ich witterte und ließ meinen Instinkten freien Lauf. Leises Säuseln erfüllte die Nacht. Ein kühler Wind kam von Westen.
Ich ruckte im Sattel. Das Pferd setzte sich wieder in Bewegung. Die Winchester hielt ich in der Hand. Sie lag quer vor mir über dem Mähnenkamm des Pferdes. Dumpf pochten die Hufe. Hin und wieder prustete das Pferd. Die Einsamkeit, die mich umgab, berührte mich fast körperlich. Ich ritt zwischen die Anhöhen. Zu beiden Seiten schwangen sich die Abhänge nach oben. Da wieherte ein Pferd. Das Geräusch wehte heran und ich nahm meinen Vierbeiner hart in die Kandare. Sekundenlang lauschte ich dem Wiehern hinterher, dann schwang ich mich aus dem Sattel, ließ die Zügel zu Boden fallen und pirschte in die Richtung, aus der das Wiehern gekommen war.
Mechanisch setzte ich einen Fuß vor den anderen. Jede Faser meines Körpers war angespannt. Mein Verstand arbeitete klar und präzise. Ein Hügel lag vor mir, ich stieg ihn hinauf und glitt oben zwischen die zerklüfteten Felsen, die sich erhoben. Unter mir lag eine Senke. Im Mondlicht sah ich ein Pferd. Ein längliches, dunkles Bündel lag daneben am Boden. Ein Mensch! Jeden Schutz ausnutzend, der sich mir bot, schlich ich nach unten. Das Pferd schien meine Witterung aufgenommen zu haben, denn es wieherte erneut. Ich verharrte in der Deckung eines mannshohen Busches. Das Gewehr hielt ich an der Hüfte im Anschlag. Die Gestalt rührte sich nicht. Ich nahm mir ein Herz und glitt zu ihr hin. Es war ein Indianer. Er lag auf dem Gesicht. Ich fühlte seinen Puls. Der Krieger war tot.
Die beiden Banditen schafften sich ihre Verfolger nach und nach vom Hals. Sie gingen dabei mit tödlicher Präzision vor. Ich richtete mich auf und ging zu dem Pferd hin. Es scheute schnaubend zurück. Schließlich stieg es auf die Hinterhand und vollführte mit den Vorderhufen einen Trommelwirbel in der Luft. Ich erwischte den Rohlederzügel. Die Hufe des Tieres krachten wieder auf den Boden und ich nahm es am primitiven Zaumzeug. Der Mustang beruhigte sich. Ich nahm ihm den Sattel aus Ästen ab, befreite ihn vom Kopfgeschirr und versetzte ihm mit der flachen Hand einen Schlag auf die Kruppe. Das Tier trabte davon, wurde schemenhaft und schließlich von der Dunkelheit aufgesaugt.
Ich holte mein Pferd und ritt weiter. Das Terrain wurde felsig. Die Vegetation wurde immer karger. Irgendwo heulte ein Wolf den Mond an. Ich ritt an einer Felswand entlang, die höchstens dreißig Fuß hoch war. Unter den Pferdehufen mahlte feiner Sand. Manchmal klirrte es, wenn ein Hufeisen gegen Stein stieß.
Und plötzlich löste sich über mir ein Schemen aus dem Felsen. Ehe ich reagieren konnte, wurde ich aus dem Sattel gerissen. Ich krachte auf den Boden und verlor das Gewehr. Der Angreifer war neben mir auf dem Boden gelandet. Jetzt warf er sich auf mich. Instinktiv nahm ich den Kopf zur Seite. Die Schneide des Tomahawks verfehlte mich und fuhr dicht neben meinem Kopf in den Boden. Der Körper presste mich auf den Boden. Ich schlug zu und meine Faust traf auf Widerstand. Ein Ächzen war zu vernehmen. Den zweiten Schlag wehrte ich mit dem Unterarm ab. Dann zog ich das Bein an und brachte es zwischen mich und meinen Gegner. Ehe er erneut zuschlagen konnte, warf ich ihn von mir. Wir kamen fast gleichzeitig auf die Beine. Ich sprang zwei Schritte zurück. »Weißer Hund!«, grunzte der Indianer und griff an. Ich zog den Remington und schoss. Der Krieger machte das Kreuz hohl und brach zusammen. Der Knall trieb auseinander und wurde von den Echos vervielfältigt, um schließlich zu verhallen.
Der Krieger am Boden stöhnte. Ich entwand ihm den Tomahawk, schleuderte ihn fort und ging neben ihm auf die Hacken nieder. »Kannst du mich verstehen?«
Der Cheyenne atmete rasselnd. »Ich spreche deine Sprache.«
»Wo ist der vierte Krieger?«
»Die weißen Hunde haben ihn erschossen.«
»Ihr habt sie also nicht erwischt.«
»Nein.«
Ich drückte mich hoch, holte mein Pferd und sammelte dann trockenes Holz, um ein Feuer anzumachen. Als es brannte, wandte ich mich dem Krieger zu. Und ich musste feststellen, dass er gestorben war. Er hatte meine Kugel in die Brust bekommen und seinen fanatischen Hass mit dem Leben bezahlt. Ein bitterer Geschmack bildete sich in meiner Mundhöhle, denn ich hasste es, zu töten. Aber er hatte mir nicht die Zeit gelassen, genau zu zielen.
Ich beschloss, an diesem Platz zu bleiben und den Morgen abzuwarten.
*
Im Osten verfärbte sich der Himmel schwefelgelb. Es war die Stunde, in der sich die Räuber der Nacht zur Ruhe begaben. Die Sterne verblassten. Morgendunst wob zwischen den Steilhängen. Lee Warner saß auf einem Felsbrocken. Er drehte sich eine Zigarette und zündete sie an. Tief inhalierte er den ersten Zug. Es war kühl. Zwischen den Büschen ruhten ihre Pferde. Ein Stück entfernt lag Dave Halleran unter seiner Decke und schlief.
Als Warner geraucht und die Kippe ausgetreten hatte, ging er zu Halleran hin, beugte sich über ihn und rüttelte ihn an der Schulter. Halleran schlug die Augen auf. Einen Moment lang fand er sich nicht zurecht. Dann richtete er den Oberkörper auf, strich sich fahrig über das Gesicht und schleuderte die Decke von sich.
»Der Tag bricht an«, sagte Warner. »Wir müssen weiter.«
Sie aßen Pemmican und tranken Wasser. Die Sonne ging auf und der Tag vertrieb die Nacht nach Westen. Dann brachen sie auf. Den Pferden hatten sie nicht die Sättel abgenommen, sondern lediglich die Bauchgurte gelockert. Die aufgehende Sonne blendete sie und sie zogen sich die Hüte tief in die Stirnen. Von Zeit zu Zeit ritten sie auf eine Anhöhe, um auf ihrer Fährte zurückzublicken. Und irgendwann entdeckte Lee Warner den schwarzen Punkt weit im Westen. Er zog eine Staubfahne hinter sich her. »Da kommt einer«, sagte der Bandit. »Warten wir hier auf ihn.«
Sie saßen ab und führten die Pferde in den Schutz einer Gruppe von Felsen. Dann nahmen sie ihre Gewehre und repetierten. Die Entschlossenheit, den Reiter von ihrer Fährte zu fegen, prägte die Mienen. Sie bezogen Stellung. Es war jetzt hell. Winzige Kristalle glitzerten im Staub. Das Land begann sich wieder aufzuheizen. Der Südwind trieb kleine Staubwirbel vor sich her.
Noch konnten die beiden Banditen keine Einzelheiten erkennen. Der Reiter kam näher. Und schließlich sagte Warner: »Es ist Logan. Er wird den Geiern und Coyoten als Fraß dienen.«
Der Marshal verschwand hinter einem Hügel aus ihrem Blickfeld. Bald waren Hufschläge zu hören. Die beiden Banditen hoben die Gewehre an die Schultern. Ihre Augen glitzerten kalt. Sie waren bereit, zu töten. Skrupel kannten sie nicht. Sie waren aus Unbarmherzigkeit, Härte und Verkommenheit zusammengesetzt. Ein Menschenleben war ihnen gerade mal den Preis für eine Kugel wert.
Das Pochen der Hufe wurde deutlicher. Dann kam das Pferd um den Hügel herum. Es war reiterlos. Lee Warner murmelte eine Verwünschung. Rastlosigkeit schlich sich in seine Züge.
»Wo ist der Hurensohn geblieben?«, presste Halleran zwischen den Zähnen hervor.
»Irgendetwas muss ihn gewarnt haben. Wahrscheinlich hat ein Gewehrlauf das Sonnenlicht reflektiert. Möglicherweise versucht er, hinter uns zu gelangen.«
»Halt du hier die Stellung«, knurrte Halleran. »Ich suche ihn.«
Warner nickte. Seine Lippen waren zusammengepresst und bildeten nur noch einen dünnen, blutleeren Strich. Unruhe flackerte in den Augen des Banditen. Seine Hände hatten sich regelrecht an Kolbenhals und Schaft der Winchester festgesaugt.
Halleran verließ seine Deckung und lief geduckt den Hang hinunter. Geröll, das da lag, wurde von ihm losgetreten und Steine kollerten hangabwärts. Unten lief der Bandit in die Deckung eines Strauches.
Das Pferd des Marshals war stehengeblieben und witterte mit geblähten Nüstern. Schließlich warf es den Kopf in den Nacken und wieherte. Warner legte an und zielte auf das Tier, drückte aber nicht ab sondern senkte das Gewehr wieder. Sein Blick sprang in die Runde.
Unten löste sich Halleran aus dem Schutz des Busches und rannte am Fuß des Hügels entlang. Nachdem er die Anhöhe halb umrundet hatte, wandte er sich in die Senke hinein. Er durchquerte sie und gelangte in den Schutz eines weiteren Hügels, lief um ihn herum und fand die Spur, die der Marshal hinterlassen hatte. Er folgte ihr und stieß auf die Stelle, an der der Marshal vom Pferd gestiegen war. Fußspuren führten nach links den Abhang hinauf. Halleran huschte zwischen die Büsche und spähte nach oben. Auf dem Hügel wuchsen Sträucher, deren Blätter im Wind zitterten. Darüber spannte sich blauer Himmel, vor dem sich weiße Wolken ballten.
Der Bandit setzte alles auf eine Karte und folgte der Spur den Abhang hinauf, den Blick ununterbrochen nach oben gerichtet. Das Gewehr hielt er schussbereit.
Plötzlich trat oben der Marshal zwischen den Büschen hervor. Er blieb aber nicht stehen, sondern bewegte sich schnell, viel zu schnell, als dass sich der Bandit schnell genug auf das sich so jäh verändernde Ziel einstellen konnte. Hallerans Schuss peitschte, die Kugel riss Blätter und Zweige vom Strauch oben, in den verklingenden Hall der Detonation hinein dröhnte das Gewehr des Marshals. Halleran bekam einen furchtbaren Schlag gegen den Oberschenkel, sein Bein wurde vom Boden weggerissen, er stürzte. Ein gequälter Laut brach über seine trockenen Lippen ...
Warner hörte die Schüsse und verspürte ein seltsames Kribbeln zwischen den Schulterblättern. Ungewissheit erfüllte ihn. In seinem Gesicht glitzerte Schweiß. Die Zeit schien stillzustehen. Die Natur schien den Atem anzuhalten. Sogar das Zwitschern der Vögel war nach den Schüssen verstummt.
Halleran kam nicht. Das Warten machte Warner mürbe. Seine Nerven vibrierten. Er glaubte schleichende Schritte zu vernehmen. Dumpf pochte sein Herz gegen die Rippen. Sein Mund war trocken. In seinem Gesicht zuckten die Muskeln. Leises Klirren war zu vernehmen. Spielten ihm seine überreizten Sinne einen Streich? Das Geräusch war in der Lautlosigkeit versunken. Die Stille war bleischwer und erdrückend.
Warner hielt es nicht mehr an seinem Platz. Er zog sich zurück und langte bei den Pferden an, band sein Pferd los und schwang sich in den Sattel. »Hüh!« Er schnalzte mit der Zunge und trieb das Tier mit einem Schenkeldruck an.
Im Galopp ritt er den Hang hinunter. Oben, auf dem Hügel, zeigte sich der Marshal. In dem Moment, als er schoss, riss Warner das Pferd zur Seite und die Kugel verfehlte ihn. Unerbittlich hämmerte Warner seinem Pferd die Sporen in die Seiten.
*
Der Bandit verschwand um den Hügel herum und ich ließ die Winchester sinken. Er war mir entkommen. Ich schritt zwischen die Felsen und stieß auf das Pferd, das Warner zurückgelassen hatte. Am Zaumzeug führte ich das Tier den Hügel hinunter, erreichte meinen Vierbeiner und band das Banditenpferd an. Dann pirschte ich zu der Stelle, an der ich Halleran eine Kugel verpasst hatte. Der Bandit war in den Schutz eines Strauches gekrochen. Ich duckte mich hinter einem von der Witterung rundgeschliffenen und bemoosten Felsen und rief: »Gib auf, Halleran. Warner ist fort, und ich habe dein Pferd.«
»Komm und hol mich!«, schrie der Bandit wild.
»Du riskierst eine zweite Kugel«, drohte ich.
Darauf gab Halleran keine Antwort. Ich äugte über den Felsen. Von dem Banditen konnte ich nichts sehen. Er lag hinter dem Wurzelstock. Jetzt schoss er. Schnell zog ich den Kopf ein. Die Kugel zog eine helle Spur über den Stein und jaulte durchdringend. Splitter spritzten wie winzige Geschosse. Ich jagte eine Kugel in den Busch. Blätter segelten zu Boden.
»Du hast keine Chance«, versuchte ich es noch einmal mit Worten. »Ich kann auch fortreiten und dich zurücklassen. Du bist verwundet und hast kein Pferd. Es wimmelt von Indianern. Deine Chance ist die eines Schneeballs in der Hölle.«
»Ich werde mich schon durchschlagen. Komm nur und hol mich, Logan. Ich kann es kaum erwarten, dir ein Stück Blei zwischen die Rippen zu knallen.«
Ich peilte die nächste Deckung, einen Busch, an, stieß mich ab und rannte, hakenschlagend wie ein Hase, zu diesem Gebüsch. Der Bandit feuerte, verfehlte mich aber. Ich atmete dreimal tief durch, dann rannte ich weiter. Stück für Stück kämpfte ich mich einen Abhang hinauf, dann wandte ich mich nach rechts und lief auf halber Höhe um den Hügel herum. Außerhalb des Schusssektors des Banditen rannte ich hügelabwärts und gelangte hinter Halleran. Ich erreichte den Schutz eines Felsens und schmiegte mich gegen das raue Gestein.
Winzige Stechmücken, die vom Schweißgeruch angezogen wurden, piesackten mich. Ich schlug mit der flachen Linken in den Schwarm hinein, der meinen Kopf wie eine dunkle Wolke einhüllte, aber es gelang mir nicht, die Plagegeister zu vertreiben.
Ich verließ die Deckung des Felsens und lief geduckt in die Richtung, in der ich den Banditen wusste. Und dann sah ich ihn. Er humpelte in Richtung der Pferde. Um den Oberschenkel hatte er sich sein Halstuch gebunden. Die Winchester benutzte er wie einen Stock.
Ich jagte eine Kugel über seinen Kopf hinweg. Er blieb stehen. Meine nächste Kugel wirbelte vor seinen Stiefelspitzen den Staub auf. Plötzlich ließ er das Gewehr los und hob die Hände. Ich trat hinter dem Strauch hervor, der mich gedeckt hatte, und schritt langsam, das Gewehr im Hüftanschlag, auf ihn zu.
Er hatte sich mir zugewandt. Seine Backenknochen mahlten. Seine Brauen hatten sich zusammengeschoben, über seiner Nasenwurzel standen zwei steile Falten. Mir entging nicht der lauernde Ausdruck in seinen Augen. Die Gefahr, die nach wie vor von ihm ausging war nicht zu unterschätzen.
»Zieh vorsichtig den Colt aus dem Holster«, kommandierte ich. »Bei der geringsten falschen Bewegung drücke ich ab.«
Ich war in der Tat nicht bereit, ein Risiko einzugehen. Diese Sorte war unberechenbar und gefährlich. Mit dem Blick übte ich Druck auf den Kerl aus. Er verzog den Mund. Dann fischte er mit zwei Fingern den Revolver aus dem Holster und schleuderte ihn fort.
»Umdrehen und Hände auf den Rücken.«
Er kam dem Befehl nach. Ich trat hinter ihn und fesselte seine Hände mit den Handschellen, die ich am Gürtel hängen hatte. Dann holte ich seinen Revolver und schob ihn in meinen Hosenbund. Ich hob auch das Gewehr des Banditen auf, dann trieb ich Halleran vor mir her zu den Pferden. Ich stieß seine Winchester in den Scabbard am Sattel seines Pferdes, half ihm beim Aufsteigen, saß selber auf und angelte mir den langen Zügel seines Pferdes. Dann ritten wir los. Wir zogen nach Südosten. Wenn ich dieser Richtung folgte musste ich auf die Spur der Fuhrwerke stoßen.
»Warner wird mich befreien«, prophezeite der Bandit.
»Er hat dich schmählich im Stich gelassen«, versetzte ich.
»Du wirst es sehen.«
»Vielleicht versucht er es«, sagte ich. »Er würde mir damit nur einen Gefallen erweisen.«
»Er wird dich töten.«
»So wie ihr den Marshal aus New Mexico fast getötet habt, wie?«
Halleran schwieg ab jetzt verbissen.
Wir ritten Stunde um Stunde. Die Hitze wurde unerträglich. Zwischen meinen Zähnen knirschte feiner Sand. Hin und wieder schaute ich von einer Anhöhe aus auf unserer Fährte zurück. Und ich sah die vier Reiter, die auf unserer Spur kamen. Es waren Indianer. Sie saßen vornübergebeugt auf ihren Mustangs und ließen ihre Pferde im Schritt gehen.
»Nimm mir die Fessel ab und gib mir meine Waffen, Logan«, forderte der Bandit.
»Vergiss es«, entgegnete ich. Ich lenkte mein Pferd den Hang hinunter, ritt durch eine sandige Mulde und hielt auf der anderen Seite zwischen den Felsen an. »Absitzen!«
»Was hast du vor, verdammt! Du setzt mein Leben aufs Spiel.«
»Mit dem Leben anderer bist du nicht so zimperlich«, knurrte ich. »Steig ab.«
Es gelang ihm ohne meine Hilfe.
»Versteck dich dort in dem Riss«, gebot ich und wies mit der linken Hand auf eine Felsspalte, schwang mich aus dem Sattel und führte die Pferde zwischen die Felsen, wo ich sie an den Ast eines dornigen Strauches band. Mein Gewehr flirrte aus dem Scabbard. Ich riegelte eine Patrone in den Lauf. Dann lief ich den Weg zurück, den wir gekommen waren. Schließlich sah ich die vier Krieger kommen. Sie hielten ihre Blicke auf die Fährte geheftet, die wir gezogen hatten. Ich stand im Schutz eines Felsens.
Mit meinem ersten Schuss brach eines ihrer Pferde zusammen. Aufbrüllend antworteten die Echos. Die Felswände schienen die Detonation festzuhalten. Der Krieger, dessen Pferd ich erschossen hatte, kroch über den Boden. Die anderen drei trieben ihre Pferde auseinander. Ehe sie zwischen den Felsen verschwinden konnten, erschoss ich einen weiteren Mustang. Der Krieger schnellte hoch und rannte in Deckung. Der andere war in den Schutz des reglosen Pferdekörpers gekrochen. Er feuerte einige Schüsse auf mich ab. Das Blei klatschte gegen den Fels und die Querschläger quarrten.
Das Hufgetrappel brach ab. Irgendwo klackerte ein Stein. Ich huschte zwischen die Felsen und lief in die Richtung, in der ich Halleran zurückgelassen hatte. Jeder meiner Sinne war auf Kampf eingestellt. Ich spürte Unruhe und versuchte sie zu unterdrücken.
Die Krieger arbeiteten sich heran. Für einen Moment sah ich einen auf einem Felsen. Ich hob das Gewehr, ehe ich jedoch abdrücken konnte, war er wieder verschwunden. Ein anderer überquerte eine freie Fläche von etwa zehn Schritten, um in die nächste Deckung zu gelangen. Ich schoss ihn von den Beinen. Wie eine riesige Eidechse kroch er weiter. Ich hatte ihn im Visier, brachte es allerdings nicht über mich, den Burschen abzuschießen. Dann verschwand er hinter einem hüfthohen Felsen. Ich schalt mich einen Narren.
Kurze Zeit verstrich. Die Cheyenne blieben verschwunden, als hätte sie die Erde geschluckt. Ich zog mich zurück und erreichte unsere Pferde. Die Tiere schnaubten nervös und stampften auf der Stelle. Ich nahm über mir auf dem Felsen eine Bewegung wahr und richtete den Blick nach oben. Da stand einer der Krieger und zielte auf mich. Ich sprang behände zur Seite. Der Knall des Schusses wurde auf mich heruntergeschleudert. Meine Kugel röhrte aus dem Lauf. Der Krieger bäumte sich auf, wankte, dann neigte er sich nach vorn und stürzte von dem Felsen. Er überschlug sich einmal in der Luft, dann verschwand er. Ich hörte den dumpfen Aufprall des Körpers.
Plötzlich hörte ich Halleran schreien. Ich rannte los. Ein Schuss krachte, und ich spürte den glühenden Hauch der Kugel. Ich zuckte herum, sah einen Krieger und drückte ab. Die Kugel fällte ihn. Dann sprang ich in den Felsspalt, in dem Halleran Zuflucht gesucht hatte. Er wehrte sich mit dem Beinen gegen einen Krieger, der mit erhobenem Dolch auf ihn eindrang. Ich wirbelte das Gewehr herum und schlug den Cheyenne mit dem Kolben nieder. Entsetzten wob in Hallerans fiebrigen Augen. Der Schmerz von seinem Bein verzerrte sein Gesicht.
Hinter mir erklang ein schriller Wutschrei. Ich schwang herum. Etwas wirbelte auf mich zu. Ich sprang mehr instinktiv als von einem bewussten Willen geleitet zur Seite und der Tomahawk verfehlte mich. Der Krieger blieb stehen und riss das Gewehr in die Höhe. Ehe er abdrücken konnte, warf ihn meine Kugel um. Da sprang der Cheyenne auf, den ich mit dem Gewehr niedergeschlagen hatte. Er riss das Messer aus dem Gürtel und warf sich auf mich. Ich steppte einen halben Schritt zur Seite und der Stoß verfehlte mich. Sofort wirbelte er wieder zu mir herum. Ich schlug mit dem Gewehr zu und traf seinen Oberarm. Seine Hand öffnete sich und der Dolch fiel zu Boden. Mein zweiter Schlag holte den Krieger von den Beinen. Aber er war nicht bewusstlos, sondern wollte sofort wieder hoch. Ich richtete die Winchester auf ihn. »Schluss jetzt!«, klirrte meine Stimme.
Der Krieger erstarrte. Ich schlug noch einmal zu. Er bekam den Lauf gegen die Schläfe und legte sich schlafen.
»Vorwärts, Halleran, verschwinden wir!«, drängte ich. Wir rannten zu den Pferden. Ich half dem Banditen beim Aufsitzen, schwang mich selbst in den Sattel, dann jagten wir davon.
*
Am Abend holten wir den Waffentransport ein. Die Sonne war schon untergegangen und rötlicher Schein lag auf dem Land. Die Fuhrwerke standen nebeneinander, dazwischen hatten die Männer ein Feuer angezündet. Ein eisernes Dreibein war aufgestellt, ein Kochkessel hing in die Flammen. Einer der Fuhrwerker stand mit seinem Gewehr neben einem der Wagen und sicherte in die Runde.
Als ich absaß, kam Joe heran. »Du hast also einen von ihnen erwischt.«
»Ja. Er ist verwundet. Wie war es bei euch?«
»Die Cheyenne haben uns in Ruhe gelassen. Aber sie wissen, wo wir uns befinden. Den ganzen Tag über konnten wir ihre Rauchsignale beobachten.«
Ich half Halleran aus dem Sattel, dirigierte ihn zu einem der Fuhrwerke und fesselte ihn an eins der großen, eisenumreiften Räder. Der Bandit verwünschte mich.
»Möglicherweise versucht Warner, seinen Kumpan zu befreien. Wir müssen auf der Hut sein.«
John Malcolm trat zu uns. Ich nickte ihm zu. Er sagte: »Ich habe schon mit ihrem Kollegen gesprochen, Logan. Wir kennen den Weg nach Fort Cobb nicht. Mister Hawk meinte, er müsse erst mit Ihnen sprechen, ehe er die Zusage erteilen könne, uns zum Fort zu führen.«
»Ohne kundigen Führer sind sie verloren«, meinte Joe.
Ich strich mir mit Daumen und Zeigefinger über das Kinn. »Auch wir sind noch nicht fertig hier«, murmelte ich. »Ja, wir bringen Sie nach Fort Cobb. Es wäre eine Katastrophe, wenn den Indianern die Wagen mit den Gewehren und der Munition in die Hände fallen würden.«
Wir befanden uns in einer Senke. Ich übernahm um Mitternacht zusammen mit einem der Fuhrwerker die Wache. Ringsum buckelten die Felsen. Sie erinnerten an geduckt daliegende Monster aus grauer Vorzeit. Ich ging zu Halleran hin. Der Bandit war wach. »Ich glaube, mein Bein entzündet sich. Das Toben in der Wunde ist kaum noch zu ertragen.«
»Gegebenenfalls müssen wir die Wunde ausbrennen«, sagte ich.
»Wann werden wir Fort Cobb erreichen?«
»Es sind ungefähr noch sechzig Meilen«, antwortete ich. »Drei Tage, wenn nichts dazwischen kommt.«
»Die Rothäute ...«
Halleran brach ab, denn zwischen den Felsen erklang der schrille Schrei eines Käuzchens. Gleich darauf wurde der Ruf an anderer Stelle beantwortet.
»Zur Hölle, sie sind da!«, flüsterte der Bandit.
Ich wandte mich ab.
»Du kannst mich hier nicht einfach den Roten überlassen, Logan. Verdammt, schließ die Handschelle auf und gib mir eine Waffe. Du kannst dir denken, dass ich nicht verschwinden werde. Aber hier an dem Wagenrad ...«
Wieder erklang der Ruf des Käuzchens. Der Fuhrwerker näherte sich. »Haben Sie das gehört, Logan?« Seine Stimme klang beklommen.
»Ja.« Mit den Augen versuchte ich die Dunkelheit zu durchdringen. Einem jähen Impuls folgend schloss ich die Handschelle auf. Ich half Halleran auf die Beine, ging mit ihm zu seinem Pferd, gab ihm die Winchester und holte seinen Revolver aus der Satteltasche, den ich ihm ebenfalls überreichte. Er versenkte ihn im Holster.
»Wenn Sie fliehen, Halleran«, sagte ich, »dann ist Ihr Leben keinen rostigen Cent wert.«
Ich weckte die anderen.
»Was ist los?«, fragte Malcolm.
»Die Indianer«, sagte ich nur. »Wir fahren weiter. Nachts kämpfen sie nicht so gerne, denn sie fürchten, dass ihre Seelen den Weg in die ewigen Jagdgründe nicht finden, wenn sie fallen.«
Die Pferde wurden eingespannt. Ich ritt voraus. Halleran und Joe folgten den Fuhrwerken. Wir fuhren nach Norden. Sich zwischen den Felsen im Osten zu bewegen wäre zu gefährlich gewesen. Also fuhren wir an den Felsen entlang, und als das Land hügelig wurde, wandten wir uns wieder nach Osten.
Die Geräusche, die wir verursachten, rollten vor uns her durch die Nacht. Wir waren sicher einige hundert Yards weit zu hören. Den Cheyenne konnte gar nicht verborgen bleiben, dass wir aufbrachen. Die Frage war, ob sie uns in der Nacht folgten. Wir kamen nur langsam voran und die Indianer waren viel beweglicher als wir.
Wir mochten zwei Meilen weit gekommen sein, als prasselnder Hufschlag zu hören war. Eine Stimme schrie etwas. Ich zerrte mein Pferd herum. Die Hufschläge entfernten sich schnell. Joe überholte die Fuhrwerke und rief: »Dieser Narr! Er ist abgehauen. Genauso gut hätte er sich gleich eine Kugel in den Kopf schießen können.«
»Weiter«, sagte ich nur und setzte mich wieder vor die Fuhrwerke.
In der Ferne trieb ein langgezogener, gellender Schrei durch die Nacht. Mir krampfte sich der Magen zusammen. Mir war klar, dass die Cheyenne den Banditen erwischt hatten.
Wir zogen die ganze Nacht hindurch. Im Morgengrauen hielten wir an. Wir befanden uns an einem kleinen Fluss. Ich vermutete, dass es sich um den Salt Fork Red River handelte. In der Nacht hatten wir ein wenig die Orientierung verloren. Das Flussbett verlief nach Osten. Die Pferde wurden getränkt. Wir wuschen uns Staub und Schweiß aus den Gesichtern. Das frische Wasser belebte mich etwas.
Meine Hoffnung, dass wir den Cheyenne entkommen waren, wurde brutal zerstört, als auf einem Hügelkamm im Westen vier Reiter verhielten. Und dann sah ich auch im Osten, Süden und jenseits des Creeks im Norden Reiter ihre Pferde auf die Hügel treiben. Wir waren eingekreist.
Die Indianer demonstrierten uns nur ihre Stärke. Nachdem sie sich einige Zeit gezeigt hatten, zogen sie sich zurück und verschwanden, als hätte es sie nie gegeben. Der Tod streckte die knöcherne Klaue aus. Mit der Intensität eines Mannes, den die Knochenhand bereits berührte, spürte ich das Verhängnis tief in der Seele.
»Sie haben uns eingekreist«, bemerkte John Malcolm. Sein Gesicht war Spiegelbild seiner Empfindungen. In seinen Augen las ich Angst. Das hatte aber nichts mit fehlendem Mut zu tun. Auch ich verspürte den drückenden Ball der Furcht in der Magengegend. Es war kein erbauliches Gefühl, registrieren zu müssen, dass der Sonnenaufgang vielleicht der letzte war, den ich erlebte. Nur ein Narr hätte keine Angst empfunden.
»Wir bleiben hier am Fluss«, murmelte ich. »Solange wir stehen, können wir uns verteidigen. Die Cheyenne haben schon hohe Verluste hinnehmen müssen. Sie werden sich einen offenen Angriff zweimal überlegen.«
Joe, der herangekommen war, sagte: »Wir können nicht ewig hier bleiben.«
»Jemand müsste versuchen, nach Fort Cobb oder Fort Sill durchzukommen, um Hilfe zu holen«, knurrte ich.
»Wer immer es auch wagt, er hat keine Chance«, versetzte Joe.
Ich zuckte mit den Schultern.
Wir blieben zwischen den Fuhrwerken, um vor gezielten Schüssen der Indianer geschützt zu sein. Einige der Männer drehten sich Zigaretten und rauchten. Niemand dachte daran, zu frühstücken. Jedem war der Appetit vergangen. Sie rauchten hastig. Die Nerven lagen blank. Plötzlich rief jemand: »Da kommt ein Reiter!«
Er kam aus einer Hügellücke. Das Pferd ging im Schritt. Langsam kam es näher. Joe stieß hervor: »Das ist Halleran.« Fünfzig Schritte von den Fuhrwerken entfernt blieb das Pferd stehen. Hallerans Kinn war auf die Brust gesunken. Seine Brust war voll Blut.
»Sie schicken uns einen Toten«, entfuhr es Malcolm. »Diese dreckigen Bastarde.«
»Ich hole ihn«, erklärte Joe und setzte sich schon in Bewegung. Er lief zu dem Pferd hin, nahm es am Kopfgeschirr und führte es heran. Kein Schuss fiel.
Halleran war tot. Sie hatten ihm die Kehle durchgeschnitten und seinen Skalp genommen. Eine Konstruktion aus Ästen, an die ihn die Cheyenne gebunden hatten, hielt ihn aufrecht im Sattel. Die Augen waren weitaufgerissen und gebrochen und spiegelten das letzte Entsetzen im Leben des Banditen wider.
Ich zerschnitt die Lederschnüre, die Halleran auf dem Pferd hielten, der leblose Körper stürzte seitlich vom Pferd, Joe fing ihn auf und legte ihn auf den Boden. Einer der Fuhrwerker nahm das Tier am Zügel und band es zwischen den Fuhrwerken an.
Dann lagen wir unter den Fuhrwerken und warteten. Nach einer Stunde etwa sprengte eine Gruppe von Kriegern zwischen den Hügeln hervor. Sie schwangen die Gewehre über ihren Köpfen, stießen spitze Schreie aus, feuerten einige Schüsse ab und verschwanden wieder in einer Hügellücke.
Sie wollten uns mürbe machen.
Auf einem Felsen etwa fünfhundert Yards entfernt zeigte sich ein Krieger. Hochaufgerichtet stand er da und starrte zu uns her. »Gib mir deine Sharps, Kirby!«, forderte John Malcolm. Kirby reichte dem Wagenboss das Gewehr. Es war eine Sharps Borschardt, Kaliber .44-100, ein Weitschussgewehr, das auch für die Büffeljagd verwendet wurde.
Malcolm zog den Kolben an seine Schulter, stellte das Visier ein, spannte den Hahn und zielte sorgfältig. Das Gewehr donnerte. Der Cheyenne auf dem Felsen wurde umgerissen und war nicht mehr zu sehen. Wutgeheul erklang.
»Wenn es finster ist, ziehen wir weiter«, sagte ich so laut, dass mich jeder der Männer hören konnte. »Ich werde vorausreiten und versuchen, Fort Cobb zu erreichen.«
»Ein Himmelfahrtskommando«, murrte Joe wenig begeistert.
»Anders haben wir überhaupt keine Chance«, sagte ich. »Ich muss es zumindest versuchen. Ich habe nichts zu verlieren.«
»Der Gedanke, dass du genauso zurückkommst wie Halleran ist wenig erbaulich«, stieß Joe hervor.
»Es ist unsere einzige Chance«, wiederholte ich. »Darum reite ich.« Ich sprach es abschließend und mit Endgültigkeit im Tonfall.
*
Der Tag schien ewig zu dauern. Die Cheyenne griffen nicht an. Die Ruhe war trügerisch. Das Warten zerrte an den Nerven, die Angst wühlte in den Gemütern, Anspannung prägte die Gesichter. Schließlich ging die Sonne unter. Die Ränder der Wolken vor dem Sonnenuntergang schienen zu glühen. Die Abenddämmerung kroch heran, Dunst stieg aus den Tälern und Hügeleinschnitten, der rötliche Schein, den der Widerschein der Sonne auf das Land zauberte, verblasste.
Wir bereiteten uns auf einen Angriff vor. Aber die Cheyenne ließen uns schmoren. Sie kamen nicht. Wir bekamen nicht eine Nasenspitze von ihnen zu sehen. Es wurde dunkel. Ich band mein Pferd los. Die Zeit bis zum Mondaufgang wollte ich nutzen. Als es noch hell war, hatte ich eine Decke zerschnitten und die Teile um Hufe des Tieres gebunden. Jetzt zog ich den Bauchgurt straff und schwang mich in den Sattel. Joe trat heran und reichte mir die Hand. Ich ergriff sie. »Halt die Ohren steif, Logan-Amigo.«
»Auch Malcolm war herangetreten. »Hals- und Beinbruch, Marshal.«
»Danke.« Ich ritt an. Die Deckenfetzen dämpften die Hufschläge. Als ich mich einmal umschaute, sah ich die Planen der Schoner nur noch als große, helle Flecke in der Nacht. Die Männer befanden sich in Deckung. Ich hielt auf eine Hügellücke zu. Als ich in die Nähe der Hügel kam, saß ich ab. Meine Sporen hatte ich abgenommen, damit mich ihr Klingeln nicht verriet. Das Licht der Sterne drang nicht bis auf den Boden zwischen den Hügeln. Die Dunkelheit in der Kerbe mutete fast stofflich und greifbar an. Wenn nur mein Pferd nicht die Witterung seiner Artgenossen aufnahm und wieherte. Ich führte es mit der rechten Hand und legte ihm die Linke auf die Nüstern.
Yard um Yard legte ich zurück. Die Dunkelheit, die mich umgab, verstärkte das Gefühl von Einsamkeit und Verlorenheit. Manchmal hielt ich an, um mit angehaltenem Atem zu lauschen. Alles blieb ruhig. Und ich dachte schon, die Linie der Belagerer durchbrochen zu haben, als neben einem Busch eine Gestalt in die Höhe wuchs und mich ansprang. Heißer Atem schlug mir ins Gesicht. Ich zog das Knie hoch, traf, ein ersterbender Laut erklang, der Angreifer krümmt sich. Ich zog blitzschnell den Remington und schlug zu. Der Indianer brach auf die Knie nieder und stieß einen schrillen Schrei aus. Mein zweiter Schlag fällte ihn.
Die Nacht schien plötzlich zum Leben zu erwachen. Ich war mit einem Satz im Sattel und trieb das Pferd an. Das Tier streckte sich. Ich feuerte es mit dem langen Zügelende an. Wutgeheul stieg in die Höhe. Es dauerte nicht lange, dann vernahm ich hinter mir trommelnde Hufschläge. Ich wandte mich nach Norden und erreichte das Ufer des Creeks. Ohne zu zögern trieb ich das Pferd hinein. Das Wasser spritzte und gischtete. Das Tier trug mich ans jenseitige Ufer. Ich hielt an, saß ab und befreite die Hufe meines Pferdes von den Deckenfetzen. Dann saß ich wieder auf und ritt schnell weiter. Ich folgte dem Fluss nach Osten. Mein Pferd lief gleichmäßigen Galopp. Allzu sehr durfte ich es nicht verausgaben, denn das Finish konnte gnadenlos sein und ich war auf die Kraft und Ausdauer des Tieres angewiesen. Der Mond schob sich über den Horizont. Die Nacht lichtete sich ein wenig. Das Pferd und ich warfen einen Schatten.
Ich hielt an. Meine Hoffnung, dass ich die Indianer abgehängt hatte, verflüchtigte sich wie Rauch im Wind, als ich die fernen Hufschläge vernahm. So wie ich meine Verfolger hören konnte, hörten sie auch mich. Und einen Moment lang bereute ich es, dass ich die Deckenfetzen von den Hufen entfernt hatte. Aber dann sagte ich mir, dass sie das Tier nur behindert hätten und ritt weiter. Ich hielt mich zwischen den Hügeln. Wieder hielt ich an, um zu lauschen. Wie es schien, waren mir die Cheyenne nähergekommen. Ich ließ mein Pferd laufen. Die Frage war, wie lange das Tier dieses Tempo durchhielt. Ich musste dem Pferd genügend Energien belassen, die es im Notfall zu mobilisieren in der Lage war. Aber diesen Vorsatz konnte ich nicht in die Tat umsetzen, solange mich die Indianer vor sich her jagten.
Also beschloss ich, das Rudel zu erwarten. Ich lenkte mein Pferd einen Hügel hinauf, trieb es ein Stück über den Kamm und saß ab. Die Indianer, die auf meiner Fährte kamen, würden das Tier nicht sehen können. Mit einem Griff zog ich die Winchester aus dem Scabbard und repetierte. Dann ging ich in Stellung.
Die kleine Ebene, durch die ich gekommen war, lag im Mondlicht. Wie ein Vorbote von Untergang und Verderben schlug das Hufgetrappel heran. Unaufhaltsam näherte es sich. Ich blieb ruhig. Dann stob der Pulk in die Ebene. Es waren ein halbes Dutzend. Ich nahm den Eindruck von Wucht und Stärke, den sie vermittelten, auf. Entschlossen hob ich das Gewehr an die Schulter. Und dann hielt ich in den Haufen hinein. Die Detonationen übertönten das Hufgetrappel. In der Ebene rollte das Echo der Schüsse, stieß gegen die Bergflanken und verebbte in fernen Schluchten. Ich nahm mir nicht die Mühe, genau zu zielen und jagte meine Schüsse einfach in die Masse der heranbrausenden Reiter und Pferde hinein. Ich sah Mustangs niedergehen und sich überschlagen. Andere rasten in das Hindernis hinein und stürzten. Pferde stiegen, überschlugen sich und bildeten mit ihren Reitern ein wildes Durcheinander. Geschrei und Gewieher erhob sich. Krieger und Pferde wälzten sich am Boden. Ich lud und schoss, so schnell ich konnte. Mein verwirrendes Feuer brachte den wütenden Ansturm zum Stocken. Die Indianer schwärmten aus und jagten hierhin und dorthin, auf der Suche nach Deckung.
Die ersten Kugeln pfiffen über mich hinweg. Ich schoss auf die Mündungsfeuer. Die Krieger, die noch nicht kampfunfähig waren, huschten durch die Dunkelheit und versuchten den Hügel zu stürmen. Immer wieder peitschte mein Gewehr. In der Ebene standen noch drei Pferde. Ich feuerte auf die dahingleitenden Schemen, vergeudete aber nur meine Munition. Also nahm ich die Pferde aufs Korn. Mit dem Krachen meiner Schüsse brachen die Tiere zusammen. Zorniges Geschrei erklang. Mit verbissener Intensität griffen die Krieger an. Einer kam hinter einem Strauch hervor und rannte geduckt hangaufwärts. In rasender Folge schoss ich. Er warf die Arme hoch, kippte nach hinten, stürzte und rollte ein Stück den Abhang hinunter, bis er mit ausgebreiteten Armen liegen blieb.
Eine Wolke schob sich vor den Mond und verdunkelte ihn. Die Finsternis verdichtete sich. Eine Situation, die den Cheyenne entgegenkam. Im Schutz der Dunkelheit konnten sie den Hang erstürmen. Ich lief zu meinem Pferd, kam mit einem Satz in den Sattel und jagte es den Hang hinunter. Jetzt war die Nacht auch mein Verbündeter. Als ich mich umwandte, sah ich zwei Krieger auf der Kuppe des Hügels. Ihre Gestalten hoben sich deutlich gegen den helleren Sternenhimmel ab. Sie wurden mir nicht mehr gefährlich, denn sie konnten mir nicht mehr folgen. Ich verspürte Genugtuung, gab mich aber keinen Illusionen hin. Vor mir lagen noch gut fünfzig Meilen Wildnis, und Rauchsignale würden die Cheyennehorden mobilisieren, die sich zwischen mir und Fort Cobb herumtrieben. Mein Leben hing an einem seidenen Faden. Mein Skalp saß höllisch locker.
Ich ritt bis zum Morgen. Dann gönnte ich dem Pferd eine Pause. Da ich mich noch beim Fluss befand, mussten weder das Pferd noch ich Durst leiden. Ich aß etwas Pemmican. Dann drehte ich mir eine Zigarette und rauchte. Das Pferd zupfte an den Trieben der Büsche am Ufer.
Fünfzig Meilen. Was mich erwartete, wusste ich nicht. Der Tod war mein ständiger Begleiter. Nach einer Stunde ritt ich weiter. Ich ließ das Pferd im Schritt gehen.
*
Rauchsignale stiegen zum Himmel. Lee Warner sah sie und biss die Zähne zusammen. Staub klebte in seinen tagealten Bartstoppeln. Er hatte die Nacht zwischen den Hügeln verbracht. Jetzt war er auf dem Weg nach Osten. Die Rauchzeichen erhoben sich im Westen. Was sie bedeuteten, wusste der Bandit nicht. Dass sie nichts Gutes bedeuteten, war ihm klar.
Er war wachsam und angespannt und hatte das Gefühl von tausend Augen beobachtet zu werden. Ein eisiger Schauer rann ihm den Rücken hinunter, wenn er daran dachte, dass er den Indianern lebend in die Hände fallen könnte. Sie verstanden es, einen Mann langsam zu Tode zu quälen.
Mit bösartigem Knall zerriss ein Schuss die Stille. In den zerrinnenden Knall peitschten weitere Schüsse. Warner ließ sich aus dem Sattel fallen. Kugeln schlugen neben ihm ein. Er hörte im Aufpeitschen das gequälte Wiehern seines Pferdes und starrte entsetzt zu dem Tier hin. Es sank auf die Vorderbeine und kippte dann tot zur Seite. Eine Kugel riss ihm den Stetson vom Kopf. Aufjapsend warf er sich hinter den Felsen in den Sand und riss das Gewehr hoch.
Die letzte Detonation verhallte. Warner schluckte würgend. Sein Hals war wie zugeschnürt. Schweiß rann über seine Wangen und hinterließ helle Spuren in der Staubschicht auf seiner Haut. Mit brennenden Augen starrte Warner zu der Stelle, an der die Cheyenne lauerten. Er lag im Schatten des Felsens, der ihm Schutz bot. Seine Hoffnung, Fort Cobb heil zu erreichen, sank auf den Nullpunkt. Er blickte hinter sich und ließ seinen Blick über die Hügelkämme schweifen. Wenn einer der Krieger in seinen Rücken gelangte, konnte er ihn abschießen wie auf dem Schießstand. Warner spürte, wie die Panik in ihm hochkroch. Wahrscheinlich wurde schon die Hölle für ihn vorbereitet.
Er überlegte, ob er versuchen sollte, die Hügel zu erreichen. Dazu hätte er eine Fläche von zweihundert Yards überqueren müssen, auf der er den Kugeln der Krieger schutzlos ausgeliefert gewesen wäre. Schwer trug er an seiner Unschlüssigkeit. Hier konnte er nicht bleiben. Er spähte über den Felsen. Ein Gewehr krachte, blitzschnell zog der Bandit den Kopf ein. Die Kugel strich über das Gestein. Eine kleine Wolke von Steinstaub schwebte über dem Felsen.
Die Nerven des Banditen versagten. Er sprang auf, jagte eine Salve in die Richtung seiner Gegner, dann begann er zu laufen. Mal bewegte er sich nach links, dann wieder nach rechts. Seine Beine wirbelten. Schüsse peitschten, die Detonationen holten ihn ein und stießen über ihn hinweg. Er setzte seinen Zickzackkurs fort. Seine Lungen begannen zu pumpen, das Seitenstechen kam. Warner spürte, dass er langsamer wurde. Sein Atem flog. Schweiß rann ihm in die Augen. Er bot noch einmal alle Reserven auf, die in ihm steckten.
Er schaffte etwa hundert Yards. Dann warf er sich in den Schutz eines Felsen und japste wie ein Erstickender nach Luft. Sein Herz raste und jagte das Blut durch seine Adern. Die Anstrengung, die hinter ihm lag, ließ seine Augen aus den Höhlen quellen. Nur langsam nahmen Pulsschlag und Atmung den regulären Rhythmus wieder auf. Er wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß aus den Augenhöhlen. Seine Lippen waren trocken und rissig.
Er beschloss, seine Flucht zu den Hügeln fortzusetzen. In dem Moment, als er hochtaumelte und sich in Bewegung setzen wollte, sah er die Reiter vor der Hügellücke, die sein Ziel war. Als wäre er gegen eine unsichtbare Mauer geprallt hielt er inne. Verbrauchte Atemluft entwich seinen Lungen wie der Überdruck in einem Dampfkessel.
Er schaute über die Schulter. Auf dem Kamm des Hügels verharrten ebenfalls Cheyenne auf ihren Pferden. Der Weg nach Osten und Westen war ihm versperrt. Der Selbsterhaltungstrieb brach bei ihm durch – eines der ältesten Prinzipien der Menschheit. Er wandte sich nach Süden. Die Indianer setzten ihre Pferde in Bewegung. Stampfend kamen die Tiere in die Ebene. Die Angst und das Entsetzen peitschten Warner vorwärts. Bald taumelte er nur noch dahin. Die Hügel erschienen ihm endlos fern. Gehetzt schaute er sich um. Die Cheyenne ließen ihre Mustangs jetzt laufen. Schnell holten sie auf. Warner stolperte und stürzte. Speichel tropfte von seinen Lippen. Seine Lungen stachen, der Kopf drohte ihm zu platzen. Er rappelte sich wieder hoch. Geduckt, den Kopf zwischen die Schultern gezogen, stand er da. Seine Bronchien pfiffen. Er konnte jetzt schon die Gesichter der Indianer erkennen. Sie muteten wie versteinert an.
Warner hatte nicht mehr die Kraft, zu fliehen. Seine Beine wollten ihn kaum noch tragen. Und obwohl es warm war, spürte er nur noch eisige Kälte. Sie kam tief aus seinem Innersten. Seine Zähne schlugen aufeinander wie im Schüttelfrost.
Dann waren die Krieger heran und kreisten ihn ein. Einer trieb sein Pferd an und ritt ihn nieder. Warner lag am Boden. Das Gewehr hatte er verloren. Seine Finger verkrallten sich im Boden, seine Nägel brachen, seine Zähne schmerzten, so sehr biss er sie zusammen.
Einer der Indianer blaffte einen Befehl. Drei Krieger sprangen von ihren Pferden. Einer hob die Winchester des Banditen auf und brachte sie dem Anführer des Rudels. Die beiden anderen fesselten Warner die Hände vor dem Leib zusammen. Ein Cheyenne zog ihm den Revolver aus dem Holster, dann schlug er ihm die flache Hand ins Gesicht. »Wir dich töten!«, grunzte der Krieger.
Eine unsichtbare Hand schien Warner zu würgen. Sie legten ihm die Schlinge eines langen Seiles aus Rohleder um die Handgelenke, die Krieger saßen wieder auf. Einer hielt das andere Ende des Seiles in der Hand. Sie ritten an. Der Strick spannte sich. Warner wurde mitgezerrt.
Die Sonne knallte auf ihn herunter und höhlte ihn aus. Jeder Schritt wurde zur Tortur. Seine Füße brannten in den Stiefeln. Nur noch ein übermenschlicher Durchhaltewille hielt ihn auf den Beinen. Sie zogen nach Osten. In der Ferne tauchte Wald auf. Und dann konnte Warner nicht mehr. Er brach auf die Knie nieder, dann fiel er aufs Gesicht. Die Indianer zügelten die Pferde. Zwei saßen ab. Einer nahm einen Wassersack vom Sattel und ging damit zu Warner, der stoßweise atmend am Boden lag. Ohne jede Gemütsregung starrte er sekundenlang auf den Weißen hinunter. Dann packte er ihn am Kragen der Weste und zerrte ihn in die Höhe. Warner lag auf den Knien. Sein Kopf baumelte vor der Brust.
»Trink!«, gebot der Cheyenne und hielt ihm den Wassersack hin.
Mit zitternden Händen griff Warner danach. Schließlich setzte er ihn sich an die Lippen und trank mit gierigen Zügen. Wasser rann über sein Kinn und tropfte auf seine Brust. Dann schüttete er sich etwas von dem Wasser über das Gesicht. Der Cheyenne riss ihm den Wassersack aus den Händen. »Steh auf!«
»Ich – ich kann nicht mehr. Macht Schluss, verdammt, schießt mir endlich eine Kugel in den Kopf.«
»Wir dich langsam töten.«
Warner erschauerte. »Ihr seid dreckige Bastarde!«, knirschte er und erntete dafür einen Schlag ins Gesicht. Er hoffte auf eine schnelle Kugel, aber die Krieger ließen sich nicht provozieren. Ein Befehl ertönte. Die beiden Krieger sprangen auf ihre Pferde. Der Pulk ritt an. Es war eine Überwindung, eine Anstrengung, sich hochzudrücken, und kostete Warner allen Willen. Schwankend stand er. Dann straffte sich das Seil und er wurde mitgezerrt. Für einen Moment loderte die Flamme des Widerstandes in ihm in die Höhe, sank aber sofort wieder zusammen, und da war nur noch Schwäche - diese grenzenlose Schwäche, die ein klares Denken unmöglich machte und seine Muskeln und Sehnen lähmte. In seiner Brust entstand ein tiefes Gurgeln. Er kam sich vor, als sei er jeden Gedankens, jeden Willens beraubt. Ein milchiger Schleier legte sich über seine Augen und seine Lider wurden schwer wie Blei. Benommenheit brandete gegen sein Bewusstsein an.
Dann nahm sie der Wald auf. Die Kronen der Bäume filterten das Sonnenlicht. Auf dem Boden wechselten Licht und Schatten. Ein Teppich aus braunen, abgestorbenen Nadeln dämpfte die Hufschläge. Die Luft schien zu stehen.
Sie erreichten eine Lichtung. Hier wuchs kniehohes Gras. Die Pferde wurden angehalten, die Cheyenne saßen ab. Warner wurde gepackt und zu einem Baum geschleppt, an den sie ihn fesselten. Dann machten sie ein Feuer, setzten sich im Kreis herum und begannen zu palavern. Warner verspürte kalte, verzehrende Furcht ...
*
Ich sah die dunklen Punkte am Himmel. Lautlos zogen sie über einer bestimmten Stelle ihre Bahnen. Aasgeier – Todesvögel. Irgendetwas musste südlich von mir ihre Aufmerksamkeit erregt haben. Ich hatte mein Pferd angehalten. Es hatte den Kopf gesenkt und zupfte an einem Grasbüschel. Ich hatte die Hände übereinander auf das Sattelhorn gelegt und beobachtete versonnen die Geier.
Sollte ich nachsehen?
Ich dachte an Lee Warner. Und ich entschloss mich. Ein Schenkeldruck und das Pferd setzte sich in Bewegung. Die Hügel öffneten sich und eine tafelflache Ebene von einem Durchmesser von etwa fünfhundert Yards lag vor meinem Blick. Einige Geier hatten sich mitten auf dieser Ebene bereits niedergelassen. Flügelschlagend stritten sie sich um die Beute, die ich im hohen Gras nicht sehen konnte. Soeben landeten wieder zwei der Aasfresser mit ausgebreiteten Fittichen.
Ich ritt hin. Bald konnte ich das Krächzen der Geier vernehmen. Mit hochgereckten Köpfen blickten sie mir entgegen. Dann sah ich, dass es sich um ein Pferd handelte, das da lag. Es trug einen Sattel und Zaumzeug und mir war klar, dass es einem Weißen gehört hatte.
Lee Warner!
Als ich bei dem Kadaver anhielt, flatterten einige der Geier ein Stück zur Seite, um sich wieder niederzulassen und mich misstrauisch mit kalten Augen zu beobachten. Sie hatten bereits Fleischstücke aus dem Pferdekörper gerissen. Ich ließ meinen sichernden Blick in die Runde schweifen. Die Luft schien in der Hitze zu zittern.
Dann heftete ich meinen Blick auf den Boden. Ich folgte der Spur, die deutlich vor mir lag, schließlich stieß ich auf eine Stelle, an der das Gras von vielen Pferden niedergetrampelt war. Von hier aus führte die Spur nach Osten. Ich folgte ihr. Meine Nerven waren zum Zerreißen angespannt. Ich sicherte ununterbrochen in die Runde. Die Sonne knallte auf mich hernieder. Kein Windhauch regte sich. Es war, als berührten Flammen mein Gesicht. Das Land lag schimmernd unter einem Hitzeschleier. Dann sah ich weit vor mir die dunkle Front eines Waldes. Die Düsternis zwischen den alten Stämmen schien Unheil zu versprechen. Ich zerrte mein Pferd in den Stand. Das Tier prustete. Die Spur führte auf den Wald zu. Über die dunklen Wipfel erhob sich Rauch. Ich riss am Zügel und nötigte mein Pferd, rückwärts zu gehen. Als mich der Kamm des Hügels deckte, saß ich ab. Ich band das Pferd an einen Strauch und kroch auf die Hügelkuppe zurück. Lange Zeit beobachtete ich den Wald. Der Rauch verriet mir, dass in dem Wald die Cheyenne kampierten. Es war für mich keine Frage, dass Warner der Bande in die Hände gefallen war und sich ebenfalls in dem Wald befand.
Ich konnte ihn nicht einfach den Indianern überlassen. Es war allerdings ein Spiel mit dem Feuer, wenn ich versuchte, ihn zu befreien. Guter Rat war teuer. Ich schaute nach dem Stand der Sonne. Sie stand hoch im Süden. In rauchiger Ferne waren die Klüfte und Grate einer Felsenkette zu sehen. Die Gipfel waren in weiße Wolken gehüllt.
Ich gab diesen Platz auf und ritt nach Süden. Und aus südlicher Richtung näherte ich mich schließlich erneut dem Wald. Am Waldrand saß ich ab und führte mein Pferd an der Trense zwischen die uralten Stämme. Die Sonne malte goldene Muster auf den Boden.
Der Geruch von Harz und Fichtennadeln erfüllte die Luft. Irgendwo im Gebüsch summten die Bienen. Die knorrigen Bäume standen oft dicht beisammen; ihre Äste hatten sich ineinander verflochten, sodass sie ein Dach bildeten, unter dem selbst bei praller Sonne ständig ein düsteres Halbdunkel herrschte. Zwischen den Stämmen wucherten Dornbüsche, Mesquitesträucher und Ocotillos.
Ich band mein Pferd an, nahm das Gewehr und pirschte vorwärts. Beerenkräuter raschelten unter meinen Füßen. Ich huschte von Baum zu Baum, verharrte manchmal und lauschte mit angehaltenem Atem. Doch nur das Zwitschern der Vögel war zu vernehmen. Tiefe Ruhe lag über allem.
Aber dann lichtete sich der Wald. Ich ließ mich zu Boden gleiten und glitt wie eine Schlange so weit an die Lichtung heran, dass ich Einzelheiten erkennen konnte. Um ein Feuer saßen über ein Dutzend Krieger. Einige von ihnen hatten Federn in den Haaren. Die Pferde standen abseits und grasten. An einen Baum war Lee Warner gefesselt. Sein Kinn war auf die Brust gesunken. Wirr hingen ihm die dunklen Haare in die Stirn.
Einmal erhob sich einer der Krieger, ging zu Warner hin, prüfte seine Fesselung und spuckte ihn an. Ich sah, dass er die Lippen bewegte. Warner hob das Gesicht. Der Krieger schwang herum und kehrte zum Feuer zurück, wo er sich in den Schneidersitz niederließ.
Ich blieb liegen. Nach einer Stunde etwa erhoben sich die Krieger. Sie liefen zu ihren Pferden, banden sie los und sprangen in die Sättel. Dann ritten sie in den Wald hinein. Zwei Cheyenne blieben zurück. Das Gros der Bande verschwand im Wald. Die Geräusche wurden leiser und leiser und versanken schließlich in der Stille.
Die beiden Krieger, die zurückgeblieben waren, setzten sich wieder ans Feuer. Sie unterhielten sich. Ich wartete etwa eine halbe Stunde, bis ich mir sicher sein konnte, dass das Rudel, das davongeritten war, eventuelle Schüsse nicht mehr hören konnte. Dann kroch ich näher an das Lager heran.
Es war mir unmöglich, die beiden zu überwältigen. Die Lichtung hatte einen Durchmesser von etwa fünfzig Yards und ich hätte die Hälfte dieser Strecke zurücklegen müssen, um zu den beiden Kriegern zu gelangen.
Ich hatte keine andere Wahl.
Kurzentschlossen richtete ich mich auf, ein paar schnelle Schritte brachten mich an den Rand der Lichtung. Einer der Krieger sah mich, griff nach seinem Gewehr und sprang auf. Ich schoss ihn nieder, der andere Cheyenne schnellte hoch und wandte sich mir zu. Er wollte das Gewehr an die Hüfte reißen, aber meine Kugel war schneller. Er wurde herumgerissen und sank zu Boden. Die Detonationen versickerten zwischen den Bäumen.
Ich glitt zu den beiden reglosen Gestalten hin. Einer der Krieger war bei Besinnung. Aus glitzernden Augen starrte er mich an. Meine Kugel hatte ihn in die Brust getroffen. Der andere hatte die Augen geschlossen, atmete aber noch. Ich nahm ihre Gewehre und schleuderte sie ein Stück fort, dann ging ich zu den Pferden und band eines der Tiere los, führte es zu Warner und löste dessen Fesselung. Er brach auf die Knie nieder und stöhnte langanhaltend.
»O verdammt«, brach es aus seiner Kehle. »Es gibt keinen Knochen in meinem Körper, den ich nicht spüre.«
»Steig auf das Pferd«, gebot ich. »Wir müssen zusehen, dass wir verschwinden.«
Ich half ihm, auf die Beine zu kommen und aufzusitzen. Dann holte ich eines der Gewehre und gab es ihm. Schließlich nahm ich das Pferd am primitiven Kopfgeschirr und führte es in den Wald hinein. Bei meinem Pferd angekommen saß ich auf. Wir ritten aus dem Wald. Dann wandten wir uns nach Osten.
»Warum bist du alleine unterwegs, Logan?«, fragte der Bandit. Seine Stimme klang mitgenommen. Es war mehr ein heiseres Geflüster.
»Der Wagenzug konnte nicht mehr weiter. Die Cheyenne haben ihn eingeschlossen. Ich bin auf dem Weg nach Fort Cobb, um Hilfe zu holen. Dein Gefährte Halleran ist tot. Die Indianer haben ihm die Kehle durchgeschnitten.«
Warner knirschte mit den Zähnen.
Ich ergriff noch einmal das Wort: »Du begleitest mich nach Fort Cobb. Ich werde ständig ein Auge auf dich haben, Warner. Und am Ende bringe ich dich nach Texas zurück.«
»Ist dir das so wichtig, Logan?«
»Ausgesprochen wichtig. Deine Sorte ist die Luft nicht wert, die sie atmet.«
»Du hast mir ein Gewehr gegeben. Hast du keine Angst, dass ich es auf dich richte?«
»Ohne mich hast du nicht den Hauch einer Chance, Warner. Du hast dem Tod einmal ins Auge geblickt. Sicher legst du keinen Wert darauf, den Cheyenne noch einmal in die Hände zu fallen.«
»Du bist für mich ein Buch mit sieben Siegeln, Marshal. Ich werde nicht klug aus dir.«
»Musst du auch nicht.«
Der Bandit schoss mir einen sengenden Blick zu. Ich musste auf der Hut sein. Aber ich wollte nicht, dass der Bandit unbewaffnet ritt. Wir mussten immer und überall mit Indianern rechnen und es war möglich, dass wir getrennt wurden. Ich wollte ihn im Falle des Falles nicht hilflos den Cheyenne überlassen.
*
»Warum kommen Sie nicht?«, fragte John Malcolm.
»Sie haben Zeit«, versetzte Joe. »Wir sind ihnen sicher. Denken sie. Es ist ihr Bestreben, uns zu zermürben. Sie gehen kein Risiko mehr ein. Haben scheinbar begriffen, dass der Preis, den sie ihrem Fanatismus bezahlt hatten, zu hoch war.«
Kirby Jones holte rasselnd Luft. »Die Warterei macht mich fertig. Wenn bloß endlich etwas geschähe, das diese verdammte Anspannung von mir nimmt.«
»Wir müssen Halleran und Gary begraben«, rief Steve Sanders. »In dieser Hitze fangen sie schon zu stinken an.«
»Schaufelt zwei Gräber«, ordnete Malcolm an.
Sie holten eine Hacke und zwei Schaufeln von einem der Fuhrwerke und begannen am Flussufer zu graben. John Malcolm, Joe und Herb Farrow, der mit seiner zerschossenen Schulter nicht helfen konnte, hielten Wache.
Die Cheyenne ließen sich nicht sehen. Aber sie waren da. In ihren Herzen brannte der tödliche Hass, in den Gemütern loderte der Vernichtungswille.
Die drei Fuhrwerker hatten zwei flache Gruben ausgehoben, in die sie ihren getöteten Gefährten und den toten Banditen legten. John Malcolm kroch unter dem Fuhrwerk hervor, stellte sich zu ihnen und sagte: »Herr, gib Gary Cameron die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihm. Herr, lass ihn ruhen in Frieden. Amen.«
Für den toten Banditen sprach niemand ein Gebet.
Sie schaufelten Erdreich auf die beiden Leichname. Bald zeugten nur noch zwei flache Erdhügel davon, dass hier zwei Männer ihre letzte Ruhe gefunden hatten.
Sie lagen wieder unter den Wagen. Schweißnasse Hände umklammerten die Gewehre. Jesse Vaughams Lippen zuckten. In seinen Augen irrlichterte es. Plötzlich kroch er unter dem Wagen hervor. »Ich halte das nicht mehr aus!«, stieß er hervor. »Ich stehe kurz davor, verrückt zu werden.«
Er setzte sich in Bewegung.
»Er ist übergeschnappt!«, presste Malcolm hervor. »Er rennt den Indsmen direkt vor die Mündungen.«
»Kommt endlich, ihr verdammten Bastarde!«, brüllte Vaugham und hob das Gewehr über seinen Kopf, schüttelte es wild und drehte sich auf der Stelle.
»Hierher, Jesse!«, schrie Malcolm. »Verdammt!«
Vaugham lief vor den Fuhrwerken auf und ab. »Kommt endlich, damit wir es hinter uns bringen!« Plötzlich hielt er an, nahm das Gewehr an die Hüfte und jagte einige Schüsse aus dem Lauf. Die Detonationen rollten die Abhänge rundum hinauf und zerflatterten über den Hügeln.
Die Indianer ließen sich nicht aus der Reserve locken.
Ein Laut, der sich anhörte wie trockenes Schluchzen, entrang sich Vaugham. »Warum kommen Sie nicht?«, entrang es sich ihm. »Warum greifen sie nicht endlich an.«
»Komm unter den Wagen!«, gebot Joe Hawk.
Vaugham schaute wie ein Erwachender. Und dann beeilte er sich, um in Deckung zu kommen.
»Ob Logan durchgekommen ist?«, fragte Malcolm.
»Wenn nicht«, versetzte Joe, »dann hätten sie uns seinen Leichnam geschickt, so wie sie uns Halleran geschickt haben.«
»Wie lange kann es dauern, bis Hilfe eintrifft?«
»Noch drei Tage etwa.«
»Großer Gott. Sollen wir hier noch drei Tage ...«
Die Stimme des Wagenbosses brach. Er strich sich mit fahriger Geste über das Gesicht und wirkte verzweifelt.
»Wir warten nicht«, sagte Joe mit entschlossener Stimme. »In der Nacht versuchen wir durchzubrechen. Wir müssen versuchen, aus dieser tödlichen Umklammerung hinauszukommen. Wenn es uns gelingt, können wir bis zum Morgen fünfzehn Meilen schaffen.«
»Es – es ist Selbstmord«, flüsterte Malcolm.
»Hier darauf zu warten, dass einer nach dem anderen durchdreht, ist nichts anderes«, versetzte Joe.
»Ich schieße uns den Weg frei!«, stieß Jesse Vaugham plötzlich hervor. »Ja, ich gehe voraus und schieße uns den Weg frei. Warten wir nicht länger.«
Er rollte unter dem Wagen hervor und begann zu laufen. Er war nicht mehr Herr seiner Sinne. Angst und Ungewissheit ließen ihn die Nerven verlieren.
»Dieser Narr!«, fauchte Joe und kroch unter dem Wagen hervor. Vaugham war schon fünfzehn Schritte entfernt. Joe nahm die Verfolgung auf. Aber Vaugham lief schnell. Joe hatte Mühe, ihn einzuholen. Sie waren ungefähr hundert Yards vom Lager entfernt, als ein Schuss krachte. Vaugham blieb abrupt stehen. Dann fiel er auf die Knie nieder. Sein Oberkörper pendelte vor und zurück.
Joe hechtete zu Boden. Weitere Schüsse krachten. Vaugham röchelte, dann fiel er aufs Gesicht. Auf dem Hügel wurden Pulverdampfwolken vom lauen Wind zerfasert.
Joe hob ein wenig den Kopf. Sofort krachte es. Erdreich wurde ihm ins Gesicht geschleudert. Wieder stöhnte Vaugham. »Wo hat es dich erwischt, Vaugham?«, fragte Joe.
Die Antwort bestand in einem unverständlichen Gemurmel. Auf dem Bauch kroch Joe zu dem Fuhrwerker hin. Er rollte sich auf den Rücken, zog den Körper des Verwundeten halb auf sich und begann sich mit Hilfe der Beine in Richtung der Fuhrwerke zu schieben. Es war anstrengend und Joe kam nur langsam vorwärts. Sein Gewehr behinderte ihn. Aber er konnte die Waffe nicht einfach zurücklassen. Insgeheim verfluchte er Vaugham. Sein Wahnwitz hatte Joe in diese prekäre Situation gebracht.
Schritt für Schritt schob sich Joe auf die Fuhrwerke zu. Er hatte etwa fünfzig Yards zurückgelegt, als John Malcolm und Kirby Jones heranliefen. Sie packten Vaugham unter den Achseln und schleiften ihn zu den Fuhrwerken. Joe erhob sich und folgte ihnen.
Zwischen den Wagen legten sie Vaugham zu Boden. Ein Blutfaden rann aus seinem Mundwinkel. Er verdrehte die Augen. Plötzlich bäumte er sich auf, ein Schwall Blut brach aus seinem Mund, dann fiel er zurück, ein Zittern durchlief die Gestalt, dann rollte sein Kopf zur Seite. Die absolute Leere des Todes senkte sich in das bärtige Gesicht.
»Zur Hölle!«, schnappte Malcolm. »Sterben hätte er auch dort draußen können.«
Joe bückte sich und schloss dem Toten die Augen. Steve Sanders und Kirby Jones hoben ein weiteres Grab aus, in das sie Jesse Vaugham legten. Dann waren es drei namenlose Gräber, die hier am Fluss zurückbleiben würden und die der Wind sehr bald eingeebnet haben würde. Es war ein gnadenloses Land, in dem man aus seinen Lektionen entweder schnell lernte oder unterging.
»Wir werden alle sterben«, flüsterte Herb Farrow, als sie an Vaughams Grab standen. »Alle ...«
Es klang wie ein böses Omen.
»Waffen und Munition dürfen ihnen auf keinen Fall in die Hände fallen«, murmelte John Malcolm. »Ich werde ...«
Er sprach nicht weiter, sondern stieg auf einen der Wagen. Mit dem Gewehrkolben schlug er den Boden aus einem kleinen Fass, in dem Pulver aufbewahrt wurde. Er schüttete Pulver heraus und legte vom Ende der Ladefläche bis zu den anderen Pulverfässern eine dünne Spur, an deren Ende er das offene Fass mit dem restlichen Pulver ablegte. Genauso verfuhr er auf dem anderen Fuhrwerk. Dann sagte er: »Ehe wir draufgehen zünden wir das Pulver an und sorgen für ein kleines Feuerwerk. Hoffentlich reißt es ein paar von den roten Teufeln in die Hölle.«
Joe Hawk stand neben einem der Räder und ließ seine prüfenden Blick über die Hügelkämme gleiten. Er sagte: »Am stärksten dürften sie im Osten konzentriert sein, weil das unsere bisherige Richtung war. Wir werden daher versuchen, nach Süden durchzubrechen.«
»Wir schaffen es nicht«, prophezeite der Wagenboss mit kehliger Stimme. »Die Fuhrwerke sind über einige hundert Yards zu hören. Sobald wir uns zwischen den Hügeln befinden, fallen sie über uns her wie die Teufel. Ich bin dafür, dass wir hierbleiben und auf Hilfe warten.«
»Was meint ihr dazu?«, fragte Joe die anderen Fuhrwerker.
»Ich bin Johns Meinung«, sagte Steve Sanders.
»Ich auch«, gab Herb Farrow zu verstehen.
»Ich schließe mich der Auffassung des Marshals an«, erklärte Kirby Jones.
»Ihr seid überstimmt«, knurrte Sanders. »Wir bleiben hier.«
Joe schwieg.
Kirby Jones spuckte zur Seite aus. »Sie werden uns an die Bordwände der Schoner nageln«, murmelte der Fuhrwerker. »Zur Hölle damit.«
Plötzlich sagte Joe: »Verdammt, sie schleichen sich an.«
Einige Sträucher, wie sie südlich des Creeks wuchsen, bewegten sich. Die Indianer hatten sich damit getarnt und krochen näher. Als sie bis auf fünfzig Yards heran waren, schnellten sie aus dem Gras in die Höhe und stürmten schießend näher. Die Gewehre der Verteidiger begannen zu krachen. Angreifer wurden herumgewirbelt und geschüttelt und sanken tot oder sterbend zu Boden. Eine Wand aus Pulverdampf stellte sich vor den Fuhrwerken auf. Der Lärm artete aus zu einem höllischen Choral.
Die Indianer wurden zurückgeschlagen. Einige wurden noch auf der Flucht erschossen. Ringsum auf den Hügeln erschienen Krieger. Gellendes Geheul erhob sich. Die Herzen der Weißen schlugen höher. Der Schreck stand ihnen in die Gesichter geschrieben und zog wie schleichendes Gift durch ihre Blutbahnen.
»Hier überrennen Sie uns früher oder später«, gab Joe zu bedenken. »Das sind mindestens hundert Krieger, die uns eingekesselt haben. Unsere einzige Chance besteht in der Flucht.«
Versonnen starrte Malcolm auf einen unbestimmten Punkt in der Ferne. Pulverschmauch klebte in seinem Gesicht. In einem scharfen Kontrast dazu stand das Weiße in seinen Augen. »Okay«, sagte er plötzlich und nickte. »Wir wagen es.«
Sie warteten die Nacht ab. Dann spannten sie die Pferde vor die Fuhrwerke. John Malcolm und Steve Sanders stiegen auf den Bock des einen Wagens, Kirby Jones und Herb Farrow sollten das andere Fuhrwerk fahren. Joe schwang sich auf sein Pferd und ritt voraus. Er hielt auf die Hügel im Süden zu. Die Fuhrwerke rumpelten. Die Geräusche muteten die Männer überlaut an. Die Anspannung hatte sie fest im Klammergriff. Dazu gesellte sich die Angst. Der Mond befand sich noch hinter den Hügeln im Osten. Sie fuhren zwischen die Hügel und bewegten sich in den Schattenfeldern. Das Gelände stieg an. Die Riemen strafften sich und knarrten in den Sielen. Wie Säulen stemmten die Pferde ihre Hinterbeine gegen den Boden. Manchmal klatschten die langen Zügel auf die Rücken der Tiere.
Schemenhafte Gestalten lösten sich plötzlich aus der Dunkelheit. Eine sprang Joe von der Seite an und versuchte ihn aus dem Sattel zu reißen. Joe, der das Gewehr in der Hand hielt, schlug zu und der Schemen ging mit einem Aufschrei zu Boden.
Andere Krieger versuchten auf die Fuhrwerke zu klettern. Die Fuhrwerker schossen mit ihren Revolvern. Grelle Mündungsblitze zuckten aus den Läufen. Dumpfes Dröhnen erfüllte den Hügeleinschnitt. »Durchbruch!«, brüllte Joe und gab seinem Pferd die Sporen. Einen Krieger, der sich ihm in den Weg warf, ritt er über den Haufen.
»Hüh! Lauft!« Die Kutscher trieben die Pferde an. Die Tiere legten sich in die Geschirre. Die Fuhrwerke jagten dahin, schlingerten und holperten. Die Indianer konnten zu Fuß nicht folgen. Die Handvoll, die es dennoch versuchte, trieb Joe, der die Wagen an sich vorbeigelassen hatte, mit einigen Schnappschüssen zurück. Dann riss er sein Pferd herum und stob hinter den Fuhrwerken her ...
Schaum tropfte von den Nüstern der Pferde. Die Tiere röchelten und röhrten. Ihre Flanken zitterten. »Ob sie uns folgen?«, fragte John Malcolm beklommen.
»Nichts zu hören«, erwiderte Joe Hawk. »Aber Morgen kommen sie ganz sicher. Die lassen uns nicht einfach ziehen. Sehen wir zu, dass wir einen guten Vorsprung herausfahren.«
Sie brachen wieder auf. Der Mond hatte sich über die Hügel geschoben und versilberte mit seinem Licht die Hügelkuppen. Der Tod hatte noch einmal einen Aufschub gewährt. Was der nächste Tag bringen würde, wusste keiner der Männer, die unter dem sternenübersäten Himmel dahinzogen, deren Zukunft sich allerdings dunkel und wenig aussichtsreich darstellte.
*
Ich wusste, worauf ich mich eingelassen hatten, als ich Lee Warner ein geladenes Gewehr überließ. Dem Banditen war nichts heilig. Das Wort Dankbarkeit war in seinem Sprachschatz nicht vorhanden. Ich war mir der Gefahr, die von ihm ausging, voll und ganz bewusst.
Wir lagerten zwischen einigen Büschen in einer Mulde. Die Pferde waren angebunden, zusätzlich hatten wir ihnen die Vorderbeine gehobbelt, um zu verhindern, dass sie sich gegebenenfalls losrissen und durchgingen.
Ich konnte nicht schlafen. Tiefe, regelmäßige Atemzüge sagten mir, dass Warner schlief. Ich richtete meinen Oberkörper auf. Die Hügel ringsum hoben sich scharf gegen den Sternenhimmel ab. Der Nachwind ließ das Blattwerk der Büsche rascheln. Ich warf die Decke von mir und erhob mich. Warner wurde nicht wach. Ich nahm mein Gewehr. Und einer jähen Eingebung folgend bückte ich mich auch nach dem Gewehr des Banditen. Ich entfernte mich vom Lager. Als weit genug weg war, hebelte ich die Patronen aus dem Magazin der Winchester des Banditen. Ich sammelte die Patronen ein und steckte sie in die Taschen meiner Weste. Dann kehrte ich zum Lager zurück und legte das Gewehr wieder an seinen Platz. Der Bandit hatte nichts bemerkt. Ich legte mich wieder hin. Und irgendwann übermannte auch mich der Schlaf.
Ich wurde wach als ein Pferd prustete. Der Platz, an dem Warner gelegen hatte, war leer. Ein Pferd stampfte. Ich erhob mich. »Warner!«
Er trat zwischen den Büschen hervor und hielt das Gewehr im Anschlag. »Ich verschwinde, Logan. Dich muss ich allerdings zurücklassen. Mein Interesse, von dir nach Texas gebracht zu werden, ist ausgesprochen gering. Ich denke, du kannst das verstehen.«
Es klang spöttisch. Der Bandit war sich seiner Überlegenheit sehr sicher. »Hast du keine Angst, dass du den Cheyenne wieder in die Hände fällst?«, fragte ich. »Ein zweites Mal werde ich nicht zur Stelle sein, um deinen Skalp zu retten.«
»Ich bin auch kein Anfänger, Logan.«
»Du bist ein Narr«, sagte ich.
Warner lachte. »Vielleicht bin ich das. Du aber bist ein Dummkopf, Logan. Andernfalls hättest du mir kein Gewehr gegeben. Hast du denn wirklich gedacht, ich lass mich von dir wie ein Hammel zur Schlachtbank führen.«
»Du wirst ab sofort gefesselt reiten, Warner«, sagte ich. »Du bist hinterhältig.«
Wieder lachte der Bandit hohnvoll. »Ich glaube, du verkennst hier etwas, Logan. Aber ich will es gnädig mit dir machen. Ich glaube, ich bin es dir schuldig. Eine schnelle Kugel ist immer noch gnädiger als der Tod am Marterpfahl der Cheyenne.«
Ich zog den Remington und spannte den Hahn. Es knackte, als die Feder einrastete. Warner drückte ab. Es machte nur klick, als der Schlagbolzen in die leere Kammer stieß. Der Bandit riss am Ladebügel und drückte erneut ab. Wieder machte es klick. »Verdammt!«, heulte er auf.
»Die Patronen befinden sich in meiner Westentasche«, sagte ich. »Ich habe es geahnt. Mein Gefühl hat mich nicht getrogen. Lass das Gewehr fallen, heb die Hände und komm her. Ich werde dich fesseln.«
Der Bandit setzte sich in Bewegung. Entgegen meiner Aufforderung ließ er das wertlose Gewehr nicht fallen. »Du schießt nicht, Logan«, stieß er zwischen den Zähnen hervor. »Zum einen bin ich unbewaffnet, zum anderen würdest du die Rothäute auf uns aufmerksam machen.«
»Darauf solltest du dich nicht verlassen.«
»Ich weiß es.«
Warner griff an und schlug mit dem Gewehr nach mir. Ich konnte dem Schlag ausweichen. Zorn wallte in mir hoch. Er nutzte die Situation eiskalt aus. Ein Schuss hätte in der Tat die Indianer auf uns aufmerksam gemacht. Ich ließ den Hammer des Remington in die Ruherast gleiten und schlug mit der Waffe nach dem Banditen. Aber er glitt behände zur Seite und rammte mir den Lauf der Winchester in den Leib. Ein abgerissener Laut entrang sich mir, ich knickte in der Mitte ein, machte aber instinktiv einen Schritt nach vorn und der Schlag, der mich wohl gefällt hatte, pfiff ins Leere. Der Bandit wurde von seinem eigenen Schwung herumgerissen. Ich hämmerte ihm die linke Faust in den Magen und er krümmte sich stöhnend. Und dann knallte ich ihm den Lauf des Remington gegen den Schädel. Er fiel auf die Knie. Seine Hände öffneten sich, die Winchester klatschte zu Boden. Im nächsten Moment aber warf er sich nach vorn, umklammerte mit beiden Armen meine Beine und brachte mich zu Fall. Dann warf er sich auf mich. Seine Hände legten sich um meinen Hals und pressten ihn zusammen. Ich zog das Bein an und rammte ihm das Knie in den Rücken, ließ den Remington fahren und packte mit beiden Händen seine Handgelenke, um den Würgegriff zu lockern.
Kein Laut drang aus meiner zugepressten Kehle. Die Luft wurde mir knapp. Der Bandit entwickelte ungeahnte Kräfte. Meine Lungen begannen zu stechen und ich verspürte Schwindelgefühl. Die Benommenheit kam wie eine graue, alles verschlingende Flut. Noch einmal rammte ich dem Banditen das Knie in den Rücken. Er ließ nicht locker. Der Schädel drohte mir zu platzen, in meinen Ohren rauschte das Blut, in meinen Schläfen hämmerte es.
Ich drosch Warner die Faust gegen die Rippen. Ein Keuchton entrang sich ihm. Vor meinen Augen begannen sich feurige Kreise zu drehen. Lange würde ich nicht mehr durchhalten. Alles in mir schrie nach frischem Sauerstoff. Ich wand mich unter dem Banditen, bäumte mich auf, hämmerte ihm erneut die Faust gegen die Rippen, merkte aber, wie meine Kraft zu erlahmen begann.
Er hielt meinen Schlägen nicht stand. Plötzlich nahm er die Hände von meinem Hals, verpasste mir einen rechten Haken und hämmerte mir sogleich die Linke gegen den Schädel.
Meine Lungen füllten sich mit Luft. Vor meinen Augen schien die Welt zu explodieren. Panik kroch in mir hoch. Wenn es ihm gelang, mich zu überwältigen, würde er mich töten. Dieser Schurke war tödlicher als die Cholera. Ich hatte die beiden Schläge noch nicht verdaut, als sich seine Hände wieder um meinen Hals legten. Ehe er jedoch richtig zudrücken konnte, packte ich seine Arme an den Handgelenken und bog sie auseinander. Mein Oberkörper schnellte hoch, ich versetzte ihm einen Kopfstoß mitten ins Gesicht. Warner brüllte auf. Ich packte ihn mit beiden Händen an der Weste und schleuderte ihn von mir.
Ich kam hoch. Mein Hals schmerzte und das Schlucken bereitete mir Mühe. Warner lag auf allen vieren. Ich drosch ihm die Faust gegen den Schädel und er fiel auf die Seite, rollte herum und kam hoch. Mit einem Aufschrei griff er an. Ich empfing ihn mit einem Aufwärtshaken, der ihn auf die Zehenspitzen stellte. Meine Hand schmerzte. Schnell öffnete und schloss ich sie einige Male, um sie geschmeidig zu halten. Der Bandit taumelte zurück. Ich setzte nach und donnerte ihm die Linke gegen den Kinnwinkel. Sein Kopf wurde auf die Schulter gedrückt. Mein nächster Schlag traf ihn in den Leib. Er vollführte eine unfreiwillige Verbeugung und ich schlug ihm die zusammengelegten Fäuste in den Nacken. Er fiel auf den Bauch.
Der Remington lag drei Schritte von ihm entfernt am Boden und schimmerte matt im Licht der Nacht. Warner begann zu kriechen. Ich packte ihn am Westenkragen, riss ihn hoch und schmetterte ihm die Faust von der Seite ins Gesicht. Er fiel auf die Seite, rollte aber sofort auf den Rücken und trat nach mir. Er traf mich am Oberschenkel und schmerzhaft zog sich mir der Muskel zusammen. Sofort kroch er weiter. Ich überwand meinen Schmerz und packte Warner am Fuß, zerrte ihn zurück, er warf sich auf den Rücken und trat erneut nach mir. Mit einem Ruck drehte ich sein Bein herum. Er brüllte auf und kam auf die Seite zu liegen. Ich ließ seinen Fuß los, erreichte mit zwei Schritten den Remington und riss ihn an mich. In dem Moment kam Warner halb hoch. Ich hämmerte ihm den Lauf gegen den Kopf. Krachend fiel er auf den Bauch. Ein Röcheln quoll aus seinem Mund. Ich schlug noch einmal zu, und jetzt erschlaffte der Bandit.
Handschellen klickten. Der Bandit zeigte mir die Zähne. Sie blinkten matt durch die Dunkelheit. Ich hob den Remington auf und stieß ihn ins Holster. Dann holte ich das Gewehr des Banditen und legte es neben meiner Decke auf den Boden.
An Schlaf war nicht mehr zu denken. Ich brach das Lager ab, half Warner auf den Mustang und saß selbst auf. Dann ritten wir.
In der folgenden Nacht erreichten wir Fort Cobb. Das Tor in dem Palisadenzaun war geschlossen. Auf dem Wehrgang über dem Tor befand sich ein Wachposten. »Wer ist da?«, rief er mich an.
»U.S. Deputy Marshal Bill Logan aus Amarillo. Ich bringe einen Gefangenen. Außerdem ist der Waffentransport, der nach hier unterwegs ist, in Gefahr.«
Ein Befehl erklang, knarrend öffnete sich ein Flügel des Tores. Ich ritt ins Fort und wurde von einigen Wachsoldaten in Empfang genommen. Ein Corporal stellte sich mir als Wachhabender vor. Ich saß ab und zerrte Warner vom Pferd. »Das ist ein Bandit, der in New Mexico steckbrieflich gesucht wird«, erklärte ich. »Außerdem hat er in Texas einen Staatenreiter niedergeschossen. Ich bitte Sie, ihn zu arretieren, bis ich ihn abhole.«
»Hier in Oklahoma werde ich nicht gesucht«, knurrte Warner. »Es gibt keinen Grund, mich hier festzuhalten.«
»Bringt ihn in den Keller«, kommandierte der Wachhabende, den Einwand des Banditen ignorierend.
Zwei Soldaten nahmen Warner in die Mitte und führten ihn ab. Sie verschwanden in der Wachbaracke, die anscheinend unterkellert war und in deren Keller sich die Arrestzelle befand.
»Ich muss mit dem Offizier vom Dienst sprechen«, erklärte der Corporal. »Er muss die Anordnung treffen, dass der Bereitschaftszug hinausreitet. Ich bin dazu nicht kompetent. Kommen Sie.«
Offizier vom Dienst war ein Lieutenant James Barner. Ein junger Mann, dem ich nicht viel Erfahrung zutraute. Er hörte sich an, was ich zu sagen hatte. Dann nickte er und sagte: »Mobilisieren Sie den Bereitschaftszug, Corporal. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Werden Sie die Patrouille führen, Marshal?«
»Natürlich.«
Der Corporal salutierte knapp, schwang herum und verließ den Raum, in dem ein Schreibtisch und ein Feldbett standen. Eine Laterne brannte und warf düstere Schatten in das Gesicht des Lieutenants. Er trug nur die Uniformhose und ein blassrotes Unterhemd. In die Stiefel war er geschlüpft, während ich berichtet hatte. Jetzt griff er nach der blauen Bluse, die über einem Stuhl hing und schlüpfte hinein. »Hoffentlich kommen wir nicht zu spät«, murmelte er. »Es wäre nicht auszudenken, wenn der Transport in die Hände der Indianer fiele.«
»Was ist überhaupt in die Cheyenne gefahren?«, fragte ich. »Sie waren doch im Großen und Ganzen immer friedlich.«
»Junge Häuptlinge, die mit den Zuständen im Territorium unzufrieden sind, wiegeln die Krieger auf. Die Besiedlung macht auch vor dem Indianerland nicht halt. An den Flüssen im Osten setzen sich Siedler fest.« Der Lieutenant zuckte mit den Schultern. »Es lässt sich nicht aufhalten. Die Regierung unternimmt nichts dagegen. Im Gegenteil. Die Fortbesatzungen wurden angewiesen, die Siedler zu schützen.«
»Man bricht also bewusst die Verträge«, murmelte ich.
»Als ich die Uniform anzog, habe ich es mir abgewöhnt, selbständig zu denken«, knurrte Barner. »Ich führe Befehle aus.«
Draußen waren Stimmen zu hören. Hufschläge mischten sich in dieses Stimmendurcheinander, Pferde wieherten, dann schrie eine laute Stimme Befehle. Der Lieutenant stülpte sich die Mütze auf den Kopf, dann gingen wir hinaus. Zwei Dutzend Soldaten standen in einer Reihe und hielten ihre Pferde am Zaumzeug fest.
Ein Sergeant kam heran, legte die Hand an die Mütze und sagte: »Die C-Kompanie ist vollzählig angetreten, Sir. Wir sind zum Abritt bereit.«
»Der Marshal wird Sie führen«, sagte der Offizier vom Dienst. »Ich wünsche Ihnen viel Glück.«
»Danke, Sir.«
Der Sergeant rief: »Aufsitzen!«
Die Trooper schwangen sich auf die Pferde. Mein Pferd wurde herangeführt und ich saß ebenfalls auf. Der Lieutenant reichte mir die Hand und sagte: »Die Armee der Vereinigten Staaten ist Ihnen zu Dank verpflichtet, Marshal.«
»Hoffen wir, dass wir noch rechtzeitig kommen«, versetzte ich.
»Fall in!«, ertönte es. Die Kavalleristen zerrten ihre Pferde herum und ritten an. Beide Torflügel waren geöffnet worden. Im klirrenden Trab ritt der Trupp aus dem Fort. Ich ritt zusammen mit dem Sergeant an der Spitze. Er nannte mir seinen Namen. Er lautete Bannister. Ein Corporal folgte uns. Zwei Scouts, die die Patrouille begleiteten, waren voraus geritten und in der Nacht verschwunden.
Ich dachte an die Männer bei dem Transport und schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass sie den Indianern trotzten, bis Hilfe eintraf.
*
Der Tag brach an. Rauchzeichen begleiteten uns. Den Cheyenne war nicht entgangen, dass eine Patrouille das Fort verlassen hatte. Die Luft schien zu kochen. Längst hatten die Soldaten ihre Felsblusen ausgezogen und hinter den Sätteln festgeschnallt. Es war ein verwegener Haufen. Für viele der Soldaten war die Armee die letzte Rettung und die einzige Möglichkeit, ihrer Vergangenheit zu entfliehen oder das gänzliche Abrutschen in die Gosse zu verhindern. In ihren blassroten Wollhemden - mit den Hosenträgern, die sich zwischen ihren Schulterblättern kreuzten - und den kantigen Gesichtern unter den verzogenen Schildern der Feldmützen sahen sie verwegen und malerisch aus.
Der Sergeant und ich ritten nach wie vor an der Spitze. Der Corporal ritt neben dem Trupp. Die Hitze sog uns regelrecht das Mark aus den Knochen. Von den Scouts war nichts zu sehen. Vor uns lag das Land wie ausgestorben; Hügel, Geröllhänge, Felsketten, weite, vegetationslose Flächen, über die der heiße Südwind Staubwirbel trieb. Hier trieben nur Klapperschlangen und Skorpione ihr Unwesen. Es war ein schönes Land – es war aber auch ein gnadenloses Land, das jeden vernichtete, der nicht stark genug war, ihm zu trotzen.
Sorgenvoll beobachtete ich die Rauchsignale, die vor und hinter uns zum seidenblauen Himmel stiegen. Die Cheyenne bereiteten etwas vor. Weit vor uns öffnete sich eine Schlucht. Zwischen den Felsen zeigte sich ein Reiter. Er kam schnell heran. Dann erreichte er uns. Es war einer der Scouts, ein Comanche, der zu seiner blauen Uniformhose ein braunes, fransenbesetztes Hemd aus Rehleder trug. Auf seinem Kopf saß ein Armeehut mit dem Emblem der gekreuzten Säbel, auf die Krone des Hutes war mit weiter Farbe ein Kreuz gemalt, das den Mann als Scout kenntlich machte.
Der Sergeant hob die rechte Hand.
»Anhalten!«, erklang die laute Stimme des Corporals.
Die Kavalkade kam zum Stehen. Klirren, Stampfen, Knarren, Schnauben und Prusten vermischten sich zu einem verworrenen Lärm.
Der Kundschafter stemmte sich gegen die Zügel und sein Pferd kam zum Stehen. Mit kehliger Stimme sagte er: »Sie warten in der Schlucht auf uns. Swift Bear ist vor der Felsenkette nach Süden geritten, um einen anderen Weg zu suchen.«
»Wie viele warten in der Schlucht auf uns?«, fragte ich.
Der Scout richtete die dunklen Augen auf mich. »Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie warten. Durch die Schlucht können wir nicht. Es wäre unser Tod.«
Ich schaute den Sergeant an. »Das kann eine Finte sein. Vielleicht wollen Sie, dass wir den Umweg um die Felswüste nehmen, und irgendwo im Süden wartet ihre Hauptstreitmacht auf uns.«
Der Sergeant blickte skeptisch drein.
Der Scout sagte: »Ich werde Swift Bear folgen. Wenn Gefahr droht, werden wir es feststellen.«
»Wir ziehen nach Süden«, ordnete der Sergeant kurzentschlossen an. Und wie zu seiner Rechtfertigung sagte er zu mir: »Unsere Scouts sind zuverlässige Leute. Wir können blind auf sie vertrauen.«
Ich fügte mich. Wir bogen also vor der Schlucht nach Süden ab. Immer wieder öffneten sich Schluchten. Am Fuß der Feldwände türmten sich Felsbrocken, die im Laufe der Zeit in die Tiefe gestürzt waren. Die Felsen muteten an wie riesige Grabsteine. Wir zogen im Schritttempo dahin. Die Männer ließen in ihrer Wachsamkeit nicht nach. Sie hielten die Karabiner schussbereit. Schweiß rann über die braungebrannten Gesichter. Weit vor uns zog der Scout über den Kamm einer Bodenwelle und verschwand gleich darauf aus unserem Blickfeld.
Dann endete das Felsmassiv, das sich von Norden nach Süden erstreckte. Hügeliges Land schloss sich an. Der Boden war mit rotbraun verbranntem Gras bedeckt. Hier und dort erhob sich ein Busch oder eine Korkeiche. Wir wandten uns wieder nach Westen. Die Felswüste befand sich nördlich von uns. Alles schien ruhig zu sein. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass sich über unseren Köpfen die dunklen Wolken des Unheils zusammenballten. Die Ruhe mutete mich unecht an – wie die Ruhe vor dem Sturm.
Und dann zogen wir in eine Ebene hinein. Vereinzelte Bäume erhoben sich. Und von einem dieser Bäume hing eine Gestalt. Man hatte sie an den Füßen aufgehängt. Die Arme baumelten schlaff nach unten. Der Sergeant riss den Arm in die Höhe und schrie: »Kompanie – halt!« Der Trupp kam zum Stehen. »Corporal!«
Der Gerufene trieb sein Pferd neben das des Sergeanten. Dieser sagte: »Nimm dir vier Mann und reite voraus, Kelly. Sieht aus, als wäre das einer unserer Scouts.«
»In Ordnung.« Der Corporal rief vier Namen. Die Soldaten trieben ihre Pferde aus der Reihe und folgten dem Corporal.
»Rundumsicherung!«, gebot der Sergeant. Die Soldaten bildeten einen Kreis und saßen ab. Die Pferde als Deckung benutzend beobachteten sie das Terrain nach allen Seiten.
Die fünf Reiter näherten sich den Baum. Einer schnitt das Seil durch und der leblose Körper fiel zu Boden. Zwei der Soldaten saßen ab. In dem Moment stoben die Cheyenne mit schrillem Geschrei aus der Hügellücke im Westen. Es waren wohl zwei Dutzend Reiter. Sie fächerten auseinander und sprengten schießend heran. Staub wallte und vermischte sich mit dem Pulverdampf. Die Erde dröhnte unter den unbeschlagenen Hufen. Die beiden Kavalleristen, die abgesessen waren, warfen sich auf die Pferde. Ihre Gefährten schickten den Indianern heißes Blei entgegen. Dann rissen sie die Pferde herum und flohen.
Das spitze, abgehackte Geschrei jagte einem Gänsehaut über den Rücken. Einer der Soldaten wurde getroffen und kippte auf den Pferdehals. Dann waren die Kavalleristen heran und sprangen im vollen Galopp von den Pferden. Der Mann, der getroffen worden war, blutete an der Schulter. Eine Salve aus den Karabinern der Soldaten peitschte den Cheyenne entgegen. Sie drehten ab und verschwanden wieder zwischen den Hügeln. Das Hufgetrappel verklang. Zwei Soldaten kümmerten sich um ihren verletzten Kameraden. Der Corporal wandte sich an den Sergeant und sagte: »Bei dem Toten handelt es sich um Bull Head. Keine Ahnung, wo Swift Bear steckt. Sie haben Bull Head die Kehle durchgeschnitten und ihm den Skalp genommen. Diese verdammten, roten Heiden!«
»Sie stecken zwischen den Hügeln«, murmelte der Sergeant. »Das bedeutet, dass uns der direkte Weg nach Westen verlegt ist.« Er richtete den Blick auf mich. »Haben Sie eine Idee, Logan?«
»Wir kehren um und reiten durch die Schlucht. Möglicherweise ist die Gruppe, die dort lauerte, abgezogen, nachdem wir den Umweg nahmen.«
»Wir sollten tun, was der Marshal sagt«, bemerkte der Corporal. »Damit rechnen sie sicher nicht. Bis sie merken, dass wir durch die Schlucht ziehen, sind wir vielleicht durch.«
Wir kehrten um. Schließlich ritten wir zwischen die Steilwände. Die Schlucht erinnerte an ein riesiges, steinernes Grab des Schweigens. Es war düster zwischen den Felsen. Die Echos verstärkten die Geräusche, die wir verursachten. Staub wehte über die oberen Ränder der Felsen. Dorniges Gestrüpp wucherte zwischen den Felsen. Der Boden war von Geröll übersät.
Manchmal traten die Felsen weit auseinander, dann rückten sie wieder ganz eng zusammen. Wir sicherten nach vorne, nach hinten und nach oben. Dann endeten die schroffen Felswände zu beiden Seiten und terrassenförmige Anhöhen schwangen sich nach oben. Schließlich lief die Schlucht aus und vor uns lag eine Ebene, die von einem Arroyo zerschnitten wurde. Weit im Westen buckelten Hügel.
Wir zogen in die Ebene hinein und erreichten das ausgetrocknete Flussbett. Das Ufer fiel etwa einen Yard steil ab. Der Boden des Arroyo war geröllübersät. Die Knochen eines Pferdes bleichten in der Sonne. Stummer Zeuge einer Tragödie, die sich hier möglicherweise abgespielt hatte.
Wir trieben die Pferde über die Uferböschung hinunter und durchquerten das Flussbett. Dann nahm uns wieder die Ebene auf. Die Konturen der Hügel im Westen verschwammen in der Hitze wie hinter einer Wand aus Wasser. Ich ritt neben dem Sergeant. »Es ist nicht auszuschließen, dass sie uns zwischen den Hügeln erwarten«, rief ich in den pochenden Hufschlag hinein.
»Corporal Kelly!«
»Was ist?« Der Corporal hatte sein Pferd neben das des Sergeanten getrieben.
»Nimm dir vier Mann und reite als Vorhut voraus, Kelly. Sieh nach, ob die Luft rein ist.«
Der kleine Trupp löste sich von uns. Wenig später verschwand er zwischen den Anhöhen. Der Sergeant ließ anhalten. Die Kavalleristen nahmen Gefechtsstellung ein.
Es dauerte eine ganze Weile, dann erschien einer der Kavalleristen und winkte uns. Wir zogen weiter ...
*
Zwei Banditen, die von einer Patrouille aufgegriffen worden waren, befanden sich mit Lee Warner in der Zelle. Ihre Namen waren Paul O'Bannion und Brad Ryder. Die beiden waren vor dem Gesetz ins Indianerland geflohen. Auf beide wartete in Arkansas der Galgen.
Die Zelle war ein Raum von vier mal drei Yards. Auf dem Boden lag fauliges Stroh. Die drei Gefangenen hockten am festgestampften Boden. Der Latrineneimer in der Ecke verströmte einen scharfen Geruch. Das kam von dem in Wasser aufgelösten Chlor, mit dem er zu einem Drittel gefüllt war. Durch das kleine, vergitterte Fenster fiel in schräger Bahn das Sonnenlicht. Vom Exerzierplatz her erschallten Kommandos.
O'Bannion und Ryder waren Typen, in deren Gesichter ein unsteter Lebenswandel jenseits von Recht und Ordnung seine unübersehbaren Spuren hinterlassen hatte. Jetzt erhob sich O'Bannion, ging zum Fenster, seine Hände legten sich um zwei der zolldicken Gitterstäbe. Auf dem Paradeplatz exerzierte eine Gruppe Soldaten. Das Sternenbanner hing schlaff an dem von Wind, Sonne und Regen gekrümmten Fahnenmast. Gellende Befehle erschallten.
O'Bannion war ein großer Mann mit dunklen Haaren. Sein Alter war schlecht zu schätzen. Das machte der dunkle Bart, der in seinem Gesicht wucherte. Er konnte dreißig, ebenso gut aber vierzig sein. In seinem Gesicht arbeitete es. Plötzlich ließ er das Gitter los und wandte sich um. »Wir müssen raus hier.«
»Leichter gesagt als getan«, knurrte Brad Ryder, ein Bursche mit sandfarbenen Haaren und rattenhaft kleinen Augen.
»Wenn uns die Marshals aus Fort Smith übernehmen ist es zu spät«, erklärte O'Bannion. »Darum müssen wir fort sein, ehe sie hier eintreffen.«
»Wohin wollt ihr überhaupt?«, fragte Warner.
»Texas«, murmelte Ryder. »Dort werden wir nicht gesucht.«
»Hast du einen Plan?«, wandte sich Warner an O'Bannion.
»Wir müssen sie überlisten, wenn sie uns das Essen bringen. Wenn wir den Wachhabenden und seinen Vertreter als Geiseln nehmen, wird man uns auch Pferde und Waffen zur Verfügung stellen. Wir müssen es jedenfalls versuchen. Zu verlieren haben wir nichts.«
»Ich bin dabei«, sagte Warner.
»Gehst du mit uns nach Texas?«
Warner verzog den Mund. »In Texas werde ich gesucht.«
»Nun, du kannst gehen, wohin du willst.«
Das Gespräch schlief ein. Warner starrte vor sich hin. O'Bannion ging vom Fenster weg und setzte sich wieder auf den Boden. Er nahm einen Strohhalm zwischen die Zähne und kaute darauf herum. Vor dem Fenster schritt ein Wachposten vorbei. Nur seine staubigen Stiefel waren zu sehen. Für einen Moment wurde die Lichtbahn, die das Fensterviereck mit den Gittern auf den Fußboden zeichnete, unterbrochen.
»Okay«, sagte Warner plötzlich. »Ich gehe mit euch nach Texas. Habt ihr dort ein bestimmtes Ziel im Auge?«
»Nein.« O'Bannion schüttelte den Kopf. »Sicher, du kannst dich uns anschließen. Sechs Augen sehen mehr als vier.« Er grinste. »Es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis Brad und ich in Texas auch gesucht werden.«
»Ich habe eine Rechnung zu begleichen«, sagte Warner. »Helft ihr mir dabei?«
»Es handelt sich um diesen Marshal, von dem du uns erzählt hast, nicht wahr.«
»Man nennt ihn Logan. Ja, ihm möchte ich gerne die Flügel stutzen. Er hat mich hierhergebracht. Ich hasse ihn und möchte es ihm heimzahlen.«
»Wenn uns die Flucht gelingt, sollten wir zusehen, dass wir nach Texas kommen«, stieß Brad Snyder hervor. »Die Rothäute spielen verrückt, und ich habe keine Lust, deiner Rachegelüste wegen meinen Skalp zu verlieren.«
»Wir erwischen Logan in Amarillo«, erklärte Warner.
»Sprechen wir darüber, wenn wir heil in Texas angekommen sind«, beendete O'Bannion das Thema.
Sie versanken wieder in düsteres Grübeln. Die Stunden vergingen. Draußen wurde es grau. Der Lichtfleck am Boden löste sich auf. Die Dämmerung kroch durch das Fenster in die Zelle. Vor der Zellentür erklangen Schritte. Ein Riegel wurde aufgeschoben. Knirschend drehte sich ein Schlüssel im Schloss. O'Bannion erhob sich und glitt zur Wand neben der Tür. Das aufschwingende Türblatt würde ihn verdecken. Er nickte Warner und Ryder zu. Die beiden erhoben sich.
»Stellt euch an die Fensterwand, ihr lausigen Banditen«, erklang es, während die Tür leise knarrend aufging. »Ihr könnt euch denken, dass wir nicht lange fackeln.« Ein junger Soldat, der ein Tablett trug, betrat die Zelle. Er hatte sich die Mütze weit in die Stirn gezogen. Auf dem Tablett standen drei Blechschüsseln mit Hirsebrei. Die Holzlöffel steckten in der gelblichen Pampe.
Jetzt merkte der Soldat, dass O'Bannion nicht bei den beiden anderen stand. »He, verdammt, was ...«
O'Bannion warf die Tür zu, packte den Kavalleristen und wirbelte ihn halb herum, sein linker Arm legte sich von hinten um den Hals des Soldaten. Das Tablett mit den Schüsseln fiel zu Boden, die Schüsseln schepperten, Brei spritzte. Warner glitt blitzschnell heran, öffnete das Holster des Kavalleristen und zog den schweren Armeerevolver heraus.
Das alles hatte nicht mehr als zwei Sekunden in Anspruch genommen. Krachend flog die Tür unter einem Tritt auf. Gewehrschlösser knackten metallisch. Die beiden Soldaten, die den Burschen mit dem Tablett begleitet hatten, standen mit angeschlagenen Karabinern vor der Tür.
Warner drückte die Mündung des Revolvers gegen den Kopf des Soldaten, der sich nach wie vor in O'Bannions Würgegriff befand. Langsam spannte er den Hahn. Klickend bewegte sich die Trommel um eine Kammer weiter. Der Soldat japste wie ein Erstickender nach Luft. »Ich blase eurem Kameraden das Hirn aus dem Schädel, wenn ihr Zicken macht.«
Die beiden waren verunsichert. In ihren Mundwinkeln zuckte es. Sie wussten nicht, wie sie reagieren sollten.
»Brad, nimm ihnen die Gewehre und Revolver weg«, kommandierte O'Bannion. »Aber komm Warner nicht in die Schusslinie.«
»Stehenbleiben!«, stieß einer der Wachsoldaten hervor und zielte auf Ryder.
»Wenn du schießt, ist dein Kamerad tot!«, drohte Warner.
Ryder setzte sich in Bewegung. Der Soldat schoss nicht. Er ließ sich entwaffnen. Ryder steckte den Revolver in seinen Hosenbund und nahm das Gewehr. »Geh in die Zelle!« Der Wachposten kam der Aufforderung nach. Ryder entwaffnete auch den anderen. O'Bannion ließ den Burschen, den er im Würgegriff hielt, los und versetzte ihm einen Stoß, der ihn tiefer in die Zelle taumeln ließ. Die Banditen verließen das Verlies und verriegelten die Tür. O'Bannion bekam von Ryder einen Revolver und ein Gewehr. Sie stiegen die hölzerne Treppe hinauf, betraten das Wachlokal und richteten die Revolver auf die beiden Männer, die an einem Tisch saßen und Karten spielten. Es waren der Wachhabende und sein Vertreter. Die beiden erstarrten. Die Gesichter spiegelten den Schrecken wider, der sie befiel. O'Bannion richtete den Blick auf einen der beiden und sagte: »Geh zu deinem Kommandeur und sag ihm, dass wir vier Soldaten als Geiseln haben. Wir wollen drei Pferde und Proviant für drei Tage. Er hat eine halbe Stunde Zeit, unsere Forderung zu erfüllen. Nach Ablauf dieser halben Stunde erschießen wir die erste Geisel. Sag ihm das, Amigo. Und lass keinen Zweifel darüber offen, dass wir es verdammt ernst meinen.«
Wie von Schnüren gezogen erhob sich der Bursche, ging zur Tür und verschwand nach draußen. Warner ging zum verstaubten Fenster, baute sich daneben auf und schaute hinaus. Er sah den Soldaten in Richtung Kommandantur laufen.
Bei dem Mann, der sich als Geisel in der Hand der Banditen befand, handelte es sich um den Wachhabenden. O'Bannion forderte ihn auf, sich an die Wand zu stellen. Ryder nahm ihm den Revolver weg.
»Halt ihn in Schach, Brad«, gebot O'Bannion und ging zur Tür, öffnete sie einen Spaltbreit und spähte nach draußen.
Es waren keine zwei Minuten vergangen, seit der Wachsoldat in der Kommandantur verschwunden war, als eine Ordonnanz auftauchte und zu den Unterkunftsbaracken rannte. Wenig später schallten laute Befehle. Soldaten kamen bewaffnet aus ihren Unterkünften. Schritte trampelten. Sie gingen rund um das Wachlokal in Stellung.
»Ich will den Kommandanten sprechen!«, rief O'Bannion.
»Der verhandelt mit euch Banditen nicht. Gebt auf, oder ihr seid innerhalb der nächsten halben Stunde tot.«
»Tot werden eure Kameraden sein«, rief O'Bannion kalt. »Ihr habt noch fünfundzwanzig Minuten, um Pferde und Proviant zu bringen. Solltet ihr das Ultimatum verstreichen lassen, erschieße ich den Wachhabenden. Und danach alle Viertelstunde einen weiteren eurer Leute. Und wenn ihr dann kommt, um uns zu holen, werden wir noch eine Reihe von euch in die Hölle schicken.«
*
Ein Lieutenant begab sich in die Kommandantur. Colonel McIntosh musterte ihn fragend. Der Lieutenant salutierte, dann sagte er: »Sie drohen, die Geiseln zu erschießen und uns dann einen Kampf zu liefern.«
Der Colonel kaute auf seiner Unterlippe herum. »Was schlagen Sie vor, Lieutenant?«
»Die Kerle scherzen nicht. Und zu verlieren haben sie nichts mehr.«
Versonnen starrte der Colonel auf einen unbestimmten Punkt an der Wand. »Am Ende werden wir vor einem Berg Leichen stehen«, murmelte er schließlich. Dann gab er sich einen Ruck. »Wir geben der Forderung nach. Es ist wahrscheinlich das Klügste. Ich kann das Leben meiner Männer nichts aufs Spiel setzen. In Zeiten wie diesen, in denen die Rothäute den Aufstand proben, ist jeder Mann, der ein Gewehr halten kann, wichtig. Lassen Sie drei Pferde satteln und hängen Sie Säcke mit Proviant an die Sättel. Wir lassen die Banditen ziehen.«
»In Ordnung, Sir.« Der Lieutenant knallte die Hacken zusammen, grüßte militärisch und lief nach draußen, um die entsprechenden Befehle zu erteilen. Zwanzig Minuten später wurden die drei Pferde vor das Wachlokal geführt.
»Die Soldaten sollen verschwinden!«, forderte O'Bannion.
Ein Befehl ertönte, die Kavalleristen zogen sich zurück. Dann trat O'Bannion vor das Gebäude. Er ging zu einem der Pferde und nahm es am Zaumzeug. Der Wachhabende erschien. Hinter ihm ging Lee Warner und hielt ihm die Mündung des Revolvers an den Hinterkopf. Den beiden folgte Brad Ryder. Die Mündung seines Gewehres beschrieb einen Halbkreis, dem er mit dem Blick folgte. Zwischen den Gebäuden woben die Schatten der Abenddämmerung.
Während Warner den Wachhabenden vor sich her trieb, übernahm Ryder die beiden anderen Pferde. Er ging zwischen den Tieren und führte sie zum Tor. O'Bannion folgte. Als sie außer Gewehrschussweite waren, saßen die Banditen auf und trieben die Pferde an. Im gestreckten Galopp donnerten sie davon.
Erst, als ihre Pferde Ermüdungserscheinungen zeigten, drosselten sie das Tempo. Es war fast finster. Im Westen hatte sich das Rot in schwefeliges Gelb verwandelt. Vor dieser Kulisse wirkten die Konturen der Hügel schwarz, scharf und klar wie Scherenschnitte.
Schließlich hatte die Nacht endgültig den Sieg über den Tag errungen. Die Banditen ließen ihre Pferde jetzt im Schritt gehen. Die Nasen der Tiere zeigten nach Westen.
*
Wir ritten nach Westen, zwischen Geröllhängen und steilen Hügelflanken.
Und plötzlich waren die Indsmen da. Auf den Hügeln zur Rechten und zur Linken wuchsen ihre sehnigen Gestalten in die Höhe.
Es waren mindestens drei Dutzend.
»Es geht los!«, brüllte der Sergeant. »Wir brechen ...«
Seine weiteren Worte gingen im Krachen der Schüsse unter. Er gab seinem Pferd die Sporen. Heiseres Gebrüll wurde laut. Pferde stampften und wieherten. Zwei - drei Soldaten stürzten von ihren Pferden. Zwei Pferde brachen zusammen und keilten im Todeskampf mit den Hufen aus. Die Soldaten rannten zu den Tieren ihrer am Boden liegenden Kameraden und sprangen in den Sattel.
Die Springfield-Kavalleriekarabiner begannen zu dröhnen. Jetzt donnerte auch der letzte der Soldaten hinter dem Sergeant her. Im vollen Galopp jagten sie ihre Kugeln die Hügelflanken hinauf.
Das Geheul der Cheyenne, das zwischen den Salven zu hören war, zerrte an den Nerven. Wieder wurde ein Reiter vom Pferderücken gefegt. Das Tier rannte im Verbund der dahinjagenden Soldaten mit.
Ich ritt inmitten eines Pulks Kavalleristen. Das Pferd lenkte ich mit den Schenkeln, Schuss um Schuss jagte ich aus dem Lauf.
Und als wir schon glaubten, dem Hinterhalt entkommen zu sein, tauchten vor uns über einer Hügelfalte weitere Indianer auf. Sie waren beritten. In einer auseinandergezogenen Reiterkette donnerten sie über die Ebene heran. Das spitze, abgehackte Geschrei voll heidnischer Grausamkeit ging durch Mark und Bein. Es waren gut und gerne zwei Dutzend.
Der Sergeant zerrte sein Pferd in den Stand und brüllte einen Befehl, der im knatternden und heulenden Inferno unterging, dann sprang er vom Pferd. Geduckt, das Pferd am Zügel hinter sich herzerrend, rannte er zu einem Felsen, der zumindest Deckung nach zwei Seiten versprach.
Ich riss mein Pferd zurück und saß ebenfalls ab. Über den leeren Sattel schoss ich auf einen Krieger, der mit verzerrtem Gesicht heranhetzte.
Auch die Kavalleristen waren abgesessen. Ebenfalls die Tiere mit sich ziehend suchten sie Deckung. Als das Pferd eines der Soldaten tot zusammenbrach, warf er sich einfach dahinter.
In der Ebene hatten die wie auf dem Schlachtfeld formierten Angreifer schon die halbe Strecke bis zu der Patrouille zurückgelegt. Immer neue Pferderücken wurden leergefegt. Die reiterlosen Gäule preschten in der donnernden Angriffwelle weiter, wurden regelrecht mitgerissen.
Jetzt schossen auch die Angreifer wie rasend. Aus der wallenden Staubwolke, die sie zurückließen, torkelten Krieger hervor und brachen zusammen. Innerhalb weniger Minuten starben ein Dutzend Indianer.
Die Horde drehte ab und floh zurück über die Bodenfalte.
Aber wir wurden weiterhin von beiden Seiten unter Feuer genommen. Ein Soldat taumelte hoch, im nächsten Moment machte er das Kreuz hohl. Sterbend schlug er auf den Boden.
Auf dem Geröllhang polterten, eine Lawine aus Steinbrocken und Sand auslösend, zwei getroffene Krieger abwärts.
Auch auf dem anderen Hügel lichtete sich die Reihe der verbissen feuernden Indianer.
Und dann zogen sie sich zurück.
Die Waffen schwiegen. Aufgewirbelter Staub und Pulverdampf zerflatterten.
Der Sergeant trat aus seiner Deckung. Sein Blick schweifte über die Hügelkuppen, richtete sich nach Norden, dann rief er mit rasselnden Stimmbändern: »Sie sind fort. Aber los sind wir sie noch lange nicht. Sie lecken jetzt nur einige Zeit ihre Wunden. Und dann kommen Sie aufs Neue.«
Die Soldaten versammelten sich. Dabei sicherten sie ununterbrochen in alle Richtungen.
»Hier sind wir ihnen ausgeliefert wie auf einem Präsentierteller«, rief Korporal Kelly rau. »Wir sollten umkehren und einen anderen Weg nehmen.«
»Wir reiten weiter«, erklärte der Sergeant. »Egal, wohin wir uns wenden. Sie sind überall. Welche Verluste haben wir?«
»Vier Mann sind tot, Reiter Sherman hat einen Schulterdurchschuss, zwei Trooper haben Streifschutzverletzungen«, kam es nach kurzer Zeit von dem Corporal.
Der Sergeant presste die Lippen zusammen, sodass sie nur noch einen messerrückenscharfen, blutleeren Strich bildeten. Schließlich schnarrte er: »Verbindet Sherman und die beiden Trooper und legt die Getöteten auf die Pferde. Wir nehmen sie mit, und wenn wir in Sicherheit sind, begraben wir sie.«
Wir ritten langsam weiter.
Die Indianer folgten uns. Immer wieder gab es Anzeichen dafür. Sie hatten große Verluste erlitten, hatten ihrem Hass und ihrer mörderischen Besessenheit einen hohen Blutzoll entrichtet.
Aber das machte sie noch fanatischer, noch leidenschaftlicher. Sie waren beseelt von dem Gedanken, die Langmesser-Soldaten bis auf den letzten Mann niederzumachen.
*
Wir zogen weiter nach Westen und wurden nach wie vor von den Cheyenne verfolgt, zu einem zweiten Angriff war es allerdings nicht mehr gekommen.
Aber weit hinter uns erhoben sich wieder die Rauchsignale.
Und vor uns ebenfalls.
Die Indianergefahr war also aktueller als auf den vielen Meilen, die wir seit dem ersten Angriff der Cheyenne zurückgelegt hatten.
Irgendwann waren keine Rauchzeichen mehr zu sehen. Vor uns begann wieder hügeliges Terrain.
Der Sergeant schickte eine Vorhut unter dem Kommando von Corporal Kelly voraus und gab das Zeichen zum Absitzen. Die Soldaten hakten ihre Feldflaschen von den Sätteln und tranken in gierigen Zügen. Dann tränkten sie aus ihren Feldmützen die Pferde. Dörrfleisch und Brot wurden verzehrt.
Einige der Soldaten trugen verschmutzte, oftmals durchblutete Verbände. Die kleinen Wunden hatten sie gar nicht verbunden. Sie hatte der Staub verklebt.
In der Ferne buckelten wieder zerklüftete Felsbarrieren. Um die Gipfel schlierte blauer Dunst. Die Sonne stand schon weit im Westen und würde in etwa zwei Stunden untergehen.
Die Vorhut verschwand aus unserem Blickfeld. Ich hob mein Fernglas an die Augen und suchte die Felswände ab. In den Felsscharten und Schluchten war alles ruhig.
Irgendwie konnte ich mich jedoch des Eindrucks nicht erwehren, dass das Gebiet, das vor uns lag, böse Überraschungen für uns bereithielt.
Ich schaute zurück. Dass es keine Rauchsignale mehr gab, beunruhigte mich ungemein. Es war, als hätten sich die Cheyenne gegenseitig alles mitgeteilt, was notwendig war, um die tödliche Falle für uns aufzubauen.
Dann kam die Vorhut zurück. Der Corporal ritt vor Sergeant Bannister hin, legte die Hand an die Mütze und gab müde zu verstehen: »Nichts, Sergeant. Keine Feder zu sehen. Ich schätze, wir kommen ungeschoren durch.«
»Danke, Kelly. Lass die Leute noch eine halbe Stunde ausruhen, dann brechen wir auf.«
Einige der Soldaten drehten sich Zigaretten und rauchten.
Unablässig beobachtete ich mit meinem Fernglas das Terrain vor uns. Da waren nur bucklige Hügel, Staub und Geröll. Nicht die Spur von Leben.
Ich drehte mich in alle Himmelsrichtungen. Und das Ergebnis meiner Rundumsicherung war überall dasselbe.
Dann war die halbe Stunde um, die der Sergeant den Männern Pause gewährt hatte. Wir zogen uns in die Sättel. Ungeschoren kamen wir durch die Hügel. Dann dehnte sich vor uns eine sandige Ebene.
Als wir etwa fünfzig Yards in die Ebene geritten waren, krachte hinter uns zwischen den Hügeln ein Schuss. Der peitschende Klang prallte in die Ebene. Um die Patrouille herum wurde es plötzlich lebendig. Aus dem Boden wuchsen die Gestalten von mehr als zwei Dutzend Cheyenne. Sie hatten flache Mulden ausgehoben, sich hineingelegt und waren von ihren Stammesbrüdern mit Sand zugedeckt worden. Atemluft bekamen sie durch dicke, hohle Halme, die an den oftmals sumpfigen Ufern der Flüsse wuchsen.
Es sah aus, als würden die Cheyenne ihren Gräbern entsteigen.
Jetzt schüttelten sie den Sand ab, mit dem sie sich bedeckt hatten, und griffen mit infernalischem Geschrei an.
Und ihre Brüder und Vettern kamen aus den Hügeln im Norden und Süden. Sie waren beritten und sprengten in halsbrecherischer Karriere heran.
Die Krieger, die völlig überraschend für uns aus dem Boden gekommen waren, rissen die ersten Reiter aus den Sätteln und droschen mit Tomahawks und Schädelbrechern auf sie in. Wildes Geschrei ließ das eine oder andere Pferd von Panik erfasst ausbrechen. Endlich hatten die Soldaten ihre Colts in den Fäusten. Aus nächster Nähe feuerten sie auf die fanatischen Angreifer.
Der Sergeant schwang seinen Säbel. Blitzend sauste die Klinge durch die Luft. Cheyenne brachen zusammen. Der Lärm war kaum noch zu ertragen. In das Krachen der Schüsse tönte das trompetende Wiehern der Pferde, gellten die Todesschreie von Roten und Weißen, stieß das Angriffsgeheul der Cheyenne, die von Norden und Süden heranstürmten.
Der Trupp, der von Süden kam, erreichte das wogende Durcheinander verbissen aufeinander einschlagender und schießender Kämpfer zuerst. Wie ein Keil stieß der Kriegertrupp in den Pulk und riss ihn auseinander.
Pferde stürzten, wälzten sich mit ihren Reitern am Boden. Aus dem ineinander verkeilten Chaos schnellten Krieger und Soldaten und warfen sich aufeinander.
Ich sah Sergeant Bannister am Boden knien und sich gegen einen Angreifer verteidigen, der ihn mit dem Kriegbeil attackierte. Wahrscheinlich hatte Bannister schon seinen Colt leergeschossen, denn er benutzte die Waffe nur noch als Schlaginstrument. Der Sergeant wehrte mit dem Unterarm den Schlag des Cheyenne ab. Dann rammte er dem Krieger den Colt in den Magen.
Ein anderer Cheyenne näherte sich mit erhobener Keule dem Sergeant von hinten. Ich gab meinem Pferd die Sporen, ritt einen Cheyenne über den Haufen und ließ das Gewehr nach unten sausen. Ehe der Krieger Bannister den Schädel zertrümmern konnte, fiel er bewusstlos zu Boden.
Die Waffen waren jetzt verstummt. In den Trommeln befanden sich keine Kugeln mehr.
Jetzt erreichte auch die Horde aus Norden die verbissen Kämpfenden. Die Krieger sprangen von ihren Mustangs und warfen sich brüllend in das Kampfgetümmel.
Ein Krieger sprang mich an, hing an mir wie eine Klette und versuchte, mich vom Pferd zu zerren. Ich schmetterte meine Faust mitten in die teuflisch anmutende Fratze mit den schwarzen und weißen Strichen der Kriegsbemalung. Der Indianer krachte zu Boden.
Der Sergeant hatte sich auf ein reiterloses Pferd geschwungen und den Karabiner aus dem Scabbard gerissen. Einen Cheyenne schoss er nieder, dann benutzte er das Gewehr als Keule. Immer wieder sauste der Kolben hernieder und fällte einen Indianer.
Und dann erhob sich über den Lärm das Schmettern einer Trompete.
Über einer Bodenwelle tauchte ein großer Reitertrupp auf. Die Reiter donnerten den sanften Hang hinunter.
Die Indianer ließen in ihrer mörderischen Verbissenheit nach. Jetzt waren sie den Soldaten noch überlegen. Aber wenn die Verstärkung heran war, dann sah es schlecht für sie aus.
Der Kampflärm hatte nachgelassen. Vor allem das gellende Geschrei der Cheyenne war verstummt. Viele der Soldaten lagen blutüberströmt zwischen toten Cheyenne.
Rumorendes Hufgetrappel schlug heran. Die Soldaten fächerten auseinander und während die Mitte sich etwas zurückfallen ließ, rückten die Flügel schneller vorwärts, bis der Trupp einen weitgezogenen Halbkreis bildete.
Die Ankunft der Kameraden gab den Kämpfenden noch einmal Auftrieb. Sie warfen sich auf die unschlüssig wirkenden Cheyenne und schlugen sie mit ihren Revolvern oder mit den bloßen Fäusten zu Boden.
Plötzlich ergriffen die Cheyenne die Flucht. Sie rannten zu den Mustangs und sprangen mit affenartiger Behändigkeit auf deren Rücken. Sie trieben sie auf die Hügel im Osten zu.
Bei den heranstiebenden Soldaten krachten die Springfields. Mustangs stürzten, Cheyenne flogen von den Pferderücken. Zwei Cheyenne, die zwischen den Toten benommen am Boden gelegen hatten, federten jetzt hoch und wollten ihren fliehenden Kameraden zu Fuß folgen. Die blutenden Soldaten um mich herum schlugen sie unerbittlich nieder. Wut und Frust brauchten ein Ventil.
Die Kavalleristen donnerten an ihnen vorbei und folgten den Rothäuten, denen die Flucht gelungen war, zwischen die Hügel. Nach einiger Zeit brandete dort noch einmal Kampflärm auf - dann trat Stille ein.
Die Soldaten, die einen Kampf auf Leben und Tod hinter sich hatten, wankten erschöpft zur Seite und ließen sich zu Boden fallen. Mit zitternden Händen luden sie ihre Revolver nach. Hier und dort erklang ein Stöhnen.
Ein Bild des Grauens umgab uns. Tote und verwundete Männer, rote und weiße, tote Pferde, vom Blut rot gefärbter Sand, blutbespritzte Sättel...
Das Grauen hatte seinen Lauf genommen im Indianerland. Der Tod war wieder einmal unersättlich gewesen in seiner Gier.
Die Patrouille kam zurück. Die Soldaten trieben ein Rudel waffenloser Cheyenne vor sich her. Als sie heran waren, saßen die Kavalleristen ab und hielten die Cheyenne mit ihren Gewehren in Schach. Einige kümmerten sich um die Verwundeten.
Ein Lieutenant ritt vor Sergeant Bannister hin. »Wir kommen aus Fort Sill«, erklärte er. »Wie es scheint, tauchten wir in letzter Sekunde auf.«
»Sie und Ihre Leute hat der Himmel geschickt, Lieutenant«, ächzte der Sergeant. »Lange hätten wir nicht mehr standgehalten.«
Dann erzählte der Sergeant von seinem Auftrag. Der Lieutenant erklärte sich bereit, uns zu begleiten. Die Verwundeten wurden verarztet, die Toten begraben. Dann brachen wir auf ...
*
Der Wagenzug lagerte zwischen den Hügeln. Joe und Kirby Jones hielten Wache. Als sie die Hufschläge hörten, weckten sie die anderen. Die Gewehre wurden geladen. Der rumorende Hufschlag rollte heran wie fernes Donnergrollen.
Joe lief auf einen Hügel und schaute in die Richtung, aus der der Getöse herantrieb. Die Geräusche wurden deutlicher. Dann lösten sich die Reiter aus der Dunkelheit. Nieten funkelten im Mond- und Sternenlicht. Joe begriff, dass es Soldaten waren, die sich näherten. Er schoss in die Luft. Der Knall prallte auseinander und übertönte für einen Moment die anderen Geräusche. Ein Befehl ertönte. Dann verstummten die Geräusche.
Joe hatte sich aufgerichtet. Zwei Reiter lösten sich aus dem Verbund und stoben heran. Bei Joe rissen sie die Pferde zurück. Joe atmete auf. »Kommt ihr aus Fort Cobb?«
»Aus Fort Cobb und Fort Sill. Reiten Sie mit dem Transport?«
»Ja. Er steht in der Senke.«
Die beiden Soldaten zogen ihre Pferde herum und ritten zurück. Der Trupp setzte sich wieder in Bewegung. Ein Reiter hielt auf Joe zu. Vor dem Marshal hielt er an. »Hallo, Partner, ich bin froh, dich heil und gesund zu sehen.«
»Hallo, Logan-Amigo. Du hast es also geschafft.«
*
Ich saß ab und gab Joe die Hand. Es war ein fester Händedruck. Dann führte ich mein Pferd in das Camp und Joe schritt neben mir her. Joe sagte: »Jesse Vaugham ist tot. Er drehte durch. Wie ist es dir ergangen?«
Ich berichtete. Als ich geendet hatte, sagte Joe: »Also müssen wir nach Fort Cobb, um Warner abzuholen.«
»So sieht es aus.«
Wir erreichten die Fuhrwerke. Die Soldaten waren abgesessen und nahmen Rundumsicherung ein. »Dem Himmel sei dank«, sagte John Malcolm, als er an mich herantrat und mir Hand schüttelte. »Wenn Sie nicht durchgekommen wären, Logan, dann wäre es auch um uns geschehen gewesen.«
Am Morgen schickte der Lieutenant aus Fort Sill seine beiden Scouts aus. Sie kamen, als die Sonne aufging, ins Camp zurück und meldeten, dass sich die Cheyenne zurückgezogen hatten. Wir brachen auf. Da wir mir den Fuhrwerken nicht so schnell vorwärts kamen, kalkulierte ich drei Tage ein, die wir benötigten, um Fort Cobb zu erreichen.
Die Cheyenne wagten keinen Angriff mehr. Meile um Meile legten wir zurück. Und am Abend des dritten Tages erreichten wir das Fort. Wir wurden mit lautem Hallo von den Soldaten begrüßt. Bei einem der Ställe saßen wir ab. Unsere Pferde waren verstaubt und verschwitzt. »Wir brechen morgen Früh auf«, sagte ich zu Joe. »Den Weg bis zur Grenze können wir in zwei Tagen schaffen. Und in vier Tagen können wir in Amarillo sein.«
»Wenn uns die Cheyenne keinen Strich durch die Rechnung machen«, versetzte Joe.
Wir versorgten unsere Pferde. Das nahm über eine Stunde in Anspruch. Mit Strohbüscheln rieben wir die Tiere ab. Dann aßen wir mit den Soldaten. Und schließlich begaben wir uns zur Wachbaracke.
»Wir holen Lee Warner morgen Früh vor Sonnenaufgang ab«, sagte ich zu dem Wachhabenden.
»Den braucht ihr nicht mehr abzuholen«, erklärte der Soldat. »Warner ist zusammen mit zwei Banditen der Ausbruch aus dem Gefängnis gelungen. Die Kerle sind über alle Berge. Mit Warner braucht ihr euch nicht mehr herumzuärgern.«
Ich war wie vor den Kopf gestoßen. »Er ist ausgebrochen?«, entrang es sich mir beinahe ungläubig.
»Ja. Es gelang ihnen, einige Wachsoldaten in der Baracke zu überwältigen und als Geiseln zu nehmen. Der Kommandeur gab dem Druck nach und ließ die Banditen ziehen.«
»Habt ihr sie wenigstens verfolgt?«
»Nein. Der Colonel wollte das Fort nicht noch mehr schwächen.«
Ich verspürte Enttäuschung. Sollte alles umsonst gewesen sein? Wir hatten unsere Haut zu Markte getragen, und das Ergebnis war, dass uns der Bandit, den wir nach Amarillo zurückbringen sollten, durch die Lappen gegangen war.
Wir begaben uns in die Kantine.
»So ein Mist«, schimpfte Joe, als wir saßen.
»Leider nicht zu ändern«, versetzte ich. Ich hatte begonnen, mich damit abzufinden. Um uns herum war Stimmendurcheinander. Die dienstfreien Soldaten drängten sich am Tresen oder saßen an den Tischen. Ich holte mein Rauchzeug aus der Tasche und drehte mir eine Zigarette, dann schob ich Tabakbeutel und Papier Joe zu, der sich ebenfalls einen Glimmstängel rollte.
Ein Mann kam in die Kantine. Es war Sergeant Bannister. Die Strapazen der vergangenen Tage standen ihm noch ins Gesicht geschrieben. Er sah uns und lenkte seine Schritte auf uns zu. »Darf ich mich zu Ihnen setzen?«
»Bitte.« Ich wies auf einen freien Stuhl.
Der Sergeant ließ sich nieder und sagte: »Ich habe es schon gehört. Warner ist abgehauen.«
»Ja«, sagte ich. »Und wenn ihn nicht die Cheyenne erwischt haben, befindet er sich wahrscheinlich schon in Fort Smith. Nun, Kerle wie er werden immer wieder straffällig. Und eines Tages ereilt sie ihr Schicksal.«
»Es tut mir leid, dass ihr den Weg nach Fort Cobb umsonst gemacht habt.«
»Er war nicht ganz umsonst«, versetzte ich.
Der Sergeant nickte. »Das ist richtig. Ohne Sie wären die beiden Fuhrwerke mit den Waffen und der Munition den Cheyenne in die Hände gefallen. Der Colonel will sich morgen persönlich bei Ihnen bedanken.«
»Wenn er seinen Dienst antritt, werden wir schon auf dem Weg sein«, erklärte ich. »Wir wollen keine Zeit verlieren.«
»Das ist verständlich«, murmelte der Sergeant. Seine Stimme hob sich. »Ihr seid nicht zu beneiden. Vor euch liegen gut achtzig Meilen Hölle. Passt nur auf eure Skalps auf.«
»Sie saßen auf dem Herweg schon ziemlich locker«, meinte Joe grinsend.
Jemand rief den Namen des Sergeanten. An einem der Tische saßen einige Unteroffiziere. Einer winkte. »Komm endlich, Tom. Du bist uns einen Bericht schuldig.« Bannister erhob sich. »Ich wünsche ihnen alles Gute, Marshals. Nun muss ich zu meinen Kameraden. Sie wollen hören, wie es uns erging.«
»Wir wollen uns gleich von Ihnen verabschieden«, sagte ich und reichte ihm die Hand. Er nahm sie, drückte sie fest und sagte: »Ich bedanke mich im Namen des Colonels bei Ihnen. Für den Ritt nach Hause wünsche ich Ihnen Hals- und Beinbruch.«
Er verabschiedete sich auch von Joe, dann setzte er sich an den Tisch mit den Unteroffizieren. Joe und ich tranken noch ein Bier, dann gingen wir in die Unterkunft, die uns bereitgestellt worden war.
Es war noch finster, als wir unsere Pferde holten. Um diese Zeit schliefen auch die Späher der Cheyenne. Das hoffte ich zumindest. Ein Flügel des Tores wurde uns geöffnet, wir führten die Tiere hinaus und saßen draußen auf. Das Fort lag am Washita River. Über dem Fluss hingen Nebelbänke. Es war kühl. Wir beschlossen, am Fluss entlangzureiten.
Es wurde Tag. Die Sonne wanderte höher und höher. Gegen Mittag verließen wir den Washita, denn er machte einen Knick nach Norden und ihm weiterhin zu folgen hätte einen Umweg von vielen Meilen für uns bedeutet. Wir füllten unsere Wasserflaschen und tränkten noch einmal die Pferde. Vor uns erstreckte sich ein Gebiet zerklüfteter Hügel und dunkler Kämme, zwischen denen kleine Prärien mit braunverbranntem Büffelgras eingebettet lagen. Bis zum Red River, der ungefähr vierzig Meilen entfernt war, gab es kein Wasser mehr.
Wir ritten in Schweigen versunken und sicherten ununterbrochen in alle Richtungen. Stechmücken plagten uns. Manchmal ließen wir die Pferde traben. Ebenen und Senken umritten wir. Wir ließen die gebotene Vorsicht nicht außer Acht.
Die Sonne senkte sich auf den westlichen Horizont, als Joe plötzlich sagte: »Sieh dorthin, Logan.«
Ich wandte den Blick in die angegebene Richtung. Rauch zerflatterte über einem Hügel. Aber es war kein Rauchsignal.
»Sehen wir nach«, sagte ich.
Die Pferde trugen uns zu dem Hügel. Wir saßen ab, nahmen die Gewehre, ließen die Pferde zurück und liefen auf die Anhöhe. Der Rauch stieg aus einem Haufen Asche. Daneben lag ein Mann am Boden. Seine Hände und Füße waren an Pfosten festgebunden, die in die Erde getrieben waren. Die Spur mehrerer Pferde führte nach Westen.
Wir beobachteten die Umgebung. Dann sagte ich: »Ich gehe hinunter. Bleib du hier und gib mir gegebenenfalls Feuerschutz.«
Joe nickte und repetierte die Winchester.
Ich lief den Abhang hinunter. Der Oberkörper des Mannes war nackt und wies viele Brandwunden auf. Er blutete aus einigen kleinen Wunden, die ihm die Indianer mit ihren Messer beigebracht hatten. Sein Skalp fehlte. Das Bild sprang mir mit erschreckender Intensität in die Augen.
Der Bursche lebte noch, hatte aber die Augen geschlossen. Seine Brust hob und senkte sich unter rasselnden Atemzügen. Ich ging neben ihm auf die Hacken nieder. Jetzt öffnete er die Augen. Sein Blick mutete verschleiert an. »Wer – wer bist du?«
»Mein Name ist Logan.« Ich winkte Joe. Auf dem Kamm wuchs die Gestalt meines Gefährten in die Höhe.
»Ich – bin – Brad Ryder«, murmelte der Mann. »Gib – mir - Wasser.«
Hufschläge erklangen. Joe kam mit den Pferden. Ich holte aus der Satteltasche ein Messer und zerschnitt die Stricke, mit denen Ryder gefesselt war. Dann hakte ich die Wasserflasche vom Sattel, schraubte sie auf, ging bei dem Verletzten auf das linke Knie nieder, schob ihm die Linke flach unter den Kopf, hob ihn ein wenig an und setzte ihm die Flasche an die trockenen, rissigen Lippen. Er trank mit gierigen Zügen.
Joe war abgesessen und neben mich getreten. Ich sagte: »Es ist Ryder, einer der beiden Kerle, die mit Warner in Fort Cobb aus dem Gefängnis ausgebrochen sind.« Ich wandte mich an Ryder. »Wo sind O'Bannion und Warner? Ist ihnen die Flucht gelungen?«
Wasser rann über das Kinn des Verletzten. Aber seine Augen blickten ein wenig klarer. »Diese Bastarde«, keuchte er. »Ich – ich sollte hier elend verrecken. Ja, Paul und Warner sind geflohen. Wahrscheinlich aber haben sie die Rothäute in der Zwischenzeit auch erwischt. Es wäre besser gewesen, in Fort Smith zu hängen, als hier – hier ...«
Seine Stimme brach. Der Schmerz von den unzähligen Brandwunden wühlte in seinen Zügen. Sie hatten ihn mit glühenden Ästen gefoltert. An Brutalität kaum zu überbieten. Es erschütterte mich.
Der Verletzte röchelte: »Ich – ich halte diese Schmerzen kaum noch aus. Erlöse mich, Logan. Schieß mir eine Kugel in den Kopf. O mein Gott, tu' es. Du – du erweist mir damit nur einen Gefallen.«
»Wir nehmen Sie mit«, sagte ich.
Aus langen Stangen, die wir aus den Büschen schlugen, unseren Decken und den Lassos bauten wir eine Schleppbahre, deren lange Enden wir am Sattel meines Pferdes befestigten. Darauf legten wir Ryder. Er murmelte: »Wir wollten nach Amarillo. Warner – Rechnung. Er will – will ...«
Ryder verlor die Besinnung.
Wir stiegen auf die Pferde und ritten an ...
*
Warner und O'Bannion stoben dahin. Eine Horde Cheyenne verfolgte sie. Die Gegend schien an ihnen vorbeizufliegen. Schaum troff von den Nüstern ihrer Pferde. Besorgt fragte sich Warner, wie lange die Pferde dieses Tempo noch durchzuhalten vermochten. Dicht vor seinen Augen wehte die Mähne des Tieres. Neben ihm ritt O'Bannion. Mit heiserem Geschrei feuerte der Bandit sein Pferd an.
Warner schaute zurück. Es waren über ein halbes Dutzend Cheyenne. Sie ritten wie die Teufel. Ihre Pferde rannten mit aufgerissenen Mäulern. Lange, schwarze Haare flatterten im Reitwind.
Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Pferde langsamer werden würden, bis der Hufewirbel sich verlangsamte. Die Tiere schienen sich zu einer letzten Kraftprobe aufgerafft zu haben. Als spürten die Tiere, dass es an ihnen lag, die Leben der beiden Weißen zu retten. Und es war, als steigerte diese letzte, verzweifelt anmutende Anstrengung ihr Tempo.
O'Bannions Pferd konnte schließlich nicht mehr. Es war am Ende. Seine letzten Energien waren verbraucht. Es taumelte nur noch dahin. Der Bandit schlug dem Tier die Faust zwischen die Ohren und knirschte mit den Zähnen. Das Pferd röhrte.
»Verdammt, Warner!«, brüllte der Bandit, aber Lee Warner hörte ihn nicht. Vielleicht wollte er ihn auch nicht hören. Er bearbeitete das Pferd mit den Sporen und dem langen Zügelende.
O'Bannion sprang ab und kniete nieder. Sein erster Schuss holte einen Cheyenne vom Pferd. Die anderen schwärmten aus. Und während zwei von ihnen weiter hinter Warner herjagten, kreisten die anderen O'Bannion ein. Schießend griffen sie an. Der Bandit wurde von mehreren Kugeln gleichzeitig getroffen und brach zusammen. Die Indianer sprangen bei ihm von den Pferden ...
Warner schoss mit dem Revolver hinter sich. Er stob auf einen Hügeleinschnitt zu. Aufgewirbelter Staub markierte seinen Weg. Schließlich war die letzte Kugel aus der Trommel und er warf das wertlose Schießeisen einfach fort. Dann jagte er zwischen die Hügel. Er trieb sein Pferd den Hang hinauf und sprang aus dem Sattel, nahm den Karabiner und wartete. Die beiden Indianer sprengten um den Hügel herum. Warner begann zu feuern. Die beiden wurden regelrecht von den Pferden gefegt. Sie überschlugen sich am Boden und blieben reglos liegen. Warner warf sich aufs Pferd und trieb es unbarmherzig an. Es ging um Leben oder Tod ...
An Ryder und O'Bannion verschwendete Warner keinen Gedanken mehr. Die beiden hatten eben Pech gehabt. Es ging nur noch darum, die eigene Haut in Sicherheit zu bringen. Er ritt die Nacht hindurch. Am Morgen erreichte er den Red River. Er ließ das Pferd saufen und schöpfte mit beiden Händen Wasser, das er sich ins Gesicht warf. Es belebte ihn. Dann trank er. Die Rastlosigkeit trieb ihn weiter. Er überquerte den Fluss. Zwanzig Meilen bis zur texanischen Grenze lagen noch vor ihm. Jede Meile konnte die letzte sein. Aber der Bandit schaffte es. Am Nachmittag tauchten die Häuser einer Ansiedlung vor ihm auf. Am Ortsbeginn war eine Holztafel an einen Pfahl genagelt. Shamrock war mit schwarzer Farbe auf die Tafel gepinselt. Die Farbe blätterte schon ab. Dennoch konnte der Bandit das Wort entziffern. Er atmete auf.
Er ritt zum Mietstall. Beim Stalltor kam ihm der Stallbursche entgegen. »Sie sehen aus, als kämen Sie direkt aus der Hölle«, sagt der bärtige Bursche.
»Ich komme aus der Hölle«, versetzte Warner staubheiser und saß ab.
»Die Indianer spielen verrückt«, sagte der Stallmann. »Wer in diesen unruhigen Zeiten durchs Indianerland reitet, ist selbst schuld.«
»Manchmal hat man eben keine andere Wahl«, knurrte der Bandit und nahm das Gewehr. »Ich bleibe nur diese Nacht. Sehen Sie zu, dass sie den Gaul wieder auf Vordermann bringen.«
»Ich tue mein Möglichstes«, versprach der Stallbursche.
Warner legte sich das Gewehr auf die Schulter und ging zum Tor. Ehe er den Stall verließ, sagte er über die Schulter: »Ach ja, eine Frage noch: Gibt es in dem Ort einen Sheriff oder Marshal?«
»Nein, gibt es nicht.«
Der Bandit ging weiter. Er trat hinaus auf die Straße, schwenkte den Blick nach rechts, nach links, dann betrat er den Gehsteig und ging zum Saloon. Menschen beobachteten ihn. Er war alles andere als Vertrauen erweckend.
Im Schankraum befanden sich vier Männer. Sie schwiegen, als Warner eintrat und zur Theke ging, und taxierten ihn. Er bestellte sich einen großen Whisky, bekam ihn und trank ihn mit einem Zug. Die scharfe Flüssigkeit brannte in seinem Hals. Er hüstelte. Dann fragte er nach dem Barber Shop. Er erhielt den Weg beschrieben ...
*
Wir kamen nach Shamrock. Sehr schnell folgte uns eine ganze Schar Neugieriger. Stimmengemurmel erhob sich auf der Straße. Es gab in Shamrock keinen Arzt. Aber Joe kannte einen Mann, der im Krieg als Sanitäter arbeitete. Zu ihm brachten wir Snyder. Er versprach, sich um den Banditen zu kümmern und wir ließen ihn in seiner Obhut.
Wir ritten zum Mietstall. Beim Stalltor saßen wir ab. Die Strapazen steckten mir in den Knochen. Ein Blick in Joes Gesicht sagte mir, dass es ihm nicht besser ging wie mir. Wir waren beide ausgelaugt und am Ende unserer Kraft.
Am Zaumzeug führten wir die Pferde in den Stall. Der Geruch von Heu und Stroh sowie Pferdeausdünstung schlug uns entgegen. Durch die Ritzen in den Wänden fiel in schrägen Bahnen das Sonnenlicht. Staubpartikel tanzten in den Lichtbahnen.
Der Stallmann kam aus dem hinteren Teil des Stalles. »Ah, Marshals«, sagte er. »Was treibt euch in unsere Stadt? He, habt ihr einen Verwundeten gebracht?«
»Ja«, erwiderte ich, »einen Burschen, den die Cheyenne um ein Haar massakriert hätten.« Ich begann, die Bahre loszubinden. »Die können Sie zusammenhacken und verbrennen«, sagte ich.
»Vor zwei Tagen kam ein Bursche hier an«, erklärte der Stallmann. »Er kam ebenfalls aus dem Indianerland und ritt ein Pferd mit dem Brandzeichen der US-Armee.«
Ich hielt inne und schaute den Stallmann an. »Ein dunkelhaariger Mann um die dreißig, groß und hager?«
Der Stallbursche nickte. »Er und sein Pferd waren ziemlich am Ende. Er kam am Nachmittag, blieb über Nacht in der Stadt und ritt am folgenden Vormittag weiter.«
»Das war Warner«, sagte ich an Joe gewandt.
Mein Freund nickte.
Ich heftete den Blick wieder auf den Stallmann: »Nannte er ein Ziel?«
»Ich dachte mir schon, dass ihn das Gesetz sucht. Er fragte, ob es in Shamrock einen Marshal oder Sheriff gibt. Was hat er denn ausgefressen?«
»Er hat einen U.S. Deputy Marshal niedergeschossen. Sagte er, wohin er reiten wollte?«
»Er will nach Amarillo«, gab Joe zu verstehen. »Das wissen wir von Ryder. Ich glaube nicht, dass Warner seinen Plan geändert hat.«
»Ja«, murmelte ich, »um eine Rechnung zu begleichen.«
*
Wir kamen zwei Tage später in Amarillo an. Nachdem wir unsere Pferde versorgt und uns etwas frisch gemacht hatten, begaben wir uns zum Richter und erstatteten ihm Bericht.
»Und Sie denken, dass sich Warner in Amarillo befindet«, stellte der Richter fest, nachdem wir am Ende waren.
»Ich bin davon überzeugt«, erwiderte ich. »Diese Sorte ist nachtragend und rachsüchtig. Ich habe ihn nach Fort Cobb gebracht und musste ihn zusammenschlagen, als er versuchte, mich zu überrumpeln. Schätzungsweise hasst er mich. Darum rechne ich mit ihm.«
»Haben Sie dem Sheriff schon Bescheid gesagt?«, fragte der Richter. »Seine Deputys sollen Augen und Ohren offen halten.«
»Warner ist ein mit allen schmutzigen Wassern gewaschener Verbrecher«, versetzte ich. »Er wird einen Weg finden, um an mich heranzukommen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als selbst die Augen offenzuhalten.«
»Ich bin auch noch da«, bemerkte Joe.
»Okay, Marshals«, sagte der Richter. »In Borger wurde Jack Prewitt mit ein paar Kumpanen gesehen. Er wird steckbrieflich gesucht, nachdem er im Süden einige Banken überfallen hat. Scheinbar wollen die Kerle nach Norden.«
»Nicht schon wieder ins Indianerland«, stöhnte Joe.
»Wir reiten morgen Früh«, sagte ich.
»Warum nicht gleich?«, fragte der Richter.
»Sie möchten mich aus Amarillo draußen haben, Sir, nicht wahr?«
»Mit jeder Meile, die Jack Prewitt an Vorsprung gewinnt, steigt seine Chance, der Justiz in Texas zu entkommen«, versetzte der Richter ausweichend.
»Es wäre nur aufgeschoben«, sagte ich. »Außerdem haben wir unseren Auftrag noch nicht erledigt, Sir. Warner läuft noch frei herum.«
Humphrey nickte. »Sie haben sicher recht, Logan.«
Joe und ich verließen den Richter, begaben uns in die Unterkunft und legten uns auf unsere Betten. Es tat gut, lang ausgestreckt dazuliegen.
»Ob Warner weiß, dass wir zurück sind?«
»Keine Ahnung. Ich werde mich jedenfalls heute Abend auf die Socken machen und ihn suchen.«
Als es dunkel wurde, gingen wir in den Cristal Palace, um etwas zu essen. Nach dem Essen machten wir uns auf den Weg. Es gab fünf Saloons in Amarillo. Nach und nach suchten wir sie auf. Warner fanden wir nicht.
Wir kehrten zur Unterkunft zurück. Als wir eine dunkle Passage passierten, knackte es und eine raue Stimme sagte: »Ich habe mir geschworen, Zeitpunkt und Ort zu bestimmen, Logan.«
Ich schüttelte meine Überraschung ab. Meine Rechte tastete sich zum Remington. Das Handgelenk berührte den Knauf. »Du hättest nach Osten reiten sollen, Warner«, sagte ich. »So ist dein Trail hier zu Ende.«
»Du bist ziemlich großspurig, Logan. Du vergisst, dass ich dich vor der Mündung habe. Du stehst gut im Licht. Und ich bin ein vorzüglicher Schütze.«
»Einer von uns beiden erwischt dich«, versprach Joe.
»Gegen dich habe ich eigentlich nichts, Hawk. Dass du einen Stern trägst, spricht natürlich gegen dich, ist aber für mich kein Grund, dich zu erschießen. Ich schätze jedoch, dass du mitmischen wirst. Also habe ich auch für dich eine Kugel in der Trommel.«
Ich warf mich gegen Joe. Gleichzeitig zog ich den Revolver. Warner feuerte. Ein dumpfer Knall sprengte die Atmosphäre. Die Kugel verfehlte uns. Ich jagte einen Schuss in die Dunkelheit und rollte mich zur Seite. Wieder dröhnte der Banditencolt. Ich zielte auf das Mündungsfeuer, schnellte hoch und rannte zu einem Vorbau, hechtete zu Boden und rollte darunter.
Hastige Schritte erklangen. Sie entfernten sich, wurden leiser, und waren schließlich nicht mehr zu hören.
Joe war in den Schutz der nächsten Hausecke gekrochen.
»Alles in Ordnung?«, fragte ich.
»Er wird es wieder versuchen«, rief Joe.
»Natürlich. Aber jetzt sind wir gewarnt.«
Ich robbte unter dem Vorbau hervor, kam hoch und lief in die Passage, in der der Bandit gewartet hatte. Das rechte Ohr in die Richtung gedreht, in die er geflohen war, lauschte ich. Zu hören waren nur die Geräusche der Stadt.
Es machte keinen Sinn, den Banditen zu suchen. Daher kehrte ich um. Wir gingen weiter. Doch wir hatten uns getrennt. Joe benutzte die linke Straßenseite, ich die rechte. An jede Gassenmündung tasteten wir uns heran. Aber Warner blieb verschwunden.
Als wir beim Gerichtsgebäude ankamen, stand ein Deputy vor der Tür des Sheriff's Office, das an das Gerichtsgebäude angebaut war. Seine Gestalt wurde vom Licht eingerahmt, das aus der Tür fiel, und warf einen langen Schatten. Er erkannte uns. »Ich habe Schüsse gehört«, sagte er.
»Ein Bursche namens Lee Warner wollte uns zum höllischen Tanz aufspielen«, antwortete Joe.
»Warner!«
»Ja. Er befindet sich in Amarillo.«
»Der Kerl ist ziemlich unverfroren. Wir werden morgen sofort die ganze Stadt nach ihm durchkämmen.«
»Ich denke, dass er morgen Früh die Stadt verlässt«, versetzte ich.
Wir gingen weiter.
Am Morgen, als es hell war, verließen wir Amarillo. Ich war mir sicher, dass Warner irgendwo lauerte und uns beobachtete. Die Gefahr, die von ihm ausging, war nicht zu unterschätzen. Es war nicht nur skrupellos und brutal, er war auch niederträchtig und hinterhältig. Gewiss lauerte er irgendwo, um mich aus sicherer Deckung abzuknallen. Ich ritt angespannt und wachsam. Meine Sinne arbeiteten mit doppelter Schärfe.
*
Warner hatte nach seinem missglückten Anschlag am Abend die Stadt verlassen. Er musste davon ausgehen, dass ihn ein ganzes Aufgebot von Marshals und Deputysheriffs suchen und wahrscheinlich aufstöbern würde. Er hatte in einer Gruppe von Büschen übernachtet, und jetzt saß er auf einem Hügel im Schatten eines Strauches und beobachtete die Stadt.
Zwei Reiter verließen Amarillo in Richtung Nordosten. Sie ritten auf der Poststraße, die nach Borger führte. Warner erkannte sie. Es waren Logan und Hawk. In seinen Augen blitzte es triumphierend auf. Er holte sein Pferd und ritt zwischen den Hügeln ebenfalls nach Nordosten. Als er weit genug von der Stadt entfernt war, sodass ein Schuss dort nicht mehr gehört werden konnte, bezog er Stellung. Seine Geduld wurde auf keine allzu lange Probe gestellt, dann sah er die beiden Marshals kommen. Die Sterne an ihren Westen reflektierten das Sonnenlicht. Als sie auf etwa zweihundert Yards heran waren, hob der Bandit den Karabiner an die Schulter. Sein kaltes Auge ruhte über Kimme und Korn auf Logan. Langsam krümmte er den Zeigefinger. Als der Abzug den Druckpunkt erreichte, hielt Warner die Luft an.
In dem Moment wieherte sein Pferd. Es hatte die Witterung der Artgenossen aufgenommen. Warner zog durch. Der Schuss peitschte. Im selben Moment gab Logan seinem Pferd die Sporen ...
*
Ich spürte den sengenden Strahl der Kugel. Ein Brennen zog über meinen Oberarm, als hätte mich ein Peitschenhieb getroffen. Der Knall des Schusses wurde über uns hinweggeschleudert. Meine gedankenschnelle Reaktion hatte mir das Leben gerettet. Ich trieb das Pferd an und jagte es von der Straße. Es donnerte erneut, aber Warner schoss viel zu überhastet und ungezielt, und mein Pferd bewegte sich schnell. Dann stob ich um einen Hügel und war aus dem Schusssektor des Banditen.
Ich hielt an. Hufgetrappel erreichte mein Gehör. Es entfernte sich und versank schließlich in der Stille. Ich zog die Winchester aus dem Scabbard, saß ab, repetierte und rannte den Hang hinauf. Auf der Kuppe wuchsen Büsche, die mir Deckung boten. Ich sah den Reiter, der einen von der Straße abgewandten Abhang hinunterritt und sich zwischen den Hügeln nach Norden wandte. Es war Warner. Ich legte an und zielte sorgfältig, dann drückte ich ab. Der Bandit gab seinem Pferd die Sporen. Ich rannte den Hügel hinunter, band mein Pferd los und sprang in den Sattel. Ohne zu zögern nahm ich die Verfolgung des Banditen auf. Als ich einmal anhielt, um zu lauschen, hörte ich auf der anderen Seite der Anhöhe dumpfes Pochen. Er befand sich ganz in meiner Nähe. Ich stieg vom Pferd und ging zu Fuß weiter, umrundete den Hügel zur Hälfte und hielt bei einigen Büschen an. Das Pochen kam näher. Dann ritt Warner hinter einem Hügel hervor. Die Winchester hielt er in der Rechten, er hatte sie mit der Kolbenplatte auf seinem Oberschenkel abgestellt.
Jetzt hielt Warner an und schaute in die Runde. Die Anspannung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Nach einer Weile ruckte er im Sattel und das Pferd ging weiter.
Plötzlich erschien auf dem Hügel linker Hand Joe. Der Bandit riss das Gewehr an die Schulter. Joe ließ sich aus dem Sattel fallen. Der Bandit feuerte im selben Moment. Ich trat aus dem Schutz der Büsche. »Warner!«
Der Bandit gab dem Pferd die Sporen und zog gleichzeitig die Zügel straff. Das Tier stieg auf die Hinterhand und drehte sich. Warner sprang ab und rannte mit langen Sätzen nach links davon. Ich zielte kurz und drückte ab. Sein linkes Bein knickte ein und er stürzte. Sofort kroch er in eine kleine Mulde und presste sich flach auf den Boden.
Ich schaute in Joes Richtung. Er war hinter einem Strauch verschwunden. Und jetzt begann er zu schießen. Wahrscheinlich konnte er von seiner erhöhten Warte aus den Banditen sehen.
»Aufhören!«, schrie Warner. »Nicht mehr schießen! Ich gebe auf!«
Joe stellte das Feuer ein.
Lee Warner erhob sich und hob die Hände. Ich verließ die Deckung und ging, das Gewehr an der Hüfte im Anschlag, auf ihn zu. Als ich auf zehn Schritte an ihn herangekommen war, griff er blitzschnell hinter seinen Rücken. Als seine Hand wieder zum Vorschein kam, hielt sie den schweren Armeecolt.
Ich feuerte.
Die Kugel riss Warner um, ehe er zum Schuss kam. Den Revolver begrub er unter sich. Langsam näherte ich mich ihm. Gehetzt schaute er zu mir in die Höhe. Das Irrlichtern in seinen Augen war erschreckend. Seine Zähne mahlten übereinander.
»Hass führt in die Hölle«, sagte ich.
»Die Pest an deinen Hals, Logan!«
*
Wir brachten den verwundeten Banditen nach Amarillo und übergaben ihn dem Sheriff. Warner wurde hinter Schloss und Riegel gebracht, der Arzt wurde verständigt. Wir begaben uns ins Büro des Richters und berichteten ihm. Er hörte schweigend zu. Dann sagte er: »Es ist gut, dass Sie diesen Kerl aus dem Verkehr gezogen haben. Er wird seine gerechte Strafe erhalten. Jetzt aber reiten Sie los und fangen sie Prewitt, ehe er ins Niemandsland verschwindet. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Marshals. Und kommen Sie mir gesund zurück.«
»Wir werden uns bemühen, Sir«, versetzte Joe trocken, dann verabschiedeten wir uns.
Hinter uns lagen einige Tage in der Hölle – was uns erwartete, wussten wir nicht.
Das Schicksal ließ keinen in die Karten blicken ...