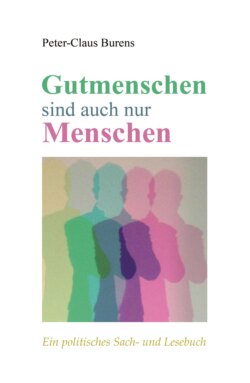Читать книгу Gutmenschen sind auch nur Menschen - Peter-Claus Burens - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAuch Maecenas war kein Altruist
Zu allen Zeiten waren Menschen bestrebt, Gutes zu tun. Über das Zahlen von Steuern und diversen öffentlichen Abgaben hinaus, haben sich seit dem antiken Griechenland Stifter, Spender und Sponsoren als aktiver Teil des Gemeinwesens verstanden.
Der historische Abriss zeigt, welche Motive zu welchen Zeiten freiwillige materielle sowie immaterielle Leistungen zugunsten der Allgemeinheit bewirkten. Dass die Beweggründe von Förderern des Gemeinwohls selten selbstlos und uneigennützig waren, sondern auch persönliche Ziele verfolgten.
Antike Kulte
Die ersten Wohltäter in der abendländischen Geschichte finden sich bei den Griechen im 4. und 5. Jahrhundert v. Chr. Reiche Bürger weihten damals heidnischen Göttern Ländereien. Da mit diesen Schenkungen kultische Zwecke dauerhaft und unter Wahrung der Vermögenssubstanz verfolgt wurden, können wir hier von veritablen Stiftungen sprechen.
Die Erträge eines solchen Nutzgutes waren für Opfergaben und somit die Verpflegung der Priester wie den Unterhalt der Tempel bestimmt. Dadurch wollte man sich zugleich des Wohlwollens der Götter und eines irdischen Gedenkens nach dem Tod versichern.
Nikias, der älteste uns namentlich bekannte griechische Stifter, ließ den Entschluss zur Errichtung einer Stiftung und deren Zweck 417 v. Chr. auf einer Stele in Delos einmeißeln. Durch diese Publizität gegenüber Dritten gab er seinem Willen generelle Verbindlichkeit.
Jeder, der fortan das den Göttern geweihte Grundstück nutzte, machte damit die Entscheidung von Nikias zu seiner eigenen. Und die Furcht vor einer Rache durch übernatürliche Wesen bestärkte ihn hierin.
Bald schon schwanden diese Ängste, und Sicherungen anderer Art waren nötig, um Nutzgut und Stiftungszweck zu erhalten. Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. verließen sich die Stifter nicht mehr auf die Gottesfurcht ihrer Mitmenschen und nachfolgender Generationen.
Das Stiftungsvermögen, das zunehmend aus Geldbeträgen bestand, wurde vielmehr einem Treuhänder anvertraut. Durch eine öffentliche und eidliche Selbstbindung an den Stiftungsauftrag übernahm dieser die Gewähr, dass die Erträge ,,auf ewig“ dem vom Stifter vorgegebenen Anliegen gewidmet blieben.
Das Prinzip der Selbstbindung von zwei oder mehreren Parteien war für die Griechen Grundlage von Vertrag und Gesetz. Der griechische Vertrag steht somit in Parallelität zum germanischen, der es den Parteien erlaubte, selbst Recht zu setzen.
Erst zur Zeit des römischen Weltreichs bedurfte der durch Addition von Selbstbindungen entstehende Konsens einer obrigkeitlichen Genehmigung. Hieraus entwickelte sich die Stiftung, wie wir sie heute kennen, als Privatdisposition auf gesetzlicher Basis.
Auch andere Phänomene, die bis in die Gegenwart präsent sind, haben ihren Ausgangspunkt im antiken Rom. Hierzu zählt das Mäzenatentum, das die Förderer von Kunst und Kultur seitdem mit einem eigenen Gattungsbegriff ehrt. Für den Personen- und Herrscherkult spielen Kunst und Kultur eine elementare Rolle.
Der im Augusteischen Zeitalter lebende, dem Adel angehörige Gaius C. Maecenas war zutiefst davon überzeugt, dass Geben und Nehmen einander bedingen. Als ein der Literatur eng verbundener Mensch unterstützte er Nachwuchstalente wie Horaz und Vergil. Diese wiederum priesen den überaus großzügigen Gönner in ihren Gedichten. Was Maecenas bereits zu Lebzeiten berühmt machte und seinen Namen für spätere Generationen zu einem Markenzeichen.
Parallel und in gewisser Weise entgegengesetzt zur Fördertätigkeit des Maecenas bestand das Interesse von Kaiser Augustus − wie das aller Alleinherrscher − darin, den eigenen Namen mit möglichst vielen guten Taten verbunden zu sehen.
Panem et circenses lautete das probate Mittel, durch das die römischen Imperatoren ihre Machtfülle beim gemeinen Volk abzusichern suchten. Die Gunst der Plebs galt es nicht nur durch die Gewährleistung einer permanenten Versorgung mit Brot und Lebensmitteln zu gewinnen, genauso durch Freizeitvergnügungen in Form von Kultur- und Sportveranstaltungen.
Demzufolge sah sich auch der Literatenkreis um Maecenas veranlasst, propagandistisch verwertbare Textbeiträge zum Herrscherkult von Augustus zu leisten. Immerhin zählte Maecenas zu den engen politischen Beratern des ersten römischen Kaisers.
Es war Vergil, der Augustus in dem Lehrgedicht Georgica als einen Weltenretter verherrlichte. „Diesen Jüngling allein lasst wehren der Zeiten Verderbnis, hindert ihn nicht“.
Christentum und Nächstenliebe
Die frühchristliche Stiftung erwuchs aus dem Geist, den der römische Kaiserkult mit seinem Zug ins Transzendente geboren hatte. Er beförderte den Glauben, wonach die als unsterblich betrachtete Seele eines Christen in Seelgerätstiftungen weiterlebt.
Ging es beim antiken Totenkult primär um den Nachruhm auf Erden, so wollten die Christen für sich das Himmelreich mittels kirchlicher Gedächtnisfeiern bzw. fortwährender karitativer Werke erlangen. Infolgedessen entstanden in stiftungsähnlicher Gestalt oder als Sachpfründe viele mittelalterliche Hospize zunächst bei Klöstern, später als Bruderschaften.
Wer kennt nicht die Heilig-Geist-Spitäler, die von Italien über Frankreich und die Alpen bis zu den Städten an der Ostsee als Sinnbilder für die christlichen Gebote der Nächstenliebe und Barmherzigkeit gegründet wurden? Hier erhielten Arme Speisung, Kranke und Krüppel Pflege, Witwen und Waisen Versorgung, Pilger eine Unterkunft.
Als Rechtsträger und Treuhänder der meisten Stiftungen war im Mittelalter die christliche Kirche die beherrschende Kraft. Dies nicht nur was das Wohlfahrts-, sondern auch was das Erziehungssystem betraf. Seit dem spätrömischen und ersten christlichen Kaiser Konstantin besaß die Kirche auf beides eine Art Monopol.
Erst in der Renaissance, mit Beginn der Neuzeit, trat in den Freien Reichsstädten das aufstrebende Bürgertum mit privaten, d. h. von der Kirche unabhängigen Stiftungen hervor. Deren Vermögen wurden von Laiengremien und Kommunen verwaltet. So bis in die Gegenwart die 1463 von Andreas Geverdes und Gerd van Lenthen ins Leben gerufene Westerauer Stiftung zu Lübeck.
„Stadtluft macht frei“ verhieß nicht nur das Abschütteln der Leibeigenschaft für Bauern und Landbewohner. Hierdurch bot sich auch die Möglichkeit, durch Arbeit und Fleiß zu Wohlstand und Reichtum zu gelangen. Dies vermochten allerdings die wenigsten Städter.
Schließlich ging mit der wirtschaftlichen Prosperität der norddeutschen Hanse- und süddeutschen Handelsstädte ein enormes, für die realen Gegebenheiten zu großes Bevölkerungswachstum einher. Damit wiederum verstärkten sich das Bedürfnis und die Nachfrage nach einer besseren Kranken-, Siechen- sowie Altersversorgung.
Neben separaten Selbsthilfeeinrichtungen der Kaufleute- und Handwerkerzünfte entstand eine Anzahl von Wohltätigkeitsstiftungen durch Handels- und Bankhäuser. Teils als Anstaltsstiftung mit Liegenschaften, teils als Kapital- oder Hauptgeldstiftung.
Letzteres geschah bisweilen in Form eines Kontos „Unseres Heilands und seiner Armen“. Dabei wurde Jesus Christus als Vertreter der Bedürftigen wie ein Gesellschafter am Gewinn und Verlust der jeweiligen Unternehmung beteiligt.
Auch Jakob Fugger engagierte sich für die Wohlfahrt seiner Vaterstadt. Er empfand sich zu sehr als Augsburger Bürger, um sein Geld allein zum Erwerb wertvoller Kunstwerke im Stil der Strozzi und Medici in Florenz auszugeben. Der schwäbische Kaufmann wollte etwas Handfestes, für die Bevölkerung Nützliches schaffen, ohne die Interessen der eigenen Firma aus dem Auge zu verlieren.
Diese musste sich am Vorabend der Reformation der öffentlichen Diskussion über Wucher, Zins und Monopole stellen. Die Gefahr eines Aufruhrs bei verarmten Zünftlern und Habenichtsen war akut. Zudem war Jakob Fugger am Ablasshandel beteiligt, mit dem um das Jahr 1517 Spenden für den Bau des Petersdoms in Rom und die Hofhaltung der Päpste eingeworben wurden.
„Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt“ suggerierte den Frommen, dass ihre Almosen sündentilgende Wirkung haben, ihnen das Höllen- und Fegefeuer nach dem Tod ersparen. Die Abtretung des Ablasshandels an Geldinstitute und große Handelshäuser zeigt jedoch, dass mit diesen Sammlungen mindestens genauso weltliche, kommerzielle Bestrebungen verfolgt wurden.
In dieser Lage galt es für Jakob Fugger sein öffentliches Renommee zu stärken. Nicht nur mit den Mitteln der Rhetorik und Propaganda, auch durch eine außergewöhnliche Tat.
Man schrieb das Jahr 1521, als er den Stiftungsbrief für die Augsburger Fuggerei unterzeichnete und besiegelte. Sie gilt als erste bedeutende Sozialsiedlung der Neuzeit und besteht bis heute.
In zunächst 52 Reihenhäusern fanden Bürger der Stadt, die unverschuldet in Not geraten waren, Wohnung und Unterkunft. Sie sollten nicht als Bettler, sondern als rechtschaffene Handwerker und Tagelöhner ihren Lebensunterhalt verdienen.
Der Stifter vermied alles, was die Beschenkten als Almosenempfänger hätte erscheinen lassen.
Deshalb verlangte Jakob Fugger die symbolische Jahresmiete von einem Rheinischen Gulden. Zudem verpflichtete er die Bewohner der Wohnsiedlung, täglich für das Seelenheil der verstorbenen Angehörigen seiner Familie zu beten.
Momentan beträgt die Kaltmiete in der Fuggerei 0,88 Euro jährlich.
Daseinsvorsorge als Staatszweck
Schon im 16. Jahrhundert, spätestens seit dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648), erwiesen sich die sozialen Probleme als zu groß, um allein durch kirchliche oder private Initiativen gelöst zu werden.
Kommunale Anordnungen, einschließlich Bettel- und Heiratsverbote für Arme, waren wenig geeignet, die wirtschaftliche Not breiter Bevölkerungsschichten erfolgreich und dauerhaft zu bekämpfen. Das gleiche galt für städtische Arbeits-, Armen-, Zucht- und Waisenhäuser.
Zudem engten sozial engagierte Bürger den Kreis der von ihnen Begünstigten ein. In Not geratenen Familienmitgliedern, eigenen Standesgruppen, Zunftgenossen und Glaubensbrüdern galten jetzt die Fürsorge und Solidarität. Eine Verantwortung für das Gemeinwesen insgesamt wurde von Privatleuten kaum noch übernommen.
Eine rühmliche Ausnahme bildete der Frankfurter Arzt und Naturforscher Johann Christian Senckenberg. Unabhängig von jeder Glaubensrichtung und Herkunft wollte er den Mitmenschen in gesundheitlichen Nöten beistehen. Nicht tradierte religiöse Hoffnungen, wie ein gottbehütetes Weiterleben nach dem Tod, ließen ihn im Zeitalter der Aufklärung zum Philanthropen werden.
Als „Dank für alle Wohltaten, die ich genossen habe“, errichtete Senckenberg ab 1763 in seiner Vaterstadt ein Krankenhaus „für die Versorgung bedürftiger Bürger und Beisassen“. Er hinterließ der Kommune zusätzlich „einen Botanischen Garten, ein anatomisches Theater, ein chemisches Laboratorium, eine ansehnliche Bibliothek“ − wie Johann Wolfgang Goethe in seinen Lebenserinnerungen berichtet.
Dessen ungeachtet bemächtigten sich ab dem 17./18. Jahrhundert die in Europa entstehenden Nationalstaaten mehr und mehr der öffentlichen Sphäre. Sie stießen in ein gesellschaftliches Vakuum vor, das es zu füllen galt.
Dies geschah ganz im Sinn des Philosophen Thomas Hobbes. Sein „Homo hominis lupus est“ unterstellt den Menschen eine Wolfsnatur, die nur ein absolutistischer Staat als Leviathan bändigen könne. Die mystische Überhöhung der Staatsmacht als allumfassende Ordnungskraft findet in dieser Zeit und Theorie ihren Ursprung. Dass es in den folgenden Jahrhunderten ausgerechnet der Staat sein würde, der seine Wolfsnatur gegenüber den Bürgern offenbarte, war für den englischen Denker damals wohl kaum vorstellbar.
Dieses Manko kam dem Kommunismus und Faschismus ebenso zupass wie dem Schreckensregime der Jakobiner während der Französischen Revolution. Erinnert sei an das blutrünstige Wüten des Comité de salut public nach 1789, eines Wohlfahrtsausschusses unter dem Vorsitz von Maximilien de Robespierre.
Ausgehend von den politischen Umwälzungen in Frankreich stand das 19. Jahrhundert ganz im Zeichen der Säkularisierung. Damit einher gingen eine intensive Ausweitung von Staatsaufgaben sowie die Zurückdrängung kirchlicher, privater, auch kommunaler Aktivitäten. Wo bisher Stiftungen und Spendenfonds Hauptelemente der Finanzierung von Schulen, Hospizen und Krankenanstalten bildeten, traten jetzt Steuergelder an ihre Stelle.
Mancher deutsche Landesherr verleibte sich in napoleonischer Zeit und im Anschluss an den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 den aus privaten Schenkungen herrührenden Besitz der Klöster oder Kirchen ein. Auf diese Weise verbesserte er die Staatseinnahmen zusätzlich.
Nur wenige, wie der hannoverische Prinzregent und spätere englische König Georg IV., stimmten einer getrennten Verwaltung der konfiszierten Güter zu. In der 1818 gebildeten, bis in die Gegenwart gemeinnützig tätigen Klosterkammer Hannover fand dies sichtbaren Ausdruck.
Die Säkularisierung von kirchlichem Eigentum entsprach ganz und gar der herausragenden Stellung der Staatsgewalt im Rahmen des Gemeinwesens, die der Philosoph Georg W. F. Hegel für Preußen maßgeblich formuliert hat. Für ihn und seine Schüler galt der Staat als „das vorhandene, wirklich sittliche Leben“. Sein Anspruch auf die „objektive Vernunft“ sollte nicht leichtfertig zugunsten fremder, nur schwer kontrollierbarer Einflüsse aufgegeben werden.
Als bestes gemeinnütziges Tun galt folglich das Steuerzahlen. Eine Vorstellung, die noch heute bei vielen Personen in der Ansicht existiert: Die Obrigkeit und der moderne Wohlfahrtsstaat werden es schon richten!
Öffentliche Aufgaben im Industriezeitalter
Die Epoche der Industrialisierung und die auf die Reichsgründung von 1871 folgende wirtschaftliche Blüte entfachten in Deutschland erneut ein beachtliches bürgerschaftliches Engagement. Es ist vergleichbar mit dem zu Beginn der Neuzeit.
Das ökonomisch erfolgreiche, gegenüber dem Adel politisch erstarkende und auf gesellschaftliche Anerkennung bedachte Bürgertum besann sich alter Tugenden. Es rief Tausende von Stiftungen und gemeinnützige Vereine ins Leben. Mildtätige Zwecke dominierten weiter, Kunst, Sport und Wissenschaft kamen hinzu.
Die in Frankfurt am Main 1914 eröffnete Stiftungsuniversität manifestierte den großen Wissensdurst vieler Bürger nach neuen Erkenntnissen. Namhafte Vermächtnisse und Spenden trugen zu ihrer Entstehung bei. Ein Rückgriff auf das von der Kommune verwaltete Erbe Johann Christian Senckenbergs beschleunigte den Vorgang.
Als private Hochschule erforschte man, neben Schwerpunktsetzungen in der Medizin und den Naturwissenschaften, vor allem die gesellschaftlichen Auswirkungen der Industrialisierung. Dies geschah auf Initiative und mit nennenswertem Kapital des jüdischen Unternehmers Wilhelm Merton.
Praktische Antworten auf die Soziale Frage gaben um die Wende des 19./20. Jahrhunderts Fabrikbesitzer in ganz Deutschland. Sie verfolgten das Ziel, durch Fürsorgeleistungen die wirtschaftliche Not unter ihren Arbeitern und deren Familien zu lindern. Gleichzeitig sollten gute Kräfte an den eigenen Betrieb gebunden und der Arbeitsfrieden gesichert werden.
Pars pro Toto mögen hier die Margarethe-Krupp-Stiftung und die von Ernst Abbé gegründete Carl-Zeiss-Stiftung stehen. Erstere baute ab 1906 preiswerten und qualitativ hochwertigen Wohnraum in Essen. Letztere schuf ab 1891 vorbildliche Sozialeinrichtungen in Jena.
Derartige Maßnahmen ergänzten die von einigen christlichen Geistlichen unternommenen Versuche, das Leid sozial entwurzelter Menschen erträglicher zu machen. Mit der Seelsorgern gegebenen Empathie wirkten sie Entfremdungserscheinungen beim Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft entgegen.
Protestantische Pastoren wie Johann Hinrich Wichern in Hamburg und Friedrich von Bodelschwingh in Bielefeld sind zu nennen, wenn es um handfeste Hilfen für in Not Geratene und Ausgegrenzte geht. Der katholische Arbeiterpriester Adolf Kolping in Köln zählte zu denjenigen, die Sozialarbeit für Handwerksgesellen leisteten.
Daneben ertrotzten die Sozialisten als politische Vertretung der Arbeiterklasse im deutschen Reichstag für ihre Klientel soziale Verbesserungen. Gesetze zur Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung wurden durch Reichskanzler Otto von Bismarck ab 1883 ins Parlament eingebracht und dort beschlossen. Ganz im Sinn einer kollektiven Daseinsvorsorge.
Dieser große politische Erfolg der Arbeiterführer August Bebel und Wilhelm Liebknecht markiert zugleich eine weitere Machtverschiebung im Verhältnis zwischen Bürger und Staat.
Der öffentliche Bereich, als sogenannt Dritter Sektor eingebettet zwischen dem staatlichen und privaten Lebensraum, wuchs in der Folge zu einem von Beamten organisierten, sterilen System von individuellen Rechtsansprüchen und staatlichen Leistungen.
Ehedem privat wahrgenommene öffentliche Aufgaben wurden nach dem Ersten Weltkrieg und dem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands noch stärker der Politik überantwortet. Eine Solidarität der Bürger untereinander, als emotionale Bindung und gelebte Nächstenliebe, schwand zunehmend.
Die Vervollkommnung der bismarckschen Sozialgesetzgebung in der Weimarer Republik, der Staat als Förderer der Wissenschaft, seine quasi Alleinstellung im Schul- und Bildungswesen, die Kommunalisierung von Kunst und Kultur waren das Ergebnis.
Totalitäre politische Systeme in Deutschland taten sodann ein Übriges, die öffentliche Sphäre zu verstaatlichen. Verbliebene Vermögen von philanthropisch gesinnten, oftmals jüdischen Mitbürgern wurden konfisziert.
Bis heute werden im allgemeinen Sprachgebrauch unter dem Begriff öffentliche Hand der Bund, die Bundesländer und Gemeinden subsumiert. Ist dies womöglich ein versteckter Hinweis darauf, dass privates Handeln im öffentlichen Bereich wenig bis nichts zu suchen hat?
Unternehmen als Sponsoren
Die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und das ,,Wirtschaftswunder“ nach 1945 schufen aufs Neue die immateriellen wie finanziellen Voraussetzungen, die für eine bürgerliche Gesellschaft unerlässlich sind.
Diese Rahmenbedingungen ermöglichten es verantwortlich denkenden und handelnden Unternehmerpersönlichkeiten, vorbildgebende Beispiele an Gemeinsinn zu hinterlassen. Hierbei ist zu denken an Alfred Toepfer, Gerd Bucerius, Bernhard Sprengel, Fritz Thyssen, Else Kröner-Fresenius, Werner Otto, Otto Beisheim, Reinhard Mohn, Peter Ludwig, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, Heinrich Dräger sowie viele andere.
Einige der Stifter, Großspender und Mäzene wollten das kulturelle Erbe bewahren, andere Anstöße zum wissenschaftlichen, speziell auch medizinischen Fortschritt geben. Wieder andere leisteten ihren Beitrag zum sozio-ökonomischen, manche zum ökologischen Wandel. Karitative Motive finden sich kaum noch.
Bedingt durch tiefgreifende strukturelle Änderungen in Wirtschaft und Gesellschaft seit der Jahrtausendwende wird man eigenverantwortlich handelnde Unternehmer mit gemeinnützigen Intentionen in Zukunft seltener antreffen. In vielen Familienunternehmen kam es inzwischen zur Ablösung von persönlich haftenden Gesellschaftern durch Aktionäre und ein von gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern mitbestimmtes Management.
Von Aufsichtsorganen bestellte Vorstände und Geschäftsführungen geben heute in Aktien- und anderen Kapitalgesellschaften vor, wer oder was gefördert wird. Die Auswahl wird in der Regel im Kollektiv getroffen im Sinne einer Corporate Social Responsibility. Die Präferenzen von Aktionären und Arbeitnehmern wollen ebenso bedacht sein wie der gewachsene Verdrängungswettbewerb auf nationalen wie internationalen Märkten.
Interne und externe Marketing- sowie PR-Experten wachen darüber, dass mit der Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Aufgabe vorab definierte Absatz- und Kommunikationsziele verknüpft sind. Sie tun dies in Abstimmung mit dem Vertrieb, der Produktion, sowie − zumal bei der Förderung von wissenschaftlichen Hochschulen − den Geschäftsbereichen für Personal, Forschung und Entwicklung.
In diesem Kontext gewinnt das Bekenntnis zum gemeinnützigen Tun eine völlig neue Sichtweise. Es ist die des Sponsors.
So möchten Sponsoren den Bekanntheitsgrad ihres Unternehmens oder den einzelner Produkte steigern. Zudem ein bestimmtes Firmen- oder Produktimage aufbauen, verfestigen, verändern. Vielleicht Kontakte mit Kunden, dem Handel, den Mitarbeitern und Multiplikatoren pflegen bzw. verbessern.
Für jedes der genannten Ziele suchen Sponsoren geeignete Mittler, Botschafter, Influencer. Das heißt Personen, Projekte, Veranstaltungen oder Organisationen, bei denen sie Werbepotenzial vermuten.
Beim Sport, der Kultur, der Wissenschaft scheinen sie in den letzten Jahren besonders fündig geworden zu sein. Neuerdings ist ein Interesse an Bildungsfragen, an Klima- und Naturschutz zu registrieren.
Leistung und Gegenleistung, als Austauschbeziehung in Verträgen schriftlich fixiert, bestimmen das nüchterne Verhältnis der Partner zueinander. Die Vereinbarung von zumeist exklusiven, zeitlich begrenzten werblichen Nutzungs- und Lizenzrechten ist Voraussetzung eines jeden Sponsorships.
Überdies können Unternehmen ihr Sponsoring bei der Finanzverwaltung als Werbeaufwand in Anrechnung bringen. Das ist in der Regel lukrativer als die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden oder der Einsatz firmeneigener Stiftungsmittel. Außerdem müssen beim Spenden Vorgaben des Gesetzgebers stärker beachtet werden.
Echte und falsche Gutmenschen
Auch wenn Sponsoren das gemeinnützige Tun in Deutschland mit jährlich über sechs Milliarden Euro zunehmend dominieren, so liefern vor allem die Non-Governmental Organizations (NGOs) − private Vereine, Verbände, Institutionen, Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen − einen lebendigen Beweis für die Pluralität und Diversität unserer Gesellschaft. Sie stehen für ein hohes Maß an kreativen Ideen, ungezählte Anliegen und alternative Meinungen.
Zu guter Letzt sind es die medial kaum beachteten, scheinbar unbedeutenden Beiträge unbekannter Personen, die den Wunsch nach Fortbestand und Weiterentwicklung einer bürgerlichen Gesellschaft unterstreichen: der Kassenwart im Verein, die ehrenamtliche Rettungssanitäterin, der freiwillige Helfer im Dritte-Welt-Laden. Nicht zu vergessen die Belegschaft einer mittelständischen Firma, die an Wochenenden ein schützenswertes Biotop unentgeltlich instand hält.
Auch die Stiftung des 1980 verstorbenen Bad Kreuznacher Lehrers Henning Kaufmann zeugt von der Vielfalt zivilgesellschaftlichen Engagements. Der Pädagoge widmete sein Leben mit großer Akribie wie Expertise einem wissenschaftlichen Orchideen-Fach, der deutschen Namenforschung. Durch die Verleihung eines mit dreitausend Euro dotierten Preises ermutigt er Jahr für Jahr junge Forscher, es ihm gleich zu tun.
Henning Kaufmann steht für das konkrete Beispiel eines Gutmenschen − für einen guten Menschen im wahrsten Sinn des Wortes. Nachhaltig und mit begrenzten materiellen Mitteln packte er eine ihm persönlich wichtige bürgerschaftliche Aufgabe beherzt an.
Wenn heute unreflektiert, eher spöttisch und abwertend von ,,Gutmenschen“ die Rede ist, werden mit dieser Wortwahl nicht selten Personen charakterisiert, die bei ihren Mitmenschen ein altruistisches Denken anmahnen. Dazu ,,politisch korrekte“, nach eigenem Gutdünken aufgestellte Regeln für gesellschaftliches Verhalten einfordern.
Derart von ihrer persönlichen Weltsicht Überzeugte ignorieren, dass ein selbstloses Dienen nicht der Natur des Menschen entspricht. Es deshalb weder von ihnen selbst noch von echten Heiligen vorgelebt wird oder wurde. Auch nicht werden kann.
Schon dem Römer Maecenas war das Prinzip des Do-ut-des in die Wiege gelegt. Gleiches gilt für die mildtätige Mutter Teresa, die Klimaaktivistin Greta Thunberg wie für die olympische Bewegung als Völker verbindende Einrichtung des Sports.
Solche und neuere Beobachtungen der Glücksforschung zeigen: Wenn wir anderen helfen, tun wir damit viel für uns selbst. So verbessert sinnstiftendes Tun die eigene Emotionsbilanz, kann sogar die Lebenserwartung um mehr als fünf Jahre steigern. Außerdem kommt eine gute Sache schneller voran, wenn Gemein- und Eigennutz Hand in Hand gehen. B e i d e s ist Antrieb und Motivation für menschliches Verhalten.
Scheinheilige Moralapostel und fundamentalistische Weltverbesserer hat Max Weber vor einhundert Jahren als selbstgerechte „Gesinnungsethiker“ gescholten. Nur hehre Worte ohne eigene Taten waren dem Volkswirt und Soziologen ein Graus.
Beim ethisch fundierten Tun geht es für Weber nicht primär um gute Absichten, sondern um die Bereitschaft zur persönlichen Haftung bei deren Umsetzung. Vehement plädiert er für eine von ihm „Verantwortungsethik“ genannte Handlungsweise in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Wer sich die Analyse von Max Weber lieber als prosaischen Text zu eigen macht, dem sei das Bonmot des Schriftstellers Erich Kästner empfohlen. „Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es“. Unvergessen bleibt in diesem Kontext auch der zivilgesellschaftliche Weckruf von US-Präsident John F. Kennedy. „Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country“.
Um die eigene Verantwortung zu minimieren, fordern Gesinnungsethiker oft wie gern Staat und Kommunen zur Durchsetzung ihrer als nicht verhandelbar postulierten Sichtweisen auf. Nur selten laden die Protagonisten zur Realisierung von gemeinsam mit interessierten Bürgern organisierten Projekten ein.
Solch staatsgläubig gesinnte Personenkreise unterstellen bewusst oder unbewusst, dass private Wohltäter in erster Linie auf eine Steuerersparnis, öffentliche Ehrungen und andere persönliche Vorteile erpicht seien. Dabei investieren die argwöhnisch Betrachteten unwiderruflich mehr an Geld und/oder Freizeit, als wenn sie ausschließlich penible Steuerzahler geblieben wären.
Allzu leicht werden die tatsächlichen Beweggründe übersehen, die echte Gutmenschen zum gemeinnützigen Tun veranlassen. Dazu gehören die persönliche Betroffenheit durch positive wie negative Erlebnisse, das ernsthafte Interesse an einer Sache oder Thematik. Schließlich eine tief empfundene Dankbarkeit für das eigene Wohlergehen oder das ehrenvolle Gedenken an Verstorbene.