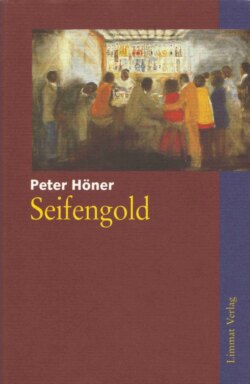Читать книгу Seifengold - Peter Höner - Страница 8
2
ОглавлениеDie Brandung klatscht an die Mauer der Terrasse. Seit Tagen fegt der Wind Gewitter und Regengüsse über die Insel, brüllt das Meer, und der Lärm rund um das ‹Rafiki Beach Hotel› verwandelt seine Räume in stille Oasen wohliger Ruhe.
Jürg Mettler liegt ausgestreckt in seinem Himmelbett und schaut in den dunklen Baldachin. Trotz der geschlossenen Fenster bläht sich das Moskitonetz in den Böen des Sturms. Die gedrechselten Stützen erinnern an die Masten eines Bootes, schemenhafte Striche, die nach oben in der Finsternis des Zimmers verschwinden.
Neben Mettler schläft Alice. Ihr Wuschelkopf ruht auf seiner Brust. Ein Bein, quer über seinen Bauch geschoben, drückt ihm auf die Magengrube.
Die Regenzeit in Lamu ist Mettlers liebste Zeit. Ihr Beginn ein Freudenfest. Schon Tage vorher wird über nichts anderes geredet. Man beurteilt den Himmel, die Wolken und die Farbe des Meeres. Einer weiß: In Malindi hat es letzte Nacht geregnet. Dann, innerhalb weniger Stunden, ist es soweit. Ein scharfer Wind fegt Staub und Hitze aus der Stadt, Wolkenbrüche spülen jeden Winkel aus. Der Dreck eines Jahres wird ins Meer geschwemmt. In der Stadt und auf der Insel herrscht der Sturm.
Nach einem ersten Freudentaumel verkriechen sich die Menschen in ihren Häusern und beginnen zu warten. Sie warten sechs Wochen lang, bis die neue Saison beginnt.
Für Mettler und Alice besitzt die Regenzeit einen zusätzlichen Reiz.
Als brummiger Griesgram ist er nach Lamu gekommen. Ein freudloser, schwitzender Privatdetektiv aus der Schweiz, der verlernt hatte, über sich selbst zu lachen. Er glaubte, zu seinem Alter gehöre eine Lebenskrise, und er war unfähig zu irgendeiner Entscheidung. Dann, im allerletzten Augenblick, entschied der Himmel für ihn. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Regenzeit begann. Völlig durchnäßt flüchtete er durch die Gassen Lamus und rettete sich zu Alice, die ihn liebte, wie er war. Sechs lange Wochen schlossen sie sich im ‹Magharibi Guesthouse› ein und vergaßen die Welt. Nach fast zwanzig Jahren hatten sie sich ein zweites Mal gefunden, der lange Regen kam ihnen gerade recht.
Die Jahre in Lamu veränderten ihn. Nicht nur, daß er schlanker wurde, kräftiger, sportlicher. Nein. Wohl zum ersten Mal erfuhr er, was es hieß, Zeit zu haben. Stunden, Tage, Wochen. Endlich hörte er auf, zu zählen und zu planen, erlebte er eine Art Stillstand. Die Heiterkeit des Augenblicks.
Er gab seinen Beruf auf. Er kaufte zusammen mit Alice das ‹Rafiki Beach Hotel› und wurde Wirt. ‹Wer nichts wird, wird Wirt.› Sagt man in der Schweiz!
Er fand Freunde. Robinson Njoroge Tetu zum Beispiel, den Chef der Kriminalpolizei. Sie mochten sich, weil sie über vieles ähnlich dachten. Und waren doch verschieden. Tetus Ehrfurcht vor der eigenen Uniform. ‹Der Polizist: Ein Diener des Staates.› Sie stritten sich sogar deswegen. Aber dann, nachdem Tetu einen weiß Gott verzwickten Fall bravourös gelöst hatte, schickte ihn ihr Bekannter, Hemed S. Lali, nach Lodwar in die Wüste. Mettler konnte seinem Freund nicht helfen. Einfacher wurde Mettlers Leben nicht. Nein. Dafür sorgte und sorgt sein Sohn Ali. Dieser weigerte sich, mit ihnen in Lamu zu leben, im Hotel zu helfen. ‹Nicht solange du und meine Mutter das ‹Rafiki› leiten!› Eine Haltung, die ihn sehr getroffen hatte. Alice sah das nicht so. ‹Wenn der Junge keine Lust hat …› Jetzt lebt er in der Schweiz, hat vor kurzem geheiratet. Er hatte nichts dagegen, bitteschön, der Junge kann heiraten, wen er will.
Sie waren auf der Hochzeit. Alice und er. Die Eltern des Bräutigams. Aber seit dieser Hochzeit träumt Alice von einem Leben in der Schweiz. Sie ist sogar bereit, das Hotel zu verkaufen und in die Schweiz zu ziehen. Weil ihre Familie jetzt in Europa, in Zürich sei.
Mettler seufzt. Er hat Ali erst kennengelernt, als der Bursche längst auf eigenen Füßen stand. An den zurückgekehrten Vater glaubte in Lamu niemand. Ali war der Sohn von Mama Alice. Natürlich war es falsch zu erwarten, daß sich zwischen ihnen noch eine Art Vater-Sohn-Verhältnis entwickeln würde. Trotzdem. Er versuchte zum Beispiel, Ali in der berühmten Hotelfachschule in Nairobi unterzubringen. Der Bursche lief davon. Mehrmals. Alice und er schickten ihren Sohn in die Schweiz, steckten ihn in ein Internat. Der Junge weigerte sich, seine mangelhafte Schulbildung aufzubessern. Er motzte, ein Besuch der Schweizer Hotelfachschule in Luzern interessiere ihn nicht. Immer war alles falsch, was er für Ali plante. Aber wenn er seinen Sohn fragte, was er denn nun werden wolle, er müsse doch etwas lernen, einen Beruf, lachte der Bursche nur. Alle zwei Monate wollte er etwas anderes. Einmal wollte er eine Musikgruppe gründen, dann träumte er von einer Ausbildung als Sprengmeister. Was ihm gerade einfiel. Oder er wollte studieren, ein Geschäft gründen, irgendetwas, wovon er sich einen Haufen Geld versprach. Seine Alten abgaunern, nannte er das wohl.
Schließlich lernte er die Schweizerin Christina Frank kennen. Vor einem Jahr, vielleicht schon früher. Die beiden wollten in Zürich einen Laden eröffnen, in dem sie allerlei Krimskrams verkauften. Tina und Ali, Kunsthandwerk aus Afrika. Und sie heirateten. An einem kalten 2. Mai.
Mettler schiebt das Bein von seinem Bauch, löst sich vorsichtig aus der Umklammerung von Alice und stiehlt sich aus dem Bett. Er schlüpft in seinen Morgenrock, setzt sich in einen Sessel beim Fenster und zieht die Vorhänge zurück.
Der Sturm hat nachgelassen. Ein gleichmäßiger, schwerer Regen rauscht auf die Hotelbauten nieder. Gleich nebenan plätschert ein Wasserstrahl von einem der Dächer auf die Terrasse. Die Brandung des Meeres ist schwächer geworden, wahrscheinlich weil die Flut ihren höchsten Stand bereits überschritten hat, und die Wellen die Hotelmauer nicht mehr erreichen.
Mettler weiß aus Erfahrung, daß sich sein Gedankenkarussell, einmal in Gang gekommen, noch bis in den Morgen weiterdreht. Er weiß auch, daß er die Fragen, die ihn beschäftigen, nicht lösen kann. Nicht ohne Alice. Trotzdem weckt er sie nicht. Seine Angst, irgendwann im Verlauf der nächsten Jahre wieder nach Europa zurückkehren zu müssen, kann oder will Alice nicht verstehen.
«Was hast du gegen die Schweiz? Was ist denn so schlimm an dem wunderschönen Land?» hatte Alice ihn gefragt, als er nach Ausreden suchte, um ihre Teilnahme am Hochzeitsfest zu entschuldigen. Er antwortete trotzig:
«Die Schweiz ist nicht schön, und Hochzeiten sind ein Greuel.»
Die naßkalten Tage – Graupelschauer, dazwischen kurze Aufhellungen einer stechende Aprilsonne – schienen ihm recht zu geben. Später verhüllte eine diesige Wolkendecke die Sonne, und die Bise trieb ihnen das Wasser in die Augen und fuhr unter Jacken und Pullover.
Die Hochzeit, das Fest an sich, war durchaus erträglich. Das übliche Ritual. Immerhin verzichteten die beiden auf einen Ausflug auf dem Hallwilersee oder ein Fest in einer Waldhütte. Christina und Ali hatten in einem Restaurant einen Saal gemietet, irgendwo hinter Winterthur. Das Essen war ausgezeichnet. Trinksprüche und Kanzelworte beschränkten sich auf ein Minimum. Auf eine Tischordnung wurde verzichtet. Viel Aufwand trieben die beiden wirklich nicht.
Aber die Gäste, Christinas und Alis Freunde, Christinas Familie. Christina selbst.
Natürlich geht es ihn nichts an, wen sein Sohn heiratet. Ali heiratete eine Weiße. Eine Schweizerin. Warum nicht. Nur: Warum heiratete er eine Frau, die zehn Jahre älter ist? Eine Frau, die soviel mehr Erfahrung besitzt und dem schmalen Bürschchen in allem überlegen ist. Sie paßte doch nicht zu ihm.
Zu Christina selbst fällt ihm nicht viel ein. Er hatte sie kaum kennengelernt. Attraktiv ist sie nicht, das kann er sagen, nicht einmal hübsch. Eine kleine Frau und ein bißchen pummelig. Doch das mochte damit zu tun haben, daß sie bereits im siebten Monat schwanger war.
Alice behauptete später, Christina habe feine Züge, Lachfältchen und ein sinnliches Grübchen über der Oberlippe. Grüne Augen. So genau hatte er seine Schwiegertochter gar nicht angeschaut. Ihre Mutter auf jeden Fall war eine kleine, dicke, bösartige Frau, die den ganzen Abend weder mit Alice und ihm noch mit Ali ein Wort gewechselt hatte.
Christina hatte ihnen erzählt, daß sie nach ihrer Banklehre mehrere Jahre in Afrika gearbeitet habe. In einem Hotel an der Diani Beach, dessen Namen er schon wieder vergessen hat. Nebenbei, und weil den Einheimischen der Zutritt zu den Touristenhotels verboten war, gründete sie zusammen mit einem Inder eine Ladenkette. In den Nischen der Hotelhallen verkauften sie den Touristen bedruckte Tücher, Afro-Kitsch, geschnitzt und getöpfert. Selbstverständlich gegen harte Devisen. Später soll ihr dann ihr Chef einen Job als Vermögensverwalterin und Anlageberaterin vermittelt haben. Immobilien.
Jaja, Christina Frank kennt seine Wahlheimat, daran zweifelt Mettler keinen Augenblick. Auch ihm wollte man vor Jahren einen solchen Hotelshop schmackhaft machen. Die Lösung seines Devisenproblems. Wertlose Schillinge würden sich in Dollars, Deutsche Mark und Schweizerfranken verwandeln. Doch er und Alice wollten in ihrem Hotel keine Krämerbude. Abgesehen davon, daß diese Art von Geschäften nicht über jeden Zweifel erhaben war. Doch er sagte nichts. Auch nicht, daß er ihre Firma kannte.
Selbstverständlich gehörten Christinas Freunde aus Afrika zur Schar der Hochzeitsgäste: Judith Kibo, eine bildhübsche Kalenjin, die zusammen mit Christina in die Schweiz gekommen war, als diese von ihren Chefs, Frau Stocker und Lomazzi, in die Schweizer Geschäftsverwaltung berufen wurde. Der indische Geschäftspartner von Christinas Ladenkette, Ralf Vir. Henrik Imbugwa Kimele, ein Sohn oder Vetter des kenyanischen Finanzministers.
Die wichtigsten Gäste aber, zumindest für Christina, waren wohl Esther Stocker, eine etwa fünfzigjährige Frau, von der es hieß, sie sei vor Jahren die Geliebte eines afrikanischen Ministers gewesen, und der Italie-ner Salvatore Lomazzi, der gerade von einer Geschäftsreise aus Ostafrika zurückgekehrt war. Lomazzi kannte Lamu:
«Ein häßlicher Ort. – Da gehe ich doch lieber gleich nach Zanzibar.»
Wenn Mettler sich vorstellt, wie Tetu die Hochzeitsgäste beurteilt hätte … Schmarotzer wäre wahrscheinlich noch die höflichste Bezeichnung gewesen. Leute, die offenbar nichts arbeiten, die kein Vermögen erbten und doch alles haben, die sich aufführen, als gehöre ihnen die Welt, erregen den Verdacht eines jeden gradlinigen Beamten. Nur sehr selten wird ein Reicher durch seine Arbeit reich, und einer wie Lomazzi hat sich bestimmt noch nie die Hände schmutzig gemacht. Mettler kann Tetu verstehen, wenn er solche Leute verdächtigt, Blender, Betrüger – Banditen zu sein.
Der Hotelier späht durchs Fenster und lauscht in die Nacht hinaus. Die Regennacht ist so stockdunkel, daß es nichts zu sehen gibt. Nicht einmal die allernächsten Dinge. Die Mauer, die den Balkon ihres Zimmers vor Wind und Regen schützt. Oder die Stange des Geländers, in der sich immer, vor allem wenn sie naß ist, irgendwo ein Lichtlein spiegelt. Aber das Hotel ist leer, es brennen keine Lichter, und aus dem Wolkenhimmel funkelt kein Stern. Der Regen rauscht. Zu sehen ist er nicht.
Während der Pausen zwischen den Gängen des Hochzeitsessens wurde Mettler Zeuge einer Bemerkung des Italieners zu Ali, die vielleicht witzig gemeint, trotzdem sehr verletzend war. Im Zusammenhang mit Ali und Christinas Laden fragte Lomazzi, ob Ali schon einen Zählrahmen habe, um seine Gewinne zusammenzurechnen. Der Italiener lachte, Ali nickte. Dann klopfte er Ali auf die Schultern und sagte zu Mettler:
«Ihr ‹schwarzes Schaf› wird zum Verkaufsmagnet. Wenn Tina nicht auf ihn aufpaßt, wird er Zürichs Casanova. – Eine Kanga von unserem Adonis aus Afrika.»
Und wieder lachte er. Und Ali nickte. Und lachte. Und versuchte etwas zu entgegnen. Aber Lomazzi ließ ihn einfach stehen. Er winkte jemandem, auf den er zueilte, um ihn zu begrüßen, ganz so, als sei die Hochzeit seine Feier.
Vielleicht war es eher Alis Nicken, sein Lachen, das Mettler irritierte. Die Hilflosigkeit seines Sohnes, die offensichtlich wurde, und die sich bestätigte, als sie zusammen mit Christina den neuen Laden besichtigten.
Das Quartier hinter Zürichs City hatte sich in den letzten Jahren sehr verändert. Viele der alten Häuser waren abgerissen oder renoviert worden. Rund um die ehemaligen Traminseln entstand ein neues Einkaufszentrum. Der Autoverkehr wurde um den Häuserblock geleitet. Eine Maßnahme, von der Christina behauptete, das sei schon immer so gewesen, habe auch mit den Hausbesetzungen nichts zu tun. Sie mochte recht haben. Mettler freilich brachte den Platz immer mit jener bunt beklecksten Hausfassade in Verbindung, die für ihn das Portal zum sogenannten Arbeiterviertel bedeutet hatte. Der Laden selbst lag hinter dem neuen Einkaufseldorado in einer der Seitenstraßen, die noch ein wenig an den ehemaligen Charakter des Viertels erinnerten. Eine Wohn- und Ladenstraße. Die meisten der Wohnungen freilich waren zu Büros umgebaut worden, von den Läden blieben nur die Schaufenster übrig. Werbeschilder und Dekorationen vergilbten in Geschäften, deren Eingänge man vergeblich suchte. Die Straßen lebten von den Restaurants, die wiederum von den Angestellten lebten, die in den ehemaligen Wohnungen arbeiteten und sich über Mittag in einer Pizzeria oder mit einem preiswerten Tagesmenü, gutbürgerlich, verpflegten. Trotzdem war es keine schlechte Lage für einen Laden, wie ihn Ali und Christina planten.
Der Laden sollte im April eröffnet werden. Doch dann verzögerte sich die Renovierung der alten Ladenlokale, weil die junge Architektin, die den Umbau leitete, sich im Dschungel baupolizeilicher Bestimmungen verrannte. Doch als Säulen die Decke stützten, wo früher eine Wand war, konnte der Laden endlich eröffnet werden.
Das Schaufenster war bereits dekoriert. Ein echter Einbaum voller Schätze aus Afrika. In der gläsernen Eingangstüre klebte, über die gesamte Breite der Türe gespannt, ein rosafarbenes Papierband: ‹Eröffnung Donnerstag›.
Im Laden glitt ein getönter Lichtstrahl über falsche Perlen. Neben Muscheln lagen ein paar Armbänder auf dunklem Samt. Drei Kangas tanzten, um Hüften geschlungen, vor einer grob gekörnten weißen Wand. Der Laden verriet Christinas Handschrift, Christinas Geschmack und Geschick. Ein billiges Schmuckstück wurde zu einer wahren Kostbarkeit.
Ein Paar Ohrringe – zwei lanzenförmige Messingplättchen an einer schwarzen Holzperle – und die entsprechende Halskette kosteten als seltenes Einzelstück zweihundertundfünfundsechzig Franken. In Kenya ließ sich Ähnliches in jedem Souvenirshop für ein paar Franken kaufen.
Doch schon Alice erlag Christinas Verkaufstrick. Selbst als sie sich von ihrer ersten Überraschung erholt und die wenigen Stücke ausgiebig bewundert hatte, durchschaute sie Christinas Verkaufsmethode nicht. Verunsichert fragte sie, ob das, was sie hier sehe, alles sei, was Ali und Tina anzubieten hätten?
Eine Bemerkung, auf die Ali offensichtlich gewartet hatte. Und siegessicher trumpfte er auf:
«Nun, siehst du, meine Mutter sagt es auch. Wir müssen mehr ausstellen. Alles! So!» Und er zeigte auf Christinas Altäre der Verkaufskunst: «Wenn jeder Kunde das Gefühl hat, bei der ausgebreiteten Ware handelt es sich um unser letztes Stück, getraut sich doch niemand zu kaufen.»
Ein kurzer Jubel.
Christina fuhr verärgert dazwischen, ein Laden sei doch kein Basar. Daß sie recht habe, dafür habe seine Mutter eben den allerschönsten Beweis geliefert. Selbst Alice, die diese Dinge ja schon tausendmal gesehen, habe sie nun mit neuen Augen angeschaut. Und sie beschwerte sich über Ali, der sich weigere, ihre Taktik zu verstehen.
«Ein unbelehrbarer Dickkopf. Er schwört auf die afrikanisch-indische Auslegeordnung, wo viel schon gut bedeutet.»
Mettler erinnerte sich an den dummen Spruch Lomazzis, ob Ali schon einen Zählrahmen habe, und Ali tat ihm leid. Sein Sprößling zwischen zwei Fronten.
Ali versuchte Christina zu beruhigen, indem er ihr zugestand, daß sie besser wisse, wie sich den Schweizern etwas verkaufen lasse. Eine Einschränkung, die Christina nicht gelten ließ. Sie behauptete, daß sie und Ralf Vir in Afrika haargenau dasselbe Konzept verfolgen würden. Und mit Erfolg. Worauf sich Mettler die Frage nicht verkneifen konnte, ob sie und Vir in Afrika auch derart überhöhte Preise nähmen?
Christina schaute ihn an, als ob sie ihn nicht verstanden hätte. Sie durchbohrte ihn mit ihren grünen Augen, entsetzt und ungläubig. Ein Weißer, ihr Schwiegervater wagte es, sie zu kritisieren? In ihrem eigenen Laden? Vor Alice und Ali?
Mettler hielt ihren Blick nicht aus. Ali wird Christina gesagt haben, wie sie ihn einzuschätzen habe. Obwohl er ihren Laden mitfinanzierte, hielten ihn wohl beide für einen selbstgerechten Blödian. Dann sagte Christina so leise, daß sie kaum zu verstehen war, daß in Zürich das Leben unvergleichlich viel teurer sei, und es, trotz seiner Hilfe, noch lange nicht sicher sei, daß sie aus den Einnahmen des Ladens leben könnten.
«Und in ein paar Wochen sind wir zu dritt.»
Und abermals entstand eine peinliche Pause. Alle starrten ihn an, auch Alice, als ob sie eine Entschuldigung erwarten würden. Er schwieg. Er hätte gerne noch ein paar Worte gesagt. Aber aus Rücksicht auf Alice stellte er keine weiteren Fragen mehr.
Kurz danach verließen sie den Laden, schlenderten durch die sonntäglichen Straßen, spazierten über die Sihl in die Innenstadt und setzten sich in ein Café. Und dort, bei einem späten, zweiten Frühstück, schlug Alice vor, daß sie und er für Christina und Ali eine Art Einkäufer spielen könnten. Kiondos, Matten, Tücher. Eine Idee, in die sie sich augenblicklich verliebte.
Ali war begeistert. Natürlich, es ging ja gegen seinen Vater. Er rühmte den guten Geschmack seiner Mutter und schwärmte von den Möglichkeiten eines Direktimports. Höhere Gewinne. Etwas Besonderes. Ausgewählte Stücke. Die beiden redeten sich in einen wahren Begeisterungstaumel. Eine eigene Firma wollten sie gründen. ‹Mutter und Sohn›. Ganze Schiffsladungen wurden auf die Reise geschickt. Schon wurde der Laden in Zürich zu klein. In Bern, Basel, in Lausanne und Winterthur entstanden weitere Geschäfte. Ali erheiterte sie mit einer Solonummer. Er als Firmenboß, Zigarre rauchend inmitten einer unübersehbaren Kinderschar. Und selbstverständlich sollten seine Kinder allesamt unentbehrliche Stützen der Gesellschaft werden.
Christina merkte rascher als Mettler, daß es ihrer Schwiegermutter mit dem ausgefallenen Plan ernst war. Sie begann, Alice und Ali die Schwierigkeiten auszumalen, die mit dem Export von Kunst verbunden seien.
«Und ein schönes Schmuckstück ist ein Kunstwerk. Strenggenommen ist jede Ausfuhr sogar verboten. Auf jeden Fall braucht man dafür eine ganze Reihe von Verträgen und Bewilligungen, die man ohne gute Kontakte kaum bekommt …»
Alice und Ali lachten.
«Ich rede aus Erfahrung. Aber bitte, versuchen könnt ihr es ja. Ich will auch nicht ausschließen, daß ich und Ali …», und listig sonderte sie Ali aus den Plänen seiner Mutter aus, «… daß Ali und ich einmal zu deiner Kundschaft zählen. Nur, im Moment? – Ist der Zeitpunkt für Experimente nicht ein bißchen ungeschickt?»
Ali wollte widersprechen, doch Christina nahm Alis Hand und legte sie auf ihren Bauch.
Nun machte Alice das Angebot, sie könnte ja einmal eine Art Testlieferung zusammenstellen. Sie hätte früher gute Kontakte zu Frauengruppen gehabt, die sich bestimmt wieder auffrischen ließen. Und wieder überließen sich Alice und Ali ihren Verrücktheiten. Sie fanden immer neue Produkte, die sich in der Schweiz vermarkten ließen: Drahtautos, holzgeschnitzte Bücherstützen und Musikinstrumente, Siwas und Trommeln, Spieldöschen, Aschenbecher aus Seifenstein. Masken, Kangas, Salatbestecke. Ringe, Ketten und Kämme.
Mettler amüsierte sich köstlich. Als er begriff, daß Alice und Ali sich nicht nur in Gedankenspiele verstrickten, war es bereits zu spät. Die beiden ließen sich von ihren Plänen nicht mehr abbringen, und er, der sich allzu lange als Mitverschwörer beteiligt hatte, war nun plötzlich selbst in die Eselei verwickelt. Es half ihm nichts mehr, daß er aufhörte, den Luftschlössern der beiden Beifall zu spenden, daß er Christinas Konzept rühmte und ihre Kontakte lobte. Alice und Ali waren bereits dabei, das ‹Rafiki› zu verscherbeln.
Herrgott, was für ein Unsinn. Er hat keine Lust, das Hotel aufzugeben. Weder jetzt noch in ein paar Jahren. Alice und er gehören nach Lamu, das ‹Rafiki› ist ihr Zuhause. Aber seit dieser Hochzeit benützt Alice jede Mißstimmung zwischen ihnen, um ein Loblied auf die Vorzüge eines Lebens in Europa anzustimmen. Ein Leben, das sie gar nicht kennt, und das ihr nur deswegen reizvoll erscheint, weil sie in Zürich wohnen könnte. In der Nähe Alis. Und, er weiß es wohl, bei der Wiege ihres Enkels.
Der Regen hat aufgehört. Die Wolkendecke reißt auf, und ein schwacher Lichtstrahl läuft vom Wind übers Wasser gepeitscht auf den Strand zu, aufblitzend tänzelt er den Schaumkronen der Brandung entlang.
Der Schein aus dem Wolkenfenster, dessen Fetzenränder vom verdeckten Mond beleuchtet werden, hellt auch das Zimmer auf. Vor der Wand mit der schwarzen Holztüre dämmern die Laken des Bettes, der Baldachin des Moskitonetzes, und im Spiegel, der dem Bett gegenüber an der Wand hängt, entsteht Mettlers Silhouette, kaum wahrnehmbar, ein Schatten im Geviert.
Mettler dreht sich nach Alice um. Nur gerade die leicht gewölbte Linie ihrer Stirne, die Form von Kinn und Nase zeichnen sich vom Kissen ab. Schon die Locken der Haare verlieren sich in den Grautönen der Umgebung. Aus aufgeworfenen Tüchern taucht ein Knie, eine dunkle Sichel vor stumpfem Weiß. Rundungen und Kuhlen verschmelzen mit den Falten des Überwurfs.
Alice ist keine kleine, zierliche Frau, sondern groß und stattlich, eine selbstbewußte Inselkönigin. Ein Vergleich, den sie nicht gerne hört. Sie sei nie eine Prinzessin gewesen. Weder damals, als sie miteinander in die Dünen liefen, noch später, als sie neu verliebt das Hotel übernahmen. Trotzdem hält Mettler Alice für eine zerbrechliche Person. Eine Empfindung, die sich noch verstärkte, als Alice vor zwei Jahren ein Kind verlor.
Nur wenige Wochen nach seiner Bruchlandung auf dem Flugfeld von Lamu – er kehrte zusammen mit Tetu von einer Mission in den Mulika Range Nationalpark zurück – brachte Alice ein Kind zur Welt, mehr als drei Monate zu früh. Die Ärzte Lamus konnten es nicht retten. Fast schlimmer als der Verlust des Kindes aber war der Rat, Alice müsse eine weitere Schwangerschaft vermeiden. In einer späteren Untersuchung wurde sogar festgestellt, daß sie keine Kinder mehr bekommen könne.
Der Befund des Arztes stürzte Alice in ein Unglück, wie es Mettler nicht für möglich gehalten hätte. Nie erlebte er Alice so verzweifelt wie in den Wochen danach. Sie trauerte und weinte. Sie lamentierte, auch sie beide könnten nicht mehr zusammenbleiben. Sie glaubte, er könne doch keine Frau wollen, die ihm keine Kinder gebäre. Ihr Temperament, ihr Stolz, ihr ganzes Wesen waren in einer Weise verletzt, die er nicht verstand. Sie waren beide über vierzig. Ihm waren eigene Kinder nicht so wichtig. Im Gegenteil.
Sie sprachen viel miteinander. Von Liebe und Heirat und Kindern. Doch nur seine uneingeschränkte Zuwendung, seine Beweise, daß er sie nach wie vor begehrte, beruhigten sie ein wenig und erlösten ihn von der Angst, Alice zu verlieren. So richtig froh machte Alice allerdings erst die Mitteilung, daß Ali heiraten werde, daß ihre künftige Schwiegertocher ein Kind erwarte. Die Vorstellung, demnächst Großmutter zu werden, weckte ihre alte Unternehmungslust und erfüllte sie mit einem Eifer, dem er hilflos gegenüberstand.
«Warum bist du denn nicht im Bett?»
Alice richtet sich auf und schiebt sich ein Kissen in den Nacken. Mettler antwortet vorsichtig:
«Der Mond. In ein paar Tagen haben wir Vollmond, der Sturm, ich wollte dich nicht wecken …»
«Du machst dir Sorgen. Ich glaube nicht, daß es Schwierigkeiten geben wird. Eine so problemlose Schwangerschaft. Wie ich damals mit Ali. Vielleicht ist das Baby schon da. Vielleicht wird es gerade jetzt, gerade in diesem Augenblick geboren. Freust du dich?»
«Worauf? Daß ich Großvater werde?»
Alice setzt sich auf, lehnt sich mit dem Rücken gegen die Wand und zieht die Beine unters Kinn. Mettler wundert sich immer wieder, wie leicht Alice erwacht. Eben noch schien sie tief zu schlafen, und jetzt beginnt sie ein Gespräch, als hätte sie nur darauf gewartet, mit Fragen über ihn herzufallen.
«Wenn es ein Junge wird, könnte er das Hotel übernehmen. Was glaubst du, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Was möchtest du lieber?»
«Ich? Natürlich einen Jungen. Dann ein Mädchen. Dann wieder einen Jungen, ein Mädchen …»
«So viele Kinder wird Christina nicht haben wollen. Du nimmst mich auf den Arm. Sie werden uns doch benachrichtigen?»
«Vielleicht. Nach den Kiondos mußten wir uns allerdings auch erkundigen.»
«Das stimmt. – Bist du noch böse?»
«Ich?» fragt Mettler verblüfft. «Warum denn das?»
«Wegen der Kiondos?»
«Ich war nicht böse. Wie kommst du denn auf die Idee?»
«Böse ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber daß dir nicht gefällt, daß ich für Christina und Ali einkaufe … Auch wenn du so tust, als ob du mit allem einverstanden wärst …»
«Halt, halt. Wer ist hinter Lali hergehetzt? In Nairobi? Wer hat sein Büro im Ministerium gestürmt?»
«Wir beide.»
«Ja. Aber ich habe unseren Herrn Minister gezwungen, sich für uns einzusetzen. Ich lobte deine Idee über den grünen Klee …»
«Das stimmt. Du hast geredet wie ein Buch. Aber das meine ich nicht …»
«Ich habe dich zu diesem Zollbeamten begleitet, zu diesem … Den Lali uns empfohlen hat, der aussah wie ein Frosch? Zu Badawy! Ich habe alle Papiere Badawys mitunterschrieben, Papiere, die dich berechtigen, deine Einkäufe in die Schweiz zu exportieren …»
«Siehst du! Deine, meine. Unsere!»
«Nein, deine. Was um Himmels willen sollte ich in die Schweiz schicken? Ich versteh' doch nichts davon. Will ich auch nicht. Neinnein, das ist nun wirklich deine Sache. Es sind deine Geschäfte, auch wenn die ‹Ken-Art› uns beiden gehört. Die ‹Ken-Art›! Ein Papier, das uns erlaubt, Salatschüsseln und Holzmasken auszuführen. Daß es nicht einfach ist, Alis Laden mit wirklich schönen Waren zu beliefern, wissen wir mittlerweile beide. Allein um diese Kiondos zu finden, bist du drei volle Tage zwischen Mokowe und Malindi hin- und hergefahren …»
«Weil ich sie nicht bei irgendeinem Inder kaufen wollte, sondern von den Frauen, die die Taschen herstellen …»
«Ja, ich weiß. Und genauso müßtest du nun nach den schönsten Ohrringen und Halsketten suchen, nach Bastkörben, Holztierchen, nach allem und jedem. Wir führen ein Hotel. Ganz abgesehen davon, daß Ali und Christina von den Kiondos nicht begeistert waren …»
«Das wissen wir doch gar nicht. Es waren sehr schöne Sisaltaschen, schlichte und kunstvollere, eine ganze Palette …»
«Aber dreihundertundfünfzig!»
«Das ist nicht viel, letztlich ist es nicht viel. Ali kann ja einen Teil weiterverkaufen …»
«Ja, warum nicht. Und du schickst ihm noch einmal dreihundert. Tausend! In ganz Europa wird nur noch mit Kiondos eingekauft. Als hätten wir mit dem Hotel nicht schon genug zu tun.»
«Es macht mir Spaß.»
Mettler schweigt. Es kommt selten vor, daß Alice und er sich streiten. Alice ist nicht nachtragend, und er, du liebe Zeit, woher hätte er das Recht genommen, mit einer Frau zu streiten, der er immer wieder dankbar ist, daß sie ihm seine Schwächen nicht unter die Nase reibt. Er lernte von ihr, daß alte Geschichten nicht bei jeder Gelegenheit hervorgekramt werden müssen. Vorbei ist vorbei. Und sie erwartete, daß er ab und an Dinge zuließ, ohne daß sie seinem europäischen Dickkopf erst ein Licht aufstecken mußte.
Aber diese Kiondo-Geschichte ist etwas anderes. Sie ärgert ihn. Das ganze Brimborium um Badawy, Lali, ihre ‹Ken-Art› in Nairobi.
Alice hat behauptet, er sei eifersüchtig. Auf Ali. Auf Alis Freunde in der Schweiz. Weil der Junge auf Christina höre und nicht auf ihn. Aber so einfach läßt sich sein Unbehagen nicht erklären.
Wahr ist, daß sich durch die Gründung dieser unbedeutenden Firma kaum etwas verändert hat. Er weiß, daß es nicht viel mehr als eine Spielerei ist. Die ‹Ken-Art› bietet Alice die Möglichkeit, Ali ein paar Dinge für dessen Laden zu schicken, unkompliziert und ohne die Ausfuhrbestimmungen des Landes zu verletzen. Sie sind dem stellvertretenden Minister, Hemed S. Lali, der seine Beziehung zu ihnen all die Jahre weidlich ausnutzte, deswegen nichts schuldig. – Lali quartierte bei ihnen seine Gäste ein, nun baten sie ihn ihrerseits um einen Gefallen. – Auch dem Zollbeamten Badawy gegenüber, diesem Frosch hinter seinem Schreibtisch, sind sie zu nichts verpflichtet.
Er weiß, daß seine Vorwürfe lächerlich sind. Alice plant nicht, im Büro der ‹Ken-Art› zu arbeiten, ihrem Büro in Nairobi, das ihnen Badawy mehr oder weniger aufgezwungen hat. Sie lebt mit ihm zusammen, und nach wie vor erledigen sie gemeinsam die Arbeit, die die Führung eines Hotels mit sich bringt. Trotzdem.
«Siehst du, du bist doch böse», nimmt Alice das Gespräch wieder auf.
«Nein, aber ich …»
«Dir gefällt nicht, daß ich mich ein bißchen um Christina und Ali kümmere …»
«Das nennst du ein bißchen?»
Alice lacht. Sie sitzt am Kopfende des Bettes. Die Bettdecke ist zu ihren Füßen geglitten. Leicht nach vorne gebeugt, das Kinn in die Grube zwischen den Knien gestützt und die Arme um ihre Beine geschlungen, schaut sie durch die Dunkelheit zu Mettler, den sie kaum sehen kann. Der große Mann ist zwischen die Polster des Sessels gesunken. Nur gerade die Umrisse seiner kräftigen Schultern, die Wölbung seines eckigen Schädels zeichnen sich vor dem helleren Fenster ab.
«Was sitzst du denn dort am Fenster, wo ich dich nicht sehen kann? Komm doch ein bißchen näher, du alter Murrbär.»
«Brummbär, Alice. Es heißt Brummbär.»
«Nun komm schon, sonst hol' ich dich.»
Mettler steht auf, streckt sich, dehnt seine Glieder. Viel zu lange schon hockte er am Fenster. Er geht zum Bett und zieht das Moskitonetz beiseite. Mit einem Sprung wirft er sich quer übers Lager, rollt zu Alice, wo er ihr zu Füßen liegenbleibt.
Der leichte Schimmer auf der schwarzen Haut ihrer Beine, der sanfte Schwung ihrer Waden überraschen ihn, als sehe er sie zum ersten Mal. Seine Fingerspitzen folgen den schlanken Beinen, kribbeln über ihre Knie, kaum daß er sie berührt.
Ihre Zehen tasten seinen Körper entlang, wühlen sich in den Stoff seines Morgenrocks. Ein Kitzeln, Schaudern. Sie lösen seinen Gürtel und schälen ihn aus seinem Rock. Stückchenweise, ein aufreizender Tanz ihrer Füße.
Dann beugt sie sich über ihn, ihre Zunge berührt ihn, spielt mit ihm, während seine Hände zwischen ihre Beine gleiten. Sein Kopf. Leicht spürt er ihre Brüste. Ihr krauses Dreieck preßt sich gegen seinen Mund. Er genießt ihren Geruch, den leichten Duft nach Gras und Meer. Das Salz ihrer Grübchen.
Für einen Augenblick strahlt das volle Mondlicht ins Zimmer. Gestochen scharf schlagen die Schatten der Fenstersprossen schräg über den blanken Boden. Eine Windböe schleudert einzelne Tropfen gegen die Scheiben. Doch schon erlischt der Mond wieder, das Sturmfenster zieht sich zu, und das Zimmer versinkt erneut in einer tintigen Dunkelheit.
Kurz darauf beginnt es zu regnen. Und nur wenige Sekunden später prasselt ein Wolkenbruch auf die Dächer des Hotels. Das Brausen des Windes vermischt sich mit dem Rauschen des Regens, und aus der defekten Regenrinne plätschert der Wasserstrahl auf die Terrasse.
Mettler und Alice schlafen eng aneinandergepreßt inmitten der zerknüllten Laken. Ihr Kopf ruht auf seiner Brust, und ihr Bein, quer über seinen Bauch geschoben, drückt ihm auf die Magengrube.
Die Regenzeit ist Mettlers liebste Zeit. Nur ein Narr ginge jetzt noch aus dem Haus und zauste sich mit Wind und Wetter.