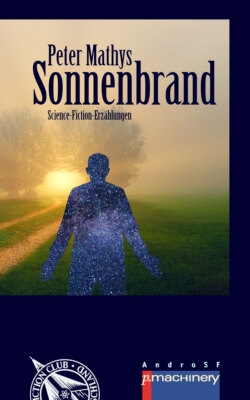Читать книгу SONNENBRAND - Peter Mathys - Страница 3
Der Schwarm
ОглавлениеDiese Geschichte ist banal und alltäglich. Einstweilen. Der Schwarm ist da – oder auch nicht. Wer weiß das schon. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht, man fühlt ihn nicht. Wahrscheinlich ist er Ausgeburt einer überhitzten Fantasie. Bei der Arztpraxis Degenhart in Frankfurt häufen sich zwar an diesem Montag die Beschwerden über Kopfschmerzen, aber am Rest der Woche ist der Zulauf normal. Normal ist vor allem am Donnerstag auch eine Zunahme von Hals- und Schluckbeschwerden; viele Patienten lassen sich für den Freitag krankschreiben. So sichern sie sich ein verlängertes Wochenende. Mehrere Ärzte diagnostizieren eine Art von Grippe und verordnen, bei Patienten mit Fieber, Bettruhe.
Anita Berger in Zürich will keine Bettruhe. Sie geht ans Fenster; der Tag ist februargrau, aber sie hätte lieber Sonne. Viele Radfahrer tragen schwarze Jacken mit Kapuzen; Jogger trotzen verbissen dem kühlen Wind. Das Fieber beschert ihr einen heißen Kopf. Nach einer Viertelstunde fühlt sie sich schwach und muss sich doch hinlegen. Sie kann kaum mehr atmen, sie keucht, versucht zu rufen, aber mehr als ein Krächzen gelingt ihr nicht. Sie verliert das Bewusstsein und stürzt. Erst nach zwei Tagen findet ihre Schwester Theodora sie auf dem Boden liegend, im Eingang zu ihrer Zweizimmerwohnung.
Jetzt geht alles schnell. Die Ambulanz kommt innert Minuten.
»Nur ein Wunder kann sie retten«, sagt der Ambulanzfahrer, während sie Anita sorgfältig auf einer Tragbahre ins Fahrzeug heben.
Im Krankenhaus landet sie sofort auf der Intensivstation. Es folgen Beatmungsgerät, Untersuchung durch einen leitenden Arzt, Blutprobe, ständige Überwachung. Nach fünf Minuten erster Erfolg: Anita wird überleben. Aber die Ärzte haben den Beginn einer Lungenentzündung festgestellt. Theodora sitzt geduldig, erst im Wartsaal, dann neben dem Bett im Zimmer ihrer Schwester. Sie ist gläubig und betet jeden Morgen und jeden Abend für Anita.
Die Analyse von Anitas Blutprobe ergibt: wahrscheinlich ein Virus, welcher Art ist noch zu klären.
Zeitgleich wird ein achtundsechzigjähriger Mann, der Taxifahrer José Delgado, ins Universitätsspital Basel eingeliefert. Er hat Herzbeschwerden und leidet unter extremem Bluthochdruck. Auch ihm wird aufgrund der Blutuntersuchung ein Virus attestiert.
Der Arzt Doktor Wolfgang Degenhart untersucht das Blut eines seiner Patienten. Seine Diagnose ist klar: ein Virus. Er nimmt sich Zeit und studiert die Geschichten anderer, fremder Viren. Spanische Grippe, Schweinegrippe, Vogelgrippe. Die erste hat in drei Schüben Europa erobert, die anderen zwei hatten ihren Ursprung in Asien. Andere Untersuchungen folgen. Sie führen zur chinesischen Provinzhauptstadt Wuhan. Doktor Degenhart meldet seine Feststellungen dem deutschen Gesundheitsamt, unvollständig, wie sie sein mögen. Gleichzeitig geschieht etwas Bezeichnendes. In den Gesundheitsämtern aller europäischen Hauptstädte treffen ebenfalls Meldungen über das fremde Virus ein. Vereinzelt wird wieder Wuhan als Quelle genannt. Niemand kennt das Virus, seine Beschaffenheit ist allen ein Rätsel. Es verbreitet sich rasend schnell; die bekannten Grippemittel wirken nicht. Aber junge Menschen werden nicht oder kaum angesteckt, ältere Patienten jedoch bilden eine Hochrisikogruppe mit geringer Lebenserwartung.
Der Taxifahrer aus Basel stirbt zwei Wochen nach seiner Einlieferung ins Spital. Er ist der erste Tote der neuen Krankheit.
Das Virus fühlt sich wohl auf der Erde. Sein Schwarm ist ausgeruht von der Reise und bereit zur Ernährung. Der Vorrat an genießbarem Fleisch ist enorm, er reicht für viele Erdenjahre; erst danach muss der Schwarm weiterziehen. Das Virus weiß nicht, ob es Artgenossen hat oder allein seinen Weg zurücklegen muss. Wenn man es fragte, was es ist, würde es antworten: »Ich bin.« Aber diese Antwort würde nicht akustisch, nicht visuell, nicht haptisch, nicht auf eine andere Art der Transmission übermittelt. Sie bildet sich im Virus, in jedem Virus, als wäre sie ständig dort gewesen. (Gedankenübertragung?) Der ganze Schwarm, alle vierhundertfünfzig Milliarden Viren, besitzt gleichzeitig alle Informationen. Er weiß, dass sich sein Speisefleisch Mensch nennt. Warum das so ist, weiß er nicht. Er ernährt sich nicht direkt durch Nahrungsaufnahme, sondern heftet sich den einzelnen Zellen seines Wirtskörpers durch eine Art Osmose an. Und manchmal bilden sich saftige Pusteln, die sind dann für die Viren Hauptspeise und Dessert zugleich. Der Schwarm hat gelernt, dass der Mensch, seine Zellen, sich verändern können, nachdem sie den Viren gedient haben. Einzelne, vor allem ältere Menschen leben nicht mehr weiter, wenn sich die Viren von ihnen ernährt haben. (Das Wort »älter« hat für die Viren keine Bedeutung. Älter war ein Mensch gewesen, weil er aufgehört hat zu leben.)
Die Menschen haben ein Programm erfunden, mit dem sie die Angriffe der Viren abzuwehren glauben. Der Schwarm lacht, nur zu seinem eigenen Vergnügen. Das Lachen ist nicht hörbar, es entspricht am ehesten einem elektronischen Flackern.
»Sie bilden sich ein, uns bezwungen zu haben. Erste Welle nannten sie das. Jetzt haben sie Angst vor einer zweiten Welle. Zu Recht, hrr … hrr.«
Der Schwarm vibriert positiv. Die Luft des Planeten Erde ist von Viren geradezu geschwängert. »Die Menschen sollten sich mit der veränderten Luft befassen, nicht nur mit den veränderten Wirtszellen. Aber dafür sind sie zu rückständig, hrr … hrr.«
Eine Arbeitsgruppe wird gebildet. Sie produziert widersprüchliche Meinungen, beschriftet haufenweise Papier, hält eine Medienkonferenz ab. Ihre Aufgabe ist es, ihren Regierungen Vorschläge zur Bekämpfung des Virus zu unterbreiten. Dazu muss vorweg definiert werden, woraus das Virus besteht und was es zu seiner Verbreitung benötigt. Die Bevölkerung zeigt erstaunlich wenig Interesse am Virus. Die täglich publizierten Zahlen von Neuansteckungen und von Todesfällen werden als interessante Statistiken zur Kenntnis genommen, aber nicht mit konkreten Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Aber dieses Desinteresse ändert sich, sobald das Fernsehen in Großaufnahme das langsame Sterben eines alten Mannes zeigt. Die künstliche Beatmung bleibt wirkungslos. Die beiden Kinder des Mannes dürfen zusehen, wie er mit dem Unvermeidlichen kämpft, aber hinter einer dicken Glasscheibe. So erschöpft sich der letzte Gruß in einem schwachen Winken, und die Sehnsucht des Mannes nach einem letzten Kuss oder einem tröstlichen Streicheln bleibt unerfüllt.
Doktor Oskar Bauer, Chefvirologe des Zürcher Kantonsspitals, leitet die Arbeitsgruppe. Für ihn ist die Pandemie am Abklingen. Doktor Degenhart, nun Vizepräsident, ist dagegen: Er ist überzeugt, dass die Viren aus dem Weltall kommen; die große Welle steht noch bevor.
Der Schwarm ist nicht untätig. Er will einen Menschen entführen und Zelle für Zelle analysieren. Wie das geschehen soll, weiß er noch nicht. Aber dass es ein großes osmotisches Fressen wird, das weiß er, hrr … hrr …!
Unterdessen ein neues Ziel, der Planet Mars, der Rote Planet. Seine zwei Monde, Phobos und Deimos. Der Schwarm umfasst sie und fliegt weiter zum Planeten hinunter. Eine große Enttäuschung. Der Rote Planet ist tot, seine beiden Trabanten ebenfalls. Nur einige Sporen in den Ritzen zwischen den Felsblöcken deuten auf vergangenes Leben hin. Aber das Urgedächtnis des Schwarms weiß mehr. Unter widrigen Umständen brauchen Sporen weder Wasser noch Nährstoffe. Sauerstoff sowieso nicht. Gewisse Sporen überdauern lebend mehrere Hundert Jahre. Wenn wir uns an ihnen festhalten, entstehen vielleicht richtige Zellen. Das wäre ein gewaltiger wissenschaftlicher Erfolg.
Der Schwarm handelt rasch. Er zieht die beiden Teilschwärme zurück, die er auf Phobos und Deimos angesetzt hat. Zusammen machen sie ein Viertel des Gesamtschwarms aus, mehr als hundert Milliarden Viren. Er stellt fest:
»Das genügt bei Weitem, um einen Tochterschwarm zu bilden. Und wenn wir Mars unter Kontrolle haben, steht diese ganze Galaxis mit ihren Sonnensystemen und Planeten zu unserer Verfügung. Wichtig ist, die Sporen sorgfältig zu pflegen, dann dienen sie uns als Nährstoff für die Viren. Dies ist dann der Moment, zu anderen Sonnensystemen aufzubrechen, Alpha Centauri zum Anfang. Das Schöne ist, wir bleiben unentdeckt, bis es zu spät ist. Für sie zu spät, nicht für uns. Ihre Planeten verändern sich nicht, bloß das Leben darauf wird leiden. Einige werden mit einem Schnupfen davonkommen, andere kriegen unheilbare Atembeschwerden, und wieder andere werden an Lungenentzündung sterben. Das Ist sehr gut, da werden auch die technische und die philosophische Entwicklung der Menschen empfindlich leiden, und wir könne diskret wachsen, hrr … hrr …!
Der Schwarm hat auch die Fähigkeit, mit sich selber zu reden und zu argumentieren. Solche Dialoge entstehen in allen Viren im selben Moment gleichzeitig, ebenso die Antworten.
Frage: »Und wenn die Aufzucht der Sporen auf dem Mars misslingt?«
Antwort: »Dann suchen wir ein paar Tausend Erdjahre lang weiter.«
Doktor Bauer, kahl und ständig lächelnd, klopft die Asche von seiner Zigarre. Auf dem Tisch steht eine Vase mit langstieligen gelben Rosen. Ein Besucher hat sie stehen lassen.
Oskar Bauer erklärt: »Die Anzahl Neuansteckungen und die Zahl der Todesfälle sind nun seit zehn Tagen regelmäßig zurückgegangen. Das lässt mich schließen, dass das Schlimmste hinter uns liegt.«
»Lieber Kollege, ich kann Ihnen nicht folgen«, sagt Doktor Degenhart in seinem gemütlich bayrischen Dialekt.
»Ihre Begründung?«
Doktor Emil Wetter, Chefarzt des Inselspitals von Bern, ein kleiner Napoleon, zieht das Wort an sich und sagt: »Wir arbeiten alle mit denselben Tatsachen, nur die Schlussfolgerungen stimmen nicht überein.« Dazu nicken die anderen zustimmend. Doktor Wetter fährt fort: »Ich wäre nicht persönlich zu dieser Sitzung gefahren, wenn mich nicht die Entwicklung dieser Seuche aufs Äußerste alarmieren würde.« Er fixiert Doktor Degenhart. »Es würde mich sehr interessieren, wie unser Münchner Kollege die Lage einschätzt.«
»Mich auch!«, ruft Oskar Bauer ins Rund.
»Aber gerne, verehrte Herren Kollegen«, sagt Wolfgang Degenhart unaufgeregt. »Die Weltgesundheitsorganisation hat dem neuen Virus die Bezeichnung n-Virus verliehen. Wie es entsteht, weiß man noch nicht, was es bewirkt schon. Wenn es auf Menschen trifft, bildet es im Blut seines Opfers zunächst mikroskopisch kleine Partikel, die rasch wachsen. Auf der Haut entstehen daraus oft rote Pusteln, die einen heftigen Juckreiz auslösen können. Was jedoch mit dem Virus geschieht, wenn es keinen Kontakt mit Menschen hat, weiß man noch nicht. Bemerkenswert ist, dass es sich mit den neuesten Superteleskopen laut den Forschungen auch auf dem Mond nachweisen lässt. Das lässt den Schluss zu, dass das Virus vom Mond auf die Erde gelangt ist.«
»Oder umgekehrt«, ergänzt Oskar Bauer.
»Möglich«, bestätigt Degenhart. »Auf jeden Fall zeichnet sich hier ein Beweis ab, dass sich das n-Virus frei im Weltall bewegen kann. Nochmals: Ich wäre nicht erstaunt, wenn es auch auf dem Mars nachgewiesen werden könnte.«
Doktor Wetter sagt: »Ich gehe davon aus, dass Kollege Degenhart uns seine Erkenntnisse dokumentarisch belegt. Dann neige ich zur These Mond Erde. Das Virus wäre dann mit oder ohne Mars Teil einer großen Familie, die durchs Weltall vagabundiert, bis sie einen Planeten findet, der genügend Wirtskörper für die Viren zur Verfügung stellen kann. Diese Voraussetzung ist auf der Erde mehr als reichlich erfüllt; der Mond wäre dann für die Viren eine bloße Zwischenstation auf dem Weg zur Erde.«
Jetzt meldet sich Doktor Bauer. »Auch damit wissen wir nicht, woher das Virus wirklich stammt. Da wir diese Frage kurzfristig nicht klären können, müssen wir uns auf das Abwehrmittel konzentrieren, an dem die Wissenschaft arbeitet.«
»Und auf unsere Patienten«, erinnert Wolfgang Degenhart.
Der Schwarm besteht aus der Summe aller Viren. Er überprüft seine eigene Argumentation laufend, indem er sie ausspricht. So sind auch alle Viren immer informiert. Aussprechen bedeutet hier nicht, Laute zu äußern, die von jemand anderem verstanden werden. Die Informationsübermittlung ist viel komplexer. Sie besteht aus virtuellen Spuren, die mit Lichtgeschwindigkeit zu den einzelnen Viren befördert und dort in materielle Impulse umgewandelt werden. Dieser Prozess kann von jedem Virus in Gang gesetzt werden. Jetzt gerade haben folgende Impulse materialisiert:
Zürich, Kantonsspital
Frau, 38 Jahre
Anita Berger
Bereits infiziert.
Kommentar: Am Objekt können wir lernen.
Frage: Wie viele Viren verträgt sie? Was geschieht mit ihren Viren, wenn sie stirbt?
Beschluss: Sofort Beginn Bearbeitung des Objekts.
Nach zwei Wochen wird Anita Berger von der Intensivstation in die normale Station verlegt, schon weil das Personal überlastet ist und die Betten überbeansprucht sind. Sie spricht, nur leise, fühlt sich schwach und denkt immer mehr ans Sterben. Doktor Bauer steht vor einem Rätsel. Seine anderen n-Virus-Patienten, die den ersten Anfall überlebt haben, erholen sich langsam und dürfen nach einer Ruhepause das Krankenhaus verlassen. Anitas Erholung jedoch bleibt auf halber Strecke stehen. Ihre Schwester Theodora verbringt jeden Tag Stunden bei ihr, meistens am Abend, bis Anita in einen unruhigen Schlummer versunken ist. Sie ist traurig, weil sie spürt, dass die Lebenszeit ihrer Schwester langsam, aber sicher verrinnt.
Am siebzehnten Tag ihres Spitalaufenthalts macht Doktor Bauer bei der Routineuntersuchung eine erschreckende Feststellung. Bei Anita haben sich am ganzen Körper große rote Pusteln gebildet; nur der Kopf ist freigeblieben. Es sieht hässlich aus, aber Anita ist dankbar, dass die Pusteln nicht jucken. Der Arzt geht systematisch vor. Vorsichtig zwackt er eine Pustel ab und trägt sie ins Labor zur Untersuchung. Unterdessen bringt eine junge Pflegerin auf einem Tablett eine Kanne Tee zu Anita. Aber der Anblick ihrer pustelübersäten Patientin erschreckt sie dermaßen, dass sie das Tablett fallen lässt und fluchtartig das Krankenzimmer verlässt. Anita stößt einen Schrei aus. In dem Augenblick betritt Theodora das Zimmer. Sie erfasst das ganze Unglück mit einem Blick, die Pusteln, die Scherben, die Teelache, ihre entsetzte Schwester im Bett. Sie geht zu ihr, streicht ihr ein verschwitztes Haarbüschel aus der Stirne und küsst sie.
Sie sagt: »Du Ärmste! Was haben sie mit dir gemacht?«
Anita erwidert, schwer atmend: »Ich glaube nichts. Sie wissen nicht weiter.«
Theodora: »Ich will den Arzt sprechen. Sofort!«
Aber Doktor Bauer steht schon im Zimmer, hinter ihm die Pflegerin mit Putzmaterial. Er geht zum Bett von Anita und sagt:
»Frau Berger, was da passiert ist, tut mir leid und ist mir peinlich. Ich entschuldige mich dafür in aller Form. Ich darf jedoch beifügen, dass wegen der n-Virus-Pandemie unser Spital überfüllt ist. Außerdem fehlen uns über zwanzig qualifizierte Pflegekräfte und sieben Ärzte. Die junge Mitarbeiterin – sie ist keine Pflegerin, sondern ausgebildete IT-Sachbearbeiterin – arbeitet erst seit vier Tagen aushilfsweise bei uns und hat noch keine Erfahrung im Umgang mit Patienten.«
Jetzt macht sich Anita bemerkbar. Sie legt ihren linken Arm auf die Bettdecke und sagt mit erschöpfter Stimme:
»Die junge Frau kann nichts dafür, dass ich aussehe wie ein verdorrter Granatapfel. Ich bin ja selber auch erschrocken.«
Doktor Bauer erlaubt sich ein winziges Schmunzeln.
»Ich habe eine vielversprechende Information für Sie, Frau Berger.«
Sie dreht den Kopf zu ihm. In ihren Augen mischen sich Schmerz und Hoffnung. Doktor Bauer fährt fort: »Wir haben im Labor schon vor einigen Tagen eine Schnellanalyse durchgeführt. Die Pusteln entstehen auf der Haut. Sie dienen den Viren als Nahrung. Nach einiger Zeit sterben sie ab, und der Heilungsprozess kann beginnen. Warum das geschieht, ist noch völlig unerforscht. Aber es funktioniert bei Patienten, bei denen sich nur wenige Pusteln gebildet haben. Ebenso wenig ist bekannt, wie sich die Pusteln derart rasend vermehren konnten. Ich habe aber Grund zur Annahme, dass auch bei großen Mengen an Pusteln, deren Wirkung nach einer gewissen Zeit abnimmt, die Heilung einsetzt.«
Anita: »Wenn ich nur lange genug lebe.«
Theodora: »Ach komm. Du wirst noch meine Bestattung organisieren.«
Doktor Bauer: »Ihr Tee wird Ihnen gleich gebracht, Frau Berger.«
Der Schwarm hat viel gelernt in den paar Wochen, die er sich nun auf der Erde aufhält. Seine Viren haben sich prächtig entwickelt. Einige mutige Stämme haben angefangen, in der Tierwelt nach Arten zu suchen, die als Wirtskörper geeignet sein könnten. Als vielversprechend haben sich große Affen, namentlich Gorillas, erwiesen, daneben skurrilerweise einige Amphibien wie Lurche und gewisse Frösche. Die Entwicklung der Viren verläuft bei ihnen ähnlich wie bei den Menschen. Aber diese haben sich noch gar nicht mit den tiermedizinischen Problemen befasst.
Schwarm: Können wir diese Tiere einfangen?
Schwarm: Warum?
Schwarm: Wir wollen wissen, wie sie sich entwickeln, wenn keine Menschen an ihnen herummachen, mit Krankenhäusern, künstlicher Beatmung, so genannten Medikamenten.
Schwarm: Wir müssen über sie herfallen, ganz ohne Medizin.
Schwarm: Wo? Wann?
Schwarm: Botswana. Jetzt, sofort.
Unsere drei Ärzte wissen nicht mehr weiter.
Die Menschheit hat die zweite Welle hinter sich und steht jetzt am Anfang der dritten. Die deutsche Bundesregierung und der schweizerische Bundesrat haben die einzuhaltenden Schutzmaßnahmen nochmals drastisch verschärft und den Menschen die letzten Freuden genommen. Im Nachbarland Freunde besuchen, geht nicht. In der Buchhandlung den Vorrat an geistiger Nahrung auffüllen – kommt nicht infrage. Und so weiter. Bei vielen Läden hängen Anzeigen an der Türe wie seinerzeit bei der Kriegsmobilmachung. Das Haus oder die Wohnung verlassen – nur für notwendige Verrichtungen: Apothekenbesuch, Einkauf von Lebensmitteln, Kinder zur Schule bringen und abholen. Bei privaten Partys nur fünf Teilnehmer aus höchstens zwei Familien. Schlimm ist: Die Zahl der Neuansteckungen verharrt ungerührt auf hohem Niveau, die virusbedingten Todesfälle ebenfalls.
In dieser Zeit der enttäuschten Hoffnungen und privaten Dramen schießen die wildesten Gerüchte ins Kraut.
Bei einem ihrer regelmäßigen Telefongespräche berichtet Oskar Bauer seinen Kollegen von einem bedrückenden Erlebnis. Ein schwerer Traum hat ihn im Schlaf heimgesucht und, nachdem er erwacht war, als Tagtraum weiter geplagt. Er ist allein über eine blühende Wiese spaziert. Gelbe und rote Feldblumen verströmen einen kräftigen Duft. Die Wiese ist von einem aggressiven Grün, das in den Augen schmerzt, wenn man nicht rechtzeitig wegschaut. Es gibt keine Bäume und keine Büsche; am Himmel gleißt eine bösartige Sonne, die schon längst alle Wolken vertrieben hat. Oskar geht weiter und weiter, er sehnt sich nach anderen Menschen, aber es ist niemand in Sicht. Endlich überquert er eine kleine Anhöhe. Am Fuß der Erhebung, auf der anderen Seite, liegt eine Frau am Boden. Sie ist barfuß, trägt Jeans und ein weißes T-Shirt und ist weder jung noch alt. Sie rührt sich nicht und ist vielleicht tot. Der Duft der Blumen hat sich noch verstärkt; er ist jetzt schwer und überall. Oskar beugt sich über den Frauenkörper; dieser sondert keinen eigenen Duft ab. Stattdessen fällt ihm das Atmen auf einmal immer schwerer. Er keucht und fängt an zu schwitzen. Er ruft laut »Wo ist Luft?« über die Wiese. Dieser Ausruf weckt ihn, Traum und Tagtraum sind verschwunden.
»So, das wär’s«, sagt er erleichtert ins Telefon. »Ende der Märchenstunde.«
Wolfgang Degenhart räuspert sich, er sagt nichts.
Emil Wetter erklärt: »Interessant.« Dann, nach einer Pause: »Du hättest die Frau untersuchen sollen.« (Sie reden einander unterdessen mit dem freundschaftlichen Du an.)
Oskar Bauer denkt an die Frau im Traum und an die mangelnde Atemluft, selbst nachdem der Traum verschwunden ist. Das Erlebnis lässt ihn nicht so leicht los. Die Frau beschäftigt ihn. Er sagt: »Sie muss etwa Bestimmtes bedeuten, aber was? War sie tot oder hat sie geschlafen? Oder bilde ich mir nur etwas ein, weil uns diese Virusgeschichten permanent auf Trab halten?«
Jetzt hustet Wolfgang Degenhart in sein Telefon. Er ist ein starker Raucher. Sowie sein Anfall vorbei ist, legt er den Kollegen seine Gedanken offen. »Es mag weit hergeholt sein, aber Oskars Traum hatte zwei markante Elemente, die Frau und die Luft. Vielleicht sollten wir beide gemeinsam betrachten.«
Emil Wetter: »Und dann?«
»Die Frau hat die schwere Luft zu lange eingeatmet und ist davon bewusstlos geworden«, führt Degenhart sein Denkmodell weiter. »Der Traum wollte Oskar eine Botschaft übermitteln.«
»Wohl direkt aus dem Unterbewusstsein«, meint Wetter sarkastisch.
»Das gibt’s durchaus«, erwidert der Münchner Kollege. Er ist nicht scharf auf ein Streitgespräch mit dem Berner.
»Dann müssen wir jetzt bloß noch die Frau finden, oder?«
»Aber nein.« Degenhart winkt ab. »Aber mit der Luft sollten wir uns beschäftigen. Die Frau ist nur Sinnbild für das, was geschehen könnte.«
»Und das wäre?«
Degenhart holt aus. »Es muss bloß der Kohlenmonoxidgehalt der Luft in einem bestimmten Gebiet massiv ansteigen, und schon haben wir eine tödliche Bedrohung für die Menschen, die in jenem Gebiet leben, hundertmal schlimmer als das Kohlendioxid CO2. Das ist die Warnung von Oskars Traum. Vielleicht verfügen die n-Viren über die Fähigkeit, die Zusammensetzung unserer Atemluft zu verändern, vielleicht haben sie eine Art Verständigung entwickelt. Wir wissen es nicht, also reine Spekulation. Aber wenn die Spekulation real wird und das Virus in eine andere Form mutiert, dann haben wir eine Bedrohung für die ganze Welt.«
Oskar Bauer: »Wir müssen etwas unternehmen. Was mit Anita Berger passiert ist, darf sich nicht wiederholen.«
Auch der Schwarm muss etwas unternehmen. Er hat nach einer langen Reise im Universum den Planeten Erde entdeckt und seine Bewohner, die sich Menschen nennen, kennengelernt. Das Experiment mit Anita Berger hat ihn allerdings selber überrascht, so viele Pusteln hat er nicht erwartet. Und genießbar sind sie nur während kurzer Zeit gewesen, dann sind sie verdorrt und abgefallen, und die Frau, auf die sich die Viren gefreut haben, ist entgegen allen Erwartungen gesund geworden und nützt ihnen nicht mehr. Das bedeutet: Der Schwarm braucht rasch eine neue Nahrungsquelle, und die Tiere in Botswana müssen warten.
Für solche Situationen hat der Schwarm das Prinzip entwickelt, für jede Standortverschiebung einen Voraustrupp von rund einer Milliarde Viren ins Zielgebiet zu entsenden. Als neues Ziel ist nach ersten Abklärungen Titan, der größte Mond des Planeten Saturn, bestimmt worden. Er ist rundum verhüllt von einer eisigen Gashülle. Darunter, auf der feindseligen Mondoberfläche, hat der Schwarm eine erstaunliche Lebensform angetroffen. Handtellergroße Plätzchen, die wie bewegliche Eisfladen aussehen, haben sich als Träger geeigneter Zellformationen erwiesen, deren Eiseskälte den Viren nichts ausmacht. Im Gegenteil: Die erste Speiseprobe, die vom Voraustrupp des Schwarms vorbereitet worden ist, hat alle Erwartungen übertroffen. Die Eisfladen basieren auf einer Art von Eiszellen, die genügend Nährstoff für die Viren enthalten. Zwanzig Zielsubjekte sind mit Viren gesättigt und danach beobachtet worden. Die Ansteckung hat sich wunschgemäß entwickelt; bloß das Blut, das an den Einstichstellen in winzigen Mengen austritt, ist graugrün, und die Farbe der Pusteln ebenfalls. Bald ist klar geworden, dass der Titanmond alle Voraussetzungen für eine gedeihliche Ernte erfüllt, Der Schwarm beschließt, sofort Richtung Titan zu fliegen, hrr …, hrr …
Der Voraustrupp muss rasch umdenken. Seine Speerspitze, die vorderste Milliarde Viren, ist verschwunden. Der Voraustrupp meldet dazu: »Wir haben keine Bewegung festgestellt, sie sind einfach in einem Mikroklick von einer hunderttausendstel Sekunde verschwunden.«
Der Schwarm, dessen Angehörige alles hören, was gesprochen wird, antwortet: »Zweite Speerspitze hinschicken. Gleiche Größe, gleiche Formation.«
Der Voraustrupp trifft die erforderlichen Anordnungen, aber die zweite Speerspitze verschwindet trotzdem, ebenso wie die erste. Der Schwarm nimmt alles zur Kenntnis. Dann folgt ein Befehl von bedeutender Tragweite.
Schwarm: »Verschiebung nach Titan abbrechen. Über mögliche Ursachen nachdenken. Dann entscheiden.«
Ohne weitere Abklärung schwirren die Viren des Schwarms zwischen Jupiter und den Asteroiden hin und her. Bei der Suche nach Ursachen des merkwürdigen Verschwindens zweier Speerspitzen des Voraustrupps kommt nichts Brauchbares zutage. Sie haben mitten im Weltall keine unerwartete Nahrungsquelle gefunden. Der Sonne Sol sind sie nicht nahe genug gekommen, um sich zu verbrennen. Ebenso wenig hat sie ein Wurmloch verschluckt. Nachdem die Abklärungen nichts erbringen, greift der Schwarm nach einem sehr selten gebrauchten Mittel: Zehn Viren, sie werden hier Pfadfinder genannt, werden allein zum Saturnmond Titan geschickt, um wenn möglich die Informationen zu finden, welche dem ganzen Schwarm vorenthalten geblieben sind. Zehn Viren sind so unendlich klein, dass sie niemandem auffallen. Ohne Elektronenmikroskop sind sie schlicht nicht zu erkennen; deshalb können sie bedenkenlos rekognoszieren, was bei Titan und seinem Umfeld los ist!
»Wir müssen etwas unternehmen«, bestätigt Emil Wetter.
Degenhart: »Ja, aber was schwebt dir vor?«
Wetter, fantasielos: »Das ist die Frage.«
Oskar Bauer: »Ich komme zurück auf Wolfgangs Kommentar zu meinem Traum. Ich will euch nicht schon wieder nerven, aber in meinem Kopf rumort es ständig.«
»Bis jetzt nervst du nicht«, grinst Degenhart. »Schildere dein Rumoren.«
»Eine Stimme, sie spricht nicht, sie ist einfach vorhanden, will mir befehlen.«
Wolfgang: »Was befehlen?«
»Luft. In meinem Traum ist mir die Luft knapp geworden. Die Stimme erscheint wieder. Ich soll die Luft untersuchen.«
Jetzt fangen die drei, Telefon in der Hand, unwillkürlich an zu schnuppern. Sie wollen wissen, ob mit der Atemluft etwas nicht in Ordnung ist.
»Ich spüre nichts«, erklärt Bauer.
Wetter: »Ich auch nicht.«
Degenhart sagt: »Klar spüren wir so nichts. Aber die Frau in Oskars Traum hat vielleicht etwas gespürt. Bloß, das ist wieder reine Spekulation. Man weiß auch nicht, ob die Traumfrau ein natürliches Ebenbild hat oder je gehabt hat. Und ich bin nicht sicher, ob wir unsere Regierungen wegen eines Traums in Aufruhr versetzen dürfen.«
»Nein, bitte nicht!« Oskars Stimme steigert sich ins Falsett. »Ich würde mich unmöglich machen. Ich werde nicht mehr träumen.«
Die drei Ärzte kommen nicht weiter. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als abzuwarten, was die Forschung der Pharma- und Chemiefirmen erbringt. Sie sind frustriert, weil sie die Heilung ihrer Patienten nicht beschleunigen können. Auch der wundersame Krankheitsverlauf von Anita Berger, den Oskar Bauer seinen Kollegen ausführlich geschildert hat, bringt nichts. Wieder zurück in seinem Arbeitszimmer, grübelt Wolfgang Degenhart über der Frage, warum sich Atemnot so prominent in Bauers Gehirn als Albtraum eingenistet hat. Ob sie überhaupt mit den n-Viren in Verbindung steht? Immerhin ist Atemnot eines der wichtigsten Symptome vieler am n-Virus erkrankten Patienten. Oder kaut Kollege Bauer in wachen Stunden an einem ganz anderen, unbewältigten Problem herum? Nein, das führt bloß noch mehr in die Irre. Und Bauer ist europaweit eine Kapazität seines Fachs. Aber angenommen, sein Traum ist die Vorstufe einer Erkrankung. Angenommen, der Traum will ihn warnen. Woher kommt er? Warum sollte Bauer gewarnt werden? Warum nicht Kollege Emil Wetter?
Die Viren fliegen durch den Weltraum, aber sie erkennen seine Schönheit nicht. Sie kennen auch kein Gefühl. Der Weltraum interessiert sie nicht. Jegliche Anteilnahme am Geschick ihrer Kollegen ist ihnen fremd. Insofern sind sie keine Lebewesen sondern eher Sachen. Aber sie haben so etwas wie Freude empfunden, als sie den Planeten Erde und seinen fast unerschöpflichen Reichtum an zweckmäßiger Nahrung entdeckt haben. Und sie kommunizieren miteinander!
Nachdem der Voraustrupp zwei Speerspitzen verloren hat, ruft ihn der Schwarm mit Ausnahme der Pfadfinder in seine Reihen zurück. Auf der Höhe von Jupiter ist er wieder komplett. Der Voraustrupp meldet, dass einige einsame Viren, etwa fünfundzwanzigtausend, seine Flugbahn gekreuzt haben. Ob sie von den Speerspitzen bei deren Verschwinden verloren gegangen oder abgesprungen sind, lässt sich nicht eruieren. Die einzelnen Viren sind sich zu ähnlich, und eine Kontaktaufnahme hat nicht stattgefunden; der Schwarm will sich so lange wie möglich bedeckt halten.
Dies gilt nicht für die Pfadfinder. Ihr Ziel ist Titan, ihre Aufgabe abklären, was mit dem Voraustrupp und den Speerspitzen geschehen ist. Aber auf dem Landeanflug zu Titan geraten sie an einen unbekannten Virenschwarm, etwa von der Größe dreier Voraustrupps. Die Pfadfinder sind zu klein und werden nicht entdeckt. Es gelingt ihnen, sich diesem Schwarm anzuschließen und mitzufliegen. Jetzt unterscheiden sie sich in nichts mehr von den Viren im unbekannten Schwarm, und der Flug geht eindeutig in Richtung Mars. Dass dies ein Fehler war, entdecken sie zu spät. Kontakt aufnehmen geht nicht, sie würden sofort als Fremdlinge erkannt und vernichtet. Was ihnen bleibt, ist zuhören, was im Schwarm gesprochen wird. Und da vernehmen sie, dass die Anderen Titan ebenfalls entdeckt haben, und dass sie vorhaben, den großen Schwarm, dem auch die Pfadfinder angehören, anzugreifen und zu vernichten und so die Nahrungsquelle von Titan für sich zu sichern.
Die Pfadfinder schaffen es, sich vom fremden Schwarm zu entfernen und zu ihrem Schwarm zurückzukehren. Dieser nimmt die Information zur Kenntnis.
Schwarm fragt: »Wie groß sind sie?«
Schwarm antwortet: »Was wir gesehen haben, war etwa dreimal so groß wie unser Voraustrupp.«
Schwarm: »Zwei gleich große Abteilungen bilden. Wenn sie uns angreifen, können wir sie umklammern. Ziel: vernichten.«
Für die Ausführung dieses Befehls braucht der Schwarm siebenundzwanzig Sekunden. Die Pfadfinder stellen überdies fest, dass der feindliche Schwarm massiv gewachsen ist. Die Zahl seiner Viren entspricht nun beinahe derjenigen des anderen Schwarms. Es zeichnet sich ab, dass die beiden Schwärme einander irgendwo zwischen Mars und den nächsten Asteroiden gegenüberstehen werden. Stehen bedeutet hier schwirren. In der Weltraumnacht sind die Schwärme von bloßem Auge klarerweise nicht zu erkennen. Würde man jedoch die Finsternis mit raumtauglichen Scheinwerfern aufhellen, so wäre die Anwesenheit der Viren in Form von winzigen Lichtspritzern erkennbar. Die Viren lösen das Problem auf einfachere Art: Die Natur hat sie mit einem ultrafeinen Geruchssinn ausgestattet, der nur von anderen Artgenossen wahrgenommen werden kann.
Bald ist es so weit. Die beiden Schwärme riechen sich und schwirren aufeinander zu. Die vordersten Einheiten verhaken sich und verschwinden mit einem Geräusch, das an einen Staubsauger erinnert. Beim Kampf der Schwärme geht es darum, dass einer von ihnen eine möglichst große Gruppe des Gegners einschlürft und vernichtet, bevor dieser ebenfalls in Aktion tritt. Das Kampfgeschehen ist ausgeglichen; einmal liegt der erdnahe Schwarm vorne, dann der titannahe. Nach kurzer Zeit ist mehr als die Hälfte der Viren vernichtet. Der Kampf tobt weiter, lautlos und unsichtbar. Er entwickelt sich zu einem kleinen Drama ohne Publikum und ohne Siegerehrung, wie es im All immer wieder vorkommt. Hier haben sich unterdessen die erdnahen Viren einen satten Vorsprung erkämpft, und das nahe Ende der Auseinandersetzung zeichnet sich immer deutlicher ab. Nach einem weiteren Austausch ist der Kampf entschieden. Der Rest des unterlegenen Schwarms, etwa zehn Prozent der ursprünglichen Größe, zieht sich zurück, über Saturn hinaus ins All auf der Suche nach einer neuen Nahrungsquelle. Der Sieger, reduziert auf die Hälfte seines ursprünglichen Bestandes, ruft alle Viren zurück, die auf Nahrungssuche oder mit einem anderen Spezialauftrag unterwegs sind. Dann erkundet er Titan und findet in dessen lebendigen Eisfladen einen brauchbaren Ersatz für die Menschen der Erde, an denen sie sich einige Jahre lang gütlich getan haben.
Die Ärzte Bauer, Degenhart und Wetter haben ihren Schlussbericht abgeliefert. Jetzt treffen sie sich informell in Bern im Hotel Schweizerhof zu einem Abschiedstrunk. Gleich gegenüber steht das eidgenössische Bundeshaus. Ein milder Frühsommer vergoldet das ehrwürdige Gemäuer. Wolfgang Degenhart zündet eine Zigarette an. Er hustet, dann sagt er:
»Meine Patienten erholen sich, und seit Tagen kommen keine Neuinfizierten dazu.«
Emil Wetter: »Bei mir sieht’s ähnlich aus. Heute Vormittag noch drei Neuinfektionen. Ältere Leute, alle drei. Dafür aber sechs, die wir als geheilt entlassen konnten.« Er macht eine Pause und nimmt einen kräftigen Schluck. »Köstlich, dieser Barolo«, erklärt er kennerhaft.
Degenhart nickt zu beidem und sagt: »Viele epidemisch verlaufende Krankheiten erschöpfen sich von selber. Sterben aus, sozusagen. Und bei dir, Oskar. Gehen dir auch die Patienten aus?«
»Ja«, bestätigt Bauer. »Aber viel interessanter … ja … heute traue ich mich eher, darüber zu reden.«
»Na, komm schon«, drängt Kollege Wetter. »Mach’s nicht spannend.«
»Er hat wieder geträumt«, vermutet Degenhart. »Stimmt’s?«
»Ja. Wieder die Frau von meinem ersten Traum.«
»Und? Hat sie diesmal mit dir gesprochen?«
»Nein.« Bauer blickt die Kollegen traurig an. »Sie hat furchtbar ausgesehen. Wie meine Patientin Berger, voll von diesen hässlichen Pusteln.«
»Alle schön dunkelrot«, sagt Emil Wetter, einfach so. Das interessiert ihn nicht mehr.
»Viel schlimmer«, widerspricht Bauer. »Graugrün.«