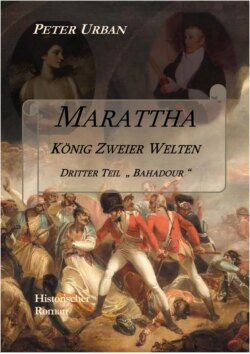Читать книгу Marattha König Zweier Welten Teil 3 - Peter Urban - Страница 4
Kapitel 2 Sepoy-General
ОглавлениеLeutnant William Dodd hatte Glück. Nachdem die Grenzen zum Maharastra überschritten waren, gelangte er ohne große Schwierigkeiten bis in die portugiesische Besitzung Goa. Obwohl die Portugiesen Großbritanniens ältester Verbündeter waren, kümmerten sie sich nicht im Geringsten um Deserteure der Armee König Georgs. Seine Goldmünzen erkauften Dodd eine diskrete Passage entlang der Küste bis hinauf nach Bharuch im Golf von Cambay. Gujerat wurde zwar von den Briten beherrscht, aber es war trotzdem kein Problem gewesen, mit einem verschwiegenen Flussschiffer den Nerbudda hinaufzufahren und Indore zu erreichen. Der Gaikwar von Bharuch – ein Mann, der nur auf die richtige Gelegenheit wartete, sich Scindia anzuschließen und seine Waffen gegen die »inglis« zu erheben – erlaubte britischen Deserteuren die Durchreise in die Gebiete, die direkt oder indirekt vom Maharadscha von Gwalior abhängig waren. In Indore befanden sich mehrere »campoos« des Franzosen Perron. Er hatte im Jahre 1796 das Erbe des berühmten Savoyarden Benoit de Boigne angetreten. Doch er beherrschte seine »jaguirs« mit einem noch unabhängigeren Geist als Benoit – Scindias treuer General und der Hüter seines Throns – es je getan hatte. Perron wusste um das Unheil, das sich in Form einer großen Armee an der Grenze zu den unabhängigen Gebieten zusammenbraute.
Als man Dodd zu ihm brachte, zögerte er nicht lange, sondern nahm den Leutnant sofort auf und ernannte ihn zum Major. Es waren weniger Dodds Vergangenheit und seine Absichten, die Perron überzeugten, sondern die Tatsache, dass der Offizier den künftigen Gegner offensichtlich gut zu kennen schien: Der Oberkommandierende von Madras, Sir James Stuart, hatte den größten Teil seiner bei Hurryhur gesammelten Truppen einem Offizier anvertraut, von dem Perron nur wusste, was sein Landsmann Allessandro Cappellini ihm Jahre zuvor anvertraut hatte. Es war in den Tagen nach dem Fall von Seringapatam gewesen. Doch Arthur Wellesley war inzwischen vom Obersten und Truppenoffizier zum General aufgestiegen; er hatte Soonda, Bullum und Wynaad genommen, Mysore regiert und die riesige Armee des »Königs zweier Welten«, Dhoondia Wao, ins Verderben geschickt. Der Ire konnte daneben noch eine beeindruckende Liste politischer Erfolge vorweisen: Sechs unabhängige Marattha-Fürsten hatten es vorgezogen, sich gegen Scindia zu wenden und an Wellesleys Seite zu kämpfen. Er hatte sogar mit Holkar immer wieder zu einer gemeinsamen Sprache gefunden und damit provoziert, dass Jeswant Rao entweder bald die Seiten wechseln würde, oder sich zu einer gefährlichen Neutralität verleiten ließ, nur um Scindia zu schaden und sich selbst den größten Teil der Macht im Maharastra zu sichern.
Perron hatte den Engländer Dodd aufgenommen und ihn zum Major befördert, und er hatte ihm ein Bataillon im »campoo« seines alten Kampfgefährten Anton Pohlmann besorgt. Pohlmann war ein ehemaliger Sergeant, der in einem der hannoverschen Regimenter der Ostindischen Kompanie gedient und dann mit Benoit de Boigne die Seiten gewechselt hatte. Dodd war zuerst sorgfältig ausgefragt worden: Er hatte über General Wellesley, seine Truppen, seine Vorgehensweise und seine Ideen bereitwillig Auskunft gegeben. Dabei stach Perron ins Auge, dass der Mann nicht nur wegen einer schmutzigen Geschichte aus Mysore verschwunden war: Nach fünfundzwanzig frustrierenden Jahren in den Truppen von »John Company« besaß er eine reiche militärische Erfahrung, und er war verbittert und hatte Ehrgeiz.
Nur weshalb Dodd ihm seinen Gegner durch die Augen eines anderen beschrieb, war Perron im Verlauf des langen Gesprächs ein Rätsel geblieben. Der Deserteur wusste nur, was sein ehemaliger Kumpan Major John Shee ihm erzählt hatte. Er war Wellesley niemals selbst begegnet. Er hatte an keiner der Expeditionen des Iren teilgenommen, und er hatte seinen Dienst in Sedaseer, nicht in Seringapatam verrichtet.
Allessandro Cappellini hatte die Gespräche Perrons mit dem Engländer oft schweigend mitverfolgt. Nach dem Fall von Seringapatam war er nicht zu Bonaparte nach Ägypten gereist, sondern hatte beschlossen, sein Glück auch weiterhin in Indien zu suchen. Einer unter vielen an der Seite eines aufstrebenden Sterns, Staub im Kometenschweif Bonapartes? Nein, dieses Leben zog den jungen korsischen Offizier nicht an. Perron hatte ihm die Chance gegeben, den »campoo« der Begum von Sumroo zu übernehmen, nachdem ein irischer Kommandeur, Oberst George Thomas, sich zu Tode getrunken hatte. Die Begum war die Witwe eines der ersten europäischen Offiziere Scindias: Walther Reinhardt hatte ihr seinen »campoo« und seine politische Position im Maharastra hinterlassen.
Wenngleich die Begum die Vierzig überschritten hatte, war sie immer noch eine schöne und vor allem hochintelligente Frau. Als Perron ihr Cappellini vorgestellt hatte, war ihre Entscheidung sofort gefallen: Sie hatte beschlossen, George Thomas zu vergessen und einen neuen, attraktiven Offizier für ihre Truppen und für ihr Bett zu rekrutieren. Cappellini hatte schnell begriffen, dass diese Position ihn in Indien zu den gleichen Höhen führen konnte, wie de Boigne und Perron sie erreicht hatten. Er hatte die Frau und den »campoo« genommen und stand damit hinter Perron und Pohlmann an dritter Stelle in der Hierarchie der europäischen Söldner des Maharadschas von Gwalior.
Perron füllte sein Glas mit kräftigem, dunkelrotem Madeira. Seine Augen suchten nachdenklich die von Oberst Cappellini. Er hatte den Offizier während der letzten Stunden mit dem Engländer Dodd eingehend beobachtet. Cappellini hatte kaum den Mund geöffnet, doch sein Schweigen war Perron unbehaglich. Er wusste, wie nützlich Cappellini dem Sultan gewesen war und über welch glänzendes militärisches Potential der Mann verfügte. Er wusste, wie wichtig ein Soldat dieses Schlages in Scindias Reihen war.
»Was ist los, mein Freund? Du hast etwas auf dem Herzen, aber aus einem unerfindlichen Grund hast du beschlossen, mich nicht ins Vertrauen zu ziehen.«
Cappellini fuhr sich mit der Hand durchs rabenschwarze Haar. Es war eine Geste, um Zeit zu schinden und eine Antwort hinauszuzögern. Man diente nicht Scindia, weil man sich den Luxus leisten wollte, seine Pflicht als Offizier und Ehrenmann zu erfüllen. Die Tage der Revolution lagen lange hinter ihm. Außer Bitterkeit und Narben war ihm nichts geblieben, und die Ideale, für die er einst sein Leben gelassen hätte, waren verschwunden.
Man schloss einen Vertrag mit den Marattha, um reich zu werden und eines Tages wohlhabend nach Hause zurückzukehren, nicht aus Idealismus. So war es schon bei Perron und den anderen gewesen. Sollte er seine Chancen aufs Spiel setzen und jetzt offen sprechen, oder sollte er schweigen, kassieren und sich mit vollen Taschen absetzen, falls es den Marattha nicht gelingen würde, die Briten und ihre indischen Verbündeten schachmatt zu setzen? Cappellini wand sich. Perron musterte ihn immer noch.
»Jean-Francois, die Geschichte dieses Dodd ist interessant. Sicher, er hat die letzten Jahre in Mysore verbracht und ist möglicherweise mit dem Iren ins Feld gezogen, doch ich habe aus den Tagen Tippus andere Erinnerungen: Verantwortung, die Regierung einer großen Provinz, das Kommando über alle Truppen zwischen Malabar und unseren Grenzen, der Krieg ... Diese Dinge machen einen Mann nicht schwächer, sondern stärker. Selbst wenn er der Bruder des Generalgouverneurs ist. Mornington wäre niemals so verrückt, um zuzulassen, dass man eine solch wichtige Aufgabe wie die Restauration des Peshwa einem Trottel anvertraut. Für Fort William steht zu viel auf dem Spiel.«
»Du meinst, Dodd lügt?« Perron wusste um die Truppenkonzentration bei Hurryhur. Man hatte ihm gemeldet, dass sie mit einem feindlichen Kontingent an der Grenze rechnen müssten. Sir James hatte Wellesley mit fast 15 000 Mann – Kavallerie, Infanterie und Artillerie – ins Feld geschickt. Oberst Stevenson, die Nummer zwei des Gouverneurs von Mysore, stand in Hyderabad mit 9000 Mann des Nizzam bereit und wartete nur noch auf den Marschbefehl.
»Lügen ist ein großes Wort, Jean-Francois! Ich habe eher das Gefühl, dass dieser Mann Wellesley überhaupt nicht kennt. Ich bin ihm vor Seringapatam entgegengetreten, ihm und diesem Baird. Sie haben gekämpft wie die Löwen. Nun tauchen sie wieder zusammen auf, und Wellesley hat in den letzten Jahren jeden in die Schranken gewiesen, der sich ihm entgegengestellt hat.«
»Wir werden sehen, Allessandro! Lassen wir alles auf uns zukommen. Wir werden wachsam sein und darauf hoffen, dass du dich irrst. Wenn Dodd Recht hat, wird es ein leichtes Spiel, wenn nicht, müssen wir uns bis aufs Messer bekämpfen. Doch wir kämpfen auf unserem Gebiet, während die Briten kurze Verbindungslinien mit ihren Nachschubbasen in Hurryhur, Chitteldroog und Hullihall benötigen. Wellesley kann nicht endlos weit voranrücken ... Irgendwann ist er so tief in diesem Gebiet, dass er Nachschubprobleme bekommt. Dann erst nehmen wir ihn uns vor und zerschmettern eine isolierte und erschöpfte Armee.«
Cappellini nickte Perron zu. »Natürlich, irgendwann wird er einen Fehler machen, dieser Sepoy-General!« Er erinnerte sich nur zu gut an den beeindruckenden Tross, den er damals vor Seringapatam gesehen hatte und daran, wie General Harris' Streitmacht mit ihren Feldgeschützen von Madras durch den tiefsten Dschungel nach
Mysore gekommen war, ohne dabei auch nur ein einziges Mal gezwungen gewesen zu sein, Nachschub im Gebiet des Sultans zu requirieren. Doch der Offizier beschloss, seine Bedenken für sich zu behalten und Perron seinen Weg gehen zu lassen. Sollte Scindias General Recht behalten, wollte er auf der Seite des Siegers stehen und einen Teil des Ruhms und der Reichtümer abbekommen. Sollte Perron sich irren, würde er immer noch die Zeit finden, die Begum zu überzeugen, dass es besser war, die Seiten zu wechseln. Sie war eine kluge Frau, und er wusste, dass er sich auf ihren Hunger nach Macht und Einfluss verlassen konnte. Sie teilten nicht nur das Bett miteinander.
Als Sir Davie Baird im Januar 1803 mit seinem feuerroten Gesicht und seiner legendären üblen Laune in Hurryhur aufgetaucht war, hatten alle sich Fragen über Fragen gestellt und darauf gewartet, dass der offene Krieg zwischen dem Schotten und Arthur Wellesley zum Ausbruch kommen würde. Sie hatten regelmäßig verfolgt, wie die beiden Generalmajore sich zusammen in Wellesleys oder Bairds Zelt begaben und jedes neugierige Ohr aus der näheren Umgebung vertrieben. Baird hatte sich in Ägypten, an Abercrombies Seite, gut geschlagen. Er hatte eine britische Armee durch die Wüste an den Nil hinauf geführt. Baird war auch ständig auf der Stabsliste von Madras, während Arthur nur provisorisch von Stuart hineingeschrieben worden war, denn London hatte bis zu diesem Tag weder seine Beförderung zum Generalmajor noch seine Berufung in den Generalstab bestätigt, und der Marquis von Mornington schien keine Anstalten zu machen, die Horse Guards wegen seines Bruders zu bedrängen.
Doch trotz der Unruhe in Wellesleys engerer Umgebung drangen nie laute Töne durch die sorgsam verschlossenen Zeltbahnen, und er und der unmögliche Sir Davie schienen in Eintracht damit zu leben, dass der Schotte als Dienstälterer das Expeditionskorps kommandieren sollte, das sein jüngerer Kamerad so sorgsam aufgestellt, ausgebildet und ausgerüstet hatte.
»Ein Glas Portwein?« erkundigte Sir Davie sich bei Arthur Wellesley, nachdem die Zeltbahn sich hinter den beiden Männern geschlossen hatte und sie sich vor den Augen der anderen sicher wussten. Er ließ sich auf sein Feldbett fallen und wies mit der Hand auf einen klapprig aussehenden Stuhl neben dem Kartentisch.
Der Ire schüttelte den Kopf und griff nach einer Karaffe mit Wasser. »Ich kann die Augen kaum noch offenhalten, Davie! Wenn ich das Zeug trinke, schlafe ich in fünf Minuten ein.«
Baird grinste. »Eine beschissene Situation für dich. Du machst die Arbeit, rackerst dich ab und bekommst die Prügel, und ich führe das Kommando.«
Sie hatten sich vor langer Zeit ausgesprochen und ihren persönlichen Konflikt begraben. Baird empfand sogar ein Gefühl der Freundschaft für den Jüngeren, und Arthur erwiderte es auf seine natürliche, ehrliche und geradlinige Art. Es war eine Stichelei des Schotten. Es bereitete ihm Vergnügen zu testen, ob Wellesleys Haut wirklich so dick war, wie der Generalmajor vorgab.
Arthur hob den Blick von seinem Glas und richtete sich auf. Es kostete ihn viel Kraft, aller Welt diese ständige Komödie unerschütterlichen Gleichmuts vorzuspielen und seine wahren Gefühle hinter einer Maske zu verbergen. Es tat ihm gut, offen mit Davie Baird diskutieren zu können, ohne befürchten zu müssen, dass Worte nach außen ins Expeditionskorps drangen. »Davie, niemand hat dich darum gebeten, nach Hurryhur zu reiten. Du hast Stuart so lange tyrannisiert, bis er nachgegeben hat. Beim letzten Mal hast du eine Bande von Schnapsleichen zum Aufstand verleitet und den Generalgouverneur bedroht. Ich werde nicht zulassen, dass du mein Korps nimmst, während ich an zweiter Stelle für dich den Laufburschen mime. Ich kann nicht mehr gehorchen, wo ich nicht befehle.«
»Du willst dich mit mir anlegen, Kleiner?« spottete der Schotte. Seine feuerroten Wangen glänzten nach dem vierten Glas Portwein wie im Fieber. Er liebte es, Wellesley auf die Palme zu bringen und zu sehen, wie weit er gehen konnte, ihn zu provozieren, bis der Junge innerlich kochte. Niemand schien ihn je gelehrt zu haben, für seine eigene Sache zu kämpfen. Wenn er jetzt, in diesem Augenblick nachgeben sollte, würde der Junge in den Händen seines Bruders Mornington zu einer Marionette der Politik werden und dabei möglicherweise Schlachten verlieren, nur weil ein ehrgeiziger Mann in Kalkutta sich in den Kopf gesetzt hatte, einen Krieg zu gewinnen.
Der Krieg war eine Angelegenheit, die man denen überlassen sollte, die dafür ausgebildet waren. In Indien galt die Prämisse der Politik einfach nicht, denn das Land war unendlich groß, und wenn sie über die Grenze ins Maharastra einmarschierten, würden sie vielleicht über Monate eigenverantwortlich entscheiden müssen, wie weit sie gehen konnten.
Wellesley erhob sich von seinem klapprigen Stuhl. Er stellte sein Wasserglas zur Seite und verschränkte die Arme vor der Brust. »Davie, es gibt zwei Gründe, warum ich bis aufs Messer kämpfen werde. Du bist ein guter General und verfügst in manchen Dingen über mehr Erfahrung als ich. Aber du hasst die Inder so sehr, dass dir am ersten Tag nach dem Grenzübertritt bereits die Hälfte der Sepoy-Regimenter weglaufen würde. Danach hättest du die verbündeten Fürsten am Hals, weil du den Mund nicht halten kannst. Es würde in einer Katastrophe enden.«
Bairds Augen funkelten. Es war einfach unglaublich, dass der Kleine so ruhig bleiben konnte. Er prügelte sich wie ein Straßenköter, und doch vergriff er sich nie im Ton. Wenn er auf dem Schlachtfeld genauso kaltblütig agieren würde wie in diesem stickigen Zelt, würde England bald von einem herausragenden General hören. »Wie oft hast du Pulverdampf geschnuppert, Junge? Du hast dich mit ein paar verlotterten Banden herumgeschlagen, deren einziges Ziel es war, zu plündern und zu brandschatzen. Dann hast du ein paar drittrangige braune Bastarde aus ihren elenden Holzbaracken vertrieben. Arthur, sei vernünftig! Die Stiefel sind noch viel zu groß für dich. Komm mit mir, als meine Nummer zwei. Lerne vernünftig dein Handwerk, und in ein paar Jahren, wenn du erwachsen bist ...«
Wellesley griff nach der Portweinflasche und schenkte Baird ein weiteres Glas ein. Dann ließ er sich neben dem Schotten auf der Pritsche nieder. »Welche Route wirst du einschlagen? Welche Strategie hast du dir gegen die Herren in Poona vorgestellt? Wie wirst du vorgehen, wenn sie nicht nachgeben? Willst du die Armee teilen? Willst du durch die Monsunstürme bis an den Tombuddra ziehen, oder versuchst du, über die Flanke und das Gebiet des Nizam entlang des Kistna und des Beemah zu marschieren? Was werden deine Männer abends in ihren Fleischtöpfen vorfinden? Wie fütterst du Pferde, Ochsen, Elefanten?«
»Nichts als Fragen, mein Freund? In deinem klugen Kopf sind zu viele offene Fragen, um diese braunen Halunken aus Poona zu vertreiben. Du solltest dir nicht so viele Fragen stellen und lieber darüber nachdenken, wie du handeln willst.« Baird bekam langsam Schwierigkeiten, seine kleine Komödie so weiterzuspielen, dass es Wellesley nicht auffiel. Weil er sich in Hurryhur herumtrieb und laut fauchte, trauten die Schnapsleichen aus Kalkutta sich nicht ins Kriegsgebiet, um für Wirbel und Aufregung zu sorgen. Stuart würde schon bald eintreffen. Dann war die Sache endlich ausgestanden.
»Natürlich, Davie! Wie ein wütender Bulle auf den ersten losstürmen, der sich der Armee in den Weg stellt ... Das ist auch ein Plan. Irgendwie erinnerst du mich an die Franzosen, die so etwas Ähnliches bei Azincourt versucht haben. Die Sache ist in die Hose gegangen.« Der General griff in die Tasche seines roten Rocks und zog ein paar eng beschriebene Seiten Papier hervor. »Das ist die Kopie eines Memorandums, das ich vor zwei Wochen an Stuart geschickt habe. Möchtest du es lesen?«
Baird schüttelte den Kopf. Seine Wangen glühten, seine Augen funkelten übermütig. »Du Hurensohn! Über den Kopf eines ranghöheren Offiziers hinweg direkt an den großen Chef! Das ist Insubordination! Dafür kommst du vors Kriegsgericht, und sie reißen dir genussvoll den goldenen Tand von den Schultern.«
»Rutsch mir den Buckel runter, Davie! Du hast verloren! Gib endlich auf und verschwinde zurück nach Madras. Du störst hier in Hurryhur. Wenn du meine Truppen willst ... nur über meine Leiche.«
Schallendes Lachen erschütterte das Zelt und das Feldlager. Baird lachte, dass ihm Tränen über die Wangen liefen. Es dauerte eine ganze Weile, bevor der Generalmajor sich wieder gefangen hatte. Er schluckte ein paarmal kräftig, dann kippte er ein weiteres Glas Portwein, um seine Stimme wiederzugewinnen. »Sobald Stuart und seine Bande gepuderter Lackaffen hier auftauchen, packt der alte Davie seine Koffer, mein Junge. Ich hab einfach nicht mehr genug Biss, um mich mit einem toll gewordenen Köter zu prügeln, der gerade einmal halb so alt ist wie ich selbst und noch alle Zähne im Maul hat. Ich kenne den verdammten Wisch zwar nicht, aber ich bin mir sicher, dass du Recht hast. Du und deine verdammte Logik! Hast du denn gar kein Gefühl mehr im Leib? Pass nur auf, dass die Praxis dir deine hübsche Theorie nicht wiederlegt und du hinterher dastehst wie ein Vollidiot.«
Wellesleys Blick traf den von Baird. Der kalte Schleier, der meist über seinen Augen lag, war verschwunden. »Vertrau mir, Davie! Versuche es wenigstens!« bat er den alten Offizier. Seine Stimme zitterte und er spürte, dass er nicht mehr lange gegen die Tränen würde ankämpfen können. Er war übermüdet und zu Tode erschöpft. Er fühlte sich schrecklich allein gelassen. Seit Wochen schon besuchte Charlotte ihn nicht mehr in seinen Träumen. Der Gedanke an Tod und Blutvergießen schien ihren freundlichen Geist zu verscheuchen oder zu erschrecken. Schon als er mit Bullum und Wynaad abgerechnet hatte, hatte sie sich von ihm zurückgezogen.
Baird legte seine Bärenpranke um Arthurs Schulter. »Mein Vertrauen ist ohne Bedeutung. Du musst lernen, dir selbst zu vertrauen, mein Junge! Du darfst nie an dir zweifeln oder dich darauf einlassen, wegen irgendwelcher Unpässlichkeiten in trüben Gedanken und Grübeleien zu versinken. Nur wenn du an das glaubst, was du tun willst, wirst du Erfolg damit haben.« Der alte Schotte hatte freundlich, beinahe sanft zu seinem jungen Kameraden gesprochen. Sir Davie hätte es selbst nicht für möglich gehalten, dazu fähig zu sein, doch Wellesley war ihm gegenüber immer so offen und ehrlich gewesen.
Sie waren beide Männer von Ehre und hatten ehrenvoll um dieses Kommando miteinander gestritten. Arthur hatte keine Querelen vom Zaun gebrochen, als er aus Madras nach Hurryhur gekommen war. Obwohl er die Möglichkeiten gehabt hatte – der Stab und die Kommandeure der indischen Hilfstruppen waren ihm fast sklavisch ergeben –, hatte er nicht versucht, Baird auszumanövrieren, sondern mit offenen Karten gespielt, seine Pläne dargelegt, seine Nachschublinien erklärt und ihm sogar angeboten, die Verhandlungen mit einigen geringeren Marattha-Fürsten an seiner statt zu führen. Sir Davie hatte abgelehnt, sich in Arthurs diplomatisches Ränkespiel mit den Maratthas einzumischen, denn er kannte seine eigenen Unzulänglichkeiten genau.
Als er gesehen hatte, was der Jüngere auf die Beine gestellt und ausgebildet hatte, war es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass er diesem Mann als Vorgesetzter nur im Weg stehen würde. Arthur besaß nicht nur das Geschick, unter indischen Bedingungen – schlechten Straßen, sporadischen Nachschublinien, Epidemien, einem schrecklichen Klima – ein Heer aufzustellen und zu führen. Er hatte bereits seit vier Jahren zur Genüge bewiesen, dass er siegen konnte. Der Kleine hatte vier Jahre lang mutterseelenallein und ohne Hilfe von außen im Kernland des Subkontinents gekämpft, während sie sich in Madras und in Kalkutta die Zeit vertrieben hatten. Er war an dieser Aufgabe gewachsen, ganz so, als ob sein bisheriges Leben eine Vorbereitung für all dies gewesen wäre.
»Bis Stuart eintrifft, halte ich dir mit meinem Geknurre die alten Trottel vom Leib, Junge. Dann kannst du nur noch auf dich selbst hoffen und darauf, dass deine große Strategie aufgeht. Und noch etwas: Mornington! Sei vorsichtig! Wenn du auch nur den kleinsten Fehler machst, knüpft er dich auf. Er will dieses Stück des Subkontinents um jeden Preis. Im Augenblick hat es den Anschein, als ob er mit aller Gewalt den einzigen Offizier im Feld haben will, der sich schon einmal hier geschlagen hat, weil er annimmt, damit mehr Trümpfe gegen die Direktoren in der Tasche zu haben. Aber wenn sein Trumpf nicht sticht, schickt er einen neuen Mann. Oder wenn die Direktoren es schaffen, ihn unter Druck zu setzen und er wählen muss – zwischen seinem Ehrgeiz und seiner Position!«
»Davie«, entgegnete der junge General, »ich habe keine Angst mehr vor ihm!« Er stockte kurz, als ihm bewusst wurde, was er soeben eingestanden hatte. Doch dann fasste er sich wieder. Eine ehrliche Aussage war immer besser als eine lächerliche Komödie mit großartigen Verkleidungen. »Es gab Zeiten, da hat er mir seinen Willen aufgezwungen, und ich habe mich gebeugt. Mornington ist der Generalgouverneur und damit der Stellvertreter der Krone. Er ist der Oberbefehlshaber. Dagegen kann ich als Soldat nichts tun. Doch er wird mich nicht einschüchtern, und ich werde mich auf militärischer Ebene auch nicht von seinen politischen Ränkespielen beeinflussen lassen. Nur ein Plan verspricht Erfolg – mein Plan! Und ich habe nicht vor, wegen Fort William Fehler zu begehen, die unnötig Menschenleben kosten.«
Baird verzog den Mund. »Vielleicht muss ein Mann in deinem Alter noch Träume haben. Du wirst schnell feststellen, wie sehr Kalkutta sich einmischen kann. Ich hoffe, dass du die Sache heil überstehst ...«
Perron hatte sein Lager von Indore nach Ahmednuggur, etwa siebzig Meilen nördlich von Poona verlegt. Die meisten der »campoos« waren Infanterieeinheiten. Die Männer hatte Scindias Feldherr sorgfältig rekrutiert. Sie kamen aus dem Norden, und der Krieg lag ihnen im Blut. Sie wurden ausschließlich von europäischen Offizieren befehligt. Ein »campoo« war gerade auf dem »maidan« zu Exerzierübungen angetreten. Dodd beobachtete die Männer aufmerksam. Er konnte seine Bewunderung nur schwer verbergen. Sie unterschieden sich in nichts von europäischen Truppen. Präzise wie Uhrwerke führten sie ihre Bewegungen aus. Ihre Disziplin war tadellos.
»Beeindruckend, nicht wahr?« Perron schmunzelte. Der Franzose war sich seiner Macht gewiss. Obwohl Scindia prahlen konnte, dass er den ganzen Maharastra mit einer schwarzen, bewaffneten Wolke aus hunderttausend Fußsoldaten und fast ebenso vielen Reitern überziehen konnte, waren diese wenigen, europäisch geführten Einheiten doch die Speerspitze der Armee des Fürsten. Lange Soldatenreihen standen stramm, als Perron langsam mit seinem neuen britischen Offizier über den »maidan« schlenderte. »Sie führen Ihre Sepoys gut! Pohlmann ist zufrieden!«
Dodd dachte einen Augenblick nach, ob er antworten sollte. Zwanzig Jahre hatte ihm »John Company« diese Rolle verweigert, obwohl er alle Anlagen besaß, Soldaten vernünftig zu führen. Doch »John Company« beförderte seine Männer nicht nach ihren intellektuellen und militärischen Fähigkeiten, sondern nur nach dem Dienstalter. Diese Unsitte führte dazu, dass er mit seinen fast vierzig Jahren immer noch einfacher Leutnant gewesen war, während Kinder in den königlichen Regimentern bereits mit dreißig Jahren zum General gemacht wurden. Dodd beschloss, das Thema zu wechseln und seine neue Stellung im Stillen zu genießen. »Die Briten werden in den nächsten Tagen angreifen, Oberst!«
»Und sie hoffen darauf, dass ich mich hier festlege und mit ihnen kämpfe.« Perron schmunzelte. »Es ist besser, wenn sie uns hinterherlaufen müssen. Der Monsun wird kommen. Sie werden uns verfolgen, doch die Flüsse werden zu unüberwindlichen Hindernissen anschwellen. Mit dem Regen kommen das Fieber und viele andere Krankheiten. Wenn die Briten sich müde gelaufen haben und vom Fieber geschwächt sind, werden wir stark sein. Sämtliche >campoos< von Scindia werden sich zusammenschließen. Der Rajah von Berar hat versprochen, seine Armee zu entsenden. Sobald wir alle vereint haben, zerschmettern wir den Feind.«
»Sie werden Ahmednuggur aufgeben müssen.« Dodd verstand sein Handwerk. Nun, da man ihm endlich seine Chance gab, wagte er auszusprechen, was er dachte. »Die Festung ist strategisch unwichtig.« »Sie haben Recht, Major. Ich würde Ahmednuggur kampflos den Briten überlassen, doch Scindia ist von diesem Ansatz nicht begeistert.
Er hat die Festung bis obenhin mit Munition und Proviant vollgestopft und besteht darauf, dass eine starke Besatzung zu ihrem Schutz zurückbleibt.« Der Franzose zuckte mit den Schultern. »Was soll’s! Ich werde Wellesley einen Haufen Höllenhunde zurücklassen, an denen er sich die Zähne ausbeißen kann. Die Festung wird ihn Zeit kosten. Jeder Tag, den der Ire verliert, ist ein kleiner Sieg für uns. Apropos Wellesley! Cappellini ist mit Ihrer Einschätzung des Mannes nicht glücklich. Wussten Sie, dass Allessandro ihn persönlich kennt? Er hat sich mit unserem Freund bei Seringapatam geschlagen.«
Dodd konnte die leichte Röte, die seine Wangen bedeckte, nicht unterdrücken. Er fühlte sich plötzlich von Perron in die Enge getrieben und mit einer Falle konfrontiert. Wollte der Franzose ihn erneut auf die Probe stellen? Vertraute er ihm vielleicht doch nicht? Hatte er Zweifel an Dodds ehrlichen Absichten, obwohl der Offizier die Seite gewechselt und in ganz Indien ein gesuchter Mann war, oder durchschaute der Feldherr des Rajahs seine Lügen, was den Iren anbetraf? »Er hat noch nie eine offene Feldschlacht geschlagen«, bemerkte Dodd bitter, »außer bei Malavelley, aber diese Geschichte war nicht von Bedeutung.«
»Major, er hat Dhoondia zerstört! Bullum! Wynaad! Soonda!« Perron blickte seinem Untergebenen fest in die Augen. Auch wenn der Engländer sich vieles vielleicht nur zusammensponn oder von Hörensagen wusste, so war er doch derjenige, der den Feind von innen kannte.
»Er wird nicht mehr als fünfzehntausend Mann Infanterie, fünfundzwanzig Geschütze und sechs-, siebentausend Reiter mitbringen. Sie werden in zwei Teilarmeen vorgehen. Eine führt Wellesley, die andere Stevenson. So haben sie es immer gehalten.«
»Stevenson ist ein alter Fuchs. Er kennt dieses Land in- und auswendig.«
»Stevenson ist vorsichtig und schlau. Doch er muss einen weiten Weg zurücklegen, um sich mit der Mysore-Armee zu vereinigen. Außerdem ist sein Nachschub von dem des Iren losgelöst. Er wird aus Hyderabad versorgt und hat damit die längere Kommunikationslinie.« »Dodd, sobald wir uns mit den Truppen des Rajahs von Berar vereinigen, verfügen wir über eine drei- oder vierfache Übermacht und haben viermal mehr Geschütze im Felde, aber der Krieg ist keine Spielerei mit nackten Zahlen. Schlachten werden von Generälen gewonnen und verloren. Erzählen Sie mir mehr über Generalmajor Arthur Wellesley.«
»Er ist jung. Knapp über dreißig.«
»Jugend ist kein Hinderungsgrund für einen guten Soldaten ...« Perron wollte gerade fortfahren, als sich von hinten eine vertraute Hand auf seine Schulter legte. Er hatte Allessandro Cappellini nicht kommen gehört, denn er war zu sehr in die Unterhaltung mit Dodd vertieft gewesen, während sein Verstand gleichzeitig am Plan gegen die britischen Angreifer feilte.
Allessandros Uniform war über und über mit Staub bedeckt. Sogar über seinem Gesicht lag eine dicke, rotbraune Kruste, in die lediglich der Schweiß tiefe Furchen gegraben hatte. Der Korse sah aus, als wäre er direkt aus den Abgründen der Hölle nach Ahmednuggur gekommen. »Jean-Francois! Er hat sich so schnell bewegt, dass wir ihn nicht haben kommen sehen. Die >jaghidars< zwischen der Grenze und der Hauptstadt sind zum Feind übergelaufen ...«
Perron fuhr herum. »Wie bitte?« Diese Nachrichten, die Cappellini ihm soeben atemlos überbracht hatte, waren unglaublich. Seine Späher hatten ihm vor weniger als vierundzwanzig Stunden noch gemeldet, dass die feindlichen Truppen regungslos um Hurryhur verharrten. Es war unmöglich, in so kurzer Zeit vierhundert Meilen zurückzulegen.
»Der Ire hat uns ausgetrickst, Jean-Francois! Irgendjemand zieht an der Grenze eine große Schau ab. Seine Armee hat sich nicht mit Stevenson zusammengeschlossen. Er ist über die Flanke marschiert, hat Darwan einfach umgangen. Er ist wie ein Geist mit seinen Rotröcken und Sepoys vor der Stadt erschienen. Holkar hat nicht einmal den kleinen Finger gerührt. Er ist nach Chandore verschwunden, nachdem er dem Iren das Haupttor der Stadt weit geöffnet hatte. Amrut Rao hatte zuerst abgelehnt, sich Holkar anzuschließen. Er wollte die Stadt zerstören, um sie nicht dem Feind zu überlassen, doch die Briten waren so schnell drinnen, dass unser Freund nicht einmal mehr die Zeit gefunden hat, sich die nächstbeste Fackel zu greifen ...«
»Poona ist kampflos gefallen!« seufzte Perron. »Umso besser! Ich wollte mich mit diesem Sepoy-General sowieso noch nicht schlagen. Er ist noch zu nahe an seinen Nachschubbasen ...«
Major William Dodd hatte schweigend und leichenblass die Unterhaltung zwischen Perron und Allessandro Cappellini mitverfolgt. Sein
Französisch war ausreichend gewesen, um das Wichtigste zu verstehen. Damit war seine Theorie über die fehlende militärische Erfahrung des jungen Bruders des britischen Generalgouverneurs in einer Rauchwolke verpufft. Shee hatte sich in seinem grenzenlosen Hass gegen den Kommandeur des 33. Regiments eine Legende zusammengesponnen, die diesem jähzornigen, verbitterten und versoffenen Halunken recht gewesen war, aber in keiner Weise der Wahrheit entsprochen hatte. Und Dodd musste nun einen Weg finden, um vor seinem neuen Dienstherren Perron nicht das Gesicht zu verlieren. Nach dem Fall von Poona konnte er nie wieder behaupten, welch unerfahrenem Gegner sie entgegentraten.
Als Elphinstones Späher an der Marschlinie aufgetaucht waren, um Generalmajor Wellesley zu melden, dass Amrut Rao Poona in Brand stecken wollte, hatte der Ire nicht lange gezögert, sondern mit 400 Reitern Bisnapah Pundits einen nächtlichen Gewaltmarsch von gut vierzig Meilen unternommen, um die Hauptstadt des Peshwa zu retten. Die Operation war ein Erfolg gewesen, auch wenn sie ihren Preis gehabt hatte: Arthur spürte heute – drei Wochen später – immer noch jeden einzelnen Knochen im Leib, und der Beritt der Männer, die ihm durch die Nacht gefolgt waren, war nach Hurryhur zurückgeschickt und durch neue Pferde ersetzt worden.
»Zum Teufel, nun sehe sich einer dieses unvernünftige Kind an!« fluchte er leise vor sich hin, als er Bajee Rao II. beobachtete. Der junge Mann ritt einen prachtvollen Schimmel. Das große Tier glänzte im Sonnenlicht. Es trug einen sonderbaren, juwelengeschmückten Lederpanzer, in den verschlungene Blumenmuster aus Goldfaden gewirkt worden waren. Ein riesiger Kriegselefant mit einem ähnlichen Panzer folgte ihm. Über die Stoßzähne hatten sie ihm einen Silberschaft gezogen, der in einer scharfen Spitze endete. Sein »mahout« schwitzte unter einem altmodischen, pittoresken Kettenhemd. Hinter ihm befand sich der »howdah« aus dunkelrotem Zedernholz. Hauchdünne goldene Rauten waren als Zierde angebracht worden. Über dem Korb flatterte ein Dach aus smaragdgrüner Seide im Wind. Links und rechts von Bajee Rao marschierte seine Leibgarde: Männer in farbenprächtigen Hemden, die mit einer Uniform nur wenig gemein hatten. Manche von ihnen waren mit Steinschlossgewehren bewaffnet, andere mit altertümlichen Hellebarden, deren Klingen so sorgfältig poliert waren, dass sie aus Silber geschmiedet zu sein schienen. Der Rajah zeigte sich seinen Untertanen und schien dabei zu vergessen, wer ihn zurück auf seinen »muzznud« gehoben hatte. Nach dem Fall der Hauptstadt war Bajee Rao II. mit einer starken britischen Eskorte aus Bombay nach Poona gebracht worden, obwohl er seit der Unterzeichnung des Vertrages von Bassein schon mehrfach insgeheim versucht hatte, seine neuen Verbündeten zu verraten. Er konspirierte beständig gegen »John Company«, schickte Kuriere zu Scindia, zum Rajah von Berar und sogar zu Holkar, der ihn verraten und verkauft hatte. Natürlich wusste Arthur über jeden Winkelzug bestens Bescheid und las meist auch gleich die Kopien der Schreiben an die Feinde mit, denn er hatte einen exzellenten Nachrichtendienst und Montstuart Elphinstone, dessen Vorahnungen den General täglich überraschten.
Trotzdem ärgerte Wellesley sich. Er würde Barry Close in Poona zurücklassen müssen, nur um zu verhindern, dass dieses unbedarfte und arrogante Kind auf dem Thron ihm und seinen Truppen auf ihrem Marsch gegen Scindia in den Rücken fiel. Er verbrachte täglich Stunden damit, sich gegen jede Intrige Bajees einen neuen Schachzug zu überlegen, und diese Zeit fehlte ihm bei der Vorbereitung seines Feldzugs. Nachdenklich drehte er den Krug mit dunklem Bier zwischen den Händen. Während seines Gewaltmarsches durch den Dschungel auf die Hauptstadt des Maharastra hatte ihn der Gedanke an ein kühles, frisches Bier und ein vernünftiges Abendessen manchmal beinahe um den Verstand gebracht. Nun verdarb der protzige Bengel auf seinem Schimmel ihm den Genuss.
Zahlmeister Dunn legte dem General mitfühlend die Hand auf die Schulter. »Ich verstehe Sie ja, mein Junge! Trotzdem sollten Sie sich den Abend nicht verderben. Wann haben Sie das letzte Mal etwas Vernünftiges zu beißen bekommen?«
Arthur zuckte mit den Schultern und wandte sich seinem Bier zu. »Wir verschwinden aus diesem Schlangenpfuhl, sobald Stuart mir meine Befehle bestätigt und mich darüber aufklärt, ob dieser verdammte Friede von Amiens irgendwelche Auswirkungen auf unsere Operation hat. Scindia wuselt heute zwar noch ziel- und planlos durch die Gegend, aber morgen oder übermorgen hat er sich vielleicht gefangen und beschließt, gegen Poona zu marschieren ...«
Immer wenn der Ire sich unbefangen aussprechen und weder Ratschläge noch brillante Geistesblitze hören wollte, verzog er sich klammheimlich zu seinem Sergeant. John war kein strategisches Genie, er war lediglich ein alter Schotte, der mit beiden Beinen im Leben stand. Er schöpfte seinem Kommandeur einen großen Teller mit kräftigem, heißem Hammelragout und frischem Gemüse voll. Dann schnitt er ein paar Scheiben Brot und setzte sich neben ihn. »Mein Junge, möchten Sie mir erzählen, was Sie bedrückt, oder ist es Ihnen lieber, wir wechseln das Thema?«
»Das Problem ist das Thema, John! Der Generalgouverneur verfolgt eine politische Strategie. Er will aus dem britischen Imperium in Indien das Imperium Britisch-Indien machen ...« Arthur schlang ein paar Bissen Ragout hinunter und spülte mit Bier nach. Seine Augen fixierten die von Sergeant-Major Dunn. »Ach, zum Teufel mit der Politik! Sobald Stuart den Befehl bestätigt, knöpfen wir uns Scindia vor!«
Der Marquis von Mornington hatte den Brief der Direktoren schockiert zur Kenntnis genommen. Sie kritisierten scharf seine Politik im Kernland Indiens. Sie nahmen den Vertrag von Bassein mit großer Besorgnis zur Kenntnis und beschwerten sich darüber, dass seine militärischen Ambitionen die Ostindische Kompanie ein Vermögen kosteten, aber keinen sichtbaren Profit hervorbrachten. Wie er diese Buchhalter hasste! Sie dachten an nichts weiter als an Tuchballen, Tee oder Gewürze, die in London versteigert würden. Sie waren kleine Geister, erbärmliche Krämerseelen, und sie sahen nicht, wie sehr ihre Position auf dem Subkontinent gefährdet würde, wenn er nicht den Marattha und anderen potentiellen Verbündeten Frankreichs sein Gesetz aufzwang.
»Henry«, fragte er leise seinen Bruder und Privatsekretär, »haben wir außer Barry Closes Bericht über die politische Situation in Poona Neuigkeiten aus dem Maharastra?«
»General Wellesley hat über den Generalstabschef von Madras mitteilen lassen, dass Holkar von kriegerischen Handlungen abzusehen gedenkt. Er hat mit Holkar einige fruchtbare Gespräche geführt. Dabei muss es ihm irgendwie gelungen sein, sich unter vier Augen mit dessen General Meer Khan zu verständigen. Der Mann hat die Seiten gewechselt und schließt zu Stevensons Teilheer auf.«
Mornington schaute Henry ungehalten an. »Ja, ja! Ich weiß, dass unser Bruder leidenschaftlich gern den großen Diplomaten spielt, doch dafür bekommt er nicht den Sold seines Königs! Militärische Fakten?«
»Richard, du scheinst zu vergessen, dass Holkar ein militärischer Faktor ist!« fauchte Henry Wellesley seinen ältesten Bruder an. Seit Jahren schon ertrug er Richards Arroganz, seinen Hochmut, seine herablassende Art und seine Demütigungen. Lange Zeit hatte er es nicht gewagt, sich zu widersetzen. Doch nun war der Generalgouverneur zu weit gegangen. Henry musste sich auflehnen.
»Richard, warum lässt du ihn diese Expedition überhaupt führen, wenn du mit seiner Vorgehensweise nicht einverstanden bist? Schick doch einfach einen anderen Mann ins Maharastra! Einen Mann, der in der Lage ist, sich mit fünfzehntausend britischen Soldaten und Sepoys gleichzeitig gegen drei Fürsten zu schlagen. Aber erspare unserem Bruder deinen Zynismus.«
»Erspar mir deinen Zynismus, Henry, und hör endlich damit auf, hier in Fort William Nachhutgefechte für Arthur zu schlagen. Es enttäuscht mich, dass nicht einmal du verstehen kannst. Der Frieden von Amiens! Ich habe mich geweigert, den Franzosen Pondicherry und Mahé zurückzugeben, und ich habe General de Caen mit seinen beiden lumpigen Kriegsschiffen zur Hölle geschickt, ohne dabei auch nur einen einzigen Briten zu gefährden. >John Company< hat wie immer laut geschrien, doch St. James hat meine Entscheidung gutgeheißen. St. James heißt auch meine Entscheidung im Maharastra gut, doch es ist mir nicht möglich, von Kalkutta aus die Situation in und um Poona zu kontrollieren. Duncan könnte von Bombay aus diesen Part übernehmen, aber er versteht meine neue Politik nicht und wird im Fall einer Krise die Nerven verlieren. Der Mann ist seit mehr als dreißig Jahren im Land, und langsam bringen ihn das Klima und die Langeweile um. Ich werde jemand anderem die politische und die militärische Verantwortung übertragen müssen ...« Er stockte einen kurzen Augenblick. »Dieser Mann wird nicht nur alle Verhandlungen mit den Fürsten führen, sondern auch über Krieg oder Frieden entscheiden. Selbständig!«
Seine Augen hatten nichts Zynisches, Selbstgerechtes mehr, als er Henry anschaute. Die Augen fragten zum ersten Mal seit Jahren, verlangten nach einer Antwort. Warum hatte ihn jetzt plötzlich die Kraft verlassen, allein eine Entscheidung zu treffen? War es das Schreiben der Direktoren? Waren es diese unterschwelligen Drohungen, dass er sich – im Falle eines Fehlschlages im Maharastra – genauso wie vor ihm Clive und Hastings vor einem britischen Gerichtshof würde verantworten müssen? War es die plötzliche Furcht, alles, was er sich erschaffen hatte, in einem unglückseligen Streit mit »John Company« aufs Spiel zu setzen, nur weil er einen Menschen falsch einschätzte?
Henry erhob sich, blieb aber zwischen seinem Stuhl und dem Schreibtisch des Generalgouverneurs stehen, plötzlich unsicher, ob Richard nur mit ihm Katz und Maus spielte, oder ob er ihn dieses eine Mal wirklich brauchte. Eine Zeitlang schwieg er und betrachtete die zierliche, schlanke Gestalt im engen, schwarzen Gehrock. Seine Augen glitten von den blankpolierten Schuhen über die blütenweißen Strümpfe hinauf zu den perfekt gebügelten Kniehosen, dem eleganten Hemd mit den prachtvollen Besätzen aus feinster Brüsseler Spitze, zu der schweren goldenen Kette, an der eine sündhaft teure Uhr von Breguet hing, zu dem sorgfältig geschlungenen Halstuch aus cremefarbener Seide ... dann blieben seine Augen auf dem Gesicht des Bruders haften. Der erste Anschein waren Energie, Entschlossenheit, Dominanz! Doch dahinter verbarg sich eine sonderbare Unsicherheit, eine innere Unruhe, die der Marquis kaum zu verbergen mochte. Richard hatte etwas Verletzliches an sich.
»Du hast ihn lange nicht mehr gesehen. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, musst du gestehen, dass du ihn gar nicht richtig kennst, denn unser Bruder hat dich nie interessiert. Du hast immer die Meinung unserer Mutter geteilt – Kanonenfutter, nichts weiter!«
»Und deiner Meinung nach ist dieser Sepoy-General mehr als das?« Ein zynisches Lächeln lag auf den Lippen des Generalgouverneurs. Doch es reichte nicht, um seine Unruhe zu überspielen. Er hatte einen Kandidaten in Zentralindien an der Hand. Er konnte jetzt nur auf diese Karte setzen und alles gewinnen oder ... verlieren. Richard fühlte sich unwohl, weil er sich in eine Situation manövriert hatte, in der er die Fäden aus der Hand geben musste, um blind zu vertrauen. »Wie ist er, Henry? Wie ist Arthur?«
»Wie er ist? Ruhig, gelassen, nachdenklich, geduldig. Er ist dir nicht unähnlich, Richard, wenn man einmal davon absieht, dass ihm dieser eiskalte Egoismus abgeht, den man vermutlich braucht, wenn man seine Kämpfe in Whitehall oder in der Leadenhall Street austrägt und nicht in irgendeinem schwülen, unwegsamen, von Ungeziefer und Krankheiten verseuchten Dschungel.«
Der Marquis von Mornington verzog den Mund. Henry wurde wagemutig. Er sagte, was er dachte, und seine analytischen Fähigkeiten waren nicht schlecht: eiskalter Egoismus! Er hasste diese Worte, doch sie stellten die perfekte Synthese seiner selbst dar, und er war stolz darauf, denn er traf Entscheidungen, ohne sich dabei von dummen Gefühlen verleiten zu lassen. »Hat er Mut?«
»Als Offizier oder als Mensch?«
»Was für einen Unterschied macht das, Henry?«
»Einen großen Unterschied, Richard. Für einen Soldaten ist es nicht schwer, mutig zu sein. Wenn du wissen willst, ob Arthur in der Lage ist, schwierige Entscheidungen zu treffen und später für die Konsequenzen seines Tuns geradezustehen ... ja, dann ist er mutig!« »Dann soll er seine Chance bekommen, Henry! Setz den Befehl für Generalmajor Wellesley auf, und schick den Kurier sofort los!« Richard schien erleichtert, als er diese Worte aussprach.