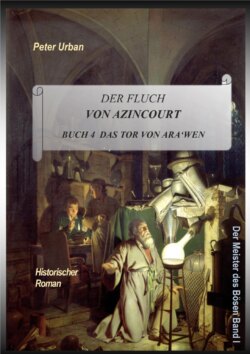Читать книгу Der Fluch von Azincourt Buch 4 - Peter Urban - Страница 3
Kapitel 1 La Blanche Hermine
ОглавлениеI
Der ausgetüftelte Belagerungsturm, den man auch eine Ebenhöhe nannte, schob sich langsam und krächzend näher. Das fahrbare Monstrum hatte mehrere Stockwerke. Sobald zum Angriff geblasen wurde, würden sich auf der obersten Plattform hinter einer hochgezogenen Zugbrücke die tapfersten Ritter und die verlässlichsten Haudegen des verfluchten Richemont drängeln. Ihre Aufgabe würde es sein, im richtigen Augenblick über die Zugbrücke und die Zinnen der Festung zu stürmen. Darunter, von Schießscharten geschützt kauerten bereits Bogenschützen und im obersten Stockwerk konnte man Topfhelme ausmachen, die im Schein der Feuer, wie Bronze glänzten. Olivier de Penthièvre konnte sich keinen Reim darauf machen, was sich hinter der soliden, hölzernen Brustwehr wirklich verbarg.
„Er muss vollkommen wahnsinnig sein! Ein solches Unternehmen in der Nacht zu wagen, widerspricht allen Regeln der Kriegskunst,“ flüsterte sein jüngerer Bruder Charles ihm zu. Ihre eigenen Waffenleute hatten den Beschuss durch die Bombarden sehr schlecht verdaut. Viele der Männer hatten noch niemals eine Kanone gesehen und waren mit der verheerenden Wirkung von Pulver nicht vertraut. Sie schrien laut, der Richemont sei mit dem Teufel im Bund und würde die Heerscharen der Anderswelt Ara’wn auf sie loslassen. Die monotonen Einschläge der Steinkugeln ins äußere Mauerwerk hatten die mit Bogen bewaffneten Bauern und Winzer vollkommen zermürbt. Viele der behauenen Felsbrocken hatten sicher ihr Ziel gefunden und den Wall zur Landseite schwer beschädigt.
„Glaubst Du, das Narbengesicht kümmert sich um die Regeln der Kriegskunst“, zischte Olivier den jüngeren Charles wütend an, „Der wird so lange vor diesen Mauern ausharren und auf sie einhämmern, bis wir nicht mehr vor und nicht mehr zurück können. Er hat genug billiges Fleisch dabei, um seinen Turm den Hügel hinaufzuschieben. Was interessieren ihn bei dieser riesigen Streitmacht vier- oder fünfhundert Knechte aus dem gemeinen Volk. Sieh nur, wie willig sie sich für den Eber von Breizh ins Geschirr legen! Der Turm kommt.“
Charles ging zu einer Gruppe Bogenschützen, die die Angreifer fixierten, wie verstörte Karnickel. Er versuchte die Männer, von denen ein paar Zeichen zur Abwehr des Bösen machten, zu beruhigen. Er bemühte sich, ihnen Mut zuzusprechen, doch das beständige Knarren und Knirschen der riesigen Holzräder der Ebenhöhe, die näher und näher rückte, machte all seine Anstrengungen zunichte. Plötzlich brüllte einer der Posten vom Außenturm: „ Dort oben stehen noch welche, die halten dieses Teufelswerk in ihren Händen. Ich sehe es ganz genau!“
Olivier drehte sich um und verließ den Wall. Dann hatte Richemont also auch seine wertvollen, teutschen Söldner unter dem Hauptmann Keyser mitgebracht und die legendären Culverines à main: „Macht Feuer unter den Pechkesseln“, befahl er im Vorbeigehen ein paar seiner Kriegsknechte, „bereitet Strohballen vor. Sobald sie nah genug sind, schießt Brandpfeile in die unteren Stockwerke des Turms.“
Ihre letzte Chance war es, das Monstrum anzuzünden. Nur wenn das hölzerne Gebälk früh genug in Flammen aufging, konnte es zum Scheiterhaufen der Ambitionen von Arzhur de Richemont werden. Sollte es ihm allerdings gelingen, trotz Pfeilhagel und Funkenregen bis vor den Wall zu kommen, dann waren sie und Champtoceaux verloren.
II
Der Rabe schwang sich hoch in die Lüfte. Das Kriegstreiben auf der Ebene war ohne Bedeutung für den großen Vogel. Er schlug einen weiten Bogen und betrachtete aus kalten, schwarzen Augen, wie sie fielen.
Man warf Steine und pechgetränkte Strohbündel auf die Knechte, um die menschliche Antriebskraft der Ebenhöhe auszuschalten. Doch alle Mühe war vergeblich, denn Richemont hatte dafür gesorgt, dass stets Nachschub an frischem Fleisch da war. Mochten die Verteidiger von Champtoceaux auch Hunderte aus den Reihen seiner Fußtruppen abschlachten: hunderte neuer Knechte warfen sich im selben Augenblick mit ungebrochener Energie in die Bresche. Die Schubkraft blieb erhalten, die Ebenhöhe rollte weiter den Hang hinauf. Erbarmungslos.
Dumpf dröhnten die vier Bombarden. Ohne Unterlass hatten sie seit den frühen Abendstunden, als die Sonne hinter dem Horizont zu versinken begann, ihre grob behauenen Steinkugeln gegen die Außenmauer der Festung geschleudert, genau an die Stelle, wo die Verbindung zwischen dem Wall und einem Wachturm eine Schwäche bot. Oben auf diesem Turm harrten trotzdem immer noch einige Bogenschützen aus, die verzweifelt einen Pfeilregen auf die Mannschaften abschossen, die die großen, schweren Geschütze bedienten. Es war ein unsinniges Unterfangen. Für einen der zu Boden ging traten sofort zwei neue Kriegsknechte neben Richemonts riesige Bombarden, füllten die Pulverkammern, kühlten die Bronze mit nassen Schaffellen, schafften mehr Steinkugeln herbei. Es war ein Hin- und Herrennen, wie in einem Ameisenhaufen.
Langsam glitt der Rabe hinunter zu der kleinen, dunklen Öffnung des Donjons. Einmal flog er vorbei. Niemand war zu sehen. Schließlich ließ er sich auf dem Sims nieder und spähte hinein. Es war ein sonderbarer Kontrast zu der wilden Aktivität draußen vor der Festung und oben auf ihren Wällen. Seine scharfen Sinne ließen ihn die ruhigen Atemzüge zweier schlafender Menschen ausmachen. Sie mussten dicht beieinander liegen, denn sie atmeten fast im gleichen Takt. Der Rabe legte denn Kopf schief, dann stieß er sich ab und flog mit zwei langsamen Schlägen seiner mächtigen, schwarzen Schwingen hinunter in den Innenhof. Niemand schenkte dem Unglücksvogel in der Hitze des Kampfes Aufmerksamkeit. Die meisten Augen waren beinahe panisch auf die Mauern und auf den Eckturm gerichtet. Ein Stimmengewirr bedeutete, dass die Ebenhöhe schon fast auf einem Niveau mit dem Wall war. Männer rannten die Treppen hinauf, frisch gefüllte Pfeilköcher über die Schultern geworfen. Andere schleppten Verletzte hinunter in die trügerische Sicherheit der wenigen langgestreckten Gebäude, deren Strohdächer noch nicht lichterloh brannten. Pfeile zischten im hohen Bogen über den Wall und versenkten sich in anonymem Fleisch. Pferde wieherten verzweifelt und schrill vor Angst. Rauch erfüllte die Festung.
Sévran schlich als dunkler Schatten an der uralten Mauer des Donjons entlang. Sein schlanker Leib klebte an den grob behauenen Steinen. Trotz des ganzen Aufruhrs vermied er es, auch nur das geringste Geräusch zu machen. Die geduckte Eichenpforte, die in den alten Wehrturm führte, stand unbewacht. Vorsichtig schob er den Riegel zurück und quetschte sich durch den engen Spalt. Genau so vorsichtig, wie er sie geöffnet hatte, schloss Sévran die Pforte wieder. Der Raum lag leer und dunkel vor ihm.
Mit einem leisen Schnippen der Finger der rechten ließ der junge Mann eine Feuerkugel entstehen. Sie mussten in großer Eile von hier verschwunden sein, denn die lange Leiter, die sie benutzten, um hinauf in den ehemaligen Wachraum zu klettern, lag achtlos auf den Boden geworfen vor ihm. Vorsichtig legte er die Feuerkugel auf den Stein. Dann hob er die Leiter auf und platzierte sie direkt unterhalb der Falltür. Genauso lautlos, wie er eingedrungen war, kletterte er nach oben und öffnete die Luke. Seine weichen Lederstiefel machten auf den hölzernen Dielen des Bodens kein Geräusch. Er wusste ganz genau, wo er hintreten konnte. Als er endlich neben Yann und Marguerite angekommen war, sank er langsam auf die Knie.
Die Ebenhöhe hatte beinahe den Außenwall erreicht. „Das Pech“, brüllte Charles de Penthièvre zu seinen Männern hinüber, „ versucht, sie mit dem Pech zu übergießen! Jetzt!“ Er selbst hielt den Bogen gespannt. Ein Brandpfeil lag bereit auf der Sehne und seine Augen fixierten eine wunde Stelle an dem Belagerungsgerät. Sie befand sich direkt zwischen der obersten Plattform und den Schießscharten der herzoglichen Bogenschützen.
Sein älterer Bruder Olivier hatte sich aus dem Staub gemacht. Alles, was der Jüngere der beiden Söhne von Marguerite de Clisson verstanden hatte, war das man ihm, der mit dieser ganzen üblen Geschichte überhaupt nichts zu tun gehabt hatte die Verteidigung von Champtoceaux gegen den wütenden Eber Richemont überließ: Seine Mutter und sein Bruder erwiesen sich wieder einmal als feige, kleine Intriganten. Und am Ende würde er die Suppe auslöffeln müssen!
Charles biss die Zähne zusammen. Das war ihre größte Chance, denn wenn es ihm jetzt gelang, seinen Pfeil genau in den dicken Hanfseilen zu platzieren, dann würde das hölzerne Gebälk in Flammen aufgehen, wie ein Haufen trockenes Reisig. Am Ende hing ihr Schicksal vom Mut und der Überzeugung jener Männer ab, die das brennende Gerüst vorwärts schieben mussten. Sollten sie es schaffen, sollte die Entfernung zwischen der Ebenhöhe und dem Wall stimmen, wenn sich die Zugbrücke der oberen Plattform rasselnd auf die Zinnen des Walles senkte, dann würde wildes Kriegsgeschrei den Anfang vom Ende von Champtoceaux signalisieren.
Was in Hunderten von Jahren weder die Nordmänner, noch die Engländer und die heimtückischen Franzosen geschafft hatten, war in dieser Stunde für den Bruder von Yann de Montforzh, Arzhur, den Eber von Breizh, in greifbare Nähe gerückt: die Bezwingung der Uneinnehmbaren an den Ufern der Loire!
„Jetzt!“ brüllte eine Stimme zu ihm hinüber. Bestialischer Gestank nach versengendem Menschenfleisch drang an Charles’ Nase. Er konzentrierte sich, spannte die Sehne bis zum Zerreißen. Das Holz seines Bogens ächzte und stöhnte vor Schmerz, dann schnellte sein Brandpfeil in die Stricke und eine Stichflamme erhellte für einen kurzen Augenblick die Nacht. Charles atmete tief und füllte seine leeren Lungen mit Luft. Er seufzte. Es war zu spät gewesen. Alle Anstrengungen waren vergebens. Der jüngere der beiden Penthièvre-Brüder ließ seinen Bogen sinken. Seine Augen starrten fassungslos auf die Ebenhöhe.
Von der obersten Plattform zischte und blitzte es und ein Hagel von eisernen Kugeln ergoss sich über den Verteidigern. Genau in diesem Augenblick signalisierte ein dumpfer Knall einen anderen Treffer der Bombarden. Schreie klangen vom nördlichen Wachturm an sein Ohr, als die Mauer von Champtoceaux brach und Angreifer und Verteidiger ohne Unterschied unter sich begrub. Die ersten Montforzh ergebenen Ritter drängen über die Zugbrücke der Ebenhöhe in seine Burg. Jene Verteidiger die nicht zu benommen oder zu verstört waren, versuchten im Gegenangriff den Belagerungsturm zu entern. Charles beobachtete entsetzt das grausige Schauspiel. Sie trafen auf der Zugbrücke waffenklirrend aufeinander. Beim ersten Zusammenprall flogen ein paar der Angreifer in die Tiefe und erschlugen, sterbend, mit ihren schweren Rüstungen ein paar der Knechte am Fuß der Ebenhöhe. Aus den unteren Etagen drängten mehr Angreifer nach oben. Rücksichtslos warfen sie diejenigen, die im blutigen Kampf zusammengebrochen waren über die Zugbrücke. Es war dabei ohne Bedeutung, ob ein Mann tot oder nur verwundet war.
III
Sie hatten ohne einen einzigen Zwischenfall den Gang erreicht. Genau in dem Augenblick, in dem Sévran, Montforzh und Marguerite aus dem Donjon in den Innenhof geführt hatte, war die Außenmauer mit einem lauten Krachen eingestürzt. Alle Augen waren auf die Kämpfenden auf der Ebenhöhe und auf den Wällen gerichtet. Marguerite und Yann konnten in der Dunkelheit nichts erkennen, das die abweisende Glätte der Mauer unterbrochen hätte, zu der Sévran de Carnac sie schweigend und bestimmt führte. Nirgendwo sahen sie eine Tür oder ein Tor, doch die Tatsache, dass der Sohn seines Verbündeten Ambrosius von Cornouailles es geschafft hatte, unbeschadet in die Festung hineinzugelangen, bewies dem Herzog, dass es diesen Weg offensichtlich geben musste.
„Vorsicht!“, flüsterte Sévran plötzlich scharf und hob die Hand. Sie blieben stehen und beobachteten, wie er, unter überhängendem Gestein fast verborgen, ein dichtes Efeugewächs mit der Rechten zur Seite schob. Er ging voran. Sie folgten ihm schweigend. Montforzh warf einen prüfenden Blick nach oben. Wachen waren nicht zu sehen: wozu auch, auf dieser nach der Loire hin gelegenen Seite der Festung, mit einem massiven, feindlichen Angriff, drüben auf der anderen Seite. Zum ersten Mal fiel eine bretonische Festung unter dem lauten, tiefen Grollen von bronzenen Bombarden. Montforzh wollte gerade noch einmal zurückblicken, als er plötzlich bemerkte das Sévran etwas in der linken Hand hielt, das den engen Gang beleuchtete. Mit der Rechten zog der Knappe seines Bruders einen langen, scharfen Dolch.
„Schnell!“ bedeutete er den beiden befreiten Geiseln knapp. Sie drängten sich an ihm vorbei in den engen, dunklen Schlund. Yann bemerkte, dass es keine Fackel war, die ihnen den Weg leuchtete, sondern eine kalte, blaue Feuerkugel in Carnacs bloßer Linker.
So schnell sie konnten, pressten sich die Drei durch den engen, abfallenden Gang unter der Außenmauer hindurch in Richtung auf den kühlen Luftzug, der andeutete, wo die andere Öffnung des geheimen Weges liegen musste. Es roch nach Schimmel und Feuchtigkeit. Man konnte das leise Schlagen der Wasser der Loire gegen ein felsiges Ufer bereits entfernt ausmachen. Die Schreie und der Lärm des Kampfes, der um die Festung der Familie Penthièvre entbrannt war, wurde von den Felsblöcken gedämpft, in die der Fluchtgang vor vielen Hundert Jahren einmal hineingetrieben worden war. Als der Weg sich seinem Ende zuneigte, quetschte Carnac sich an ihnen vorbei, als Erster nach draußen. Es war zwar unwahrscheinlich, dass dem Herzog und Marguerite an einer solch verborgenen Stelle noch Gefahr drohte, doch der junge Mann wollte offensichtlich erst ganz sicher sein, bevor er seinen beiden Schutzbefohlenen zurief, sie könnten auch ins Freie treten.
Er hatte den schmalen Pfad, der am Ufer entlang durch dichtes Strauchwerk führte entdeckt, nachdem er sich zum ersten Mal durch den geheimen Gang aus Champtoceaux hineingeschlichen hatte. Die Strecke war gefährlich. Geröll und Gestrüpp mussten überwunden werden. Das Ufer fiel steil ab. Die Loire floss an dieser Stelle reißend schnell. Sie war tief und verräterisch und selbst größere Boote hatten hart gegen sie zu kämpfen, um sicher an der Festung der alten Clisson vorbeizukommen. Von der Höhe fauchte grimmig der Lärm des Kampfes hinunter an den Fluss. Marguerite legte ihre Hand vertrauensvoll in die Hand von Sévran, während Yann ihnen vorsichtig folgte.
„Wir dürfen keine Zeit verlieren“, flüsterte der junge Carnac, „nur noch etwa fünfhundert Schritte trennen uns von Euren Männern und Mesire de Richemont. Wenn wir uns nicht beeilen, dann werden noch mehr aus Eurer treuen Miliz unten an der Ebenhöhe sinnlos verbluten!“
„Dieser Angriff ist nichts weiter, als eine Kriegslist!“ konstatierte Herzog Yann erschüttert.
Sévran presste fest Marguerites kleine Hand und zog sie weiter: „Ja, Mesire es ist nur eine List, damit ich in die Festung hineinschleichen und mit Euch wieder hinausschleichen kann.“
Marguerite verzog den Mund zu einem klugen, kleinen Lächeln. Sie wusste natürlich ganz genau, wie Sévran wirklich nach Champtoceaux hinein gekommen war, doch sie wollte ihr Geheimnis mit niemanden teilen. Sie erwiderten den Druck seiner Hand und folgte ihm weiter die steile Böschung entlang.
Endlich konnten die scharfe Augen des jungen Mannes im Schein der zahlreichen Feuer, die die Strohdächer der Festung genauso erbarmungslos auffraßen, wie die hölzerne Konstruktion des riesigen Belagerungsturmes, eine Ansammlung gerüsteter und gespornter Berittener auf schweren Kriegspferden ausmachen. Fahnen und Wimpel flatterten im Nachtwind, doch es war unmöglich zu erkennen, wessen Farben es waren. Nur eine einzige Kriegsfahne hob sich im Schein der Flammen ab: auf reinweißem Grund stand leuchtend ein gewaltiger, kupferroter und sehr zorniger Eber unter einer mächtigen Eiche: „Que qui le vueille!“ brüllte er.
„Mein Onkel“ rief Marguerite durch die Dunkelheit und noch bevor Sévran sie davon abhalten konnten, hatte sie sich von ihm losgerissen und rannte die letzten Schritte zu der Gruppe.
Arzhur de Richemont hatte die Stimme seiner Nichte trotz des unmenschlichen Lärms des Kriegstreibens gehört. Mit einem erstaunlich behänden Satz war er aus dem Sattel. Er breitete die Arme aus und presste nur wenige Augenblicke später den zierlichen Körper der jungen Frau fest gegen das harte Metall seines eisernen Brutspanzers.
„Meine süße, kleine Marguerite“, flüsterte er ihr glücklich ins Ohr. Doch sofort besann er sich seiner Pflichten. Er ließ sie los und schrie den Versammelten der Gruppe in schneller Folge Befehle zu. Pferde wieherten schrill, als ihre Reiter ihnen die Sporen heftig in die Flanken stießen und über das ebene Feld, nach vorne, auf die umkämpfte Festung zu stoben.
Sévran war ein paar Schritte zurück in die Dunkelheit getreten, als sein Ritter auf Herzog Yann zuschritt und sich tief vor ihm verbeugte: „Mein geliebter Bruder. Ich habe lange auf diesen Augenblick gewartet!“
Noch bevor Yann antwortete, rissen unzählige Ritter ihre Schwerter zusammen mit Arzhur de Richemont aus den Scheiden: “Montforzh. Montforzh. Malo au riche duc ! Gwenn Ha Du ! Malo au riche duc ! Gwenn Ha Du !“
Der harte Klang der Schwerter, die auf Schilde geschlagen wurden, übertönte plötzlich das Stechen und Sterben auf den Wällen von Champtoceaux. Richemont war vor Yann de Montforzh auf die Knie gesunken. Seine Augen glänzten und er hielt nur mit großer Mühe die Tränen der Freude und der Erleichterung zurück, als er seinem Bruder und Herzog den mächtigen Beidhänder als Zeichen der Treue und der Ergebenheit entgegenstreckte. Diese Geste Richemonts verwandelte die ritterliche Ehrbekundung für den Herren der Bretagne in tosenden Jubel und Freudengeschrei.
Alleine Marguerite bemerkte in diesem Augenblick der grenzenlosen Erleichterung und des Siegestaumels, wie eine dunkle Gestalt sich aufmachte heimlich in der Nacht zu verschwinden.
„Sévran!“
Anstatt ihn nur zurückzurufen, lief sie ihm einfach hinterher. Und dann ging alles ganz schnell. Er hielt inne und wandte sich zu ihr um. Ein erschöpftes, kleines Lächeln spielte um seinen schmalen Mund. Seine schwarzen Augen hielten die braunen Augen von Marguerite ohne zu blinzeln, fast genauso, wie die Rabenaugen es getan hatten. Vorsichtig, fast zögerlich ergriff sie seine Linke. Ein sonderbarer Ausdruck der Erleichterung überzog Marguerites Gesicht, als das Lächeln von seinem Mund auf seine Augen übersprang und sie mit einem Mal warm und lebendig werden ließ. Dann hielten die beiden jungen Menschen sich plötzlich eng umschlungen, ihr Kopf lag an Sévrans Brust und seine Wange auf ihrem Haar. Sie zitterte leicht und er zog sie enger an sich und küsste sanft ihr Haar: „Es ist vorbei, meine kleine Fee“, murmelte er leise, so dass nur sie ihn hören konnte, „es ist vorbei und niemand wird Dir je wieder Böses tun! Das schwöre ich Dir auf mein Leben. A ma vie!“
Sie gab keine Antwort, sondern hob leicht den Kopf von seiner Schulter und lächelte ihn an. Seine Lippen legten sich vorsichtig auf die ihren. Es war ein sanfter Kuss, nicht viel mehr als eine federleichte Berührung. Sie vergaßen die Welt. Es gab tausend Dinge die jeder dem anderen sagen wollte, doch sie sprachen sie nicht aus, sondern hielten sich nur fest in den Armen. Dann glitt Marguerites Hand von seiner Schulter in seinen Nacken. Sie streckte sich zu ihm hinauf und drückte ihre Lippen fest und bestimmt auf die Seinen. Sein Körper zitterte in ihren Armen genauso leicht, wie der Rabe es getan hatte, wenn sie ihn oben im Turm berührt hatte.
IV
Yann de Montforzh hatte den Mann nicht vergessen, der ihn und seine Tochter aus dem Donjon von Champtoceaux zurück in die Freiheit geführt hatte. Trotzdem war er ein wenig verwundert gewesen, als er beinahe zufällig Zeuge der kleinen Szene wurde, die sich am Rande der Gruppe um Arzhur und seine treuesten Seigneurs abspielte. Während sie ihm noch heftig zujubelten und die geglückte Befreiung ihres Herzogs durch ihren gerissenen Handstreich feierten, hielten sich dort, halb verborgen von der Dunkelheit und ein paar Pferden zwei junge Menschen in den Armen, ganz so als ob sie miteinander nicht nur einfach bekannt waren.
Diese zärtliche Umarmung sprach deutlich von tiefster Vertrautheit und noch deutlicher von so großer Zuneigung, dass selbst ein herzogliches Gebot sie nicht mehr brechen konnte.
In den zwei Jahren, die Sévran de Carnac seinem Bruder nun schon als Knappe gedient hatte, war es Yann niemals aufgefallen, dass der Sohn von Ambrosius de Cornouailles seiner jüngsten Tochter in irgendeiner Weise näher gestanden hätte, als jeder andere beliebige, junge Adelige an seinem Hof. Gewiss, sein kleines Mädchen zog die Ruhigeren unter ihnen den wilden, lauten Tunichtguten vor und gelegentlich hatte er bemerkt, wie sie sich zu Carnac gesetzt hatte, um seinen Lieder zuzuhören oder um ihm eine jener endlos langen, uralten und zutiefst melancholischen Geschichten in Versform zu entlocken, von denen er Hunderte auswendig zu kennen schien. Doch mehr hatte er nie bemerkt.
Yann de Montforzh seufzte, senkte den Kopf und schloss für einen kurzen Augenblick die Augen. Warum musste es ausgerechnet der Derwyddon sein? Warum hatte ihr Herz nur jenes unheimliche, dunkle und kalte Geschöpf gewählt, das aus einer anderen Welt und aus einer anderen Zeit stammte? Ausgerechnet jenen Sévran de Carnac, den möglicherweise kaum mehr als sein lebendiger Leib aus Fleisch und Blut an das Hier und Jetzt band und von dem gemunkelt wurde, er wäre tot zur Welt gekommen und erst durch eine uralte Magie unter den Sonnwendfeuern in der Johannisnacht zum Leben erweckt worden. Yann überlegte, doch eine Antwort konnte er nicht finden, nur eine Lösung: er sah eine ganze Reihe politischer Vorteile für die Bretagne am Horizont auftauchen, insbesondere ein verschwenderisch reiches Brautgeld in Form verschiedener befestigter Anlagen an der Küste. Er vermutete, dass Ambrosius seine Insel Bréhat vor der Pointe de l’Arcouest endlich an die Bretagne abtreten würde und möglicherweise auch Noirmoutier und die Ile de Yeu. Außerdem war Sévran selbst Baron von Carnac und damit Herr über eine der gewaltigsten Festungen an der ganzen Atlantikküste. Sie verfügte über hochmoderne Geschützbatterien, die Ambrosius erst kürzlich bei den Spaniern gekauft hatte und dominierte die Einfahrt in den natürlichen Hafen, der vor dem bretonischen Vannes lag. Wer diese Festung besaß, der hielt den gesamten Küstenstreifen bis hinunter nach La Baule und hatte die Macht über die gesamte Mündung der Loire.
Die Docks von Vannes und Nantes waren der Schlüssel des bretonischen Überseehandels, der sich durch die englische Besetzung der Normandie noch ausgeweitet und verstärkt hatte. Mit ihren geschützten Inlandhäfen waren die beiden Städte die Quelle des Reichtums der Montforzh und Yann als hartem Realisten durchaus die Hand einer Tochter wert. Außerdem verfügte der dunkle Hexenmeister aus dem Zauberwald von Brécheliant offensichtlich über viele, weitere Fähigkeiten, die sich in der gefährlichen Zeit, in der sie lebten als durchaus nützlich erweisen konnten. Und sonderbarerweise schien das kalte, unheimliche Geschöpf seiner kleinen Marguerite gegenüber sogar zu so etwas ähnlichem, wie Gefühlen fähig. Er schien sie gar... zu lieben!
Er würde seiner jüngsten Tochter ihren Willen lassen: Yann räusperte sich und brachte seine Gedanken wieder auf den Punkt.
„Herr! Mein Herr, Herzog und geliebter Bruder“, dröhnte Arzhurs tiefe Stimme durch den Aufruhr der siegestollen Seigneurs, „dieses Rattenloch ist verdammt! Eure Kämpen stürmen bereits über die Wälle. Euer schlimmster Feind ist gebrochen. Es ist nur noch eine Frage von wenigen Stunden und Champtoceaux, Clisson und Penthièvre werden Euch auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sein. Dieser Streich ist uns gelungen, weil das ganze Land sich zu Montforzh bekannt hat und alle ohne zu Zögern die Waffen ergriffen haben, kaum dass Eure edle Gemahlin Jeanne den Heerbann ausrufen lies. Doch das Unternehmen ist auch deswegen geglückt, weil einer der Unseren ohne zu Zögern bereit war, sein Leben in die Waagschale zu werfen, um zuerst die Schwächen der Festung zu erkunden und dann hineinzuschleichen und Euch zu befreien.“ Richemont deutete mit der eisenbewehrten Hand auf Sévran de Carnac und seine Augen leuchteten.
Zögernd und beinahe unwillig entließ Sévran, Marguerite aus seiner Umarmung. Als er den Kopf senkte, um sein Unbehagen über die Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwurde zu verbergen, fühlte er ihre kleine lebendige Hand in seiner Hand und spürte, wie sie ihn festhielt und ihm mit ihrer Geste Mut zusprach. Wenn Marguerite ihn nicht zurückgehalten hätte, wäre er schon lange irgendwo in der Dunkelheit verschwunden, wo weder Richemont, noch ein anderer wohlmeinender und überschwänglicher Mensch ihn hätte finden können. Der Gedanke daran, dass seine Rolle in der Befreiung von Montforzh in irgendeiner Weise bekannt werden könnte, beunruhigte Sévran in höchstem Maße. Er hatte sich von Arzhur de Richemont ausbedungen, dass man dieses Thema so schnell wie möglich wieder vergaß. Doch offensichtlich war sein Ritter aus irgendwelchen Gründen nicht bereit, sein Versprechen zu halten...
„Ein Schwert!“ Yann de Montforzh bedeutete dem Baron de Porhoët, der im Sattel eines schweren schneeweißen Normannen saß, ihm seine Waffe auszuhändigen. Dann sprach er zu Carnac. Seine Worte waren wohl gewählt und seine Stimme trug über das Kampfgetöse auf den Wällen von Champtocé. Die Seigneurs hatten sofort verstanden, was der Herzog zu tun beabsichtigte, darum zwangen sie ihre Streitrösser mit harter Hand und Sporenstichen einen Halbkreis um Yann, Richemont und den Erben von Cornouailles zu bilden.
Arzhur, dem die übermütige Freude über die Freiheit seines Bruders und den bevorstehenden Fall der Festung von Champtoceaux im Gesicht geschrieben stand, trat neben den jungen Mann. Seine eisenbewehrte Hand packte ihn mit unnachgiebig festem Griff an der Schulter. Marguerite strich im sanft über die Hand und flüsterte ihm ein paar aufmunternde Worte ins Ohr. Sévran seufzte leise und beugte sich schließlich dem Willen der jungen Frau und dem harten Druck seines Lehrmeisters. Er sank vor Herzog Yann auf die Knie. Die Worte, die nun von ihm erwartet wurden, waren ihm wohl bekannt. Er hatte sie in seiner Kindheit oft gehört, wenn einer der Knappen von Concarneau am Ende der Ausbildung den Ritterschlag erhielt.
V
Es war zwar bereits empfindlich kalt geworden, doch die Natur zeigte sich an den Ufern der Loire immer noch von ihrer besten Seite. Sie blinzelte in die strahlende Sonne an einem wolkenlosen, hellblauen Himmel und zog lediglich den langen, pelzverbrämten Mantel etwas fester um die Schultern. Yolande d’Aragón, die Herzogin von Anjou ließ sich auf einer kleinen Steinbank vor den Rosenbeeten nieder. Die letzten Blumen schimmerten noch immer dunkelrot, während die Blätter bereits braun und welk von den Büschen hingen. Sie bedeutete ihrer Tochter Marie, sich neben sie zu setzen. Dann legte sie ihr einen Arm um die Schultern der jungen Frau und zog sie enger an sich.
Marie war erst vor wenigen Tagen gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Dauphin Charles de Ponthieu und ein paar seiner Freunde aus Loques in Angers eingetroffen. Die beiden jungen Leute waren bereits im Alter von drei Jahren miteinander verlobt worden und Charles war zusammen mit Marie aufgewachsen, bis eine Laune seiner Mutter Isabeau de Bavière den damals Fünfzehnjährigen zurück nach Paris gezwungen hatte. Seit der Eroberung der Stadt durch die Burgunder und Charles‘ Rettung durch den bretonischen Renegaten Tanguy de Châtel, waren Marie und der Dauphin wieder vereint und das Mädchen hatte geschworen, ihrem Verlobten niemals wieder von der Seite zu weichen.
Marie war ruhiger und gelassener als Yolandes andere Sprösslinge. Ihr mangelte es sowohl an Scharfzüngigkeit, als auch am typischen Sarkasmus der Mitglieder des Hauses Anjou. Marie war auch weitaus weniger brillant und begabt. Sie besaß weder Yolandes Schönheit, noch die hohe Statur und die makellosen Gesichtszüge ihres Vaters, König Louis von Neapel und Sizilien. Doch dies tat der Zuneigung der Herzogin für ihre Tochter keinen Abbruch. Eher das Gegenteil war der Fall, denn die kleine, farblose und brave „Marie-Souris“, die Maus von Loques, wie man sie hinter ihrem Rücken nannte, war ihrem Gatten Charles trotz all seiner Fehler, Unzulänglichkeiten und Schwächen treu ergeben. Und sie verstand es gefällig und ohne Unmut über seine Eskapaden in den Betten anderer Frauen hinwegzusehen.
Maries offensichtlicher Mangel an Qualitäten hatte ihr erstaunlicherweise einen festen Platz an der Seite des Dauphins eingebracht. Nicht einmal im Rahmen geheimer Beratungen oder eines Regierungsrates wurde der jungen Frau die Tür gewiesen. Für gewöhnlich saß oder stand sie stumm und mit einem törichten Lächeln auf den Lippen irgendwo in der Nähe von Charles de Ponthieu und bewunderte ihn. Natürlich begriff Marie kaum, was sie hörte, doch Yolande kannte ihre Tochter genau und wusste ihr oftmals sinnloses Geplapper zu interpretieren und vermochte die für sie wichtigsten Informationen sorgsam aus dem Ganzen zu lösen. Die Einladung der Herzogin an ihre Tochter und ihren Schwiegersohn, ein paar Wochen in Angers zu verbringen, entsprang nicht nur einer Laune von Yolande, oder dem Verlangen die jungen Leute zu sehen. Gerüchte über verschiedene höchst gefährliche, politische Fehlentscheidungen des Dauphin, dessen Situation durch den Verrat von Montereau und den Verrat von Troyes bedenklich geworden war, hatten sie dazu bewogen einen Versuch zu unternehmen, ihren alten Einfluss am Hofe des Thronfolgers zurückzuerobern.
Früher, als Charles noch bei ihr gelebt hatte, hatte er immer ohne zu Zögern auf ihren Rat gehört und sich nach ihren Wünschen und Empfehlungen gerichtet. Doch damals war er noch ein Kind gewesen. Es schien Yolande so, als ob der Fall von Paris sämtliche Karten des Spiels um die Macht in Frankreich neu verteilt hatte: Schon alleine die Tatsache, dass Charles trotz seiner großen, finanziellen Not ein Leben in Loques ihrer Gastfreundschaft in Angers und ihren reich gefüllten Schatztruhen vorzog, unterstrich diese Tatsache. Sie betrachtete Marie von der Seite. Vielleicht hatte sie in ihrem Spatzenhirn ja die Lösung des Geheimnisses.
Vieles deutete darauf hin, dass der Dauphin von irgendjemandem dazu überredet worden war, Abstand zwischen sich und seine überaus mächtige, künftige Schwiegermutter zu bringen. Während der letzten drei Jahre hatte sie sich nur noch Maries bedienen können, um zu Charles vorzudringen. Mit einer knappen, herrischen Handbewegung schickte die Fürstin ihre Hofdamen und ihre beiden jüngsten Töchtern fort. Sie musste in Ruhe und ungestört mit Marie sprechen, wenn sie Antworten auf die Fragen finden wollte, die sie schon seit Monaten quälten.
Da gab es einmal das Gerücht von Charles‘ Verwicklung in das Komplott gegen Yann de Montforzh, den Herzog der Bretagne. Es war ein schlimmes Gerücht! Nach dem heimtückischen Mord an Jean Sans Peur, konnte es ihn das letzte Bisschen an Glaubwürdigkeit kosten, das er noch hatte.
Zuerst schwatzte Marie nur belangloses Zeug, doch ihre Mutter ließ sie geduldig gewähren. Die junge Frau war erst am Vorabend aus Loques in Angers eingetroffen und schien ein Verlangen zu haben, die neuen Kleider zu beschreiben, die sie zu ein paar Festen getragen hatte, die während des Herbstes zu Ehren der Helden von Baugé gefeiert worden waren. Danach kamen Tratsch und Klatsch über Menschen, von denen Yolande noch niemals zuvor in ihrem Leben gehört hatte. Sie nickte freundlich und ermunterte Marie trotzdem weiterzusprechen.
Endlich wandte ihre Tochter sich interessanteren Themen zu. Der überraschende Tod von Tanguy de Châtel, dem ehemaligen Provos von Paris und engstem Vertrauten ihres zukünftigen Schwiegersohnes war ein Rätsel, das sie alleine nicht zu lösen vermochte. Sie hoffte irgendwelche Schlüssel zu diesem Geheimnis in Maries Geplapper zu finden, denn offensichtlich hatte Charles bis jetzt noch keinen Grund gesehen, Tanguy als seinen militärischen Berater zu ersetzen. Aber er hatte sich trotzdem dazu durchgerungen, bei Baugé mit den Engländern zu kämpfen.
Yolande konnte sich einfach nicht vorstellen, dass der wankelmütige, blasse, mutlose und entscheidungsfaule Ponthieu alleine beschlossen haben konnte, alle seine Truppen einschließlich der Schotten gegen den Herzog von Clarence ins Feld zu schicken. Irgendjemand musste ihm ins Ohr geflüstert haben... Irgendjemand, der über ähnliche militärische Kompetenzen verfügte, wie der verstorbene de Châtel.
Marie-Souris versuchte gerade, ihr glaubhaft zu machen, dass der Teufel höchstpersönlich Tanguy abgeholt und in die Hölle eingeladen hätte. Eine alte Vettel, die die Kerzen in Loques anzündete, hatte es ihr erzählt. Yolande hätte ihre Tochter am liebsten kräftig durchgeschüttelt. Wie konnte eine erwachsene Frau nur solchem Unfug Glauben schenken?
Marie schien ihn nicht besonders gemocht zu haben, den Tanguy. Er war ein harter Kriegsmann gewesen, rau und ungeschliffen, dem die Feste und spielerischen Vergnüglichkeiten, mit denen Charles und sein Hofstaat sich die Zeit zu vertreiben pflegten, missfielen. Außerdem war er ungesellig und eigenbrötlerisch gewesen, hatte sich oft in seinen Gemächern eingeschlossen und dort gerumpelt und rumort. Die gleiche alte Vettel, die ihr von dem unheimlichen Treiben erzählt hatte, hatte ihr auch berichtet, dass sie einmal einen feuerroten Dämon durch Tanguys Kamin in den Nachthimmel habe fliegen sehen.
Yolande schüttelte wieder den Kopf über die Leichtgläubigkeit und Dummheit von Marie. Doch sie wagte es nicht, den Redefluss ihrer Tochter zu unterbrechen. Die Herzogin wusste, dass de Châtels größte Sorge seit dem Tag seiner Ankunft aus Paris in Loques immer nur der Bedrohung des Landes jenseits der Loire durch die Engländer und die Burgunder gewesen war.
Er hatte mehrfach versuchte, den Dauphin zu überreden eine Annäherung mit Montforzh und Ambrosius de Cornouailles zu versuchen, denn beide Fürsten hatten seit Azincourt ihr Spiel bedeckt gehalten und galten als neutral. Er war es auch gewesen, der Charles‘ Wahnsinnstat von Montereau vertuscht hatte.
Gelegentlich warf Yolande ein belangloses „Unglaublich!“’ oder „Nicht möglich!“ in die Konversation, um Marie am Laufen zu halten. Wahrlich, ihre Tochter war nicht die Schlaueste, doch sie besaß ein unwahrscheinliches Gedächtnis und grub dort mit jeder Stunde, die im Garten verging ein anderes Juwel aus. Die Herzogin hätte am liebsten laut und ungehobelt geflucht, wie die Söldner es zu tun pflegten, als ihre Tochter de Châtel noch einmal hart verdammte und als wüsten Schlagetot und heimlichen Nekromanten beschimpfte. Sie selbst hatte ihn gewiss nicht geliebt, den Provos von Paris und alle seine geheimnisvollen Plänkeleien mit der Schwarzen Kunst, doch alles was man der Herzogin zugetragen hatte, deutete darauf hin, dass er der Einzige in Ponthieus gesamtem Umfeld gewesen war, der nicht nur aus purem Eigennutz gehandelt hatte.
„John Buchan, Konnetabel von Frankreich“, murmelte Yolande leise, „was für ein blödsinniger Entschluss, ausgerechnet diesen Mann auszuwählen! Seine einzige Motivation es ist, Henry Lancaster zu schaden, damit sein eigener Vater Albany sich oben in Schottland anstelle der Stuarts ungestört auf den Königsthron setzen kann.“
Während Marie weiter plapperte und dabei ihren jüngeren Schwestern beim Spielen im Garten zusah, dachte die Herzogin von Anjou nach. De Châtel . Er war vielleicht nicht der bestmögliche Mann an der Seite von Ponthieu gewesen, doch um vieles besser, als alle anderen, die Charles‘ kleinen Hofstaat ausmachten und auf jeden Fall ehrlicher um Frankreich besorgt, als jener John Stuart, Earl of Buchan, der jetzt ungehindert das Schwert des Konnetabel in der Hand hielt. Doch was konnte sie dagegen unternehmen?
Während eine der beiden jüngeren Schwester der anderen mit einem seidenen Schal die Augen verband, kam Yolande plötzlich ein Name in den Sinn: Arzhur de Richemont, der Eber von Breizh... Der jüngste Bruder von Yann de Montforzh!
Wenn es gelingen würde, einen Mann vom Schlage Richemonts neben Charles zu platzieren, dann hatten sie vielleicht eine Chance sich gegen Lancaster zu stellen. Die Herzogin nickte. Ja, Richemont!
Sie würde einen Boten in die Bretagne schicken und Yanns Bruder bitten, sie in Angers aufzusuchen. Jetzt, wo die Penthièvres endgültig geschlagen und diese elende Farce der Entführung von Montforzh zu einem Ende gekommen war, konnte Arzhur es wagen sich auf den Weg an die Loire zu machen. Sein Bruder saß wieder fest im Sattel und regierte das Land unangefochten.
Eine der Hofdamen drehte gerade ihre jüngste Tochter beim Spiel ein paar Mal im Kreis, bis sie die Orientierung verlor und rannte dann selber weg, um sich einen verborgenen Platz zu suchen. Marie schmunzelte. Die Kleine stolperte verunsichert und mit weit nach vorne gestreckten Händen auf ein Rosenbeet zu. Die Mädchen, die sich vor ihr versteckten, warteten still, bis sie sehen konnten, dass die kleine Yolande ihren Irrtum bemerkt hatte. Dann rief eine von ihnen ganz leise: „Hier bin ich!“ und ihre jüngste Schwester drehte sich um.
Arzhur de Richemont! Charles würde einen Soldaten, wie ihn benötigen, falls er jemals den französischen Thron besteigen wollte, keinen selbstsüchtigen Ausländer, wie John Stuart, der eigene, königliche Ambitionen hegte und Frankreich lediglich als Schachbrett benutzte, auf dem er nur genug Figuren herumschieben musste, um seinen englischen Erzfeind und Widersacher Henry Lancaster von Schottland abzulenken.
„Sie wird eine ganze Weile brauchen, bis sie herausfindet, wo ihre Freundinnen sich verstecken“, bemerkte Marie d’Anjou belustigt und riss Yolande aus ihren Gedanken. Schließlich fing sie an, der Mutter von dem Tanzvergnügen zu erzählen, dass der junge Baron de Laval kurz nach dem Sieg bei Baugé anlässlich von La Hires Geburtstag veranstaltet hatte. Sie hatten sich köstlich amüsiert. Es war ein herrliches Fest gewesen und Laval hatte es an nichts fehlen lassen. Er hatte sogar eine Truppe von Schauspielern engagiert, die den Fall und Tod des Herzogs von Clarence nachstellten. Marie erwartete gespannt, was die Weihnachtszeit an neuem Zeitvertreib bringen mochte.
„Laval?“ Yolande blickte ihre Tochter neugierig an. Natürlich wusste sie, dass Marie vom jungen Enkel des berüchtigten Baron Jean de Craon sprach. Dieser bereitete den Ordensmitgliedern von Santiago Sorgen, seitdem ein aufgeweckter, junger Bruder von Saint Benoît seine Loyalität für Ambrosius de Cornouailles über seine Loyalität zur Heiligen Mutter Kirche gestellt hatte und durch ein vom Krieg zerrissenes Land geritten war, um vom Diebstahl einer sonderbaren Handschrift aus der Gruft eines Mannes zu berichten, der nachweislich einen Lapis Philosophorum geschaffen hatte. Dass der gleiche Alchimist mit Hilfe des Steins Blei in Gold verwandelt und auch noch herausgefunden hatte, wie man ihn gebrauchte, um auch die legendäre Lacta Philosophiae herzustellen, war das zweite, wichtige Detail.
„De Craon“, flüsterte Yolande, „immer wieder de Craon. Und jetzt hat er uns auch noch am Hof von Charles de Ponthieu einen üblen Floh in den Pelz gesetzt“, sie runzelte die Stirn.
De Craon war der Cousin jenes unsagbar schlechten und durch und durch verdorbenen George de la Tremoille, den der französische Thronfolger entgegen all ihrer guten Ratschläge in seine Dienste genommen hatte, nachdem er aus immer noch unbekannten Gründen von einem Tag auf den anderen Troyes und Isabeau de Bavière im Stich gelassen hatte.
Die Herzogin fragte sich schon seit geraumer Zeit, wie es möglich war, dass dieser Mensch Charles Geld lieh, wo man sich doch erzählte, er habe im Augenblick seines Abfalls von Isabeau de Bavière einen erheblichen Teil seiner Pfründe eingebüßt. De la Tremoille und der Vertrag von Troyes waren zwei undurchsichtige Themen. War der kleine, fettleibige Kerl gegangen, weil er dagegen gewesen war, Henry Lancaster auf den französischen Thron zu heben und dabei Ponthieu zu enterben und zum Bastard zu erklären? Oder war er gegangen, weil er in dem sich anbahnenden, gewaltigen Konflikt um die französische Erbfolge größeren Profit an der Seite von Charles erhoffte? Oder hatte ihn Jean de Craon gar über das Manuskript von Abraham Eleazar ins Vertrauen gezogen und die beiden Cousins planten eine eigene, undurchsichtige Intrige, von der niemand wusste?
Marie war so in ihrer Erzählung versunken, dass sie weder die leisen Worte ihrer Mutter gehört hatte, noch bemerkte, wie die feingliedrigen, schneeweißen Hände der Herrin von Anjou sich zu Fäusten zusammenballten.
„Nun, er muss wirklich ein außergewöhnlicher junger Mann sein, dieser Baron Gilles de Laval“, stimmte sie ihrer Tochter zu und lies nichts von der inneren Unruhe durchscheinen, die sich langsam in ihr aufbaute. Eine Kreatur, die von Jean de Craon und gewiss auch von George de la Tremoille manipuliert wurde, befand sich an der Seite von Charles de Ponthieu. Warum?
„Oh, er wird Euch sicher gefallen, Mutter“, schmunzelte Marie. Sie hatte Gilles de Laval vom ersten Augenblick an schrecklich gerne gemocht: er war hübsch, wortgewandt und immer gut gelaunt und vor allem machte er sich nie über sie lustig oder nannte sie hinter ihrem Rücken Marie-Souris. Gilles hatte Marie vom ersten Augenblick an respektvoll und freundlich behandelt. Oft schickte er ihr sogar kleine Aufmerksamkeiten; Sachen, die ein bisschen Farbe und Abwechslung in ihren Alltag in Loques brachten: ein paar bunte Blumen, wenn es draußen trüb und regnerisch war, oder einen Korb voller seltener Früchte. Einmal, als er bemerkt hatte, dass sie völlig niedergeschlagen und mutlos gewesen war, hatte er ihr einen wundervoll geschmiedeten Käfig mit einem Pärchen farbenprächtiger, kleiner Vögel aus dem Orient gebracht. Man nannte sie Papageien. Marie hatte vergessen ihn zu fragen, wie man an solch seltene Tiere kam, doch ihre Laune hatte sich sofort verbessert. Außerdem hatte Mesire Gilles bei Baugé bewiesen, dass er sich wacker schlagen konnte und ein Mann von Mut und Ehre war. Charles hatte ihn noch auf dem blutigen Feld zum Ritter geschlagen.
Marie konnte sich gar nicht mehr bremsen, ihrer Mutter alle Vorzüge und Qualitäten des jungen Mannes aufzuzählen und wortreich von ihm zu schwärmen. Dabei kamen Ponthieus alte Getreuen, La Hire, Xantrailles, Jean d’Olon und selbst Jean d’Alençon gar nicht gut weg. Ein schlimmer Gedanke durchfuhr die Herzogin von Anjou plötzlich Sie runzelte die Stirn und sah Marie tief in die Augen: „Kind, sei bitte ehrlich zu Deiner Mutter. Du hast doch nicht etwa... “
Marie brach in glockenhelles Lachen aus. Sogar ihre spielenden, jüngeren Schwestern hielten inne und starrten die Ältere entgeistert über diesen Ausbruch an.
„Oh, Maman! Wie könnt Ihr auf so einen Gedanken kommen. Ich liebe Charles. Er ist mein Leben. Mesire Gilles ist nur ......wundervoll und ich liebe ihn auch! Aber Gilles ist nicht so wie Charles“, dann senkte sie den Kopf und flüsterte Yolande ins Ohr, „Mesire Gilles ist zu allen Frauen charmant und freundlich, nur käme ihm niemals in den Sinn, zu einer von uns in der gleichen Weise charmant zu sein, wie er dies“, sie errötete leicht und senkte die Stimme noch weiter und konnte nur mit Mühe ein Kichern zurückhalten, „zu seinesgleichen ist... Er... Nun Ihr könnt Euch gewiss denken was ich sagen will, Maman!“
Yolande schluckte kurz und hart. Sie hatte einiges erwartet und sich bereits geistig darauf vorbereitet, von ihrer Tochter möglicherweise ein pikantes Geständnis anhören zu müssen. Doch diese Enthüllung warf sie völlig aus dem Gleichgewicht: Ein Sodomit! Der Enkel des widerlichen, alten Teufelsanbeters de Craon war ein Sodomit.
Sie schüttelte sich vor Ekel, obwohl sie den jungen Ritter noch nicht ein einziges Mal mit eigenen Augen gesehen hatte. Schon alleine der Gedanke an seine widernatürliche Neigung erfüllte sie mit tiefster Abscheu. Diese Kreatur, die de Craon und de la Tremoille neben ihrem künftigen Schwiegersohn etabliert hatten, gab seiner verbotenen Neigung so offensichtlich nach, dass es selbst ihrer naiven und etwas dümmlichen Marie nicht verborgen geblieben war. Und trotzdem erfreute er sich scheinbar in solch hohem Maß der Gunst ihres künftigen Schwiegersohnes, dass Charles ihn auf dem Schlachtfeld von Baugé mit eigener Hand zum Ritter geschlagen hatte.
Sie musste dringend mit Arzhur de Richemont sprechen! Arzhur de Richemont war ein Mann, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand. Sie musste umgehend dafür sorgen, dass jemand an Ponthieus Seite gestellt wurde, der üblen, widernatürliche Einflüsse von Frankreichs Thronerben fernhielt. In diesen Tagen, in denen das Schicksal des Landes an drei verschiedenen Fronten gleichzeitig gespielt wurde, war es von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit und das Überleben des Südens, genau zu begreifen, wer den Dauphin beeinflussen konnte und in welchem Maße. Charles herrschte seit dem Sieg von Baugé zwar unangefochten über ein Drittel von Frankreich, doch diese Herrschaft stand auf tönernen Füßen. Die Engländer hielten mehrere Festungen in der Beauce. Sie waren die Schlüssel zur Loire und zu den Gebieten, in denen Ponthieus Anspruch auf die Krone unangefochten akzeptiert wurde. Sie konnten ohne Schwierigkeiten Hand an Orléans legen und damit seine Herrschaft durch den Besitz einer einzigen, strategisch wichtigen Festung zerschmettern. Nicht nur Charles’ Krone hing davon ab, ob und wie lange er den Süden hielt, sondern auch das Überleben von Anjou. Auch wenn Cornouailles und Breizh mit ihren Seehäfen und mächtigen Flotten sich gemeinsam endlos lange jedem Versuch der Engländer widersetzen konnten... Anjou hatte alleine keine Chance. Die Herzogin straffte ihre Schultern. Der Entschluss war gefasst. Sie würde Yann de Montforzh bitten seinen Bruder so schnell wie möglich an die Ufer der Loire zu entsenden.