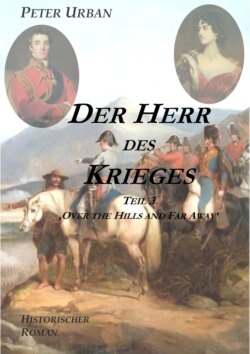Читать книгу Der Herr des Krieges Teil 3 - Peter Urban - Страница 3
Kapitel 1 Freneida
ОглавлениеIn der letzten Novemberwoche kam Wellington mit seinem 33. Regiment, dem Stab, dem Nachrichtendienst und den Ärzten in Freneida an. Niemand verstand so richtig, was er diesem trostlosen kleinen Nest in den Bergen eigentlich abgewinnen konnte, denn dem Sieger von Salamanca stand jeder Adelspalast Portugals weit offen. Doch Arthur wußte genau, warum er ausgerechnet an einem Ort überwinterte, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagten: Zum einen lag Freneida nahe der Frontlinie, direkt am Agueda. Wenn die Franzosen sich rührten, dann war er der Erste, der es erfuhr. Dann hielten ihm Abgelegenheit und Unzugänglichkeit all die leidigen und nutzlosen Störenfriede vom Hals, die ihn in Lissabon oder Oporto belästigt hätten: Dem Intriganten, dem Speichellecker, demjenigen, der um Vergünstigungen nachsuchte war der lange Weg hinauf in die Beira einfach zu anstrengend! Die drei Tage Zeitverzögerung zwischen Lissabon und seinem Winterquartier, gaben ihm zudem Zeit, alle Briefe, die er schrieb oder erhielt, sorgfältig zu überdenken. Und außerdem war die Gegend wunderbar, um mit einer Meute Hunde auf die Jagd zu reiten. Genau wie seine Leoparden, brauchte auch Wellington reichlich zu Essen, ein warmes Bett, angenehmen Zeitvertreib und ein bißchen Frieden, um sich von den Anstrengungen und Entbehrungen des Jahres 1812 zu erholen. Freneida war, in seinen Augen, hierfür ein idealer Ort.
Seit dem Vorjahr hatte sich das kleine Bergdorf, hoch oben in der Beira, in seinem äußeren Aspekt auch kaum verändert: Immer noch war alles ein bißchen zerfallen und bejahrt. Die wenigen Straßen zierten ein paar Löcher mehr, die die Einwohner notdürftig mit Steinen zugeworfen hatten und die Überreste der uralten Wehrburg, die Freneida umgaben wie eine Stadtmauer, hingen noch schiefer in der Landschaft als 1811. Die höchste Stelle der Ansiedlung zierte derselbe kreisrunde Wachturm mit dem Storchennest, in dem dasselbe Paar Schwarzstörche nistete, mit dem alle bereits bei ihrem ersten Aufenthalt auf dem Hochplateau Bekanntschaft gemacht hatten. Um das Dorf lagen auf Terrassen kleine Obstgärten, die sorgsamer gepflegt wurden als die Bauernhäuser. Sie wurden von Steinmauern gesäumt, die älter waren als die zerfallene Wehrburg und gleich hinter Freneida eröffnete sich eine weite, ursprüngliche Berglandschaft. Adler, Geier und andere große Raubvögel drehten ihre Kreise am Winterhimmel. Die meisten der umliegenden Gipfel überzog bereits eine schneeweiße Kappe. Die ganze Gegend war ein ständiger Wechsel zwischen schroffem Gebirge, Wäldern und kleinen Seen, reich an Wild und Fischen.
Zufrieden fand Arthur sein vertrautes Quartier des Vorjahres wieder und der Besitzer mußte nicht einmal mehr überredet werden, es dem alliierten Oberkommandierenden für die Dauer eines Winters abzutreten: Selbst in den abgelegenen Bergen der Beira hatte man das Grollen der Kanonen von Salamanca deutlich vernommen. Das Haus war eigentlich nichts Besonderes. Es ähnelte einer großen Bauernküche, mit dem Unterschied, daß darunter noch ein Stall lag. Außer der Küche und dem Stall gab es drei winzige Kämmerchen, einen zweiten, etwas kleineren Stall, den obligatorischen Obstgarten mit Apfelbäumen und einen Zugbrunnen im Innenhof. Vielen kam das Winterquartier, das Wellington sich ausgewählt hatte, notdürftig und spartanisch vor. Er selbst fand es gemütlich und familiär. Erleichtert ließ er sich in sein weiches, sauberes Bett in einem der drei kleinen Kämmerchen des ersten Stocks fallen. Er hatte den großen Schlüssel in der groben Holztür zweimal umgedreht und zuvor jedem seiner Adjutanten und allen Offizieren des Stabes geschworen, daß er sie eigenhändig teeren und federn würde, falls sie während der nächsten acht Tage auch nur auf die Idee kämen, sich mit einem Stück Papier in der Hand zu nähern. Während er sich unter seiner warmen Federdecke wie eine Katze zusammenrollte, war John Dunn bereits damit befaßt, die Schweine aus dem Erdgeschoß auszuquartieren und den größten Raum des Bauernhauses wieder in ein Arbeits- und Besprechungszimmer zu verwandeln, Paddy Seward begrüßte überschwenglich seine kleine Freundin Manuela, Vater Jack Robertson zog bei seinem Kollegen, dem Pfarrer von Freneida ins Pfarrhaus hinter dem Marktplatz ein, Kopenhagen und Elmore knabberten in ihrem vertrauten, trockenen Stall selig an frischem, fein duftendem Heu, während sie ihre müden Hufe im sauberen Stroh ausruhten, und Lady Lennox bemühte sich energisch darum, die letzten Spuren eines anstrengenden Feldzuges aus hüftlangem, dunkelbraunem Haar zu entfernen, um sich wieder in ein ansprechendes weibliches Wesen zu verwandeln.
Pünktlich, eine Woche später, tauchte ein gutgelaunter, ausgeruhter und umgänglicher alliierter Oberkommandierender beim ersten gemeinsamen Abendessen des Stabes und der Offiziere des 33. Regiments auf. Das sogenannte ‚große Besprechungszimmer’ war in eine Art Speisesaal verwandelt worden. Der Geruch nach Hausschweinen hing zwar immer noch ein bißchen in allen Ritzen und Winkeln, doch niemand störte sich daran. Um einen langen Tisch aus ausgehängten Türen und Brettern, der sich unter einer Last aus Schüsseln und Terrinen bog, drängelten sich fast 40 Personen. John Dunn hatte bei allen Nachbarn Stühle ausborgen müssen. Tom Picton war mit seinen jungen Adjutanten und Oberst John Colborne, den er von Black Bob Craufurd geerbt hatte, aus Moimento de Beira herübergeritten, um dem Jefe ein paar Tage Gesellschaft zu leisten und ein wenig auf die Jagd zu gehen. General Castaños und Don Julian Sanchez hatten ebenfalls beschlossen, den Abschluß eines anstrengenden, aber erfolgreichen Jahres gemeinsam mit ihren Freunden zu feiern. Arthur bemerkte, daß Lady Lennox zusammen mit Picton und McGrigor in einer Ecke des großen Raumes stand, angeregt mit den beiden alten Herren diskutierte und sich gut zu amüsieren schien. Die Drei lachten und ihre Portweingläser schlugen aneinander. Sarah trug das enge, dunkelgrüne Samtkostüm, in dem er sie so gerne sah, hatte ihre kleinen
Perlen in den Ohren und das dunkle Haar locker hochgesteckt. Sie sah bezaubernd aus. Als sie ihn entdeckte, zwinkerte sie ihm spitzbübisch zu. Seine ganze Familie war versammelt. Es war an der Zeit, alle Mißverständnisse und Unstimmigkeiten der letzten Wochen zu begraben und gemeinsam in die Zukunft zu schauen. Lord Wellington gab Sergeant Dunn ein kurzes Zeichen, dann blickte er entwaffnend in die Runde: „Ladys and Gentlemen! Ich kann Ihnen mitteilen, daß 1812 trotz des Rückzuges auf Ciudad Rodrigo ein gutes Jahr für unsere Armee war! Wir haben weit mehr erreicht, als ich zu hoffen gewagt habe. Unsere Verluste halten sich in angemessenen Grenzen. Die britische Regierung ist sehr zufrieden mit uns allen, und viele Probleme, mit denen wir in den ersten Jahren dieses Krieges konfrontiert wurden, haben sich in Luft ausgelöst!” Zwei der Waschfrauen des 33. Regiments boten allen Anwesenden Champagner an. Mary Seward nahm ein wenig verlegen ihr Glas vom Tablett. Robin hatte bei Salamanca nicht nur einen feindlichen General gefangengenommen, sondern auch den Adler eines französischen Regiments erbeutet. Sie war nun die Frau eines Majors. Man lud sie in die Offiziersmesse ein und behandelte sie mit Respekt. Sie hatte sogar ein junges spanisches Dienstmädchen, das ihre Wäsche wusch und ihr alle groben und anstrengenden Arbeiten abnahm, und Rob teilte sich mit einem anderen Offizier einen Burschen. Mary trug zwar, weil es so praktisch war, wochentags immer noch eine rote Soldatenjacke und einen schwarzen Rock, aber nun war es eine Jacke, die man eigens für sie genäht hatte und nicht mehr eine Abgetragene von Rob. Und in Madrid hatte Major Seward ihr vom Preisgeld sogar ein hübsches schwarzes Kleid aus richtigem Samt geschenkt. Sie trug es, wenn sie in die Kirche ging, oder in die Offiziersmesse eingeladen wurde. Während sie vorsichtig das schwere Kristallglas, genau wie Donna Ines und Lady Lennox am Stiel festhielt und abwartete, was folgen würde, bemerkte Mary aus dem Augenwinkel, daß Lord Wellington sie amüsiert beobachtete. Bereits in Madrid hatte er sich einen Spaß daraus gemacht, sie und Rob ähnlichen Prüfungen zu unterziehen. Einmal war er sogar so weit gegangen, Major Seward und seine Gemahlin zu einem Empfang des Bürgermeisters, mit anschließendem Ball abzukommandieren und bei der Vorstellung im Prunksaal des alten Rathauses an der Plaza Mayor mit fast sadistischer Freude jedem spanischen Notabeln, den er in die Finger bekam, Robs Heldentaten bei Badajoz und Salamanca zu schildern und hinterhältig darauf hinzuweisen, daß Miss Seward hervorragend Spanisch sprach. Fast im Reflex warf die schottische Bauerntochter dem irischen Adelssprössling einen strafenden Blick zu. Arthurs Grinsen wurde noch breiter. Seit Badajoz war er sich sicher, daß es kein Fehler gewesen war, einen einfachen Mann aus den Rängen so schnell, so weit nach oben zu befördern, obwohl er im Regelfall nicht die allerbeste Meinung vom Charakter seiner Soldaten hatte. Wenn sie ihm entglitten und wie bei Badajoz oder während des Rückzuges auf den Agueda zu reißenden, unkontrollierbaren Bestien wurden, war er in seiner Wortwahl nicht gerade zimperlich: „Ihr seid der Abschaum der Erde!”, urteilte er dann; eisig, distanziert, überlegen, verachtungsvoll. In diesen Momenten hörten die Leoparden die Stimme eines Mannes, der über eine unüberbrückbare Kluft zwischen sich und den Ungebildeten hinweg sprach. Was die Mehrheit seiner Männer anbetraf, hatte Arthur mit diesem vernichtenden Urteil meist auch Recht, denn sie entstammten der untersten Schicht der britischen Bevölkerung und waren nur in den regulären Dienst eingetreten, weil sie ansonsten keinen Ausweg mehr gesehen hatten, um überhaupt einen Lebensunterhalt zu verdienen oder ungestraft der Justiz zu entkommen. Doch mehr als 25 Jahre des ständigen, engen Zusammenlebens mit diesem ‚Abschaum der Erde’ hatten ihn gelehrt, daß man, wenn man es verstand, die Spreu vom Weizen zu trennen weiß, von Zeit zu Zeit Einen fand, der es wert war, seinen Weg nach oben zu machen. Der General wußte, mit welchen Vorurteilen diese Männer oft von Seiten der Ränge und auch von Seiten ihrer neuen Offizierskollegen aus der Oberschicht oder dem Adel zu kämpfen hatten. Sie gehörten nicht mehr zur einen Gruppe und würden nie richtig von der anderen akzeptiert werden. Dazu war die britische Gesellschaft zu sehr in zwei Klassen gespalten. Aus diesem Grund hatte er sich in Indien zurückgehalten, wenn es um Beförderungen einfacher Soldaten ins Offizierskorps ging. Er hatte damals noch nicht die Macht gehabt, zu schützen, wo Schutz notwendig war. Heute jedoch war seine Stellung in der britischen Armee und in der Gesellschaft seines Landes so einzigartig und abgehoben, daß niemand mehr wagte, ihm zu widersprechen. Die raren Perlen, die er in seinem riesigen Schweinestall fand, den man gemeinhin als das anglo-alliierte Feldheer bezeichnete, beförderte er nun, wenn er das Gefühl hatte, daß sie eine Bereicherung für das Offizierskorps darstellten. Er wußte, daß der Respekt, den man ihm zollte, sich auch auf seine Schützlinge übertrug. Rob war sein erstes Experiment gewesen!
Wellington erinnerte sich noch genau daran, wie sein Regiment an Sergeant Seward gekommen war: Er hatte anstelle seines ältesten Bruders, der der Hoferbe war, Dienst in der Yeomanry des County Paisley geleistet. Viele brave Bauernsöhne taten dies, wenn sie den Hof des Vaters nicht übernehmen konnten. Es war ein Weg, um ein bißchen Geld dazuzuverdienen, ohne die Heimat verlassen zu müssen. Meist reichten fünf Jahre Dienst aus, um genug für eine ordentliche Pacht angespart zu haben. Kurz bevor das 33. Regiment sich auf den Weg nach Indien machen sollte, hatten die Landstreitkräfte dann unter einem großen Mangel an Unteroffizieren gelitten. Sie hatten damals jungen, bewährten Männern aus den sogenannten Home Forces angeboten, mit dem Dienstrang eines Sergeanten in die reguläre Truppe überzuwechseln, wenn sie Lesen, Schreiben und Rechnen konnten, zwei Jahre Dienst und einen guten Leumund vorwiesen. Es war einer der ersten Reformversuche des Herzogs von York gewesen, nachdem er von Lord Amherst den Posten des Oberkommandierenden der Landstreitkräfte übernommen hatte. Rob war ein abenteuerlustiger, kräftiger, junger Bursche gewesen. Die Aussicht, ein wenig die Welt zu sehen, bevor er sich endgültig niederließ und Schafe züchtete, hatte ihn dazu veranlaßt, sich freiwillig für den Dienst in einem Hochlandregiment zu melden. Das 93. Regiment von Lord Wemyss of Wemiss, das unweit von Grennock, in Glasgow seinen Stammsitz hatte, benötigte dringend Sergeanten. Der Rekrutierungsoffizier teilte Seward dieser Einheit zu. Doch irgend jemand aus der Militärverwaltung machte dann einen dummen Schreibfehler und auf dem Marschbefehl des frischgebackenen Unteroffiziers wurde aus der Zahl 93 plötzlich die Zahl 33. Als Rob, seinen Marschbefehl in der Tasche, das Gepäck in der Hand, gefolgt von seiner siebzehnjährigen Ehefrau Mary beim Garnisonskommandeur von Glasgow vorsprach, drückte der ihm – ohne groß nachzudenken – eine Transportorder für das Postschiff nach Irland in die Hand. Vierzehn Tage später meldete der Sergeant sich pflichtbewußt, wenn auch ein wenig erstaunt bei Oberstleutnant Wesley in der Garnison von Dublin zum Dienst. Das 33. sah ganz und gar nicht nach einem schottischen Regiment aus. Arthur bemerkte natürlich sofort den Fehler. Doch Seward hatte einen guten Eindruck auf ihn gemacht und dem 33. mangelte es genauso sehr an Unteroffizieren, wie dem 93. Nachdem der Zahlmeister sich davon überzeugte, daß Rob wirklich vernünftig Lesen, Schreiben und Rechnen konnte, war der Oberstleutnant noch weniger bereit, einen ordentlichen, jungen Sergeanten wieder zu seinem richtigen Regiment zurückzuschicken. Die Freiwilligen aus der Yeomanry wurden höflich behandelt. Sie waren ein rares Gut, um das die Obristen der regulären Armee sich stritten. Wesley machte da keine Ausnahme. Sehr diplomatisch wurde Rob gefragt, ob es ihm etwas ausmachen würde, beim 33. in Irland zu bleiben, oder ob er darauf bestand, daß man ihn zurück nach Glasgow in die heimatlichen Berge schickte. Weniger diplomatisch ließen Robs künftige Kameraden anklingen, daß bald eine abenteuerliche Reise nach Indien bevorstand. Er und Miss Mary waren jung und unternehmungslustig. Sie waren aus ihrer Heimat noch nie herausgekommen und wollten etwas anderes sehen als Grennock. Sie erklärten dem Oberstleutnant, daß sie eigentlich lieber bleiben würden. Das 33. Regiment hatte sich nach dieser Entscheidung zwar noch schriftlich mit den Kollegen aus Glasgow herumstreiten müssen – das 93. wollte seinen Sergeanten zurückhaben, das 33. berief sich auf den Marschbefehl –, doch am Ende schrieb Oberstleutnant Wesley sehr höflich an General Wemyss of Wemyss und man einigte sich gütlich. Rob blieb in Irland. Die Schotten suchten sich einen anderen Mann und alle waren zufrieden! Schnell stellte man fest, daß man einen guten Griff getan hatte. Bei Seringapatam bewies der Schotte dann, daß er sich nicht nur vernünftig um die Regimentsbuchhaltung kümmern konnte, sondern auch ein guter Frontsoldat war. Bei der Rückkehr aus Indien war er bereits, anstelle von John Dunn, Sergeant-Major und Zahlmeister des 33., den Weg nach Hamburg und nach Dänemark machte er als Stabsunteroffizier von General Wellesley. Als Rob nach Fuentes de Onoro ganz alleine General Eblé, den Kommandeur von Almeida gefangen nahm und damit die Fehler von zwei Offizieren im Generalsrang gutmachte, akzeptierten sowohl Offiziere als auch Mannschaften überraschend widerstandslos Lord Wellingtons Entscheidung, ihn zum Leutnant zu befördern. Bereits als Sergeant-Major war er in seiner ruhigen und ausgeglichenen Art der gute Geist des Regiments gewesen. Als Leutnant änderte er seinen Arbeitsstil um keinen Deut. Seine Leistungen vor Badajoz und bei Salamanca sprachen danach bereits für sich selbst. Außerdem konnte man weder den Schotten noch seine Frau dem zuordnen, was gemeinhin als Unterschicht bezeichnet wurden. Sie stammten beide aus alten bäuerlichen Familien, die über eigenes Land verfügten und nur den Laird zum Herren hatten. Beide konnten Lesen und Schreiben, und tief geprägt vom kalvinistischen Glaubensgut, verabscheute Rob das, was gemeinhin ein Problem in den Streitkräften war: Den Alkohol! Nun mußte Arthur seinem Protegé und Miss Mary nur noch ein paar alte Verhaltensformen aus Grennock abgewöhnen und die beiden würden schon bald der Stolz des Regiments sein. Und an dem Tag, an dem ihr kleiner Paddy sein Fähnrichspatent bekam, hatten dann sicher bereits alle vergessen, daß sein Vater nur der Sohn eines Bauern aus den wilden schottischen Bergen war. In Madrid hatten die Sewards sich tapfer geschlagen, als er sie mit den Notabeln der alten, spanischen Hauptstadt konfrontiert hatte. Trotz der schwierigen Bedingungen des Feldzuges, beobachtete er, wie sorgsam Mary und Rob sich um die Erziehung ihres einzigen Kindes kümmerten. Die Drei waren es wert, daß man für sie Schicksal spielte! Der General wandte seine Aufmerksamkeit erneut seinen zahlreichen Gästen zu: „Der südliche Teil Spaniens ist nun von den Franzosen befreit. König Joseph hat zwar versucht, Madrid wieder einzunehmen, doch seine Niederlagen haben ihn so diskreditiert, daß nicht einmal der fanatischste Afrancescado noch an ein Haus Bonaparte in Spanien glaubt. Große Teile Nordspaniens werden von den irregulären Armeen Minas y Espozas und Mendizabals kontrolliert und“, er griff in seine Rocktasche und zog ein Schreiben von Robert Castlereagh hervor, „General Bonaparte hat im Verlauf seines letzten Abenteuers fast 600.000 Mann verloren! Der Feldzug gegen Zar Alexander war ein Fehlschlag. Die ‚Grande Armée’ ist auf dem besten Weg, in Rußland zugrunde zu gehen! Der Korse hat am 14. September den Rückzug aus einem zerstörten Moskau angeordnet. Ihre russischen Kameraden Kutuzov, von Wittgenstein, Barclay de Tolly und Chichagov treiben den Feind auf die Grenze zu.” Er hob sein Glas: „Hoffen wir, daß dieser furchtbare Krieg bald zu Ende geht. Mit ein bißchen Glück werden wir den nächsten Winter bereits in den Pyrenäen verbringen!”
Wellingtons Eröffnung, was Napoleon Bonapartes Fehlschlag in Rußland anbetraf, hatte den gewünschten Effekt. Laut und aufgeregt fingen alle Anwesenden an, durcheinanderzuschnattern. Man hörte den glockenhellen Ton aneinanderschlagender Kristallgläser. Der Verlust von mehr als einer halben Million Soldaten im Osten bedeutete, daß Frankreich nicht in der Lage war, große Truppenkontingente zur Verstärkung König Josephs über die Pyrenäen zu schicken. Für den General und die britische Regierung hatte sich die entscheidende Frage immer um diesen Punkt gedreht, denn egal, wie geschickt ein Feldheer geführt wurde und wie furchtlos seine Soldaten kämpften, es war unmöglich, einen Gegner zu schlagen, der über eine acht- oder zehnfache Übermacht verfügte. Zufrieden verschwand Arthur zu Picton und Sarah. Obwohl dieser Dezembertag durch die guten Neuigkeiten aus Whitehall zu etwas ganz besonderem geworden war, wollte er doch nicht an der Tradition seiner familiären und informellen Abendessen rütteln. Sie waren dazu da, daß alle freimütig und offen miteinander sprechen konnten, ohne auf die militärische Rangordnung zu achten. Sie waren eine Art Ventil, das der General geschaffen hatte, um Konflikte und Spannungen abzubauen, die sich aufstauen konnten, wenn man unter großem Erfolgsdruck arbeiten mußte. Sein Stab war so klein, daß er einfach nicht zulassen konnte, daß irgendeiner sich unnötigerweise vor ihm fürchtete und nicht wagte, offen Probleme anzusprechen, die vielleicht das Funktionieren der ganzen Militärmaschine störten. Dies war auch der Grund, warum er Sitzordnungen verabscheute und selbst entweder nur sehr freimütig oder über ganz alltägliche Dinge sprach. Oft verzog er sich aber auch einfach auf einen nicht exponierten Sitzplatz, schwieg, beobachtete und hörte aufmerksam den Eingeladenen zu. Picton packte ihn am Arm und flüsterte ihm ins Ohr: „Obwohl du uns einen fürchterlichen Kinnhaken versetzt hast, mit deinem üblen Schrieb vom 28. November, haben sich doch alle wieder ganz schnell beruhigt. Ich habe das Gefühl, daß dieser Wutausbruch sogar sein gutes hatte: Meine zwei unfähigsten Offiziere sind auf eigenen Wunsch nach England zurückgekehrt. Sie haben ihre Entscheidung innerhalb von nur zwei Tagen getroffen ... Und es geht bereits das Gerücht, daß du bald einen ähnlichen Wunsch von Sir William Erskine vorgelegt bekommst!”
Der Ire rieb sich zufrieden die Hände. Vielleicht gab es doch eine höhere Macht, die seine Stoßgebete erhört hatte und die Erfahrungen des grausamen Rückzuges auf die portugiesische Grenze überzeugten die, die unfähig waren, ihre Plätze in seinem Feldheer für bessere Männer freizumachen. Er würde dem wahnsinnigen Sir William keine Träne nachweinen! Ermutigt durch den Klatsch aus der Dritten Division, ging ihm plötzlich durch den Kopf, wie er seinen unfähigen Generalquartiermeister Sir James Gordon auf diplomatische Art und Weise und ohne böses Blut loswerden konnte. Er entschuldigte sich bei Picton und wandte sich an Sir James McGrigor, seinen Generalinspekteur der Hospitäler: „Mc, können Sie mir einen kleinen Gefallen tun?“
Der Schotte sah Lord Wellington neugierig an. Irgend etwas im Gesichtsausdruck seines Gegenübers ließ den Mediziner aufhorchen.
„Nehmen wir mal an, Sie würden jetzt Ihr Glas nehmen und ganz unauffällig zu Oberst Gordon hinüber schlendern”, fuhr der Ire hinterlistig fort und Picton grinste bereits, „und Sie würden ihn in ein unverfängliches Gespräch verwickeln. Sie wissen schon, über diese schlimmen Krankheiten, die man sich im Sommer in Spanien einfangen kann – Guadiana-Fieber, die ekeligen Hautausschläge und Ringwürmer ...! Sie können das nämlich ganz hervorragend! Erinnern Sie sich noch, wie Sie Picton und mir letztes Jahr innerhalb von fünf Minuten den Appetit für eine ganze Woche verdorben haben?”
McGrigor schnalzte mit der Zunge: „Sie meinen, ich soll den Herrn davon überzeugen, daß er sicher des Todes ist, wenn er nicht schleunigst um Heimaturlaub bittet?”
Arthur nickte. In seinen graublauen Augen blitzte der Schalk. Der schottische Mediziner zog ihn näher an sich. Der Hals von Thomas Picton wurde immer länger. Er wollte die Pointe nicht verpassen. „Keine Sorge! Ich werde den guten Mann schon zu überzeugen wissen, daß er sich beim Rückzug irgend etwas eingefangen hat. Ich finde, er hat eine ungesunde Gesichtsfarbe ... und wie ich Gordon kenne, rennt der Ihnen in zwei oder drei Tagen die Tür ein und bittet um Heimaturlaub, weil er mit einem Mal fürchterlichen Schmerzen spürt und sich ganz dringend in England auskurieren lassen muß.”
Wellington schickte seinen Generalinspekteur der Hospitäler erwartungsvoll an die Front. Wenn Gordon erst einmal auf der anderen Seite des Atlantiks war, würde er sich schon selbst zu helfen wissen, um ihn auch dort zu halten. Thomas Picton gelang es nur noch mit großer Mühe, ernst zu bleiben. Sie waren nicht mehr weit von ihrem gemeinsamen Ziel entfernt, die Franzosen aus Spanien fortzujagen und der Jefe schien zu jeder Schandtat bereit, um 1813 wirklich bis an die Pyrenäengrenze zu kommen. Wenn es sein mußte, stiftete er sogar den alten Mac an, um einem unfähigen Offizier eine nichtexistierende Krankheit einzureden. „Mit seiner Spanienerfahrung wäre Gordon doch der geeignete Mann, um Militärberater in Venezuela zu werden!”, flüsterte er Wellington ins Ohr.
„Generalissimo Miranda wäre von den organisatorischen Fähigkeiten meines ehemaligen Quartiermeister-Generals sicher begeistert!”, war die zynische Antwort.
Zusammen mit Robert Castlereaghs Brief aus London, war auch ein Schreiben von Arthurs Bruder Henry aus Cadiz angekommen: Nach der Befreiung von Madrid hatte man die Höchste Junta durch liberale Cortes ersetzt. Dieser hatte nicht nur sofort eine neue liberale Verfassung verkündet, sondern auch beschlossen, Lord Wellington zum Supreme Generalissimo aller spanischen Armeen zu ernennen, ihm das Herzogtum von Ciudad Rodrigo und einen feudalen Landsitz bei Granada – Soto de Roma – zu schenken und ihm den Orden vom Goldenen Vlies zu verleihen. Großbritanniens höchster Offizier auf der Iberischen Halbinsel war immer noch dabei, diesen wahren Tropensturm an Ehrungen und Auszeichnungen, der sich völlig unerwartet über ihn ergossen hatte, zu verdauen. Doch die Medaille hatte auch eine Kehrseite! Und die sah nicht sonderlich ermutigend aus: Wellington hatte genau das bekommen, was er nie angestrebt hatte und worauf er persönlich nicht den geringsten Wert legte: Einen pompösen Titel, ein totes, goldenes Schaf, das man sich an einem unpraktischen Samtband um den Hals hängen mußte und einen Landsitz, der so riesig war, daß alleine die Steuern für den Obstgarten ihn vermutlich ruinierten! Doch seine Befehlsgewalt beschränkte sich auf rein militärisch-operative Belange. Der General hatte eigentlich darauf gehofft, daß die iberischen Verbündeten sich dazu durchringen würden, ihn mit der spanischen Armee genau das machen zu lassen, was Sir John Beresford – auf seine Anregung hin – so erfolgreich mit den Portugiesen getan hatte: Sie vernünftig auszubilden, ihnen eine Hand voll erfahrener, britischer Offiziere beizustellen und die gesamten Landstreitkräfte zu reformieren. Er brauchte auf Seiten seiner Alliierten vernünftige Soldaten und 100.000 Spanier, die kämpfen und manövrieren konnten, waren der entscheidender Faktor für einen schnellen und endgültigen Sieg über Frankreich auf der Pyrenäenhalbinsel. Nur mit ihrer Hilfe konnte er den Prozeß beschleunigen, den er unter unendlichen Mühen und Gefahren bereits 1808 eingeleitet hatte. Arthur spürte bereits seit dem Fall von Badajoz, daß er am Ende die Adler vertreiben würde. Doch wenn lediglich Briten, Portugiesen, Castaños, Morillo und die Guerilla kämpften, dann rechnete er mit zwölf Monaten, die zusätzlich vergehen würden, bevor der letzte Franzose hinter den Pyrenäen war. Er beschloß, für einige Wochen nach Cadiz zu reisen und zu versuchen, die Cortes umzustimmen. Er wollte reiten, sobald er das Gefühl hatte, daß die 500 Meilen im Sattel ihn nicht umbrachten.
Obwohl er an diesem Abend ein tapferes Gesicht aufsetzte und allen seine legendäre Unverwüstlichkeit vorspielte, hatte er doch mehr unter dem letzten Feldzug gelitten, als er offen zugeben konnte. Damit stand er offenbar nicht alleine da: Vor dem Abendessen hatte er einen kurzen Blick auf die Appellstärke seines Feldheeres zum 1. Dezember 1812 werfen können und wäre vor Schreck dabei fast umgefallen: In 64 britischen Bataillonen waren nur 30.397 Soldaten und Offiziere zum Dienst angetreten. 13 Bataillone hatten mehr kranke Männer als Soldaten unter Waffen und zwölf waren auf eine Ist-Stärke von unter 300 Mann abgefallen. Die restlichen 18.000 Leoparden bevölkerten hustend, fiebernd, mit triefenden Nasen und geschwollenen Mandeln die Lazarette bis hinunter nach Lissabon. Und selbst bei der Kavallerie plagten Grippe und Halsschmerzen 1500 Reiter, ganz abgesehen von 700 Pferden, die auch alle irgendwelche Wehwehchen hatten. Seine 15 Veterinäre waren offensichtlich genausobeschäftigt wie seine Humanmediziner. Von den Verwundeten der Schlacht bei Salamanca abgesehen, waren die Krankheiten zwar nicht ernst, aber doch ausreichend, um allen – vom Chef bis hinunter zum Trommlerjungen – eine lange, lange Ruhepause zu gönnen! Kurz vor Mitternacht verabschiedeten die Gäste sich.
John Dunn warf der ganzen Unordnung, die fast 40 Personen in dem verhältnismäßig kleinen Raum zurückgelassen hatten nur einen verächtlichen Blick zu. Das Geschirr und die Gläser würden bestimmt nicht die Flucht ergreifen, wenn er sich jetzt schlafen legte und erst morgen aufgeräumt wurde. Er schickte die Waschfrauen des Regiments in ihre Quartiere, wünschte seinem General und Lady Lennox eine gute Nacht und zog sich, zufrieden über den erfolgreichen Abend, in seine Kammer zurück.
„Endlich allein!”, seufzte Sarah. „Laß uns schlafen gehen.” Seit vielen Wochen schon hatte sie keine Gelegenheit gehabt, auch nur ein einziges Wort mit Wellington zu wechseln. Nachdem die Ärzte erfahren hatten, daß die Belagerung von Burgos ein Fehlschlag gewesen war und sowohl Arthurs als auch Hills Teilarmee sich auf die Grenze Portugals zurückzogen, war der Sanitätsdienst frenetisch damit befaßt gewesen, die Verwundeten, die in den Lazaretten um Salamanca gelegen hatten, zu evakuieren und hinter die portugiesische Grenze zu bringen.
„Hast du Lust, für vier oder fünf Wochen nach Andalusien mitzukommen, schicke Kleider auszuführen, auf ein paar Bälle zu gehen und ins Theater und in Sevilla die Reales Alcazares zu besichtigen und die Kathedrale, einen Abstecher nach Jerez de la Frontera zu machen, in der Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre hübsche Pferde anzuschauen, sich in der Bucht von Cadiz im warmen Wasser zu aalen ... und Henry zu besuchen?”
„Uff, das waren gerade aber mehr als vier Worte, mein Lieber! Was löst denn diese plötzliche Gesprächigkeit aus? Ich dachte, du wolltest in der Stille und Einsamkeit von Freneida über den nächsten Feldzug gegen Bonny meditieren!”
Wellington zog den Brief seines Bruders aus der Tasche und streckte ihn Sarah hin. Aufmerksam las sie die beeindruckende Auflistung iberischer Auszeichnungen und Ehrungen, die man über dem Sepoy-General ausgeschüttet hatte. Sie entlockte nur Kopfschütteln. Als die junge Frau beim Absatz über die Befehlsgewalt des Supremo Generalissimo angelangt war, wurde ihr klar, warum der General mit einem Mal, so unerwartet von der Reiselust gepackt wurde. Mitten im Winter 500 Meilen quer durch Portugal und Spanien zu reiten, war alles andere als erholsam. Die Wege waren grauenvoll, das Wetter furchterregend und es gab nichts, was Arthur so sehr verabscheute wie Trubel, Bälle, Empfänge und andere gesellschaftliche Verpflichtungen, die im Angesicht der Siegesserie von 1812 unausweichlich wurden, wenn er sich in der provisorischen Hauptstadt blicken ließ. „Wirst du den ganzen Stab mitnehmen?”, fragte sie besorgt. Die meisten seiner Offiziere standen in diesem Augenblick auch auf ihrer Krankenliste. Regen und Kälte auf dem Rückzug von Burgos hatten selbst vor den goldenen Schulterklappen nicht halt gemacht.
Der General schüttelte den Kopf: „Die sind doch alle außer Gefecht! Ich habe vorhin die Listen gesehen. Außer dem Quartett, Antonio und mir steht das ganze Hauptquartier drauf!” Einen Augenblick hielt er inne. Sein Gesichtsausdruck wurde mißtrauisch: „Sag mal, sind meine feinen jungen Herren wirklich krank, oder wollen die bloß Heimaturlaub?”
„Arthur“, sagte Lady Lennox und hatte dem General bereits prüfend die Hand auf die Stirn gelegt. Sein ständiges Husten gefiel ihr überhaupt nicht. Er hatte Fieber und die Art und Weise, wie er den ganzen Abend von einer Tischkante an die andere umgezogen war, deutete auf eine schmerzhafte Lumbago hin. „Der einzige, den ich im Moment guten Gewissens als wirklich gesund bezeichnen würde – außer deinem ausgezeichneten Sanitätsdienst natürlich – ist Jack Robertson! Die anderen habe ich auf die Liste gesetzt, obwohl sie meist laut protestiert haben. Antonio steht nicht drauf, weil er mich meidet wie die Pest, wenn ich morgens beim Appell im weißen Kittel die Runde mache! Und dich haben wir nur verschont, weil du durch acht Tage freiwilligen Aufenthalt im Bett ausreichend guten Willen und Vernunft bewiesen hast ...” Während sie sprach, nutzte sie die Gelegenheit zu einer kurzen Untersuchung, die Wellington ausnahmsweise widerstandslos über sich ergehen ließ. „Also, wenn du morgen losreiten willst“, sie schüttelte den Kopf, „dann kommst du nicht weit! Auf den ersten Blick würde ich sagen: Schwere Bronchitis, Fieber, allgemeiner Erschöpfungszustand, Lumbago und die Rippen von Talavera kratzen so über das Rippenfell, das ich dich am liebsten sofort für weitere vierzehn Tage ins Bett stecken möchte ... Sonst hast du nämlich eine Entzündung und darfst sechs Wochen zu hause bleiben.”
Zu Sarahs großem Erstaunen hörte sie ein kooperatives ‚Einverstanden!’. Sie wich einen Schritt zurück und blickte den General entsetzt an: „Wie bitte?”
„Ich bin einverstanden und verspreche dem klugen Doktor, bis Mitte Dezember ganz brav zu sein!” Arthur spürte selbst, daß es vernünftiger war, sich nicht mit aller Gewalt zu überfordern, wenn es nicht unbedingt notwendig war. Vierzehn Tage früher, oder später in Cadiz anzukommen, konnte das Schicksal des Feldzuges auf der Iberischen Halbinsel nicht mehr beeinflussen. Aber er konnte es! Nur dafür brauchte er mehr Kraft, als er in diesem Augenblick hatte.
Die nächsten zwei Wochen über konstatierte Dr. Lennox, daß der alliierte Oberkommandierende sich wirklich an sein Versprechen hielt: Elmore und Kopenhagen erfreuten sich ruhiger Tage im Obstgarten des Hauptquartiers, wo sie warm unter dicken Wolldecken verpackt, das letzte Fallobst vernichteten. Aus den geplanten wilden Jagdausflüge mit Tom Picton und John Colborne, die beide gesundheitlich auch nicht ganz auf der Höhe waren, wurde beschauliche Spaziergänge über den Marktplatz, bis zum einzigen Kaffee von Freneida. Arthur überwand sich sogar dazu, nicht mehr bereits um fünf Uhr morgens aus den Federn zu hetzen, um sich sofort auf die Arbeit zu stürzen ...
Der Stab und das 33. Regiment schienen genausovernünftig wie Lord Wellington. Trotzdem hatten die Unternehmungslustigsten der Soldaten bereits einen Weg entdeckt, um etwas für ihre Gesundheit zu tun und gleichzeitig ihren mageren Sold von 1 Schilling pro Tag aufzubessern: Sie gingen angeln und verkauften ihren Fang auf den Märkten der umliegenden Bauerndörfer. Der Zeitvertreib war den irischen und schottischen Bauernsöhnen angenehm und er brachte gute Dollares ein. Die spanischen Bergbewohner selbst waren keine Angler. Erst als auf dem Tisch des Hauptquartiers ständig frischer Fisch in allen Varianten auftauchte, wurde Lord Wellington der Geschäftstüchtigkeit seiner Leoparden gewahr. Es gab ein ungeschriebenes Gesetz in den Landstreitkräften des Königs, daß jeder einfache Soldat das Recht hatte, einem Handwerk oder einer anderen Arbeit nachzugehen, wenn die Armee nicht im Felde stand. Das 33. Regiment, obwohl ursprünglich als West Riding Regiment geführt und hauptsächlich durch Männer aus den Industrie- und Bergbaugebieten Lancastershires rekrutiert, hatte sich im Verlauf der letzten 15 Jahre unter einem irischen Oberst gewandelt. Da das Regiment Arthur folgte und lange in Irland stationiert gewesen war, bevor es nach Indien verschickt wurde, war der Anteil an irischen und schottischen Tagelöhner- und Bauernsöhnen inzwischen höher als der an Arbeitern aus der Unterschicht Mittelenglands. Dadurch war zwar die Disziplin wesentlich verbessert worden, aber zwei neue Probleme tauchten auf: Die Iren waren ein trinkfreudiges Völkchen und konnten an keinem Wein- oder Bierfaß vorbeigehen, ohne es anzustechen. Und die Schotten und Iren im Verband sprachen so wenig Englisch, daß sie – ähnlich wie die Connaught Rangers – von Offizieren und Unteroffizieren geführt werden mußten, die Gälisch sprachen. Was ihnen in der Armee König Georges manchmal Probleme bereitete – bei der Belagerung von Seringapatam hatte Arthur seine ganzen Befehle in der keltischen Ursprache der Inseln erteilt, sehr zur Unzufriedenheit von General Harris, der als echter Engländer kein Wort davon verstanden hatte –, erwies sich in der Beira als Vorteil. Irgendwie war der Dialekt der Bergbewohner dem Gälischen so verwandt, daß die Leoparden und ihre Gastgeber sich prächtig verständigen konnten. Als Wellington, gemeinsam mit Tom Picton, Paddy Seward und seiner kleinen Freundin Manuela auf dem Weg zum täglichen Kaffeeklatsch mit Jack Robertsons Quartett und den Ärzten über den Marktplatz schlenderte, bemerkte er im abgedeckten Dachstuhl des Bürgermeisterhauses ein ganzes Dutzend kräftiger Rotröcke, die sich eifrig am Holz zu schaffen machten, während der Alcalde – in einer unverständlichen Sprache mit Sergeant-Major Howard diskutierte. Die Szene machte ihn neugierig. Er drückte Picton den kleinen Paddy in die Hand und ging zu seinem Sergeanten und dem Alcalden hinüber. Howard hielt ein Stück Papier und erklärte irgend etwas. Als er den General kommen sah, wollte er Haltung annehmen. Arthur winkte ab und sah interessiert nach oben: „Was ist denn das, Will?”
„Die schottischen Zimmerleute ihres Regiments, Mylord!”
„Wir haben elf Zimmermänner?”
„Ja! Alle aus dem County Aberdeen! Clan Howard! Alles meine Verwandten, Sir Arthur!”
Wellington nickte. Seine Regimentsliste sah recht eintönig aus. Entweder hatte er Schotten, die Howard, McGregor, Finlay, Price oder Seward hießen, oder Iren – O’Shea, O’Reah, Conolly, Conelly und sogar entfernt mit ihm verwandte Coleys. Obwohl die sogenannten Clan-Regimenter in der britischen Armee nicht mehr so häufig anzutreffen waren wie in den Tagen des Herzogs von Marlborough, existierten sie doch noch vereinzelt. Meist dann, wenn die Obristen selbst Schotten oder Iren waren. Er hatte ein Hochlandregiment, das 79., in dem jeder, vom Oberst bis zum Trommlerjungen hinunter Gordon hieß. Sie hatten die Männer durchnummerieren müssen, um die Übersicht zu bewahren.: „Das heißt, die Howards sind Zimmerleute?”
Der Sergeant nickte.
„Haben wir auch irgend jemanden, der Pferde vernünftig beschlägt?” Außer den 30 oder 35 Offizierspferden und seinen beiden Schlachtrossen gab es in Freneida hauptsächlich Esel und Maultiere. Das Feldheer hatte zwar unzählige Hufschmiede, aber die waren mit der Kavallerie hinter Guarda im Winterlager. Vor seinem langen Ritt nach Andalusien wollte Wellington noch Kopenhagen und Elmore beschlagen lassen und Sarah’s Libertad brauchte auch dringend neue Eisen.
„Versuchen Sie’s mal mit den Coleys oder den Conellys, Mylord! Die kommen alle aus der Gegend von Kildare. Ihre eigenen Leute! Die Iren sind Hufschmiede! Schottland ist kein gutes Land für Pferde!”
„Können Sie mir irgendeinen Coley oder Conelly besonders empfehlen, Will?” Der Sergeant hatte das Interesse seines Generals geweckt. Arthur war sich nie richtig bewußt gewesen, daß die meisten seiner Leoparden noch etwas anderes konnten, als Adler ins Jenseits zu befördern.
„Sie wollen ernsthaft diesen hellbraunen, hinterlistigen Teufelsbraten beschlagen lassen?” Der Sergeant kratzte sich nachdenklich hinter dem Ohr: „Mylord, das ist ein echtes Himmelfahrtskommando!“
Wellingtons Hengst hatte schon mehr Soldaten ins Lazarett befördert als der Feind. Er war berüchtigt! Wenn er nicht gerade ausschlug, biß er. Am Schlimmsten gebärdete der irre Gaul sich immer dann, wenn sein Herr nicht zusah und ein unglücklicher Rotrock ihn festhalten mußte. Aber jedesmal, wenn es den General zurückkommen sah, wurde das scheinheilige Vieh wieder lammfromm, legte die Ohren nach vorne und blickte alle unschuldig mit großen braunen Augen an.
Arthur grinste: „Will, der Fuchs ist friedliebend! Sogar Major Sewards kleiner Sohn kann auf ihm reiten! Daß mein braver Kopenhagen mit dem Leibhaftigen verwandt sein soll, ist eine besonders üble Verleumdung! Außerdem“, er appellierte an den schottischen Geschäftssinn, „kann der Hufschmied pro Pferd vier Schilling berechnen und ich haben insgesamt fünf Pferde zu beschlagen!”
Der Sergeant pfiff durch die Zähne. Fast ein ganzer Monatssold für einen Tag Arbeit. Das war ein Geschäft! Doch als richtiger Schotte reichte ihm dieses Angebot des Oberkommandierenden noch nicht aus: „Einverstanden! Aber der hellbraune Teufel kostet Sie zwei Schilling pro Huf! Gefahrenzulage, Mylord!”
Arthur stöhnte hörbar auf. Sein eigenes Regiment wollte ihn schröpfen. Er verschränkte die Arme vor der Brust: „Ein Schilling, sechs Pennies und ich halte mein Pferd selber fest! Schlagen Sie ein, Will und schicken Sie mir morgen früh einen Hufschmied vorbei!”
Der Sergeant war zufrieden. Freneida zeichnete sich für die Männer des 33. als einträglich ab. Der Alcalde hatte ihnen für das Dach fünf Silberdollares versprochen. Die Fische gingen bestens, Price stellte mit ein paar Experten Fallen und brachte Hasen und Kaninchen auf die Märkte und von Zeit zu Zeit das Fell eines Fuchses oder einer Wildkatze, und solange die Hufschmiede des Kommissariats mit der gesamten Kavallerie in den grünen Ebenen zwischen Guarda und Coimbra waren, konnte man einen neuen Geschäftszweig eröffnen: drei Dutzend Pferde über fünf Monate Winterlager; das waren insgesamt fast 20 Pfund Sterling, nachdem der General einen Schilling pro Huf akzeptiert hatte und ein Pferd alle vier bis sechs Wochen beschlagen werden mußte. Sie hatten sieben Witwen und zwei Dutzend Halbwaisen zu versorgen und konnten diese neue Geldquelle gut gebrauchen. Wie die meisten Regimenter, die von guten Offizieren und Unteroffizieren geführt wurden, hielt das 33. zusammen wie Pech und Schwefel.
Wellington kehrte kopfschüttelnd zu Picton zurück, und die beiden setzten ihren Spaziergang über den Marktplatz fort.
Am 10. Dezember fand Arthur das langersehnte Schreiben seines General-Quartiermeisters Gordon auf dem Schreibtisch vor. Der Offizier bat endlich um einen Gesprächstermin mit dem Oberkommandierenden. Der stieß einen inneren Jubelschrei aus und jagte Lord Fitzroy Somerset los, um Sir James umgehend ins Hauptquartier zu bitten. Bedrückt betrat Gordon eine halbe Stunde später das Arbeitszimmer.
„Oberst, was kann ich für Sie tun?”, begrüßte Wellington ihn geschäftsmäßig. Er wollte sich seine Erleichterung auf keinen Fall anmerken lassen.
„Mylord, in letzter Zeit steht es nicht gut um meine Gesundheit ...”
„Und Sie müssen nach England reisen, um sich kurieren zu lassen?” Der General blickte ihn entsetzt an: „Das können Sie mir doch nicht antun, Sir! Gerade jetzt! Das Feldheer braucht Sie! Ich brauche Sie!”
Der Gesichtsausdruck des Obersten wurde noch bedrückter: „Mylord, ich sehe keinen anderen Weg mehr! Seit ein paar Wochen schon leide ich fürchterlich. Sir James McGrigor und seine Ärzte wissen nicht, was sie noch tun können, um mich hier zu kurieren. Der Professor hat es ja versucht. Schon seit fast vierzehn Tagen gibt er mir jeden Tag eine Medizin zu trinken, aber sie wirkt nicht! Er hat mir empfohlen, dringend einen seiner Kollegen an der Universität von London zu konsultieren!”
Wellington ließ den Kopf in die Hände fallen. Gordon nahm an, daß seine Bitte um Heimaturlaub den Oberkommandierenden an den Rand der Verzweiflung trieb. Doch Arthur mußte einfach den Kopf gesenkt halten und sein Gesicht in den Händen verstecken, damit der General-Quartiermeister sein zufriedenes Grinsen nicht sehen konnte: „Oberst, in diesem Fall muß ich selbstverständlich Ihrem Gesuch stattgeben. Aber Sie verstehen sicher auch, das ich Sie nur schweren Herzens ziehen lasse. Ihre wertvolle Hilfe wird mir fehlen!”, schwindelte er mit deprimierter Stimme. „Gut! Brechen Sie sofort auf! Ich werde an Vize-Admiral Martin in Oporto schreiben und ihn bitten, Sie mit dem ersten Kriegsschiff das übersetzt, zurück nach England zu bringen!”
Gordon wollte gerade mit hängendem Kopf das Zimmer verlassen, als der Oberkommandierende ihn noch einmal zurückrief. „Aber Sie müssen mir versprechen”, seufzte er scheinheilig, „daß Sie sofort zurückkommen werden, wenn die Ärzte in England sie als geheilt betrachten!”
„Selbstverständlich, Mylord! Verlassen Sie sich darauf.” Gordon salutierte und kehrte in sein Quartier zurück um zu packen. Er fühlte sich unwohl bei dem Gedanken, Lord Wellington so im Stich zu lassen, wo das Feldheer ihn doch brauchte. Es war einfach bedrückend, mit anzusehen, wie der Oberkommandierende unter diesem Verlust litt. Aber Professor McGrigor hatte sehr besorgt geklungen, als er über dieses sonderbare Morasverdes-Fieber gesprochen hatte. Es gab nach Aussagen des berühmten Arztes nur eine Heilung: Beständig in einem kühlen, feuchten Klima zu leben, wie man es in England fand und Orte mit heißen, trockenen Sommern zu meiden. Die Zeichnung, die Lady Lennox ihm in einem medizinischen Werk gezeigt hatte und die den Ausschlag darstellte, der in der Endphase des Fiebers den Körper der Opfer überzog, hatte grauenhaft ausgesehen. Er mußte schnellstens nach Hause zurück, denn es ging offensichtlich um Leben und Tod! Sobald er wieder gesund war, würde er dann seinen Freund, den Prinzregenten, um eine Stelle im Kriegsministerium oder in den Horse Guards bitten und Sir Arthur einen netten Brief schreiben, in dem er ihn für diesen Schritt um Verzeihung bat. Durchs Fenster konnte er beobachten, wie Lord Wellington ins Hauptquartier des Medizinischen Dienstes eilte. Er machte einen verärgerten Eindruck. Gordon hoffte, daß der hitzige Ire dem alten Mac wegen seines Krankenscheins nicht den Kopf abreißen würde.
Nachdem die Tür des Hauptquartiers des Sanitätsdienstes ins Schloß gefallen war und Arthur sicher sein konnte, daß er außerhalb des Blickfeldes seines scheidenden General-Quartiermeisters war, konnte er seine Freude über Gordons Versetzungsgesuch nicht mehr zurückhalten. Er nahm zwei Treppenstufen auf einmal und stürmte, ohne anzuklopfen in Professor McGrigors Büro: „Er fährt nach England! Gordon hat sich seinen Marschbefehl vor zehn Minuten abgeholt!” Der General klopfte dem alten Mediziner ungestüm auf die Schulter. Dann ließ er sich in einen Stuhl fallen: „Und jetzt erzählen Sie mir schon, welche Krankheit unser ehemaliger General-Quartiermeister hat, damit ich mich auch ein bißchen amüsiere!”
Sir James zwinkerte Wellington zu und zog ein großes Buch aus einer Schublade. Er schob es über den Tisch. Das Bild war ekelhaft. Der General schüttelte sich: „Was ist denn das?”
„Das ist ein uraltes, portugiesisches Lehrbuch für angehende Mediziner, und dieses Bild stellt einen Mann dar, der so ziemlich jede Hautkrankheit hat, die man im letzten Jahrhundert identifizieren konnte! Weil Gordon aber kein Portugiesisch lesen oder verstehen kann, haben wir’s als Endstadium des Morasverdes-Fiebers bezeichnet, Sir Arthur!”
„Was für ein Fieber?” Wellington waren inzwischen eine ganze Menge Krankheiten geläufig – von den Listen der Regimentsappelle her.
„Morasverdes-Fieber! Das ist der Ort, an dem Ihr Feldheer sich auf dem Rückzug in absolutes Chaos aufgelöst hat! Diese Krankheit befällt nur britische General-Quartiermeister, die keine Landkarten lesen können!”
„Und wie kuriert man dieses schreckliche Leiden, Mac?” Arthur verschluckte sich fast vor Lachen, aber er mußte noch einen Brief an Oberst Torrens schreiben, den Sekretär von Prinny. Die Sache mit der Krankheit war zwar ein vernünftiger Vorwand, aber er wollte Torrens trotzdem ehrlich sagen, warum er auf eine erneute Entsendung von Sir James verzichten wollte und lieber seinen bewährten Stabsoffizier Sir William de Lancey mit der freigewordenen Stelle betraute, bis man ihm General Murray schicken konnte: Gordon war einfach nicht in der Lage, die an ihn gestellten Anforderungen im Felde zu erfüllen. Das bedeutete nicht, daß er keinen ausgezeichneten Verwaltungsbeamten beim Nachschubwesen in London abgeben würde, wo er kaum Schaden anrichten konnte! Das Wissen des Oberkommandierenden um sein aufbrausendes Wesen, hatte im Lauf der Jahre dazu geführt, daß er bei Fällen, wie Sir William einen fälligen Wutausbruch unterdrückte und eine diplomatische Lösung suchte, die den Betroffenen nicht verletzte. Der General-Quartiermeister war schusselig, aber er hatte weder Befehle verweigert, noch gefaulenzt. Gordon konnte sich mit Kompaß und Karte einfach nicht im Gelände orientieren und Wellington hatte weder Zeit, noch Lust, ihm Nachhilfestunden zu erteilen oder auch noch den Job des General-Quartiermeisters mit zu übernehmen, nur damit einer von Prinnys Saufkumpanen irgendwann zum General befördert wurde.
„Ich hab den Oberst an einen alten Freund verwiesen, Professor Gallagher! Das ist der Spezialist für Tropische Krankheiten an der Universität von London. Sie kennen ihn! Der Spaßvogel, der bei einem unserer ersten gemeinsamen Abendessen, als Sie gerade frisch aus Indien zurückgekommen waren mit seiner Erklärung für das Madras-Fieber in der Manteltasche aufgetaucht ist!”
Arthur erinnerte sich nur zu gut: Gallagher hatte beim Essen einen riesigen, in Alkohol eingelegten Wurm vor ihm auf den Tisch gestellt und in leuchtenden Farben geschildert, wie das Vieh sich über seine Opfer hermachte. Und dann hatte man ihm doch tatsächlich einzureden versucht, daß der Wurm aus der Leber eines eben erst verschiedenen Offiziers stammte, der zehn Jahre in Indien gedient hatte. Da Wellington, wie alle anderen Soldaten, die lange in der Kolonie gelebt hatten immer wieder unter Anfällen von Madras-Fieber litt, hatte er kreidebleich vor dem Einmachglas gesessen, seinen Inhalt fixiert und sich ausgemalt, wie der Spaßvogel Gallagher als nächstes den Wurm aus seiner Leber in Alkohol konservieren würde, um den Studenten ein neues gruseliges Untier zu präsentieren. Irgendwie fing General-Quartiermeister Gordon an, ihm richtig leidzutun.
„Na ja, ich habe dem Obersten empfohlen, sich um eine Stelle in England zu bemühen. Das Morasverdes-Fieber hat die Besonderheit, nur unter den klimatischen Bedingungen in Portugal und Spanien auszubrechen. Aber in allen Ländern mit gemäßigtem Klima und ohne Kampfhandlungen gegen Frankreich ist es völlig ungefährlich!” McGrigor hatte noch gut im Gedächtnis, wie sein Kollege Gallagher und die Assistentenbande sich vor vielen Jahren mit General-Major Wellesley amüsiert hatten. Sie bekamen so selten richtige Soldaten zwischen die Finger – diejenigen, die auf Schlachtfeldern bis zu den Knien im Blut gestanden hatten und als beinharte Feuerfresser verrufen waren! Neben tropischen Krankheiten, die man sich in Indien einfangen konnte, waren Autopsien ein Lieblingsthema gewesen, um herauszufinden, wie lange es brauchte, um Großbritanniens einzigen ungeschlagenen General davon zu überzeugen, auf den Nachtisch zu verzichten und kreidebleich um ein Glas Brandy zu bitten. Oberst Gordon würde sicher ein genausoprächtiges Opfer abgeben, um einige gemeinsame Abendessen des Lehrstuhls seines Kollegen mit ähnlichen Reaktionen zu verschönen, bevor er als geheilt entlassen werden konnte.
Arthur dankte dem Generalinspekteur seiner Hospitäler herzlich für die unschätzbare Hilfe bei der schmerzlosen Entfernung eines unfähigen General-Quartiermeisters. An der Tür drehte er sich noch einmal kurz um: „Was für eine Medizin haben Sie ihm da eigentlich vierzehn Tage lang gegeben?”
„Unsere Empfehlung des Monats! Zwiebelsirup mit Honig und Zitrone. Hilft gegen so gut, wie alles! Husten, Halsschmerzen, Fieber ... Das Zeug steht im Moment gallonenweise herum, weil die Hälfte Ihres Regiments krank war. Schmeckt absolut grauenvoll!”
Fluchtartig verließ der General das Arbeitszimmer von Sir James. Sarah hatte dafür gesorgt, daß man auch ihm drei Mal am Tag diese ‚Empfehlung des Monats’ einflößte. Seine Bronchitis und das Fieber waren inzwischen fast verschwunden, aber er erinnerte sich mit Schrecken an seine eigene, große Flasche mit der zähflüssigen, stinkenden Flüssigkeit, die John Dunn ihm dauernd unter die Nase hielt. Und sein alter Sergeant zählte pflichtbewußt die Löffel, die er zu schlucken hatte! Er beschloß, in spätestens zwei Tagen nach Andalusien aufzubrechen. Er fühlte sich überhaupt nicht mehr krank und er wollte endlich wieder auf ein Pferd steigen, anstatt dauernd überall zu Fuß hinzurennen, mit einem dicken Schal um den Hals und einem warmen Mantel über den Schultern. Außerdem tischte man ihm zu jedem Essen heiße Hühnerbrühe mit Gemüse auf, scheuchte ihn spätestens um zehn Uhr abends ins Bett – mit einer Wärmflasche – und legte ihm, bevor er das Recht hatte, die Türschwelle seines Hauptquartiers zu überschreiten, prüfend die Hand auf die Stirn: Kein Fieber – Ausgang! Fieber – ab ins Bett! Der alte John war gnadenlos. Arthur hatte genug davon, daß man ihn behandelte wie ein unmündiges Kleinkind oder einen todkranken, steinalten Greis!
Am 20. Dezember erreichte der General gemeinsam mit seinem portugiesischen Adjutanten Don Antonio Maria Osorio Cabral de Castro, Lord Fitzroy Somerset und Lady Lennox Cadiz. Man bereitete ihnen einen überschwenglichen Empfang, feierte den General, genau wie er es befürchtet hatte, mit Bällen, Empfängen und Theatervorstellungen und ließ ihm keine ruhige Minute ... und überall auf den Plätzen der Stadt standen – zur Krönung – irgendwelche Musiker und spielten und sangen, was in dieser Saison in Spanien gerade besonders in Mode zu sein schien. Das Lied hieß ‚Ahe Marmont’ und war nicht in vernünftiges Englisch zu übersetzen. Der Inhalt verballhornte die französische Niederlage bei Salamanca und die englische Küche, die Arthur selbst Monsieur Marmont an der Arapiles-Kette aufgetischt hatte. Wellington war zwar nicht besonders glücklich darüber, Abend für Abend in großer Uniform vorgeführt zu werden wie ein Tanzbär, aber das kleine Spottlied gefiel ihm gut!
Trotz der ständigen Festlichkeiten, war er bereits am Weihnachtstag 1812 wieder an der Arbeit. Seine nichtsnutzigen Adjutanten schlenderten unterdessen mit Lady Lennox durch das hübsche Hafenviertel mit seinen gepflegten Gärten, besuchten die historische Altstadt mit ihren Baudenkmälern aus der Maurenzeit oder gingen einkaufen.
Frei heraus schrieb Arthur unterdessen dem spanischen Kriegsminister Don Juan de Carvajal, was er von seinem neuen Status als Supremo Generalissimo der spanischen Streitkräfte hielt. Es war einfach unmöglich, die Funktion eines Oberkommandierenden auszufüllen, wenn man nicht einmal Offiziere befördern konnte, die ihre Arbeit verstanden und andere fortschicken durfte, die beim Geschäft störten. Ohne seine Worte auf die Goldwaage zu legen, teilte er Carvajal mit, daß er entweder diese Rechte zugesprochen bekam, oder Spanien sich einen anderen Supremo Generalissimo suchen konnte.
Der Diplomat Henry Wellesley blickte seinem kämpferischen Bruder kopfschüttelnd über die Schulter: „Das ist aber ein frontaler Angriff, Arthur!”
Wellington schmiß die Feder hitzig ins Tintenfaß. Der ganze Schreibtisch war voller schwarzer, feuchter Kleckse: „Es ist doch unsinnig, Henry! Wozu brauche ich einen verdammten Titel, wenn ich die verdammten Soldaten nicht kommandieren kann, wie es verdammt noch mal strategisch sinnvoll ist. Und wie soll ich irgendwen kommandieren, wenn mir dauernd 150 Leute dazwischenreden! Hast du mal gezählt, wie viele Generäle unsere Verbündeten haben?”
Henry Wellesley konnte gerade noch das Tintenfaß festhalten. Sein kleiner Bruder gestikulierte genau so raumgreifend wie die Spanier.
„Ich hab’s getan! Die können Kompanien von Generälen kommandieren lassen, wenn sie wollen: Auf 300 Soldaten kommt ein verdammter General. Überleg dir mal, wie viele Obristen und andere Offiziersränge Spanien haben muß! Wer soll denn überhaupt noch kämpfen, wenn alle nur herumkommandieren wollen? Im Prinzip müßte man vier Fünftel des Offizierskorps rausschmeißen ... Die Soldaten selbst sind nicht schlecht. Sie werden nur von Amateuren geführt ... Dazu noch von Amateuren, die sich nie einigen können. Ich hab’s bei Talavera erlebt: Alleine de la Cuesta – möge er in Frieden ruhen – brachte es fertig, innerhalb von fünf Minuten, drei verschiedene Auffassungen zu vertreten. Natürlich standen die alle im totalen Widerspruch zueinander ...”
Beschwichtigend hob Henry Wellesley die Hände. Er war seit 30 Jahren Diplomat und verstand genau, was möglich und unmöglich war. Das Ansinnen seines kleinen Bruders würde einen schon schwierigen und empfindlichen Verbündeten so vor den Kopf stoßen, daß Großbritanniens spanische Politik genauso in den Stillstand getrieben wurde, wie – vor wenigen Wochen – Frankreichs Truppen bei Cabezon: „Darf ich dir einen Rat geben, Arthur?”
Wellington nickte friedfertig.
Henry setzte sich auf die Fensterbank im Arbeitszimmer des prächtigen Palais an der Plaza de Hispanidad, der als britische Gesandtschaft diente und schwieg einige Minuten. Er wußte, daß sein Bruder oft sehr heißblütig und emotional reagierte. Wenn man ihm nicht Zeit gab, sich zu beruhigen, dann war er in der Lage, aus purem Stolz eine vernünftige andere Meinung zu verwerfen und trotzig seinen eigenen Weg weiterzugehen. Der britische Gesandte konnte manchmal nur noch den Kopf über Sir Arthur schütteln: So kühl und beherrscht er sich nach außen gab, so südländisch-aufbrausend war er in seinem Inneren. Nachdem Wellington vom Schreibtisch aufgestanden war und im Raum auf und abging, um seine nervöse Energie zu bändigen, wußte Henry, das sein Bruder jetzt bereit war, vernünftig zuzuhören: „Was tust du auf dem Schlachtfeld, wenn du Deinen Gegner nicht im Zentrum angreifen kannst?”
„Henry, ich bin kein Anfänger, der einen Gegner im Zentrum angreift! Vernünftigerweise versucht man, zuerst eine der beiden Flanken aufzurollen ... wenn der Feind mitspielt, fällt man ihm in den Rücken. Wenn nicht, muß er seine Aufstellung ändern ...” Der General hielt inne. Er war doch nicht nach Cadiz gekommen, um seinem älteren Bruder eine Vorlesung über die Kunst der Kriegführung zu halten! „Verdammt, komm zum Punkt!”
„Du hast dir gerade selbst die Frage beantwortet, wie du mit den Cortes und Carvajal umgehen mußt! Ich bin als Diplomat auch kein Anfänger! Umgehe die Spanier doch einfach an ihren Flanken. Pack sie bei ihrer Ehre! Zieh die Armee auf deine Seite! Dann müssen die Cortes nachgeben ... Carvajal handelt unter Druck. Der hat schon lange begriffen, daß die Blakes, O’Donojus oder Eguias nichts zustande bringen, wenn ihnen kein echter Berufssoldat die Hand führt. Der wartet doch nur darauf, das du ihm irgendein Argument aufzeigst, damit er deinen Forderungen nachgeben kann, ohne sein Gesicht zu verlieren.”
Wellington seufzte hörbar.
Henry wußte, daß sein kleiner Bruder begriffen hatte, denn gleichzeitig mit dem Seufzer verschwand der undiplomatische Brief an den spanischen Kriegsminister im Papierkorb. Unter dem zufriedenen Blick des britischen Gesandten verfaßte der alliierte Oberkommandierende zuerst eine Liste mit Empfehlungen für Don Juan de Carvajal, in der er ausführlich erklärte, welche Vorteile Kronrat, Cortes und Regierung aus einer reformierten Armee ziehen konnten – für die Zeit nach der Vertreibung des Usurpators Joseph Bonaparte. Dann schrieb er einen Aufruf an die spanische Armee. Er war voll mit guten Vorsätzen und klang nicht bedrohlich, sondern äußerst kooperativ. Der Ire biß sich auf die Lippe und fügte als letzten Satz ein, daß er selbstverständlich die spanische Regierung über alle Heldentaten der spanischen Generalität und des Offizierskorps auf dem Laufenden halten und sich für verdiente Belohnungen und Beförderungen einsetzen würde. Nachdem er eine Hand voll Sand über die feuchte Tinte geworfen hatte, fand er, daß es im Arbeitszimmer des britischen Gesandten in diesem Augenblick fürchterlich nach Korruption stank. Doch Henry Wellesley klopfte seinem kleinen Bruder nur sehr zufrieden auf die Schulter und strahlte übers ganze Gesicht: „War doch gar nicht so schwer ...“
Die meisten Vollmachten, die der neue Supremo Generalissimo der spanischen Regierung und den Cortes abverlangt hatte, erhielt er zugesprochen. Die Generalität und das Offizierskorps hatten Druck auf den Kriegsminister Don Juan de Carvajal ausgeübt, denn sie wollte – genauso wie die portugiesischen Truppen unter Marschall John Beresford – endlich auf der Straße des Ruhmes, von Sieg zu Sieg reiten. Sie waren sich nun alle einig, daß sie gemeinsam mit den Anglo-Portugiesen, unter der Führung von Generalissimo El Duque de Ciudad Rodrigo kämpfen wollten. Außerdem verdrängte der pompöse spanische Titel zumindest ein klein Wenig, daß man sich von einem Ausländer herumkommandieren lassen würde. Glücklicherweise sprach der Generalissimo ziemlich gut Spanisch und besaß auch die Höflichkeit, sich in dieser Sprache an seinen neuen Generalstab zu wenden. Auf einem nervigen, herumtänzelnden schneeweißen Andalusierhengst, der eine übergroße scharlachrote Schabracke trug, die die Damen von Cadiz prachtvoll mit Gold- und Silberfäden bestickt hatten, passagierte er anschließend an den zur Parade angetretenen spanischen Truppen vorbei. Er hatte den Zweispitz gezogen und hielt den Arm – Zeichen der Achtung – gesenkt. Die Soldaten jubelten ihm lautstark zu, während der schneeweiße Andalusier ihm das Leben zur Hölle machte ... alle verziehen El Duque de Ciudad Rodrigo großmütig, daß er immer noch seine rote britische Generalstabsuniform trug, denn deutlich sichtbar und über allen anderen militärischen Auszeichnungen, die er in seinem langen Soldatenleben erhalten hatte, hob sich an einem purpurfarbenen Seidenband der Orden vom Goldenen Vliesr ab. Im Hintergrund beobachtete Henry Wellesley zufrieden und erleichtert seinen kleinen Bruder. Der Kronrat und die Cortes waren wohlgestimmt und würden in nächster Zeit ihrem britischen Verbündeten keine Probleme mehr bereiten. Das anglo-alliierte Feldheer hatte sich mit einem Federstrich – zumindest theoretisch – auf 170.000 Mann vergrößert und konnte somit als wertvolles Spielgeld gegenüber Österreich, Rußland, Preußen und den deutschen Ländern eingesetzt werden. Der Sieg von Salamanca hatte den besten Soldaten König Georges III. plötzlich zu einer Persönlichkeit von europäischem Niveau erhoben. Er war damit der einzige akzeptable Kandidat geworden, wenn sich je die Frage bezüglich des Oberkommandos über ein gemeinsames Feldheer aus fünf oder sechs Nationen gegen General Bonaparte ergeben sollte. Großbritannien hielt einen echten Trumpf in der Hand, mit Hilfe dessen die Insel im Konzert der europäischen Mächte – nach dem Untergang Napoleons – zweifellos die erste Geige spielen konnte.
Während Großbritanniens Gesandter in Spanien sich Albions glorreiche Zukunft in den schillerndsten Farben ausmalte, ging dem Supremo Generalissmo ein ganz anderer Gedanke durch den Kopf. Er spürte, daß er anfing, gereizt und irritiert zu sein. Das ganze Aufhebens, das man um seine Person machte, mißfiel ihm von Tag zu Tag mehr: Im alten Rom hatte man dem siegreichen Feldherren wenigstens einen Mann beigestellt, der ihm zwar den goldenen Lorbeerkranz des Siegers übers Haupt hielt, der ihm aber gleichzeitig während des ganzen Triumphzuges ins Ohr flüsterte: „Bedenke, u bist nur ein Mensch!” Es war eine gute Sache, immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden. Die schlimmsten Fehler machte ein Mann immer dann, wenn er zu selbstsicher wurde und nicht mehr akzeptieren konnte, daß es auch noch ein paar andere kluge Köpfe neben ihm gab. Obwohl ein übersteigertes Selbstwertgefühl nicht gerade zu den am stärksten ausgeprägten Charaktereigenschaften Wellingtons gehörte, hatte er doch die Befürchtung, daß dieser ganze Trubel ihm langsam zu Kopf stieg. Der Lärm, die vielen Menschen, die Paläste und die politischen Intrigen erdrückten ihn. Don Antonio Maria Osorio Cabral de Castro und Lord Fitzroy Somerset hörten ihn leise vor sich hin grummeln: „Wenn dieser ganze Unsinn nicht bald ein Ende nimmt, dann explodiere ich! Wenn ich mir auch nur einen einzigen, ernsthaften Ausrutscher gegen Bonny leiste, dann knüpft ihr mich – gemeinsam mit euren britischen Freunden – doch genausoenthusiastisch auf, wie ihr mir heute zujubelt!” Er wandte sich seinen Adjutanten zu und fragte sie: „Wie wäre es, wenn wir morgen aus diesem Tollhaus verschwinden und zurück in unsere friedlichen Berge reiten?”