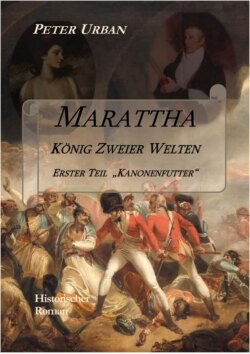Читать книгу Marattha König Zweier Welten Teil 1 - Peter Urban - Страница 4
Kapitel 2 Henriettas Hoffnung
ОглавлениеPünktlich um sieben Uhr standen ein Oberst, ein Oberstleutnant, zwei Majore, drei Hauptleute und mehrere blutjunge Leutnants und Fähnriche sauber herausgeputzt und mit blitzblanken Reitstiefeln vor einem großen, im holländischen Kolonialstil gehaltenen Gebäude in der Stadtmitte von Capetown.
»Gludenstackstraaten?« erkundigte Arthur sich bei einem halbnackten, dunkelhäutigen Mann, der müßig auf einer hölzernen Treppe vor einer geräumigen Veranda lungerte. Die Antwort war unverständlich und schien nur aus Umlauten zu bestehen.
»Das ist Holländisch, Sir!« erklärte der muntere Major West seinem gestrengen Vorgesetzten.
Arthurs düstere Mine hellte sich auf: »Sie verstehen diesen Menschen, Francis?«
»Kein einziges Wort, Sir! Aber als wir damals in Flandern waren, da klang es so ähnlich!«
Während Major West sich für seine vorlaute Äußerung einen missmutigen Blick von Oberst Wesley gefallen lassen musste, wurde die beeindruckende Pforte, die die Veranda mit dem Inneren des luxuriösen Gebäudes verband, wie von Geisterhand geöffnet, und ein Farbiger in aufwendiger Livree, die in der schwülen Hitze von Kapstadt denkbar ungeeignet sein musste, verbeugte sich tief vor den Offizieren des 33. Infanterieregiments des Königs.
»Mylord Ashton und die Damen erwarten Sie bereits!« hörte man nun in einem leidlich guten Englisch. Der Dunkelhäutige verbeugte sich erneut und wies ihnen dann den Weg ins Innere des prachtvollen Hauses.
Schließlich fanden sich alle in einem riesigen, feudal möblierten Raum wieder, in dem die Damen und Herren der vornehmen Gesellschaft sich bereits zusammengefunden hatten. Ein Tisch aus exotischem Holz zog sich wie eine lange Straße von einem Ende des Speisezimmers bis zum anderen. Britische Uniformen mischten sich bunt mit Abendgarderoben, und Oberst Ashton selbst stand der Gesellschaft am Kopfende des Tisches vor. Er wirkte ziemlich angeheitert. Zu seiner Linken saß ein unirdisches Geschöpf mit blondem, zu einer komplizierten Frisur hochgestecktem Haar und schneeweißer Haut. Ein Gebilde aus hellblauer und cremefarbener Seide, das Arthur so filigran erschien, dass er es auf den ersten Blick nicht als Kleid zu identifizieren vermochte, wogte zwischen Stuhl, Tisch und Boden, wie die Wellen des Nordatlantiks. Ein Paar strahlend blauer Augen blickte verzückt zu Henry und einem großen Kristallgefäß, das offenbar mit einem alkoholischen Getränk gefüllt war.
Der junge Oberst des 33. Regiments kannte die Regeln: Zwei Pint Claret oder Champagner auf einen Zug, ohne abzusetzen! Es war ein idiotisches kleines Spiel, mit dem die Herren Offiziere zu beweisen versuchten, dass sie richtige Männer waren. Er hatte es oft genug selbst gespielt ...
Rechts neben Ashton saß ein weiteres Geschöpf in üppiger Abendgarderobe. Die Dame war brünett und kreidebleich. Auch in ihren blauen Augen lag ein Ausdruck der Bewunderung.
»Weiber!« fuhr es Arthur durch den Kopf, während er sich missmutig auf einen wenig exponierten Platz an einer Ecke des Tisches fallen ließ. Oberstleutnant Sherbrooke hatte derweil schon mindestens zehn breite Schultern in einem Anfall überschwänglicher Wiedersehensfreude blau geschlagen. Major Shee umarmte hingebungsvoll einen großen Kristallkelch mit einer hellgelben Flüssigkeit. Der Lärmpegel im Raum konnte nur mit einem Schlachtfeld verglichen werden. Wild klangen Stimmen aus dem 33. und 12. Regiment durcheinander. Ab und an wurden diese Stimmen von hohen, schrillen Tönen durchbrochen.
»Weiber!« fuhr es Arthur wieder durch den Kopf. Doch gleichzeitig hörte er die innere Stimme der Vernunft rufen: »Kitty! Du meinst Kitty, du Narr!«
Irgendwie gelang es dem jungen Oberst in dem ganzen Trubel, den Krug mit dem Wasser zu sich zu ziehen und sein großes Kristallglas bis zum Rand zu füllen. Während die anderen in einem angeheiterten Zustand Flasche um Flasche entkorkten und in unendlich weite Soldatenkehlen schütteten, nippte er nachdenklich an seinem Glas und versteckte sich hinter einer unüberwindlichen Mauer aus verbohrtem Schweigen und schlechter Laune.
Plötzlich legte sich von hinten eine Hand auf seine Schulter, und eine vertraute Stimme flüsterte ihm durch den Lärm zu: »Was soll diese griesgrämige Trauermiene?« Henry Ashton hatte sich von seinem großen Glas und den beiden Schönen an seiner Seite losgerissen, einen jungen Offizier vom Platz neben Wesley vertrieben und sich selbst zu seinem Freund gesetzt. Obwohl er seit der Eröffnung des fröhlichen Saufgelages, die wohl zwei oder drei Stunden vor der Ankunft der Kameraden des 33. Regiments gelegen haben musste, vollauf damit beschäftigt gewesen war, seine jungen Herren bei Laune zu halten, und sicher schon weitaus mehr getrunken hatte, als ein vernünftiger Soldat es in einem solch heißen und ungesunden Klima tun sollte, war ihm doch nicht entgangen, dass Arthur an der ganzen Abendgesellschaft nicht teilnahm, sondern nur – fast wie ein armer Sünder – die Zeit absaß, zu der er verdammt worden war. Was für ein Unterschied zwischen den gemeinsamen Jugendtagen in Dublin und London und dieser Vorstellung am Tisch des Kommandeurs des 12. Regiments! Henry wusste nicht, was er davon halten sollte. Und Wesley wollte ihm die Sache nicht leichter machen: Er hatte beschlossen, sein Leben zu ändern, doch diese Entscheidung ging keinen Menschen auf der Welt etwas an.
»Laß gut sein, Henry! Eine lange Seereise ist nichts für die Infanterie! Ich hab das Meer noch nie richtig vertragen!« schwindelte er. »Du hast mir die beiden Ladys an deiner Seite noch gar nicht vorgestellt«, lenkte er dann vom leidigen Thema der Ausschweifungen in britischen Offiziersmessen ab.
»Das reizende blonde Geschöpf ist Jemima Smith, die älteste Tochter von Sir Charles Smith, dem Orientalisten. Und die Dunkelhaarige ist ihre jüngere Schwester Henrietta. Ich soll die beiden in Madras abliefern. Sie haben vor einiger Zeit das Pensionat verlassen und fahren zu ihrem Vater. Übrigens, weder die eine noch die andere kleine Lady ist verheiratet!«
Ashton zog den Oberst von seinem bequemen Platz und in Richtung Jemima und Henrietta.
Die nächsten Tage am Kap verliefen angenehm und ruhig. Zuerst hatte Arthur dafür gesorgt, dass die Männer des 33. Infanterieregiments ihre Transportschiffe zumindest tagsüber verlassen konnten. Damit sie nicht wild wurden und aus dem Ruder liefen, beschäftigte man sie mit Waffendrill, ein paar Märschen hinauf in die Tafelberge und Schießübungen. »John Company« hatte genug Geld in den Kassen, um die paar hundert Schuss Munition zu verkraften, die das 33. Regiment außer der Reihe verbrauchte. Schließlich sollten die Rotröcke in Indien sofort einsatzfähig sein.
Doch entgegen seiner sonstigen Gewohnheit überließ Arthur die Männer den Majoren Shee und West. Er hatte für sich und seine Nummer zwei, John Sherbrooke, ein anderes Arbeitsprogramm zusammengestellt: Seit Kapstadt sich fest in britischer Hand befand, war es nicht nur zu einer obligatorischen Zwischenstation auf dem Rückweg von Indien nach Europa geworden, sondern auch zu einem Ort, an dem die Beamten Seiner Majestät und der Ostindischen Kompanie Erholung vom krankheitserregenden Klima des Subkontinents suchten. Wenn man seine Ohren aufsperrte und an den Stellen herumlungerte, wo diese Heimkehrer und Erholungssuchenden sich aufhielten, dann konnte man – so vermutete der junge Offizier – sicher eine ganze Menge wertvoller Informationen aufschnappen. John Sherbrooke widersprach seinem gestrengen Vorgesetzten natürlich nicht. Es war viel angenehmer, mit der hübschen Jemima Smith am Arm durch Kapstadt zu ziehen, als oben in den Tafelbergen herumzurennen und auf imaginäre Feinde zu feuern. Wesley hatte sich die jüngere Henrietta von Oberst Ashton »ausgeliehen«, wie er es zynisch zu nennen pflegte. Doch John Sherbrooke konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass die zynische Bemerkung seines Chefs nur eine Schutzbehauptung war. Er und Arthur waren gerade einmal sechsundzwanzig Jahre alt, und bei aller Ernsthaftigkeit, die sie in ihrem Soldatenberuf an den Tag legten, waren sie doch nicht viel mehr als große, verspielte Kinder, die sich amüsieren und austoben mussten.
Bei ihrem gemeinsamen Spaziergang durch den hübschen botanischen Garten am Fuß der Tafelberge waren die vier jungen Leute natürlich auch anderen Spaziergängern aus gutem Hause begegnet. Jemima und Henrietta waren mit Henry Harvey Ashton schon vor einiger Zeit am Kap angekommen und wohlbekannt mit den Mitgliedern der kleinen britischen Kolonie. Natürlich hatte eine der vornehmen Damen Sir Charles’ Töchter sofort gefragt, wer denn ihre Begleiter in den schmucken roten Uniformen des Königs seien. Als man feststellte, dass auch die Herren Offiziere aus guten Familien kamen, ließ die Einladung zum Tee nicht lange auf sich warten.
Während Arthur Henrietta den Stuhl hinschob, konnte er sich nicht mehr zurückhalten und ließ die Augen dezent über ihre hübschen Schultern und ihren Nacken gleiten. Ohne ihre opulente Abendgarderobe, in einem einfachen Musselinkleid und das dunkle Haar locker hochgesteckt, sah die Kleine hinreißend aus. Außerdem hatte sie strahlend blaue Augen, denen man kaum widerstehen konnte.
Zufrieden ließ der Oberst sich an ihrer Seite nieder. Ihre Gastgeber waren auf dem Rückweg aus Fort St. George nach England und machten drei Monate Station am Kap, um sich zu erholen. Sir Marmaduke Orford war lange Jahre der Surveyor-General of the Ordonances von Lord Hobart, dem Gouverneur von Madras, gewesen. Nun hatte er seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert und befunden, dass zwanzig Jahre Dienst in Indien ausreichend seien. Die Orfords wollten nach Kent, wo ihre beiden Töchter mit einem Leutnant zur See, Wentworth, und einem Geographen, Hauptmann Philip Morgan, verheiratet waren. Sir Marmaduke hatte auf dem Subkontinent sein Glück gemacht und fuhr mit prall gefüllten Taschen nach Europa.
»So, so, Sie sind also einer der jüngeren Brüder von Lord Mornington! Wir haben viel miteinander zu tun gehabt, Ihr werter Bruder und ich. Seitdem er in den Aufsichtsrat der Kompanie berufen wurde, hat sich einiges verändert. Ein bemerkenswerter Mann, Mornington. Und ein enger Vertrauter des Premierministers. Sie werden es mit eigenen Augen sehen, junger Freund. All diese Unarten und Ausschweifungen, für die unsere überseeischen Besitzungen inzwischen berüchtigt sind, werden bald ein Ende haben. Keine dubashery mehr. Und wer dabei erwischt wird, Schmiergeld zu nehmen, der wandert ins Gefängnis.«
»Korruption!« übersetzte Arthur leise für John Sherbrooke, der seine Passage ans Kap der Guten Hoffnung nicht mit Studien der Landessprachen Indiens ausgefüllt hatte. Dann blickte der Oberst entschuldigend die Damen am Tisch an. »Ich möchte Ihnen diesen Nachmittag nicht verderben, Lady Julia, Miss Henrietta, Miss Jemima, aber Sir Marmaduke berichtet so interessante Dinge, dass ich ihm gerne einige Fragen stellen würde, wenn Sie gestatten!«
Lady Orford nickte dem Offizier freundlich zu, die beiden Töchter von Sir Charles Smith ergaben sich in ihr Schicksal. Obwohl Henrietta diese politischen Gespräche ausgesprochen langweilig fand, setzte sie doch ihr gewinnendstes Lächeln auf. Im Vergleich zu der Abendgesellschaft in Henry Ashtons Haus, bei der Wesley ihr ausgesprochen trübselig und fade vorgekommen war, schien er ihr außerhalb der alkohol- und tabakgeschwängerten Offiziersmesse ein ganz bemerkenswerter Vertreter des stärkeren Geschlechts zu sein. Er sprühte über vor Leben, seine graublauen Augen funkelten munter, während er den alten Sir Marmaduke über seine Adlernase hinweg ins Kreuzverhör nahm. Seine abgetragene Uniform fiel der jungen Frau an diesem sonnigen Nachmittag in einem blühenden Garten gar nicht mehr auf, denn im Gegensatz zu vielen Offizieren, denen sie zu Hause in England vorgestellt worden war, legte er großen Wert darauf, dass alles ordentlich und sauber war, und irgendwie verschwand seine so offensichtliche pekuniäre Not hinter einem freundlichen und umgänglichen Wesen und einem wachen Verstand. Sie bedauerte ein wenig, dass der hübsche junge Offizier in diesem Augenblick seine ganze Aufmerksamkeit nur Sir Marmaduke schenkte und keinen Blick für sie übrig hatte.
Der alte General hatte dazu angesetzt, die Lage im Karnatik zu schildern, der indischen Provinz, die sich wie eine Schlange entlang der Coramandel-Küste zog und mit vier britischen Besitzungen auf dem Subkontinent gemeinsame Grenzlinien hatte.
Henrietta verstand, dass es an diesen Grenzen nicht immer ruhig zuging. Jenseits des Karnatik lag Mysore, dessen Herrscher mit den revolutionären Franzosen verbündet war. Immer wieder stieß er mit seinen bewaffneten Räubern gegen die Handelsposten der Ostindischen Kompanie auf britischem Gebiet vor und raubte der ehrenwerten Gesellschaft die Früchte ihrer Arbeit. Lord Clive war bereits einmal gegen ihn gezogen und hatte die befestigte Hauptstadt Seringapatam belagert. Doch die Vorräte waren im Verlauf eines endlosen Tauziehens vor den starken Mauern ausgegangen, und die Soldaten starben im grausamen Klima Südindiens wie die Fliegen. Clive hatte seine Geschütze zerstört und sich dann mit gesenktem Haupt vor dem Vater Tippu-Sultans zurückgezogen.
Während Sir Marmaduke berichtete, zog sich auch Oberstleutnant John Sherbrooke zurück, allerdings nicht gedemütigt wie der große Clive, sondern am Arm der schönen Jemima.
Die älteste Tochter von Sir Charles Smith war eine leidenschaftliche Herzensbrecherin. Aus diesem Grunde begleitete Lady Julia Orford die beiden jungen Leute auf ihrem Spaziergang durch den Garten. Doch sie war anständig genug, ein wenig Abstand zu halten und so das sanfte Turteln der Tauben nicht zu stören.
Während Sherbrooke Jemima kleine Komplimente machte und unablässig mit ihr plauderte, lauschte Arthur gebannt den Worten von Sir Marmaduke. Erst als der Tag zum Abend wurde und der Anstand es gebot, sich zurückzuziehen, um der Dame und dem Herrn des Hauses zu gestatten, sich zum Dinner umzukleiden, bemerkte Wesley, dass die kleine Lady immer noch brav neben ihm saß. Er legte den Kopf schief und sah sie an wie ein trauriger Cockerspaniel. »Miss Henrietta, es tut mir leid, Ihnen den ganzen Nachmittag mit diesem endlosen Gespräch über Indien verdorben zu haben. Sie müssen mich für einen ungehobelten irischen Bauerntölpel halten!«
Orford schmunzelte, während die junge Frau beschwichtigend ihre Hand auf den Arm des Offiziers legte. »Nicht doch, Oberst Wesley! Ich fand es sehr anregend, Ihnen und Sir Marmaduke zuzuhören! Als mein Vater seine persische Grammatik verfasst hat, da habe ich ihm auch immer gerne zugehört, wenn er von Indien erzählte. Es muss ein faszinierendes Land sein! Ich kann es kaum noch erwarten, in Fort St. George anzukommen und mit eigenen Augen zu sehen, was man mir in meinen Kindertagen immer so lebhaft beschrieben hat!«
Orford räusperte sich. »Wesley, ich werde Ihnen natürlich ein Empfehlungsschreiben für Sir Charles mitgeben. Ich glaube, Sie sollten ihn unbedingt sehen und sich ausführlich mit ihm unterhalten. Er ist ein intimer Kenner der gesamten politischen Lage in den unabhängigen Gebieten, und er kann Ihnen sicher viele Dinge über Tippu, den Rajah von Bullum oder den Peshwa erklären, die mir als einfachem Finanzbeamten Seiner Majestät verschlossen geblieben sind.«
Henrietta lächelte Sir Marmaduke wie eine Verschwörerin an. Sie war der Idee, den jungen Oberst des 33. Regiments als Gast ihres Vaters in seinem Haus in Poonamallee zu sehen, nicht abgeneigt. Schließlich hatte Sir Charles seine Töchter zu sich nach Indien geholt, um sie zu verheiraten.
Arthur hatte seine Enttäuschung mit Miss Pakenham zwar noch nicht überwunden, aber dieser Schmerz machte ihn nicht blind. Der Blick war seinem wachsamen Augenpaar nicht entgangen, und noch weniger entgingen ihm die vielen anderen Blicke, die Miss Henrietta ihm ganz unverfroren und selbstbewusst zuwarf. Wie alt mochte die Kleine sein? Achtzehn, vielleicht neunzehn Jahre. Er würde Ashton fragen. Diskret natürlich. Er hatte keinesfalls vor, auf das Fohlen hereinzufallen. Aber nichts sprach dagegen, sich im Rahmen des Anstands und der Ehre eines Gentlemans mit ihr zu vergnügen.
Als er sie aus dem Augenwinkel betrachtete, ging ihm durch den Kopf: »Du bist viel zu gut für einen Soldaten, bei dem du nicht weißt, ob er zurückkommt, oder ob er dich an deinem zwanzigsten Geburtstag bereits zur Witwe macht.« Er zog seine Uhr aus der Tasche und ließ den Deckel aufschnappen. Es war bereits nach fünf am Nachmittag, und es ziemte sich nicht, Sir Marmaduke und Lady Julia weiter zu belästigen. »Mit Ihrer Erlaubnis«, er verbeugte sich leicht vor Orford, »werden Oberstleutnant Sherbrooke und ich die Ladys jetzt nach Hause geleiten. Oberst Ashton hat Sir Charles versprochen, gut auf Miss Henrietta und Miss Jemima aufzupassen, und wir möchten nicht, dass er sich um seine beiden Schutzbefohlenen sorgt!«
Henrietta konnte ihre Enttäuschung über Wesleys vernünftigen Entschluss nur mit Mühe verbergen. Sir Marmaduke erwiderte die Verbeugung mit einem Augenzwinkern. »Kommen Sie morgen zum Dinner, Oberst! Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein paar Freunde vorstellen dürfte, die Ihren Wissensdurst über Indien besser zu befriedigen verstehen als ich! Um sieben Uhr also, und selbstverständlich sind Oberst Ashton, Oberstleutnant Sherbrooke und die beiden jungen Damen ebenfalls eingeladen. Lady Julia und ich genießen es, in geselliger Runde zu speisen.«
»Zu gütig von Ihnen, Sir. Sherbrooke und ich nehmen Ihre Einladung mit Freuden an, und was Miss Henrietta und Miss Jemima betrifft, werden wir Oberst Ashton um seine Zustimmung bitten!« Arthur bot der jüngeren der beiden Smith-Töchter seinen Arm an. Dann ging er mit ihr zu Lady Julia, um sich für die Einladung zu bedanken und sich zu verabschieden.
John Sherbrooke verstand ohne Worte, dass sein Kommandeur beschlossen hatte, den vergnüglichen Teil des Tages zu beenden. Er verbeugte sich galant vor der alten Dame und folgte Arthur durch den Garten der Orfords.
Kapstadt war eine reiche und europäisch geprägte Stadt. Es bereitete zu dieser Tageszeit keine Schwierigkeiten, eine Droschke zu bekommen. Noch vor sechs Uhr abends befanden Jemima und Henrietta sich wieder in Henry Harvey Ashtons Obhut, die Einladung für den folgenden Tag war abgestimmt worden, und die beiden Offiziere des 33. Infanterieregiments machten sich auf den Weg zu ihren eigenen Quartieren am Hafen, unweit des Kais, an dem die Transportschiffe der Soldaten festgemacht waren.
Arthur hatte sich für diese bescheideneren und weniger eleganten Unterkünfte entschieden, um näher bei seinen Männern zu sein.
Während die jungen Offiziere Sherbrooke, West und Shee das muntere Nachtleben von Kapstadt genießen durften, zog er es vor, gemeinsam mit dem Zahlmeister des Regiments, Sergeant-Major John Dunn, zu arbeiten. Viele Dinge mussten besorgt werden, bevor die riesigen Schiffe wieder in See stachen. Auf der Überfahrt von England nach Afrika hatten sich einige Nachlässigkeiten eingeschlichen, die Wesley missfielen und derer er für das längere Stück der Reise Herr zu werden gedachte.
Der Teil des Regiments, der Major West anvertraut und auf drei Schiffen untergebracht worden war, befand sich in Bestform. Die Männer sahen ausgeruht und gesund aus und besaßen eine glänzende Moral. Die, die unter Shee nach Kapstadt gekommen waren, machten einen anderen Eindruck auf den Offizier. Er kannte jeden seiner 733 Soldaten mit Namen. Er wusste um die Vergangenheit seiner Männer, um ihre Vorzüge und um ihre Charakterschwächen. Wenn er sich ein bisschen anstrengte, gelang es ihm sogar, fast wörtlich die Einträge auf den 733 Blättern des Regimentsbuches aufzusagen: Größe, Gewicht, Physiognomie, Bestrafungen und Auszeichnungen, Dienstjahre und Familienstand. Arthur hing mit derselben Leidenschaft und Liebe an seinem West Riding, die ein Mann in seinem Alter normalerweise der Dame seines Herzens zuteilwerden ließ. Nachdem er sicher war, dass all seine Offiziere fort waren und die Soldaten sich vollständig auf den Transportschiffen befanden, gab er Sergeant-Major Dunn ein Zeichen, ihm zu folgen.
John war der dienstälteste Unteroffizier des Regiments und ein Mann mit makelloser Vergangenheit. Bevor er den Rock des Königs angezogen hatte, war er ein wohlhabender Bauer in den schottischen Bergen gewesen. Nur der Tod seiner Frau und seiner drei Kinder, die von einer schlimmen Pockenepidemie dahingerafft worden waren, hatte ihn dazu bewogen, in die Armee einzutreten. Er war nicht aus Not oder wegen eines kriminellen Aktes den Trommeln des Anwerbungssergeanten gefolgt, sondern weil er – aus Trauer – mit seiner Heimat und seiner Vergangenheit brechen wollte. Als Arthur zum 33. Regiment gekommen war, hatte Dunn dem jungen, unerfahrenen und linkischen Offizier oft diskret geholfen. Im Verlauf der letzten drei Jahre waren aus dem Vertrauensverhältnis gegenseitige Wertschätzung und Respekt geworden. Arthur und Dunn hatten sich auf eine für die britischen Landstreitkräfte ungewöhnliche, ja gefährliche
Gratwanderung begeben: Wenn niemand in der Nähe war, gestanden sie sich ein, dass sie eigentlich gute Freunde waren!
Der Oberst schloss sorgfältig die Tür seines Zimmers, während der Sergeant-Major sich aufmachte, Kerzen in dem kleinen Raum anzuzünden. »Sir, ich glaube, die Männer verstehen nicht, dass es in diesem warmen, schwülen Klima notwendig ist, sich täglich mit Seewasser gründlich zu waschen und mindestens einmal pro Woche die Hängematten zu säubern. Sie schlafen so dicht gedrängt, dass der kleinste Floh, den der eine hat, sofort auf die restlichen 149 Rotröcke überspringt. Major Shee versteht es auch nicht. Er war die ganze Überfahrt nur damit beschäftigt ...« Er stockte und warf Arthur einen gequälten Blick zu, während dieser seinen Uniformrock auszog und sich bequem in einen Sessel fallen ließ.
»Sprechen Sie es doch einfach aus, John! Wir beide wissen es, und jeder bis hinunter zum jüngsten Trommlerjungen weiß es: Shee hat seine Tage mit Kartenspielen und seine Nächte mit Saufen zugebracht.« Der Oberst wies mit der Hand auf den zweiten Sessel im Raum und gebot seinem Zahlmeister, Platz zu nehmen.
Dunns Reaktion auf die harte und geradlinige Aussage seines Kommandeurs war nur ein leichtes, trauriges Lächeln.
»Sie sollten mir alles erzählen, mein Freund. Ich war diese fünfzehn langen Wochen nicht mit dem Regiment auf See, deswegen werde ich Major Shee gegenüber nicht mit der Faust auf den Tisch schlagen ... noch nicht.«
Dunn fuhr sich müde mit der Hand über die Augen und schüttelte den Kopf. »Sir, wenn Rob Seward weiterhin in einer von Shees Kompanien bleibt, wird der junge Mann bald keine Sergeantenstreifen mehr auf dem Ärmel tragen, sondern die Striemen der Neunschwänzigen auf dem Rücken!«
»Zwischen Shee und einem Tanz mit der Katze stehe immer noch ich, John. So leicht bindet man mir Seward nicht zwischen die Hellebarden.«
»Rob wird Shee in den nächsten Tagen den Schädel einschlagen, wenn dieser nicht aufhört, Miss Mary zu belästigen. Die Soldatenfrauen müssen Sewards Frau schon vor dem Major verstecken. Er macht dem Mädchen gegenüber bei jeder Gelegenheit anzügliche Bemerkungen, oder er versucht gar, sie zu betatschen.«
»Gütiger Himmel, die Kleine ist kaum achtzehn Jahre alt und stammt aus einer strengen, katholischen Familie. In der Klosterschule hat man sie unterrichtet und dann dem guten Rob zur Frau gegeben. Und der wacht über sie wie ein Zerberus. Warten Sie, John, bis wir in Indien sind. Ich will Shee in flagranti erwischen, und dann reiße ich ihm die Epauletten von der Schulter. Sagen Sie, mein Freund, brauchen Sie nicht dringend einen Stellvertreter? Ich habe das Gefühl, dieser ganze Papierkrieg ist ein bisschen viel für einen einzelnen Mann.« Oberst Wesley verzog das Gesicht zu einem hinterhältigen Grinsen. Er wollte Ruhe und Ordnung in seinem Regiment. Doch Major Shee hatte es schon seit langer Zeit darauf angelegt, die Harmonie zwischen Kommandeur und Soldaten zu stören. Da es keine legalen Mittel gab, den ständig betrunkenen und bösartigen Offizier loszuwerden, beschloss Arthur, ihn einfach auszumanövrieren.
John Dunn nickte zustimmend. »In diesem Fall muss Robin – zusammen mit Miss Mary – aber von der Warwick auf die Argonaut überwechseln, damit ich die lange Fahrt nach Kalkutta nutzen kann, meinen Assistenten mit der Buchführung und dem ganzen administrativen Kram vertraut zu machen.«
»Unbedingt, John! Ich glaube nicht, dass wir vor Ort viel Zeit haben werden, uns mit solchen Dinge zu beschäftigen. Sie werden als erstes gemeinsam losziehen und die Versorgung der Männer sicherstellen. Sir Marmaduke Orford, der gerade aus Fort St. George angekommen ist, hat mir berichtet, wie unruhig die Lage im Dekkan ist, und ich nehme an, dass wir sofort ins Feld geschickt werden.«
Zufrieden blickten sich der alte Sergeant-Major und der junge Oberst an. Dann erhob sich Wesley von seinem bequemen Sessel, holte zwei Gläser von einer kleinen Kommode und füllte sie mit Brandy. Ein Glas drückte er Dunn in die Hand. Nachdem die beiden Männer getrunken hatten, verabschiedete sich der Sergeant-Major. Arthur löschte alle Kerzen bis auf eine und setzte sich mit Sir Charles Smiths Wörterbüchern an den Arbeitstisch. Er hatte eine lange Nacht vor sich. Jeden Tag studierte er mindestens fünf Stunden die Sprachen und die Besonderheiten des künftigen Kriegsschauplatzes. Der Nachmittag mit Henrietta im Garten war ein Vergnügen gewesen, das ihn nicht von seinen guten Vorsätzen abhalten durfte.
Wie Oberst Henry Harvey Ashton vermutet hatte, blieb das 33. Regiment vierzehn Tage in Kapstadt. Die Schiffe der Ostindischen Kompanie wurden repariert, frischer Proviant und Trinkwasser für die fünfmonatige Fahrt vom Kap nach Kalkutta wurden geladen, das Pulver und die Munition der Geschütze überprüft. Die Seeleute flickten die Segel und teerten sorgfältig die Rümpfe der Schiffe, denn der Seeweg über den Indischen Ozean, vorbei an Madagaskar und der Île-de-France, entlang der Küsten der Malediven und Ceylons bis in die Bucht von Bengalen und schließlich durch die Gangesmündung nach Fort William war nicht ungefährlich. Außer französischen und amerikanischen Kaperschiffen drohten auch noch Sommerstürme und unberechenbare Winde.
Wesley hatte jeden einzelnen Tag an Land damit verbracht, mit den Mitgliedern der britischen Kolonie in Kapstadt zu sprechen, die auf dem Rückweg aus Indien waren. Sir Marmaduke Orford hatte es sich nicht nehmen lassen, den jungen Wesley in seinen Bekanntenkreis einzuführen, denn im Verlauf einiger gemeinsamer Abendessen hatte er den Oberst zu schätzen gelernt. Der hohe königliche Beamte vermutete, dass England schon bald von Wesley hören würde, wenn seine Gesundheit dem mörderischen Klima und den Seuchen und Krankheiten, die den Subkontinent heimsuchten, standhielt. In den zwanzig Jahren, die er in Indien verbracht hatte, war Orford vielen Offizieren begegnet – Männern mit einem Patent des Königs und Männern mit einem Patent von »John Company« –, doch nie war ihm einer begegnet, der so schnell so viel begriff und bereits Schlussfolgerungen über ein Gebiet und eine politische Lage zu ziehen vermochte, obwohl er noch nicht einmal seinen Fuß auf indischen Boden gesetzt hatte.
Während Arthur der kleinen Henrietta mit einem spielerischen Kniefall am anderen Ende des Gartens einen Strauß Jasmin in die Hand drückte, flüsterte Sir Marmaduke Lady Julia zu: »Wissen Sie, meine Liebe, es wird der Tag kommen, an dem wir unseren Freunden in England erzählen können, dass wir diesen jungen Offizier schon kannten, als er noch ein Oberst war. Wenn das Klima oder der Krieg ihn nicht umbringen, wächst hier ein großer Soldat heran und vielleicht sogar mehr als das.«
»Der junge Ashton hat mir vor ein paar Tagen erzählt, dass man ihm während des unglückseligen Flandernfeldzugs bereits eine eigene Brigade unterstellt hat. Wesley war damals gerade dreiundzwanzig Jahre alt. Und der Junge muss seine Sache wirklich gut gemacht haben. Die Schulterstücke trägt er nicht, weil Lord Mornington ihm das Patent gekauft hat ...«
Lady Julia schenkte Sir Marmaduke Tee nach und beobachtete weiter amüsiert, wie Arthur Miss Henrietta den Hof machte. Sie hatte nicht das Gefühl, dass es mehr als ein Spiel war, bei dem weder die eine noch die andere Seite zu Schaden kam. So ernsthaft Oberstleutnant John Sherbrooke Jemima umwarb, so unverfänglich und eindeutig war doch Wesleys Verhalten der jüngeren Schwester gegenüber. Seine graublauen Augen sahen ein Kind, das amüsiert werden wollte, und er tat genau das, was ein älterer Bruder tun würde: Wenn Henrietta Tennis spielen wollte, dann war er ein williges Opfer, eifrig bemüht, das Mädchen gewinnen zu lassen. Auf der Tanzfläche gestattete er ihr, ihn zu tyrannisieren.
In den Blicken, die er ihr zuwarf, konnte Lady Julia keine Leidenschaft oder andere Gefühle lesen. Es war spöttisches oder belustigtes Augenzwinkern oder gespielte Unzufriedenheit, wenn die Kleine zu forsch wurde. Einmal hatte die alte Dame beobachtet, wie Henrietta versuchte, einen Kuss zu provozieren. Bekommen hatte sie einen Nasenstüber und schallendes Gelächter. Lady Julia machte sich nicht einmal mehr die Mühe, ein wachsames Auge auf den Oberst und die Tochter von Sir Charles Smith zu werfen. Sie war erfahren genug, um zu begreifen, dass der junge Mann nach Indien fuhr, um seinen Weg zu gehen. Er würde sich nicht mit einer Frau belasten. Er hatte das Schwert gewählt, auch wenn Henrietta sicher insgeheim hoffte, sie könnte den Sieg über seine Ambitionen doch noch davontragen.
»Arthur, wann werdet ihr Kapstadt verlassen?« erkundigte sich die jüngere Tochter von Sir Charles Smith. In ihrer Stimme lag ein Hauch von Sorge.
Der Offizier nahm freundschaftlich die kleine Hand des Mädchens in die seine und führte sie zu einer Bank, die unter einem Zitronenbaum stand. »Setz dich ein bisschen zu mir, Henrietta. Ich glaube, wir müssen uns ernsthaft miteinander unterhalten.« Obwohl sein Verhalten eindeutig war, schien die junge Dame nicht zu verstehen, dass es in seinem Leben keinen Platz für andere Gefühle gab als Freundschaft und Kameradschaft. Die Schiffe würden in zwei Tagen in See stechen, und er hatte beschlossen, ehrlich und offen zu sein.
Henrietta hatte sich ganz dicht neben ihn gesetzt und ihre Hand auf seinen Arm gelegt. Der Blick, den sie dem Offizier zuwarf, war alles andere als ermutigend. Das Paar blauer Augen strahlte, genährt von der Hoffnung, er würde die verhängnisvollen Worte aussprechen, auf die sie so sehr wartete.
Er erinnerte sich genau: Kurz bevor das Regiment nach Flandern in den Krieg gezogen war, hatte Kitty ihn mit genau denselben Augen angesehen, nur waren es nicht klare, blaue Saphire gewesen, sondern tiefbraune, kostbare Topase. »Henrietta, wie alt bist du eigentlich?« begann er sein schwieriges Vorhaben.
»Beinahe achtzehn, Arthur. In zwei Monaten.«
»Du weißt, dass wir in achtundvierzig Stunden auslaufen?« Es war nicht einfach, die richtigen Worte zu finden. Die Saphire strahlten unwiderstehlich. Das Fohlen war reizend und würde eines Tages zu einer wunderbaren Frau erblühen. Irgendwie ähnelte Henrietta Kitty so, wie er sie in Erinnerung behalten wollte: verspielt, lebenslustig, lebendig und mit einem wachen Verstand. Es wäre so einfach, seine Niederlage in Irland mit fünf kurzen Worten unter einem schwer tragenden Zitronenbaum in einem Garten am anderen Ende der Welt wettzumachen. Doch zwischen diesen Worten und seinem persönlichen Glück stand Indien, ein eiserner Vorsatz, ein Schwur, der wichtiger war als Liebe, Zärtlichkeit, Zuneigung und eine eigene Familie. »Ich habe dich in der kurzen Zeit hier in Kapstadt wirklich liebgewonnen, Henrietta.« Seine Stimme war unsicher, und er hatte Angst, in die strahlend blauen Saphire zu blicken. »Trotzdem ist es sinnlos. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, auf die du wartest, wirst du an deinem zwanzigsten Geburtstag mit großer Wahrscheinlichkeit bereits Schwarz tragen.«
»Was willst du mir erklären, Arthur?« Die Stimme des Mädchens hatte sich plötzlich verändert. Sie hatte nichts Kindliches, Verspieltes mehr. Wesley hatte sie nicht angesehen, sondern geradeaus geblickt. Er hatte das Gefühl, dass neben ihm nicht mehr die kaum achtzehnjährige Henrietta saß, sondern eine reife, erwachsene Frau. Er wandte sich ihr zu und nahm ihre Hände ganz sanft in die seinen. Jetzt war seine Stimme nicht mehr unsicher, sondern fest und kalt.
»Du weißt, dass ich Soldat bin. Und ich fahre nach Indien, um in einen Krieg zu ziehen. Du hast etwas Besseres verdient, als die Frau eines Berufsoffiziers zu werden. Du würdest nur deine jungen Jahre damit zubringen, auf einen Mann zu warten, der nie da ist, wenn du ihn brauchst. Bei jedem Klopfen an deine Tür wäre dein erster Gedanke, dass irgendein anderer Mann in einer roten Uniform auftaucht, um dir zu sagen, dass der, auf den du wartest, nie wieder zurückkommt.« »Nicht alle Soldaten fallen, mein Lieber!« erwiderte Henrietta spöttisch. »Manche werden sogar ziemlich alt und sterben in ihren Betten an Herzversagen.«
»Henrietta, ich kann nur Freundschaft geben.«
»Sir John Sherbrooke hat offenbar weniger Bedenken als du – und das, obwohl er sicher in denselben Krieg zieht, in den auch du ziehen wirst«, stichelte die Stimme neben Wesley. Henrietta war zwar noch ein junges Mädchen, aber sie war nicht dumm. Als Tochter eines berühmten Gelehrten aus einer großen Familie von Akademikern hatte man auf ihre Erziehung viel Wert gelegt. Sie konnte durchaus mit Worten umgehen.
»John Sherbrooke ist John Sherbrooke. Er hat seine Einstellung zum Leben, und er muss seine Verantwortung tragen. Vielleicht sorgt er sich nicht um Jemima. Wenn ihm etwas zustoßen sollte, kann er mit der Gewissheit die Augen schließen, dass eine ganze Horde von Sherbrookes – Vater, Brüder, Cousins – existiert, die sich rührend um die Witwe des gefallenen Helden kümmern wird und weder Mühe noch Kosten scheut, um eine ganze Brigade unglücklicher Halbwaisen standesgemäß großzuziehen.«
»Du hast auch eine Familie, Arthur!« Henrietta gab sich nicht so einfach geschlagen. Oberst Wesley argumentierte logisch und bediente sich schlüssiger Argumente. Doch jeder seiner Thesen konnte man begegnen.
»Meine Liebe, wenn du jemals in die Lage kommen würdest, vom guten Herz meiner reizenden Familie abhängig zu werden, würdest du den Tag verfluchen, an dem du mich überredet hättest, dir einen Antrag zu machen. Die Wesleys und Morningtons würden dich eher an der Pforte von Dungan Castle vor Hunger sterben sehen, als auch nur einen Bediensteten mit einer Schüssel Suppe zu schicken. Und ich selbst kann dir nichts bieten, außer einem Offizierspatent und den Schulden meines Vaters.« Arthurs Stimme hatte einen bösen, zynischen Klang bekommen. Jedes Mal, wenn er von den Wesleys und Morningtons sprach, erfüllte ihn unbändiger Hass, ein Hass, den er nicht zu unterdrücken vermochte.
Henrietta spürte seinen Gefühlswandel. Während der Tage am Kap und im Garten von Sir Marmaduke hatte sie viel über Richard Lord Mornington gehört. Die meisten hatten mit Ehrfurcht und Bewunderung über diesen Mann gesprochen, seine Aktionen im Aufsichtsrat der Ostindischen Kompanie gelobt oder von seinen glänzenden Gesetzesvorschlägen im Unterhaus berichtet und davon, dass er ein enger Freund des britischen Premierministers war und das Ohr der Regierung hatte. Einige besonders wagemutige Gäste hatten seinen Namen sogar mit dem Amt des nächsten Außenministers oder Finanzministers der Insel in Verbindung gebracht. Immer wenn die anderen über Mornington philosophierten, verfinsterte sich Arthurs Miene. Seine abgetragene Uniform, die offensichtliche finanzielle Not, unter der er litt, und dieser sonderbare Gesichtsausdruck hatten Henrietta mehr über das Verhältnis zwischen ihm und seiner Familie erzählt als seine letzten, hasserfüllten Worte. »Und wenn das Schicksal es gut mit dir meint, Arthur, und wenn du in Indien dein Glück machst?«
»Wir werden sehen, Henrietta. Darf ich dir einen Rat geben ...« Er schaute ihr tief in die blauen Augen und hielt ihre kleinen Hände ganz fest.
»Gib mir deinen guten Rat, Arthur, und sei mir nicht böse, weil ich so forsch gewesen bin.« Sie hatte verstanden, dass Wesley seinen Weg gewählt hatte und – aus irgendeinem geheimnisvollen Grund – um nichts in der Welt Zugeständnisse machen konnte.
»Du bist noch so jung und hast ein ganzes Leben vor dir. Du wirst viele nette Menschen kennenlernen. Wähle dir einen, der sein Herz nur dir schenkt und keine so anspruchsvolle Geliebte hat wie die Armee. Lasse mich in zwei Tagen ziehen und behalte die schönen Stunden in Erinnerung, die wir miteinander verbringen durften. Und dann, irgendwann, triffst du deine Entscheidung. Ich werde dich ab und an besuchen, und du kannst dann selbst sehen, ob du wirklich irgendetwas für mich empfindest. Gib dir selbst Zeit und gib mir Zeit. Wenn es das Schicksal gut mit mir meint und ich mein Glück in Indien mache, dann kommt vielleicht der Tag, an dem ich dir diese schwerwiegende Frage stellen kann, ohne von deinem Vater wie ein räudiger Hund aus dem Haus gejagt zu werden.«
»Arthur, Papa würde dich nicht ...«
»O doch, Henrietta! Er würde! Er liebt sein Kind und will nur dein Bestes. Er wird deine Hand nicht an einen unbedeutenden, mittellosen Oberst wegwerfen, der noch nicht einmal einen Titel führt, und der dir auf irgendeinem abgelegenen Außenposten im Dschungel ein Leben bietet, das nicht viel besser ist als das der einfachen Soldatenfrauen ...«