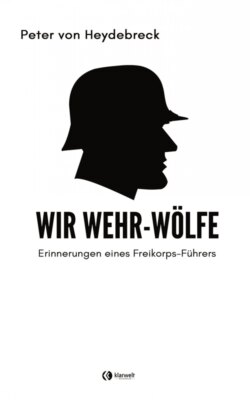Читать книгу Wir Wehr-Wölfe - Peter von Heydebreck - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Marschieren
Оглавление„Wir, die wir den Lehnseid geschworen,
Stehn täglich gelassen am offenen Grab.
Doch Hagen hat etwas verloren,
Was keiner von uns seinem Lehnsherrn gab.“
„Wir gaben in klirrenden Tagen
Dem König den Schwertarm für billige Huld,
Doch am schwersten Tage gab Hagen
An Gunther den Eid: Mein Teil sei die Schuld.“
Börries Frhr. v. Münchhausen.
Wir marschierten durch den einbrechenden Abend des 4. November. Hinter uns lag die Schlacht. Und mehr noch: der Krieg, doch das wussten wir nicht. Vor uns die sinkende Dunkelheit glich der Zukunft, und damit hatten wir uns schon lange abgefunden. Wir wussten lediglich, dass wir hungrig und müde waren und erhofften von der Zukunft nur eins, dass unsre Opfer nicht umsonst sein möchten. Ein Großkampftag war vorüber. Einer der vielen; programmmäßig war er verlaufen. Nach massierter Artillerievorbereitung hatte der Feind seinen Angriff einige Kilometer vorgetragen, dann war er zwischen Mittag und Abend zum Stehen gekommen; vor wenigen beherzten Scharfschützen hier, dort vor einem einsamen Maschinengewehr. Die Feuerwalze hatte sie übersprungen. Da lagen sie fest, die Sturmkolonnen des Marschall Foch, lagen flach an die Erde gedrückt durch den Willen weniger lehmfarbener Gestalten und warteten. Warteten auf Flieger, Tanks, Artillerie, auf die vernichtende Macht ihres Materials, dass sie diese deutsche Front zerschlüge und den Weg frei mache. Lagen immer noch auf französischem Boden. Einst von den deutschen Armeen im Sturmlauf weniger Tage durchschritten, verlangte seine Befreiung das Opfer ewig neuer Schlachten. Hatten noch eine weite Straße bis zum Rhein, noch nicht die Hälfte errungen. Mit Recht sang der Tommy sein „That is a long, long way to Tipperary, that is a long, long way to go“, den Londoner Gassenhauer. Ihre Freude am Siegen ward lahm. Man merkte, auch drüben wurde schon zu viel vom Frieden geredet.
Wir marschierten zurück, nicht weit, nur einige Kilometer, nur bis zum äußersten Rande der Schlacht. Dort wurde, wie so oft nun schon, eine neue Front errichtet.
Uns Führer erwartete eine unruhige Nacht. Die Mannschaft schlief, die Funktionäre aller Grade arbeiteten. Die gesamte Brigade, in einem Dorf versammelt, sollte neu gegliedert werden, lange Wochen des Einsatzes hatten an ihren Gefechtsstärken genagt. Die Verbände wurden daher zusammengelegt und aus je zwei Bataillonen eines gebildet. Ich erhielt die Führung des auf diese Weise aus den Radfahrbataillonen 5 und 6 neuformierten Truppenkörpers. Kaum zusammengekoppelt, besetzten wir bereits in den Vormittagsstunden unseren neuen Gefechtsabschnitt. Er lag in der Gegend südöstlich Valenciennes und des Forét de Mormal, in dem sich die Kämpfe des gestrigen Tages abgespielt hatten. Vor der Front seltene Ruhe. Nur tastend suchte der Feind mit uns Gefechtsfühlung zu gewinnen, auch seine Artillerie beschränkte ihre Tätigkeit auf vereinzelte Feuerüberfälle. Mir kam die Ruhe besonders gelegen, weil sie mich in die Lage versetzte, einen Überblick über die so schnell zusammengestellte Formation zu gewinnen. War es doch eine Belastung des Verantwortungsbewusstseins in dieser entscheidungsschwangeren Zeit, vollkommen fremde Verbände zu führen. Gut, dass ich die Zukunft und ihre Aufträge für uns nicht durchschaute! Wertvolle Unterstützung fand ich durch die Adjutanten der Bataillone 5 und 6, die Leutnants Voß und Oppermann, freudige Genugtuung in der Tatsache, dass jetzt auch 3 Radfahrkompagnien Oelser Jäger unter meinem Kommando standen.
Da, überraschend schon am nächsten Abend der Ablösungsbefehl. Er berief uns für den folgenden Tag in einem einzigen Gewaltmarsch nach Brüssel. Es verlautete, wir sollten als Belohnung für unsere seit Einsatz an der Westfront bewiesene Tapferkeit für einige Zeit dorthin in Ruhequartiere verlegt werden. Auch Waffenstillstands- und Friedensgerüchte gingen um. Doch warum der Gewaltmarsch? Wir gaben nicht viel auf solche Nachrichten, hatten weder Zeit noch Laune für all die Etappenlatrinen und ließen Rätsel Rätsel sein. Die Jäger schwangen sich auf ihre Räder, ich in mein Auto und froh, einmal wieder eine dem Wesen unserer Sonderwaffe entsprechende Verwendung gefunden zu haben, eilte die bewegliche Truppe nach Norden.
20 km vor Brüssel Halt! Wir wurden abgedreht mit Marschziel Lüttich, das wir bis zum 10. November nachmittags zu erreichen hatten. Die Straße dorthin, belebt, bot nicht ein Bild, aus dem auf besondere Ereignisse hätte geschlossen werden können. Vereinzelten Indiszipliniertheiten von Landsturmmännern begegneten wir mit der ganzen Verachtung, die eine ihres Wertes sich bewusste Fronttruppe den prahlerischen und selbstsüchtigen Auswüchsen von gewissen Elementen der Etappe, und zwar aller Grade, stets gezeigt hat. Obwohl uns offiziell nichts bekannt wurde, gewann ich den Eindruck, dass Waffenstillstandsverhandlungen im Gange sein müssten. Auch erfuhren wir die Tatsache, dass in einigen Städten der Heimat revolutionäre Strömungen gegen die Ufer der Ordnung brandeten. Etwas Positives war nicht zu erlangen. Unser Tag, durch die gewaltigen Märsche ausgefüllt, gab uns keine Muße, wilden Gerüchten nachzuspüren.
Umso niederschmetternder die Wirklichkeit!
Etwa 3 Uhr nachmittags. Das Bataillon hatte seinen Bestimmungsort zur befohlenen Stunde erreicht und ruhte entlang der Straße. Vor uns die Stadt erweckte in den abgespannten Geistern der marschmüden Truppe freudige Erwartungen. Quartiere, Mädchen, andere langentbehrte kleine Lebensfreuden lockten. Zwischen den ersten Häusern warteten Offiziere der Kommandantur Lüttich. Schweigend übergaben sie mir in verschlossenen Umschlägen Anweisungen und Befehle. Ich erbrach den ersten, er war von der Obersten Heeresleitung. Der Boden unter mir wankte, ich glaubte zu irren, las nochmals. In dürren Worten, fast höhnisch, herzlos und sachlich: Liquidierung des Krieges — Revolution in ganz Deutschland — das Schicksal der Krone — der Kaiser verraten! Und als letzter Punkt die schamlose Zumutung: sofort Soldatenräte zu bilden. Darunter der Name v. Hindenburg. Ich fieberte vor Empörung, hielt alles für eine gemeine Lüge, für eine Infamie und ließ das unselige Blatt in meiner Tasche verschwinden. Weitere Schriftstücke, trostlos, erbärmlich. Pflichterfüllung, gegebene Tatsachen, des Dienstes gleichgestellte Uhr lief weiter, als ob nichts passiert fei. Nirgends ein mutiges Wort, das Verrat Verrat nannte, nur Resignieren und das Bestreben, noch Schlimmeres zu verhüten. Und dann der Weisheit letzter Schluss: geordnet in die Heimat zurückkehren. Doch das Wozu, das Ziel war nicht genannt.
Schließlich der besondere Auftrag für uns. In Lüttich Tausende von Deserteuren, beziehungsweise Versprengte. Unter ihnen in Uniform Aufwiegler, die die Heimat entsandt hatte. Stündlich wurde offener Aufruhr erwartet. Riesige Proviantdepots, deren Plünderung die Verpflegung der Fronttruppen gefährden würde, seien zu schützen, Lüttich, das große Defilee für sämtliche in Belgien stehenden Heeresteile, unbedingt freizuhalten. Alles käme jetzt auf die Haltung der Radfahrbataillone an.
Damit waren wir mitten hineingestellt in das erbärmliche Narrenspiel.
Der Zwang zum Handeln gab mir die Ruhe wieder. Ich instruierte die Unterführer und sprach dann zu den einzelnen Kompagnien persönlich. Von den Anweisungen und Befehlen gab ich nur das bekannt, was ich für gut hielt, und kennzeichnete die Zumutung, Soldatenräte zu bilden als das, was sie war, als einen Verrat am deutschen Heere, als den Versuch, das Vertrauen der Soldaten zu ihren Offizieren zu vernichten, die im Feuer gehärtete Kampfgemeinschaft der Fronttruppen zu zerschlagen. Dann fügte ich hinzu, der Auftrag des Bataillons, die innere Stadt zu sichern, würde in den kommenden Tagen die größten Anforderungen an den bewährten Geist der Kompagnien stellen, der Weg dorthin durch die Straßen der Stadt einem Kreuzgang der Erniedrigung gleichen. Darum die Zähne zusammengebissen, kein Blick nach rechts noch links, aber das Haupt stolz erhoben, diszipliniert wie ein Bataillon der Friedenszeiten, als die unüberwindlichen Soldaten der 1000 Schlachten des Weltkrieges wollten wir einziehen.
Und wir marschierten. Wahrlich, die Lage war ernst, die Zustände übertrafen in ihrer Gemeinheit alles, was ich nach den Schilderungen der Lütticher Offiziere erwartet hatte. Marschierten durch grölenden Mob, die Unterwelt war entfesselt, die niedrigsten Elemente beherrschten die Straße. Marschierten vorüber an verwahrlosten Gestalten in deutschen Uniformen, die sich mit belgischen Grubenarbeitern anzubiedern versuchten, alten, sich wichtigtuenden Etappenschweinen, jungen Burschen, die Rekrutendepots entlaufen oder als Ersatz für die Front bestimmt, fahnenflüchtig geworden waren; vorüber an Judenbengels, die in unser Ehrenkleid gesteckt als Drahtzieher und Hetzer fungierten; alles Erscheinungen, die die Front nicht kannte. Wir marschierten durch ein Spalier — und das war das Schwerste. Kerle im feldgrauen deutschen Rock, belgisches Gesindel, Männer und Weiber, Franktireurs von 1914 in langen Reihen untergehakt, singend und sich im Takt wiegend: „Siegreich wollen wir Frankreich schlagen“. Höhe der Würdelosigkeit, blutigster Hohn, pfui Deiwel! Da hatten wir die Scheu überwunden, auch auf Deutsche zu schießen.
Die Haltung der Jäger war beispiellos. Marschierten, wie ich gewollt, marschierten in festgefügter Kolonne, ein Korps erbarmungsloser Rache, die Garde des Schicksals, den langen Weg durch die Straßen, kein Frauenzimmer, keine Dirne wagte frech sich zu nähern, hätten alles zertreten, marschierten auf dem Platz vor dem Stadthaus im friderizianischen Paradeschritt an mir vorüber. Hielten, standen, ein Fels in der Brandung zwischen gaffenden Massen. Vielstimmige Kommandostimmen schlugen schrill durcheinander, die Kompagnien übernahmen ihre Aufträge. Wachen wurden besetzt, Posten gestellt, Maueranschläge befestigt, die Lastautos der Kraftwagen-Maschinengewehr-Kompagnie, M. G.s schussbereit, ratterten in stündlicher Patrouillenfahrt drohend durch die Stadt. Ab 8, 9 oder 10 Uhr, die Zeit weiß ich nicht mehr, war ein Betreten der Straßen verboten. Als in den letzten Stunden vor Mitternacht die ersten Meldungen einliefen, die Jäger hätten verschiedentlich geschossen, auch ein Offizier, der auf Anruf nicht gestanden, sei von einem Posten tödlich getroffen, wusste ich die Truppe in meiner Hand. Sie war der Aufgabe gewachsen. Eine große Befriedigung durchdrang mich.
Doch das war nur der Anfang. Eine schwere Prüfungszeit begann. Am nächsten Tage schon kam die Flut, die Lüttich fast eine Woche lang durchspülte. Tag und Nacht, Kolonne hinter Kolonne, ununterbrochen, Tausende und aber Tausende jagten, hetzten durch die Stadt, lungerten umher. Alle Fahrzeuge besetzt, dass die Pferde oft zusammenbrachen, alle Lastautos überfüllt, prügelten sich um die Plätze. Auf dem Bahnhof dasselbe Bild. Jeder dachte nur an sich, mochte der andere verrecken. Eine Psychose der Angst löste alle Bande der Verbundenheit, Angst zu spät zu kommen, wo sich in Deutschland jetzt andere gesund machten. Nur die Feldküche hielt noch Reste von Formationen zusammen. So flutete es tagein, tagaus, johlend, schreiend, schimpfend, zu mehreren Kolonnen nebeneinander, sich überholend, die Straße versperrend. Wo sie nur all das rote Tuch her hatten? Auch anständige Elemente waren dazwischen. Viele, viele. Ich merkte es an der Strammheit, mit der sie mir begegneten. Doch sie gingen unter in der unaufhörlich, nun bald eine ganze Woche dahinrollenden Masse.
Von Tag zu Tag wurde das Bild unerträglicher. War das alles Etappe oder sollte das schon . . .? Immer häufiger versuchten auch mich solche Zweifel. Zweifel, gegen die ich mich anfangs energisch verwahrt hatte, wenn sie im Bataillon laut werden wollten. Allmählich erlagen wir ihnen alle. Selbst ich kam zu der erschütternden Erkenntnis: Das also ist das sieggewohnte Heer, und wir von all den tapferen Bataillonen das einzigste, das seinen Ehrenschild blank hielt! Tatsächlich, das glaubte ich jetzt auch. Konnte ich wissen, wie stark das Etappen- und Verwaltungsheer in Belgien war?
Ich bangte um die seelische Widerstandskraft der mir anvertrauten Truppe. Sie trug den Kopf nun täglich tiefer. Ich fühlte, die Stimmung der Jäger wurde lahm, bei diesem ewigen Anblick von Schmach und Schande, die Vereinsamung war zu vollständig. Ich rang um ihre Seele und sprach täglich zu den Kompagnien. Von Nibelungennot und -leid, von Hagen, der aus Treue zu seinem König schuldig wurde, vom Kampf der letzten Goten am Vesuv. Ich pochte auf Truppenstolz und fanatisierte den Korpsgeist. Denn ich wusste, nur die persönliche Verbundenheit hielt angesichts solchen Zusammenbruchs die junge Mannschaft noch bei Pflicht und Fahne. .
Noch taten sie ihren Dienst wie am ersten Tage, bewachten die ihnen anvertrauten Objekte mit mustergültiger Energie und schossen hin, wenn es sein musste. Doch wie lange noch? Vorgesetzte Dienststellen zuckten die Achseln. Noch war das Bataillon intakt. Vereinzelte schwache Elemente aus unseren Reihen spurlos verschwunden, hatten sich mitspülen lassen von der roten Flut. Das war nicht schlimm, damit hatte ich gerechnet und freute mich nur, dass es so wenige waren. Ein anderer Fall gab mir zu denken. Ich besuchte die Quartiere einer Kompagnie und fand vier oder fünf kleine schwarz-rot-gelbe Papierfähnchen. Ich hatte offengestanden von der Bedeutung dieser Farbenzusammenstellung noch nie etwas gehört, erinnerte mich aber, dass die von Fliegern abgeworfenen Flugblätter der Feindpropaganda so umrandet waren. Das erweckte mein Misstrauen. Der Herkunft dieser Fähnchen nachgehend, endete meine Untersuchung bei einem Feldwebel, den ich auf Grund einer Verfehlung während des Marsches nach Lüttich gemaßregelt hatte. Undurchsichtige Zusammenhänge vermutend, die ich erst später durchschaute, schritt ich ein: für uns gäbe es nur schwarz-weiß-rot. An diesem Abend lastete die Sorge um meine so übermenschlich beanspruchte Truppe besonders stark auf mir. Ich hätte ihren Zusammenbruch nicht überleben können.
Der nächste Morgen. Ich verließ mein Quartier. Die rote Flut, über Nacht merkwürdig verebbt, hatte die grauen Novemberwolken mit sich gezogen. Sonnenschein und wenig Gesindel. Kaum dass ich diese wohltuende Veränderung festgestellt hatte, fegten in wilder Fahrt mehrere Jäger auf ihren Rädern heran, Leute der Kompagnie mit den verdächtigen Fähnchen. Hielten, meldeten militärisch, laut und alle auf einmal: „Herr Hauptmann, gleich kommen sie reinmarschiert!“ — „Wer?“ fragte ich erstaunt. „Die deutsche Jägerdivision mit Musik und schwarz-weiß-roten Fahnen!“ Die Gesichter freudig erregt, wie erlöst von einem langen hässlichen Traum, standen sie vor mir.
Und dann kamen sie wirklich einmarschiert mit geordneten Verbänden, in feldgrünen Röcken, mit klingendem Spiel und „Heil Kaiser Dir“. Kamen uns abzulösen, kamen nicht, wie ich geglaubt, als die letzten Zeugen der ruhmreichen kaiserlichen Armee, kamen als ihre Spitze.
Was sich eine Woche lang durch die Straßen gewälzt hatte, war alles Etappe. Die Front aber marschierte! Die Jäger trugen den Kopf jetzt wieder hoch, stolz wie in alten Tagen. Und mit Berechtigung, denn eine Prüfungszeit lag hinter ihnen, wie sie der Umsturz wohl nur wenigen Truppen gestellt hatte. Waren unbeschadet durch die Stürme der Zeit gegangen, sich und ihrem unglücklichen Kaiser treu geblieben. Das stolze Wort war nicht verweht: „Es lebe der König und seine Jäger!“
Ich saß in meinem Quartier wenige Kilometer von Köln, wohin uns die letzten Märsche geführt hatten, und dachte der jüngst vergangenen Tage. Draußen auf der Dorfstraße scherzten die Jäger mit rheinischen Mädchen, waren froh, in Deutschland zu sein und freuten sich wie die Kinder auf Heimat und Frieden, auf die Weihnacht bei Muttern. Feststimmung herrschte. Morgen sollten sie als erster Fronttruppenteil in Köln einmarschieren, ein feierlicher Empfang war vorgesehen, die ganze Radfahrbrigade zum letzten Mal geschlossen versammelt. Unterkunft in Mülheim, dann Abtransport in die Garnisonen. Die Züge standen irgendwo nicht weit jenseits des Rheins bereit. So stand es im Brigadebefehl, und dann musste es doch stimmen. Darum ihre Freude.
Ich aber saß und sann. Es war seit jenem Nachmittag vor Lüttich das erste Mal, dass ich Zeit und Ruhe fand, Gedanken und Gefühle zu gliedern, mir über die ganze Tragweite der jüngsten Ereignisse Klarheit zu geben. Sann über Vergangenes und Gegenwärtiges, dachte nicht an mich und meine Zukunft, dazu war das Schicksal des Vaterlandes zu gewaltig, sondern dachte an den König und seine Jäger. Und meine Gedanken kreisten und kreisten und fanden doch keine Erklärung. Warum hatte er uns nicht gerufen? Wie gerne wären wir gefolgt und wieviel leichter wäre dann der Kampf gewesen, als der, den wir in Lüttich hatten durchstehen müssen. Als wir dort hineingeschickt wurden, war die Schlacht schon verloren. Kein Sieg, auf den wir noch hoffen konnten, kein Ziel, um das wir wussten. Denn die Parole der Obersten Heeresleitung, geschlossen in die Heimat marschieren, um uns dort aufzulösen, war wahrlich kein Ziel, um das es sich lohnte zu kämpfen. Wer hatte den Kaiser beraten und ihm den Glauben an seine Soldaten genommen? War es ein Opfer um des Friedens willen gewesen, und er still gegangen, seinem Volke den Bürgerkrieg zu ersparen, oder hatte die Truppe in Spa ihm die Treue versagt? Doch dann wäre der greise Feldmarschall ja schützend vor seinen Kaiser gesprungen: „Nur über meine Leiche!“
So lief ich im Leerlauf und fand keinen Ausweg.
Auf der Dorfstraße draußen war das fröhliche Lachen verstummt, seit Stunden schon war es dunkel. Mein Bursche kam. Er wollte mich aufmuntern und setzte sich zu mir. Da haben wir uns am Tische gegenübergesessen, erst geklönt und dann geschwiegen, Josef Hahn, ein Arbeiter aus Hannover, und ich, sein Hauptmann, und schließlich haben wir gemeinsam geweint um unsern Kaiser.
Der Einzug in Köln war vorüber. Reichlich laut und überschäumend hatte man nicht den Weg zum Herzen der Frontsoldaten zu finden verstanden. Unter Konfetti und Papierschlangen, dass mein Reitpferd oft scheute, zogen wir wie ein Karnevalszug durch die lärmende Menge. Wir hatten ein anderes Wertempfinden vom Sinn des Seins, standen mit unserm soldatentümlichen Denken fremd inmitten der wilden Ausgelassenheit, lachten gutmütig linkisch, waren vom Kriege eben verdorben. Unsere ganze Unzulänglichkeit kam uns so recht zum Bewusstsein.
Dann überschritten wir den Rhein und marschierten nach Mülheim. Hier fanden wir gute Unterkunft und freundliche Aufnahme, waren mit den Rheinländern bald wieder sehr zufrieden. Ich hatte einige Quartiere besichtigt und mit den Jägern gesprochen. Überall die gleiche Frage, ob wir nun auch wirklich verladen würden. Sie konnten es kaum erwarten, bis der Zug ging. Auch sie waren, wie alle Truppen, von der für die damalige Zeit so bezeichnenden Erscheinung der Ungeduld ergriffen. Im Übrigen zeigten sie vergnügte Gesichter. Schon vor 12 Uhr mittags in die Quartiere gekommen, freuten sie sich des vor ihnen liegenden freien Tages.
Die Freude war nur kurz. Hässlich und unerwartet wurden wir bereits in den frühen Nachmittagsstunden aus unserer Ruhe gerissen. Alarm! Wir sollten sofort zurückmarschieren, wieder zurück über den Rhein. Ein Befehl des Generalkommandos berief uns für 8 Tage nach Köln, den Schutz der Rheinbrücken zu übernehmen. Ich war empört. Hätten die Herren am grünen Tisch des Generalkommandos sich das nicht rechtzeitig überlegen können oder glaubten sie, uns als Objekt ihrer Unfähigkeit missbrauchen zu dürfen? Machten wilde Versprechungen, um uns nachher zu narren. Stellten ihre beste Truppe wochenlang verlassen und verraten mitten zwischen verwahrloste Etappenformationen, ließen den Frontoffizier mit seiner Verantwortung allein ohne jede Verbindung, geschweige Unterstützung, um dann in völliger Truppenfremdheit Truppe und Führer wie zu einem Kinderspiel frivol und überheblich in die schwersten Konflikte zu führen. Nie hatte ich seit Wochen auch nur einen Vorgesetzten gesehen. Ich spielte mit dem Gedanken zu streiken. Wusste ich doch, wie dieser plötzliche Gegenbefehl das Vertrauen zur Führung erschüttern, wie niederziehend die überraschende Umkehr auf dem Wege nach Hause auf die Stimmung der Jäger wirken würde. Nur schweren Herzens gab ich den Befehl an die Kompagnien weiter. Es war kurz vor der für den Abmarsch festgesetzten Zeit. Mein Bursche meldete mir, die Kompanieführer wünschten mich zu sprechen. Nichts Gutes vermutend, empfing ich sie. Ein Blick in ihre Gesichter, ich wusste, was nun kam.
„Herr Hauptmann, die Leute weigern sich, wollen nicht marschieren.“
„Das ist nicht wahr!“ fuhr ich auf, „ich werde die Kompagnien persönlich sprechen. Gleich jetzt. Sie werden marschieren!“
„Den Weg können Sie sich sparen, draußen stehen schon die Abordnungen der Mannschaft.“
Also doch . . . Versagen. Schneidend kalt, ungerecht entließ ich die Offiziere.
„Reinkommen!“ schrie ich.
Eiliges Gedränge. Hacken klappten aneinander, betont stramm. 3 Mann jeder Kompagnie, Oberjäger, Gefreite, Jäger. Mustergültig die Haltung.
„Ihr habt Soldatenräte gebildet?“ fragte ich verächtlich.
„Nein, Herr Hauptmann, das gibt’s bei uns nicht.“
„Ihr wollt nicht marschieren?“
„Wir marschieren, Herr Hauptmann haben’s ja befohlen.“
„Ja, Kerls, was wollt ihr denn hier, vorwärts zu den Kompagnien!“ Da blieben sie stehen, stießen sich an, machten verlegene Gesichter. Ich sah, sie hatten etwas auf dem Herzen, sicher irgendeine kindische unmögliche Idee, wie sie der Blödsinn dieser ganzen Zeit nur eingeben konnte. Wahrscheinlich sollte ich ihnen eine Eisenbahn kaufen und mit ihnen ausreißen. Irgend so etwas war’s schon. Mochten sie ruhig reden.
„Na, raus mit der Sprache“, sagte ich freundlich. Ich setzte mich hin.
„Herr Hauptmann, wir haben eine Bitte, haben uns das schon lange besprochen . . .“ Sie stockten, ich merkte, es wurde ihnen sauer zu reden.
„Ihr könnt mir alles sagen“, munterte ich sie auf.
Da kamen sie raus mit der Sprache. Ich solle die Offiziere entlassen und alle .Kompagnien persönlich führen. Die Feldwebel wüssten ja gut Bescheid, das würde schon gehen. Einmal im Reden, legten sie los, befürchteten, ich könnte ihnen das Wort abschneiden, mir solche Sprache verbieten. sagten, sie wollten nur richtigen Offizieren gehorchen und nicht jungen Herren, die unerfahren und kürzer Frontsoldat als sie selber.
Das hatte ich nicht erwartet . . . Lange sah ich sie an. War das Meuterei und erste Zerfallserscheinung? Ich sollte mit der Mannschaft gegen die Offiziere gehen, und wo musste der Weg folgerichtig enden?
„Ihr wollt eure Offiziere verlassen, die euch im Feuer vorangesprungen sind?“ fragte ich ernst.
„Das haben sie gemacht, das ist richtig, aber sich wirklich um uns kümmern tut nur Herr Hauptmann. Und der Lage jetzt sind sie auch nicht gewachsen. Die sind ja gar nicht richtig königstreu. Wir aber sind es, Herr Hauptmann, und marschieren mit Ihnen, wohin Sie befehlen.“
Nein, sie waren keine Meuterer, das war ehrlich und echt. Gesundes Empfinden aus den Tiefen der Volksseele verlangte nach starker, bekenntnistreuer Führung.
„Ich werde mit den Kompanieführern sprechen und dann entscheiden. Jetzt aber, jetzt wird marschiert!“
„Zu Befehl, Herr Hauptmann!“ klang es vertrauensfreudig zurück. Ihre Augen leuchteten. Kommissstiefel krachten aneinander, dass die Wände wackelten.
Und es wurde marschiert. Noch einmal zurück über den Rhein, in eine neue ernste Prüfungszeit ging der Marsch.
Ich war der Truppe im Kraftwagen vorausgeeilt und meldete mich befehlsgemäß beim Generalkommando. Es war ein bayrischer Stab, einquartiert in einem Hotel dicht an der großen Kaiserbrücke. Die maßgebenden Generalstabsoffiziere empfingen und beglückwünschten mich zu meiner vorzüglichen Truppe, sich selber, uns zur Verfügung zu haben, und dankten Gott, dass ich wirklich den Befehl ausgeführt hatte und gekommen war. Denn die Lage sei sehr bedrohlich, besonders erschwert durch einen recht radikalen Arbeiter- und Soldatenrat, der im Rathaus oder sonst einem Gebäude, ich weiß heut nicht mehr, welches sie nannten, eine Nebenregierung aufgemacht hatte, sich in alles einmischte und auch Befehle erteilte. Ich sollte den Schutz der Rheinbrücken übernehmen und gleichzeitig als Rückhalt für das Generalkommando dienen, um eine geordnete Befehlserteilung zu gewährleisten. Wie ich mir meine Aufgabe dächte?
Ich sah auf die Uhr: „Das Bataillon wird in 20 Minuten am Rhein eintreffen. Ich werde sofort vor das Rathaus marschieren und die Truppe dort aufstellen. Dann werde ich einen Stoßtrupp reinschicken, den Arbeiter- und 5oldatenrat festnehmen und fesseln lassen, werde auf die Kaiserbrücke marschieren, halten und einschwenken und dann unter präsentiertem Gewehr die Gefesselten über das Geländer weg in den Rhein schmeißen lassen.“— Hugh, das wilde Frontschwein hat gesprochen. Ich hätte meine Rede mit diesen Indianerworten ruhig schließen können, sie passten durchaus in das Bild unserer Sitzung. Erst entsetztes Schweigen, dann schauten sich die Bleichgesichter vor mir vorsichtig um, ob auch die Türen geschlossen und niemand meine Worte gehört haben könnte. Und dann haben sie mich angeschissen, auf den Ernst der Lage verwiesen, sich solche Indianergeschichten verbeten.
Als ich nicht weich wurde, redeten sie mir vernünftig zu: Unsicherheit der Verhältnisse, Köln überschwemmt mit Tausenden von Angehörigen völlig verwahrloster Etappenformationen, die Fronttruppen noch Tagemärsche weit entfernt; vieles daran war richtig. Schließlich wurde mir unter Hinweis auf Hindenburg, der selber das schwere Opfer gebracht hätte, sich auf den Boden der Tatsachen zu stellen, mein Vorhaben verboten.
Dass ich gehorchte, war der schwerste Fehler, den ich im Verlaufe der ganzen Revolution gemacht habe. Hätte ich damals bereits über Erfahrungen auf dem Gebiet innerer Kämpfe verfügt, wie ich sie kurze Zeit später schon besaß, ich hätte die Möglichkeit, auch nur vorübergehend das Steuer rumzureißen, nicht aus der Hand gegeben, und, ganz gleichgültig, wie es ausging, selbständig gehandelt. Doch was wusste ich von Werbestellen, von Einstellung Freiwilliger, von der Pflicht, in gewissen Augenblicken nicht zu gehorchen.
Die Folgen meines Verzichts bekamen wir sofort zu spüren. Überall begegneten wir Schwierigkeiten, die vom Arbeiter- und Soldatenrat ausgingen. Die Verpflegungssätze waren unzureichend und schlecht, Heizmaterial, Stroh und Decken, ja, die Quartiere selbst wurden uns verweigert. Alles mussten wir selber zusammenrequirieren, inmitten einer Großstadt und angesichts der späten Tagesstunde, eine nicht einfache, ärgerliche Aufgabe, erschwert noch durch Lage und Auftrag, die eine geschlossene Unterbringung verlangten.
Schließlich zogen wir in die mehrstöckigen unheizbaren Brückentürme, einige nahegelegene Säle und die Kellerräume des Hotels, welches das Generalkommando belegt hatte; konnten noch froh sein, einige Ballen Stroh aufgetrieben zu haben und nicht auf blanken Steinböden schlafen zu müssen.
So endete der Tag, dem das Bataillon am Morgen festlich gestimmt entgegenmarschiert war, das war der Abschluss des würdigen Empfanges, den die Stadt Köln den ersten aus dem Kriege zurückkehrenden Fronttruppen bereitete.
An diesem Abend noch sprach ich die Offiziere des Bataillons. Sie ersparten mir die schwere Aufgabe, ihnen mein Gespräch mit den Mannschaften mitteilen zu müssen. Sie baten gleich zu Beginn um ihre Entlassung in die Heimat. Ein Teil gab offen als Grund die Tatsache an, der Zeit und ihren Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Sie taten mir leid, denn sie waren die Opfer eines überlebten Systems in der Behandlung des Führerproblems. Sie traf keine Schuld. Sie waren zu jung und unerfahren an eine Stelle gestellt, die sie als Gesamtheit nicht ausfüllen konnten. Es war ein Fehler, auch während des Krieges die Eignung für den Offizier von der Schulbildung abhängig zu machen. Den tapfersten und berufensten Elementen der Mannschaft, gleichgültig ob chargiert oder nicht, war damit der Weg zum Aufstieg verschlossen. Man hatte sich selber die Möglichkeit versagt, besondere Leistungen durch Aufrücken in die verantwortliche Führerschicht zu werten. Die bewusste Überlegenheit sowohl an Fronterfahrung wie in der Behandlung der Mannschaft führte den geborenen Frontsoldaten zwangsläufig in Konflikte mit dem jungen Kriegsleutnant. Das war auch das Schicksal der heute scheidenden Offiziere.
An meiner Seite blieben einzig die Offiziere des Stabes, darunter die Leutnants und Adjutanten Voß und Oppermann. Durch ihre langjährige Truppenzugehörigkeit kannten sie die meisten der nun für die Kompagnien verantwortlichen Feldwebel besser als ich. Ihnen war es daher zu danken, dass sich auch in Zukunft der Dienstbetrieb reibungslos abwickelte.
Eisiger Wind fegte am nächsten Morgen den Rhein entlang, wehte um die Türme der Kaiserbrücke, zog durch ihre schießschartenähnlichen Fenster in die kalten steinernen Verließe. Frostig und dumpf schlug mir die Luft entgegen, als ich diese betrat, warm und freudig mein Herz, als ich sie wieder verließ. Kurz vor mir war der Kölner Soldatenrat da drinnen bei den Jägern gewesen, hatte ihnen Bürgerquartiere mit Verpflegung und 15 Mark Tagegelder geboten, wenn sie mich absetzten und sich ihm unterstellten. Doch er war an die falsche Adresse gekommen. Statt jeder Antwort hatten sie ihm die Türe gewiesen, blieben lieber in ihrem kalten Gemäuer bei Pfenniglöhnung und Feldküchenfraß, ehe sie ihre Seele verkauften. Der Versucher ging weiter um. Als er am folgenden Tage abermals kam und 18 Mark bot, da haben die Jäger ihm die Fresse zerhauen und dabei in die Ohren geschrien: „Kommst du Hund noch einmal wieder, dann schmeißen wir dich in den Rhein!“
Eine harte Woche verging. Die Gesichter wurden lang und schmal, die Stimmung war schlecht. Ich sah, Köln war ihnen leid, sie hatten Sehnsucht nach Hause. Sie sprachen mit mir nicht darüber, verloren kein Wort mehr. Aus Kameradschaft. Wollten das Herz mir nicht schwer machen, wussten auch so, dass ich tat, was ich konnte, mussten eben warten, bis die Ablösung kam. Und an einem Tag kam sie. Wieder die deutsche Jägerdivision. Kam marschiert gerade wie in Lüttich mit „Heil Dir im Siegerkranz“, als starker geschlossener Verband. Die hatten es besser, waren immer unter sich, marschierten wohl langsamer, nicht so leicht und schnell wie wir auf den Rädern, marschierten aber in anständiger Gesellschaft, Bataillon mit Bataillon. Brauchten nicht ewig stehen als einsamer Posten inmitten Etappen- und Heimatgesindel. Wir sahen neidvoll auf sie und ihre gestraffte Haltung.
Sie lösten uns ab, und dann marschierten auch wir. Nicht in die Heimat. Den Anschluss hatten wir verpasst, verpassen müssen, als man uns zurückrief. Marschierten zu einem langen Auftrag. Er führte uns abseits der Straße des großen uns so verhassten Verkehrs in gesunde, von den Wehen der Zeit kaum berührte Gegenden ländlicher Ruhe. Marschierten in eine schwere Arbeit — eigentlich schon im Auftrag der Feinde, und das war das Schwere dabei, denn sonst war sie leicht. Wir mussten die Grenze des Brückenkopfes Köln abstecken, mussten auf einer Strecke von 60 km alle 100 Schritt eine Stange oben mit einem Strohbündel in die deutsche Erde graben. So verlangte es der Waffenstillstandsvertrag, den der fromme Herr Erzberger in undeutscher Demut zum Erstaunen der französischen Offiziere im Wald von Compiégne unterschrieben hatte. Die rheinischen Bauern taten die Arbeit nicht, taten auch recht so. Auch die vielen zurückflutenden Formationen hatten sich dem Generalkommando verweigert, allerdings aus entgegengesetzten, aus vaterlandslosen Motiven. Einer musste es machen, da hatte man es mir befohlen. Ich wusste, ein Abtransport kam für die nächsten Wochen nicht in Frage. Erst sollten die Lande von dem roten Etappengesindel befreit werden, das überall rumlag. Statt irgendwo untätig warten zu müssen, schien es mir für den Geist der Truppe besser, ich stellte sie in einen Pflichtenkreis. Neben dem Gefühl der Kameradschaft gegenüber dem für die Ausführung dieser Anordnung verantwortlichen Offizier des Generalkommandos war diese Überlegung ein weiterer Beweggrund, solchen für den Frontsoldaten demütigenden Befehl auszuführen.
Es war der letzte Auftrag, den der Krieg mir erteilte, und — der bitterste —
Darüber war es Dezember geworden. Wir marschierten durch Rheinland-Westfalen nach Hamm. Hier waren bald nur noch wenige um mich versammelt, nur 150 Mann, nur die drei Kompagnien der Oelser Jäger. Die andern Teile des Bataillons waren nach und nach in ihre Garnisonen befördert worden. Weihnachten stand vor der Tür, es wurde Zeit, dass ich mein Wort einlöste: „Zum Fest seid ihr zu Hause.“ Ich telefonierte an das Generalkommando in Münster und erhielt den Bescheid, meine Truppe sei zuverlässig und stünde fest hinter mir, darum könne sie warten. Andere weniger gute Formationen machten Schwierigkeiten, die müssten erst abgeschoben werden. Da gab ich Dampf: „Ihr wisst also, dass meine Jäger alles tun, was ich befehle. Habe ich bis morgen keinen Zug, dann marschiere ich auf Münster und hebe euch aus!“ Der drüben am andern Ende der Strippe war auch ein altes Frontschwein. Wir einigten uns im Guten. Drei Tage später konnten wir verladen.
Wir saßen in meiner Wohnung einander gegenüber, erzählten und fanden kein Ende. Die halbe Nacht war darüber vergangen, dann hatten wir geschlafen, um am Morgen von neuem zu beginnen. Der Schatz unserer Erinnerungen war unerschöpflich, Erinnerungen an Friedensjahre und Kriegszeiten, an gefallene und überlebende Kameraden, an den Schlachtentod dieses Leutnants, die Verwegenheit jenes Gefreiten, in buntem Durcheinander Ernstes und heiteres. Wir hatten geschimpft und geschwärmt, gelacht und gleich wieder gedankenvoll geschwiegen, waren bei dem traurigen Kriegsausgang, dem letzten schweren Erleben und schließlich bei den derzeitigen Zuständen in unserer Garnison Oels angelangt. Und dabei hatten wir uns leicht veruneinigt, mein Freund, der Oberleutnant Johansen und ich. Seit einem Jahr tat er Dienst beim Ersatzbataillon, seit ihn ein schwerer Hüftschuss lahm an den Krückstock zwang. So hatte er den Umsturz in der Heimat erleben müssen, unter Verhältnissen, die nicht einfach waren. Denn Oels hatte während des Krieges sein Gesicht erheblich verändert. Mit dem Bau einer großen Eisenbahnwerkstätte waren viele stadtfremde Elemente zugezogen, die sich naturgemäß revolutionären Einflüssen leichter zugänglich zeigten als die bodenständige Bevölkerung. Hinzu kam, dass an der Spitze des Ersatzbataillons irgendein alter Landwehrknochen stand, den der Krieg wieder ausgebuddelt hatte. Unter solcher Führung, inmitten einiger Hundert wenige Wochen vorher eingezogener Rekruten, die nichts mit dem Wesen des Bataillons gemein hatten, dessen stolze Uniform sie trugen, und losgelöst von dem Frontgeist einer wirklichen Truppe, traf Johansen der Umsturz. Trotz dieser schweren Verhältnisse hat er seine Stellung als Offizier tapfer behauptet, er war der einzige, der sich den Einfluss auf die Mannschaft gewahrt hatte.
Ich hingegen war noch keine 24 Stunden wieder im Lande, sah die unerquicklichen Verhältnisse, ohne sie gerecht beurteilen zu können, und übte an allem und jedem scharfe Kritik, tadelte die Tatsache eines und wenn auch nur der Form nach bestehenden Soldatenrats, das unmögliche Auftreten junger Rekruten mit roten Kokarden, die roten Fahnen an öffentlichen Gebäuden der Stadt. Nein, ich hatte mir die Verhältnisse in Oels ganz anders gedacht. Wohl war der Empfang gestern Nachmittag warm und herzlich gewesen, weiß Gott, anders und ehrlicher als damals in Köln. Auf dem Bahnhof viele Menschen, bekannte Gesichter, die Musikkapelle, Marsch durch die Straßen, freudig bewegtes Winken, vor dem Rathaus auf dem Ring würdige Begrüßung durch den Bürgermeister, schlicht, aber echt, und alles, obgleich der Zeitpunkt unserer Ankunft erst wenige Stunden vorher bekannt war. Trotzdem bangte ich wieder einmal um den Geist meiner Leute; und zwar wegen dieses Einmarsches gestern. Denn wir waren gar nicht marschiert, nicht stramm wie in Lüttich, auch nicht wie in Köln, geschweige denn wie damals vor 4 ½ Jahren, als wir durch dieselben Straßen wirklich marschierten, hinaus in den Krieg; waren nicht marschiert, wie ich mir’s gedacht, nicht so fest und geschlossen, wie wir in Wirklichkeit waren, nicht eindrucksvoll, dass die Bürgerschaft staunte. Zu viel Freundschaft und Liebe hatte sich in die Kolonnen gedrängt, die Ordnung gelöst und mir die Führung erschwert. Es war ein Augenblick der Schwäche gewesen. Würde die Truppe ihn überwinden, mir weiterhin folgen und auch durch Konflikte mit mir marschieren? Denn nach Lage der Dinge schienen mir Auseinandersetzungen mit der von Arbeiter- und Soldatenräten beratenen Garnisonstadt unvermeidlich. Oder würden die Jäger nun mitschwimmen im Strudel der öffentlichen Meinung. Ich wusste, das Gift der Versuchung im Becher der Freude und Freundschaft gereicht, war gefährlicher als Feindschaft, bestechender als klingende Münze. In Kritik und Sorge klang die mahnende Stimme des Freundes. Ich solle nicht provozieren, den Bogen nicht überspannen, denn mit meinen paar Mann könne ich im Augenblick doch nichts erreichen, höchstens die Lage verschärfen. Auch hätten Erfahrungen gezeigt, wie gute Fronttruppen standhaft bis in die Garnisonen marschiert, dort aber alsbald infiziert und umgefallen seien. „Kein Wunder, wenn das Ziel, das man uns gesteckt hat, doch nur Auflösung heißt!“ rief ich verbittert. Ich sah, es war keine Zeit zu verlieren, und nahm mir vor, alle Zweifel gleich heute zu klären. Ich fürchtete sonst den Einfluss auf die Leute zu verlieren.
Die Ereignisse überholten diesen Entschluss. Mein Jäger trat in unser Gespräch. Er richtete aus, die gesamte Mannschaft der Kompagnien wolle mich sprechen. Ich solle sofort in ihr Quartier, den großen Saal einer Gastwirtschaft, kommen. Die ungewöhnliche Art solch einer Bestellung des Kommandeurs durch die Mannschaft schien die Bedenken meines Freundes zu rechtfertigen. Ich war auf jede Überraschung gefasst.
Sie kam. Doch anders, als ich erwartet. Schon wie ich den Saal betrat, schlug mir ein Fluidum der Beruhigung entgegen. Nur freudig bewegte Gesichter, dicht drängten sie um mich. Und dann trat der kleine Krause stramm vor mich hin, ein Vizefeldwebel mit E. K. I, Handgranatenspezialist im Vernichten englischer Tanks. Wie ein Fanal der Treue flammte sein Blick, wie eine Siegesfanfare klang seine Meldung: „Herr Hauptmann, wir haben heute Nacht alle roten Fetzen runtergeholt und auf dem Ring mit „Heil Kaiser Dir“ öffentlich verbrannt. Wir reißen auf der Straße allen die roten Kokarden ab. Wir verweigern, uns dem Ersatzbataillon und seinem Soldatenrat zu unterstellen. Wir bleiben geschlossen und selbständig wie bisher nur unter Ihrem Befehlt“
Am Abend hatte uns die Heimat zu einer Begrüßungsfeier eingeladen, einem schlichten Bierabend. Der Landrat hielt eine ernste, eindrucksvolle Ansprache, einige improvisierte Vorträge folgten. Dann wurde getanzt und geliebt. Ich gönnte meinen Jägern solch langentbehrte Freuden. Zwischendurch sang ein Verein sich sehr wichtig gebärdender Männer ein mehrstimmiges Lied. Obgleich das Stiefkind solcher Chorgesänge, der Text, ja meist nicht zu ergründen ist, glaubte ich Worte herausgehört zu haben, wie „Proletarierheer“ und „Sklavenketten befreit“. Nachdem der gnädig aufgenommene Beifall verklungen war, erkundigte ich mich bei dem Dirigenten nach dem Sinn dieses Liedes.
„Was wir gesungen haben, das ist unser Revolutionslied“, war die aufgeblasene Entgegnung.
„Wer ist wir?“ forschte ich interessiert und wurde mir durch die Antwort gleich der Auszeichnung bewusst, mit einem vom jetzt regierenden Arbeiterrat entsandten sozialdemokratischen Gesangverein sprechen zu dürfen.
„Ja, da kann ich Sie nur bitten, das Fest sofort zu verlassen. Ich bedaure aufrichtig, dass die Herren Räte nicht erschienen sind, es wäre mir ein unvergleichliches Vergnügen gewesen, sie mit Ihnen zusammen aus dem Lokal zu wuchten.“
„Haben Sie Töne?“ sprachlos, entrüstet schauten sie einander an.
Nein, da war nichts zu hören, die eben noch so tonbeflissenen Sänger hatten gar keine mehr, alle Töne waren ihnen vergangen.
Und solchen Ton erlaubt man sich gegen uns Genossen und das nennt sich Revolution! dachten sie, packten ihre Tonblätter und verschwanden.
Denn hinter mir standen zwanzig, Ärmel hochgezogen und Fäuste in den Taschen geballt.
Es war eine Kampfansage, von mir als solche berechnet und von der andern Seite auch richtig aufgefasst. Bereits am nächsten Morgen suchte mich der Arbeiterrat der Stadt in Gestalt von drei redefeurigen Herren, Typ Gesangverein, in meiner Wohnung persönlich auf. „Wir wünschen den Herrn Heydebreck zu sprechen, sind Sie das?“ Ich gab zu, auf diesen Namen zu hören und führte sie in mein Zimmer. Hier belehrte mich zunächst ein phrasenreicher Vortrag über die Tatsache eines Umsturzes, seine Segnungen und Machtmittel. Ich hörte belustigt zu, unterbrach aber schließlich den Redeschwall: „Und was hab’ ich mit dem Klamauk zu tun?“ „Erstens, Ihre Leute haben uns unsere roten Fahnen gestohlen und verbrannt. Wir verlangen Feststellung der Namen und Bestrafung.“
„Erstens gibt’s da nichts mehr festzustellen, denn ich weiß die Namen schon lange. Zweitens sage ich sie Ihnen nicht. Drittens habe ich die Festgestellten wegen dieser geradezu vorbildlichen Handlungsweise durch Bataillonsbefehl belobt.“
„Was, Sie machen sich mit den Dieben noch gemeene?“ Die Herren waren außer sich. Die Fahnen waren ihr Eigentum, sie verlangten Bezahlung.
„Bedaure, wenn einer seine schmutzige Wäsche, zum Beispiel, öffentlich aushängt, dann kann er sich nicht beklagen, wenn ordnungsliebende Leute kommen und sie entfernen.“
„Das wird sich die Arbeiterschaft nicht gefallen lassen!“ entrüstet und besorgt zugleich, die Arme in die Seiten gestemmt, schauten sie sich gegenseitig an.
„Ich warne Sie vor meinem Bataillon. Wir haben Erfahrungen im Unterdrücken von Unruhen“, sagte ich langsam und betont.
„Sie wollen wohl drohen? Na, das weitere werden Sie ja erleben.“
„Hoffentlich erleben Sie nicht, wer besser schießen kann.“ Die Unterredung beendend, öffnete ich die Tür.
„Bloß schade, dass man sich dafür die Stiebeln dreckig gemacht hat!“ noch zwischen Tür und Angel der Letzte. Der ganze Tiefstand meiner Moral kam mir bei diesen herzlichen Worten so recht zum Bewusstsein.
*
Eine Stunde später wird mir ein telefonisch übermittelter Befehl des Chefs des Generalslabes Breslau vorgelegt. Um 2 Uhr soll ich im Hotel „Schwarzer Adler“ sein, dort will er mich sprechen. Als ich hinkomme, war bereits ein Zimmer bestellt. Ich habe noch Zeit und schaue zum Fenster hinaus auf den um diese Tageszeit langweilig stillen Oelser Ring. Nach einer Weile fährt ein Auto vor. Zwei oder drei Soldaten ohne Kokarden, offene Mäntel, gewollt unmilitärisch, dazwischen ein Oberstleutnant. Aussteigend begrüßen sie sich mit Zivilisten, wurden also offenbar erwartet. Den einen kenne ich, er war heut früh in meiner Wohnung. Dann beobachte ich den Oberstleutnant, er spielt eigentlich eine dürftige, etwas nebensächliche Rolle, etwa die eines Bärenführers für hohe Herrschaften. Ein Frontbild taucht auf, mit einem Schützengraben, den Parlamentarier oder Kriegsberichterstatter besichtigen. Dann ging auch immer ein militärischer Sachverständiger mit und sagte ihnen, wie man sich verhalten müsste. Immerhin, das hatte noch halbwegs Sinn. Die wollten doch ihr Fronterlebnis haben, für Zeitungen oder Parteiversammlungen. Allein konnte man sie nicht laufen lassen, sie hätten Unheil angerichtet, wären womöglich versehentlich zum Feinde übergegangen. Da musste eben dafür gesorgt werden, dass sie den nächsten Zug in die Heimat mit heilen Knochen wieder erreichten. Hier aber ist etwas anderes dabei, die Rolle des Offiziers verschoben, als wäre er ein Gefangener. Mir ist, ich müsste dem Kameraden beispringen. Währenddessen sind sie in das Haus gegangen und dann -— dann kommen sie alle zusammen in mein Zimmer.
Im selben Augenblick begreife ich: vor diesen Leuten sollst du dich verantworten! Empörende Zumutung! Ich will gehen. Doch da begrüßt mich der Oberstleutnant, kommt in freundlich wohlwollender Weise auf meinen Fall zu sprechen, meint, wir wollten die Sache ganz kurz machen und sagt etwas ähnliches wie „so tun, als ob“. Worauf er hinaus will, verstehe ich nicht. Ich hatte damals noch nicht gelernt, bei gewissen Gelegenheiten den Gehorsam zu verweigern und empfinde in diesem Moment den anerzogenen Respekt vor höheren Vorgesetzten als eine schwere, qualvolle Last. Auch denke ich, sie würden es dir als Flucht auslegen, und bleibe.
Laut und wichtig debattierend nehmen sie alle an der einen Längsseite des Tisches Platz. Der Oberstleutnant, rechts von ihm ein jüdischer Musketier der 51er, links der zweite Begleiter aus Breslau, auch ein nichtchargierter Soldat, dann folgen die Oelser Arbeiterräte. Ich sitze allein auf der anderen Seite, dem Oberstleutnant gegenüber. Der als Soldat des tapferen Infanterieregiments 51 verkleidete Jude zündet sich eine Zigarette an, will sein Etui wegstecken, unterbricht die Bewegung und hält es dem Oberstleutnant hin. Ohne ihn anzusehen, die Zigarette im Munde: „Rauchen Sie auch eine?“ Ich halte den Atem an, beobachte gespannt, was wird der Offizier jetzt machen . . .? Und . . . er nimmt, tatsächlich, er nimmt . . . Als ob ich nichts gesehen hätte, schaue ich schnell weg. Ich schäme mich furchtbar.
Inzwischen hatte die Verhandlung begonnen, ohne dass ich zunächst folgen konnte. Ich musste dauernd denken: der Chef des Generalstabes hat die Zigarette genommen, er hat sich tatsächlich eine Zigarette genommen, schenken lassen, hinschmeißen lassen von dem Juden. Dabei habe ich das Gefühl, der Kerl sieht dich an. Ich möchte aufspringen und ihm ins Gesicht schlagen; ich bin ganz wirr, merke es und zwinge mich zur Ruhe.
Einer der Arbeiterräte hält eine Rede. Es ist eine Beschwerde über mich und meine Jäger, aus der ich entnehme, dass der Umsturz in Oels schön und ruhig verlaufen ist. Alle Kreise, Bürger, Arbeiter und Soldaten hätten sich vernünftig benommen. Jedoch seit 3 Tagen, seit unserer Heimkehr, seien die Errungenschaften der Revolution in Gefahr. Heute hätte ich sogar gedroht, auf die Arbeiter schießen zu wollen. Energisches und schnellstes Durchgreifen sei dringend geboten. Wie wollen sie das nur machen? Während ich darüber nachdenke, dankt der Oberstleutnant dem Arbeiterrat für seine lichtvollen Ausführungen und will sich dann an mich wenden. Doch der Jud kann schneller, kommt ihm zuvor und redet mich an.
„Was ist denn mit dem passiert?“ frage ich den Oberstleutnant, erstaunt über diese vorlaute Frechheit. Ich sage es beabsichtigt kameradschaftlich, will distanzieren von den anderen, denn wir beiden Offiziere gehören doch zueinander.
Der Oberstleutnant wirft seinem Nachbarn nur einen ersuchenden Blick zu, und dann fordert er mich auf, zu den Anschuldigungen Stellung zu nehmen.
„Herr Oberstleutnant“, entgegne ich bestimmt, „ich bin nur hierhergekommen, weil ich gewohnt bin, Befehle von Vorgesetzten auszuführen. Ihre Zumutung, dass ich mich vor solchen Leuten verantworte, ist eine Entwürdigung des Frontsoldaten. Ich werde in diesem Falle weggehen!“
Ich sehe sein kaltes, feindlich lächelndes Gesicht und erkenne auf einmal, er hält zu den anderen. Ich fürchte eine brutale Antwort, doch es kommt etwas Schlimmeres: Wenn ich mich den neuen Verhältnissen nicht fügen wolle, müsse ich den Rock ausziehen. Er mache mich aber darauf aufmerksam, dass dann der jetzige Staat alle Versorgungsansprüche als erloschen betrachten würde.
Das sagt ein Offizier dem anderen! Und das vor diesem Kreis, vor lauter Feinden, und solche Argumente . . .
Da hatte ich das Meutern gelernt: „Den Gefallen tue ich Ihnen nicht“, ich sage es kühl und so hochnäsig ich kann, „ich denke, wir leben in der Zeit, da die Mannschaft entscheidet, wer Führer ist? Und deswegen, Herr Oberstleutnant, bleibe ich an der Spitze meines Bataillons, solange es — mir passt!“
Schweigen — alle schauen auf den Oberstleutnant, was wird er sagen . . .? Mir ist das Wurscht. Ich lehne mich in meinen Stuhl zurück. Fortgehen? nein, jetzt bleibe ich, jetzt gerade. Ich zünde mir eine Zigarette an, pfeif’ leise vor mich hin. Johansen fällt mir ein. Dem tatest du mit deiner Kritik sehr weh, denke ich und leiste im stillen Abbitte: Junge, die Verhältnisse zu Hause, die kannte ich nicht, solche Vorgesetzte und keine Fronttruppe, auf die du dich stützen konntest, dein Weg war vorgezeichnet. Ich danke Gott, dass ich ihn nicht zu gehen brauchte.
Drüben sind sie in lebhaftes Gespräch geraten. Das Stichwort gab einer der Arbeiterräte: „Die haben ja noch nicht mal einen Soldatenrat!“ Wild griffen die andern es auf, gleichsam als hätten sie das „Sesam, öffne dich“ zu den verschlossenen Herzen meiner Jäger nun gefunden. Dabei habe ich das Empfinden, meine Anwesenheit ist ihnen nunmehr lästig. Das reizt mich, sie zu ärgern.
„Zu Ihrer Beruhigung“, sage ich dazwischen, „seit gestern hat das Bataillon einen Soldatenrat. Ohne mein Zutun allerdings. Die Leute haben ihn trotz meines Verbots gewählt, ich wusste nichts davon!“
Sie horchen auf, wenn auch misstrauisch.
„Doch nur ein Mitglied!“ lache ich, „und das bin ich!“
Der Oberstleutnant drängt zum Aufbruch, dazwischen redet der Jud, denn die Genossen aus Oels sind noch mit Recht höchst unbefriedigt. „Lasst das nur unsre Sorge sein“, sagt er abschließend, „wir haben Erfahrungen in der Behandlung von Fronttruppen. Nichts wie Aufklärung fehlt. Dazu schicken wir unsre besten Leute herüber. Dann geht’s wie überall. Ich garantiere.“
„Der Plan ist zu begrüßen“, rufe ich hinein, „doch mache ich Sie darauf aufmerksam, dass meine Jäger durch das viele Aufklären der letzten Zeit schon recht nervös sind!“
„Und wer zuletzt der Aufgeklärte ist“, füge ich, als sie gehen, noch hinzu, „und wie es ihm bekommt . . . ich kann für nichts garantieren!“
Vierundzwanzig Stunden später begann die große Aufklärungsaktion. Zu dieser Zeit trafen 50 Matrosen auf dem Bahnhof ein. Sie kamen von Breslau und gingen sofort in den Gasthof zum Kurfürsten, das Quartier des Radfahrbataillons. Hier wollten sie sich gleich häuslich einrichten, was die Jäger jedoch erstaunt über so viel Unverfrorenheit zunächst unterbanden. Darauf zeigten die andern Ausweise und Befehle des Generalkommandos vor. Die Papiere waren in Ordnung, äußerlich nur, inhaltlich aber nicht; wenigstens nicht nach Ansicht der Jäger. Denn der Befehl, der in den Papieren geschrieben stand, war die ausdrückliche Anordnung, dass die Matrosen im Gasthof zum Kurfürsten einquartiert seien und die Unterkunft mit den Mannschaften des Radfahrbataillons zu teilen hätten. Meinungsverschiedenheiten entstanden. Sie endeten damit, dass die Matrosen nachgaben und mit dem nächsten Zuge wieder nach Breslau zurückreisten.
Ich erfuhr den Vorfall erst, als alles vorüber war. Einige Jäger suchten mich in meiner Wohnung auf und meldeten kurz Tatsache und Verlauf.
„Was habt ihr denn zu den Matrosen gesagt?“ fragte ich erfreut.
„Mit .Kulis wohnen wir nicht zusammen.“
„Und was haben die überhaupt hier gewollt?“
„Die königstreuen Radfahrer mal richtig aufklären.“
„Und dann . . .“
„Und dann haben wir unsere Knarren genommen — wir waren bloß 25, die anderen waren ausgegangen — und dann sind wir einfach gleich auf sie los und dann haben wir sie durch die Straßen zum Bahnhof gejagt. Und dort, Herr Hauptmann, dort haben wir ihnen zum Abschied erklärt: „Da müssen schon fünfundzwanzigtausend Kulis kommen, wenn ihr 25 königstreue Radfahrjäger aufklären wollt!“
Ihre Gesichter strahlten.
Mit einem langen Blick der Liebe und Dankbarkeit umfing ich sie: Was seid ihr mir die ganze letzte, schwere Zeit gewesen, was gabt ihr mir an jedem Tag, auch heute wieder! Sie mögen jetzt viele Güter zu vergeben haben, aber keines so wertvoll, wie euer Vertrauen. In dieser Zeit des Verrats, um die Gefolgschaft solcher Männer zu wissen, ist höchste Ehrung . . . das adelt.
Ein wilder Stolz schlug mir ins Blut: Und deswegen bleibe ich an ihrer Spitze, so lange es . . . mir passt!
*
An diesem Abend sitze ich allein in meinem Zimmer. Ich halte Zwiesprache mit mir selber und suche im Dunkel der Zukunft den Weg zu finden, den Überzeugung und Pflicht mir weisen sollen. Es ist wieder wie damals in der ausweglosen Dämmerstunde vor Köln, ich denke des Königs und seiner ihm treugebliebenen Jäger. Wochen sind seitdem vergangen, und immer noch hängt der schwarze Vorhang über den Geschehnissen, die sich am 9. November im Großen Hauptquartier abgespielt hatten.
Warum schweigen sie alle, die an diesem Tage als handelnde Personen auf der Bühne standen und in der großen Tragödie verantwortlich mitwirkten? Auch er, den das Schicksal zum Wächter von Volk, Heer und Krone berief, dem es die Hauptrolle vertraute, greift nicht in den Vorhang? Ich verstehe es nicht. Kein Erlass des Feldmarschalls an das treugebliebene Heer, das er immer noch führt — getragen von jahrealtem Vertrauen und ausgerüstet mit all der Befehlsgewalt, die einst sein Kaiser ihm verlieh — zerreißt die Zweifel und liefert die Waffe gegen Verleumdung und Lüge. Wir warten täglich darauf, durch Wochen vergeblich.
Und das Ende: Die Fronttruppe geht in der Garnison befehlsgemäß auseinander. Der Einzelne losgelöst von der Gemeinschaft und damit vom Rückhalt, den ihm Treue und Zucht dieser Gemeinschaft gaben, taucht unter im Meere des Irrsinns, der Straße und Meinung beherrscht. Ihn begleitet kein Rüstzeug, um für den Kaiser streiten zu können, denn er weiß nichts um die Wahrheit dessen, was sich in Spa abgespielt hat.
Viele erliegen dem Zweifel in ihrer eigenen Brust. Millionenwerte an Treu und Glauben werden vertan. Tor und Tür stehen offen für erlogene Geschichten und hässliche Worte. Feigheit versteckt sich hinter dem Namen des greisen Feldmarschalls, Soldatenräten dient er als Zeugnis ihrer Daseinsberechtigung.
Er, der Royalist und erste Offizier der Armee wird von den schwankenden Gestalten dieser erbärmlichen Zeit als Beispiel missbraucht, wie man das Opfer bringt, sich Tatsachen zu fügen. Der befreienden Tat selber aber steht sein Name im Wege.
So zeichnet sich das Bild der Lage in krankhaft-irren, grotesken Linien auf dem schwarzen Hintergrunde der Zukunft vor mir ab.
Ich sinne und suche und ende stets dort, wo ich anfing: Was hindert den Feldmarschall an einer Erklärung, die Tausende und aber Tausende aus Zweifeln erlösen würde. Denn Zweifel sind da — das hat nichts mit Königstreue und Fahneneid zu tun — sie drängen sich auf und . . . waren nicht nötig.
Denn als dreiviertel Jahre zu spät das Geheimnis enthüllt wird, entrollt sich ein Bild, das den Kaiser weit über alle hinaushebt, die das Schicksal als verantwortliche Mitspieler der großen Tragödie zu diesem weltgeschichtlichen Augenblick auf die Bühne gerufen hatte. Es zeigt den letzten Träger der Hohenzollernkrone, vom eigenen Kanzler verraten, der hinter seinem Rücken in Berlin die „Republik“ ausrief, auf einsamem Posten, in hoffnungslos verzweifeltem Ringen mit den Führern des Heeres. Mit Gröner, „dem neuen Mann auf dem verlassenen Plage Ludendorffs, dem Manne, der Hemmungen nicht kennt“1, der dem Kaiser die Gefolgschaftstreue seiner Armee aufsagt und in diesem für den Monarchen schwersten Augenblick überlegen bedauernd die Schultern nur zuckt: „Fahneneid? Kriegsherr? Das sind schließlich Worte — das ist am Ende bloß eine Idee —“. Der vor knappen zwei Wochen auf diesen Posten gestellt, den Geist der Fronttruppe so wenig kennt, ja, wie seine Auffassung über Fahneneid und Kriegsherr beweist, mit Frontgeist so gar nichts gemein hat, dass er sich zu der Behauptung versteigt, selbst die Truppe des Hauptquartiers, das berühmte Sturmbataillon Rohr, sei unzuverlässig geworden.2
Das Bild zeigt den Feldmarschall, der sich „schweren Herzens dem auf sorgfältiger Prüfung der Verhältnisse beruhenden Urteil des Generals Gröner pflichtgemäß3 anschließt, der dem Kaiser meldet, „dass militärische Kräfte zur Niederwerfung der Revolution nicht zur Verfügung stehen. Es zeigt den großen alten Mann, der still, tieferschüttert, in ausweglosem Schweigen das Schicksal seines Königs und Herrn, dem er so lange treu und tapfer als Soldat gedient hat, sich erfüllen lässt“4, zeigt ihn, an dessen Unerschütterlichkeit ein ganzes Volk glaubt, dem Gebot der Stunde nicht gewachsen, einer Stunde, die der Kronprinz in seinen Erinnerungen mit den Worten festhält: Der Kaiser suchte „mit seinen Augen den Blick des Generalfeldmarschalls, als müsste er bei ihm Kraft und Hilfe suchen in seiner Qual. Aber da war nichts.“
„Allein war der Kaiser“.
Sein Kanzler hatte das Reich an die Feinde der Krone verraten.
Die Heeresführung versagte sich ihm.
Die Waffenstillstandsverhandlungen standen vor dem Abschluss, die Kampftätigkeit ruhte, der Weg zur Front war verschlossen, der Krieg war aus.
Und kein Hagen war bei seinem König.
So ging das Hohenzollernreich unter. Anders als das der Nibelungen. Weil Ludendorff fehlte. Von ihm hatte sich Hindenburg getrennt, und seitdem war er . . . Gröner.
All das weiß ich an diesem Abend nicht. Um mich der Raum, vor mir die Zeit, alles ist dunkel. Und in mir . . . da leuchtet nur ein Licht, ganz rein und klar — die Mannentreue meiner Jäger. Doch der Abend ist lang, und vor lauter Sinnen werde ich müde, müde noch weiter mitzuspielen unter Schwächlingen, zwischen Lumpen. Ist denn nicht alles sinnlos? In wenigen Tagen wird sich das Bataillon auflösen, meine Getreuen werden auseinandergehen, jeder woandershin, wo er zu Haus ist, und ich werde allein sein. Habe ich es anders gewollt? Ich verschloss mich Vorschlägen und Plänen, die Formation weiterhin geschlossen zusammenzuhalten. Denn ich weiß, das ist alles Romantik, der Krieg ist aus, die Mehrzahl der Männer gehört nach Hause. Der verheiratete Mann zu seiner Familie, der Bauernsohn in den eigenen Betrieb, die vielen Oberschlesier wird die engere Heimat brauchen, denn dort sieht es bös aus. Über kurz oder lang werden wir uns doch trennen müssen — ob so oder so. —
Etwas Neues muss werden, denke ich, und ich sehe gleichzeitig den Weg.
Gleich meinen Jägern werde ich über Weihnachten zu Muttern gehen. Bald nach dem Fest kehre ich zurück. Hier in Oels werden mich meine 6etreuen erwarten. Ein kleiner Rest, nur die jungen Burschen, die noch keine Jahre verloren, einige, die die Heimat nicht brauchte, und solche, denen der Frieden nicht zusagt. Mit ihnen will ich eine neue Truppe bilden, Gleichgesinnte einstellen und ins Baltikum marschieren. Vielleicht auch nach Polen — das wird die Zeit weisen. Nur erst mal marschieren weit weg von Deutschland, von Schmach und Verrat, abseits der Straßen, auf denen der Frieden sich wälzt; in Treue und Kameradschaft, wie in den Jahren am Feinde, marschieren, marschieren bis . . . wir den Krieg wiederfinden.
Andere werden das Gleiche tun. Und an einem Tage werden wir uns alle sammeln. Das Losungswort wird „Deutschland“ sein, das Kampflied „Heil Kaiser Dir“. Wir werden in die Heimat zurückmarschieren, und alle im Kriege gefallenen Kameraden werden unsern Marsch begleiten.
1 Aus: „Erinnerungen des Kronprinzen“
2 Die Haltlosigkeit dieser Behauptung ist durch eine Denkschrift des Bataillons nachgewiesen worden. Die Schrift führt dabei die Tatsache an, dass dem Bataillon der Gebrauch der Waffe verboten war. S. Niemann: „Revolution von oben, Umsturz von unten“.
3 Authentische Darstellung der Vorgänge des 9. Novembers 1918 in Spa (Hindenburg, Plessen, Hintze, Marschall, Schulenburg).
4 Aus: „Erinnerungen des Kronprinzen“