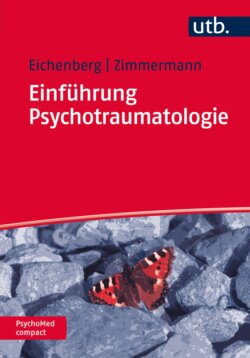Читать книгу Einführung Psychotraumatologie - Peter Zimmermann - Страница 9
Оглавление1 Einführung – Epidemiologie, Prävention und Pathogenese
Wie die verschiedenen somatischen Systeme des Menschen in ihrer Widerstandskraft überfordert werden können, so kann auch das seelische System durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmöglichkeiten überfordert und schließlich traumatisiert, d. h. verletzt werden. Von dem was geschieht, wenn eine solche Verletzung eingetreten ist, oder was zur Heilung geschehen sollte, handelt eine psychologische und psychosomatische Traumatologie als Lehre von Struktur, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten seelischer Verletzungen und ihrer Folgen.
In einer ersten Arbeitsdefinition kann ein psychisches Trauma daher als seelische Verletzung verstanden werden (von dem griechischen Wort Trauma = Verletzung), wobei zentral ist, dass diese von außergewöhnlicher Bedrohung ist oder ein katastrophales Ausmaß hat, das nahezu bei jedem tief greifende Verzweiflung auslösen würde.
1.1 Allgemeines zur Psychotraumatologie
Die Beobachtung, dass extreme Ereignisse ebenso extreme Reaktionen verursachen, ist bereits sehr alt. Gleiches gilt für die ersten systematischen Beschreibungen der Symptome, die nach traumatischen Erlebnissen auftreten, wie sie beispielsweise noch aus dem Ende des 19. und Anfängen des 20. Jahrhunderts von Beteiligten schwerer Unglücke, Soldaten der beiden Weltkriege und Überlebenden des Holocausts vorliegen. Es gab eine Reihe von Bezeichnungen wie Kriegs- oder Gefechtsneurose, Granatenschock („Shell Shock“) oder Kampfesmüdigkeit. Aber auch Opfer von sexuellen Übergriffen wiesen ein vergleichbares psychisches Störungsbild auf (Herman, 1993), und in ihren Beschreibungen finden sich die typischen Symptome, die noch heute als charakteristisch für Reaktionen auf traumatische Erlebnisse betrachtet werden:
ungewolltes Wiedererleben von Aspekten des Traumas, z. B. in Form von „Flashbacks“ (auch „Nachhallerinnerungen“; das plötzliche und häufig intensive Wiedererleben früherer Erlebnisse und der damit verbundenen Emotionen) oder Albträumen;
Anzeichen einer erhöhten Erregung, z. B. Schreckhaftigkeit und Schlafstörungen;
Vermeidung von Situationen, Gesprächen und anderen Reizen, die an das Trauma erinnern.
Hinzu kommt emotionale Taubheit, die sich in Interessenlosigkeit oder Entfremdung von anderen Menschen ausdrücken kann.
Im Jahr 1980 hat die Amerikanische Psychiatrische Gesellschaft die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) in ihr Krankheitsklassifikationssystem (DSM-III) aufgenommen. Seit den frühen 1990er Jahren ist die Diagnose auch im Internationalen Krankheitsklassifikationssystem (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation vertreten. Inzwischen hat sich die Psychotraumatologie zu einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin entwickelt.
Psychotraumatologie kann definiert werden als die „[…] Erforschung seelischer Verletzungen in Entstehungsbedingungen, aktuellem Verlauf sowie ihren unmittelbaren und Langzeitfolgen“ (Fischer & Riedesser, 2009, S. 392).
Zu den Meilensteinen neuer Disziplinen gehört die Gründung wissenschaftlicher Fachgesellschaften (im deutschsprachigen Raum z. B. das Deutsche Institut für Psychotraumatologie (www.psychotrauma tologie.de) sowie die Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (www.degpt.de), für internationale Fachgesellschaften siehe z.B. International Society for Trauma Stress Studies (www.istss.org), European Society for Trauma Stress Studies (www.estss.org) und Fachzeitschriften (z.B. Trauma (www.asanger.de/zeitschriftzppm/), Trauma & Gewalt (www.klett-cotta.de/zeitschrift/Trauma_Gewalt/7821), Journal of Traumatic Stress (http://www.istss.org/education-research/journal-of-traumatic-stress.aspx).
1.2 Definitionen und Begriffsbestimmungen
Die Psychotraumatologie hat sich inzwischen ausdifferenziert in die Allgemeine und Differenzielle Psychotraumatologie sowie die Spezielle Psychotraumatologie.
Die Allgemeine Psychotraumatologie behandelt allgemeine Gesetzmäßigkeiten traumatischen Erlebens und dadurch bedingten Verhaltens, die Differenzielle Psychotraumatologie befasst sich mit interindividuellen und intersituativen Unterschieden und Dispositionen von Traumaerleben und -verarbeitung. Die Spezielle Psychotraumatologie ist auf typische Situationen ausgerichtet wie Gewaltkriminalität, sexueller Kindesmissbrauch etc.
Traumaspektrum
Durch die intensive Beschäftigung mit psychischer Traumatisierung seit einigen Jahrzehnten hat sich das Wissen inzwischen sehr vergrößert. So weiß man beispielsweise heute, dass es nicht lediglich die sog. Posttraumatische Belastungsstörung als Folgeerkrankung nach einem potenziell traumatischen Erlebnis gibt. Vielmehr kann man von einem „Traumaspektrum“ aus Störungsbildern sprechen, bei denen eine psychotraumatische Verursachung diskutiert wird oder bereits nachgewiesen ist (Kap. 2.4). Ihnen gemeinsam ist eine psychische Traumatisierung, die sich nach Fischer und Riedesser (2009, S. 395) wie folgt definieren lässt:
„Psychische Traumatisierung ist ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“.
Situationstypen
Heute zählen nach den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachverbände (Flatten et al., 2011) zu den traumatischen Ereignissen:
erlebte körperliche und sexualisierte Gewalt, auch in der Kindheit (sog. sexueller Missbrauch),
Vergewaltigung,
gewalttätige Angriffe auf die eigene Person,
Entführung,
Geiselnahme,
Terroranschlag,
Krieg,
Kriegsgefangenschaft,
politische Haft,
Folterung,
Gefangenschaft in einem Konzentrationslager,
Natur- oder durch Menschen verursachte Katastrophen,
Unfälle oder
die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit.
Diese verschiedenen traumatischen Situationstypen werden grob in sog. man-made-disaster und natural-disaster unterteilt.
Man-made-disaster bezeichnen menschlich verursachte Traumatisierungen (z.B. Vergewaltigung, Folter, Mobbing) während unter Natural-disaster Naturkatastrophen (wie Erdbeben) oder auch Unfälle gefasst werden.
Arten traumatischer Erfahrungen
Eine weitere Unterscheidung betrifft den Aspekt der Art der traumatischen Erfahrung.
So ist ein Monotrauma (Typ-I-Trauma) ein einmaliges belastendes Ereignis, z.B. eine sexuelle Gewalttat oder ein Verkehrsunfall. Komplexe Traumatisierungen (Typ-II-Trauma) sind fortgesetzte seelische und evtl. auch körperliche Verletzungen, die oft bereits in frühen Lebensjahren beginnen, wie Misshandlungen oder Vernachlässigung durch eine Person, die auch aus dem familiären Umfeld stammen kann.
Beziehungstraumata
Solche Traumatisierungen werden auch als Beziehungstraumata bezeichnet. Diese werden paradoxerweise durch die engen Bindungsfiguren hervorgerufen, die eigentlich Sicherheit und Schutz gegen Traumatisierung gewährleisten sollen.
Unter kumulativer Traumatisierung versteht man „eine Traumatisierung in einzelnen Schritten, deren jeder für sich subtraumatisch verbleiben würde. In der einsetzenden Erholungsphase wird jedoch jedes Mal die Restitutionstätigkeit der Person durch erneute Ereignisse gestört und somit auf Dauer das psychische System zum Zusammenbruch gebracht“ (Fischer & Riedesser 2009, S. 397).
1.3 Wissenschaftsgeschichte und Konzepte der Psychotraumatologie
Unter den wissenschaftlichen Pionierleistungen, die in der Psychotraumatologie zusammenfließen, sind u. a. der sehr eigenständige Ansatz von Pierre Janet zu nennen, die Psychoanalyse und die auf den ungarischen Internisten und Biochemiker Hans Selye zurückgehende Stress- und Copingforschung (ausführlich bei Fischer & Riedesser, 2009).
Der traumazentrierte Ansatz Janets
Pierre Janet (1859 – 1947) und Sigmund Freud (1856 – 1939) waren Zeitgenossen. Janet, französischer Philosoph, Psychiater und Psychotherapeut, hatte seinerzeit ebenso wie zeitweilig auch Freud mit dem berühmten Hypnosearzt Jean-Martin Charcot an der Pariser Salpêtrière zusammengearbeitet. Aus den Hypnoseexperimenten und den therapeutischen Ansätzen Charcots ging hervor, dass zahlreiche psychopathologische Auffälligkeiten und Symptombildungen, unter denen die psychiatrischen Patienten litten, mit verdrängten Erinnerungen an traumatische Erlebnisse zusammenhingen.
Dissoziation
Janet zog als erster den Begriff der Dissoziation als Erklärungskonzept heran. Dissoziationen ergeben sich nach Janet als Folge einer Überforderung des Bewusstseins bei der Verarbeitung traumatischer, überwältigender Erlebnissituationen. Er führte aus, dass die Erinnerung an eine traumatische Erfahrung oft nicht angemessen verarbeitet werden kann: Sie wird daher vom Bewusstsein abgespalten, dissoziiert, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzuleben, entweder als emotionaler Erlebniszustand, als körperliches Zustandsbild, in Form von Vorstellungen und Bildern oder von Reinszenierungen im Verhalten. Die nicht integrierbaren Erlebniszustände können im Extremfall zur Ausbildung unterschiedlicher Teilpersönlichkeiten führen, was der dissoziativen Identitätsstörung (siehe z. B. Putnam, 2013) entspricht. Janet hat als erster Gedächtnisstörungen beschrieben, die mit Traumatisierung einhergehen (Veränderungen des Gehirns, Kap. 1.7).
Bedeutsam auch heute noch für die Psychotraumatologie ist zum einen Janets Entdeckung, dass traumatische Erfahrungen, die nicht mit Worten beschrieben werden können, sich in Bildern, körperlichen Reaktionen und im Verhalten manifestieren (der „unaussprechliche Schrecken“). Zum anderen hat seine Konzeption des 3-Phasen-Modells der Traumabehandlung heute noch große Bedeutung (Janet, 1889).
Psychoanalyse
Trauma und Hysterie
Freuds Traumakonzeption stellt den Beginn der psychoanalytisch orientierten Psychotraumatologie dar. In seiner Beschäftigung mit dem psychischen Trauma hat Freud sehr unterschiedliche Epochen durchlaufen. In einer frühen Phase, wie sie sich z. B. in den Studien zur Hysterie (Freud & Breuer, 1875) widerspiegelt, war er davon überzeugt, dass eine reale traumatische Erfahrung, insbesondere sexuelle Verführung von Kindern, jeder späteren hysterischen Störung zugrunde liege. In einer späteren Forschungsperiode (etwa ab 1905) relativierte er diese Auffassung. Heute wissen wir, dass sexueller Missbrauch in der Kindheit zwar auch zu einer hysterischen Störung führen kann, ebenso gut aber auch zu anderen Störungsbildern wie der Borderline-Störung oder dissoziativen Störungen (Kap. 2.4).
Trauma und Triebimpulse
In einer späteren Epoche entwickelt Freud einen zweiten Traumabegriff. Neben unerträglichen Situationsfaktoren werden inakzeptable und unerträglich intensive Triebwünsche und -impulse als Traumafaktoren untersucht. Wenn somit auch nach Freud der traumabezogene Standpunkt nicht verlassen wird, so wird er doch in eine breitere ätiologische Konzeption einbezogen, die „innere“ Faktoren wie die physische Konstitution und den Verlauf der Kindheit berücksichtigt. Trauma wird jetzt Bestandteil einer Geschichte als Lebensgeschichte und als Geschichte der Entwicklung von Triebwünschen und Lebenszielen. In dieser weiten Konzeption der Neuroseentstehung ist das Trauma ein ätiologisches Moment unter anderen, das sich in einem Ergänzungsverhältnis mit Erbfaktoren und Triebschicksal befindet, wobei sich diese pathogenetischen Faktoren aufsummieren und damit aufschaukeln können.
Unter den psychoanalytischen Autoren, die das Traumakonzept weiter entwickelt haben, sind u. a. folgende zu nennen: Abram Kardiner, Masud M. Khan, John Bowlby und Donald Winnicott (Übersicht bei Brett, 1993).
Trauma und Krieg
Der Amerikaner Abram Kardiner (1891 – 1981) verfasste sein Werk „The Traumatic Neuroses of War“ während des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1941 (Kardiner, 1941). Seine klinische Erfahrung ging zurück auf die psychotherapeutische Arbeit mit amerikanischen Soldaten, die im Krieg gegen Nazi-Deutschland und Japan kämpften. Er war der erste, der die massiven physiologischen Begleiterscheinungen traumatischer Reaktionen schon in der Namensgebung berücksichtigte, indem er von der traumatischen Neurose als einer „Physioneurose“ sprach. Kardiner formulierte ein Syndrom von Folgeerscheinungen, das in Vielem bereits als Vorläufer der heutigen Psychotraumatischen Belastungsstörung (PTBS) gelten kann.
Bindungstrauma
Masud Khan (1924 – 1989) erweiterte Freuds Traumabegriff mit seinem Begriff des kumulativen Traumas (Khan, 1963) (Kap. 1.2). Er war Schüler von Donald Winnicott (1896–1971), englischer Kinderarzt und Psychoanalytiker, der die Auswirkungen von frühen Bindungstraumata in einflussreichen Werken beschrieb.
frühkindliche Deprivation
Der Brite John Bowlby (1907 – 1990) war einer der ersten Psychoanalytiker, die empirische Forschung mit psychoanalytischer Theorie und Praxis verbanden. So entstand das auch heute noch bedeutendste Standardwerk zum Deprivationstrauma, in dem die Auswirkungen von frühkindlicher Deprivation wie z. B. früher Elternverlust, häufig wechselnde Beziehungserfahrungen und Trennungstraumata zusammengefasst sind (Bowlby, 1976, 1987). Seine Forschungen waren der Beginn der heute sehr etablierten Bindungsforschung (Strauß, Buchheim & Kächele, 2002).
Stressforschung
belastende Umweltfaktoren
Eine dritte Forschungsrichtung, die wesentlich zur Entstehung der Psychotraumatologie beigetragen hat, ist die Stressforschung mit den Pionierarbeiten des Mediziners Hans Selye (1907 – 1982). Selye näherte sich der Frage belastender Umweltfaktoren als Internist unter dem Gesichtspunkt der körperlichen Reaktionen und der Krankheiten, die durch kurz- oder langfristige Belastung hervorgerufen werden können.
Modell der Stressreaktion
Im Jahre 1936 formulierte er sein Modell der Stressreaktion mit den drei Phasen des Alarms, des Widerstandsstadiums und schließlich des Erschöpfungsstadiums. Die Alarmreaktion ist gekennzeichnet durch einen erhöhten Sympathicotonus und eine sympathicoton gesteuerte „Bereitstellungsreaktion“. Im Widerstandsstadium werden alle Reserven des Körpers mobilisiert, um die massive Belastung kompensieren zu können. So kommt es physiologisch etwa zur Produktionssteigerung von Nebennierenhormonen wie Cortisol und zur Erhöhung des Blutzuckerstoffwechsels (Kapitel 1.7).
Dekompensation wichtiger Funktionen
Dauert der pathogene Umweltreiz, der „Stressor“, wie Selye ihn nannte, weiter an, so treten massive und zum Teil irreversible Folgen wie Dekompensation der Reproduktionsfunktionen und Sexualfunktionen, der Wachstumsvorgänge und der Immunkompetenz (Erschöpfungsstadium) auf.
Stressreaktion
Eine 28-jährige verheiratete Frau arbeitet als Chefsekretärin in einem großen Konzern. Sie begibt sich zu ihrem Hausarzt, da sie seit einigen Monaten unter Symptomen leidet, die ihr zunehmend Besorgnis bereiten. So ist sie häufig, insbesondere vor großen Besprechungen, sehr angespannt und nervös, leidet unter Herzklopfen und schwitzt stark. Zusätzlich sieht sie dann verschwommen und empfindet ein schwankendes Schwindelgefühl, das meist noch einige Stunden danach andauert Nach einer organischen Ausschlussdiagnostik berät der Arzt sie dahingehend, ihre Arbeitsprozesse klarer zu strukturieren und Aufträge, für die sie nicht zuständig ist, konsequent abzulehnen. Zudem soll sie sich mehr bewegen und ein Entspannungstraining erlernen.
Nach sechs Monaten stellt sie sich erneut vor. Sie habe die Hinweise „aus Zeitmangel“ nicht umsetzen können. Sie sei nun täglich schon während der Arbeit erschöpft, fühle sich ständig unter Druck, sie schlafe nicht mehr richtig, sei immer wieder erkältet und auch die Sexualität mit ihrem Partner habe deutlich nachgelassen. Der Hausarzt empfiehlt nun die Durchführung einer Kur.
Die Untersuchungen Selyes haben sich auf die Erforschung der Psychosomatik innerer Krankheiten sehr fruchtbar ausgewirkt. Da Selye auch schon psychologische Symptome beschrieben hat, die dem physiologischen Stressverlauf entsprechen, hat diese Forschungsrichtung insgesamt einen wichtigen Beitrag zu einer psychologischen und psychosomatischen Traumatologie geleistet.
Für die Traumaforschung wertvoll regte das Modell zur Analyse von Umweltfaktoren an, allerdings wurden erst sehr viel später, z. B. im sog. „transaktionalen Stressmodell“ nach Lazarus und Folkman (1984), subjektive „Vermittlungsgrößen“ wie z. B. Abwehr- und Copingprozesse berücksichtigt. Es entstand eine Forschungsrichtung, die sog. „Stress- und Coping-Forschung“, in der sich kognitiv-behaviorale Ansätze mit Konzepten der Anpassungs- und Bewältigungsmechanismen aus der psychoanalytischen Ich-Psychologie verbinden.
1.4 Epidemiologische Daten
Prävalenz der PTBS
Die Angaben zur Prävalenz der PTBS schwanken in der Literatur zwischen 1,3 % bis 7,8 % der Allgemeinbevölkerung (Kessler et al., 1995), wobei bei Frauen von einer doppelt so hohen Inzidenzrate wie bei Männern ausgegangen wird (10 % vs. 5 %). Der aktuelle Deutsche Gesundheitssurvey beziffert die 12-Monats-Prävalenz für PTBS mit 2,4 %, wobei Frauen (3,8 %) deutlich häufiger betroffen sind als Männer (0,95 %) (Wittchen & Jacobi, 2012). Dieser geschlechtsspezifische Befund wurde in einer Reihe von Studien belegt. Die höhere Prävalenzrate bei Frauen begründen Kessler et al. (1995) damit, dass diese mehr schwerwiegende traumatische Ereignisse erleben (z. B. Kindesmisshandlung, Vergewaltigungen). Eine ebenfalls höhere Prävalenz des weiblichen Geschlechts konnte von Giaconia et al. (1995) unter Kindern und Jugendlichen festgestellt werden. Die Lebenszeitprävalenz bei 14- bis 18-jährigen Jugendlichen liegt zwischen 5 % und 10 % (Elklit, 2002). Bei 2- bis 5-jährigen Kindern wurde eine Prävalenzrate von 0,1 % ermittelt (Lavigne et al., 1996). Diese niedrige Rate spricht für eine mangelnde Adaptation der PTBS-Kriterien an das Kleinkindund Vorschulalter.
Die generellen Schwankungen in den Studien hängen mit der unterschiedlichen Verwendung der Diagnosekriterien und den verschiedenen Erhebungsbedingungen zusammen. In einer israelischen Untersuchung wurde die Diagnose bei Erwachsenen z. B. nur bei 3 % der Betroffenen vom Hausarzt gestellt (Taubman-Ben-Ari et al., 2001).
Abhängigkeit vom Situationstyp
Die PTBS entwickelt sich nach traumatischen Erfahrungen also unterschiedlich häufig (Flatten et al., 2011), wobei die Wahrscheinlichkeit hierfür auch von der Art des traumatischen Situationstyps abhängt. Exemplarisch zeigt die folgende Aufstellung die mögliche Spannbreite (Flatten et al., 2011):
ca. 50 % Prävalenz nach Vergewaltigung;
ca. 25 % Prävalenz nach anderen Gewaltverbrechen;
ca. 50 % bei Kriegs-, Vertreibungs- und Folteropfern;
ca. 10 % bei Verkehrsunfallopfern;
ca. 10 % bei schweren Organerkrankungen (Herzinfarkt, Malignome).
Eine mögliche genetische Ätiologie des Störungsbildes wurde explizit kontrolliert in einer Untersuchung von Goldberg et al. (1990) an eineiigen Zwillingen, von denen jeweils einer am Vietnamkrieg teilgenommen hatte. Die Autoren fanden eine Prävalenzrate von ca. 17 % unter den Kriegsteilnehmern im Verhältnis zu 5 % in der Vergleichsgruppe. Wurden nur diejenigen Zwillinge in den Vergleich einbezogen, die einem hohen Niveau von Einsatzstress ausgesetzt waren, so stieg die PTBS-Rate in der Untersuchungsgruppe auf das Neunfache der Kontrollgruppe an.
Grundsätzlich muss mit einer relativ breiten interindividuellen Variation bei der Verarbeitung potenziell traumatischer Situationen gerechnet werden. Wie die Zwillingsstudie nahelegt, bewegt sich der erbgenetisch determinierte Varianzanteil dabei innerhalb enger Grenzen. Umso wichtiger erscheint es auch unter präventiven Gesichtspunkten, dem differenziellen Verlauf der traumatischen Reaktion und den Bedingungen für ihren Übergang in chronische Verläufe, d. h. in den sog. traumatischen Prozess, verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen (Kap. 1.5 und 1.6).
1.5 Prävention psychischer Erkrankungen nach Traumatisierungen
Traumatische Ereignisse werden von bis zu 84 % der Bevölkerung zumindest einmal erlebt (Lebenszeitprävalenz) (de Vries & Olff, 2009). Zu psychischen Folgeerkrankungen kommt es allerdings nur bei einer Minderzahl der Betroffenen. Selbst bei schweren Traumatisierungen wie Bürgerkriegen oder Vergewaltigungen, bleiben 50 % und mehr psychisch gesund (S3-Leitlinie PTBS; Flatten et al., 2011) (Kap. 1.6).
Die Frage nach gesund oder krank hängt wesentlich mit der individuellen Konstellation vielfältiger Schutz- und Risikofaktoren zusammen, angefangen bei den Kontextfaktoren der traumatischen Situation (Bedrohlichkeit, individuelle Bedeutung etc.), biografischen Dispositionen, aber auch der Ressourcenlage der Traumaopfer (zur Bedeutung von Ressourcen siehe auch Kap. 3).
Gut ausgebildete Ressourcen können die Entstehung psychischer Erkrankungen nach Belastungen verhindern oder deren Folgen zumindest abmildern. Sie umfassen beispielsweise Kompetenzen wie die Aufmerksamkeits- und Impulskontrolle sowie Stressbewältigungs-(Coping-)Strategien, die Wahrnehmung und den Umgang mit Emotionen und Körperfunktionen, die Fähigkeit zum Umgang mit Anspannung (zum Beispiel durch Anwendung aktiver Entspannungstechniken) oder auch soziale Kontakte und Kompetenzen.
Insbesondere bei Einsatzkräften wie Polizei, Feuerwehr oder Bundeswehr, aber auch in bestimmten Berufszweigen (z. B. Lokführer) sind traumatische Erlebnisse ein mehr oder weniger vorhersehbarer Teil des Berufsbildes. Für die Ausbildung und Versorgungsplanung dieser Professionen ist daher die Berücksichtigung von Ansätzen für eine gezielte Prävention von Traumafolgestörungen eine besondere Chance. Die häufig vertretene Ansicht, dass eine wiederholte Exposition mit traumatischen Situationen zu einer Prävention im Sinne einer „Gewöhnung“ führt, hat sich nicht halten lassen. Eher muss dann mit einem Symptomanstieg als Ausdruck eines Kumulativeffektes gerechnet werden.
In den letzten Jahren wurde eine Reihe von Techniken aus ressourcenorientierten psychotherapeutischen Verfahren oder Methoden abgeleitet und für präventive Zwecke adaptiert.
Zudem wurden Wirksamkeitsstudien durchgeführt, deren Zahl allerdings im Vergleich zu Therapiestudien eher begrenzt und die Qualität zum Teil sehr wechselhaft ist, so dass auf diesem Gebiet nach wie vor ein erheblicher Forschungsbedarf besteht.
Im Mittelpunkt der durchgeführten Studien stand vor allem der Effekt von Vorbereitungs- und Ausbildungsmaßnahmen vor dem Eintritt einer Belastung (Primärprävention) sowie von Frühinterventionen zeitnah nach einem Ereignis (Sekundärprävention).
Auf das Thema Frühintervention wird im Kapitel 5.1 detailliert eingegangen.
Allgemeine Grundsätze der Primärprävention von Traumafolgestörungen
In den vergangenen Jahren wurde eine Reihe von psychosozialen Interventionen im Hinblick auf ihre Eignung für die Prävention von Traumafolgestörungen nach traumatischen Ereignissen untersucht (Zusammenfassung bei Skeffington et al., 2013); dazu gehörten:
Psychoedukation zum Thema Stress und Stressfolgen;
Stress- und Angstmanagement;
Entspannungstechniken;
Verbesserung von Coping-Strategien;
Wahrnehmung von Körperfunktionen, Emotionen und Gedanken;
Verbesserung von Aufmerksamkeits- und Emotionsregulation.
Im Regelfall werden diese Elemente insbesondere bei Einsatzkräften im Rahmen ihrer Ausbildung oder vor Beginn potenziell belastender Einsätze im Rahmen von Kleingruppen-Veranstaltungen vermittelt, um auch die positive Wirkung des Gruppenzusammenhalts (Kohäsion) zu nutzen und einen gegenseitigen Austausch der Teilnehmer zu fördern. Eine weitere Variante ist die Einbindung von Stressprävention in virtuelle, multimedia-basierte Simulationen von Einsatzgeschehen. Dabei werden einsatznahe Trainingssituationen eingespielt und die Anwendung von Präventionstechniken während der Situation geübt und nachbesprochen.
Spezielle Inhalte und Bewertung präventiver Ansätze
Psychoedukation ist ein verbreiteter Ansatz in der Primärprävention psychischer Belastungen. Sie beinhaltet die Vermittlung von Informationen zu möglichen Stressoren vor, während oder nach den antizipierten Ereignissen. Kernbestandteil ist dabei die Besprechung der individuellen Bedeutung von potenziell kritischen, einschließlich auch traumatischen Ereignissen für die betroffene Person, sowie von möglichen psychischen und körperlichen Reaktionen (Früherkennung) Ergänzend können auch die Erarbeitung von Bewältigungsstrategien und die Vorstellung professioneller Hilfsangebote im Falle von Belastungen oder Erkrankungen hilfreich sein.
Meist wird Primärprävention dieser Art in Vortrags- oder Seminarveranstaltungen durch einsatzerfahrenes, geschultes Personal angeboten. Zusätzlich empfiehlt sich aber auch die Anwendung von Broschüren oder Internet-Angeboten.
Beispielsweise hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung verfügbare Materialien in einer „Mediensammlung zum Thema Psychotrauma“ zusammengefasst, die im Internet unter www.dguv.de kostenfrei abrufbar ist.
Die Bundeswehr verfügt mit www.PTBS-Hilfe.de und www.angriffauf-die-seele.de über zwei online-basierte Portale, die eine Vielzahl an Materialien bereitstellen, unter anderem auch einen Online-Selbsttest und einen Lehrfilm zum Thema PTBS Seit 2016 ist zudem eine App zu diesen Themen kostenfrei erhältlich („Coach PTBS“) (Zu den Einzelheiten siehe auch Kapitel 5.10).
Auf der Website der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotaumatologie (www.DeGPT.de) steht ein anschaulicher Lehrfilm zu Traumafolgen und ihrer Behandlung zur Verfügung.
Studien zum präventiven Effekt von Psychoedukation wurden bislang nur im Kontext von Sicherheitskräften durchgeführt, hatten allerdings methodische Schwächen, sodass noch keine gesicherte Aussage zu ihrer Wirksamkeit möglich ist (Skeffington et al., 2013).
Psychoedukation wurde in mehreren Ansätzen mit einer Vermittlung von Stressbewältigungskompetenzen kombiniert. Dazu gehören Wahrnehmungstrainings für Körperfunktionen und -reaktionen, zum Beispiel über Biofeedback, für Emotionen und gedankliche Bewertungen (Kognitionen). Diese sollen dabei als integraler Teil der Stressverarbeitung erkannt werden, um in einem zweiten Schritt Mechanismen der Gegenregulation zu erlernen, z. B. ein aktives Entspannungsverfahren. Bewährt haben sich bei traumabezogenem Stress Techniken zur Atementspannung sowie auch imaginative Verfahren, die Entspannung über die Entwicklung von Fantasiebildern zur inneren Sicherheit, Naturbezogenheit etc. ermöglichen (z. B. der „Sichere Ort“, Kap. 3.2).
Ergänzend sind Verfahren des Stress- und Angstmanagements und der Aufmerksamkeits- und Emotionsregulation in der Prävention erprobt worden, daneben auch Kommunikationstrainings und die Erarbeitung von Coping-Strategien. Diese Techniken können in diesem Rahmen nicht detailliert wiedergegeben werden, es wird auf die einschlägigen Lehrbücher der Verhaltenstherapie (z. B. Margraf & Schneider, 2008) verwiesen.
Schutzfaktor soziale Unterstützung
Exemplarisch sei aber auf die Bedeutung sozialer Kontakte für die Prognose nach Traumatisierungen hingewiesen. Eine gute soziale Unterstützung hat sich in zahlreichen Studien als sehr wichtiger Schutzfaktor erwiesen. Maßnahmen, die zu einer Verbesserung dieser Unterstützung beitragen, wie beispielsweise die Entwicklung von Copingund Konfliktbewältigungs-Strategien durch soziales Kompetenztraining, können daher stress-präventiv wirksam sein. An gleicher Stelle setzen auch Angebote an, die die Aufklärung von Angehörigen Traumatisierter verbessern, wie etwa Angehörigen-Hotlines, Angehörigengruppen oder Aufklärungsbroschüren, wie z. B. die der Bundeswehr „Wenn der Einsatz noch nachwirkt“ für Angehörige traumatisierter Soldaten (www.angriff-auf-die-seele.de/cms/informationen/tipps/401-broschuerewenn-der-einsatz-noch-nachwirkt.html, 17. 2. 2017).
Die Kombination aus Psychoedukation und Stressbewältigungsstrategien wurde an einer Stichprobe von 20 Polizeibeamten in Sarajewo untersucht, von denen die Hälfte ein derartiges Training erhielten, die andere Hälfte als Kontrollgruppe dagegen nur eine Routine-Polizeiausbildung. Die Trainingsgruppe zeigte im Vergleich zur Kontrolle eine signifikante Reduktion von Angst und somatischen Reaktionen auf Stress (Sijaric-Voloder & Capin, 2008).
In zwei weiteren Studien an Polizeikräften wurden Psychoedukation und Stressbewältigungstraining in Kombination mit einer virtuellen Stressexposition durchgeführt und erprobt. Dabei wurden zunächst Informationen vermittelt und Techniken, z. B. Entspannungsverfahren, eingeübt. Anschließend wurden die Teilnehmer einer Computer-basierten Stresssituation ausgesetzt, die dem polizeilichen Berufsbild entsprach. Die trainierten Teilnehmer reagierten im Vergleich zu nicht Trainierten professioneller und mit weniger negativer Stimmung und Stress (Arnetz et al., 2009).
Um die verschiedenen Elemente von Stress- und Traumaprävention in einer standardisierten Form unter Nutzung von Multimedia-Elementen vermitteln zu können, wurde vom psychologischen Dienst der Bundeswehr das Computer-basierte Lern- und Übungsprogramm CHARLY (Chaos Driven Situations Management Retrieval System) entwickelt.
Computer-basierte Primärprävention CHARLY
CHARLY ist für Gruppen von 10 – 30 Soldaten zur Anwendung vor Beginn eines Auslandseinsatzes konzipiert. Jeder Teilnehmer arbeitet an einem eigenen Computer auf einer Plattform, die mit den anderen Anlagen vernetzt ist und auch Vergleiche der Ergebnisse zulässt. Die Bearbeitung dauert anderthalb Tage und wird von einem Psychologen begleitet, der für etwaige Fragen oder Probleme als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Dabei führt ein strukturierter Algorithmus durch verschiedene Themen bereiche, zunächst Psychoedukation zu Stress und Trauma, einschließlich verschiedener Stress-Spiele (Serious Gaming), wobei das erzeugte Anspannungsniveau über eine vegetative Messung (Hautleitfähigkeit, Herzfrequenzvariabilität) angezeigt wird. Im Verlauf kommen ergänzend Informationen und Übungen zu einsatzbezogenen Stressoren und deren Auswirkung dazu (ebenfalls als Stress-Spiele), die Vorstellung verschiedener Entspannungsverfahren sowie soziales Kompetenztraining.
Zwischen 2012 und 2014 wurde eine Studie zur Wirksamkeit von CHARLY bei Bundeswehrsoldaten im Zusammenhang mit einem Auslandseinsatz durchgeführt (Wesemann et al., 2016). Dabei wurden 67 Teilnehmer vor und nach einem Einsatz mit verschiedenen psychometrischen Testverfahren untersucht, unter anderem der Symptom-Checklist-90 (revised) sowie der Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS). Konkret erhielten 36 Probanden randomisiert über anderthalb Tage CHARLY, 31 wurden als Kontrolle durch eine Psychologin über den gleichen Zeitraum zum Thema Stress und Stressbewältigung informiert. Bei vergleichbarer Art und Anzahl einsatzbezogener Belastungen waren die Probanden, die CHARLY erhalten hatten, nach dem Einsatz auf den beiden Skalen signifikant weniger belastet als die Kontrollgruppe.
Die gezielte psychologische Prävention von Traumafolgestörungen hat in den psychosozialen Versorgungssystemen noch nicht den Stellenwert der Therapie nach Traumatisierungen erreicht, obwohl in den letzten Jahren eine Reihe von Ansätzen entwickelt und evaluiert wurde. Die bisherigen Forschungsergebnisse sind aufgrund kleiner Fallzahlen und verbesserungswürdiger methodischer Designs eher noch als vorläufig zu bewerten. Es ergaben sich aber vielversprechende Hinweise, dass die Kombination von Psychoedukation und Trainingselementen einen positiven Einfluss auf die Verarbeitungsfähigkeit und Prognose stressexponierter Personengruppen haben könnte, insbesondere, wenn sie standardisiert und multimedia-basiert vermittelt werden.
1.6 Pathogenese und Verlauf trauma-induzierter Störungsbilder
Bei einer psychischen Traumatisierung wird die Entstehung von Beschwerden und Symptomen aus einem prozesshaften Geschehen, d. h. einem Entwicklungsverlauf heraus verstanden.
Das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung nach Fischer und Riedesser (2009) umfasst einen dreiphasigen Ablauf: Am Anfang steht die „Traumatische Situation“, gefolgt von der „Traumatischen Reaktion“, welche in die Erholungsphase oder aber in den „Traumatischen Prozess“ übergeht.
In diesem Modell werden zudem subjektive und objektive Aspekte der traumatischen Situation systematisch aufeinander bezogen; Symptombilder werden prozesshaft und umwelttheoretisch betrachtet statt überwiegend aus internen Eigenschaften des Symptomträgers heraus.
traumatische Situation
Die traumatische Situation umfasst das traumatische Ereignis selbst sowie die unmittelbar darauf folgende „Schockphase“. Ob ein Ereignis einen traumatischen Charakter annimmt, hängt dabei nicht nur von objektiven Situationsfaktoren, wie beispielsweise der Dauer des Ereignisses, dem Bekanntheitsgrad des Täters oder der mittelbaren vs. unmittelbaren Betroffenheit ab. Auch personengebundene Merkmale wie die aktuelle und überdauernde psychische Disposition, protektive Faktoren (z. B. ein hilfreiches soziales Umfeld, für eine Übersicht biografischer Schutzfaktoren siehe z. B. Egle et al., 1997, siehe Kasten), Risikofaktoren (z. B. Vortraumatisierungen wie z. B. Verlust einer Bindungsperson in der Kindheit, siehe ebenso Egle ebd. und Kasten) sowie der physiologischen Disposition (vgl. Fischer & Riedesser, 2009) spielen eine Rolle (siehe auch Bender & Lösel, 2015).
Schutzfaktoren nach Egle et al. (1996, S. 19)
eine dauerhaft gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson;
Aufwachsen in einer Großfamilie mit kompensatorischen Beziehungen zu den Großeltern und entsprechender Entlastung der Mutter;
ein gutes Ersatzmilieu nach frühem Mutterverlust;
überdurchschnittliche Intelligenz;
ein robustes, aktives und kontaktfreudiges Temperament;
sicheres Bindungsverhalten;
soziale Förderung, z. B. durch Jugendgruppen, Schule oder Kirche;
verlässlich unterstützende Bezugspersonen im Erwachsenenalter, vor allem Ehe- oder sonstige konstante Beziehungspartner;
lebenszeitlich späteres Eingehen „schwer lösbarer Bindungen“;
eine geringe Risiko-Gesamtbelastung.
Risikofaktoren nach Egle et al. (1996, S. 19)
niedriger sozioökonomischer Status der Herkunftsfamilie
mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr;
schlechte Schulbildung der Eltern;
große Familien und sehr wenig Wohnraum;
Kontakte mit Einrichtungen der „sozialen Kontrolle“;
Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils;
chronische Disharmonie;
unsicheres Bindungsverhalten nach dem 12. / 18. Lebensmonat;
psychische Störungen der Mutter oder des Vaters;
alleinerziehende Mutter;
autoritäres väterliches Verhalten;
Verlust der Mutter;
häufig wechselnde frühe Beziehungen;
sexueller und / oder aggressiver Missbrauch;
schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen;
ein Altersabstand zum nächsten Geschwister von unter 18 Monaten;
uneheliche Geburt.
In der traumatischen Situation ist Handeln dringend erforderlich, kann aber aufgrund der situativen Gegebenheiten nicht erfolgen; eine subjektiv angemessene Reaktion ist unmöglich. In bedrohlichen Stresssituationen versetzt das vegetative Nervensystem den Körper in einen Aktivierungszustand und bereitet ihn auf Reaktionen, die dem Selbstschutz dienen sollen, vor (Fischer & Riedesser, 2009; Herman, 2003). Diese Bereitstellungsreaktionen können als Triade von Kampf, Flucht oder Totstellreflex zusammengefasst werden (Bering, 2011). In der traumatischen Situation kann keine dieser akuten Reaktionstendenzen sinnvoll umgesetzt werden, es entsteht eine Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Handlung(-smöglichkeit); es kommt zu einer „unterbrochenen Handlung“.
traumatische Reaktion
Postexpositorisch stehen die Betroffenen dann vor der paradoxen Aufgabe, eine Erfahrung verarbeiten zu müssen, die ihre Verarbeitungskapazität überschreitet. Mit der traumatischen Reaktion versuchen sie, das Unfassliche dennoch zu fassen und zu überwinden. Die sich in dieser Phase zeigenden Beschwerden werden hierbei nicht als krankhaft angesehen, sondern als normale Reaktionen auf ein nicht normales, erlebtes Ereignis (sog. „Normalitätsprinzip“). Zur Verarbeitung des Erlebten muss das traumatische Erlebnis als singuläres Extremereignis der eigenen Lebensgeschichte begriffen werden, dessen Wiederholung zwar prinzipiell möglich, aber äußerst unwahrscheinlich ist.
Misslingt den Betroffenen die Integration des Traumas, geht die traumatische Reaktion nicht in die Erholungsphase, sondern in den traumatischen Prozess über. Die Symptome chronifizieren. Der traumatische Prozess ist gekennzeichnet durch den Versuch, mit einer unerträglichen Erfahrung zu leben, ohne sich mit ihr wirklich konfrontieren zu müssen.
In der postexpositorischen Phase findet somit eine Art Weichenstellung statt. Korrektive Umgebungsfaktoren können den Übergang in die Erholungsphase entscheidend erleichtern. Andererseits ist die postexpositorische Phase insgesamt als besonders vulnerabler Zeitabschnitt zu sehen, in dem schon vergleichsweise geringe zusätzliche Belastungen eine pathogene Entwicklung fördern können. Dem Umgang von Behörden und Helferpersonen mit Traumaopfern kommt hier eine besondere präventive Bedeutung zu (vgl. Eichenberg & Harm, 2008). Sie müssen geschult werden, sich sensibel auf den natürlichen Traumaverlauf und die vulnerable postexpositorische Zeit einzustellen und Hilfsmaßnahmen dem natürlichen Erlebnisverlauf und Verarbeitungsprozess der Betroffenen anzupassen.
Traumastörungen weisen insgesamt eine spezifische Pathogenese auf, die sich u. a. aus der Dynamik von Traumaschema und traumakompensatorischem System ergibt (ausführlich bei Fischer, 2007).
Insgesamt muss die Analyse traumatischer Situationen (wie z. B. sexueller Missbrauch) neben den traumatogenen Situationsfaktoren (z. B. Bekanntheit des Täters) und ihrem objektiven Zusammenwirken das zentrale traumatische Situationsthema berücksichtigen, das sich aus der Verzahnung von objektiven Gegebenheiten und subjektiver Bedeutungszuschreibung auf dem Hintergrund der persönlichen Lebensgeschichte bildet.
Das zentrale traumatische Situationsthema stellt die zentrale subjektive Bedeutung dar, die eine traumatische Situation für die betroffene Persönlichkeit annimmt. Hier liegt der Punkt maximaler Interferenz zwischen traumatischer Situation und Persönlichkeitssystem.
Oft sind es gerade die aufgrund früherer Belastungsfaktoren im Lebenslauf gebildeten traumakompensatorischen Mechanismen und Strukturen, die für Traumatisierung besonders anfällig oder „zerbrechlich“ sind.
Traumaschema
Um diesen Punkt von Situationsfaktoren und persönlicher Situationsdeutung bildet sich das Traumaschema aus. Es ist durch eine systematische Diskrepanz von Wahrnehmung und Handlung gekennzeichnet und folgt einer Tendenz zur Wiederaufnahme und Vollendung der unterbrochenen Handlung. Diese kann die passive Form des Wiederholungszwangs annehmen und führt dann zu einer unbewussten Reproduktion der traumatischen Situation.
Das Traumaschema ist Ausdruck des Regulationsverlustes in der traumatischen Situation. Es speichert die Erinnerung an den Ereignisablauf, die peritraumatischen Erlebnisphänomene sowie ein Bild des Subjekts in hilfloser, ungeschützter Verfassung angesichts einer extrem bedrohlichen Lage. Unter dem Druck der peritraumatischen Erfahrung verliert das Traumaschema verschiedene Funktionen gelingender Wahrnehmungs- und Erfahrungsverarbeitung. Im postexpositorischen Zeitraum zielt die Traumaverarbeitung dann darauf ab, Erlebnisinhalte und Form des Traumaschemas aufzuarbeiten und in den kognitiv-affektiven Wissensbestand der Persönlichkeit zu integrieren. Ein Verarbeitungsmechanismus des psychobiologischen Systems ist hier ein Wechsel der Phasen von Verleugnung und Intrusion (Wiedererleben). Der Verarbeitungsprozess kann in diesen Phasen „entgleisen“. Einmal kann der ursprüngliche traumatische Erlebniszustand als Panikzustand fortbestehen und der Betroffene wird dauerhaft von unkontrollierbarer Erregung überflutet. Eine zweite Variante besteht darin, dass sich die Vermeidungs- / Verleugnungsphase verfestigt und sogenannte „frozen states“, eingefrorene Erlebniszustände mit psychovegetativen und psychosomatischen Reaktionen fixiert werden.
traumatischer Prozess
Bei relativ ungenügendem Abschluss der postexpositorischen Phase kommt es zum traumatischen Prozess. Dieser ist gekennzeichnet durch den paradoxen Versuch, sich an eine unerträgliche Erfahrung anzupassen, mit ihr zu leben, ohne sich mit ihr wirklich konfrontieren zu können. Bei genereller Schwäche der Kontrollfunktionen entwickelt sich eine chronische Posttraumatische Belastungsstörung mit intrusiver Symptomatik. Bei überstarken, starren Kontrollmaßnahmen, die bei einer Erfahrung von Extremtraumatisierung wie etwa der Folter überlebensnotwendig sein können, kommt es zu einer generellen Erstarrung der Persönlichkeit mit Verlust der emotionalen Spontaneität.
kompensatorisches Schema
In weniger extremen Fällen ist das Persönlichkeitssystem bestrebt, die traumatische Erfahrung durch Strategien zu kontrollieren, wobei der Entwurf des kompensatorischen Schemas die zentralste darstellt. Eine wesentliche Funktion des Schemas besteht in der kompensatorischen Umkehr des Traumaschemas. Aus hilfloser Abhängigkeit wird Sicherheit, aus Schwäche Stärke usw. Traumaschema und kompensatorisches Schema sind die zentralen dynamischen Kräfte im traumatischen Prozess. Das kompensatorische Schema entwirft ein verändertes Script oder Drehbuch, das sog. Traumascript, in dem die traumatische Erfahrung zwar enthalten ist, jedoch in erträglicher Dosierung und Verarbeitung.
Vertiefung: Traumakompensatorisches Schema
Basisstrategie und individuelle Ausprägung der traumakompensatorischen Maßnahmen: Während sich in der peritraumatischen Erfahrung spontane Selbstschutzmechanismen bilden, werden diese während der weiteren traumatischen Reaktion und im traumatischen Prozess elaboriert. Das kompensatorische Schema umfasst drei Komponenten: Eine ätiologische Theorie (wodurch ist das Trauma entstanden?), die Heilungstheorie (wie kann das Trauma geheilt werden?), die präventive Theorie (was muss geschehen, um eine Retraumatisierung zu vermeiden?). Diese Komponenten sind logisch aufeinander bezogen, basieren aber schon auf einer traumatischen Erfahrung, die entsprechend ihrer Speicherung im Traumaschema nur unvollständig zugänglich ist und in wichtigen Teilaspekten oft nur implizit erinnert werden kann. Von daher erwecken die traumakompensatorischen Maßnahmen einen – von außen betrachtet – irrationalen, unzweckmäßigen Eindruck, während es sich, gemessen am gegebenen Informationsstand, um subjektiv sinnvolle Maßnahmen handelt.
Traumakompensatorisches Schema nach sexualisierter Gewalt
(nach Bering et al., 2004)
Eine 36-jährige Frau wurde Opfer sexualisierter Gewalt. Mit dem alkoholisierten Täter war sie freundschaftlich verbunden. Er sei ihrer Meinung nach „verrückt“ geworden. Kindheitserinnerungen werden geweckt. Sie entwickelt das Vollbild einer PTBS, das von einer schweren depressiven Reaktion begleitet ist. Albträume quälen sie. Zu Hause ist sie sozial gut eingebettet; nur dort fühlt sie sich wohl. Außenkontakte meidet sie. Eine stationäre Behandlung lehnt sie wegen ihrer 4-jährigen Tochter ab; sie ist ihr Lebensinhalt.
Zehn Wochen nach dem Ereignis, nach dem Durchlaufen der Einwirkphase, befindet sie sich in der Phase der Verfestigung des traumatischen Prozesses. Die Situationsdynamik ist gekennzeichnet vom subjektiven Erleben der Patientin, eine vertrauensvolle Beziehung zum Täter aufgebaut zu haben. Auf der objektiven Seite jedoch wurde sie von ihm vergewaltigt. Die Dynamik des Traumaschemas besteht daher aus der Diskrepanz dieser beiden Situationsfaktoren („Vertrauen fassen vs. Enttäuschung erleben“). Nun setzt der Schutzreflex des Traumakompensatorischen Schemas ein mit seinen drei Anteilen (Ätiologie, Prävention, Reparation).
Ätiologisch: Um sich erklären zu können, wie sie sich in ihrer Wahrnehmung so täuschen konnte, führt die Patientin das Psychotrauma auf einen Ausnahmezustand des Täters zurück, indem sie ihn situativ für „verrückt“ erklärt. Somit kann sie die guten Beziehungsanteile schützen.
Präventiv: Um nicht noch einmal Opfer einer Gewalttat zu werden, zieht sie sich in ihr häusliches Umfeld zurück und meidet Beziehungen zu anderen Menschen (außer zu ihrer Tochter), damit sie nicht wieder enttäuscht wird.
Reparativ: Die 4-jährige Tochter der Patientin ist Lebenssinn und Heilungstherapie gleichzeitig für ihre seelischen Verletzungen. Sie erholt sich über ihr Selbstbild als „gute Mutter“.
Zwischen Spannungsfeld von Traumaschema und Traumakompensatorischem Schema entsteht die Symptomatik der PTBS vom depressiven Verlaufstypus.
1.7 Psychobiologie trauma-induzierter Störungsbilder
Die Psychobiologie trauma-induzierter Störungsbilder, das heißt die Interaktion psychischer und pathophysiologischer Prozesse und Veränderungen nach traumatischen Erlebnissen, ist durch ein komplexes Geschehen gekennzeichnet, das vielfältige Regelsysteme des Hirn- und hormonellen Stoffwechsels umfasst Die maßgeblichen Zusammenhänge werden bis heute trotz umfangreicher Forschungsarbeiten noch nicht vollständig verstanden.
Um einen ersten Überblick zu erleichtern, erfolgt an dieser Stelle im Rahmen dieses einführenden Beitrags eine Beschränkung auf die Posttraumatische Belastungsstörung als Traumafolgestörung, über die in diesem Bereich auch die fundiertesten Erkenntnisse vorliegen.
Zur Vertiefung liegen detaillierte Reviews aus jüngster Zeit vor:
Sherin & Nemeroff, 2011; Marinova & Maercker, 2015
Die wesentlichen, einer Posttraumatischen Belastungsstörung zuzuordnenden Veränderungen finden sich in den folgenden Bereichen:
(neuro-) hormonale Effekte;
funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) und Positronen-Emissionstomographie (PET);
(Epi-) Genetik.
(Neuro-)hormonale Veränderungen
Im Mittelpunkt (neuro-) hormonaler Veränderungen nach Traumatisierung stehen die Katecholamin- (insbesondere Noradrenalin) und die Cortisolregulation.
vermehrte Noradrenalinausschüttung
Es kommt zu einer Hoch-Regulation der Plasmaspiegel des Stresshormons Noradrenalin, die zu sekundären Folgen wie gesteigerter Wachsamkeit und Nervosität (Hypervigilanz), Impulsivität, erhöhtem Blutdruck (Hypertonie) und Herzrasen (Tachykardie) führen kann. Diese wiederum tragen zu einer erhöhten Häufigkeit von Herzerkrankungen bei der PTBS bei, letztlich auch zu einer erhöhten Sterblichkeit (Mortalität) im Langzeitverlauf (S3-Leitlinie PTBS; Flatten et al., 2011).
Hypocortisolismus
Demgegenüber wird die Ausscheidung von Cortisol unterdrückt (Hypocortisolismus), mit der Folge reaktiv erhöhter Level an Corticotropin Releasing Hormon (CRH). Da Cortisol die Noradrenalin-Ausscheidung hemmt, führt der Cortisol-Mangel dementsprechend zu einer ungezügelten Ausscheidung (Disinhibition) von Noradrenalin und verstärkt dessen negative Folgen.
Weitere Regelsysteme, die sich nach Traumatisierungen verändern, hier aber nicht detailliert wiedergegeben werden können, umfassen beispielsweise Dopamin, Serotonin, gamma-Aminobuttersäure (GABA), Glutamat, endogene Opioide und Neuropeptid Y.
Zum Teil existieren zu diesen Veränderungen widersprüchliche Befunde, die auch mit den untersuchten Patientengruppen und traumatischen Ereigniskategorien zusammenhängen können.
Veränderungen im fMRT und PET
Eine Reihe von Studien konnte strukturelle und funktionelle Veränderungen des Gehirns nach Traumatisierungen nachweisen, die sich u. a. in der (funktionellen) Magnetresonanztomographie (fMRT) und der Positronen-Emissionstomographie (PET) abbilden ließen.
Strukturell zeigten sich verminderte Volumina der Hippocampi, des linken Corpus amygdaloideum (Mandelkern) und anterioren cingulären Cortex sowie der linken Insel und des rechten Gyrus parahippocampalis (Meng et al., 2014).
Bahnbrechend für die neurobiologische Modellbildung waren Untersuchungen mithilfe der Positronen-Emissionstomographie. Hiernach war unter experimentell induzierten szenischen Erinnerungen an ein Trauma (Flashbacks) besonders das Broca-Areal (motorisches Sprachzentrum) in seiner Aktivität unterdrückt und die Mandelkernregion (Corpus amygdaloideum) der rechten Gehirnhälfte besonders aktiv (Kosslyn et al., 1996).
Diese Befunde decken sich mit dem klinischen Phänomen, dass viele Traumatisierte das Geschehen oft nur bildhaft wiedererleben, nicht in Worte fassen können und immer wieder von einem Zustand wortlosen Entsetzens („speachless terror“) ergriffen werden.
Parallel zu diesen Befunden waren im funktionellen MRT unter Reizexposition verminderte Aktivitäten des linken Hippocampus und Gyrus parahippocampalis auffällig. Diese Region ist an der emotionalen Bewertung und Einordnung eingehender (auch belastender) Sinneseindrücke beteiligt und damit für eine gesunde Reizverarbeitung unentbehrlich. Interessant war die Beobachtung, dass einige dieser Veränderungen unter kognitiv-behavioraler Stabilisierungsbehandlung im Gruppensetting rückläufig waren, also offenbar psychotherapeutisch beeinflussbar sind (Thomaes et al., 2012). Dieser Befund korrespondiert mit der Beobachtung, dass Patienten unter erfolgreicher Therapie trauma-bezogene Emotionen klarer wahrnehmen und benennen und dadurch die traumatische Erfahrung besser verstehen und in ihren Erlebnishorizont einordnen können.
(Epi-)genetische Dispositionen und Veränderungen
Bei trauma-assoziierten Erkrankungen stehen schon per definitionem Umweltfaktoren an erster Stelle der Pathogenese. Dennoch sind genetische Dispositionen Teil des Krankheitsgeschehens, vor allem Varianten (Polymorphismen) im genetischen Material der Gehirn-Botenstoffe (Neurotransmitter) Dopamin, Noradrenalin, Serotonin.
Dazu kommen umgekehrt aber auch genetische Veränderungen, die offenbar durch Traumafolgestörungen verursacht werden, zum Beispiel epigenetische Veränderungen im Methylierungsgrad von Glucocorticoid-Rezeptor-DNA und FKBP5-DNA (dieses Gen ist ein Modulator der Stresshormonachse und ist u. a. an der Entstehung von Depression beteiligt). Diese waren mit der Symptomschwere und Therapieprognose bei Kriegsveteranen assoziiert (Yehuda et al., 2013).
Die Erkenntnisse über die neurobiologischen Korrelate von Traumafolgestörungen sind in den vergangenen Jahren weit fortgeschritten. Sie sind deshalb von besonderer Bedeutung, da sie die Grundlage für Weiterentwicklungen in den Bereichen medikamentöser Behandlung, aber auch Früherkennung und Verlaufskontrolle von Traumafolgestörungen darstellen können.
1.8 Fragen zu Kapitel 1
1. Bitte definieren Sie die Disziplin „Psychotraumatologie“ inklusive der Beschreibung ihrer Ausdifferenzierungen.
2. Was versteht man unter einer „psychischen Traumatisierung“?
3. Bitte erläutern Sie den Begriff der „Kumulativen Traumatisierung“.
4. Skizzieren Sie einige zentrale traumahistorische Konzepte.
5. Wie wahrscheinlich ist die Ausbildung einer PTBS nach a) Vergewaltigung, b) bei Kriegs- und Folteropfern, c) bei Verkehrsunfallopfern? Haben Sie Erklärungen für die individuelle Spannbreite für die Entwicklung einer Traumafolgestörung?
6. Skizzieren Sie das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung nach Fischer und Riedesser.
7. Welche Schutzfaktoren stehen welchen Risikofaktoren gegenüber, die darüber entscheiden, ob ein Ereignis für eine Person traumatischen Charakter annimmt?
8. Nennen Sie drei Module, die in der Primärprävention psychischer Erkrankungen nach Traumatisierungen eingesetzt werden.
9. Auf welche Weise können Computer-basierte Angebote die konventionelle Stressprävention sinnvoll ergänzen?
10. Welche beiden (neuro-) hormonellen Systeme sind bei einer PTBS vor allem betroffen und wie?
11. Nennen Sie drei Areale des Gehirns, deren Funktion sich nach Traumatisierungen verändert.