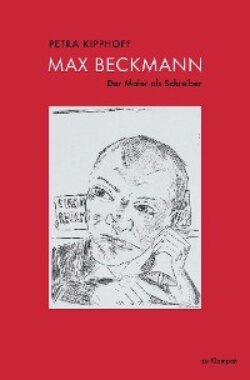Читать книгу Max Beckmann - Petra Kipphoff - Страница 5
Schwarz und Weiß
ОглавлениеKunst dient der Erkenntnis, nicht der Unterhaltung, der Verklärung oder dem Spiel.1
Max Beckmann, der Maler, Zeichner und Graphiker, war auch ein lebenslanger Schreiber, ein vielfältiger und eigensinniger Autor. Am umfangreichsten in seinen Tagebüchern und Briefen, zwei Kategorien, die man üblicherweise nicht zur literarischen Produktion zählt. Die aber bei Beckmann von einer Kontinuität und Intensität sind, die sich wie von selbst zu einem Roman in eigener Sache, einem autobiographischen Drama, fügen. Zur bewegten Autobiographie gehören neben Briefen und Tagebüchern auch die Texte, Programme und Vorträge, die Beckmann im Zusammenhang mit seiner künstlerischen Arbeit geschrieben hat. Und schließlich hat er, der sich sehr für das Theater seiner Zeit interessierte, auch drei kleine Dramen verfasst, das dritte wurde erst im Nachlass gefunden.
Die »archaische Wucht des Erzählenwollens« erkannte der langjährige Freund Stephan Lackner in den Tryptichen von Beckmann. Diese Energie war schon von Anfang an vorhanden und zu erkennen. Wenn auch zunächst in einer Theatralik der Sujets. In seinen frühen Jahren hatte Beckmann das große Format für die großen Dramen der Antike, des Christentums und des Alltags in den Farben der Alten Meister gewählt. Da gab es die »Auferstehung« (1908/1909), »Das Erdbeben von Messina« und die »Kreuzigung Christi« (beide 1909), »Die Amazonenschlacht« (1911) und den »Untergang der Titanic« (1912). Mehr Drama ging nicht. Beckmann brauchte das große Format für großartige Ereignisse. Und begegnete diesen auch in angemessener Ausstattung. Ein frühes Foto, das Beckmann bei der Arbeit zeigt, ist am Strand aufgenommen, im Jahr 1907 an der Ostsee. Beckmann steht hier an der Staffelei, im dunklen Anzug, die Melone liegt am Boden, eine Flasche steht neben dem Malkasten. Zwischen Pose und Profession lässt sich der dreiundzwanzigjährige Künstler, der grade von einem Stipendienaufenthalt in der Villa Romana in Florenz zurückgekehrt ist, hier ablichten.
Der Hang zum Drama, der mit den großen historischen oder biblischen Tragödien beginnt, setzt sich im kleinen Format der schwarzweißen Graphik-Zyklen fort. Auch hier wird eine grausame Geschichte erzählt, jetzt aber aus der schwarzweißen, erlebten alltäglichen Gegenwart, so in »Hölle« (1919), »Gesichter« (1919), »Stadtnacht« (1920), »Jahrmarkt« (1921) und der »Berliner Reise« (1922). Diese großen Graphik-Folgen, die alle in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, sind das Gegenteil der historischen Dramen in Öl, sie haben einen sehr direkten und von Beckmann teils auch selber miterlebten Anlass und Hintergrund. Es sind drastische Reportagen aus dem Großstadt-Alltag der Armut und Gewalt tätigkeiten, der Kriegsverletzten, Obdachlosen und Verhungernden. Die Blätter dokumentieren ein Elend, das alle Farben hinter sich gelassen hat.
»Ja: Schwarz und Weiß, das sind die beiden Elemente, mit denen ich zu tun habe«, sagt Beckmann 1938 in einem Vortrag in London über seine Malerei und betont damit das schwarzweiße Entweder – Oder einer andererseits vielfarbigen Welt. Und fährt fort: »Das Glück oder Unglück will es, daß ich nicht nur weiß, nicht nur schwarz sehen kann. Eins allein wäre viel einfacher und eindeutiger. Allerdings wäre es dann auch nicht existent. Aber trotzdem ist es doch der Traum vieler, nur das Weiße (nur das gegenständlich Schöne) oder nur das Schwarze (das Häßliche und Verneinende) sehen zu wollen … Ich kann nicht anders, als mich in beidem zu realisieren. Nur in beidem, Schwarz und Weiß, sehe ich Gott als eine Einheit, wie er es sich als großes, ewig wechselndes Welttheater immer wieder neu gestaltet.«2
Schwarz und Weiß, in diesen beiden für die Typographie und die graphischen Künste essentiellen Farben kommen sich Text und Zeichnung oder Radierung sehr nahe. Und vereinen sich gelegentlich auch. So hat Beckmann zum Beispiel den Beginn des neunten Kapitels der »Offenbarung des Johannes« mit einem Kohlestift über den Text hinweg seitenfüllend um eine Skizze ergänzt, die ein Kopf sein könnte.
Von »literarischer Ichkunst« spricht der Kunsthistoriker Hans Belting angesichts des Maler-Autors Beckmann, die sich in seinen zahlreichen Selbstporträts, Ölbildern wie Bleistiftzeichnungen und Radierungen, aber auch in seinen Texten widerspiegelt. Das geschieht voller Selbstbewusstsein, aber auch in vielen verschiedenen Kostümierungen, Posen und Rollen.3 Beckmann hat Dostojewski und Shakespeare illustriert, zu Clemens Brentanos grausamem »Märchen vom Fanferlieschen« acht Radierungen hinzugefügt, Goethes »Faust«, Teil II, und die »Apokalypse« nach der Übersetzung von Martin Luther bebildert. Und sich im Schreiben ein zweites Forum geschaffen.
Immer wieder tauchen auf den Bildern von Max Beckmann Buchstaben, Wortfetzen, einzelne Wörter, Zeilen, Noten oder ganze Schriftseiten auf, die auf ein Buch, eine Institution, eine Zeitung, ein Hotel, eine Champagnermarke hinweisen. Beckmann streut diese Kürzel und Zitate mal mehr, mal weniger auffällig, mal kryptisch und mal entzifferbar über das Bild, positioniert sie oft auch sehr deutlich.
Sie verquicken nicht nur den fernen Mythos, das theatralische Geschehen und seine Protagonisten mit der Realität der Gegenwart. Sie sind auch, vom Zeitungsfetzen bis zum Champagneretikett, ein Hinweis auf den weltläufigen Herrn Beckmann im schwarzen Anzug und gern mit Zigarette, für den die Bar zum Alltag gehört wie das Atelier. Eine herumliegende Zeitung oder ein Buch, eine Champagnerflasche und ein Hotelboy mit Käppi sind Hinweise und Requisiten des Alltags des Großstadtmenschen, des Zeitungs- und Literatur-Lesers, Bar-Besuchers und Reisenden, von dem wir zum Beispiel durch das Bild »Golden Arrow« (1930) auch erfahren, dass er offensichtlich in Marseille im Grand Hotel abgestiegen ist.
Gelegentlich kommt es auch zu sehr eigenwilligen Pointierungen. Wenn auf dem Bild »Badekabine (grün)« (1928) aus dieser Kabine nicht nur, erwartungsgemäß, der Blick auf einige entfernte Menschen im Meer fällt, sondern auf dem Fensterbrett der Kabine neben den Badelatschen sehr sichtbar ein Buch mit den Buchstaben »TITAN J. Paul« liegt, dann wird der neugierige Bildbetrachter darauf hingewiesen, dass Beckmann im Strandgepäck nicht irgendeinen flatterhaften Unterhaltungsroman hat, sondern den Giganten Jean Paul. Wobei diese wohl eher ungewöhnliche Strandlektüre auch die Distanz zu den bürgerlich banalen und entfernten kleinen Badenden vergrößert. Übrigens geht Beckmann gern mit Anzug und Hut an den Strand, wie ein Foto zeigt. Dass der »Titan« offensichtlich für ihn ein immens bedeutsamer Roman war, wird durch das Tagebuch belegt, dem man entnehmen kann, dass er die vier Bände mit vielen hundert Seiten mehrmals gelesen hat.
Eine maritime Idylle ist diese Strand-Szene allerdings im Vergleich zu »Galeria Umberto« (1925). Auf dem hochformatigen Bild greifen Hände, teilweise auch ohne erkennbare Körperzugehörigkeit, meist ins Leere, dann auch um die eigenen Beine. Eine Trompeterin, zwei naturgemäß undefinierbare Rumpfgestalten und ein Fisch ergeben keine Gesellschaft. Wohl aber eine Szene voller rätselhafter Gestalten und Requisiten sowie offener Gewalttätigkeit. Von der Decke hängt kopfüber eine ihrer Unterarme beraubte Person, an deren Hals die an einem Schal baumelnde Flasche Champagner aus dem Hause Heidsieck zu sehen ist, der entzifferbare Teil des Etiketts mit den Buchstaben EISI legt diese Provenienz jedenfalls nahe.
Das Bild »Mimosen« (1939) bietet zwischen einer Vase mit den titelgebenden Blumen und einem leeren Weinglas auch Lektüre, einen Band VOLTAIRE. Und auf dem Bild »Kinder des Zwielichts – Orkus« (1939) findet eine gewaltsame Auseinandersetzung dreier in einem Boot sitzender Figuren statt, die von einigen weiß gekleideten weiblichen Gestalten aus dem Hintergrund beobachtet werden. Das Wort SORTIE ist der durch einen Pfeil verdeutlichte Hinweis auf den Ausgang. Das Wort, das die Richtung für den Ausgang aus dem Theater oder dem Kino angibt, hat mehrere Möglichkeiten, denn in dieser Atmosphäre der Gewalt tätigkeiten und Grausamkeiten kann es ein Ausgang sein, aber auch das Ende bedeuten.
Auf dem Aquarell »Ewichkeit« (1936) ist ein auf einer abgebrochenen Säulenspitze sitzender, exotisch aussehender Mann damit beschäftigt, das Wort EWICHKEI (das T fehlt noch) auf ein an der Wand hängendes Schild zu pinseln. Wobei diese Orthographie, die auch eine eigene Klangqualität hat, wohl mehr von der Nietzsche-Lektüre geprägt ist als vom Glaubensbekenntnis. Auf dem Blatt 6 der »Berliner Reise« (1922) sieht man eine zwischen stehenden, debattierenden Männern auf dem Boden sitzende Frau mit einem Pamphlet LIEBKNECHT AUFRUF und einem Buch MARX. Es sind die von der gescheiterten Revolution 1919 »Enttäuschten II«, die allerdings Hunger, Elend und Gewaltsamkeit auf der Straße und in den Dachkammern vielleicht nicht direkt mit erleiden müssen, die Beckmann in anderen Zeichnungen und Radierungen deutlich beschrieben hat. Am erschreckendsten in dem Zyklus »Die Hölle« (1919). Hier musste nichts erfunden werden, hier sind die grausamsten Szenen des Nachkriegsalltags schwarz auf weiß präsent, ein Blatt heißt explizit »Das Martyrium«.
Auch auf den Tryptichen, diesen Dramen in drei Bildakten, die Klaus Gallwitz »große, verschachtelte Gedankengebäude« genannt hat4, findet sich Geschriebenes, Gedrucktes. Beckmann hat, entsprechend den in Kirchen seit dem 16. Jahrhundert aufgestellten Drei-Flügel-Altären und ihrer Darstellung der Heils-, und Unheilsgeschichte, die von ihm selber als Bildautor konzipierten und meist bellicosen Geschichten der Gegenwart durch Figuren der Antike um einen historischen Hintergrund erweitert. Und damit als zeitlos qualifiziert – oft auch die Dramen in drei Akten in der Welt des Theaters und des Zirkus angesiedelt.
Wobei er, egal, ob es sich um den Mythos der griechischen »Argonauten«, um »Schauspieler« oder das Kinderspiel »Blindekuh« handelt, nie als Illustrator des vorhandenen Textes oder Themas arbeitet, sondern immer als Erfinder einer eigenen Geschichte, vor allem aber als Dramatiker agiert. Und zwar mit der von ihm entfalteten Bildrhetorik, zu der es eben auch gehört, dass er seine Dramen gleichzeitig mit den Helden und Halbgöttern der Antike wie auch den Personen und den Requisiten des Großstadtalltags besetzt, sich gelegentlich auch selber auf die Bühne stellt, zum Beispiel als Zuschauer und Beobachter. Einmal aber auch, auf der Mitteltafel des Triptychons »Schauspieler« (1941/42), als König, der auf die Bühne der mittleren Tafel tritt und ein spitzes Messer auf seine Brust setzt, das Blut macht sich schon auf der Jacke des grünen Anzugs breit.
Ein großes Stück Papier liegt am Boden, AMSTERD ist da sehr deutlich zu lesen. Das Triptychon »Karneval« (1943), auf dessen linkem Flügel sich diese Information findet, ist im Exil in Amsterdam entstanden, in den Jahren 1942/3 und in einer kriegsbedingt vielfach bedrohlichen Situation für den Emigranten Beckmann. Die zeitlose Bild-Geschichte wird durch Textelemente, wie zum Beispiel das am Boden liegende Stück Papier mit der Schrift AMSTERD, in der Realität des zeitgenössischen Alltags verankert. Auch in dem als Drama in drei Akten aufgebauten Triptychon »Versuchung« (1936/7) ist das der Fall. Die Lektüre von Gustave Flauberts »Die Versuchung des Heiligen Antonius« (1874, auf Deutsch zuerst 1909 erschienen) war hier wohl ein auslösendes Moment.
»Meine Liebe gilt den 4 großen Malern männlicher Mystik: Mäleßkirchner, Grünewald, Breughel und van Gogh«5, schreibt Beckmann, und obwohl ihn der Weg wohl einmal nach Isenheim führte, gibt es keinen Kommentar zum Isenheimer Altar in seinen Tagebüchern und Briefen. Sollte ihm dieses Werk die Sprache verschlagen haben? Er selber wird zwischen 1937 und 1950 neun Triptychen auf der Bühne der Bilder inszenieren.
Die dritte Schauseite des »Isenheimer Altar« zeigt die Versuchung des Heiligen Antonius durch ein überwältigendes Aufgebot von brutalen Ungeheuern und furchterregenden Tieren, die den greisen Heiligen bedrohen und mit Klauen, Zähnen und Stöcken über ihn herfallen. Und wo ist die Versuchung? Für diese ist angesichts der Dimensionen der Bestrafung bei Grünewald kein Platz. Dass auch der Eros dazugehörte, ist eher unwahrscheinlich oder, angesichts des Greisenalters des Heiligen, schon sehr lange her.
Anders bei Beckmann. Auf der Mitteltafel des Triptychons »Die Versuchung« sieht man einen jungen Mann in roten Pumphosen und einem gelben, kurzärmeligen Oberteil ausgestreckt am Boden liegen. Gebannt schaut er auf eine üppige, nur minimal bekleidete Frau, die in geringer Entfernung von ihm sitzt. Er ist aber gefesselt und sie deshalb für ihn unerreichbar. Hinter ihm liegt ein aufgeschlagenes Buch am Boden, mit einiger Mühe kann man den ersten Vers des Johannes-Evangeliums entziffern: »IM ANFANg WAR DAS WORT«. Außerdem auf einem Zettelrand das Wort SATURN. Der Page, der auf dem rechten Flügel des Triptychons forsch voranschreitend eine auf allen Vieren am Boden kriechende Frau an einer Leine führt und mit der Linken auf einem Tablett eine Krone servierbereit hält, ist, wie auf dem Käppi zu lesen, ein Hotelboy des Berliner Restaurants (Kem)PINSKI.
Angesichts des dramatischen Geschehens, das sich auf dem Bild abspielt, sind diese Buchstaben oder Satzfetzen optisch eher Randerscheinungen. Und tragen doch dazu bei, den Radius des Bildgeschehens, den Mythos oder die Geschichte mit zielstrebiger Nonchalance, die ihre Kürzel wie zufällig verstreut, in eine andere Zeit, in die Gegenwart und Welt von Max Beckmann hinein zu erweitern, mit allen Zufälligkeiten und Banalitäten. Zu Recht stellt Michel Butor in seinem Buch »Die Wörter in der Malerei« die Frage, warum dieses Thema noch nicht untersucht worden ist: »Eine erstaunliche Blindheit, denn grade das Vorhandensein dieser Wörter unterminiert die durch unser Bildungssystem errichtete Trennwand zwischen der Literatur und den bildenden Künsten.«6 Max Beckmann, der ohne Bücher nicht sein wollte und konnte, hat die Trennwand für sich selber beiseite geschoben. Und seine Arbeiten dadurch um ein Element erweitert, das manchmal eine Information, einen Kommentar, oft aber auch ein Rätsel in die Welt der Bilder bringt.
»Im Anfang war das Wort«, so beginnt die Apokalypse des Johannes, und vor allem diesem Text verdankt sich die Tatsache, dass das Wort Apokalypse zum Synonym geworden ist für die Geschichte des Weltuntergangs oder auch für Schrecken und Vernichtung aller Arten. Im Anfang, und in dem Moment, wo der Mensch beginnt, sich verständlich zu machen, ist das Wort. Für Max Beckmann, der diesen Text 1941 mit 27 nachträglich kolorierten Steinzeichnungen anschaulich gemacht und interpretiert hat – es handelte sich um eine Auftragsarbeit –, war das Wort von Anfang an Begleiter. Und ist es bis zum Schluss geblieben. Beckmanns letzte Eintragung im Tagebuch ist vom Tag seines Todes.
26. Dezember 1950
Schneefall …
Den ganzen Tag gearbeitet
Auch noch am »Kopf« –
Und »Theatergarderobe«
Q. war böse – 7
Es gibt Max Beckmann, den klaren und pointierten, oft auch zynischen und angriffslustigen Autor der Vorträge und Kommentare zu seiner Arbeit, seinem Werk, der Kunst überhaupt. Und daneben das Leben in den Briefen und im Tagebuch. Ohne Illusion und später auch oft mit Resignation. Aber dann gibt es auch plötzlich den romantischen Phantasten, der von ekstatischen Festen psalmodiert und himmlischen Wolken nachdichtet. Und seiner geliebten Mathilde, genannt Quappi, kurz vor der Heirat die grandiosen Möglichkeiten einer imaginierten Hochzeitsreise schildert:
»Wollen wir nach Afrika uns im Urwald eine Hütte bauen und Bäume ausroden? Den Negern ein Grammo mitbringen und ›Windsor‹ zum Gestampf dicker Negressen spielen lassen. In Seen baden und Krokodile am Bauch kitzeln … Oder wir mieten den Zigeunerwagen, lassen einen Motor einbauen und rasen über Grönland zu den Eskimos Deinen Ahnen!! – Ja was meinst Du – ›Die kleine Eisprinzessin kommt zurück …‹ rufen dann die Eisbären und putzen sich fleißig mit Pebeo die Zähne, damit sie recht gefährlich aussehen. – Die Robbenjungfrauen aber versammeln sich und überreichen Dir einen grünen Mooskranz mit Nordlichtern besteckt und ich bekomme viel Schnaps von den guten Eskimomännern und Thran zum Einreiben …
Das Wohnungsamt des Nordpols hat uns den zur Zeit unbewohnten Palast der Eiskönigin zugewiesen in dem bis jetzt nur Eisbären und Eisbärinnen höchst unerlaubt ohne Berechtigung ihren Foxtrott im gelbroten Schein der Nordlichter getanzt haben … Denk Dir: des Morgens werden wir dann durch den großen Trommlerchor der schwarzen Walrosse geweckt (sie können die großen, weißen und roten Trommeln ganz gut mit ihren großen Flossen halten) und können ganz vorzüglich trommeln: Rum, RRum, RummPumPung. – Ein Großer Walfisch bläst auf einer Riesenflöte den Orionchoral, das große Solo. – Er ist etwas fett und sentimental, der große Walfisch und vor Ergriffenheit über sein eigenes Spiel rinnt ihm die Träne aus seinen kleinen Augen, so groß wie ein Fass. Du musst wissen, dass der Walfisch ein großer Verehrer von Jean Paul ist. Daher bläst er so gern die Flöte im Morgensonnenschein.«8
Es gibt den Briefschreiber, der die Liebste und das Verliebtsein feiert, dabei natürlich auch sich selber. Der den Liebeskummer festhält, die Fragen und Probleme des privaten und politischen Alltags, der die Freuden und Leiden seiner ersten Liebe Minna, später seiner zweiten Liebe Quappi mit teilt, den Freunden und schließlich auch dem Sohn Peter. Gern in einem dramatischen Tonfall, den er nur gegenüber dem Sohn nicht anwendet. Aber gelegentlich auch mit einer Offenheit relativ Fremden gegenüber, die nichts verbirgt und so hoffnungslos wie selbstbewusst klingt.
Mitte März 1919 schreibt er an den Kunsthistoriker Julius Meier-Graefe, der sich für das Werk und den Künstler interessiert und der ihn zu einer Professur beglückwünscht, die Beckmann aber abgelehnt hatte: »Ich weiß nur das eine, daß ich der Idee, mit der ich geboren bin und die sich vielleicht noch embryonal schon in dem Drama und der ersten großen Sterbeszene findet, mit dem Aufgebot aller meiner Kräfte folge bis ich nicht mehr kann.«9
Stephan Lackner gegenüber erlaubt er sich und dem Freund zur momentanen Erleichterung im November 1939 auch den ihm nicht fremden Zynismus: »Ich schreibe dieses gerade während einer Verdunkelung in Amsterdam beim harmonischen Concert des Sirenengeheuls. Man muß anerkennen, daß unbekannte Regisseure alles auf bieten um die Situation in einem Carl Mayschen Sinne weiter interessant zu gestalten. Kritisch muss aber festgestellt werden, daß ihnen leider nicht mehr sehr viel Neues einfällt und daß wir das Recht haben – nun selber etwas Neues zu insceniren. Und das wird ja auch wohl mal kommen. – Ich bin jedenfalls in intensiver Vorarbeit um neue Coulissen zu produzieren mit denen weiter agiert werden kann.«10
Es gibt den Tagebuchschreiber, der die berufliche Situation kommentiert, die Erwartungen, Enttäuschungen und Erfolge. Die Ironie ist dabei ein gewisser Selbstschutz. Er muss das »Fietsen«, also Fahrradfahren, in Amsterdam ebenso lernen, und es wird ihm zur angenehmen Selbstverständlichkeit, wie die Arbeit in der gemieteten Bodenkammer statt im eigenen Berliner Haus mit Atelier. Auch die Umzüge, also die Emigration erst nach Holland, von dort in die Vereinigten Staaten, wo er sich mit einem holperigen Englisch abmüht, sind für einen Künstler wohl noch etwas komplizierter als für einen Autor. Max Beckmann fühlt sich oft auf endloser Fahrt, wie Odysseus. Dann aber wird auch die gelungene Vollendung eines Bildes oder die erfolgreiche Herstellung von Bratkartoffeln gefeiert, alles knapp und anschaulich, oft gleichzeitig mit den Grausamkeiten des Krieges und in jedem Fall ohne Schnörkel. »Die frappante Dialektik von Vitalität und Verkühlung zieht sich durch Beckmanns Leben hindurch«, schreibt Bernhard Maaz.11
Von der erschreckenden, im wahrsten Sinne des Wortes mörderischen Realität des Krieges, den Verwundeten, Sterbenden und Toten, die er aus seiner Zeit als freiwilliger Sanitäter 1914/1915 erst in Ostpreußen und dann vor allem in Flandern direkt vor Augen hatte, berichtet er in seinen Briefen mit einer gnadenlosen Genauigkeit. Das Auge nimmt präzise das Grauen in allen seinen Details auf, die Emotionen sind abgeschaltet. Beckmann konnte andererseits aber auch heiter verrückte Verse oder groteske kleine Balladen schreiben, die ihren Vorvater in Wilhelm Busch und den Kollegen im Zeitgenossen Christian Morgenstern hatten.
Was seine künstlerische Arbeit betrifft, so äußerte er sich nicht der Umbruchstimmung der aufgewühlten, von Verletzungen aller Art gezeichneten Kriegs- und Nachkriegszeit und den Meinungen und Aktionen anderer Künstler entsprechend, die sich oft auch programmatisch zu einer Gruppe vereinigt hatten, zum Beispiel der »Brücke« oder dem »Blauen Reiter«. Max Beckmann war immer ein dezidierter Einzelgänger mit einer deutlich artikulierten eigenen Meinung. Der nicht die Konfrontation scheute, selbst wenn er, wie in der Debatte um die moderne und zeitgenössische Kunst, ziemlich allein dastand. Um so besser.
»Tja«, so lautet das kleinste Wort von Beckmann, der ein sehr deutscher Titan unter den großen Künstlern des 20. Jahrhunderts und auch ein eigenwillig insistierender Autor war. Nicht zuletzt in dem, was er ausließ. »Tja«, ein eher im Gespräch als im gedruckten Text benutztes Dreibuchstaben-Nichtwort, das man ein Pausenzeichen nennen könnte, verwandte der Maler von neun großen Triptychen, deren jedes ein meist dramatisches Sujet der Literatur, der Mythologie oder des Alltags zum Thema hat, besonders gern.
»Tja«, dieses retardierende Moment im Gespräch und Selbstgespräch, das in seine Bilder und Graphiken nicht hineinpasst, kommt in den späten Tagebüchern 1940/1950 über dreißig Mal vor, manchmal auch zweimal hintereinander. »Tja«, dann ein paar Wörter, dazwischen Gedankenstriche, Leerräume, Fragezeichen. »Tja – Doris gestorben«12 – so der Eintrag im Tagebuch am 23. Juli 1950. Doris war die Schwester von Quappi, Beckmanns zweiter Ehefrau, die schon in Holland lebte, als Beckmanns auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus dort ankamen. An den Verleger und Sammler Reinhard Piper, dem er seit seiner Berliner Zeit verbunden war und der ihm seine Memoiren geschickt hatte, schrieb Beckmann am 25. Dezember 1950, zwei Tage vor seinem plötzlichen Tod: »Tja, man hat damals einiges gewollt und will oder muß noch immer.«13
Es waren die Jahre des Exils in Holland (1937/1947), als Beckmann aus Furcht, die Tagebücher könnten den Nazis in die Hände fallen, Notizen und Tagebuchblätter auch der früheren Jahre in dem Moment vernichtete, als die deutsche Wehrmacht die Niederlande im Mai 1940 besetzte. Dann folgte 1947 die Emigration in die USA. Die völlig neue Umgebung, die englische (amerikanische) Sprache, die Unsicherheit über die Zukunft seiner Arbeit, das Einkommen und den Wohnort, dazu die altbekannten, gesundheitlichen Herzprobleme waren eine kontinuierliche Belastung.
Der junge, von allem Anfang an sehr selbstsicher auf tretende Beckmann hat diese kleinen Signale der Unterbrechung oder auch Ratlosigkeit nicht gebraucht. Aber später half ihm diese Atempause. Einmal sogar in einem nicht erhofften, aber sehr ersehnten, freudigen Zusammenhang: »Tja also, man hat ihn: FIRST PRIZE OF THE CARNEGIE (1500 D.) Brief von H. S. Gaudens mit allen Chicanen. Ich hatte es nicht geglaubt, daß so etwas möglich ist in dieser Konkurrenzwelt – na ja –«14.
Lange Meditationen oder differenzierte Argumentationen waren ohnehin nicht Beckmanns Sache, entsprachen nicht seinem Temperament und Stil. Der Vortrag mit der geduldigen Entwicklung einer These, einer differenzierten Botschaft war die Ausnahme, und auch hier ließe sich eine Summe, eine Quintessenz meist in ein, zwei knapp konturierten Sätzen zusammenfassen. Wobei Kürze nicht immer nüchterne Sachlichkeit bedeutet. »Ignorantia pyramidalis«, so sein Zwei-Worte-Urteil über einen Text von C. G. Jung, im Buch des Autors an den Rand geschrieben.
Als er während der Berliner Zeit im Salon Cassirer zum ersten Mal Bilder von Henri Matisse sah, vermerkt er im Tagebuch am 7. Januar 1909: »Die Matisseschen Bilder mißfielen mir höchlichst. Eine unverschämte Frechheit nach der anderen.«15 Beckmann war aber offensichtlich doch erheblich irritiert von dieser »unverschämten Frechheit«, die er so beleidigt wegwerfend kommentiert, als habe ihm ein Flegel auf die Füße getreten.
Er selber malte zu dieser Zeit in großem Format und oft in den für Historienbilder typischen dunklen Farben, Grundton Braun, bei Katastrophen im Meer Dunkelgrün. »Die Sintflut« (1908), »Auferstehung« (1908/9), »Kreuzigung Christi« (1909) waren alles Themen aus der Bibel. Über den »Untergang von Messina«, 1909, eine Katastrophe der Gegenwart in biblischen Dimensionen, informierte er sich detailliert. Die gigantischen Dramen, egal ob die biblische Kreuzigung oder die zeitgenössische Schiffskatastrophe wie der »Untergang der Titanic« (1912), waren seine Präferenz. Chaos und Kampf, Vernichtung und Untergang. Nicht sehr kunstzeitgemäß. Aber das machte ihn noch selbstsicherer.
Und wenn er nicht malen konnte, dann schuf er Bilder in Wörtern. So schreibt er von der Front an seine Frau Minna: »Draußen das wunderbar großartige Geräusch der Stadt. Ich ging hinaus durch die Scharen verwundeter und maroder Soldaten, die vom Schlachtfeld kamen und hörte diese eigenartige schaurig großartige Musik. Wie wenn die Tore zur Ewigkeit aufgerissen werden ist es, wenn so eine große Salve herüberklingt. Alles suggeriert einem den Raum, die Ferne, die Unendlichkeit. Ich möchte, ich könnte dieses Geräusch malen.«16
Was andererseits die Texte betrifft, so kann man sagen: Nie war Pathos knapper als bei Max Beckmann. Und dadurch besonders intensiv. Von Anfang an. Seine Sätze sind meist kurz und kategorisch. Signale. Ausrufe. Behauptungen. Spruchbänder. Seine frühen Bilder zwischen 1905 und 1913 signierte er mit den Buchstaben MBSL oder HBSL, »Max / Herr Beckmann seiner Liebsten«, Widmungen für seine erste Frau Minna Beckmann-Tube. Max und Minna, oder »Maken« und »Minken«, blieben über die Scheidung, Beckmanns zweite Ehe und seine Emigration hinaus ein Leben lang miteinander verbunden.
Manchmal, und gerade wenn es um sehr essentielle, aber auch sehr private Dinge ging, gibt es hier nur ein Kürzel oder auch einen Hauch von Ironie. So schreibt Beckmann am 19. April 1949 an sein »liebes Minnachen«, das er mit Care-Paketen versorgte, wie er sich darüber freue, dass sie ein Bild, das er vor langer Zeit von ihr gemalt hatte, wieder aufgehängt hat. Und fügt hinzu: »Schönes Bild. Denke auch manchmal gern ans Original.«17
Das siebte, 1945 vollendete Triptychon, eine Ansammlung von gedrängt vereinzelt agierenden Menschen, dazu Trommel, Harfe, Flöte und ein großer Wecker, ist unter dem Titel »Blindekuh« bekannt. Hatte aber vorher schon »Die große Bar«, »Cabaret« und »Ochsenfest« geheißen, Namenswechsel, die mit Beckmanns Lebensthemen zusammenhängen. Die aber auch seine Reaktion auf die letzten Wochen und Tage des Krieges widerspiegeln, die im Tagebuch mit knappsten Sätzen verfolgt werden, Ironie inclusive. Dienstag, 1. Mai 1945: »Lebensmittelpakete durch englische Flieger abgeworfen. In München, Oberammergau – Italien fertig … Mussolini erschossen – das ist wahr. Kämpfe im Anhalter Bahnhof. Nachmittag in drei Bars. Keine Peky.« Mittwoch, 2. Mai 1945: »Hitler offiziell gesneuveld.« Freitag, 11. Mai 1945: »Man sieht die Canadesen mit holländischen Meisjes, ausgewechselt gegen die Germans.« Sonntag, 20. Mai 1945: »Noch Knallsonne und Knall-Nationalismus. Deformierung Germany’s in bestem Gange.« Donnerstag, 31. Mai 1945: »Stubenarrest für die Germans das Mindeste …« Samstag, 9. Juni 1945: »Ein gewisser Gleichmut fängt an, sich herabzusenken. Schade nur, dass ich bis 1. November nicht rauchen will. Tja, man sitzt in Berlin und langsam formulieren sich die Bilder.«18
Kurze Sätze. Die keinen Widerspruch dulden. Oft auch besonders dann, wenn es um sehr essentielle Dinge geht. Auch die Wörter stauchte Beckmann, ehe sie durch den inhaltlichen oder persönlichen Impetus übergewichtig werden konnten, gern auf Kurzformeln zusammen. Die Angina pectoris, Lebens- und Todeskrankheit, rückt in der Kurzform »Peky« verbal in die Nähe des Hundehaustiers, das mit Quappi in sein Leben kam und Butshy hieß. Die Apokalypse, mit deren Umsetzung in eine Folge von Radierungen er im Amsterdamer Exil beginnt, wird zur »Apo«. Am 13. November 1941 notiert er: »Apo-müde – déprimé – kalt«19, und am 27. Dezember: »Apo Endspurt«, einen Tag später: »Endgültig Apo – Gott sei Dank!«20
In den späteren Jahren kam ihm auch die amerikanische Vorliebe für Kürzel sehr entgegen. Das auf ein »Tryptic« reduzierte Tryptichon hat Grünewald hinter sich gelassen. »Argo« sind die Argonauten, sein letztes Tryptichon, an dem er noch am 24. Dezember 1950 gearbeitet hat, drei Tage vor seinem Tod. Zuletzt nennt er es noch einmal mit vollem Namen: »Weihnachten vorbei … Jane war zum Weihnachtshammel da. Ich todmüde. – Am Morgen noch ›endgültig‹?! ›Argonauten‹ fertig gemacht.«21
Immer sind es auch grade die großen Themen, die persönlichen wie die politischen Herausforderungen und Probleme, denen Beckmann in dieser sprachlichen Minimierung ihren Platz zuweist, sie vielleicht so im Zaum zu halten versucht. Dazwischen dann Gedankenstriche, Leerräume, Fragezeichen, Pausenpunkte, die Spannung zwischen zwei Absätzen. Dieses Abbremsen und Aussparen reduziert nicht den Sachverhalt, pointiert aber das Pathos und gibt den Fakten mehr Gewicht. Auch das Nebeneinander von Weltpolitik, Küchendienst und Poesie ist keine Ausnahme, sondern ein Kommentar zur Lebenssituation. Am 21. Juli 1942 vermerkt Beckmann im Tagebuch: »Es regnet und stürmt wie ungefähr im März. Fing an, Jean Pauls ›Selina‹ zu lesen. Abends gute Bratkartoffeln von mir selbst.«22