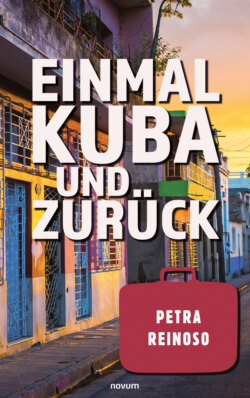Читать книгу Einmal Kuba und zurück - Petra Reinoso - Страница 5
ОглавлениеKapitel 2
Es war nun schon März. Im Sommer würde ich fertig sein mit meiner Ausbildung. Aber etwas war anders mit mir, meine Periode blieb aus. Das kam zwar immer wieder mal vor, aber dieses Mal dauerte es einfach zu lange. Raul ging mit mir zum Arzt. „Sie sind schwanger, möchten Sie eine Überweisung in die Klink zu einem Schwangerschaftsabbruch? Das müsste ich dann schnellstens wissen, da Sie bereits in der elften Woche sind. Sie sind ja noch jung.“ Was dachte der sich eigentlich? Schon wieder einer, der meinte, er müsse mir sagen, was ich zu tun hatte. „Ich muss die Nachricht erst mal verdauen, natürlich will ich nicht in eine Klinik. Ich möchte das Kind.“ Zum Glück war ich vor Kurzem 18 Jahre geworden und somit konnte mir niemand mehr reinreden. Raul konnte es kaum glauben, er war total erfreut über diese Nachricht und wir stellten uns das süße Baby vor, wie es wohl aussehen würde. „Ich weiß aber nicht, wie ich es meinen Eltern sagen soll, schließlich wohne ich noch zu Hause. Sie werden mich rausschmeißen. Mit einem Kind zu Hause zu wohnen, damit werden sie niemals einverstanden sein.“ „Dann wohnst du eben bei mir oder wir suchen uns eine Wohnung.“ „Es ist sehr schwer, eine Wohnung zu finden, es gibt kaum welche und wenn dann nur mit Beziehungen und Geld haben wir ja auch nicht, um eine Wohnung überhaupt erst mal einzurichten und bei dir im Wohnheim, niemals.“ „Es bleibt uns ja noch etwas Zeit, jetzt muss ich es erst mal meinen Eltern sagen.“ Ich fühlte mich wohl und war glücklich. Ich würde es meinen Eltern sagen aber nicht heute und auch nicht morgen. Auf jeden Fall würde ich das Kind bekommen. Dann würde alles anders mit Raul und mit meinen Eltern. Eines Abends sagte ich zu meiner Mutter: „Ich muss dir was sagen, ich bin schwanger.“ Sie schaute mich schockiert an und brachte kein Wort raus. Ihre Augen waren so starr und ihr Mund war zusammengekniffen. Diese Stille machte mich ganz nervös. Was war denn los mit ihr, wieso sagt sie nichts. „Was soll das? Dass du dir mit solchen Angelegenheiten einen Scherz erlaubst, hätte ich dir nicht zugetraut.“ „Das ist kein Scherz, ich bin wirklich schwanger.“ „Du nimmst doch die Pille, das kann gar nicht sein.“ „Ich habe sie eben vergessen, zu nehmen.“ Dass Raul sie mir weggenommen hatte, habe ich ihr lieber nicht erzählt. So langsam merkte ich, dass sie mir nun doch glaubte. „Du wirst es abtreiben, darüber bist du dir hoffentlich im Klaren. Wir gehen morgen zusammen zum Arzt und machen einen Termin.“ Ich sagte dazu gar nichts mehr, egal was sie vorhatte, ich würde das Kind bekommen. Der Arzt gab mir die Einweisung für eine Klinik für den nächsten Tag. Da ich keinen Ton mehr sagte, ließ mich meine Mutter alleine zur Klinik fahren. Ich verließ das Haus und fuhr erst gar nicht hin, denn ich wusste, dass ich keinen Abbruch machen würde. Am Abend als ich nach Hause kam, sagte sie: „Wieso bist du nicht in der Klinik?“ „Ich war da, aber die Ärzte haben gesagt, es ist schon zu spät für einen Abbruch.“ „Das glaube ich dir nicht, wäre ich doch bloß mitgefahren. Wir fahren morgen zusammen hin.“ „Nein, das werde ich nicht, es ist zu spät und ich will das Kind bekommen.“ „Dann sagst du es deinem Vater selbst, du wirst schon sehen, was er dazu sagt. Hier kannst du jedenfalls nicht wohnen bleiben mit einem Kind. Das kannst du alleine großziehen, denn dein Raul wird eines Tages nach Kuba zurückgehen und dann stehst du alleine da. Auf unsere Hilfe brauchst du gar nicht erst zu hoffen. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen.“ Ich ließ sie reden und zum ersten Mal wurde mir klar, dass ich diese Entscheidung alleine treffen konnte. Keine Bevormundung von niemandem. In dieser Hinsicht waren sie machtlos, sie konnten es mir nicht verbieten. Das Erste und das Einzige, was sie mir nicht verbieten konnten und wo ich mich nicht wie sonst ergeben musste. Endlich keine Schläge mehr, sie hatten damit keine Macht mehr über mich, kein erzwungener Gehorsam mehr. Das befreite mich unheimlich. Mein kleines Baby unter meinem Herzen hatte mir diese Freiheit verschafft. Was für ein Schatz, so ungeplant hat es in mir seinen Platz eingenommen und mit so einer großen Wirkung. Mein Vater kam nach Hause, „Deine Tochter ist schwanger.“ Wieso plötzlich dieser Sinneswandel, ich dachte, ich sollte es ihm selber sagen, na ja auch gut. Jetzt war es raus, dann war nur noch abzuwarten, wie er reagiert. Ich war in meinem Zimmer, er kam rein. „Was habe ich da gehört? Mach doch, was du willst, aber suche dir eine Wohnung, hier bleibst du nicht mit einem Kind.“ Er winkte mit einer Handbewegung ab, wie er es immer tat, wenn er sein Gegenüber für blöd hält und ging wieder raus. Von meinen Arbeitskollegen und Freundinnen aus der Schule hörte ich nur Positives, sie teilten meine Freude und das gab mir sehr viel Mut. „Deine Eltern werden sich schon wieder beruhigen!“, sagten sie. „Warte es erst einmal ab, spätestens wenn das Baby da ist, dann können sie nicht mehr widerstehen, so ist es immer.“ Obwohl ich das zwar nicht ganz glauben konnte, hoffte ich es zumindest, denn schließlich war auch Maria schwanger. Ihr Baby sollte fünf Wochen vor meinem geboren werden und wenn sie dann die Erste war, hatte sich dann vielleicht die erste Freude über Enkelkinder wieder gelegt. Nun hatte ich einen Termin bei meinem Lehrausbilder. Ich machte mir Sorgen, dass ich vielleicht meinen Abschluss nicht mehr machen könnte. Das wäre eine Katastrophe, eine angefangene Ausbildung nicht zu beenden, ein Kind zu bekommen und irgendwann vielleicht ohne Berufsabschluss einen Job zu finden. Diesen Triumph konnte ich meinen Eltern nicht lassen, dann hätten sie ja mit all ihren Prophezeiungen recht gehabt. „Sie sind in anderen Umständen!“, sagte er. „Ja, aber der Termin ist Ende Oktober.“ „Im Mai haben Sie Abschlussprüfungen, ich denke, das dürfte dann kein Problem sein, Ihre Ausbildung noch vor der Geburt ihres Kindes abzuschließen.“ Mir fiel ein Stein vom Herzen, zum Glück waren meine Sorgen unbegründet. Ich weiß auch nicht, aber vielleicht hatte er ja auch eine Tochter. Er merkte meine Freude und sagte: „Haben Sie sich etwa Sorgen gemacht? Wir lassen doch niemand im Regen stehen.“ „Danke, ich bin wirklich erleichtert.“ „Aber Sie müssen nun die Abteilung wechseln, der Paketdienst ist in Ihren Umständen nicht mehr zulässig.“ Was war ich froh, nicht mehr im Paketdienst arbeiten zu müssen. Wieder etwas, was ich meinem kleinen Baby zu verdanken hatte. Als ich nach Hause kam und es meinen Eltern erzählte, interessierte es sie überhaupt nicht. Aber für sie war ja auch meine Schwangerschaft verwerflich, wie sollte sie dann auch etwas interessieren, was nur im Geringsten damit zu tun hatte. In den nächsten Wochen und Monaten bekam ich das sehr deutlich zu spüren. Sie mieden es förmlich, mich anzusehen. Wenn mein Appetit auf Süßes mich wieder mal überkam und ich auf meinen Babybauch zeigte, wandten sie sich angewidert ab oder sagten: „Du wirst schon sehen, was du davon hast.“ Ich hätte mir so sehr gewünscht, mit meiner Mutter über mein Empfinden zu sprechen, dass sie auch mal über meinen Bauch streicheln möchte und dabei zusah, wie mein kleines süßes Schätzchen sich bemerkbar machte, oder dass es sie interessierte, wie sich mein Bauch so langsam nach vorne beult. Alle diese Freuden konnte ich nicht mit den zukünftigen Großeltern teilen. Ihre einzige Sorge war, so schnell wie möglich eine Wohnung für mich zu finden, noch bevor mein Baby auf die Welt kommt.
Meine neuen Kolleginnen aus der Abteilung, in die ich gewechselt hatte, versorgten mich ständig mit Kuchen und jede von ihnen wollte immer wieder meinen Bauch anfassen. Sie brachten mir einfach alles, was ich brauchte, damit ich mich bloß nicht überanstrenge. Sie gaben mir Babysachen von ihren Kindern und sammelten schon für den Kinderwagen. Ich erzählte ihnen nichts von dem, was ich hingegen täglich zu Hause erlebte. Denn inzwischen hatte ich gelernt, zwei Persönlichkeiten zu entwickeln. Die eine Persönlichkeit, die ich zu Hause war, wenn Raul dabei war, und die andere Persönlichkeit, wenn er nicht dabei war. Mit Raul verbrachte ich so gut wie jeden Tag außer wenn er Nachtschicht hatte. Da wollte ich auf keinen Fall allein in seinem Wohnheim bleiben. Ihm passte das gar nicht, weil ihm dann die Kontrolle über mich fehlte. Wenn er Spätschicht hatte, brachte er mich dazu, die ganze Schicht vor seiner Firma zu stehen, bis er Feierabend hatte. Aus dem Fenster konnte er mich sehen. Mir wurde immer bewusster, dass ich in einem ganz engen Korsett gefangen war und niemandem davon erzählen konnte. Kein Mensch würde mir das je glauben. Ich war sicher, sie würden denken, dass ich schuld daran war, dass es so war, wie es war. Wenn ich zu Hause verprügelt wurde, dann war das ja auch meine Schuld und ich musste die Strafe dafür bekommen. Im Grunde genommen war ich fix und fertig, denn auch wenn ich zu Hause bei meinen Eltern war, fühlte ich mich nicht wohl. Raul ließ auch während meiner Schwangerschaft nicht von seinen Eifersuchtsszenen ab. Immer wieder fing er einen Streit wegen anderen Männern an. Er sagte immer: „Ich werde erst sehen, wenn das Kind auf der Welt ist, ob es von mir ist oder nicht.“ Diese Worte verletzten mich zutiefst, wo ich doch sein Kind unter meinem Herzen trug. Wie konnte ich nur an so einen Mann geraten und wieso ließ ich mir so viele Bosheiten gefallen? Ich wusste nicht mehr, wo ich hingehörte, meine Eltern wollten mich loswerden und bei Raul musste ich mich ständig aufs Neue beweisen, auf ihn einreden und ihn besänftigen, damit seine Gewalttätigkeiten mich nicht zu sehr verletzten, geschweige denn mein Baby trafen. Als ich dann bereits im sechsten Monat schwanger war, nahm mir mein Vater den Wohnungsschlüssel weg. „Du kommst ab sofort nur noch hier rein, wenn wir auch da sind, sonst schleppst du uns noch den Kubaner hier rein und der räumt uns vielleicht noch in aller Ruhe die Wohnung aus.“ „Aber warum? ich habe ihn noch nie mit nach Hause gebracht, er war noch nie hier. Ich bin doch viel früher als ihr von der Arbeit zu Hause.“ „Dann wartest du eben vor der Tür, bis einer von uns da ist.“ Das war ein Schock für mich, wie sehr sie sich in jeder Hinsicht gegen mich entschieden. Da war es geradezu ein Wunder, dass ich mich überhaupt noch zu Hause aufhalten durfte. Jeden Tag stand ich nun vor der Haustür und wartete auf meine Eltern, dass sie mir die Tür aufschlossen und mich mit hineinnahmen. Es war ein sehr warmer Sommertag, als ich wieder mal vor der Haustür wartete. Ich hatte ein wunderschönes schwarzes Kleid an, in der Mitte zwischen Brust und Bauch war ein regenbogenfarbenes, glitzerndes Karo. Unter diesem Karo streckte sich mein Fußball großer Bauch hervor. Ich sah meinen Vater von der Ferne kommen. Seine Augen waren zu kalten Schlitzen geformt und seine Lippen waren nur noch ein gerader Strich. So wie er eben immer aussah, wenn er wütend war. „Mach, dass du sofort ins Haus reinkommst!“ „Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? „Du sollst im Haus auf uns warten und nicht auf der Straße, wo jeder dich sehen kann. Es muss ja niemand sehen, dass du schwanger bist.“ Ich war volljährig, ich war schwanger aber anscheinend ohne einen Funken Selbstwertgefühl. Wo sollte das auch herkommen? Da mein Vater Tischlermeister war, pflegten meine Eltern sehr viele Beziehungen zu anderen nützlichen Leuten. Tut einer dem anderen einen Gefallen, so auch umgekehrt. So war es für sie dann doch nicht so schwer, durch ihre Beziehungen zu einer Wohnungsbaugesellschaft für mich eine Bleibe zu finden, wo andere jahrelang drauf warten mussten. Ich war im siebten Monat schwanger, als sie mir einen Wohnraum präsentierten. „Wir haben eine Wohnung für dich besorgt und schauen sie uns heute gemeinsam an.“ Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, konnte es kaum glauben, sie machten also doch ernst. Damit war es dann wirklich gewiss, dass sie mich noch vor der Geburt meines Kindes loswerden mussten. Sie würden es gar nicht mitbekommen, wenn es dann so weit war und dann auch nicht bei mir sein oder mich in die Klinik bringen. Na ja, ich hatte ja Raul, mit wem sollte ich es auch sonst durchziehen? Ich sagte keinen Ton zu ihnen, ich fragte auch nicht nach der Wohnung, wo sie war, wie groß sie war oder wie sie aussah. Dass sie kein Bad haben würde, konnte ich mir ja selber denken, ich traute mich auch gar nicht, nach solch einem Luxus zu fragen. Wir fuhren nun zusammen zu dieser besagten Wohnung. Auf dem Weg dahin freute ich mich aber dann doch, endlich mein eigenes kleines Heim zu haben. Ich merkte nur, dass es ziemlich weit bis dorthin war. Von außen sah das Haus ganz ordentlich aus, meine Eltern hatten auch schon die Schlüssel. Die Wohnung war im Erdgeschoss und entpuppte sich als kaltes dunkles Loch. Sie war gerade mal 13 qm groß. Es gab keinen Flur, sondern beim Öffnen der Wohnungstür stand man direkt in der Küche, von welcher aus es in ein kleines Zimmer ging. Das war dann auch schon alles. Das WC befand sich außerhalb, neben der Haustür und der Platz darin reichte gerade für die WC-Schüssel. Ich war für den ersten Moment sehr erschrocken, aber es war nun auch egal, Hauptsache allein. Nur was sollte ich hineinstellen, viel Zeit hatte ich nicht mehr. In der Küche befand sich ein kleines gusseisernes Waschbecken und ein Kochherd und die Fenster sahen undicht aus. „Tja, so haben wir auch mal angefangen oder hast du etwa was anderes erwartet? Sei froh, dass du überhaupt eine Wohnung hast!“ „Ich habe ja gar nichts gesagt, wenn es denn sein muss, dann soll es so sein. Es reicht ja aus und baden kann ich ja dann in der Babybadewanne.“ Es herrschte eine eiskalte Stimmung, passend zu diesem Loch, in dem wir standen. Ich wollte es ja so und deshalb nahm ich es auch so an. „Du kannst sofort einziehen. Wir geben dir dein Bett, deinen Schrank, unseren alten Küchentisch, die Hocker dazu und unseren alten Kühlschrank mit. Wir wollten uns sowieso einen neuen kaufen und etwas altes Geschirr kannst du auch noch mitnehmen. Das ist immer hin besser als gar nichts. Wir wären froh gewesen, wenn wir damals auch so hätten anfangen können. Du wolltest dein Kind und nun sieh zu, wie du zurechtkommst.“ Ja, ja das mussten sie ja noch unbedingt erwähnen. Aber mit der angebotenen Grundausstattung würde es schon gehen. Es ging dann alles ganz schnell. Mein Vater organisierte den Transport der Möbel und zwei Tage später wohnte ich schon in dieser Wohnung. Ich fühlte mich unglaublich einsam. Raul war nun auch jeden Tag da und das nahm mir wenigstens hin und wieder das Gefühl der Einsamkeit. Wir wohnten nun zusammen. Er besorgte uns noch ein paar Kleinigkeiten, die man so in einem Haushalt braucht. Ich versuchte diese Wohnung einigermaßen gemütlich zu machen, obwohl das nicht einfach war, denn sie war kalt und feucht. Zwischen die Fenster legte ich alte Tücher, damit das Wasser, das reinlief, nicht für noch mehr Feuchtigkeit sorgte. Wir schliefen zusammen in einem Bett, was durch meinen Bauch gar nicht mehr so einfach und erholsam war, da es einfach an Platz fehlte. Schon bald ging ich nicht mehr arbeiten und so sorgte ich für den Haushalt und kochte uns jeden Tag kubanisches Essen. Raul bestand darauf. Ich war seine Köchin und seine Putzfrau. Wir lebten wie ein altes Ehepaar und ich musste immer zu Hause bleiben und auf ihn warten. Unverändert und ungebremst war immer noch seine grenzenlose Eifersucht. Er bestimmte mein Leben, was ich wann tun sollte und alles ausschließlich für ihn. Als Maria dann ihr Baby bekam, fuhr ich fast jeden Tag zu ihr. Es war wunderbar, ihr bei allem zuzusehen. Ich habe dadurch alles lernen können, was ich mit einem Neugeborenen machen muss und wie ich es versorgen muss. An all diese aufkommenden Dinge hätte ich nie von selber gedacht. Das war mein wichtigster, unerwarteter und nützlichster Grundstein, den ich da mitbekam. Ich konnte es nun kaum noch erwarten, bis es endlich bei mir so weit war. Mein Baby war schon eine Woche überfällig und ließ immer noch auf sich warten. An diesem einen Tag im November musste ich am Morgen zu einer Untersuchung, um sicherzugehen, dass auch alles in Ordnung ist. Raul hatte Spätschicht. Er begleitete mich und ging dann am Mittag zur Arbeit. Da saß ich nun ganz allein in meiner kleinen Wohnung, als ich plötzlich Schmerzen bekam. Ich wusste nicht, was es sein könnte. Es war einfach nicht leicht für mich, dies einzuordnen, da ich auch nicht wusste, wie sich die Wehen anfühlen. Niemand war da, den ich hätte fragen können. Ich ging zu einer Telefonzelle und rief meine Mutter an. Was auch immer passiert sein mag, aber ich musste meine Mutter anrufen. Wen sonst sollte man in so einem Moment fragen, ich war wieder mal allein. Obwohl ich mir immer gewünscht hatte, mein Baby zu bekommen und irgendwann mal seinen Großeltern Bescheid zu geben. Aber nun musste ich leider zeigen, dass ich anscheinend doch Hilfe brauchte. Meine Schwester war bei ihr mit ihrem Sohn. „Maria, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe Schmerzen.“ Nach langem Frage- und Antwortspiel sagte sie: „Du hast Wehen, Schwester, das ist nichts anderes als Wehen. Setz dich in die Straßenbahn und komm her.“ „Gut, ich komme dann bis gleich.“ Ich ging gar nicht mehr nach Hause, sondern fuhr direkt zu meiner elterlichen Wohnung. Auf dem Weg dahin gingen mir noch so viele Dinge durch den Kopf. Ich konnte es kaum glauben, dass ich mit Wehen in einer Straßenbahn saß, die alle paar Minuten anhält, sozusagen im Rhythmus zu meinem nun drängenden Baby. Es war halb drei, als ich ankam. Meine Mutter begrüßte mich nur oberflächlich und Maria packte ihre Siebensachen zusammen und dann gingen wir gemeinsam zu ihr nach Haus. Da saß ich nun bis 20 Uhr, sie hatte die Ruhe weg und wollte mir es unbedingt ersparen, zu früh in die Klinik zu fahren. „Bevor du sie nicht alle halben Minute hast, brauchst du gar nicht erst losfahren.“ Ich verließ mich vollständig auf Maria, sie würde schon das Richtige tun. Wenigstens war ich nicht mehr allein. Meine Mutter fuhr mit mir dann gegen 20:00 Uhr mit dem Taxi in die Klinik ohne eine Tasche mit den nötigsten Sachen für mich und mein Baby. Aber darüber machte ich mir keine Gedanken. Dort angekommen wusste ich: Allein gehe ich da rein aber zu zweit komme ich wieder raus. Ein seltsames, aber schönes Gefühl. Ich drehte mich noch einmal um und sah, wie meine Mutter draußen stand und bleiben musste, und wurde immer ängstlicher. Ich wusste nicht, was jetzt alles auf mich zukam, mal abgesehen von den Schmerzen, die das Ganze mit sich bringt. Mein kleiner, süßer Sohn begrüßte mich dann nachts halb zwei und wurde mir direkt auf meinen Bauch gelegt. Er sah genauso aus, wie ich ihn mir vorgestellt hatte mit seinen flauschigen, vielen, dunklen Haaren, seine Ohren waren leicht geknickt und auch mit feinen, dunklen Härchen besetzt. Er war einfach zuckersüß und schon da auch unter den Schwestern die Nummer eins. „Wie soll er denn heißen?“ Raul und ich waren uns nie einig über einen Namen für unser Kind. Ich wollte ihn gerne Ricardo nennen, da aber sein Bruder so hieß, war er überhaupt nicht damit einverstanden. Er bestand darauf, ihn Raul zu nennen, so wie es sich in Kuba für den ersten Sohn gehört. Ich wusste einfach, wenn meine Eltern diesen Namen hören, dass nun ihr Enkelkind so heißen würde, würden sie noch weniger mit ihrer neuen Rolle als Großeltern einverstanden sein und ihn mit irgendwelchen Spitznamen rufen, damit sie bloß nie den Namen aussprechen mussten. Ich wollte jedoch keinesfalls Streit mit Raul, dann hätte er vielleicht sogar nicht mal sein Kind akzeptiert. „Er heißt Raul und weil er noch so klein ist, ist er Raulito, das ist lediglich die Verkleinerungsform von Raul.“ Ich konnte nun mein Baby noch für eine ganze Weile im Tuch eingehüllt im Arm behalten. Das war etwas Wunderbares, Einzigartiges und Inniges. Meine Eltern erbarmten sich und riefen Raul in seiner Arbeitsstelle an, um ihm mitzuteilen, wo ich war. Er kam am nächsten Morgen und seine erste Frage war nach seinem Namen. Er war unglaublich stolz auf seinen Sohn, das machte mich sehr glücklich. Unser kleiner Kubanito. Meine Mutter kam mit Maria am Nachmittag. Nachdem nun auch sie den Namen erfahren hatte, schüttelte sie den Kopf. Ich spürte nur Ablehnung. Endlich kam der Tag, an dem ich mit Raulito nach Hause konnte. Ich war kaum zwei Stunden zu Hause, als mein Vater kam. Ich war fassungslos, was war denn in ihn gefahren, war das etwa ernsthaftes Interesse? Er wollte tatsächlich sein Enkelkind sehen. Er brachte mir sogar drei Bananen mit. „Wo hast du denn die Bananen aufgetrieben?“ Ich habe sie eben besorgt, du brauchst jetzt Vitamine.“ Es war dennoch ein unangenehmes Gefühl. Die ersten Wochen kam ich sehr gut zurecht, mein kleiner Raulito entwickelte sich prächtig. Wir waren nun zu dritt, auch wenn wir sehr wenig Platz hatten, genügte uns das. Raul machte allerdings seinem Machodasein alle Ehre. Ich versorgte nun unser Kind, Raul und den Haushalt – auch dann als ich nach einem Jahr wieder arbeiten musste. Sein Verhalten mir gegenüber änderte sich nicht. Es wurde sogar schlimmer, seine jähzornigen Anfälle, seine Aggressionen, seine Gewalt, seine Eifersucht. Er verbot mir einfach alles. Ich durfte nur anziehen, was er erlaubte. Ich hatte kaum noch Kontakt zur Außenwelt. Ich durfte nicht mehr zu Maria, auch mit Anna ließ er keine Treffen zu. Das sei alles schlechter Umgang für mich und die würden mich nur mit anderen Männern verkuppeln wollen. Ich hatte nur für ihn da zu sein und ich sollte bloß nicht auf die Idee kommen, mich trennen zu wollen. Das würde ich nicht überleben, er würde dann unser Kind nehmen und nach Kuba gehen. Immer mehr fühlte ich mich meiner Freiheit beraubt. Ich hatte nicht einmal die Freiheit, ihn zu lieben oder nicht, ich hatte ihn zu lieben. Die Wohnung verließ ich nur dann mit meinem Sohn, wenn er bei der Arbeit war und das auch nur unter großen Anstrengungen, dabei nicht aufzufliegen. Meistens war ich bei Maria, damit wenigstens auch unsere Kinder zusammen sein konnten. Sie war die Einzige, der ich einige Details über meine Beziehung anvertraute. „Warum schmeißt du ihn nicht einfach aus deiner Wohnung raus? Wie lange willst du das noch mitmachen, sieh dich doch mal an, du bist ja nur noch ein Schatten von dir selbst.“ „Was soll ich denn machen, ich habe ihm schon oft gesagt, dass ich so nicht mehr mit ihm weiter zusammenleben möchte. Da dreht er jedes Mal fast durch und droht mir wie immer, mir unser Kind wegzunehmen. Es gibt auch nicht immer Streit, manchmal kann er auch wieder ganz lieb sein.“ „Das reicht aber nicht aus. Du kannst dir das doch nicht jedes Mal damit entschuldigen.“ Ich sagte nur: „Wenn er dann in zwei Jahren nach Kuba muss, ist es dann sowieso vorbei.“ Maria redete auf mich ein, aber alles Reden nützte nichts. Ich hatte trotzdem noch die ungestillte Sehnsucht nach Geborgenheit und die Hoffnung, dass er sich doch irgendwann ändern würde. Selbst wenn ich ihn verlassen würde, dann wäre ich auch wieder allein und meine Eltern hätten mit all ihren Vorhersagen recht gehabt. Immer wieder fragte ich mich, wieso man denn nicht glücklich sein konnten, jetzt wo wir zusammenwohnten und eine Familie waren. Es müsste doch eine Möglichkeit geben, dass Raul zur Besinnung kommt und erkennt, dass das, was er macht, nur Schaden anrichtet. Keiner meiner Kollegen bekam etwas von alledem mit. Raul schlug mich nach wie vor grundlos in seinem Jähzorn und nie hatte ich es gewagt, mich dagegen zu wehren. Ich war ihm einfach unterlegen, kam gegen ihn und seinen Willen nicht an. Es gab kaum eine Stelle an meinem Körper, die nicht blau geschlagen oder blau von Bissspuren war. Kaum färbten sich die Flecke gelb und fingen an zu verblassen, hatte ich auch schon wieder neue Zeichen der Brutalität. Ich war mit dem besten Make-up ausgestattet, was ich auftreiben konnte, um die Schandmale wenigstens im Gesicht zu verkleistern. Die Angst beherrschte mich in vollem Umfang. Ich war abgemagert und sah auch sonst extrem mitgenommen aus. Ich war müde und kraftlos. Irgendwann wurde mir klar, dass ich denselben Mann hatte wie meine Mutter. Die einzigen Freiheitsmomente hatte ich, wenn ich arbeiten war. Das konnte er mir nicht verbieten. Da wir nicht verheiratet waren, musste ich arbeiten gehen. So lauteten die Gesetze in der DDR. Zur Arbeit schminkte ich mir die Lippen, um wenigstens etwas frischer auszusehen und bevor ich nach Hause ging, wusch ich es gründlichst wieder ab. Wenn es dann zwischendurch mal Tage gab, an denen er sich normal verhielt, schöpfte ich jedes Mal wieder Hoffnung, dass er sich vielleicht doch noch ändern würde. Seinem Sohn war er ein guter und liebevoller Vater. Kubaner sind sehr kinderlieb und das merkte man auch bei ihm. Ich war froh, dass Raulito von unseren Auseinandersetzungen nichts mitbekam. Nach zwei Jahren ging Raul für sechs Wochen Sonderurlaub nach Kuba. Ich sorgte in dieser Zeit schnellstens für eine neue Wohnung, glücklicherweise halfen mir meine Eltern dabei, da sie auch da wieder ihre guten Kontakte spielen ließen. Sie sahen für mich eine neue Wohnung als einzige Chance, um von Raul wegzukommen. Ich schaffte den Absprung noch während diesen sechs Wochen. Ich zog mit meinem Sohn in einen anderen Stadtteil, in eine größere Wohnung, die zwar auch nicht besonders schön war, aber für meine Flucht war das nicht so wichtig. Ich hoffte, so die Trennung durchstehen zu können, ohne den Angriffen von Raul ausgeliefert zu sein. Kaum dass Raul zurückgekehrt war, lauerte er mir wieder auf und fing mich auch schon an meiner Arbeitsstelle ab. Er bestand darauf, seinen Sohn zu sehen, und drohte mir wie immer Gewalt an. „Wenn du mir nicht sofort sagst, in welchem Kindergarten unser Sohn ist, dann …“ „Ich will mit dir nicht mehr zusammenleben, du bist gewalttätig, ich halte das nicht mehr aus. Ich komme ganz gut alleine klar.“ „Das werden wir ja sehen, ich werde meinen Sohn schon bekommen und dann nehme ich ihn mit und gehe für immer nach Kuba. Dann wirst du ihn nie wiedersehen.“ Diese Drohung brachte mich jedes Mal zur Ohnmacht. Er war so aggressiv, wenn er das sagte. Mir schnürte es die Kehle zu. Meinen kleinen süßen Liebling durfte ich niemals verlieren. Somit hatte er mich in der Hand, ich war machtlos. Hilfe konnte ich von niemand erwarten. Ich gab nach und ging mit ihm gemeinsam unseren Sohn abholen und dann in meine Wohnung. Seine Freude, seinen Sohn wiederzusehen, war riesengroß und sichtlich echt. Auch Raulito war überglücklich. Er wurde regerecht überhäuft mit Streicheleinheiten. Raul sah wieder völlig gelassen aus und ich merkte, dass er seinen Sohn wirklich über alles liebte. „Ich halte das nicht aus ohne euch. Jeden Tag denke ich an euch, das kannst du mir nicht antun. Ich muss einfach bei euch sein. Ab jetzt wird alles anders, ich weiß, was auf dem Spiel steht. Ich will euch nicht verlieren.“ „Ich kann dir das alles nicht mehr glauben, auch wenn ich es noch so gerne möchte.“ „Glaub mir doch, dieses Mal ist es mein Ernst.“ Er entschuldigte sich immer wieder und umarmte mich dabei und ich hatte wieder mal das gute Gefühl, Liebe zu bekommen. Ich ließ ihn bleiben. Ab diesem Moment war er wieder jeden Tag bei mir. Die ersten Wochen verliefen normal, Raul gab sich Mühe, obwohl ich merkte, dass es nun wieder mit meiner kurzen, zurückgewonnenen Freiheit vorbei war. Ich war wieder jeden Tag zu Hause und durfte nun auch nirgendwo mehr allein hin. Raul war wieder in seine alte Rolle geschlüpft und immer wieder machte sich die Eifersucht in ihm breit. Er vermutete hinter jedem Kollegen von mir einen potenziellen Liebhaber für mich und konnte sich dabei so in Rage reden, dass er auch wieder regelmäßig auf mich einschlug. Es war für mich ein Kampf, ihn jedes Mal zu beruhigen, um wenigsten seine Schläge einzudämmen, damit ich nicht schon wieder mit blauen Flecken übersät zur Arbeit gehen musste. Ich rechtfertigte mich gegenüber seinen Anschuldigungen, dass ich mir oft wünschte, ihn doch endlich wirklich mal mit einem Mann zu betrügen. Aber mir stand nicht im Geringsten der Sinn danach. Raulito war nun schon drei Jahre alt und in der Zwischenzeit hatte Raul sogar seinen Aufenthalt in der DDR noch einmal um ein Jahr verlängern lassen können. Meine Eltern hatten sich nun gänzlich aus meinem Leben zurückgezogen. So bekamen sie auch nicht mit, dass ich nun zwischenzeitlich eine Eheschließung beantragt hatte. Raul wollte unbedingt heiraten, da er aber ein Kubaner war, war dies nicht so ganz einfach. Ich musste die dazu nötigen Anträge stellen und er musste sich alle seine Unterlagen aus Kuba schicken lassen. „Wenn wir für immer als Familie zusammenbleiben wollen, müssen wir heiraten, sonst kannst du auch nicht einfach so nach Kuba ausreisen.“ Erschrocken und erstarrt stand ich da, als er das zu mir sagte, denn nun wusste ich, jetzt machte er ernst und wenn ich ihm jetzt und hier eine Absage erteilte, das würde ich nicht überleben, dann wäre er sicher zu allem fähig. Nur alleine der Gedanke, dass die Zeit, die ihm noch in der DDR verblieb, nicht mehr reichen könnte, machte ihn so rasend. Ich selber hoffte, die Zeit würde nicht mehr reichen, bis die Genehmigung da war. Die Angst ließ mich erstarren. Ja und das obwohl nun in all den Jahren die Angst mein Leben dominierte, trotzdem konnte es immer noch etwas geben, dass aus dieser Angst panische Angst wurde. Ich war beherrscht von der Angst und sie war stärker als alles andere. Nur einzig und allein mein kleiner Sohn hielt mich noch aufrecht. Er war so ein lieber Junge, es gab nie Probleme mit ihm. Er spielte zufrieden, er war glücklich und bekam zum Glück immer noch nichts von den Auseinandersetzungen mit. Raul war ihm jedoch auch ein liebevoller Vater. Das machte er wirklich ausgezeichnet und vor allem war es echt. Da kam die kubanische Kinderliebe komplett durch. Er nahm ihn oft mit vollem Stolz mit zu seinen Landsleuten. Dort war Raulito dann immer der Liebling. Von allen wurde er vergöttert. Da konnte man die Machos beobachten, wie sie sich plötzlich selber wieder in Kinder verwandelten und sogar in Kindersprache mit ihm sprachen. Das gefiel Raulito und er genoss es in vollen Zügen, ständig wurde er herumgereicht und in die Luft geschmissen, geschaukelt und verwöhnt und alles, was ich da sah, war ehrliche, echte Zuneigung. Vielleicht ersetzten sie ihm ja auf diese Art die Großeltern. Ab und zu an den Wochenenden ging ich auch mit und ich wurde auch von allen akzeptiert und respektiert. Sie sahen uns als eine ganz normale Familie und das respektierten sie. Raul war dann selbst auch immer wie ausgewechselt. Dann hatte auch ich immer wieder mal ein paar Glücksmomente. So musste es auch in Kuba sein, sagte ich mir. Alle waren zufrieden und glücklich und zu alledem schien auch noch immer die Sonne. Der Tag unserer Heirat rückte nun immer näher. Alle Genehmigungen waren da und nun musste ich es bald mal meinen Eltern sagen. An einem Nachmittag nach der Arbeit ging ich zu ihnen. Ich sagte auch vorher meiner Schwester Bescheid, damit sie auch da war. Sie begrüßten Raulito und mich ganz normal und nahmen auch mal ihren kleinen Enkel in den Arm und verwöhnten ihn sogar ein bisschen mit Schokolade und Streicheleinheiten. Meine Mutter kochte etwas zum Abendessen und in meinem Hals machte sich ein Knoten breit. Irgendwann kam sie aber doch, die Stunde der Wahrheit. Nach dem Essen sagte ich: „Raul und ich heiraten in zwei Wochen.“ „Du bist ja verrückt geworden, das ist nicht dein Ernst“, sagte meine Schwester. „Nach allem was er dir angetan hat, jetzt wo er doch sowieso bald zurückmuss, musst du ihn dann auch noch heiraten? Ich fasse es nicht, du bist wahnsinnig. Und dann was kommt danach? Gehst du etwa mit ihm nach Kuba? Hast du das etwa wirklich vor?“ „Ja, wir sind ja eine Familie und in Kuba wird alles anders, ich weiß es, wirklich.“ Mein Vater sagte: „Dir ist nicht mehr zu helfen, weißt du denn überhaupt, was dich dort erwartet?“ „Ja, Raul hat es mir ja erzählt und seine Eltern schreiben auch immer ganz liebe Briefe und freuen sich schon auf uns.“ „Und das glaubst du ihm? Er kann dir doch sonst was erzählen, ihm würde ich kein einziges Wort glauben. Wahrscheinlich setzt er dich dort dann mittellos auf die Straße.“ Bei all den Anschuldigungen gegen Raul tat er mir schon richtig leid und ich stellte mich innerlich nur noch mehr auf seine Seite. „Also mit uns brauchst du nicht zu rechnen, denke bloß nicht, dass wir zu deiner Hochzeit kommen werden.“ Als ich nach Hause kam, war Raul da und ich erzählte ihm von dem Abend. „Das war doch klar, dass sie dagegen sind. Diese Menschen sind nicht gut für dich. Ich habe dir schon immer gesagt, dass die Deutschen kaltherzig sind. Das ist in Kuba ganz anders. Sobald wir geheiratet haben, beantragst du deine Ausreise.“ Ich sprach nicht mehr darüber, für mich war es ja nun entschieden. Hatte ich A gesagt, so musste ich auch B sagen, so war es dann eben. Ich wollte auch nicht, dass er sich jetzt nur noch mehr wütend redete. Ich dachte nur, irgendwann würde er sicher mit seiner Eifersucht, mit seinem Jähzorn und dem Prügeln aufhören, aber was war dann mit der Liebe, was passierte damit, konnte ich die dann überhaupt noch aufbringen? War es überhaupt Liebe? Wusste ich das so genau? Ich liebte meinen Sohn, aber die Liebe zu Raul war nicht dasselbe, das Gefühl ihm gegenüber, das manchmal da war, war das die Liebe? Was war Liebe? So könnte es sein, zusammen sein, das war Liebe so wie bei anderen Paaren auch, sonst wären sie nicht zusammen. Aber bedingungslose Liebe bekam ich nur von meinem kleinen Sohn. Wir heirateten an einem Samstag. Meine Oma kam und meine Cousine, alles mütterlicherseits. Das waren die einzigen Gäste, die da waren. Meine Eltern kamen nicht, so wie sie es auch angekündigt hatten, auch nicht meine Schwester. Sie wollten nicht dabei sein, es gab für sie keinen Grund zum Feiern. Man konnte hier auch nicht von einer Feier sprechen, auch wenn ich ein Brautkleid anhatte. Viel davon hatte ich nicht, denn wir gingen nur etwas essen und waren am frühen Abend schon wieder daheim. Wir hatten geheiratet und war ein paar Stunden danach schon wieder zur Tagesordnung übergegangen. Meine Oma blieb noch eine Weile bei uns. Sie war sehr lieb und wir besuchten uns auch sonst in größeren Abständen. Sie war immer begeistert von Raul, sie wusste jedoch nichts über unsere Beziehung. Ich wollte sie nicht damit belasten. Sie mochte Raul, sie mochte Kuba und sie mochte Fidel Castro. Kuba war für sie das Land, in dem der Kommunismus funktionierte, und davon war sie begeistert. Niemals hätte ich ihr das Bild von Raul zerstören können, schließlich liebte auch ich sie. Sie war die Einzige, die mich in meinem Vorhaben bestärkte, denn, wenn man sich schließlich für einen Mann entschied, dann blieb man auch bei ihm. Das waren immer ihre Worte. Aber ich war sicher, wenn sie gewusst hätte, wie er wirklich war, dann hätte auch sie mir abgeraten und ihm vor allem mal ordentlich die Meinung gesagt. Die Tage, Wochen und Monate vergingen. Mein Ausreiseantrag lief in vollen Zügen. Der Staat hatte es nun auf mich als republikfeindlichen Bürger abgesehen mit allen dazugehörigen Repressalien, auch wenn ich nur nach Kuba, in das sogenannte sozialistische Ausland ausreisen wollte. Ich hätte ja schließlich von Kuba aus in die ganze Welt reisen können und somit auch in das feindliche, kapitalistische Ausland. Mit dem Tag meiner Antragstellung auf Ausreise wurde mein Arbeitgeber informiert und damit wurde ich sofort degradiert. Meinen gemütlichen Bürostuhl in einer kaufmännischen Abteilung musste ich nun gegen den Paketdienst eintauschen. Ab sofort durfte ich wieder die Pakete vom Fließband nehmen und verteilen und Postautos ein- und ausladen. Alles das, was ich während meiner Ausbildung zwar machen musste, aber immer gehasst hatte, da wir in einer großen unbeheizten Halle arbeiteten und zudem war dies noch ein harter Job: acht Stunden am Tag schwere Pakete schleppen und voll beladene Postkarren durch die Gegend ziehen. Auch da musste ich mich wieder fügen und tun, was man mir auftrug. Von Diskretion hielt hier niemand was, jeder wusste Bescheid, warum ich nun wieder im Paketdienst war, was wiederum einige der Kollegen dazu trieb, über mich zu tratschen. Ich blieb von keinem Gerücht verschont, so bunt und fantasievoll gestalteten sie ihren Tratsch. Wenigstens war es ihnen so nicht langweilig. Zum Glück konnte ich mich aber auf meine, mir erhalten gebliebene Kontaktfreudigkeit verlassen. So gab es ein paar Kolleginnen, mit denen ich mich schnell anfreundete und die mich sogar auch beneideten, den DDR-Staat endlich verlassen zu können. Was man jedoch nie vorher genau wissen konnte, war das Datum der Ausreise. Es konnte lange dauern und es konnte auch ganz schnell gehen. Das Ausreiseamt schickte mich auch wirklich überall hin, um mich und meinen Sohn abzumelden, frei zu kaufen, um Bescheinigung betteln und Leumundszeugnisse einholen. Ich lernte dabei Behörden in der DDR kennen, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie existieren, geschweige denn wofür es sie überhaupt gab. Jeder Einzelne von denen, die ach so gönnerhaft hinter ihrem Schreibtisch hockten, würdigte mich nur mit Verachtung. Das ließen sie mich auch spüren und kosteten dies in vollen Zügen aus. Immer wieder bestellen sie mich umsonst hin, ließen mich ewig warten und im Dunkeln tappen. Kein Einziger wollte mir sagen, wann ich denn mit einer Ausreise rechnen könnte. Für Kuba war das jedoch alles kein Problem, denn auf der kubanischen Botschaft würde ich mein Einreisevisum problemlos bekommen, sobald die Ausreise genehmigt war.
Der Zeitpunkt der endgültigen Rückreise von Raul rückte immer näher. Seine Zeit in der DDR war abgelaufen und eine Verlängerung gab es nicht mehr und war im Grunde genommen auch nicht mehr nötig. Dennoch war uns klar, dass er wohl vor mir nach Kuba fliegen würde. Wir beschlossen auch, alles, was wir besaßen, mit nach Kuba zu nehmen. So bestellten wir einen Container, der einen Monat vor Rauls Abreise zu packen war, damit er noch verschifft werden konnte, denn schließlich hatte er einen langen Weg auf dem Ozean vor sich und sollte wenigstens ungefähr zeitgleich mit uns in Kuba sein. Wir organisierten das alles so, dass sobald unsere Einrichtung im Container verstaut war, meine Freundin Sonja, die auch mit einem Kubaner zusammen war, in unsere Wohnung zog. Sie wollte ohnehin aus ihrer feuchten Wohnung raus und da es auf legalem Wege Jahre dauerte, bis jemand in der DDR eine Wohnung bekam, nahm ich sie als Untermieterin zu mir und wenn ich dann nach Kuba ginge, würde der Mietvertrag auf sie umgeschrieben. Das war zwar nicht legal, aber erfüllte den Zweck für uns alle, denn auch zu befürchten hatte sie dadurch später nichts. Auf die Straße konnte man sie schließlich nicht so einfach setzen. Ihr Freund war schon einige Monate wieder in Kuba, nur hatten sie es nicht geschafft, bei all dem Papierkrieg vorher zu heiraten. Sie versuchten es jedoch im Nachhinein, was sich sehr schwierig gestaltete.
Es war eine sehr anstrengende Zeit, denn Raul forderte auch dann noch immer sein Recht als Ehemann und als sich bei mir immer noch keine Tür auftat und er nun bald zurückmusste, ließ er seinen Zorn wie immer an mir aus. Nun war es so weit, an einem Sommertag im August brachte ich Raul nach Berlin zum Flughafen. In diesem Moment spürte ich eine nicht enden wollende Traurigkeit. Plötzlich war es so weit, er musste weg und Raulito und ich mussten zurückbleiben im Ungewissen. Unser Zuhause schwamm in einem Container auf dem Ozean und keiner von uns wusste, wann wir uns wiedersehen würden. Ich wollte nun auch so schnell wie möglich weg und wäre am liebsten gleich mitgeflogen. Raulito war inzwischen vier Jahre alt. Für ihn war sein Papa jetzt mal schnell weg und ich sagte ihm, dass wir ihn bald wiedersehen würden. Raul hatte ihm seine Heimat immer im schönsten Licht beschrieben. „Raulito, Kuba ist ein schönes Land. Dort ist es immer warm, die Sonne scheint den ganzen Tag, du kannst im Meer baden und immer draußen spielen, deine Großeltern und deine Cousins und Cousinen freuen sich auch schon auf dich.“ Er erzählte ihm dies alles und Raulito freute sich so sehr darauf. Ich war froh darüber, denn das machte ihn glücklich und wenn ich auch nicht wusste, in was für eine ungewisse Zeit ich ging, so wusste ich doch, dass das, was Raul ihm erzählte, die Wahrheit war. Denn so viel hatte ich inzwischen von der Kinderliebe der Kubaner mitbekommen. Daran gab es keinen Zweifel. Das Flugzeug hob ab und nun war Raul weg. Ich steuerte nur noch auf unsere Ausreise hin. Es vergingen Monate und mit Sonja konnte ich sehr gut zusammenleben. Wir halfen uns, wo wir konnten, und verbrachten viel Zeit zusammen, sogar Weihnachten machten wir uns ein schönes gemütliches Fest mit allem, was dazugehört. Leider blieb es mir nicht erspart, meinen kleinen Sohn und mich noch mal mit Wintersachen einzukleiden. Dass es nun doch noch so lange dauern würde und auch noch einen Winter, damit hatten wir nicht gerechnet. Unsere Möbel waren auch inzwischen auf Kuba eingetroffen und bei seinen Eltern verstaut. Maria besuchte ich jetzt auch wieder regelmäßig und ab und zu meine Eltern. Es war stark spürbar, dass die Tage gezählt waren, an denen wir uns noch sehen konnten. Sie wollten mich zwar allesamt dazu überreden, die Ausreise zurückzuziehen, aber sie schafften es nicht. Ich war nun fest entschlossen, ich wollte mit Raulito zu Raul und seiner Familie nach Kuba. Alle meine Vorstellungen über dieses Land, in dem unsere Beziehung sich endlich erholt, sollten doch wahr werden. Das war es doch, was mich die ganzen Jahre zu Raul hat halten lassen. Obwohl auch mich immer wieder, wenn ich bei Maria war, eine Wehmut überkam, denn die Vorstellung ganz weit weg zu sein, war auch mir manchmal etwas zu viel. Dieses absolut Endgültige war mir zu diesem Zeitpunkt nicht ganz bewusst. Denn niemand wusste, ob ich jemals als Republikfeind zurückkommen könnte, denn die erzwungene Einbürgerung meines Vaters war auf einmal wieder gegenwärtig.
Raul und ich schrieben uns regelmäßig Briefe, sodass wir fast jede Woche voneinander Post bekamen. In seinen Briefen fiel nie ein böses Wort und er verging fast vor Sehnsucht nach uns. Es beschlich ihn auch die Angst, dass wir vielleicht doch nicht mehr kommen würden. Dennoch konnte ich ihm nicht meinen Missmut über unsere Ausreise zum Ausdruck bringen, denn die Briefe wurden gelesen und wenn ich etwas Negatives über die DDR geschrieben hätte, dann hätte Raul meine Briefe nie bekommen. An einem Tag im Februar war es endlich so weit. Ich bekam einen Brief, der mich aufforderte, auf dem Amt zu erscheinen. Endlich bekam ich unsere lang ersehnte Ausreisegenehmigung. Innerhalb von 14 Tagen hatte ich die DDR zu verlassen. Verglichen mit anderen Ausreisenden hatte ich eher noch viel Zeit, denn es gab Leute, die in 24 Stunden weg sein mussten. Aber trotzdem waren auch die 14 Tage nicht viel bei der weiten Reise, da ich noch nach Berlin auf die kubanische Botschaft musste, um das Einreisevisum für uns zu bekommen, was nicht ohne Termin ging, und die Flüge mussten auch noch gebucht werden. Nach dieser langen Zeit des Wartens waren diese zwei Wochen für mich die traurigste Zeit. Die Zeit des Abschiedes, denn unsere Tickets waren One-Way-Tickets.
Ich musste Raul ein Telegramm schicken in der Hoffnung, dass er es auch erhält, denn für einen Brief, der vier Wochen unterwegs war, hätte die Zeit nicht mehr gereicht. Raulito war überglücklich mit der Freude, bald seinen Papa wiederzusehen. Überall erzählte er: „Wir gehen nach Kuba zu meinem Papa.“ Es war so schön, ihn so glücklich zu sehen, aber ich wusste dennoch, dass er sich sicher nicht vorstellen konnte, wie weit wir weggingen. Unser Gepäck musste ich so zusammenstellen, dass wir die 40 kg nicht überschritten. In der Zwischenzeit hatte sich aber schon wieder so viel an Kleidung angesammelt, dass ich einiges zurücklassen musste. Es war der 22. Februar 1986, der Tag, an dem wir abflogen. Bei meinen Eltern hatte ich mich am Abend zuvor verabschiedet. Meine Mutter war so traurig, dass sie fasst kein Wort herausbrachte. Sie wusste, es gab an dieser Entscheidung nichts mehr zu ändern. Das schien sie fasst ohnmächtig werden zu lassen. In ihren Augen las ich: Eine Mutter bleibt immer die Mutter und ich werde immer ihr Kind bleiben, ganz egal was auch passiert war. Sie tat mir so unendlich leid, sie konnte sich meinem Vater nie widersetzen und nun, wo ich für immer wegging, hoffte ich, dass meine Schwester sich ihrer annahm. Sie sagte: „Wann geht euer Zug morgen früh nach Berlin zum Flughafen?“ „Wir müssen den Zug um acht nehmen, da wir sonst den Flieger am Nachmittag nicht schaffen, wenn wir einen Zug später fahren würden.“ „Lebwohl mein Kind und schreibe bitte sofort, wenn ihr angekommen seid!“ Mein Vater behielt die ganze Zeit die Fassung, er verabschiedete sich von uns, wünschte uns alles Gute und gab mir 50 Deutsche Mark. „Man weiß ja nie was passiert und mit dem Geld kannst du überall bezahlen.“ Am nächsten Morgen begleiteten mich meine Schwester, ihr Sohn Max und Sonja. Ich war so froh, dass sie sich die Mühe machten, uns bis nach Berlin zu bringen, denn schließlich mussten sie ja dann auch noch anschließend zwei Stunden Rückfahrt in Kauf nehmen. So selten wie es bei uns in Leipzig schneite, schneite es ausgerechnet an diesem 22. Februar unentwegt. Es war sehr kalt und wir fuhren alle zusammen schon um sieben Uhr auf den Leipziger Hauptbahnhof. Es war das reinste Caos. Die Züge standen alle auf den Gleisen, die nicht in unseren Tickets angegeben waren. Sicher waren überall die Weichen gefroren und man musste wieder mal improvisieren. Wir rannten zu fünft durch den Bahnhof und suchten unseren Zug. Die Kinder mussten wir auf den Arm nehmen, dazu kam noch mein Gepäck, zwei Koffer, eine Reisetasche, ein Rucksack und die Gitarre von Raulito. Niemand war in der Nähe, den man hätte fragen können – und obwohl wir noch Zeit gehabt hätten, wussten wir intuitiv, dass wir uns beeilen mussten. Irgendetwas trieb uns, da wir uns denken konnten, dass die Deutsche Bahn die Fahrpläne überraschend geändert hatte. Auf die Kälte und den Schnee waren sie nicht vorbereitet und selbst wenn, standen dagegen kaum Mittel zur Verfügung. Also hieß es rennen und irgendwie zusammenbleiben. Endlich fanden wir einen Zug, der unserer zu sein schien. Die Schaffnerin stand schon davor, hielt ihre Kelle nach oben und pfiff. In diesem Moment erst erkannte ich den Ernst der Lage und wusste, wenn der Zug weg war, dann auch unser Flugzeug und damit unser letztes Geld, das ich für die Tickets ausgegeben habe. Ich schrie und schrie und schrie: „Haaaaaaalt, stoppen Sie den Zug, sie müssen den Zug stoppen, wir müssen unbedingt mit“! Die Schaffnerin war so erschrocken, dass sie nun nur noch in ihre Pfeife pfiff, die ihr um den Hals hing. Wie sah das wohl aus, drei Erwachsenen beladen mit Gepäck und zwei davon mit einem Kind auf dem Arm, schreiend und rennend auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Der Zug stoppte ruckartig, die Schaffnerin riss die Tür auf. „Beeilt euch, das ist heute der letzte Zug, der nach Berlin geht.“ Diese elenden hohen Treppen in einem Zug, die einem das Einsteigen so schwer machen und das Gefühl hinterließen, dass man daneben tritt. Ich stieg als Letzte ein, aber während dem Einsteigen von Sonja und meiner Schwester hielt ich die ganze Zeit an ihrer Hand, das gab mir das Gefühl, dass ich da auch noch rein muss. Wir standen nun im Zug und flogen erst mal über mein Gepäck, die Schaffnerin rannte neben dem Zug her und schrie: „Schließen Sie die Tür, um Himmels willen schließen Sie die Tür.“ Obwohl der Zug nur langsam anfuhr, schaffte sie es nicht, von außen die Tür zu schließen, und ich wusste mit meinen 22 Jahren nicht mal, wie man eine Tür im Zug zumachte. Plötzlich glaubte ich, nicht richtig zu sehen, meine Eltern rannten neben dem Zug her. Sie hatten nun die Zugtür erreicht, die immer noch offen stand, und ich streckte meine Hand zu meiner Mutter. Für mich ein unendlich langer Augenblick des nicht Loslassens. „Mein Kind, mein Kind, geh nicht weg!“ Sie weinte, ich weinte. Ich schrie: „Mutti lass mich los, der Zug wird schneller, lass mich los.“ Sie ließ einfach meine Hand nicht los und mein Vater rannte die ganze Zeit hinter ihr und mit ihm die Schaffnerin, die wiederum schrie: „Türen schließen!“ Maria zog mich von hinten zurück und schloss endlich mit ihrer ganzen Kraft die Tür. Was für ein Drama, was für ein trauriger Abschied. Meine Eltern waren tatsächlich noch mal zum Bahnhof gekommen. In diesem Moment verzieh ich ihnen alles und erkannte, dass es ihnen wirklich wehtat, dass ich für immer ging. In der Zwischenzeit hatten sich genug Leute im Zug zu einer Menschentraube gebildet, die das ganze Schauspiel beobachteten. Ich konnte nun meine Tränen nicht mehr zurückhalten und schluchzte nur noch. Zum Glück war unseren Kindern nichts passiert, denn ich fragte mich, wo sie die ganze Zeit waren. Gar nicht auszudenken, was hätte passieren können. Die Fahrt verlief länger als geplant, immer wieder waren die Weichen vereist. Wir waren dann gegen Mittag am Flughafen Berlin Schönefeld. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich auf einem Flughafen und ich fand es sehr spannend. Die vielen Menschen verschiedener Nationalitäten, das war so aufregend und interessant für mich. Wir erfuhren nun, dass mein Flug drei Stunden Verspätung haben würde. Dreißig Minuten später hieß es, dass wir vor 20 Uhr nicht fliegen können, denn es schneite ununterbrochen. Maria entschied sich, nun doch zurückzufahren, da sie noch einen langen Weg vor sich hatte und auch nicht wusste, was für eine lange Rückreise nun noch vor ihr lag. Sonja war ebenfalls dieser Meinung und uns war allen klar, dass es wohl das Beste war. Wir verabschiedeten uns alle unter Tränen, Maria gab mir ihren Ring und ich gab ihr meinen. „Damit du immer an mich denkst, mein Schwesterchen.“ Das war wirklich eine gute Idee von ihr. Raulito und Max gaben sich ein Küsschen und wir winkten ihnen so lange zu, bis nichts mehr von ihnen zu sehen war. Ich blieb mit Raulito allein zurück und da stand ich nun mit meinem ganzen Gepäck, das ich mit meinen zwei Händen gar nicht tragen konnte. Ein Gepäckwagen war auch nirgends aufzutreiben, so blieb uns nichts anderes übrig, als uns auf die Bänke zu setzen und zu warten. Nach fünf Minuten dann die Durchsage. Vor morgen früh ging kein einziger Flug mehr, alle Passagiere sollten sich im Flughafenrestaurant einfinden, wo sie mit einem kleinen Imbiss versorgt werden. Ich starte die ganze Zeit den Ring von Maria an und dachte nur, zum Glück waren sie gegangen, und hoffte, dass sie noch einen Zug erwischten, der heute noch zurück nach Leipzig fährt. Aber was sollte ich jetzt hier die ganze Nacht machen und hoffentlich würden Raul so lange auf uns in Havanna warten. Es war eine nicht enden wollende Nacht. Wir versuchten, auf den Bänken zu schlafen. Raulito lag auf meinem Schoß und ich hatte ständig mit einem Auge unser Gepäck im Visier. Schlafen konnten wir nicht recht, da ich auch Angst hatte, den Flug vielleicht noch zu verpassen. Früh um vier Uhr hörten wir endlich die lang ersehnte Durchsage. Es ging endlich los. Wir hatten nun 22 Stunden Verspätung, als das Flugzeug abhob. Müde waren wir nicht, da wir beide viel zu aufgeregt waren, denn es war unser erster Flug im Leben. Im Flugzeug selbst ging es ziemlich laut zu, da eine ganze Gruppe Kubaner mit uns flog. Schnell war auch hier Raulito wieder der Mittelpunkt und fast jeder von ihnen kam zu uns an den Platz, um mit ihm zu spielen oder rumzualbern. Alle interessierten sich für unsere Geschichte, wieso wir nach Kuba auswanderten. Fernando, ein Kubaner, der direkt vor uns saß, war besonders hingerissen von Raulito und von seinen blauen Augen. Er alberte die ganze Zeit mit ihm und sang ihm kubanische Kinderlieder vor. Es war einfach so unterhaltsam, das mit anzusehen und anzuhören. In Kanada hatten wir Zwischenlandung und auch hier schien die Warterei wieder kein Ende zu nehmen. Wir mussten noch einmal drei Stunden bis zum Weiterflug warten, da sich eine Deutsche aus der DDR abgesetzt hatte und den Weiterflug verweigerte. Auf kanadischem Boden war sie frei und plante so anscheinend ihre Ausreise in die BRD. Zwar auf Umwegen, aber wenigstens ohne Repressalien, die mit einer Ausreise aus der DDR zusammenhingen. Nun endlich waren auch diese drei Stunden überstanden und wir konnten endlich unserem Ziel entgegenfliegen.