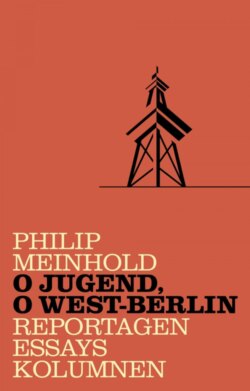Читать книгу O Jugend, o West-Berlin - Philip Meinhold - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kreuzberg – With Tears In My Eyes
ОглавлениеEin Samstagabend in Neukölln, an der Grenze zu Kreuzberg: Mein alter Schulfreund Martin ist aus Köln zu Besuch, zusammen mit unseren Freundinnen gehen wir indisch essen. Wir sitzen am Kanal, Martin überredet mich, die erste Berliner Weiße meines Lebens zu trinken – er hat mit dem Quatsch auch erst in Köln angefangen, als Berliner trinkt man so was ja nicht. Auf die violetten Plastiksitze vor dem Restaurant hat jemand die Worte „Yuppies raus“ gesprüht, dabei ist das ein typischer Billig-Inder: Palak Paneer für 6,90 Euro, ein Becks für 2,30 … Gut, es gibt Cocktails, aber die kosten in einer den ganzen Tag währenden Happy Hour 3,50 Euro, was den Laden zum Lieblingslokal meiner Freundin macht. Das Restaurant ist so yuppieesk wie der Rest der Gegend, nicht mehr und nicht weniger.
Auf dem Dach eines Mietshauses auf der anderen Seite des Kanals prangte lange Zeit weithin sichtbar der Schriftzug „KreuzKOTZE“, in Anlehnung an die Ortsbeschreibung Kreuzkölln, die vor ein paar Jahren sowohl die räumliche als auch die ideelle Nähe Nordneuköllns zu Kreuzberg ausdrücken sollte: Partys, Szene, junge Leute – auch hier geht was, wollte sie sagen. Gleichzeitig grenzte sie Nordneukölln wie eine Enklave vom Rest Neuköllns ab.
Inzwischen ist die giebelhohe Polemik auf dem Dach übermalt, und auch die Bezeichnung Kreuzkölln ist für die Identitätsstiftung nicht mehr nötig: Die Hipness hat sich wie ein langsamer Lavastrom Richtung Süden gefressen, hat auf ihrem Weg Bars, Cafés und Restaurants wie Magma-Gestein hinterlassen. Inzwischen kann man auch sagen, man wohne in Rixdorf, ohne angesehen zu werden, als käme man von einem anderen Stern.
Ich muss an einen meiner ersten Abende in der Gegend denken, Mitte der Nullerjahre: Staunend und raunend war von ersten Szenekneipen die Rede – dem Freien Neukölln, dem Ä, wir trafen uns im Kinski –, Tische und Stühle auf dem Bürgersteig, das Publikum anders als anderswo. Nicht friedrichshain-szenig, nicht mitte-versnobt, für Kreuzberg nicht politisch genug. Stattdessen: studentisch-schluffig.
Inzwischen kann man hier Fußvolk jeder Couleur sehen: Sandalen und High Heels, Springerstiefel und Chucks – die Monokultur des Ausgehens hat zu einer Vielfalt des Schuhwerks geführt. Lediglich die Träger der Halbschuhe von Karstadt und KiK haben sich in die immer spärlicher werdenden holzgetäfelten Kneipen verkrochen, in denen man nicht zum Vergnügen trinkt, sondern aus Verdruss.
Aber genug der Gentrifizierungskritik und Sozialromantik – wir sitzen beim Billig-Inder und warten aufs Essen; die Berliner Weiße schmeckt, wie sie aussieht: nach flüssigem Kaugummi. „Ja“, räumt Martin ein, „in Köln schmeckt die besser“. Vielleicht sollte man Berliner Weiße nur am Müggelsee trinken oder irgendwo anders, wo Touristen verkehren, die wissen, wie so ein Berliner Nationalgetränk schmecken muss. Unser Essen kommt, und wie immer, wenn wir uns treffen, ergibt ein Wort das andere: Unser Gespräch mäandert zwischen dem No-Border-Camp in Köln und dem Berliner Sechstligisten TeBe hin und her, zwischen dem Film-Noir-Klassiker „Kiss me deadly“ und der Critical Whiteness, zwischen den Ehen unserer Eltern und den Neurosen unserer Bekannten.
Wir essen und reden und trinken zur Verdauung einen Cocktail; die Nacht ist noch jung, zumindest jünger als wir – eine Kombination, die in der Konsequenz das nächste Ziel vorgibt: die 80er-Party im SO 36, die mit dem Titel „Dancing with tears in my eyes“ ironische Distanz zur eigenen Jugend verspricht. Und wie sonst soll man das eigene Alter ertragen?
Wir überqueren den Landwehrkanal, gehen die Ohlauer runter, biegen ab in die Wiener Straße. Hier reihen sich das Madonna, die Weiße Taube und das Wiener Blut aneinander – alteingesessene Kreuzberger Kneipen, die nicht wegen der Reiseführer hier sind, sondern trotz ihnen –, dazwischen Spätis und Döner. Vor dem Wild at Heart sammeln sich Rockabillys und Punks, im benachbarten Tiki Heart kann man Burger bestellen, die nach Elvis und Johnny Rotten benannt sind. Irgendwer von uns hat „Dancing with tears in my eyes“ zu pfeifen begonnen, und die anderen stimmen mit ein. Es gibt so Songs, die braucht man nur zu erwähnen, um sie im Ohr zu haben.
An der Ecke, wo einst Bolle brannte, steht heute eine Moschee, deren glänzende, gläserne Fassade wiederum an einen Einkauftempel erinnert. Wir überqueren die Skalitzer Straße und mit ihr eine weitere unmerkliche Grenze: Das Publikum wird touristischer, der Bürgersteig voller, die Bars und Restaurants reihen sich aneinander wie Nutten, die einen übers Ohr hauen wollen. Vor einem Restaurant stehen Kellner in Anzügen und reden auf einen ein, als wollten sie einem Lose verkaufen. In der Luft ein Sprachgewirr aus Englisch, Spanisch, Französisch – „Herrlich, in so einer mitteleuropäischen Touristenstadt“, lässt sich Martin vernehmen. Wo ist nur unser altes schmuddeliges Kreuzberg hin?
Neben dem SO 36 tritt ein älteres türkisches Ehepaar aus einem Kulturverein auf die Straße, eine Gruppe Schwuler und Lesben läuft an ihnen vorbei. Keine Ahnung, wie ich auf die Sache mit der 80er-Party gekommen bin: Im SO 36 findet heute Gayhane statt, eine orientalische Homo-Party. Da wir aber auf Eighties statt auf Elektro geeicht sind, kehren wir erst mal im Franken gegenüber ein, bei einem Bier beratschlagen, wie es weitergehen soll.
Vor dem Franken ist es voll, drinnen schön leer und schön warm; jeden Schluck Bier dünstet man sofort wieder aus. Aus den Boxen dringen ohrenbetäubende Hardcore-Riffs, die Shots sind billig, die Barkeeperin tätowiert, ein Schild warnt vor pickpockets. Man fragt sich unwillkürlich, wer hier vor wem gewarnt wird: Die Touris vor den Punks oder umgekehrt – so weit ist es also gekommen. Martin versucht mithilfe einer App herauszubekommen, wo wir in der Nähe noch tanzen gehen können, aber entweder die App funktioniert nicht oder er kommt mit ihr nicht zurecht, und so lassen wir uns einfach weiter treiben, ins Roses schräg gegenüber.
Im Roses kommt man sich wie in einem überdimensionalen Schatzkästchen vor: Wände und Decke sind mit rosa Fell ausgeschlagen, überall glitzert und funkelt es – eine Discokugel hier, ein paar Plastikblumen da, kleine Kronleuchter wechseln die Farbe des Lichts. Überall durchtrainierte Typen mit Bizeps wie Bällen, einer sieht aus wie Bushido. Die Mädchen sind in Feierlaune und bestellen Jägermeister, Martin und ich versuchen unseren Flüssigkeitshaushalt mit Bier zu regulieren. „No pictures!“, herrscht der Barkeeper zwei junge Frauen, die an einem Tisch sitzen, an. Vielleicht, damit Bushidos Ruf nicht ruiniert wird oder die irgendeiner anderen bürgerlichen Existenz; vielleicht, um nicht zur Touristenattraktion zu verkommen. Dieses Verbot zu fotografieren in Kneipen und Clubs, die Warnung vor Taschendieben: Das alles gleicht den letzten Sandsäcken, mit denen ein Deich gestützt wird, denke ich, bevor er endgültig bricht.
Martin bildet sich ein, der Schweiß und Menschendunst im Roses würde sich im Fell unter der Decke sammeln und von dort auf uns niederschweben: höchste Zeit also, weiterzuziehen. Am Kotti böten sich im 360-Grad-Winkel Möglichkeiten: Möbel Olfe, Würgeengel, Festsaal Kreuzberg, Monarch – doch egal, was wir in Erwägung ziehen: Überall wird es voll sein und voller Touristen. Und so voll sind wir noch nicht!
Wie ein Drehkreuz spült der Platz das Partyvolk in die verschiedenen Richtungen; vorbei die Zeiten, als man sich hier vorkommen konnte wie Snake Plisken in John Carpenters „Die Klapperschlange“, abgeworfen über einem gesetzlosen, sich selbst überlassenen Ort voll verkommener Elemente.
Meiner Freundin fällt ein Club ein, der ihr kürzlich empfohlen worden ist, und so nehmen wir die 270-Grad-Ausfahrt in Richtung Reichenberger und gehen ins Bohnengold. Drei hintereinander liegende Räume ziehen sich wie Katakomben in ein Mietshaus hinein: im ersten Raum eine vollbesetzte Kneipe voller Menschen und Lärm, dahinter ein schlauchartiges Zimmer im 70er-Jahre-Style; zwei Stufen hinab, durch eine Eisentür, ein Keller mit Tanzfläche. Es riecht nach Schimmel, doch das scheint niemand zu stören, ein DJ legt Elektro mit 80er-Einschlag auf. Wir schlagen uns durch zur Bar. Die Mädchen bleiben bei Jägermeister, wir Jungs bei Bier – wir stellen fest, dass wir zu dick sind, um hier dazugehören. Die Jungs tragen Röhrenjeans, bedruckte T-Shirts und Scheitel; magersüchtig und milchgesichtig stehen sie auf der Tanzfläche rum, die knochigen Knie zucken zur Musik. „Man erkennt nie, ob das nun Hipster sind oder Trottel“, erklärt Martin. Merkwürdig, dass die ironische Distanz zur eigenen Jugend heute schon während ihr einsetzt.
Vor uns geht ein Mädchen auf einen Hipster-Jungen zu, beide sind Anfang zwanzig. Sie sagt: „I‘ve watched you? What are you drinking?“
Zwischen den Elektro-Beats hören wir die Bruchstücke eines Gesprächs, wie es in dieser Sekunde in Berlin wahrscheinlich fünfzig Mal geführt wird: I‘m from Sweden. / Berlin is so great. / Where have you been so far … und so weiter. Man weiß nicht so recht, ob man das süß finden soll, oder ob man die beiden kräftig schütteln soll und sagen: „Könnt ihr nicht aufhören, Plattitüden aneinanderzureihen?“
Weil wir es in der Hipsterhölle nicht mehr aushalten, setzen wir uns vorne an einen Tisch; obwohl keine Musik läuft, ist es unfassbar laut: Am Tisch neben unserem wird auf Englisch geschrien, irgendwer zersticht die Luftballons einer Geburtstagsrunde. Wir stellen uns die Fragen, die uns begleiten: Wären wir früher auch in so einen Laden gegangen? Stört es die Touristen nicht, nur unter ihresgleichen zu sein? Wollen sie nicht irgendwo feiern, wo Berliner sind?
„Ob die es gut finden, heutzutage jung zu sein?“, frage ich. „Ich finde, sie sehen nicht so aus.“
„Jung sein ist doch immer gleich“, erklärt meine Freundin, „und außerdem haben sie keinen Vergleich.“
Weil wir den aber haben, finden wir es hier schrecklich. „Kommt, lasst uns gehen“, spricht G. schließlich aus, was wir denken. „Ich ertrag die Oberflächlichkeit und die aufgesetzte Coolness nicht, das Englisch, die gute Laune und das Gebrüll.“ Ein letztes Mal wechseln wir die Lokalität, gehen in die Meuterei schräg gegenüber.
An den Wänden hängen Plakate mit der Aufschrift „Stille Straße bleibt“ und „20 Jahre Rostock-Lichtenhagen“, aus den Boxen dringt Musik mit orientalischem Einschlag. Wir bestellen vier Fassbrause à 1,30 Euro. Wie schön, in einem so unprätentiösen, uncoolen Laden zu sitzen. Erleichtert atmen wir durch. Natürlich ist es toll, was man in Berlin alles erleben kann: von der Hardcore-Laden in die Schwulenbar, von der Hipsterhölle in die Politkaschemme – und das alles im Umkreis von zehn Minuten. Aber man kann sich auch vorkommen wie auf einer Interrail-Tour: Das Abteil heißt Kreuzberg, das Ziel Montagmorgen – und im Grunde ist den meisten ist es ziemlich egal, wo sie sind.
(2012)