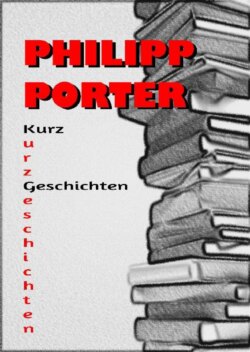Читать книгу Philipp Porter Kurzgeschichten - Philipp Porter - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIn vino veritas
Die ersten dicken Regentropfen klatschen auf meinen Kopf. Ich sehe in die dunklen, fast schwarzen Wolken hinein. Es wird wohl nicht viel Zeit vergehen, bis es schütten wird.
Mit beiden Händen fahre ich mir über meine nasse Glatze und ärgere mich, dass ich meinen Hut im Auto gelassen habe. Doch es ist wohl das geringste Problem, das ich nun habe. Ich sehe mich nochmals um. Strenge meine Augen an, um die anbrechende Dunkelheit zu durchdringen. Doch es ist niemand da, bis auf ihn.
Langsam gehe ich in die Arena hinein. Ich bin mir absolut sicher, dass er es ist. Es wäre ansonsten wohl ein dummer Zufall.
Weshalb hatte er angerufen? Am Telefon wollte er es mir nicht sagen. Er tat geheimnisvoll, fast schon dramatisch. Da ich an diesem Wochenende nichts vorhatte, willigte ich ein, zu kommen. War es ein Fehler?
Eigentlich hatte ich keine Lust in diese Angelegenheit, was immer es auch war, mit hineingezogen zu werden. Doch es war wohl schon zu spät. Sie würden ohne große Mühe feststellen, dass ich einer der Letzten gewesen war, der mit ihm telefoniert hatte.
Als ich nur noch wenige Meter entfernt bin, gehe ich in die Knie und sehe mich um. Hunderte von Fußspuren sind zu erkennen. Doch keine Tatwaffe, kein Hinweis, kein Anhaltspunkt. Langsam umrunde ich meinen alten Freund, der mit hölzernem, starrem Blick in die schwarzen Wolken starrt.
„Wer hat dir das nur angetan? Wäre ich schneller gefahren, würdest du dann noch leben?“, sage ich leise vor mich hin. Zwei Fragen, auf die es im Moment wohl keine Antworten gibt.
Als ich an seinem Kopf ankomme, sehe ich die tiefe, klaffende Wunde, aus der klebriges Blut sickert.
„Stumpfer Gegenstand, rund, schwer. Eine Tatwaffe wird wohl nicht so leicht zu bestimmen sein“, geht es mir durch den Kopf.
Ich schaue mich nochmals um. Nichts! Derjenige, der zuschlug, hat keine verwertbaren Spuren hinterlassen.
Die Tropfen werden dicker, fallen dichter und ich ziehe mein Telefon aus der Handytasche heraus.
Während ich warte, lasse ich meinen Blick über das römische Amphitheater hinweggleiten. „Ob es hier, zur damaligen Zeit, als es erbaut wurde, auch Gladiatorenkämpfe gab? Wahrscheinlich, weshalb auch nicht“, grüble ich.
Ich fühle mich etwas unwohl bei diesem Gedanken. Immerhin kann derjenige, der hier brutal gemordet hat, noch in der Nähe sein. Ich stehe mitten auf einem leeren Platz. Nur zwei Fluchtwege sind offen: Der eine geht nach Süden, zum Parkplatz hin, und der andere nach Norden. Wo es dort hingeht, weiß ich nicht.
Auch an eine schnelle Flucht über die Mauer der Arena, die fast vier Meter hoch ist und glatte Wände hat, ist nicht zu denken. Nochmals umrunde ich meinen alten Freund, um mich von diesen düsteren Gedanken abzulenken. Soll ich seine Taschen durchsuchen?
„Besser nicht“, sage ich zu mir selbst. Anhaftungen sind sehr leicht festzustellen. Ich kenne die Arbeitsweise der hiesigen Kripobeamten nicht, doch es wäre fatal, wenn sie an der Innenseite seiner Jacke Fasern von meinem Mantel finden würden. Dann sehe ich es. Kaum zu erkennen, doch es ist da. Neben seiner rechten Hand, in den Sand gemalt. Es liegt eindeutig über den Fußspuren. Ich ziehe nochmals mein Handy aus der Tasche heraus. Stelle den Nachtmodus ein. Eine kleine Leuchtdiode wirft gleißend weißes Licht auf den Boden. Ich schaue auf das Display und drücke den Auslöser. Die Qualität ist zwar bescheiden, aber es wird für meine Zwecke ausreichen.
„Soll ich den Hinweis abdecken? Wenn der Regen noch stärker fällt, ist die Spur in ein paar Minuten verschwunden“, viel weiter komme ich mit meinen Gedanken leider nicht. Die ersten Blaulichter zucken stechend durch die Dunkelheit und in Windeseile bin ich von vier übereifrigen Beamten in schwarzen Uniformen umstellt.
„Hände hoch! Hinter den Kopf! Sofort! Zurücktreten, zurück! Weiter, weiter! Keine Bewegung!“
Innerlich schüttele ich den Kopf. Dilettanten. Welcher Mörder ruft schon bei der Polizei an und bleibt dann seelenruhig neben der Leiche stehen.
Regentropfen fallen schwer vom Himmel. Die ersten Pfützen bilden sich. Ich sehe zu meinem Freund hinüber, der im Dreck liegt und mit leerem Blick in die schwarzen Wolken starrt.
Die Tür des Polizeiwagens, in dem ich seit einer halben Stunde sitze, wird mit Kraft aufgezogen und ein stämmiger, in die Jahre gekommener Mann steigt ein. Missmutig wirft er die Tür in ihr Schloss zurück. Es wird eng in dem Polizeibus, der nicht gerade viel Platz für zwei stämmige Kerle bietet, die beide über zwei Meter groß sind.
Ich schaue dem Mann direkt in die Augen, während er sich mit einem verschlissenen Taschentuch das Gesicht und die Haare trocknet. Der Mann deutet mit seiner linken Pranke auf mein Handy, das auf dem kleinen Klapptisch liegt, der an der Seitenwand des Polizeibusses befestigt ist.
„Ist das dein Handy?“, fragt er schroff und stopft dabei das tropfnasse Taschentuch in seine Jackentasche. „Ich hab dich etwas gefragt!“, setzt der Bulle aggressiv nach und wirft sich dabei nach vorne.
Kalte Wut steigt in mir auf. Ich kann es nicht leiden, wenn sich jemand im Ton vergreift.
„Dieser Bulle weiß noch nicht einmal, wer ich bin, und wird schon plump“, denke ich. „Wenn ich ihm sage, dass ich ohne meinen Anwalt nicht antworten werde, rastet er sicherlich aus.“ Ich lasse es.
„Jo Berghoff", sage ich daher nur und schaue an ihm vorbei, hinaus in den Regen, zu meinem Freund. Zwei Männer tragen gerade einen Leichensack in die Arena hinein.
Die Kulisse wirkt wie aus einem Tatort: düstere Szenerie, schwerer Platzregen, Dunkelheit, zuckende Blaulichter, Beamte in Uniform. Ein knallharter Bulle mit seinem Täter. Eindeutig Mord!
„Kennst du ihn?“, fragt mit tiefem Bass der Hüne, der sich mir noch immer nicht vorgestellt hat. Ich schaue ihn gelangweilt an.
„Woher kommst du? Was willst du hier in Trier? Hast du ihn erschlagen?“
Das sind nun schon vier Fragen auf einmal. Ich verbanne die Tatortbilder aus meinem Kopf und überlege, ob ich nun doch einen Anwalt verlangen soll. Die Zielrichtung dieses zuständigen Kommissars ist eindeutig: ein Toter und ein Mörder mit Glatze. Und dieser kennt den Toten und hat kein Alibi. Einfache Strickweise. Und wenn er herausbekommt, dass ich schon einmal wegen Totschlag eingesessen habe, ist es wohl ganz vorbei. Die Vergangenheit holt einen immer wieder ein.
„Ich habe Papiere ...“, sage ich und deute mit meinem Kinn auf meine Autoschlüssel, die neben dem Handy auf dem kleinen Tisch liegen, „... sie sind in meinem Wagen.“
Der Bulle greift zum Handy, nicht zu den Schlüsseln. „Teures Teil. Nicht billig, was?“
„Auf was will dieser Mistkerl nur hinaus? Raubmord? Wer schlägt schon einen tot wegen eines Handys?“ Ich korrigiere schnell meine Gedanken.
„Es ist bezahlt. Fünfhundertfünfundneunzig Euro mit Vertrag. Läuft auf meinen Namen. Sie können es gerne überprüfen“, sage ich gelangweilt.
Der Kommissar klappt das Handy auf und wählt zielsicher den Anrufspeicher aus.
„Dumm ist er nicht …“, schießt es mir durch den Kopf. „Das Handy ist gerade einmal acht Wochen auf dem Markt und dieser Hüne kennt das Menü, als ob er es mit entwickelt hat.“ Sein Daumen zuckt. Ein kurzer Blick. „Jetzt weiß er, dass ich mit Ulf kurz vor seinem Tod noch telefoniert habe. Kein Kommentar von ihm. Ist das nun gut oder schlecht für mich?“ Die Gedanken kreisen in Lichtgeschwindigkeit in meinem Schädel.
Der Kommissar wechselt das Menü. Der Daumen zuckt mehrmals nach unten.
„Er ist im Telefonbuch. Die eingetragenen Namen werden ihm aber kaum etwas sagen“, denke ich.
Doch dann ein anerkennendes Nicken vom Kommissar. Er kratzt sich mit seiner linken Pranke am Hals.
„Sie haben gute Kontakte, Jo. Ich kenne einige dieser Namen, die hier abgespeichert sind. Woher kommen Sie noch mal?“
Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. So schnell kann es gehen. Vom „Du“ zum „Sie“ innerhalb weniger Einträge in einem Telefonspeicher.
Ich zeige meinem neu gewonnenen Freund umständlich meine Hände, die mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt sind. Er nickt zustimmend und erlöst mich.
„Darmstadt“, sage ich und reibe mir die schmerzenden Handgelenke. „Danke“, hänge ich freundlich hinten dran.
„Schon gut. Ich wusste nicht, dass mir ein Kollege gegenübersitzt.“
„Kein Kollege“, antworte ich knapp und nehme mein Handy wie auch meine Autoschlüssel wieder an mich.
„Aber die Einträge ..., ich dachte ...“
Ich muss wieder grinsen. „Ja! Es sind sehr gute Bekannte, sogar Freunde von mir! Aber im weitesten Sinne haben Sie wohl Recht. Irgendwie sind wir schon Kollegen. Jedenfalls stehen wir auf der gleichen Seite.“
„Das werden wir noch sehen, Jo!“ Der Hüne greift zum Griff der Schiebetür und reißt sie auf. „Überprüf doch mal einen Jo Berghoff aus Darmstadt“, ruft er einem seiner Kollegen zu und wirft gleich darauf die Tür mit einem Ruck ins Schloss zurück. Die nette Plauderstunde ist schon wieder vorbei. „Kennst du den Wegmeier?“
Ich schaue dem Hünen erneut fest in die Augen. Soweit ich mich erinnern kann, ist er nur kurz bei Ulf gewesen. Er hat keine Papiere von ihm entnommen und er hat auch keine Informationen von einem seiner Kollegen erhalten. Er kennt Ulf persönlich!
„Ja, ich kenne Ulf, schon lange, wenn Sie es genau wissen wollen. Und ja, wir waren hier verabredet. Und nein, ich habe ihn nicht erschlagen.“
Die Tür wird aufgezogen und ein uniformierter Beamter schiebt seinen triefend nassen Kopf herein. Er flüstert dem Hünen etwas ins Ohr.
Ich verstehe kein Wort, aber ich kenne den Inhalt der Nachricht dennoch. „Es ist immer das Gleiche“, denke ich.
Der Kommissar nickt und zieht die Tür wieder in ihr Schloss zurück. Ein eiskalter Blick trifft mich. Verachtend. Er mag keine Privatermittler. Viele mögen uns nicht.
„Ein Schnüffler, der schon mal gesessen hat – wegen Totschlag. Nicht schlecht. Das ergibt ja ein rundes Bild. Ich frag dich noch mal: Was willst du hier?“
„Die Frage, ob ich Ulf erschlagen habe, fehlt. Ob er sie vergessen hat? Oder ist sie vorläufig nicht mehr relevant?“, geht mir durch den Kopf.
„Würden Sie mir bitte Ihren Namen nennen? Ich möchte wissen, mit wem ich es zu tun habe."
Der Kommissar zuckt sichtlich zusammen. Jede Faser seiner massigen Hände spannt sich. Nach einer kleinen Ewigkeit sagt er: „Hauptkommissar Ackermann, K3, Mordkommission."
Ich nicke dankend. „Darf ich telefonieren?“ Der Griff zu meinem Handy ist real, die Frage rhetorisch. Zweimal dringt der Rufton aus dem Lautsprecher, dann wird das Gespräch entgegengenommen.
„Hallo, ich bin es, Jo. Ich habe hier in Trier ein kleines Problem. Ulf Wegmeier wurde erschlagen und ich sitze als Tatverdächtiger einem Hauptkommissar Ackermann vom K3 gegenüber. Könntest du das bitte regeln? Danke.“
Die Hände des Hünen zucken. Seine Halsschlagader tritt sichtbar hervor. Auch der hochrote Kopf ist nicht mehr zu übersehen.
Eine halbe Minute später spielt sein Handy einen leisen Klingelton ab. Er weiß ebenso gut wie ich, wer am anderen Ende der Leitung ist.
Und es ist wohl das erste Mal im Leben des Herrn Hauptkommissar Ackermann, dass man ihn in die Schranken weist. Er antwortet nur mit knappen Jas und ebenso kurzen Neins. Keine weitere Silbe kommt über seine Lippen. Doch seine Blicke, wären sie fassbar, würden mich glatt in winzig kleine Stücke zerteilen.
Nachdem er aufgelegt hat, sitzt Ackermann nur stumm da und fixiert mich. Ich starre ebenso stur zurück. Ich weiß, dass er mir nichts anhaben kann, und er scheint zu überlegen, wie er es dennoch anstellen könnte.
„Und?“, frage ich, da dieses dämliche Herumsitzen in dem engen Polizeibus zu nichts führt. „Was machen wir?"
„Wir?“, kommt es verächtlich zurück. „Wir machen überhaupt nichts. Du setzt dich in dein Auto und fährst wieder dahin zurück, von wo du auch gekommen bist. Und ich ermittle in dem Mordfall Ulf Wegmeier.“
Ich muss leise lachen. Dieser Hauptkommissar aus Trier glaubt wirklich, dass ich meine Nase nicht in diesen Fall stecken werde. Ich tippe mir mit zwei Fingern kurz an die Stirn, um mich zu verabschieden, da kommt noch einmal die Frage, die er mir bereits zweimal gestellt hat.
„Was wollte Wegmeier?“
Ich zucke mit den Schultern. „Keine Ahnung. Er rief mich an und fragte, ob ich ihm helfen könnte. Ich habe momentan keinen aktuellen Fall, also bin ich losgefahren. Als ich auf dem Parkplatz ankam, stand sein Wagen bereits da. Aber keine Spur von ihm. Ich bin herumgelaufen und habe ihn gesucht. Den Rest kennen Sie.“
„Welcher Wagen?“
Innerlich schüttele ich den Kopf. Seine Kollegen wimmeln nur so draußen im Regen herum, aber keiner hat sich einmal die Mühe gemacht festzustellen, wie Ulf wohl hierher gekommen ist.
„Sein Wagen, ein dunkelblauer Mercedes, E-Klasse. Er steht auf dem Besucherparkplatz, hier gleich um die Ecke.“
„Und du hast keine Ahnung, was er von dir wollte?"
Ich schüttele den Kopf. Diesmal sichtbar. Ich habe wirklich keine Ahnung. „Er war Journalist. Er ist immer hinter irgendetwas her gewesen. Ich habe für ihn schon das eine oder andere Mal ermittelt. Aber gefährlich war es nie.“
Ackermann starrt verloren aus dem Fenster in die Dunkelheit hinein. Ich hingegen möchte keine Zeit verlieren.
„Ich würde mich gerne in Ulfs Wohnung und in seinem Wagen umsehen. Auch die letzten Telefonate, die er geführt hat, würden mich interessieren.“
Ackermann starrt noch immer aus dem Seitenfenster. Hat er nicht verstanden oder will er nicht? Ich winke mit meinem Handy. Es soll so viel heißen, dass ich jederzeit nochmals telefonieren könnte, wenn ich nur wollte. Ein kurzes Nicken von ihm. Gute Freunde werden wir wohl nie werden.
Die Durchsuchung von Ulfs Wagen ergab nichts. Einige Akten, Artikel und Aufzeichnungen, die ohne einen konkreten Hinweis kaum zu verwerten waren.
In Ulfs Wohnung sah es anders aus. Anscheinend war er einer mächtigen Gaunerei auf der Spur gewesen. Die schon lange zurückliegende Weinpanscherei mit Glykol in den Achtzigern war wohl Kinderkacke gegen das, was Ulf herausgefunden hatte. Wenn ich seine Unterlagen richtig einschätzte, waren wohl einige der renommiertesten Winzer der Moselregion mit involviert. Ein mächtig heißes Eisen. Wohl zu heiß für einen Journalisten aus der hiesigen Region.
Ulf wusste aber, dass ich solchen brisanten Fällen nicht aus dem Wege ging – ich liebte sie sogar. Daher wohl auch sein Anruf. Ackermann dachte wohl das Gleiche, nur sah man ihm an, dass er schon jetzt Bauchschmerzen bei dem Gedanken bekam. Er lebte hier und er kannte mit Sicherheit die Herren auf der Liste, die er gerade in den Händen hielt.
„Kumpels?“, frage ich salopp und bekomme umgehend die passende Reaktion auf meine provokativ gestellte Frage. Doch einhundertvierzig Kilo, auf zwei Meter zehn, wirft man nicht so einfach um. Ich bewege mein Kinn vorsichtig hin und her.
„Schade, dass wir nicht alleine sind", brumme ich leise und gehe, ohne zu fragen, ob ich darf. Hier kann ich für meinen alten Freund sowieso nichts mehr tun.
Da ich mich in Trier nicht gut auskenne, nehme ich erst einmal Kurs auf die Porta Nigra, die ganz in der Nähe ist. Ich werde für die nächsten Tage ein Zimmer benötigen und daher muss ich mich irgendwo einbuchen. Würde Ulf noch leben, hätte ich dieses Problem nicht.
Als ich an dem alten Stadttor vorbeifahre, ermahne ich mich selbst, einmal nachzulesen, was es mit diesem alten, düsteren Bauwerk wohl auf sich hat. Soweit ich mich erinnern kann, wurde es in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts ohne Mörtel gebaut. Mehr weiß ich nicht. Ich werfe dem Bauwerk einen anerkennenden Blick zu, als ich an ihm vorbeikomme, und fahre über die Nordallee in Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke davon.
Kurze Zeit später begebe ich mich in den Dschungel der Trierer Einbahnstraßen. Ich mag diese Stadt nicht sonderlich. Auto fahren, wenn man sich nicht auskennt, ist eine Qual.
Nach einigem Suchen finde ich den Deutschherrenhof in der gleichnamigen Straße. Hier war ich vor einer kleinen Ewigkeit schon einmal, und wo es mir gefallen hat, da gehe ich gerne wieder hin. Die Zimmer sind gemütlich, die Betten groß und das Essen ausgesprochen gut.
Nach einer heißen Dusche und einer ausgiebigen Rasur erinnert mich mein knurrender Magen an feste Nahrung. Ich nehme mein Handy und gehe ins Restaurant. Während ich auf mein Essen warte, erledige ich einige Anrufe. Ackermann wird sicherlich ein Stück seiner Schreibtischplatte abbeißen, wenn er entsprechende Order von seinem Chef bekommt. Ich kann mir ein breites Grinsen nicht verkneifen.
Das Steak Madagaskar und der trockene Rotwein schmecken vorzüglich. Während ich genüsslich kaue, summt mein Handy und dreht sich dabei langsam auf der hölzernen Tischplatte im Kreis. Ich schaue mit einem Seitenblick aufs Display. „Trierer Vorwahlnummer. Es muss Ackermann sein“, geht es mir durch den Kopf, während ich ein paar Pfefferkörner auf ein Stück Fleisch schiebe. Doch ich habe keine Lust mit ihm zu reden. Ich will mir den Appetit nicht mit einem unnötigen Gespräch verderben. Er muss sich wohl oder übel damit abfinden, dass ein Privatschnüffler volle Akteneinsicht bekommen wird.
Beim letzten Bissen schießt mir ein Gedanke durch den Kopf: „Der Hinweis!“ Von Ulf in den Sand gemalt. Ich nehme mein Handy und suche das Bild aus dem Speicher heraus. Auf dem kleinen Display ist aber fast nichts zu erkennen.
Auf meinem Zimmer lade ich das Bild in meinen Laptop hoch. Nach ein paar kleinen Korrekturen, mit meinem neuen Bildbearbeitungsprogramm, ist es scharf. Ich lasse das Bild um die eigene Achse rotieren.
„Was soll das sein? Was hat Ulf da mit seinen Fingern in den Sand gemalt?“, frage ich mich selbst.
Es sind vier zusammenhängende Bögen und ein Einzelner, links von den anderen. Ich stelle das Bild auf den Kopf und wieder zurück. Doch eines weiß ich: Ulf hat auf mich gewartet und dies ist ein Hinweis. Leider kann ich nichts damit anfangen.
Mein Handy summt erneut. Ich schaue aufs Display. Die gleiche Nummer. Ich melde mich. Und wie erwartet ist es Ackermann. Er sitzt bei der Staatsanwaltschaft und will mich sehen. Sofort!
Ich erkläre ihm, wo ich mich eingebucht habe, und er beschreibt mir den Weg zu sich. Keine fünfhundert Meter zu Fuß. Fünf Minuten später sitze ich vor ihm.
Der Staatsanwalt an seiner Seite sagt außer einem „Schönen guten Abend" nichts. Ackermann führt das Wort und er redet viel. Er erklärt mir, was 1985 alles los war mit den Österreichern und den Weinabfüllern in Deutschland, und versucht sich dann in Chemie. Diethylenglykol, mit Zuckertest im Wein nicht nachweisbar, bleibt nur bei mir hängen. Mich interessiert aber, was Ulf in Trier herausbekommen hat. Doch hier schweigt Ackermann beharrlich.
„Noch mal meine Frage an dich, Jo: Was wollte Ulf Wegmeier von dir?“
Ich zucke mit den Schultern. „Keine Ahnung. Geben Sie mir die Akten und ich sage es Ihnen vielleicht.“
Ackermann schüttelt energisch den Kopf. „Keine Chance. Auch wenn du hundert Mal telefonierst. Von mir bekommst du nichts!"
Die Hand, die sich auf Ackermanns Arm legt, bringt ihn etwas aus der Fassung. Die leisen Worte des Staatsanwaltes ganz und gar. Ohne einen Kommentar fliegt ein Aktenordner über den Schreibtisch hinweg und landet vor meinen Füßen.
Nach einer halben Stunde weiß ich mehr. Sehr viel mehr. Ulf hätte sich eine neue Bleibe suchen müssen. In Trier hätte er keinen Stein mehr auf den anderen bekommen. Ich nicke Ackermann zu und werfe den Ordner zurück.
„Viel Spaß“, sage ich nur, nehme einen Stift aus einer Schale und ein Stück Papier von einem Stapel Notizblätter. Mit schnellen Zügen zeichne ich auf das Stück Papier, was Ulf in den Sand gemalt hat. Ich schiebe den Zettel über den Schreibtisch hinweg. „Können Sie mir sagen, was das ist?“, frage ich den Staatsanwalt.
Ackermann starrt auf den Zettel. „Was soll das?“, fragt er aggressiv. Instinktiv weiß er, dass mir etwas bekannt ist, das ihm offensichtlich entgangen ist.
„Tatortsicherung ist eines der profanen Dinge, die Beamten an einem Tatort vornehmen sollten. Jede noch so kleine Spur kann hilfreich sein. Besonders, wenn nicht viel Zeit vergeht, bis es zu schütten beginnt. Zwei Kollegen hätten ausgereicht, um mich festzunehmen, die anderen beiden hätten sich nützlich machen sollen.“
Der Blick des Staatsanwaltes spricht Bände.
„Ulf hat dies mit den Fingern in den Sand gezeichnet, bevor er starb. Ich kann leider keinen Zusammenhang mit dem Inhalt seiner Recherchen herstellen. Sagt Ihnen dieses offensichtliche Symbol etwas?“
Ackermann will auffahren, doch die linke Hand des Staatsanwaltes auf seinem Unterarm hält ihn zurück. Dann nimmt der Staatsanwalt einen Stift und verbindet den alleinstehenden Bogen mit den anderen. Danach zeichnet er zwei parallele Linien über die Bogengruppe und zwei einzelne an die Seite der fünf Bögen.
Ackermann spricht es zuerst aus. „Die Moselbrücke?“
Der Staatsanwalt nickt zustimmend.
„Ich bin nicht von hier, aber ich weiß, dass die Moselbrücke sieben Bögen hat und nicht fünf“, sage ich und lehne mich in dem Stuhl zurück, auf dem ich sitze.
Ackermann nickt. „Ja, stimmt, Jo. Aber wenn Wegmeier es mit einer einzigen Handbewegung in den Sand gemalt hat, würden zwei Bögen in den Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger noch hineinpassen. Vielleicht hatte er nur keine Gelegenheit mehr den Hinweis vollends zu ergänzen? Es gibt zwei Winzer auf der Liste, die das Symbol der Brücke in ihren Etiketten haben. Hier setze ich an.“
Ich sage nichts. Ich kannte Ulf. Er hätte mir keine halben Sachen hinterlassen, noch nicht einmal, wenn er im Sterben gelegen hätte. Es muss eine andere Erklärung für die fünf Bögen geben. Ich verabschiede mich. Ackermann hat eine heiße Spur und offensichtlich kein Interesse mehr an mir.
Während ich durch die dunklen Straßen Triers laufe, geht mir ständig diese Brücke im Kopf umher. „Ist es überhaupt eine Brücke?“
Der Staatsanwalt und Ackermann haben mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Der Gedanke sitzt aber bombenfest in meinem Kopf verankert. Ich gehe Richtung Frankenturm und biege dann zum Pferdemarkt ab. „Comida Tapa-Bar“, steht auf einem beleuchteten Schild. „Weshalb nicht?“, sage ich. Ich muss auf andere Gedanken kommen.
Während ich mir ein Bier genehmige und meinen Gedanken nachhänge, kommt eine kleine Gruppe junger Leute in das Lokal herein. Schnell werden Runden bestellt und die Stimmung wird zusehends locker.
Ich höre gewohnheitsmäßig hin, wenn sich Menschen unterhalten. Ist nicht die feine Art, aber in meinem Job äußerst nützlich. Die jetzige Weinkönigin muss eine ausgesprochene Schönheit sein und der Prinz, der sie nächste Woche sogar heiraten wird, ein glücklicher Mann. Sie ist eine Winzertochter, deren Vater mit fast fünfzehn Prozent Anteil an der gesamten Weinmenge im Moselgebiet aufwarten kann. Nach meiner Kenntnis über einige Tausend Liter besten Weines.
„Nicht schlecht. Glückspilz“, murmele ich, trinke aus und gehe. Die Nacht ist bereits zu kurz, um am nächsten Tag fit zu sein.
Der Anruf von Ackermann kommt früh, zu früh für meinen Geschmack. Und die überschwängliche Stimme von ihm ebenso. Man hört trotz des schlechten Empfangs, dass er vor Hochmut fast platzt. Zwei Festnahmen, zwei Treffer. Die hiesigen Winzer hatten Ulf wirklich auf der Abschussliste. Und was dies bei den Umsatzmengen hieß, ist wohl klar. Leider gibt es auch zwei bombensichere Alibis. Ackermann gibt mir aber zu verstehen, dass er sie knacken wird. Er hätte so seine Methoden. Ich lasse mir die Namen der beiden Verdächtigen geben und notiere sie auf dem Rand der Tageszeitung vom Vortag. Mein Blick bleibt dabei an einer Familienanzeige hängen.
Während des Frühstücks male ich fünf Bögen auf meine Serviette. Fünf Bögen, die aussehen wie die Finger meiner Hand. Lange Striche führen nach unten. Ein paar Längs- und Querstriche in die Zeichnung hinein und ich bin in Darmstadt. Der Fünffingerturm. Der Hochzeitsturm. Der Ort, an dem sich junge und verliebte Paare vor dem Traualtar das Jawort geben.
Und dann ergibt jeder einzelne Gedanke, der in meinem Kopf umherschwirrt, ein Gesamtbild: die Verlobungsanzeige in der Zeitung, die Gespräche in der Tapa-Bar, der Name eines Verdächtigen, Ulfs Hinweis im Sand.
Schnell habe ich die Telefonnummer der Weinkönigin herausgefunden und ebenso schnell eine Verabredung mit ihr.
Als wir uns treffen, an dem Ort, der von weiß-roten Polizeiabsperrbändern nicht zugänglich ist, bin ich sichtlich überrascht. Sie ist wirklich eine Schönheit.
Schnell komme ich zu dem Grund meines Anrufes. Sie zögert, doch der Blick in die Arena hinein, in der noch vor wenigen Stunden Ulf Wegmeier lag, zwingt sie zum Reden.
„Ich wollte es nicht, das müssen Sie mir einfach glauben. Es war ein Unfall.“ Dicke Tränen laufen über ihr schönes Gesicht.
„Was war die Tatwaffe?“, frage ich unbeeindruckt.
„Ein Stein. Er lag auf dem Boden. Wir stritten uns, ein Stoß, er stolperte und dann war es passiert. Er wollte meinen Vater ruinieren. Die Hochzeit, alles wäre aus gewesen. Rolf, mein Verlobter, er wird mich nicht heiraten, wenn Vater ins Gefängnis kommt.“
„Ich habe keinen Stein gesehen“, gebe ich zurück und frage mich, was das für ein Kerl ist, der sie wohl nur heiratet, wenn der Vater weiter gepanschten Wein produziert.
„Ich habe ihn mitgenommen. Als ich Sie kommen sah, bekam ich Angst. Wer glaubt mir denn schon, dass es ein Unfall war. Jeder denkt doch ...“ Die Tränen rauben ihr jedes weitere Wort.
Ich nicke. Ja, da hat die schöne Weinkönigin wohl Recht. Ackermann wird ihr sicherlich nicht glauben.