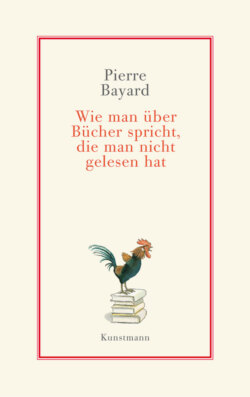Читать книгу Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat - Pierre Bayard - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweites Kapitel BÜCHER, DIE MAN QUERGELESEN HAT
Оглавлениеin dem wir mit Valéry erkennen, dass es reicht, ein Buch querzulesen, um ihm einen ganzen Artikel zu widmen, und dass es bei manchen Büchern geradezu unziemlich wäre, anders vorzugehen.
DER GEDANKE DES »ÜBERBLICKS« beschränkt sich nicht auf die Stellung des Buches innerhalb der kollektiven Bibliothek. Er gilt genauso für die Situierung eines einzelnen Abschnitts innerhalb eines ganzen Buches. Die Fähigkeiten der Orientierung, die ein gebildeter Leser in Bezug auf die Zusammensetzung der Bibliothek im Allgemeinen zu entwickeln weiß, sind ebenfalls gefragt, wenn es um das Innere eines einzelnen Bandes geht. Gebildet sein heißt fähig sein, sich rasch in einem Buch zurechtzufinden, und das bedeutet nicht, dass man das ganze Buch lesen muss, ganz im Gegenteil. Man könnte sogar sagen, je größer diese Fähigkeit ist, umso weniger ist es nötig, ein bestimmtes Buch zu lesen.
Die Haltung von Musils Bibliothekar stellt einen Extremfall dar, der selbst unter den erklärten Lesemuffeln nur Seltenheitswert hat, da es außerordentlich schwierig ist, nie zu lesen. Schon verbreiteter ist der Fall des Lesers, der nicht ganz auf Bücher verzichten will, sich jedoch mit dem Querlesen zufriedengibt. Musils Held befindet sich übrigens in einer zweideutigen Position, da er sich zwar einerseits, wie wir gesehen haben, davor hütet, die Bücher zu öffnen, sich aber doch für die Titel und Inhaltsangaben interessiert und so, ob er will oder nicht, eine erste Annäherung ans Werk andeutet.
Dass wir Bücher überfliegen, ohne sie wirklich zu lesen, hindert uns keineswegs daran, sie zu kommentieren. Unter Umständen ist dies sogar die effizienteste Art, sie sich anzueignen, weil man so ihr tiefes Wesen und ihre Möglichkeiten der Bereicherung respektiert, ohne sich in Einzelheiten zu verlieren. Dies jedenfalls ist die Meinung – und entschiedene Praxis – des Meisters im Nichtlesen, Paul Valéry.
∗
In der Galerie der Schriftsteller, die vor den Risiken des Lesens gewarnt haben, nimmt Valéry eine Vorzugsstellung ein, ist doch ein Teil seines Werkes nichts anderes als eine scharfe Anprangerung der Gefahren genau dieser Tätigkeit. So lebt Monsieur Teste, ein Held ganz im Sinne Valérys, in einer Wohnung, in der kein einziges Buch steht, und wir dürfen davon ausgehen, dass er in diesem wie in vielen anderen Punkten dem Schriftsteller, der aus seiner Lesefaulheit keinen Hehl macht, als Vorbild dient: »Ich hatte erst eine Abneigung gegen das Lesen und meine Lieblingsbücher an meine Freunden verteilt. Später, nach der kritischen Zeit, musste ich sogar einige Bücher neu erwerben. Aber ich bin noch immer kein großer Leser, suche ich doch in einem Werk stets nur nach dem, was meine eigene Tätigkeit im einen oder anderen Sinne befördern kann.«[1]
Dieses Misstrauen gegenüber Büchern betrifft als Erstes die Biografie. Valéry hat sich innerhalb der Literaturkritik dadurch einen Namen gemacht, dass er die Notwendigkeit der gewöhnlich aufgestellten Beziehung zwischen Werk und Autor in Zweifel zog. Tatsächlich herrschte im neunzehnten Jahrhundert die Meinung vor, dass die Kenntnis des Autors jene des Werks begünstige und man also so viele Informationen wie möglich über ihn zusammentragen solle.
Valéry, der mit dieser Tradition in der Kritik bricht, vertritt die Ansicht, dass der Autor allem Anschein zum Trotz das Werk nicht erklären kann. Dieses ist das Produkt eines schöpferischen Prozesses, der sich zwar in ihm abspielt, ihn aber übersteigt und sich nicht auf ihn reduzieren lässt. Es ist also, um ein Werk zu verstehen, absolut sinnlos, Erkundigungen über den Autor einzuholen, da dieser bestenfalls eine Durchgangsstation ist.
Valéry ist zu seiner Zeit keineswegs der Einzige, der für die Trennung zwischen Werk und Autor plädiert. In Gegen Saint-Beuve[2] verficht Proust die Theorie, nach der das literarische Werk das Produkt eines Ich ist, das sich von der Person, die wir kennen, unterscheidet, und er illustriert diesen Gedanken in der Suche nach der verlorenen Zeit[3] mit der Figur des Bergotte. Damit aber nicht genug, verbannt Valéry nicht nur den Autor aus dem Feld der Literaturkritik, sondern entledigt sich bei dieser Gelegenheit auch gleich noch des Textes.
∗
Dass Valéry wenig – oder manchmal auch gar nicht – liest, hindert ihn nicht daran, eine dezidierte Meinung über die Autoren zu haben, die er nicht kennt, und sich ausführlich über sie zu äußern.
Valéry hat also Proust genauso wenig gelesen wie die meisten anderen, die über ihn reden. Doch im Gegensatz zu so vielen lässt er sich dadurch nicht aufhalten, sondern gesteht es mit ruhigem Zynismus ein, und so beginnt seine Hommage an Proust in der Nouvelle Revue Française vom Januar 1923, kurz nach dem Tod des Schriftstellers, mit folgenden Worten:
»Obwohl ich kaum einen einzigen Band des großen Werks von Marcel Proust kenne und die Kunst des Romanciers mir eine fast unbegreifliche Kunst ist, weiß ich doch immerhin durch das wenige aus der Recherche du temps perdu, das ich Muße zu lesen hatte, was für ein außerordentlicher Verlust der Literatur widerfahren ist; und nicht nur der Literatur, sondern mehr noch der geheimen Gesellschaft, welche in jeder Epoche die bilden, die der Literatur ihren wahren Wert geben.«[4]
Doch es kommt gleich noch schlimmer, denn als Rechtfertigung dafür, dass er den Autor, von dem er spricht, nicht kennt, versteckt er sich hinter den positiven, vor allem aber übereinstimmenden Meinungen André Gides und Daudets:
»Um gegen jeden Zweifel sicher zu sein, hätte es mir im übrigen, selbst ohne eine Zeile dieses umfangreichen Werks gelesen zu haben, genügt, über seine Bedeutung so ungleiche Geister wie Gide und Léon Daudet einig zu finden; ein so seltenes Zusammentreffen kann nur in nächster Nähe der Gewißheit stattfinden. Wir können beruhigt sein: die Sonne scheint, wenn beide doch es zugleich verkünden.«[5]
So ist also die Meinung anderer entscheidend, um seine eigene Ansicht zu formulieren, ja, man kann sich sogar vollständig auf sie stützen, sodass man – nehmen wir an, das ist für Valéry der Fall – keine einzige Zeile des Textes gelesen haben muss. Das Dumme an diesem blinden Vertrauen in andere Leser ist nur, wie er unumwunden eingesteht, dass es schwierig ist, im Kommentar durch Genauigkeit zu glänzen:
»Andere werden genau und gründlich über ein so starkes und feinsinniges Werk sprechen. Wieder andere werden darstellen, was der Mensch war, der es schuf und zum Ruhm brachte; vor vielen Jahren habe ich es nur gerade eben eingesehen. Ich kann hier nur eine Meinung ohne Kraft und beinahe unwürdig, geschrieben zu werden, vortragen. Es ist nur eine Ehrung, eine vergängliche Blume auf einem Grab, das dauert.«[6]
Sieht man über Valérys Zynismus hinweg und trägt stattdessen seiner Ernsthaftigkeit Rechnung, so muss man zugeben, dass die paar Seiten über Proust, die auf diese Einleitung folgen, einen Kern Wahrheit enthalten, denn sie zeigen etwas, das wir immer wieder selbst feststellen können, nämlich dass es keineswegs nötig ist, seinen Gesprächsgegenstand zu kennen, um sich korrekt darüber zu äußern.
Nach der Einleitung spaltet sich der Artikel in zwei Teile. Der erste handelt vom Roman im Allgemeinen, wobei sich Valéry offensichtlich nicht lange mit genauen Betrachtungen abzugeben gedenkt. So erfährt man, dass der Roman darauf abzielt, »uns ein oder mehrere imaginäre ›Leben‹ mitzuteilen; er führt Personen ein, setzt Zeit und Raum fest, berichtet Vorfälle«, was ihn von der Poesie unterscheidet und es ihm erlaubt, ohne sehr großen Verlust zusammengefasst oder übersetzt zu werden.[7] Diese Bemerkungen, mögen sie auch für eine ganze Reihe von Romanen Gültigkeit haben, lassen sich allerdings kaum auf Proust anwenden, dessen Werk sich nur schwer zusammenfassen lässt. Im zweiten Teil seines Textes zeigt sich Valéry schon etwas besser inspiriert.
Dieser ist Proust gewidmet, um den man in einer Hommage wohl nicht ganz herumkommt. Nachdem er ihn zu allen anderen Schriftstellern in Beziehung gesetzt hat, von denen er zuvor sprach, hebt Valéry nun doch dessen Besonderheit hervor, ausgehend von der gewiss Proust’schen Vorstellung, dass sein Werk sich auszeichnet durch den »Überfluß an Verknüpfungen, die das geringste Bild so ungezwungen in der eigenen Substanz des Autors fand«. Dieser Fingerzeig auf die Proust’sche Art, die unendlich kleinen Verbindungen jedes Bildes in Szene zu setzen, stellt einen doppelten Vorteil dar. Als Erstes ist es nicht nötig, Proust gelesen zu haben, um dafür empfänglich zu sein, und um dies festzustellen, kann man ihn aufschlagen, auf welcher Seite man will. Darüber hinaus ist dieses Vorgehen strategisch angemessen, da es darauf hinausläuft, den Akt des Herauspflückens selbst und damit also den Verzicht auf das Lesen zu legitimieren.
Tatsächlich kann Valéry sehr geschickt erklären, wie die Anziehungskraft von Prousts Werk mit seiner außerordentlichen Eigenschaft zusammenhängt, dass man ihn auf jeder beliebigen Seite aufschlagen kann:
»Der Reiz seiner Werke ruht in jedem Fragment. Man kann das Buch aufschlagen, wo man will; seine Lebenskraft hängt überhaupt nicht von dem ab, was vorausgeht, gewissermaßen von der erworbenen Illusion; sie beruht in dem, was man die Selbsttätigkeit seines Textgewebes nennen könnte.«[8]
Valérys Geniestreich besteht darin, dass er sich für die Theorie zu seiner Lektürepraxis auf den Autor beruft, den zu lesen er nicht vorhat und der geradezu nach seinem Vorgehen verlangt, sodass der Verzicht auf das Lesen noch das beste Kompliment ist, das man ihm machen kann. Und so macht er denn auch, wenn er in den Schlussfolgerungen seines Artikels die »schwierigen Autoren« würdigt, die bald niemand mehr verstehen kann, kein Geheimnis daraus, dass er, hat er seine Aufgabe als Kritiker erfüllt, genauso wenig wie zuvor die Absicht hat, sich an die Lektüre Prousts zu machen.[9]
∗
Wenn die Würdigung Prousts Valéry dazu dient, seine Vorstellung vom Lesen darzulegen, so wird ihm ein anderer bedeutender Zeitgenosse, Anatole France, die Gelegenheit bieten, sein wahres Gesicht zu zeigen und diesmal nicht nur auf den Autor, sondern auch gleich noch auf den Text zu verzichten.
Als Valéry im Jahr 1927 als Nachfolger von Anatole France in die Académie Française aufgenommen wird und dadurch in die Verlegenheit kommt, dessen Nachruf zu verfassen, tut er alles, um der Aufgabe, die er sich in der Einleitung seiner Rede selbst stellt, nicht nachzukommen:
»Der einzige Hilfsquell der Toten sind die Lebenden. Unsere Gedanken sind für sie der einzige Weg zum Licht. Die uns so viel gelehrt haben, die offenbar für uns dahingegangen sind und alle ihre Chancen uns überlassen haben, sie seien – so ist es gerecht und unser würdig – ehrfürchtig in unserem Gedenken empfangen, sie mögen ein wenig Leben aus unseren Worten trinken.«[10]
Wollte Anatole France im Gedächtnis oder in einem Text weiterleben, so hätte er einen anderen finden müssen als Valéry, der sich während seines ganzen Vortrags die größte Mühe gibt, ihm nicht zu huldigen. Tatsächlich ist Valérys Rede nichts anderes als eine nicht abreißende Serie von Gemeinheiten gegen seinen Vorgänger, für den er wiederholt das Prinzip des zweifelhaften Kompliments in Anwendung bringt:
»Das große Publikum war meinem ruhmvollen Vorgänger unendlich dankbar, daß er ihm das reizvolle Gefühl einer Oase verschafft hatte. Der erfrischende Gegensatz seiner abgemessenen Schreibweise zu den geräuschvollen und verwickelten Stilarten, in denen ringsumher geschrieben wurde, rief nur angenehme, freundliche Überraschung hervor. Es schien, als seien Ungezwungenheit, Klarheit und Einfachheit auf die Erde zurückgekehrt. Sie sind ja die gefälligen Göttinnen der Mehrheit. Jeder mußte eine solche Sprache lieben, die sich ohne vieles Grübeln genießen ließ, deren gefällige Natürlichkeit verführte, deren Durchsichtigkeit bisweilen wohl einen Hintergedanken durchscheinen ließ, der aber nicht undeutbar, im Gegenteil stets leicht verständlich, wenn auch nicht immer ganz befriedigend war. Seine Bücher bewiesen eine vollendete Kunst, die gewichtigsten Gedanken und Probleme obenhin zu streifen. Nichts behinderte den schweifenden Blick, außer etwa das Erstaunen selbst, keinem Widerstand zu begegnen.«[11]
Einer solchen Dichte an unterschwelligen Beleidigungen auf so wenigen Zeilen begegnet man nicht jeden Tag, wird doch das Werk Anatole Frances nacheinander als »angenehm«, »freundlich«, »erfrischend«, »gemessen« und »einfach« bezeichnet, was in der Literaturkritik schwerlich als Kompliment aufgefasst werden kann. Und darüber gefällt es – ein letzter Fußtritt – möglicherweise allen. Man kann es genießen, ohne zu grübeln, da die Ideen nur »gestreift« werden, eine Einschätzung, die Valéry auch gleich weiter ausführt:
»Was ist auch reizvoller als die köstliche Illusion der Klarheit, die uns ein Gefühl müheloser Bereicherung, sorgenlosen Genießens, achtlosen Verständnisses, kostenlosen Schauspiels schenkt?
Glücklich die Schriftsteller, die die Last des Denkzwanges von uns nehmen und mit leichter Hand ein reizvolles Trugbild um die komplizierte Gestalt aller Dinge weben!«[12]
Stellt Valérys Huldigung auf Anatole France nichts als eine Anhäufung von Gemeinheiten dar, so stimmt der Text durch seine Vagheit umso nachdenklicher, als ob Valéry auf keinen Fall den Eindruck erwecken möchte, er habe Anatole France gelesen, da dies seiner Meinung über ihn widersprochen hätte. Nicht nur nennt er keinen einzigen Titel seines Werks, der Text wird zu keinem Moment auch nur ein bisschen explizit, und er macht nicht die leiseste Anspielung auf eines seiner Bücher.
Schlimmer noch, Valéry hütet sich, auch nur ein einziges Mal den Schriftsteller, auf dessen Sitz er folgen wird, beim Namen zu nennen, sondern verweist nur andeutungsweise durch Wortpiele auf ihn: »Nur in Frankreich, dem er seinen Namen entlieh, war er selbst möglich und anderswo kaum vorstellbar.«[13]
Dass Valéry unbedingt den Eindruck zu vermeiden sucht, er könnte Anatole France gelesen haben, mag vielleicht auch mit dem Hauptvorwurf zusammenhängen, den er ihm macht, nämlich zu viel zu lesen. France, den er als unermüdlichen Leser bezeichnet – was bei Valéry einer Beschimpfung gleichkommt –, ist jemand, der sich, ganz anders als sein Nachfolger an der Académie, in den Büchern verirrt hat:
»Ich weiß wahrhaftig nicht, meine Herren, wie eine Seele bei dem bloßen Gedanken an die unendlichen Stapel von Schriftwerken, die sich in der Welt ansammeln, den Mut bewahren kann. Was gibt es für den Geist Schwindelerregenderes, Verwirrenderes, als die golden geharnischten Wände einer Bibliothek zu betrachten; und was ist Niederdrückenderes zu sehen als die Bücherbänke, jene Brüstungen aus Geisteswerken, die auf den Uferstraßen sich bilden; jene Millionen von Bänden und Broschüren, gestrandet an den Ufern der Seine, wie geistige Wracks, ausgesondert vom Zeitenfluß, der sich ihrer entledigt und sich von ihren Gedanken reinigt?«[14]
Dieser Leseexzess hat bei France zum Verlust seiner Originalität geführt. Denn genau das ist aus Sicht Valérys die Hauptgefahr, die das Lesen für einen Schriftsteller darstellt, weil es ihn in Abhängigkeit zu anderen bringt:
»Meine Herren, das gelehrte, feinsinnige Mitglied Ihrer Vereinigung hat der großen Zahl gegenüber kein Unbehagen verspürt. Sein Geist war widerstandsfähiger. Um sich vor solchem Widerwillen und vor dem Schwindel, den die Statistik erregt, zu bewahren, hatte er nicht nötig, nur sehr wenig zu lesen. Fern von allem Gefühl der Bedrücktheit, regte ihn dieser Reichtum an, dem er soviel Belehrung und glückliche Wirkungen für Art und Bedarf seiner Kunst entnahm.
Man hat nicht unterlassen, ihm hart und unverständig vorzuwerfen, um so viele Dinge zu wissen und sich seines Wissens wohl bewußt zu sein. Was sollte er denn tun? Was tat er anderes, als was seit je geschieht? Es gibt nichts Originelleres, als daß man den Schriftstellern eine Art von Verpflichtung auferlegt, in jeder Hinsicht originell zu sein.«[15]
Einer der Schlüssel zur Lektüre des Textes ist in der Formel zu finden, die sich antithetisch zu Frances Vorgehen verhält, »zu ignorieren, was man weiß«. Die Bildung trägt die Bedrohung in sich, in den Büchern der anderen stecken zu bleiben, was unbedingt zu vermeiden ist, will man selbst schöpferisch sein. Kurz, France, der keinen persönlichen Weg zu finden wusste, ist geradezu ein Paradebeispiel für die schädlichen Folgen des Lesens, und man versteht, dass Valéry nicht nur sorgsam darauf achtet, kein einziges Mal aus seinem Werk zu zitieren oder es auch nur zu erwähnen, sondern sogar seinen Namen zu nennen, als könnte schon das Aussprechen ihn in einen identischen Prozess des Selbstverlusts verwickeln.
∗
Das Problem bei diesen »Würdigungen« Prousts oder Anatole Frances ist, dass sie Misstrauen streuen auf alle anderen Texte, die Valéry Schriftstellern gewidmet hat, weil man sich unweigerlich fragt, ob er sie gelesen oder wenigstens kurz überflogen hat. Sobald Valéry zugibt, dass er wenig liest, sich aber mit seiner Meinung trotzdem nicht zurückzuhalten gedenkt, wird auch die kleinste, noch so harmlose seiner kritischen Bemerkungen suspekt.
Seine Huldigung an den dritten großen Namen aus dem Geistesleben der ersten Jahrhunderthälfte, Henri Bergson, ist nicht gerade dazu angetan, diese Sorge zu entkräften. Der Text mit dem Titel »Rede auf Bergson«[16] stammt von einer Konferenz der Académie Française vom Januar 1941 anlässlich des Todes des Philosophen. Er beginnt auf ziemlich klassische Weise mit der Erwähnung seines Sterbens und seiner Beisetzung, um dann in reinster Diplomatensprache mit einer Aufzählung seiner Qualitäten fortzufahren:
»Er war der Stolz unserer Akademie. Ob wir von seiner Metaphysik eingenommen waren oder nicht, ob wir ihm in seiner tiefgehenden Suche, der er sein ganzes Leben gewidmet hat, und in der wahrhaft schöpferischen Entwicklung seines immer kühneren und freieren Denkens gefolgt sind oder nicht, wir hatten in ihm das authentischste Beispiel der höchsten intellektuellen Tugenden.«[17]
Nach einer solchen Einleitung dürfte man eigentlich erwarten, dass diese Komplimente eine Spur von Rechtfertigung erfahren und Valéry – warum nicht? – sein Verhältnis zu Bergson etwas näher ausführen würde. Diese Hoffnung aber gibt der Leser rasch auf, denn die Formel, die den nächsten Abschnitt einleitet, ist zu denen zu zählen, die man gewöhnlich für Kommentare zu nicht gelesenen Texten reserviert:
»Ich werde nicht auf seine Philosophie eingehen. Dies ist nicht der Augenblick, eine Untersuchung vorzunehmen, die gründlich sein soll und dies nur sein kann im Licht heller Tage und in der vollen Entfaltung des Denkens.«[18]
Es steht im Falle Valéry ganz zu befürchten, dass die Weigerung, auf Bergsons Philosophie einzugehen, keine Floskel ist, sondern wörtlich genommen werden muss. Und die Fortsetzung des Textes wirkt nicht gerade beruhigend, was Valérys Kenntnis seines Denkens betrifft:
»Die sehr alten und folglich sehr schwierigen Probleme, die Bergson behandelt hat, wie das Problem der Zeit, das des Gedächtnisses, und vor allem das der Entwicklung des Lebens, sind von ihm neu gestellt worden, und er hat damit die Lage der Philosophie, wie sie sich noch vor fünfzig Jahren in Frankreich darstellte, erstaunlich verändert.«[19]
Dass sich Bergson mit der Zeit und dem Gedächtnis auseinandergesetzt hat – welcher Philosoph hat das nicht? –, sagt noch nicht viel aus über sein Werk oder dessen Originalität. Lässt man die wenigen Zeilen über die Gegenüberstellung von Bergson und Kant außer Acht, bleibt der Text so vage, dass er sich zwar wunderbar auf Bergson anwenden lässt, genauso jedoch auf viele andere Autoren, die von diesen konventionellen hagiografischen Floskeln ebenso zutreffend beschrieben würden.
»Bergson, diese sehr erhabene, sehr reine, sehr überlegene Gestalt des denkenden Menschen – vielleicht einer der letzten Menschen, die ausschließlich, gründlich und überlegen gedacht haben werden in einer Epoche der Welt, da die Welt immer weniger denkt und nachsinnt, da die Zivilisation sich Tag um Tag mehr auf die Erinnerung zu beschränken scheint, auf die Reste, die wir von ihrem vielgestaltigen Reichtum und ihrer freien und überströmenden intellektuellen Produktion bewahren, während Elend, Angst, Zwang aller Art die Unternehmungen des Geistes beeinträchtigen oder behindern –, Bergson scheint bereits einem vergangenen Zeitalter anzugehören, und sein Name erscheint uns wie der letzte große Name in der Geschichte der europäischen Intelligenz.«[20]
Offensichtlich kann Valéry es nicht lassen, mit einer Gehässigkeit zu schließen, schafft es doch die freundliche Wendung »der letzte große Name in der Geschichte der europäischen Intelligenz« nur mit Mühe, die Härte der vorangehenden abzumildern, mit der Bergson charmant in ein »vergangenes Zeitalter« abgeschoben wird. Wenn man sie liest und Valérys Leidenschaft für die Bücher kennt, muss man annehmen, dass er die überholte Stellung des Philosophen innerhalb der Ideengeschichte vor allem zu Protokoll nimmt, um seine Werke nicht aufschlagen zu müssen.
∗
Diese Praxis der Kritik ohne Autor und Text hat nichts Absurdes an sich. Sie beruht bei Valéry auf einem fundierten Begriff von Literatur, dessen einer Hauptgedanke sagt, dass nicht nur der Autor, sondern auch das Werk überflüssig ist.
Das Unbehagen, das vom Werk ausgeht, muss als Erstes mit seinem allgemeinen Literaturbegriff in Verbindung gebracht werden, der mit dem zusammenhängt, was er in der Nachfolge von Aristoteles und anderer Poetik nennt. Tatsächlich geht es Valéry vor allem darum, die Hauptgesetze der Literatur aufzuzeigen. Von da aus wird eigentlich jeder Text suspekt, da er zwar als punktuelles Beispiel der Erarbeitung dieser Poetik dienen kann, gleichzeitig aber auch genau das ist, was beiseitegelassen werden muss, wenn man sich einen Überblick verschaffen will.
So könnte man William Marx folgen, wenn er feststellt, dass sich Valéry weniger für ein bestimmtes Werk als für seine »Idee« interessiert:
»So wie die universitäre Kritik versuchte, so viele Unterlagen wie möglich anzuhäufen und den außerliterarischen Quellen (Korrespondenzen, persönliche Dokumente usw.) eine besondere Bedeutung in ihrer Arbeit beimaß, so will eine Kritik im Sinne Valérys ihren Gegenstand so stark wie möglich eingrenzen, bis in ihrem Betrachtungsfeld nur noch das Werk selbst übrig bleibt, sogar weniger als das Werk: die einfache Idee des Werks.«[21]
Die Chancen, Zugang zu diesem »weniger als das Werk«, zu seiner Idee, zu bekommen, stehen besser, wenn man ihm nicht allzu nahe kommt, da man sonst Gefahr läuft, sich in seiner Besonderheit zu verlieren. Somit hat der Kritiker vielleicht die besten Erfolgsaussichten, das zu entdecken, was ihn interessiert, wenn er die Augen schließt vor dem Werk und sich, um über es hinauszugehen, vorstellt, was es sein könnte: das, was es nicht ist, sondern was es mit anderen gemeinsam hat. Demzufolge bedeutet jede allzu aufmerksame, wenn nicht sogar jede Lektüre ein Hindernis, den Gegenstand in seiner ganzen Tiefe zu erfassen.
Mit dieser Poetik der Distanz erfährt eine unserer gebräuchlichsten Beziehungsarten zum Buch durch Valéry eine rationale Begründung: das Querlesen. Tatsächlich ist es recht selten, dass wir ein Buch in der Hand haben, das wir von der ersten bis zur letzten Zeile lesen, falls eine solche Praxis überhaupt möglich ist. Meistens tun wir mit den Büchern das, was Valéry für seine Proust-Lektüre geltend macht: Wir lesen es quer.
Dieser Begriff des Querlesens kann auf mindestens zwei Arten verstanden werden. Im ersten Fall ist das Vorgehen linear. Der Leser beginnt den Text am Anfang, geht dann dazu über, Zeilen oder Seiten zu überspringen, und nähert sich langsam dem Ende, ob er es nun erreicht oder nicht. Im zweiten Fall ist das Vorgehen zirkulär, da der Leser nicht für eine geordnete Lektüre optiert, sondern im Buch herumschweift und unter Umständen sogar mit dem Ende beginnt. Diese Methode drückt genauso wenig wie die erste irgendeine Geringschätzung aus. Sie stellt ganz einfach eine der gängigen Beziehungsarten zu einem Buch dar und sagt noch nichts über die Meinung des Lesers aus.
Die Prägnanz dieser Aneignung erschüttert jedoch spürbar den Unterschied zwischen Lesen und Nichtlesen oder sogar den Begriff des Lesens selbst. In welche Kategorie soll man all jene einordnen, die eine bestimmte Zeit, gar Stunden mit einem Buch verbracht haben, ohne es vollständig zu lesen? Soll man, wenn sie darüber sprechen müssen, sagen, dass sie über ein Buch sprechen, das sie nicht gelesen haben? Eine vergleichbare Problematik stellt sich für all jene, die wie Musils Bibliothekar an der Peripherie des Buches stehen bleiben. Man kann sich fragen, wer von beiden der bessere Leser ist, derjenige, der ein Werk gründlich liest, ohne es einordnen zu können, oder derjenige, der sich in keines vertieft, aber über alle Bescheid weiß.
Wie man sieht, ist es nicht einfach – und das Ganze wird sich noch mehr zuspitzen –, genau zu bestimmen, was das Nichtlesen und mithin was das Lesen ist. Es scheint, dass wir uns gewöhnlich, jedenfalls was die Bücher betrifft, die uns innerhalb einer vorgegebenen Kultur begleiten, in einem Zwischenbereich bewegen, sodass man in den meisten Fällen gar nicht so leicht sagen kann, ob man sie gelesen hat.
∗
Genauso wie Musil regt auch Valéry dazu an, in Begriffen der kollektiven Bibliothek statt des einzelnen Buches zu denken. Für einen echten Leser, der die Literatur durchdringen möchte, zählt nicht das einzelne Buch, sondern die Ganzheit aller andern, und wenn man seine gesamte Aufmerksamkeit einem bestimmten unter ihnen schenkt, läuft man Gefahr, das Ganze aus dem Blick zu verlieren und damit das, was in jedem Buch an dieser umfassenderen Organisation teilhat, die uns erlaubt, es von Grund auf zu verstehen.
Doch Valéry schlägt vor, noch einen Schritt weiter zu gehen, wenn er uns auffordert, jedem Buch mit dieser Haltung zu begegnen und stets diesen Überblick anzustreben, der im Interesse einer Gesamtsicht auf alle Bücher liegt. Die Suche nach dieser Perspektive bedingt, dass man darauf achtet, sich nicht in einem einzelnen Abschnitt zu verlieren und also eine vernünftige Distanz zum Buch zu halten, die allein es ermöglicht, seine wahre Bedeutung einzuschätzen.
1 PAUL VALÉRY, Œuvres I, QB +, Paris 1957, S. 1479
2 EB +
3 UB und EB ++
4 PAUL VALÉRY, Werke, Frankfurter Ausgabe in 7 Bänden, Band 3, Zur Literatur, 1989, S. 421
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid., S. 424, Hervorhebungen vom Autor
9 Ibid., S. 426
10 Ibid., S. 353f.
11 Ibid., S. 362
12 Ibid., S. 362f.
13 Ibid., S. 370
14 Ibid., S. 372
15 Ibid., S. 373
16 Ibid., S. 151
17 Ibid.
18 Ibid., S. 152
19 Ibid.
20 Ibid., S. 154f.
21 WILLIAM MARX, Naissance de la critique moderne, UB +, Arras 2002, S. 25