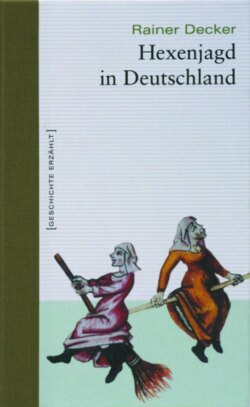Читать книгу Hexenjagd in Deutschland - Rainer Decker - Страница 6
Rom 1657 — Der päpstliche Kämmerer wundert sich
ОглавлениеFerdinand von Fürstenberg, Geheimkämmerer Papst Alexanders VII., dürfte nicht wenig gestaunt haben, als ihn Mitte August 1657 in Rom ein dickes Briefpaket aus seiner Heimat Westfalen erreichte. Absender war der Fürstbischof von Paderborn, Dietrich Adolf von der Recke. Die beiden Geistlichen kannten sich persönlich. Fürstenberg war einer der 24 Domherren in Paderborn. Dieses Amt konnte er zwar faktisch nicht ausüben, da er sich seit 1652 in Italien aufhielt. Aber einen vertrauenswürdigen Landsmann in einflussreicher Position beim Vatikan zu haben, war damals und ist noch heute für einen Diözesanbischof von Vorteil.
Der Fürstbischof von Paderborn brauchte dringend Hilfe, genauer, einen guten Rat. In seinem Bistum war nämlich buchstäblich der Teufel los. Hunderte von Besessenen, meist weibliche Jugendliche, aber auch Männer, machten die Straßen unsicher. Bei ihren Anfällen behaupteten sie, Teufel hätten von ihnen „Besitz“ ergriffen, und dies sei die Schuld von Hexen, die ihnen die Dämonen in den Leib gezaubert hätten. Sie würden die Plagegeister erst los, wenn die Schuldigen vor Gericht gestellt und am Ende auf Scheiterhaufen verbrannt würden. Erste Handgreiflichkeiten gegen die vermeintlichen Hexen waren Vorboten einer drohenden Lynchjustiz – für den Fall, dass der Landesherr, Dietrich Adolf, nicht schleunigst seinen Richtern gestattete, eine großangelegte Verfolgung in die Wege zu leiten. Für Hexenprozesse war Dietrich Adolf nicht in seiner Eigenschaft als Bischof zuständig, sondern als weltlicher Landesherr. Denn Schadenzauber, der Kern der Hexerei, wurde in Deutschland in der Neuzeit aufgrund staatlichen Rechts verfolgt. Nur im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gab es, wenn man vom Kirchenstaat des Papstes in Italien absieht, geistliche Fürstentümer mit Erzbischöfen, Bischöfen, Äbten oder Äbtissinnen an der Spitze, die zusätzlich zu ihrer Funktion als geistliche Oberhirten auch Landesfürsten waren, wenngleich sie natürlich ihr Amt nicht, wie die Kurfürsten, Herzöge und Grafen, vom Vater erbten, sondern gewählt wurden.
Der Bischof zögerte. Nicht, dass er grundsätzlich den Glauben an Hexen in Zweifel gezogen hätte. Aber verbarg sich in den angeblich Besessenen wirklich der Teufel? Waren es nicht vielmehr, wie manche seiner Berater glaubten, Simulanten, die auf sich aufmerksam machen wollten, die auf Mitleid, aber auch handfeste Vorteile in Form von Almosen und Geschenken spekulierten? Und gesetzt den Fall, die Dämonen hatten sie tatsächlich unter ihrer Fuchtel, war dann sicher, dass sie die Wahrheit sagten, wenn sie bestimmte Personen als Hexen denunzierten? Wollte der Teufel, der Vater der Lügen, nicht Unschuldige ins Verderben stürzen? Steckten die Besessenen nicht mit den Dämonen unter einer Decke, waren sie, statt Opfer zu sein, in Wirklichkeit Mittäter, Verbündete des Teufels, Hexen?
Ferdinand von Fürstenberg war, seitdem im Winter 1656/57 der Bischof und Landesherr Dietrich Adolf von der Recke sich zum ersten Mal in dieser Angelegenheit an ihn gewandt hatte, in Grundzügen über die Entwicklung in der fernen westfälischen Heimat informiert.
Wie sein Briefpartner bezweifelte er nicht, was seit dem Spätmittelalter viele Christen in Europa glaubten: Es gibt Menschen, hauptsächlich Frauen, die einen Pakt mit dem Teufel schließen. Sie wenden sich von Gott, seinen Heiligen und seiner Kirche ab und verschreiben stattdessen ihre Seele dem Satan, dem sie sich auch sexuell hingeben. Als Gegenleistung erhalten sie übermenschliche Fähigkeiten. Sie können fortan, nachdem sie sich mit einer geheimnisvollen Salbe eingeschmiert haben, auf Mistgabeln, Besen, Ziegenböcken usw. durch die Lüfte reiten, vornehmlich zum Hexensabbat, einem großen Treffen vieler Hexen und Dämonen, einer gewaltigen Orgie, auf der Böses ausgeheckt wird, Unwetter, Brandstiftungen, vor allem aber Anschläge auf Menschen und Tiere, mit Hilfe von Gift, das die Teufel ihren Anhängern geben. Das Gift wird, so glaubte man, der Nahrung beigemischt, und so können auch Dämonen in die Körper der Menschen gelangen.
Vorurteil 1: Mittelalterlicher Hexenwahn
Das Mittelalter, die Zeit von ca. 500 bis 1500, war nicht so finster wie sein Ruf. Schädigende Magie, oder was man dafür hielt, wurde zu allen Zeiten und in allen Kulturen verfolgt, schon in der Antike und noch heute in Afrika. Prozesse gegen Hexen im engeren Sinne gab es erst seit dem 15. Jahrhundert, also dem ausgehenden Mittelalter. Die meisten Hinrichtungen fanden zwischen 1560 und 1700 statt, in der Neuzeit. Richtig ist lediglich, dass das neue Bild der Hexe mit den Elementen Zauberei, Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Hexenflug und -sabbat in dieser Konzentration im Spätmittelalter entstand.
Wer die Möglichkeit von Hexerei bestritt, wurde als Ketzer verfolgt. 1592 versuchte der aus Holland stammende Geistliche Cornelius Loos, in Köln ein Buch gegen den Hexenglauben an sich zu veröffentlichen. Während des Drucks wurde der päpstliche Nuntius darauf aufmerksam. Er ließ die ersten Exemplare beschlagnahmen, Loos verhaften und zwang ihn zu einem feierlichen Widerruf.
Ferdinand von Fürstenberg hatte um so weniger Zweifel, als seine Familie führend an dem Versuch, dieses teuflische Laster auszurotten, beteiligt gewesen war. 1626 geboren, war er nicht nur während des Dreißigjährigen Krieges, sondern zur Zeit der größten Hexenverfolgungswelle überhaupt aufgewachsen. Sie suchte zwischen 1626 und 1631 vornehmlich die geistlichen Fürstentümer in Deutschland heim, mit Hunderten von Toten allein schon in Ferdinands Heimat, dem Sauerland. Der damalige Landesherr war sein Taufpate, dem er den Vornamen verdankte: der Kölner Erzbischof und Kurfürst Ferdinand von Bayern. Der Vater des kleinen Ferdinand, Friedrich von Fürstenberg, war als oberster Beamter (Landdrost) des Territoriums sowie als Inhaber adliger Unterherrschaften mitverantwortlich für die Massenverfolgung jener Jahre. Der Zeitgeist konnte aber nicht jeden verblenden. Um 1630, auf dem Höhepunkt der Hexenjagd im katholischen Deutschland, schrieb Friedrich Spee, Jesuit und Theologieprofessor an der Universität seines Ordens in Paderborn, die berühmte Kampfschrift gegen die Hexenprozesse, Cautio Criminalis. Sie erschien 1631 in erster und ein Jahr später in zweiter Auflage.
Spee war deswegen Anfeindungen innerhalb seines Ordens und von Seiten anderer einflussreicher Katholiken ausgesetzt. Aber sein Vorgesetzter, der in Köln ansässige Provinzial der norddeutschen Jesuitenprovinz, Pater Goswin Nickel, hielt die schützende Hand über ihn. Er nahm den Ordensbruder aus der Schusslinie, der er im Rheinland und in Westfalen ausgesetzt war, und versetzte ihn nach Trier, wo Spee, ein bedeutender Seelsorger und Dichter, 1636 im Alter von 45 Jahren an einer Seuche starb, die er sich bei der Pflege und Betreuung kranker Soldaten zugezogen hatte.
Römische Verbindungen
Pater Nickel stieg 1652 zum Generaloberen des Jesuitenordens auf, mit Sitz in Rom. Auch er wurde 1656/57 über die bestürzenden Ereignisse in Paderborn informiert und beriet sich deswegen mit dem jungen Herrn von Fürstenberg. Dieser dürfte zwar Spee nicht mehr persönlich kennen gelernt haben, besaß aber ein Exemplar der Erstausgabe der Cautio Criminalis. Argumente gegen die blindwütige Verfolgungsmentalität, die in Deutschland vorherrschte, konnte der Paderborner Domherr in Rom reichlich gewinnen. Dort verbrachte er zwischen 1652 und 1661 die schönsten Jahre seines Lebens. Er verdankte sie seiner Bekanntschaft mit Fabio Chigi, dem in Köln residierenden päpstlichen Nuntius.
Der hochbegabte, literarisch und wissenschaftlich äußerst interessierte Ferdinand von Fürstenberg, der in Köln die Universität besuchte, machte den Italiener durch kunstvolle lateinische Gedichte, die er ihm widmete, auf sich aufmerksam. Der junge Mann teilte mit dem späteren Papst die Liebe zur lateinischen Sprache und Literatur sowie zur Geschichte.
Im Jahr 1651 wurde Fabio Chigi als Staatssekretär von Papst Innozenz X. nach Rom berufen, ein Jahr später folgte die Erhebung in den Kardinalsstand. Darauf lud er Ferdinand von Fürstenberg, der inzwischen Paderborner Domherr geworden war, nach Rom ein, wo Ferdinand bald zu dem Gelehrtenkreis gehörte, den der Kardinalstaatssekretär um sich versammelte. In diesen Jahrzehnten war die Metropole am Tiber das große Kulturzentrum des europäischen Barock. Neben Francesco Borromini prägte vor allem Lorenzo Bernini das Stadtbild bis heute u. a. durch die Gestaltung des Petersplatzes mit den berühmten Kolonnaden, mit der Piazza Navona usw. Nach der Wahl Fabio Chigis zum Papst (Alexander VII.) im April 1655 avancierte Ferdinand zu einem seiner Geheimkämmerer, zuständig für deutsche Angelegenheiten.
„Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen“
Aufgrund seiner Stellung stand Ferdinand von Fürstenberg die Vatikanische Bibliothek offen. Hier konnte er seinen wissenschaftlichen Neigungen frönen. So fand er in einer Abschrift das in Vergessenheit geratene Gesetz Karls des Großen über die besiegten Sachsen aus der Zeit um 780. Darin stand u. a.: „Wenn jemand, nach Art der Heiden, getäuscht durch den Teufel, glauben würde, dass irgendein Mann oder eine Frau eine striga [blutsaugende Hexe] sei und Menschen verzehre, und sie deswegen verbrenne oder deren Fleisch zum Essen gibt oder sie selbst isst, wird er mit der Todesstrafe bestraft werden. Wenn einer einen Menschen dem Teufel geopfert und nach Art der Heiden den Dämonen angeboten hat, der möge des Todes sterben.“1 Hier wurden nicht etwa Hexen mit der Todesstrafe bedroht, sondern diejenigen, die solche tatsächlich unschuldigen Zeitgenossen umbringen und sich ihre „magischen“ Fähigkeiten durch Verzehren ihres Fleisches einverleiben wollten. Karl der Große ging somit, von seinen Theologen beraten, massiv gegen den heidnisch-germanischen Hexenglauben und Kannibalismus vor.
Das ist typisch für die Kritik der frühmittelalterlichen Kirche am heidnischen „Aberglauben“. Magie, weiße, heilende, und schwarze, schädigende, war und ist in vielen Kulturen verbreitet. Schon einige der frühesten Schriftzeugnisse der Menschheit, babylonisch-assyrische Keilschrifttexte, haben die Bekämpfung von gesundheitsschädlichem Zauber zum Thema. Ähnliches gilt für Ägypten. Dies spiegelt sich noch im Alten Testament in der Erzählung vom Aufbruch des Volkes Israel aus der Knechtschaft in Ägypten ins Gelobte Land wider. „Und der Herr sprach zu Moses: Das Herz des Pharao ist hart; er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh hin zum Pharao morgen früh […] und sprich zu ihm […] ‚Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, auf das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden.‘ […] Und alles Wasser im Strom wurde zu Blut verwandelt […] Und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. So wurde das Herz des Pharao verstockt und er hörte nicht auf Moses.“ (Ex 7, 15–22, Lutherübersetzung)
Als Theologe kannte Ferdinand von Fürstenberg auch die einschlägigen Strafbestimmungen im Alten Testament: „Wenn ein Mann oder eine Frau Geister beschwören oder Zeichen deuten kann, so sollen sie des Todes sterben; man soll sie steinigen; ihre Blutschuld komme über sie.“ (Lev 20, 27) Für die Geschichte der Hexenverfolgungen war langfristig bedeutsamer die berühmte Stelle im 2. Buch Moses (Ex 22, 17), die Luther übersetzt: „Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen.“ Der Begriff im Originaltext, Mechaschepha, meint eindeutig Frauen. In der für die katholische Kirche maßgeblichen lateinischen Übersetzung aus der Spätantike, der Vulgata, steht dagegen: „maleficos non patieris vivere“ – die Zauberer sollst du nicht leben lassen.
Im Neuen Testament werden Frauen nicht mit Magie in Verbindung gebracht. Dem neugeborenen Jesus huldigen männliche Magier (magoi), die weisen Sterndeuter aus dem Osten, die später zu den Heiligen Drei Königen umgedeutet wurden. An vielen Stellen der Evangelien und der Apostelgeschichte kommen böse Geister vor, stumme oder redende. Sie kennen, anders als die Menschen, verborgene Dinge, hier die wahre Natur von Jesus, weshalb er ihnen zu schweigen gebietet. Jesus treibt die bösen Geister aus und gibt seine Macht über sie weiter: „Und er rief die Zwölf zu sich und hob an und sandte sie je zwei und zwei und gab ihnen Vollmacht über die unsauberen Geister […] Sie gingen aus und predigten, man sollte Buße tun, und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund.“ (Mk 6, 12) Auch Paulus verfügte über diese Gabe des Exorzismus.
Magische Praktiken und ihre Bestrafung
Hexen, wie sie sich die Menschen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit vorstellten, gab es in der Antike nicht, aber zahlreiche Formen von Magie. In der agrarisch geprägten frühen römischen Republik legte das Zwölftafelgesetz (um 450 v. Chr.) die Todesstrafe für Erntediebstahl mit zauberischen Mitteln fest. Als mit dem Aufstieg Roms zur Weltmacht die städtische Bevölkerung und damit auch die Gewaltverbrechen zunahmen, sah ein Gesetz des Diktators Sulla (81 v. Chr.) die gleiche Strafe für Giftmischer, -händler und Zauberer vor. Auch die Gesetze der Kaiser, sowohl der heidnischen als auch der christlichen, richteten sich gegen Schadenzauber, besonders Giftmischerei. Darüber hinaus wurde verbotene, nämlich nicht von den staatlichen Priestern praktizierte Wahrsagekunst, verfolgt, besonders wenn sie den Kaiser, z. B. den künftigen Zeitpunkt seines Todes, zum Gegenstand hatte und damit dessen Autorität untergrub.
Die Folter durfte in Strafprozessen gegen freie römische Bürger nur in Ausnahmefällen angewandt werden. Sie schloss aber Magier ein. Einem haruspex, einem Astrologen oder Wahrsager, der verbotene Künste (z. B. Traumdeutung) ausübte, wurde im kaiserlichen Recht der Tod auf dem Scheiterhaufen angedroht.
Folter und Feuerstrafe für Zauberer sind also keine Erfindung des Mittelalters, sondern der Antike. Magie galt als okkultes, besonders gefährliches Verbrechen. Die Sicherungen des üblichen Strafprozesses zur Vermeidung von Fehlurteilen wurden aufgehoben, und die Abscheu vor den finsteren Tätern legitimierte eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden überhaupt. In der Praxis dürften aber solche Prozesse selten gewesen sein.
Stärker als bei den Römern war bei den Germanen der Glaube an blutsaugende und menschenfressende Frauen verbreitet. Darüber hinaus wirkte sich langfristig für die Entstehung des Hexenbegriffes der Glaube aus, Frauen flögen nachts durch die Luft, um sich mit ihresgleichen zu treffen und bestimmte Handlungen durchzuführen. Diese Vorstellung fand sich noch im 16. und 17. Jahrhundert im italienisch-slowenischen Grenzraum bei den Benandanti, den „gut Wandelnden“. Die betreffenden Männer und Frauen behaupteten, zu gewissen Zeiten im Jahr, besonders während der Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, verließen sie im Geist ihren Körper, flögen durch die Lüfte, bewaffneten sich mit Fenchelstengeln und kämpften damit gegen die Hexen, die mit Hirsestengeln ausgerüstet seien. Damit wollten sie einen guten Ausgang der Ernten erreichen, den die Hexen zu verhindern trachteten. Benandanti könnten nur die sein, die mit einer „Glückshaube“ geboren seien, d. h. mit der Fruchtblase auf die Welt kämen.
Die mittelalterliche Kirche bestritt die Vorstellung, dass bestimmte Frauen fliegen könnten. Noch Juristen und Kirchenjuristen der Frühen Neuzeit kannten den Rechtsgrundsatz, der im 11. Jahrhundert zum ersten Mal formuliert und dann ins kanonische Recht aufgenommen worden war: „Gewisse verbrecherische Frauen, die rückwärts, nach Satan hin, gewandt sind, […] glauben und behaupten von sich, von Illusionen und Wahngebilden der Dämonen verführt, dass sie in nächtlichen Stunden mit der Diana, der Göttin der Heiden, und einer unzähligen Menge von Frauen auf gewissen Tieren reiten und viele Länderstrecken in der Stille einer tiefen, totenstillen Nacht durchqueren und dass sie ihren Befehlen wie denen einer Herrin gehorchen und in bestimmten Nächten zu ihrem Dienst herbeigerufen werden […] Die Priester sollen mit allem Nachdruck predigen, dass diese Auffassung gänzlich falsch ist und dass nicht vom göttlichen, sondern vom bösen Geist solche Wahngebilde über den Sinnen der Ungläubigen vorgespiegelt werden. Folglich ist es Satan selbst, der sich in einen Lichtengel verwandelt […] Wer ist denn nicht schon in Träumen und nächtlichen Visionen aus sich selbst hinausgeführt worden und hat viele Dinge im Schlaf gesehen, die er zuvor niemals im Wachen gesehen hatte.“2
Es gibt im mittelalterlichen Kirchenrecht aber auch Stellen, in denen die Wirksamkeit der magischen Praktiken unterstellt wird: „Schadenszauberer oder Beschwörer oder Verursacher von Unwettern oder wer durch Anrufung der Dämonen die Sinne der Menschen verwirrt, sollen mit allen Arten von Strafen belangt werden.“3
Die ambivalente Beurteilung von „Aberglauben“ und Magie, als eingebildet oder real existierend, spiegelt eine uneinheitliche Haltung kirchlicher Gremien wider. Einig war man sich im Klerus, dass gegen den „Aberglauben“ mit Kirchenbußen vorgegangen werden musste. Die schärfste Form der Kirchenstrafe war der Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft und damit der Gesellschaft überhaupt. Für die vielen leichteren Fälle, wozu auch Magie zählte, gab es ein breites Repertoire von Bußen, bei schwereren Vergehen die Pflicht zu einer kostspieligen und möglicherweise gefährlichen Wallfahrt und – am häufigsten – das Fasten über einen bestimmten Zeitraum. Ein eherner Grundsatz des Kirchenrechts lautete, dass ein reumütiger und nicht rückfälliger Sünder Anspruch auf Milde, die Chance zur Besserung hatte. Dieses modern klingende Prinzip, das auf Resozialisierung verweist, fehlte im weltlichen Recht. Hier waren, wie schon im römischen Staat, Leibesstrafen an der Tagesordnung, bis hin zum Verbrennen von Zauberern.
Das weltliche Recht des Mittelalters kannte also, wie schon das der Römer, bei Schadenzauber kein Pardon. Es verhängte, insbesondere wenn sich der Zauber gegen Gesundheit und Leben von Menschen richtete, die Todesstrafe durch Verbrennen bei lebendigem Leibe. Nicht aus dem römischen Recht stammt die so genannte Wasserprobe. Sie ist mit den christlichen „Gottesurteilen“ vergleichbar. Man glaubte, wenn die Frauen mit Dämonen im Bunde wären und daher fliegen könnten, würden sie von dem natürlichen Element, dem Wasser, abgestoßen und daher – sogar gefesselt – an der Oberfläche schwimmen.
Die relativ moderate Behandlung der superstitio (Aberglaube) durch die Kirche hängt auch damit zusammen, dass ihr der Gedanke an eine Verschwörung von Teufelsanbetern, eine Sekte von Hexen, zunächst fremd war. Aber Ansätze in dieser Richtung waren gegeben: Zum einen durch die Verfolgung der Juden, die aufgrund der Pestwellen seit 1348 als Sündenböcke („Brunnenvergifter“) herhalten mussten, zum Zweiten durch die Verfolgung zweier Gegenbewegungen gegen die etablierte Kirche, die im 13. Jahrhundert aufgekommen waren: Katharer und Waldenser. Ihnen wurde die Verehrung des Satans unterstellt, wobei sie ihm Opfer darbrächten, ihn anbeteten und mit ihm und ihresgleichen Geschlechtsverkehr hätten. Dies wird auch sprachlich deutlich, indem die im ostfranzösischen Sprachraum gebräuchlichen Wörter vaudoisie und vauderie, Waldensertum, verallgemeinert im Sinne von Ketzertum, seit 1430 nahtlos in die Bedeutung „Hexerei“ übergingen. Im Deutschen wirkte sich die Entstehung des neuen Hexenbildes dadurch aus, dass – von der deutschsprachigen Schweiz ausgehend – langsam an die Stelle des vorherrschenden Wortes „Zauberer, Zauberin“ (niederdeutsch toverer, toversche), das den Schadenzauber in den Mittelpunkt stellte, die „Hexe“ trat.
Hexenverfolgungen in deutschen Landen
Die neue Hexensekte war die Kopfgeburt gelehrter Juristen und Theologen. Sie beließen es nicht bei der praktischen Verfolgung der Teufelsdiener, sondern brachten ihr Gedankengebäude in „wissenschaftlichen“ Abhandlungen zu Papier, so dass man hier durchaus den modernen Begriff der „Ideologie“ anwenden kann. Das bekannteste Beispiel ist der „Hexenhammer“ (Malleus Maleficarum), ein Handbuch für Hexenrichter, verfasst von dem päpstlichen Inquisitor Heinrich Institoris (Kramer), das 1487 im Druck erschien und bis ins 17. Jahrhundert zahlreiche Neuauflagen erlebte.
Während das kirchliche Strafrecht den Abfall vom Glauben, in Form des Paktes mit dem Dämon, in den Vordergrund rückte, blieb das weltliche Recht auf den Schadenzauber konzentriert. Die für mehrere Jahrhunderte im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation maßgebliche Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. aus dem Jahr 1532 legte in Artikel 109 fest: „Item so jemand den Leuten durch Zauberei Schaden oder Nachteil zufügt, soll man strafen vom Leben zum Tod. Und man soll solche Straf mit dem Feuer tun.“ Luthers Reformation hat in der juristischen und in der theologischen Einschätzung des Hexenglaubens nicht viel geändert. Schadenzauber war für den Wittenberger Reformator ein todeswürdiges Verbrechen. Wie die meisten mittelalterlichen Theologen hielt er dagegen nichts von der Vorstellung des Hexenflugs und -sabbats: „Glauben viel, sie ritten auf einem Besen oder auf einem Bock oder sonst auf einem Eselskopf zu einem Ort, wo alle zusammenkommen, die in der geheimen Zunft sind, prassen und schlemmen miteinander nach Gutdünken, was verboten ist, nicht nur zu tun, sondern auch zu glauben, dass etwas daran sei.“4
Die Position der römisch-katholischen Kirche unterschied sich in dieser Hinsicht nur wenig von der Martin Luthers. Dessen Gegenspieler, Kurien-Kardinal Cajetan (1468– 1534), der den Reformator 1518 in Augsburg verhörte, schrieb in seinem Kommentar zu den Werken des hl. Thomas von Aquin: „Mit Erlaubnis Gottes führt der Teufel bisweilen Personen mit ihrem Willen (durch die Luft) von Ort zu Ort. Aber dies scheint sehr selten zu geschehen.“5
Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts gab es in Deutschland keine großen Hexenverfolgungen, d. h. zusammenhängende Prozessserien an einem Gericht mit mehr als 15–20 Angeklagten. Ob die Zeitgenossen zwischen 1520 und 1550 mehr von den religiösen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten in Atem gehalten wurden als von der Angst vor Zauberern und Hexen? Es fällt auf, dass der Hexenhammer nach 1523 für mehrere Jahrzehnte nicht mehr neu aufgelegt wurde.
1555 sicherte der Augsburger Religionsfrieden bis zum Dreißigjährigen Krieg ein labiles Gleichgewicht zwischen den konkurrierenden religiösen Kräften. Sieben Jahre später beginnt das Zeitalter der großen Hexenverfolgungen in Deutschland mit 63 Hinrichtungen in der südwestdeutschen Grafschaft Helfenstein (zwischen Stuttgart und Ulm). Die Hysterie wirkt in den 70er und 80er Jahren auf Westfalen und Norddeutschland ansteckend. Eine Massenpanik muss die protestantische Stadt Osnabrück ergriffen haben, wo 1583 sage und schreibe 121 Personen, fast ausschließlich Frauen, hingerichtet werden. Ende der 80er Jahre wurde das katholische Erzbistum Trier von einer noch größeren Angst heimgesucht. Auslöser war plötzlicher eintretender Frost, der die Weinernte vernichtete. Auf der Suche nach Sündenböcken stellte sich der Weihbischof Dr. theol. Peter Binsfeld an die Spitze der Verfolger. Die Lehre von Hexenflug und -sabbat, der Glaube an eine verschwörerische Hexensekte, führte zu lawinenartig ansteigenden Prozess- und Opferzahlen.
Hexenprozesse
Auch wenn sich viele Akademiker von dieser Hysterie anstecken ließen – unumstritten war die Hexenverfolgung nie. Aber im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts behielten in Deutschland die Verfechter eines harten Kurses die Oberhand. Katholische und evangelische Verfolgungsbefürworter bestätigen sich in ihrer Meinung trotz konfessioneller Feindschaft. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war bekanntlich territorial stark zersplittert. Die vielen Kurfürstentümer, Herzogtümer, Grafschaften, geistlichen Fürstentümer und freien Reichsstädte waren in Justizsachen unabhängig. Die Halsgerichtsordnung Karls V. bot nur einen Rahmen. Die Landesherren konnten eigenes Recht schaffen und sich von der herrschenden Lehre absetzen oder sie weiterentwickeln. Innerhalb der Territorien gab es adlige Unterherrschaften, deren Inhaber die Strafgerichtsbarkeit in eigenem Namen ausübten. Neben die Schöffen, die den führenden Bauern- oder Bürgerfamilien entstammten, beriefen sie studierte Juristen als Berater. Deren Einstellung zu Hexenwesen und -prozess war unterschiedlich. Sie hing von der eigenen Biographie, der Prägung in Elternhaus und Schule, insbesondere aber dem Universitätsstudium ab.
Eine Kontrolle der Untergerichte durch höhere Instanzen war nicht durchgängig gegeben. Es gab zwar zwei oberste Reichsgerichte, das Reichskammergericht in Speyer und den Reichshofrat in Wien. Für Strafsachen waren sie aber nur in Ausnahmefällen zuständig, wenn nämlich der Angeklagte glaubhaft machte, dass das Gericht gegen elementare Grundsätze verstoßen, ihm also das Recht geradezu verweigerte hatte. Wenn auf diese Weise die beiden Obergerichte angerufen wurden, entschieden sie auffallend oft für die „Hexen“.
Die meisten Verfahren kamen aber gar nicht erst ins ferne Speyer oder Wien. Öfter wurden dagegen die Prozessakten, d. h. die Verhöre der Zeugen und Angeklagten sowie die Anträge des Anklägers und wenn vorhanden, des Verteidigers, an juristische Universitätsfakultäten zur Begutachtung eingeschickt. Vielfach entschieden die Professoren im Sinne ihrer „Kunden“, also der Gerichte, gegen die Angeklagten.
Die Landkarte der Hexenprozesse in Deutschland zeigt Konzentrationen in Gebieten mit relativ gering entwickelter Staatlichkeit, den Kleinterritorien West- und Südwestdeutschlands, und in denjenigen der größeren Länder, wo Adel und Städte die Strafgerichtsbarkeit in eigener Regie ausübten, wie z. B. im stark vom landsässigen Adel geprägten Mecklenburg mit ca. 2000 Hinrichtungen. Großterritorien mit einem entwickelten Instanzenzug und einem professionellen Justizsystem zeigten eher unterdurchschnittliche Werte, so die evangelisch-reformierte Kurpfalz, wo es kaum Hinrichtungen gab, und das lutherische Kursachsen, das „nur“ einige hundert Hinrichtungen aufzuweisen hat, was bei der hohen Bevölkerungszahl vergleichsweise wenig war.
Vorurteil 2: Millionen Hingerichtete
Seit einem Zeitungsartikel von 1784 geistern Zahlen von Millionen Opfern der europäischen Hexenverfolgung durch die Gazetten. Der Verfasser hatte einen zufälligen lokalen Befund (30 Hinrichtungen in einem deutschen Kleinterritorium Ende des 16. Jahrhunderts) durch simple Hochrechnung mit Hilfe des Dreisatzes zu 9 442 994 Hinrichtungen im christlichen Europa zwischen 600 und 1700 aufgeblasen. Die Rechenspielerei ist grotesk – das hätte schon damals jedem kritischen Herausgeber auffallen müssen. Stattdessen wurde der Artikel noch 1784 sowie acht Jahre später erneut abgedruckt. Die seriöse Forschung hat es schwer, die lieb gewordenen Vorurteile der vermeintlichen ‚Aufklärer‘ richtigzustellen. Sie hält weniger als 100 000 Hinrichtungen in Europa für wahrscheinlich, wovon ungefähr die Hälfte auf das Heilige Römische Reich Deutscher Nation entfällt.
Das größte katholische Territorium – abgesehen von den österreichischen Landen –, Bayern, bestätigt diesen Trend. Herzog Maximilian I. (reg. 1597–1651) ließ keine Massenprozesse mehr zu. So war Bayern innerhalb des katholischen Deutschlands eines der Gebiete mit relativ wenig Hinrichtungen. Anders sah es in den Territorien von Maximilians Bruder Ferdinand aus, Erzbischof von Köln und Bischof von Paderborn. Die Gratwanderung zwischen frommem Verfolgungseifer und einigermaßen fairen, an der kaiserlichen Halsgerichtsordnung orientierten Verfahrensgrundsätzen – z. B. lehnte er die Wasserprobe ab – gelang ihm nicht. Denn anders als sein Bruder Maximilian im zentralistisch regierten Herzogtum Bayern stieß Ferdinand im Rheinland und in Westfalen auf Mitspracherechte und Vernetzungen der adligen und juristischen Eliten, an denen die halbherzigen Versuche, Missstände abzustellen und Fanatikern das Handwerk zu legen, abprallten.
Erst eine neue Generation von Fürsten in Deutschland besann sich eines Besseren. Innerhalb des Episkopates ist der Würzburger und Wormser Bischof sowie Mainzer Erzbischof Johann Philipp von Schönborn (geb. 1605, reg. in Mainz 1647– 1673) hervorzuheben. Nach einer Anekdote, die der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1717) erzählt, hatte Schönborn, damals noch als junger Domherr, Pater Friedrich Spee kennen gelernt und war von ihm über das unmenschliche Wesen der Hexenprozesse aufgeklärt worden. Daher habe er nach seinem Amtsantritt in Mainz alle Hexenprozesse in dem Erzbistum untersagt. Zwar ist weder die Echtheit dieser Erzählung verbürgt noch ein entsprechender Erlass in Hexensachen; an der moderaten Haltung Schönborns in dieser heiklen Frage kann aber kein Zweifel bestehen. Im Kurfürstentum Trier beendete Erzbischof Karl Kaspar von der Leyen um 1653 weitere Verfolgungen.
Nicht alle Gerichtsinhaber und Juristen schlossen sich dieser skeptischen Haltung an. So unentschieden war auch die Lage im Hochstift Paderborn in jenem Jahr 1657, als sich Bischof Dietrich Adolf hilfesuchend an Papst und Kardinäle in Rom wandte.