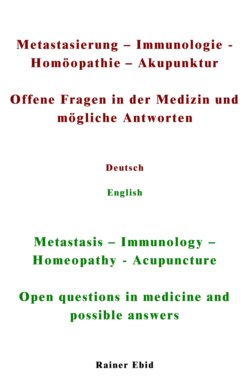Читать книгу Metastasierung-Immunologie-Homöopathie-Akupunktur Offene Fragen in der Medizin und mögliche Antworten Deutsch English Metastasis-Immunology-Homeopathy-Acupuncuture Open questions in medicine and possible answers - Rainer Ebid - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеImmunologie und Nervensystem
Das Immunsystem ist phylogenetisch alt. Im Zuge eines komplexerwerdenden Organismus ist eine Organisation und Strukturierung, zur effektiven Nutzung des Immunsystems, notwendig.
Das Nervensystem hat die notwendige Ausstattung, um dieser Anforderung gerecht zu werden.
Fakten und Gedanken:
(1) Antigene werden durch dendritische Zellen in Lymphknoten präsentiert. Lymphknoten sind innerviert, ebenso wie das Knochenmark. Immunologische (Stamm-) Zellen finden sich im Knochenmark.
(2) Das Nervensystem ist, neben dem Blutgefäßsystem und dem Lymphgefäßsystem, eines der großen Transportsysteme des Körpers. Neben dem Transport von Informationen, in Form elektrischer Signale, gibt es die Möglichkeit Substanzen zu transportieren. Der retrograd axonale Transport erfolgt von der Peripherie in Richtung ZNS (zentrales Nervensystem), der anterograd axonale Transport in Gegenrichtung, also vom ZNS in die Peripherie. Während der retrograd axonale Transport beispielsweise mittels des Actin- oder Dyneinsystems erfolgt, nutzt der anterograd axonale Transport beispielsweise das Kinesinsystems. Der retrograd axonale Transport ist für den Transport von Tetanustoxin bekannt und steht möglicherweise im Zusammenhang mit der Genese des Morbus Parkinson. Der Transport kann langsam oder schnell, mit bis zu 41 cm pro Tag, erfolgen.
Im Gegensatz zum Blut- oder Lymphgefäßsystem kann das Nervensystem sehr zielgerichtet leiten.
(3) Das Nervensystem besitzt die Grundlagen für Lernen und Gedächtnis.
Sowohl das Lernen als auch das Gedächtnis ist zur Speicherung von Erfahrungen, beispielsweise nach Erstkontakt mit einem Antigen, notwendig. Der Mechanismus der Immunisierung im Rahmen einer Impfung deutet auf einen Lernprozess hin. Im Rahmen der Primärdosis wird die Information bezüglich eines bestimmten Antigens übermittelt, wodurch ein gewisser Schutz entsteht. Durch das Boostern, also die Wiederholung der Antigenexposition und damit der Antigeninformation, wird der Lerneffekt verbessert, so dass der Schutz nachhaltiger wird. Allgemein führt beim Lernen eine wiederholte Präsentation des Lerninhaltes zu einem besseren Lerneffekt.
Eine Möglichkeit des Lernens auf der Ebene des ZNS (zentrales Nervensystem) besteht mit Hilfe der neuronalen Plastizität.
(4) Es wurden Impfungen nach experimentellem Schema durchgeführt. Das Boostern, also die Impfverstärkung, erfolgte in diesem Fall nicht durch eine erneute Gabe des Impfstoffes, sondern auf der Grundlage der klassischen Konditionierung, mit einem konditionierten (gustatorischen) Reiz. Der Boostereffekt war in diesem Experiment nicht so stark wie bei konventioneller zweiter Antigenexposition, jedoch vorhanden.
(5) Im Rahmen depressiver Verstimmungen ist ein negativer Einfluss auf die Immunabwehr bekannt. Die Amygdala, ein Gehirnkern und Teil des limbischen Systems im ZNS (zentrales Nervensystem), welche mit Angst und anderen Emotionen assoziiert ist, wird als dem Immunsystem vorgeschaltet beschrieben. Asthmaanfälle können durch klassische Konditionierung, wie den Anblick eines Bildes mit Wiesenblumen, getriggert werden. Hier ist der Auslöser ein konditionierter Reiz, welcher emotional bewertet wird.
Zusammengefasst zeigt sich, dass das Nervensystem die Struktur und die Mechanismen besitzt, welche im Rahmen der Immunologie eine Rolle spielen können. Aus Punkt (4) und speziell Punkt (5) lässt sich schlussfolgern, dass alleine ausgehend vom ZNS eine Modulation der Aktivität des Immunsystems möglich ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass das ZNS in der Immunologie eine zentrale Rolle spielt.
Ein Modell zur Organisation des Immunsystems:
(1) Das Meldesystem
Nach der Antigenpräsentation im Lymphknoten, durch dendritische Zellen, wird das Antigen von dort aus, mittels retrograd axonalen Transportes, in das ZNS weitergeleitet. Alternativ ist eine Kodierung des Antigens in Form elektrischer Signale denkbar. Sensorik mit der differenzierten Weiterleitung von Signalen ist beim Riechvorgang bekannt. Die Neurone können eine große Vielfalt unterschiedlicher olfaktorischer Stimuli weiterleiten. Ein Kodierungssystem ist also durchaus vorstellbar. Manche Tierarten haben mehr olfaktorische Rezeptoren als andere. Damit verbunden ist eine erniedrigte Schwelle zur bewussten Wahrnehmung olfaktorischer Reize. Ob damit auch eine erhöhte Diversität der wahrgenommenen Geruchsstoffe besteht, ist unbekannt. Möglicherweise haben unterschiedliche Spezies unterschiedliche Spektren der Substanzwahrnehmung. Riechrezeptoren wurden auch im Gastrointestinaltrakt sowie in unterschiedlichen inneren Organen beschrieben. Es ist anzunehmen, dass die differenzierte Weiterleitung der Information unterschiedlicher Stimuli nicht auf das olfaktorische System beschränkt ist.
Eine Kombination retrograd axonalen Transportes mit einem elektrischen Signal ist günstig. Das ermöglicht eine Assoziation eines Antigens mit einem elektrischen Signal, als Grundlage für eine klassische Konditionierung. Das wiederum ermöglicht, ab dem Zweitkontakt mit dem Antigen, einen Ersatz des Antigentransportes durch ein elektrisches Signal.
(2) Das Koordinierungszentrum
Zentralnervös muss die Information gespeichert werden. Das ZNS ist prädestiniert für die Speicherung von Informationen, also die Gedächtnisbildung. Eine Möglichkeit ist die neuronale Plastizität, mit der Ausbildung synaptischer Verbindungen. Die Gedächtnisbildung entsteht im Rahmen eines Lernprozesses. Durch die wiederholte Präsentation einer Information wird diese länger gespeichert.
Im Rahmen einer Impfung ist ein Booster notwendig. Dieser wirkt als Verstärker, durch die wiederholte Darbietung der Antigeninformation. Er führt zu einer länger andauernden Immunität als die Erstimpfung. Somit besteht eine Analogie zum Lernprozess.
Somit kann man sich das ZNS als Bibliothek immunologischer Informationen vorstellen.
(3) Das Effektorsystem
Zum Immunsystem gehört auch die Effektorseite, zur Erzeugung einer Immunantwort auf einen immunologischen Stimulus hin. Konditionierte Immunzellen sind bekannt.
Im Rahmen des Erstkontaktes mit dem Antigen wird dieses, nach dem retrograd axonalen Transport zum ZNS, mittels des anterograd axonalen Transportsystems ins Knochenmark weitergeleitet, um dort eine Konditionierung der Immunzellen (immunologische Stammzellen) zu bewirken. Es ist durchaus vorstellbar, dass somit der neuronale Weg von der Bibliothek im ZNS zu den konditionierten Immunzellen im Knochenmark etabliert wird.
Wird der Antigentransport durch ein elektrisches Signal begleitet, so ist bei wiederholter Antigenexposition ein Ersatz des Antigentransportes durch das elektrische Signal möglich, im Sinne einer klassischen Konditionierung.
[An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Konditionierung der Immunzellen ein Vorgang ist, welcher ihnen spezielle Eigenschaften verleiht. Die klassische Konditionierung ist ein Lernvorgang.]
Zusammenfassung des Modells
Zusammengefasst ermöglicht der Erstkontakt mit dem Antigen den Aufbau eines Wegesystems innerhalb des Nervensystems. Ein Antigentransport erfolgt vom Lymphknoten in das ZNS und vom ZNS in das Knochenmark, begleitet von elektrischen Signalen. Im Zuge dessen wird ab dem Zweitkontakt, für die Informationsübertragung zum und vom ZNS, der Antigentransport, mittels klassischer Konditionierung, durch elektrische Signalübertragung ersetzt. Im ZNS werden, im Rahmen eines Lernvorganges, spezifische Daten in der ZNS-Bibliothek hinterlegt.
Diskussion des Modells
Der Transport elektrischer Signale ist schneller als der Substanztransport. Ein erneuter Kontakt mit dem Antigen kann somit schnell den konditionierten Immunzellen gemeldet werden. Dabei kann das entsprechende elektrische Signal an irgendeiner geeigneten Stelle im Organismus generiert und an das ZNS übermittelt werden.
Ab dem Zweitkontakt mit einem Antigen ist, durch das zentrale Register im ZNS, nicht nur die Erkennung des Antigens möglich. Von der ZNS-Bibliothek aus kann, mit Hilfe des Nervensystems, über den Weg, welcher im Rahmen des Erstkontaktes etabliert wurde, auch gezielt die entsprechende Region der konditionierten Immunzellen - in der entsprechenden Nische des Knochenmarkes - angesteuert werden. Somit kann das Erfolgsorgan im Knochenmark, ab dem Zweitkontakt mit dem Antigen, schnell und gezielt erreicht werden. Folglich wird durch elektrische Signale rasch und gezielt eine Antikörperproduktion induziert. Die Antikörper werden in der Peripherie verteilt.
Klassischerweise wird das Antigen vaskulär (Blut- und/oder Lymphgefäßsystem) transportiert, tritt - nach Verdünnung – in der entsprechenden Nische in Kontakt mit konditionierten und/oder unkonditionierten Immunzellen und löst eine Immunreaktion aus.
Die Modulation der Aktivität (Stimulation) konditionierter Immunzellen durch ein spezifisches neuronales Signal kann in einem komplexen Organismus eine zeitsparende Alternative sein.
Bei wiederholtem Kontakt des Organismus mit dem Antigen ist das Zeitintervall bis zur spezifischen Immunantwort (IgG-Antikörper) verkürzt, verglichen mit dem Erstkontakt. Das mag einerseits daran liegen, dass bei wiederholtem Kontakt mit dem Antigen bereits konditionierte Immunzellen vorliegen. Somit entfällt die Zeit für die Konditionierung der Immunzellen, bei wiederholtem Kontakt des Organismus mit dem Antigen. Andererseits kann die schnellere Immunantwort durch die verkürzte Zeit der Signalweiterleitung auf neuronalem Wege bedingt sein. Eine Kombination beider Effekte ist am wahrscheinlichsten.
[Anmerkung: Nach dem Erstkontakt des Organismus mit einem Antigen erscheinen erst IgM-Antikörper im Serum, erst später IgG-Antikörper. Ab dem Zweitkontakt erscheinen IgG-Antikörper im Serum, jedoch viel schneller als nach dem Erstkontakt. Dieser zeitliche Ablauf könnte ein Hinweis darauf sein, dass das vaskuläre Transportsystem genutzt wird, um die Bildung von IgM-Antikörpern zu induzieren, während das neuronale Transportsystem genutzt wird, um die Bildung von IgG-Antikörpern zu induzieren.]
Es ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, dass der Signalweg durch das Nervensystem, für eine topisch zielgerichtete Immunantwort, in entgegengesetzter Richtung beschritten wird. Dabei würde der axonale Transport in umgekehrter Richtung erfolgen, also vom Knochenmark über das ZNS zum Ort der Wahrnehmung des Antigens. In diesem Falle würden statt des Antigens Antikörper transportiert werden. So wäre eine gezielte Immunantwort am Ort der Wahrnehmung des Antigens möglich.
Es wurde eine ZNS-Bibliothek postuliert. Die Frage ist, wo im ZNS eine derartige Bibliothek angelegt worden sein kann. Da das Immunsystem phylogenetisch alt ist, bieten sich phylogenetisch ältere ZNS-Abschnitte an. Die ZNS-Prozesse im Rahmen der Immunologie erfordern kein Bewusstsein, also keine Verbindung zum Assoziationskortex, so dass kortikale Strukturen – zumindest des Neocortex - nicht zwingend erforderlich sind.
Das vorgeschlagene neurophysiologisch-immunologische Interaktionsmodell bietet, auf neurophysiologischem Wege, eine Erklärung für den Einfluss der Psyche auf die Immunität. Entsprechende neuronale Verbindungen sind ausreichend.
Das Kleinhirn hat modulierende Effekte auf die Intensität der motorischen Signale des ZNS an die Peripherie. Analog dazu könnte man sich vorstellen, dass Zentren im ZNS einen modulierenden Effekt auf die Speicher der immunologischen Information im ZNS haben. Auf rein neurophysiologischem Wege könnte somit eine Immunreaktion sowohl generiert als auch unterdrückt werden.
Es ist vorstellbar, dass der retrograd axonale Transport von Substanzen (Antigenen) in Richtung ZNS nicht nach dem ersten Antigentransport eingestellt wird, sondern auch bei wiederholtem Kontakt stattfindet, also parallel zu den elektrischen Signalen. Die elektrischen Signale sind nur für die reduzierte Zeit bis zur Immunantwort verantwortlich. Der Transport von Substanzen (Antigenen) in Richtung ZNS findet in diesem Falle weiterhin statt. Bei ZNS-Erkrankungen ist eine Störung im Transportsystem vorstellbar, beispielsweise eine Insuffizienz im Kinesin-System. Dadurch ist die Entfernung von Substanzen aus dem ZNS gestört. Das könnte zur intraneuronalen Akkumulation von (immunologisch relevanten) Substanzen führen. Das „perineural network“ kann Substanzen nicht von intraneuronal, also aus dem Zellinneren, entfernen.
Günstig wäre es, in einem derartigen neurophysiologischimmunologischen Interaktionsmodell, das Kodierungssystem für elektrische Signalübertragung zu entschlüsseln. Somit könnte bei antigenbasierten Impfungen ein Boost, also eine Impfverstärkung, alleine auf der Basis der elektrischen Stimulation ausgelöst werden, ohne den erneuten Kontakt mit allen Bestandteilen eines Impfstoffes.
[Anmerkung: Zum besseren Verständnis wurden das vaskuläre (Blut- und Lymphgefäße) und das neuronale Transportsystem einander gegenübergestellt. Zumindest ein partielles Zusammenspiel der Transportsysteme ist jedoch notwendig, so dass eine scharfe Trennung nicht sinnvoll ist.
Um im Rahmen des Erstkontaktes zu den Nervenendigungen in den Lymphknoten zu gelangen, muss das Antigen im vaskulären System transportiert werden. Bei wiederholtem Kontakt könnten auch andere Nervenendigungen geeignet sein die entsprechenden Signale zu senden.
Die schnelle IgG-Produktion im Rahmen des wiederholten Kontaktes mit dem Antigen kann zur Reduzierung der Antigenkonzentration führen, bevor die IgM-Produktion in relevantem Umfang initiiert wird.]