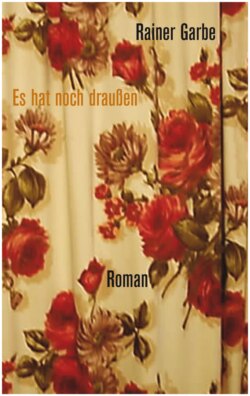Читать книгу Es hat noch draußen - Rainer Garbe - Страница 5
2.
ОглавлениеEinen Monat später biegt Berger wieder in die Straße seiner Kindheit ein. Der „Rosenbusch“ ist die letzte Abzweigung einer vom Langerfelder Markt relativ steil ansteigenden Straße, die oben an einem Denkmal endet. Daran schließt nahtlos der großflächige Wald an, in dem sie manchmal mit bis zu zwanzig anderen Kindern gespielt haben. Rosenbusch, das klingt irgendwie edel, nach heiler Welt.
Jetzt steht er wieder vor seinem Elternhaus. Es ist das mittlere Haus eines von drei nebeneinander liegenden Blocks, die kurz nach dem 2. Weltkrieg gebaut wurden und früher dem Folienunternehmen gehört haben, in dem ihr Vater und die Väter der gesamten Nachbarschaft arbeiteten. Diese Werkshäuser, eine Straße unterhalb des Rosenbuschs stehen drei weitere Dreierblocks, sehen von außen bis heute gleich aus. Im Parterre besteht die Fassade aus mittelgrauem, mauerartigem Backstein mit einem breiten Fenster, im ersten Stock aus (asbesthaltigen) Eternitplatten; hier sind zwei Fenster mit grünen Holzläden eingelassen. Das braun geziegelte Dach hat ein Erkerfenster im zweiten Stock und eine Luke im Speicher. Zwei Schornsteine sind die höchsten Punkte jedes Blocks.
Es ist Ende März, warm und im Vorgarten wuchert der Rasen. Auf der Terrasse hat der Bruder mehrere Eimer mit faulendem Inhalt abgestellt. Helmut gönnt sich mit der Familie gerade einen Skiurlaub und hat Wohnungs- und Autoschlüssel an einem abgesprochenen Punkt hinterlegt, damit Berger die Tage bei ihnen übernachten kann und mobil ist. Müllsäcke hat er von Hamburg mitgebracht. Davon werden sie in der ersten Zeit wohl am meisten brauchen.
Auf der grünen Haustür klebt noch die von der Mutter aus weißer Plastikfolie ausgeschnittene „12“. Berger betrachtet die Klingel mit dem Namensschild. Die Umrandung hält wohl ewig. Alte Kaugummis, von ihr gesammelt und wieder weich gekaut oder erwärmt, haben ihr als Knetmasse gedient. Daraus formte sie diese kleine rechteckige Fläche um die Klingel herum und kerbte die verdickten Ränder mit einem Messer so ein, dass es wie eine Bordüre aussah. Sogar die Ränder der Badewanne dichtete sie einmal mit Kaugummi ab; das funktionierte aber nicht, die Masse wurde bald rissig.
Berger drückt einmal den Klingelknopf: dieses helle, durchgehende Schellen, das sie früher nur selten selbst auslösen mussten, weil jeder in der Familie wusste, dass man sich den Hausschlüssel mit den Fingern angeln konnte. Auch das war eine von Mutters Ideen gewesen: An der Innenseite der Haustür wurde direkt unter dem Briefschlitz eine ovale Öse ins Holz geschraubt und darin der Schlüssel eingelegt und mit einer daran befestigten Schnur vor dem Zu-Boden-Fallen gesichert.
Berger muss den Schlüssel im Schloss leicht hin- und herbewegen, bevor er sich endgültig nach rechts drehen lässt und die Haustür öffnet. Dieses ruckelnde Drehen mit Gefühl – diese früher jeden Tag mehrfach ausgeführte Bewegung ist so in ihm drin, dass seine Hand sie auch jetzt noch, nach werweißwieviel Jahren, wie automatisch ausführt. Beim Öffnen schiebt er einen Haufen Post beiseite, der sich im Flur auf dem Kachelboden gesammelt hat. Es riecht nicht mehr so schlimm wie vor Wochen. Helmut hat in Küche, Wohnzimmer und im ersten Stock die Fenster geöffnet, sodass ein leichter Durchzug entsteht.
Berger stöhnt innerlich: Wo anfangen bei den Bergen an Zeitungen, Kleidungsstücken, Kartons, Eimern, Blechdosen und Plastiktüten. Zuerst zieht er sich ein Paar Gummihandschuhe an, die der Pfleger als Vorratspackung auf dem Schränkchen im Flur gelassen hat. Bisschen klein, aber besser, als mit bloßen Händen in den alten Sachen zu wühlen. Die Hoffnung, in seinem ehemaligen Zimmer etwas Vertrautes oder Überraschendes zu finden, lässt ihn schließlich dort beginnen. Auf dem Boden vor dem großen Kleiderschrank, der sich über etwa zwei Drittel der Länge des Raums zieht, liegen Stapel von Hosen, Pullovern und Jacken, dazu Plastiktüten mit Stoffen und Wollballen; auch auf dem Bett ist alles voll mit Mänteln, Kissen und Tüten. Die vier von der Mutter mit Tapete beklebten Kleiderschranktüren bilden einen passenden Rahmen dazu.
Na, dann wollen wir mal. Berger öffnet den ersten Sack und greift sich ein Teil nach dem anderen. Jedes Mal muss er entscheiden: aufheben oder weg damit? Die Säcke nur nicht so voll machen, sonst reißen sie beim Raustragen. In einer Stunde hat er fünf, sechs Säcke gepackt und ins Elternschlafzimmer gestellt. Berger ist zufrieden, trotzdem scheint das Zimmer kaum leerer geworden zu sein.
Sie hat tatsächlich nichts weggeworfen. In einer Schublade der Kommode findet er Frotteeslips und Socken aus seiner Kindheit. Die Slips sind braun und hellblau gemustert; die gab es damals im Dreierpack, erinnert er sich. Die Socken sind aus Acryl und am Bund völlig ausgeleiert. Irgendwo ist wahrscheinlich auch noch die dicke braune Wollunterhose. Grob gestrickt war sie und kratzte bei jeder Bewegung. Die musste er im Winter in die Schule anziehen, sonst erkältet’s ihr euch. Berger weiß noch, wie er dann in der Klasse möglichst stillsaß und in den Pausen auf dem Schulhof das Gehen und Rennen vermied. Diese Tortur blieb ihm erspart, wenn er Sport hatte; das fragte sie ihn oft am Abend vorher. Dann hätten seine Schulkameraden im Umkleideraum dieses Wollungetüm zu Gesicht bekommen und Schlechtes von ihr denken können. Irgendwann beantwortete er ihre Frage so oft wie möglich mit Ja.
Das „Plastron“ war auch so ein seltsames Teil, das ihn bis zur Unterstufe des Gymnasiums verfolgt hat: ein Kragen mit zwei herunterhängenden Stücken Baumwollstoff, die am Rücken mit dünnen Schnüren zusammengebunden wurden. Dieses halbe Hemd konnte natürlich nur unter einem Pullover getragen werden; wenigstens hat es nicht gekratzt. Bestimmt ist es auch in irgendeiner dieser Plastiktüten zu finden.
Dass die Brüder jetzt tage- und wochenlang im Haus zu tun haben werden, liegt vor allem an der Eigenart der Mutter, praktisch alles aufzuheben und zu sammeln. Am Anfang, als die Geschwister noch Kinder waren, mag das noch einigermaßen nachvollziehbar gewesen sein – etwa wenn sie, um ein paar Pfennige zu sparen, die Schulbrote statt in einen Frühstücksbeutel in eine Tüte packte, in der ursprünglich Walnüsse gewesen waren. Mit der Zeit wurde dieser von ihr oft mit Stolz beschriebene Sparsamkeitssinn den Geschwistern immer peinlicher. Sie hob jede leere Bonbontüte auf, jeden gebrauchten Briefumschlag, auf dem man noch schreiben kann, jede Büroklammer, jedes Marmeladenglas, jedes noch so kleine Gummiband. Sie stellte sogar selber Gummibänder her, indem sie alte Fahrrad- und Autoschläuche in Ringe schnitt; damit ließen sich auch schwerere Plastiktüten und Kartons, in denen sie alle möglichen Dinge hortete, kraftvoll umspannen und verschließen. Hinter das Gummiband der meisten Tüten und Kartons steckte sie ein Etikett mit ihrer runden Handschrift. Alte Gardinen, liest Berger, auf einer größeren Tüte steht: Alles verschiedene Stoffmuster; das Etikett einer leichten Tüte lautet: 3 große Tüten von Aldi (für Kleiderbügel). Daneben ein kleiner Kunststoffbeutel: Alles Ostersachen. Berger schaut kurz hinein: Papiergras, Farbstifte und Plastikeier – ab damit in den Müllsack.
Die Etiketten sind rechteckig und oval aus Papier oder einem Stück Pappe geschnitten. Neben den Säcken packt Berger auch Kartons mit Zeitungen, Pappe und Papier, stapelt sie im Flur des ersten Stocks und beschriftet sie mit Karteikarten aus dem Schreibtisch des Vaters. „Papiermüll“ und „Plastikmüll“ schreibt er darauf, auch „Schuhe“ und „Medikamente“ – wie deine Mutter, denkt er. Aber für den Fall, dass Helmut die Sachen in seiner Abwesenheit getrennt entsorgen will, ist es schon sinnvoll, beruhigt sich Berger. Sein Rücken fängt an zu schmerzen, die Hände sind feucht in den Handschuhen. Er schaut aus seinem Schlafzimmerfenster. Der Garten ist heruntergekommen, nichts Grünes mehr zu sehen. Der kleine Zaun zum rechten Nachbarn steht immer noch. An der Trennlinie zum linken Nachbarn wuchsen früher Himbeer- und Stachelbeersträucher. Zwei Häuser weiter wohnt Forstmann. Der bringt gerade seinen Garten in Schwung, schneidet Sträucher und knickt die trockenen Äste zu Brennholz. An Forstmanns Garten grenzt der eines älteren Paars von der Häuserreihe eine Straße tiefer. Die beiden sitzen auf der Terrasse, der Mann trinkt aus einer Tasse und stellt sie ab; es ist so ruhig, dass Berger das Klackern des Porzellans hören kann. Die Märzsonne ist angenehm warm. Er würde jetzt auch lieber irgendwo einen Kaffee trinken, als in seiner Vergangenheit zu wühlen. Das Fenster ist morsch, überall blättert der Lack ab. Im Winter haben sich oft Eisblumen an den Scheiben gebildet, in die sie mit den Fingernägeln Rillen und Figuren kratzten. In den oberen Zimmern konnte ja nicht geheizt werden. Warum es im ganzen Haus keine Heizung und keine neueren Fenster gab, ist Berger und seinen Geschwistern bis heute unbegreiflich. Anfang der 70er-Jahre bot das Folienunternehmen „Betzberg“ die Häuser vom Rosenbusch und der Straße darunter den Familien zum Kauf an; die Alternative war: ausziehen. Sämtliche Mieter wurden (stolze) Hausbesitzer und ließen – dank staatlicher Förderung – zu erschwinglichen Preisen eine Zentralheizung und auch neue Fenster einbauen. Nur die Bergers nicht. Die Mutter hatte sich quergestellt mit Argumenten wie Kälte ist gesund und diese modernen, dichten Fenster lassen kein bisschen Luft mehr durch. Unbegreiflich, wie sie sich damit beim Vater durchsetzen konnte. Wahrscheinlich hatte er – wie in vielen anderen Situationen – erst sachlich argumentiert, irgendwann aber entnervt resigniert gegenüber ihrem Starrsinn. Auch wenn sie ja nicht ganz unrecht hatte in dem zweiten Punkt: Minusgrade in den Zimmern und Eisblumen am Fenster sollte man seinen Kindern nicht zumuten. Berger und sein Bruder haben wegen der fehlenden Heizung schon früh ein inneres Heizsystem entwickelt. Einen Pullover brauchen sie jedenfalls selten, und bei ihren Frauen gelten sie als „Öfen“ – oder „Nachtspeicher“, wie Berger manchmal scherzt.
Wenn die Familie fünf Wochen Urlaub in Südtirol machte, haben er und die Schwester ihre Puppen an die Scheibe dieses Fensters gelehnt, damit sie in den Garten schauen konnten. Nun hängen hier nur noch die durchsichtigen Gardinen schlaff herab. Darüber der Vorhang, den sie sich, als sie noch alle drei hier schliefen, gegenseitig verkauft haben. Das war so ein Spiel bei ihnen: „Vorhängeverkaufen“. Einer war der Ladenbesitzer, der andere der Käufer: Ich hätte gern ein Stück von dem hier.
Im nächsten Moment sieht er die nackten Füße von Helmut vor sich. Der große Zeh des Bruders, dessen Fußende ans Gitterbett des drei- oder vierjährigen Berger reichte, war „die Tante“. Morgens, wenn es schön warm war unter Helmuts Decke, griff der kleine Berger durch die Stäbe und sagte der Tante guten Morgen, was er durch Kneten, Ziehen und Biegen des Zehs bekräftigte. Erst jetzt fällt Berger ein, dass man diesen Zeh ja „großer Onkel“ nennt. Das Tante-Begrüßen verlängerte jedenfalls den Aufenthalt im warmen Bett.
Berger zählt die vollen Säcke: 15. Endlich kommt er in seinem Zimmer an die Schränke heran. Die will er morgen ausräumen. Er zieht die Gummihandschuhe aus und wirft sie in einen der offenen Säcke. Dann macht er noch einen Rundgang durchs vollgestellte Elternschlafzimmer über die Treppe in den zweiten Stock, wo Helmut und Frida ihre Zimmer hatten. Der Bruder bekam seinen eigenen Raum, als er mit zehn oder elf Jahren aufs Gymnasium kam. Wann Frida nach oben zog, weiß Berger nicht mehr genau; vermutlich zu Beginn ihrer Pubertät.
Spinnweben sind keine zu sehen, stellt er fest. Offenbar haben auch die Insekten längst das Weite gesucht. Aber Mäuseköttel überall, wie ausgesäte Schokostreusel. In Fridas Zimmer schaut er einige Sekunden lang auf ein vergilbtes Porträt des jungen Uli Hoeness im Trikot von Bayern München (wohl aus einem „Kicker“ von Helmut). Für diesen Spieler hat sie in den 70er-Jahren mal geschwärmt. Überraschend eigentlich, denn in der Familie interessierte sich niemand besonders für Fußball, außer für die Spiele der Nationalmannschaft. Nur Berger kuckte hin und wieder mit seinen Freunden die „Sportschau“. Jetzt fällt ihm ein: Helmut war mal an zwei Karten für das Spiel Wuppertaler SV gegen Bayern München gekommen und mit Frida ins Stadion gefahren. Der WSV war in die Bundesliga aufgestiegen und die Bayern zu Gast. Hinterher schwärmten die Geschwister davon, Beckenbauer, Müller, Maier und Hoeness endlich mal live gesehen zu haben. Eine Ecke des Posters hat sich inzwischen von der Reißzwecke gelöst und aufgerollt, die Tapete ist an dieser Stelle etwas heller.
Das Puder der Handschuhe hat weiße Stellen auf Bergers mittlerweile trockenen Händen hinterlassen. Wieder unten in der Küche, dreht er den Hahn auf. Es kommt kein Tropfen. Ach ja, Helmut hat das Wasser abgestellt. Über dem Spülstein schüttet er Mineralwasser aus einer Flasche über seine Hände, reibt sie gegeneinander, spült nach und wischt sie an seiner Hose einigermaßen trocken. Zurück in der Wohnung des Bruders, zieht er gleich Schuhe, Hose und T-Shirt aus und duscht sich den Muff vom Leib. Nach altem Haus riechen die Sachen, sie werden ab jetzt zu seiner Arbeitskleidung für diese Tage.
Schon um Zehn geht er ins Bett, doch sein Kopf ist noch im Elternhaus. Die Froni fällt ihm ein, die kindsgroße Puppe der Schwester. Die Mutter hatte aus Wollresten einen Kopf, Rumpf und Gliedmaßen geformt, mit beigefarbener Haut (einem alten Baumwollstoff) überzogen und mit Filzstift ein unschuldiges Gesicht gemalt, in das die aus braunen Wollfäden gedrehten Haare fielen. Froni trug eine alte Strickjacke von Frida und ihre ersten (weißen) Schuhe, sie trägt sie noch immer. Seit die Schwester in einem Wohnheim lebt, sitzt die Puppe als stumme Gefährtin auf ihrem Sessel. Ob sie wie eine Schwester für Frida war, zumindest eine Zeit lang, und von der Mutter so gedacht? (Berger wird seine Schwester danach fragen.) Er hat jetzt nicht mehr die Puppe im Sessel vor Augen, sondern die Mutter im Drehstuhl.
Du bist so gestorben, wie ich es mir vor Jahren einmal vorgestellt habe: in einer Ecke kauernd, ausgezehrt – ein wortloser Abgang, ohne uns noch einmal angerufen und um Hilfe gebeten zu haben. Im Grunde ein natürlicher Tod. Wie ein Tier, das um sein Ende weiß, hast auch du nichts mehr zu dir genommen, dich eingerollt in eine Ecke und auf das Ende gewartet.
Bergers Ziel für den zweiten Tag: das Badezimmer entrümpeln. An diesem Raum, wenn auch dem kleinsten, will er zeigen, dass er was geschafft hat in dieser Zeit, bevor Helmut den Container bestellen und die erste Fuhre entsorgen lassen wird.
Beim Blick auf den Kinderstuhl im Flur fällt ihm ein, dass er genau hier zum ersten Mal in seinem Leben etwas Totes gesehen hat. Eines Mittags, als er aus der Schule kam, lag einer der beiden Wellensittiche, die er zum achten oder neunten Geburtstag bekommen hatte, auf dem Stühlchen. Der Anblick des auf ein Stück Zeitungspapier gebetteten kleinen leblosen Körpers im hellblauen Federkleid traf ihn ins Herz. Die Mutter meinte, der Vogel habe wohl Zug bekommen von den Malern, beim Lüften des Wohnzimmers. Es war eine absolute Ausnahme, dass sie einmal Handwerker im Haus hatten, wo doch die Mutter sonst all diese Arbeiten selber erledigte. Nach ein, zwei Tagen starb, ob an Zug oder Einsamkeit, auch der andere Sittich. Berger erinnert sich, darüber tagelang traurig gewesen zu sein.
Das Stühlchen steht hier schon eine Ewigkeit. Mindestens ebenso lange bedeckt im Bad ein Brett die Wanne. Früher lagerte die Mutter darauf Illustrierte, Kreuzworträtsel und Klopapier. In den letzten Jahren haben sich hier jedoch alle möglichen Sachen angesammelt: Kartons voller Zeitungen, Medikamenten-Packungen, Mullbinden, leerer Konservendosen und Bleistifte (die sie immer mit einem Messer anspitzte, weil dann weniger von der Mine verloren ging); außerdem eine Lupe, ein halbes Dutzend Nagelscheren und ein Joghurtbecher gefüllt mit Sicherheitsnadeln, alles von grobem Staub bedeckt. Berger würde die überquellenden Kartons am liebsten direkt in einen Müllsack werfen. Aber der Gedanke an möglicherweise wichtige Briefe, alte Fotos oder Bargeld lässt ihn vorsichtiger arbeiten.
Hinter der angelehnten Tür das gleiche Bild wie vor Jahrzehnten: der nie benutzte Besen in der Ecke und am Haken der Kinder-Garderobe Vaters weinroter Bademantel. Den trug er eigentlich nur im Urlaub, wenn er als Einziger auf der Schattenseite des Schwimmbads am Beckenrand stand oder im Liegestuhl die Zeitung las. Sonst hing der Mantel immer hier am Haken. Nur in den letzten Jahren, als der Vater bereits pensioniert war, hatte er ihn wieder öfter an. Das ist auch das letzte Bild, das Berger von seinem Vater im Gedächtnis hat: er in diesem weinroten Bademantel in der Küche sitzend. Da hatte der noch nicht diagnostizierte Bauchspeicheldrüsen-Krebs schon irreparable Schäden in seinem Körper angerichtet.
Ist Weinrot nicht eine Farbe der Melancholie? Berger macht ein Foto: der Bademantel am Haken vor der Sternenmuster-Tapete. Die letzte Gelegenheit, Bilder aus seiner Jugend und Kindheit mit der Kamera festzuhalten. Das hat er schon einmal getan, als die Eltern allein Urlaub in Südtirol machten. Von unten bis oben fotografierte er das Haus, natürlich auch die Unordnung, die skurrilen Dinge: die Zeitungsstapel in der Küche, die Schubladen voller gefalteter Plastiktüten, die Eimer mit gebrauchtem Wasser neben der Toilette, faule Äpfel auf der Fensterbank, jahrzehntealte Zahnbürsten mit vergilbten, ausgefransten Borsten. Es waren Fotos, die kein gutes Licht auf ihr Leben warfen. Er machte ein Album daraus und schenkte es dem Bruder zu Weihnachten. Ihm kamen Tränen beim Anblick des nostalgischen Haus-Spaziergangs. Über ihre Schwiegertochter, Helmuts Frau, fiel wenig später schließlich auch der Mutter das Album in die Hände. Dieser Moment der Bloßstellung muss schlimm für sie gewesen sein, die alles tat, um nach außen eine glückliche Familie zu präsentieren; die ihre Kinder kurze Lederhosen und Hemden, Söckchen und Schuhe in Weiß für den Sonntagsspaziergang anziehen ließ; die alle paar Monate den Vater und die Kinder vor der Kamera in Positur brachte, mit Selbstauslöser die heile Welt auf dem Sofa darstellen wollte (und dies auf den Schwarzweiß-Fotos durch Nachziehen der Augenbrauen mit Bleistift zu verstärken versuchte).
Nachdem sie alle Bilder aus dem Album gerissen und vernichtet hatte, musste Berger ihr versprechen, ihr die Negative zu schicken (was er wirklich tat), damit sie auch die aus der Welt schaffen konnte. Später einmal räumte Berger ihr gegenüber ein, das Album sei eine künstlerisch-dokumentarische Verarbeitung seines Konfliktes mit ihr gewesen; sie aber hat ihm diese Aktion nie verziehen. Schade, denkt Berger, dass ich damals keine Abzüge für mich habe machen lassen.
Er nimmt den Mantel vom Haken, hält ihn noch einen Moment in der Hand und steckt ihn dann in den schon wieder fast vollen Müllsack. Dann fällt sein Blick auf die cremegelben Bodenfliesen, die von grauen, wolkigen Strukturen durchsetzt sind. Als Junge hat er oft versucht, in ihnen Gesichter zu erkennen, wenn er auf der Schüssel saß. Noch einmal nimmt er die Perspektive von damals ein, indem er sich dreht und leicht nach vorne beugt. Das eine oder andere Gesicht auf den Fliesen erkennt er tatsächlich noch immer, aber auf die Brille setzt er sich dabei nicht. Die ekelt ihn an, seit die Mutter sie vor ein paar Jahren mit einem passend geschnittenen Schaumstoffoval beklebt hatte. Um die Kloschüssel herum stehen vier, fünf aufgeschnittene Milchkartons als Behälter für dreckige, ausgetrocknete Putzlappen, daneben Plastiktüten mit noch unklarem Inhalt und zwei Eimer mit abgestandenem Wasser. In beiden schwimmt eine leere Konservendose. Diese Überreste einer Sparmaßnahme der Mutter empfand er damals schon als Erniedrigung: Benutztes Wasser vom Familien-Badetag aus dem Trog in der Waschküche oder das von der Wäsche schleppte sie in diesen Eimern ins Bad und ordnete an: Nicht spülen, sondern mit der Dose das gebrauchte Wasser aus dem Eimer schöpfen. Bei Klein, wie sie normales Pinkeln nannten, war das einfach. Bei Groß aber musste man die Brühe mit voller Wucht in die Schüssel kippen, damit der stinkende Brocken genug Schwung bekam für seinen Weg durchs Abflussrohr. Bei diesen Toiletten von damals landet die Wurst nicht gleich im Wasser, sondern erst auf einer waagerechten Fläche. Er zielte immer auf die Rundung zwischen diesem Plateau und oberem Toilettenrand. Wenn ihm dies nicht auf Anhieb gelang und die Wurst noch wie eine tote Maus unten im Loch schwamm, war mindestens eine weitere Ladung Wasser in den Abfluss nötig, im äußersten Fall ein starker Strahl direkt aus dem Eimer. Manchmal missachtete er die Anordnung der Mutter und zog doch die Spülung. Dazu musste man nur das Ventil am Zuleitungsrohr wieder aufdrehen, das sie oft verschlossen hatte, um ihrer Anweisung mehr Nachdruck zu geben. Meist aber unterwarf er sich der Prozedur mit der Konservendose, mit einigem Widerwillen. Vor allem schämte er sich, seinen Freunden gegenüber. Immer, wenn Besuch kam, eilte er als erstes ins Bad und stellte die Eimer in sein Zimmer nebenan. Meist bat er die Freunde auch gar nicht herein, sondern redete mit ihnen durch die halb geöffnete Haustür. Nur wenige Male saßen sie, zum „Stratego“- oder Schachspielen, in der unaufgeräumten Küche, in Bergers kaltem Zimmer oder im Wohnzimmer, das immer erst aufgeheizt werden musste. Berger hätte seinen Freunden gern einen gemütlicheren Ort geboten. Jahre später bekam er einmal von einem in der Runde zu hören, die Familie Berger sei nicht sehr gastfreundlich, was ihm einen Stich gab.
Die Sache mit dem Spülwasser hatte ja schon was Krankes. Dass sie das Klopapier aber aus alten Telefonbüchern machte, war noch eine Steigerung. Es bestand aus in Viertelstücke gerissene oder geschnittene Seiten, die sie in kleinen Stapeln auf das Brett über der Badewanne legte. Dieses harte Papier mit Namen und Nummern aus Wuppertal musste man vor dem Gebrauch immer erst weich reiben. Kein Wunder, dass sie später Hämorrhoiden bekam. Auch Klopapier von der Toilette des Tennisclubs nahm sie oft mit: keine ganze Rolle, was vielleicht aufgefallen wäre, sondern nur ein paar abgewickelte Meter, die sie in ihre Handtasche stecken konnte.
Hier hat doch auch mal ein Kondom gelegen. Berger sieht sie noch vor sich, die hautfarbene Hülle, die an mehreren Stellen zusammenklebte – von der trüben Flüssigkeit, die Berger damals (und zu viele Jahre später noch) immer in einem Taschentuch auffing. Am Morgen nach einer Party entdeckte er das gefüllte Gummi auf der Holzplatte. Ein Schreck für ihn, er war schockiert. Ein Beweis dafür, dass es wild und ausschweifend zugegangen war: dass zwei „es getrieben“ hatten. Die Eltern waren auf einer Tennisreise oder einer Wochenendfahrt, und Helmut und Frida hatten diese Gelegenheit genutzt, um Freunde und Klassenkameraden einzuladen. Auch Leute von Bergers Stufe waren dabei, nicht seine Freunde, nur die etwas Älteren. Im ganzen Haus ging es rauf und runter, er aber hatte sich in seinem Zimmer eingeschlossen und traute sich nicht heraus (auch nicht, als ihn Helmut und ein anderer ihn dazu ermuntert hatten). Eingeschlossen im Zimmer, ausgeschlossen vom Leben. Es waren die Jahre, in denen er mehr Zeit mit seiner Gitarre als mit anderen verbrachte. Respekt und auch Angst vor den anderen bestimmten in dieser Zeit sein Leben. Einige waren zwei, drei Jahre älter als er und seine Wuppertaler Freunde, manche einmal sitzengeblieben. Sie trugen Parka oder Kampfjacken und verbrachten die Pausen in der Raucherecke, während er, Klaus und die anderen zum Bäcker gingen oder Fußball spielten. Der Respekt ihnen gegenüber reduzierte sich erst auf ein normales Maß oder schlug gar zu Bergers Gunsten um, als er sie später auf den Abiturtreffen wiedersah.
Die Eimer stellt er auf die Terrasse, die Milchkartons und Plastiktüten kommen in den Müllsack. Dann macht er sich an das vollgepackte Brett. Eine Menge Apotheker-Hefte und alte Ausgaben der „Wuppertaler Rundschau“ holt er aus den Kartons. Plötzlich durchbricht ein kurzes Klappern die Stille, gefolgt von einem platschenden Geräusch unten im Flur. Berger erschrickt, doch im nächsten Moment realisiert er: die Post. Der Briefträger hat sie durch die Klappe in der Tür geworfen. Ein Brief von der Bank, ein Stapel in Folie verschweißter Supermarkt-Prospekte, ein Reiseangebot und ein Faltblatt von der Telekom. Bis auf den Bank-Brief wirft er alles auf den Haufen hinter der Haustür.
In einem der Kartons im Bad liegt ein kleines Portemonnaie in Herzform. Er öffnet den Reißverschluss, findet einen Schein und ein paar Münzen. 21 Euro. Kaffee- und Kuchengeld für die nächsten Tage, Mutti gibt einen aus.
Dann zieht er einen Umschlag mit Fotos aus dem Karton. Die Mutter beim Tennis mit anderen Frauen, die Berger nicht kennt. Bei einem Bild muss er mehrmals hinschauen: ein Doppel mit einer Bekannten, die beleibte Mutter im Vordergrund. Um schlanker zu wirken in der ohnehin weit geschnittenen, selbst genähten Hose und Jacke, hat sie auf dem Foto vom Oberteil abwärts entlang der Hose einen millimeterdünnen Streifen Papier geklebt, der eine ähnliche Farbe hat wie der Hintergrund der Tennishalle.
Wieder so ein Versuch, die Wirklichkeit zu beschönigen, aber von diesem Verschlankungsversuch ist er gerührt. Er fährt mit einem Finger über die erhöhte Stelle. Eine handwerkliche Feinarbeit – ihre Version von Photoshop. Das ist natürlich kein Müll. Er steckt die Umschläge in einen der vom Bruder bereitgestellten Kartons auf dem Küchentisch, die schon bis oben voll sind mit Fotos, Briefen und Zetteln mit handgeschriebenen Notizen. In einem Zeitungsartikel hat Berger mal gelesen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Sammeln von Dingen und der Leibesfülle der betreffenden Person. Nicht loslassen können lautete die Deutung. Das traf ja bei der Mutter zu, auch in körperlicher Hinsicht. Die ganzen Jahre, die Berger sie erlebt hat, hatte sie eine Figur, für die die Modewelt die Bezeichnung „vollschlank“ erfunden hat.
Sein Magen knurrt. Er fährt die 300 Meter zum Langerfelder Markt und bestellt im Eiscafé „Zum alten Forsthaus“ Milchkaffee und Käsekuchen, der überraschend gut schmeckt. Hier ist offenbar seit den 70er-Jahren nichts verändert worden. Nach ein, zwei Bissen schaut er durch die Spitzengardine des Fensters. In ihm regt sich Widerwille gegen diese Arbeit. Der Tod ist zu spüren im Haus seiner Eltern, auch wenn sie nicht dort gestorben sind. Den eigenen Kindern das ganze Haus vollgemüllt zu hinterlassen – auf Berger wirkt das nicht nur hilflos. Liegt darin nicht auch eine gewisse Bösartigkeit?
Wir sollen jetzt die Dinge ausräumen, mit denen du nicht fertig geworden bist. Warum habe ich das nicht mal angesprochen, als du noch gelebt hast. (Wohl, weil ich den Mut nicht hatte.) Aber bei Kritik von uns Kindern warst du immer sofort eingeschnappt. So haben wir das irgendwann gelassen, weil du dich dann wie ein kleines Mädchen benommen hast. Vielleicht hättest du auch geantwortet: Aber mein mühsam erspartes Geld nehmt Ihr später wohl gerne, was?
Helmut hat einmal versucht, sie zum Ausmisten zu bewegen; das war etwa ein Jahr vor Ihrem Tod. Doch auf seinen Vorschlag, einen einzigen Stapel alter Zeitungen zum Papiercontainer mitzunehmen, fing sie zu weinen an. Er ließ den Stapel an seinem Platz, machte ihr aber deutlich, sie nicht mehr zu besuchen, da er es hier nicht mehr aushalte.
Berger wird klar: Mit der Arbeit im Haus hat er nun die Möglichkeit, ein letztes Mal zurückzugehen in die eigene Jugend und Kindheit – und mit der Vergangenheit aufzuräumen. Vielleicht findet er ja auch noch etwas Überraschendes oder Liebgewonnenes oder längst Vergessenes von damals.
Wie ein Goldgräber kommt er sich vor, mit der Hoffnung, die ganze Arbeit werde mit ein paar wertvollen Funden belohnt. Am späten Nachmittag hat er das Brett über der Badewanne geräumt und in den Flur gestellt. Leer ist das Bad noch nicht, aber Land in Sicht. Den Rest hier mache ich morgen, beschließt er.
Die Badewanne hat er seit seiner Kindheit nicht mehr leer gesehen. Berger erinnert sich, dass sie damals einige Zeit sogar von einer alten Holztür komplett bedeckt wurde. Irgendwann entdeckte einer der Geschwister, dass die Mutter in der Wanne die Weihnachtsgeschenke aufbewahrte. Dann konnte man im Sitzen auf der Klobrille die Tür etwas anheben und schon mal hoffen oder tippen, für wen wohl welche Sache gedacht war. Zum Duschen aber war in der Wanne kein Platz. Dazu hätte man die ganzen Zeitungen, die Stapel Klopapier und dann die schwere Tür wegräumen und außerdem den Boiler aufheizen lassen müssen, was eine gute halbe Stunde brauchte. Da ging er lieber den „Steilweg“ hinunter zur Tennisanlage von Betzberg. Im Winter, wenn eine Traglufthalle über den ersten der drei Plätze gespannt war und nur zum stündlichen Wechsel jemand in den Umkleideraum kam, duschte er dort einmal die Woche. Den knapp zehnminütigen Fußweg legte er so, dass er gegen „Zwanzig nach“ dort war, also einige Minuten Ruhe zum Duschen hatte – wobei er selten die Möglichkeit ausließ, sich dabei selbst zu befriedigen. Diese vorübergehende Flucht von zuhause, die Stunde des Alleinseins und die Beschäftigung mit dem eigenen Körper genoss er, auch wenn er dort immer unter Zeitdruck stand.
Auf der Spiegelablage neben der Badewanne entdeckt er eine Flasche „DuschDas“. Das war lange Jahre sein Lieblings-Duschgel. Aber nicht diese rosafarbene Flasche mit dem nach Lavendel riechenden Zeug, sondern das nach Zitrone duftende in der blauen Flasche. Die sah aus wie ein kleiner Atommeiler: längs geriffelt und mit einem schräg aufgesetzten, weißen, halbkreisförmigen Drehverschluss. Sofort fällt ihm der frische Geruch des Gels wieder ein, das genauso blau wie die Flasche war – einer der Düfte, der sein Gedächtnis über viele Jahre am stärksten besetzte. Zur Flasche gab es eine ebenfalls blaue Kordel, die in einem kleinen Haken an der Rückseite eingeklinkt werden konnte, zum Aufhängen in der Dusche. Beim Schulsport war dieses Duschgel für Berger und die Jungs seiner Clique eine Art Statussymbol, auch weil die anderen noch Seife benutzten. In den 80er-Jahren verschwand die Flasche dann irgendwann aus den Regalen und musste einer größeren weißen mit Klebeetikett weichen, die es noch immer gibt, ihm aber nicht gefällt, da sie ganz ein Produkt des irrsinnigen allgemeinen Schlankheitstrends ist. Die Flasche auf der Spiegelablage würde er natürlich aufbewahren, wenn sie blau wäre, aber rosa – weg damit. Vielleicht entdeckt er noch etwas Überraschendes, als Entschädigung für den Tag und die Rückenschmerzen – ein Mitbringsel aus seiner alten Heimat für seine neue, Hamburg. Also nochmal in sein Schlafzimmer.
Der flache Karton mit dem Geschenkpapier stand schon im Schrank, als er ein kleiner Junge war. Während andere, etwa Helmuts Kinder, Weihnachten bei der Bescherung voller Spannung das Papier aufrissen, fingerte die Mutter minutenlang an den Klebestreifen herum, um das Papier zu schonen: Das kann man noch brauchen fürs nächste Jahr! Berger nimmt kleine Stapel heraus und lässt sie nach und nach in einen Müllsack fallen. Wie die Jahresringe eines Baums liegt das Papier im Karton: ganz oben im aktuellen Stil – das könnte vom letzten Mal sein – bis in die 50er-Jahre zurück. Das letzte Stück legt er in das obere Fach des Schranks, das er auf einem Zettel mit „Aufheben“ beschriftet hat. Da sind schon einige Bücher, Wecker, Feuerzeuge und eine Tüte voller Regenschirme deponiert. Unter seinem Bett zieht er eine schmale Schublade voller Klopapierrollen hervor. Was diesen Vorrat anging, hätte sie noch einige Jahre leben können. Als er die Schublade zurückschiebt, erkennt er daneben den Nachttopf aus seinen Kindertagen. Dieser weiße Emailletopf mit Henkel – er als Zwei- oder Dreijähriger mit üppigen weißen Locken in der Küche auf diesem Topf sitzend, mit keck-fragendem Blick zum Vater schauend, der im Türrahmen steht und auf den Auslöser einer Fotokamera drückt (die Mutter sitzt auf ihrem Stammplatz am Küchentisch). Das Foto gibt es noch, seit Jahren liegt es in seiner Bilderkiste.
Das muss jetzt ... Berger streicht über den Rand des Topfs, wo an einer Stelle ein Stück Emaille abgeplatzt ist ... bald 45 Jahre her sein. Wahrscheinlich ist das überhaupt die erste Situation in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann.
Sein Blick fällt auf das Nachtschränkchen an der Kopfseite des Bettes. Darin liegt doch bestimmt noch etwas aus seinen Jugendjahren. Zwei Säcke mit Stoffen und mehrere aufgerollte Teppichläufer muss er beiseite räumen, um sich den Weg zu bahnen. Dann kann er die Tür bis zur Hälfte öffnen. Aus dem oberen Fach zieht er ein Matheheft; das kommt erstmal auf die Seite. Dann fühlt er etwas kleines Weiches, und eine kindliche Freude überkommt ihn: Det, das Mainzelmännchen mit der Brille – der erste wirklich lohnende Fund. Das ist eine Belohnung von der Mutter gewesen, für eine Eins im Diktat. Diktate fielen ihm immer leicht in der Volksschule; die Groß- und Kleinschreibung sowieso, und ein Komma setzte er immer dann, wenn die Lehrerin eine kurze Pause beim Vorlesen machte. Mit dieser Kommaregel lag er fast immer richtig.
Den Det hatte er sich ausdrücklich gewünscht, den Chef der Mainzelmännchen mit der schwarzen Hose und auf dem Rücken verschränkten Armen, der damals in der Werbepause einem anderen Mainzelmann durch Fingerzeig die Reihenfolge anwies, in welcher der die Blumen zu gießen hatte. Oft hatte er das Brillenmännchen im Schaufenster des Tabak- und Zeitungsladens gesehen, dann endlich gehörte es ihm. Berger schaut Det an, als wäre es sein Spiegelbild, da er selbst seit der vierten Klasse eine Brille trägt. Er lächelt und steckt ihn ein. Dann holt er noch etwas aus dem Schränkchen. Etwas, in das er lange Zeit verliebt war: eine schwarzhaarige Schöne mit schneeweißen Zähnen, von einem Mann hochgehoben und dem Betrachter ein verlockendes Lachen schenkend. Es ist das Bild einer Anzeige für irgendein Medikament (ein Potenzmittel?), das es wahrscheinlich gar nicht mehr gibt. Berger hält die herausgerissene Illustrierten-Seite in der Hand. Das war über Jahrzehnte seine Traumfrau; nach so einer hat er sich immer umgeschaut. Auch wenn er offener geworden ist, ein Faible für Dunkelhaarige hat er noch immer. Die strahlende Schwarze aber hebt er nicht auf; ihm reicht die Erinnerung. Er lässt die Seite in die Mülltüte fallen. Man muss auch loslassen können.
Das letzte, was er an diesem Tag buchstäblich ans Licht bringt, ist ein Fotoalbum mit Porträts der deutschen Nationalspieler bei der 74er Fußball-WM. Berger hatte die karikaturartigen Illustrationen aus der Fernsehzeitschrift ausgeschnitten. Sepp Maier und Gerd Müller erkennt er, Beckenbauer und Netzer natürlich, Paul Breitner, Berti Vogts, „Katsche“ Schwarzenbeck, Grabowski, Bonhof; bei Höttges und Cullmann muss er einen Moment überlegen. Zwischen den angegilbten Kartonseiten liegt ein „Bestellschein für das große Sammelalbum von Ernst Huberty, Album nur noch lieferbar bis 30.6.1975“. Ernst Huberty – sofort hat Berger auch die Namen der anderen Sportschau-Moderatoren parat: Fritz Klein mit der dunklen Hornbrille, Dieter Adler und Adi Furler, der auch Pferderennen kommentierte. Die Sportschau ließ er selten aus, einige Male schaute er auch mit Klaus und den anderen Jungs; der hatte sogar eine Magnettabelle, auf der er die Vereinswappen nach jedem Spieltag neu ausrichtete. Wenn Berger ihn samstagnachmittags besuchte, waren schon von weitem die Bundesliga-Liveberichte zu hören. Stadionsprecherartig schallten verschiedene Männerstimmen aus einem Kofferradio, das dort mitten im Garten stand, wenn Klaus’ schwerhöriger Vater in den Beeten arbeitete. Berger interessierte sich ja mehr für Tennis. Er muss innerlich lächeln: Für „Tennis Borussia“, eine ihm damals völlig unbekannte Regionalliga-Fußballmannschaft aus Berlin, empfand er Sympathie, bloß weil in diesem Namen sein Lieblingssport vorkam.
Als er am dritten Tag vor dem Haus aus dem Auto steigt, ruft von der anderen Straßenseite ein Mann nach ihm, den er sofort als Herr Specht erkennt. Der Vater zweier früherer Spielkameraden spricht ihn erst mit „Helmut“ an, weil die Brüder sich ähnlich sehen und Berger Helmuts Auto fährt. Dann erkennt Specht seinen Irrtum und erzählt, dass er einen Interessenten für das Haus habe, ein Türke mit Familie – netter Mann, der könne auch einiges selber machen und beim Ausräumen helfen. Berger registriert: die Stimme, die dicke, großporige Nase – wie damals; ein Krückstock ist noch die markanteste Veränderung. Und als Spechts Frau dazukommt, sieht Berger die Bilder wieder vor sich: die ganze Truppe sonntagnachmittags bei Spechts im Wohnzimmer auf dem Teppich vor dem Fernseher hockend und auf „Bonanza“ wartend. Spechts hatten den ersten Farbfernseher weit und breit. „In Farbe“ lautete der Hinweis in der „HörZu“. War das ein Ding, wie diese Landkarte von innen her verbrannte und die vier Cowboys angeritten kamen. Die Melodie kann heute noch jeder 40- und 50-Jährige pfeifen. Daran erinnern die Spechts sich natürlich auch noch. Berger könne Ole ja mal besuchen, bietet Specht ihm an, der wohne jetzt im oberen Teil des Hauses. Im selben Haus wie die Eltern, das wäre für Berger undenkbar. Er hat auch nie nachvollziehen können, warum viele seiner Schulkameraden in Schwelm geblieben sind. Er wäre wahrscheinlich erstickt an seiner Vergangenheit, zu eng wäre es ihm geworden im kleinen Wuppertal (geschweige denn im Dorf Langerfeld). Schon in der Schulzeit suchte er sich Freiheiten und unternahm kleine Fluchten. Manches Mal schwänzte er samstags die letzte Stunde, kaufte auf dem Heimweg beim Spielzeugeisenbahn-Händler ein „Faller“ oder „Kibri“ Haus und baute es nachmittags zuhause am Küchentisch zusammen. Noch heute, wenn er „vom Süden“ über die Autobahn nach Hamburg „rein“ fährt, weitet sich sein Brustkorb, wird sein Atem tiefer, spürt er Ebbe und Flut, die Gezeiten in sich: den Wechsel von Treibenlassen und Tatendrang. Für ihn nicht „das Tor zur Welt“, eher ein weiter, bunter Platz, der ihm Weitblick ermöglicht hat.
Zwei Minuten später schließt er die Haustür auf, und wieder empfängt ihn die Stille. Nur der Kühlschrank in der Küche ist zu hören: ein kurzes Ruckeln beim Anspringen der Kühlung, dann ein leichtes Summen.
Jetzt, am dritten Tag, beginnt die Arbeit für ihn Routine zu werden. Handschuhe an, Müllsack von der Rolle reißen und los. Das Bad soll heute auf jeden Fall leer werden. Erst das halbhohe Regal neben dem Klo. Er zieht den kleinen Vorhang auf: alles alte Schuhe, die die Eltern seit zig Jahren nicht mehr getragen hatten. In der untersten Reihe Pumps aus den 60er- oder 70er-Jahren, halbhoch mit spitzen Absätzen. Mit denen hat er seine Mutter nie gesehen; mit halbhohen breiteren Absätzen schon, aber diese pfennigkleinen, die hätten nicht zu der Frau gepasst, wie er sie in Erinnerung hat. Korpulent war sie schon in seinen Jugendjahren. Später legte sie sogar noch zu, sodass sie ihre Kleider weiter machen musste. Die meisten Sachen nähte sie ohnehin selbst, die letzten zwanzig Jahre fast nur noch Hosen und Jacken. Gekauft wurde nie etwas, nur Stoffe und davon sind noch immer jede Menge übrig, bestimmt fünf, sechs große Säcke.
Sie esse morgens nur zwei Scheiben Knäckebrot ohne was drauf, beteuerte sie vor den Geschwistern und dem Vater oft, dazu eine Tasse Kaffee und dann den ganzen Tag nichts mehr. Als Kinder glaubten sie das und fühlten manchmal auch ein wenig mit ihr. Später aber fragten sie sich, wie kann jemand, der so wenig isst und sich auch sonst fast alles versagt, so dick sein. Bestimmt hatte sie irgendwo in den Schränken Schokolade versteckt, über die sie herfiel, wenn sie allein war.
Berger kann sich nur schwer vorstellen, dass sie einmal eine sexuell anziehende Frau gewesen war. Sicher, auf alten Fotos sieht sie mit ihren blonden Locken aus wie die junge Hanna Schygulla. Auf so eine konnte ein attraktiver Mann in Uniform wie der Vater schon fliegen. Umgekehrt natürlich auch. Aber nachdem die Geschwister innerhalb von nicht mal vier Jahren auf die Welt gekommen waren, schienen die Eltern erotisch nichts mehr miteinander zu tun zu haben. Von Frida weiß Berger jedenfalls, dass die Mutter ihn „danach nicht mehr rangelassen“ habe. Der Vati will mit mir schlafen, aber ich möchte das nicht, waren ihre Worte. Frida traute sich damals nicht, nach dem Grund zu fragen. Berger hat seine Mutter nie nackt gesehen – doch, ein einziges Mal, als er die Tür des Eltern-Schlafzimmers öffnete. Da stand sie, fünf Meter entfernt mit dem Rücken zu ihm, vor dem Spiegel mit nur einer hautfarbenen Strumpfhose bekleidet, die von ihrem üppigen Hintern zu großer Dehnung gezwungen wurde. Und seinen Vater? Den sah Berger nur wenige Male im Umkleideraum des Tennisclubs, und dann auch nur für Sekunden. Obwohl der einen drahtigeren Körper hatte und attraktiver war als manch anderer Mann im Club, huschte er nach dem Spiel verstohlen unter die Dusche und zog sich danach schnell wieder seine Unterhose an. Zärtlichkeiten zwischen den Eltern waren auf zwei ausdruckslose Küsse beschränkt: wenn er von der Arbeit gekommen war und bevor er – meist noch vor den anderen – schlafen ging.
Berger hält einen Brief in der Hand, den er in einem der Kartons auf dem Badewannenbrett gefunden hat. Er stammt aus dem Jahr 1938 und ist mit Federhalter geschrieben – offenbar von der Mutter an den Soldaten Richard Berger, ihren zukünftigen Ehemann. Dein Annilein, lautet der Gruß zum Schluss, da kommen Berger ein paar Tränen. Ihr habt euch wirklich mal geliebt.
Unter dem Waschbecken findet er Plastiktüten mit alten Fotos: die Mutter als etwa neunjähriges Mädchen mit ihren beiden Brüdern und den Eltern, die drei Kinder mit schwarzen Schnürstiefeln und Wollstrümpfen, ihre Mutter und sie haben die langen Haare zu Zöpfen geflochten. Ein kleines, süßes Mädchen voller Unschuld. Ein paar Sekunden schaut er dieses Bild an.
Beim erneuten Blick auf die Kloschüssel fällt Berger ein Ritual des Vaters ein, dessen Zeuge die Geschwister oft wurden, während sie in ganz jungen Jahren nebenan in ihren Betten lagen. Er nannte es immer „Austreten“ und erledigte es im Stehen, sodass sie den Strahl im Abfluss spritzen hören konnten. Um einiges lauter aber waren seine Fürze, die sie einzeln zählten und dabei auch auf die Länge und Lautstärke achteten. Eins, zwei, drei, vier wurde dann gekichert und kommentiert. Und wenn der Vater sie noch tratschen hörte oder Licht brennen sah, schickte er seinem „Gute Nacht“ noch ein sanftes „Murkst euch aus!“ oder „Macht finster!“ hinterher. Berger schüttelt sich und leert weiter das Regal. Als es schließlich geräumt ist, spürt er eine tiefe Befriedigung. Erfreulich wenig zu entsorgen ist am Waschbecken und dem darüberhängenden Schränkchen. Zwei angerostete Nagelscheren und ein Kamm, in dem noch Haare stecken: das Letzte, was von ihrem Körper geblieben ist. Berger schaut ein paar Sekunden auf die grauen gewellten Haare, bevor er den Kamm in den Sack fallen lässt. Nur noch die Spraydosen auf dem Regal und die alten Putzlappen hinter der Tür, dann ist das Bad geräumt. Der erste leere Raum im Haus. Dieser Erfolg muss belohnt werden, also Kaffee und Kuchen.
Er hat so konzentriert gearbeitet und sich in seine Erinnerungen fallen lassen, dass er erst jetzt merkt, wie warm es draußen ist. Minuten später sitzt er wieder im Eiscafé, im ruhigeren hinteren Teil am Fenster, wo nur drei ältere Frauen am Nebentisch plaudern. Die Inhaberin grüßt ihn schon mit einem freundlichen Hallo und bringt wieder Kaffee und Käsekuchen. Berger öffnet das kleine Fenster, schaut auf den Langerfelder Markt, hört die Vögel zwitschern.
Einen Spaziergang durch die Straßen würde er jetzt gerne machen, die Sonne im Gesicht. Aber sie müssen sich ranhalten. Bald ist Sommer, dann wird es noch genügend Gründe geben gegen die Arbeit im Haus. Die Tennissaison steht bevor, das heißt: Mannschaftsspiele an mindestens fünf Wochenenden, andere Turniere nicht mitgerechnet. Dazu kommt natürlich der Job und der eine oder andere Urlaub oder Kurztrip. Und da ist auch noch Britta, Bergers Freundin, die ihn nicht nur als Entrümpler erleben will.
Ich muss mich aufs Ausräumen konzentrieren, darf mich nicht ablenken lassen von den Dingen, den Erinnerungen. Wie ein Unbeteiligter, ein Besucher. Aber nein. Das würde nicht funktionieren. Das hier ist mein Abschied. Von dir, vom Vati, von meiner Kindheit.
Auf einmal überkommt ihn eine wohltuende Gelassenheit. Er hat doch Zeit. Er kann sich in Ruhe von seiner Vergangenheit verabschieden. Und das wird er auch tun. „Uns drängt ja nichts“, hätte der Vater gesagt.
Der Keller fällt ihm ein. Da will er heute doch noch einmal reinschauen. Seit Jahrzehnten ist er da unten nicht mehr gewesen. Ob der Tenniskoffer, den er dem Vater vor mehr als 30 Jahren zu Weihnachten geschenkt hat, noch in der Waschküche liegt? Wäre doch Kult, mit dem Ding im Club aufzulaufen. Oder die alten Holzschläger: den schwarzen mit dem orangen und roten Balken im Herz, den Björn Borg damals spielte.
Er nimmt seine Jacke, zahlt und geht über den Marktplatz. Müllsäcke muss er noch besorgen, bei „Seifen-Gans“. Hier kaufte er immer sein DuschDas. Später war eine Zeitlang ein Früchte-Shampoo der Renner, Erdbeer und Apfel seine Lieblingssorten. Einmal probierte er sogar einen Tropfen davon, weil es so lecker roch: schmeckte natürlich nach Seife. Berger hält kurz inne, als er das Geschäft betritt: eine ähnliche Stille wie im Elternhaus. Es riecht nach altem Putzmittel, spärliches Neonlicht fällt in die wenigen Regalreihen. Aus dem hinteren Teil des Ladens erscheint eine Frau in einem Kittel und geht langsam in Richtung Kasse. Ihre und Bergers Schritte sind kaum zu hören auf dem abgewetzten Linoleumboden. Einige der Regale sind nur zum Teil gefüllt. Berger greift sich eine Rolle Müllsäcke und bezahlt, sein Blick fällt auf die Kasse: ein älteres Modell. Sein förmliches „Auf Wiedersehen“ beantwortet die Frau mit einem melodischen „Tschööhö!“
Als er wieder im Flur seines Elternhauses steht und auf die Packung Gummihandschuhe schaut, entscheidet er: genug für dieses Mal. Das Bad ist geräumt, und morgen ist auch noch ein Tag.