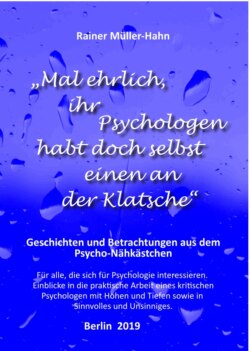Читать книгу "Mal ehrlich, ihr Psychologen habt doch selbst einen an der Klatsche" - Rainer Müller-Hahn - Страница 5
Teil 2: Ausbildung
ОглавлениеSchule
In der Grundschule war ich ein guter Schüler, galt als freundlich und sympathisch, glänzte manchmal im Unterricht mit verständigen Beiträgen und beteiligte mich engagiert. Aber ebenso schnell, wie mein Interesse aufflammte, verlosch es auch wieder. Ich tarnte mich dann mit einem wachen und aufmerksamen Gesichtsausdruck, um dahinter zu träumen. Diese Mimikry hat mich später als Erwachsener gut durch viele öde Besprechungen gebracht. Damals war es mir gleichgültig, wie es mit mir in der Schule weitergehen würde. Ein Besuch des Gymnasiums stand überhaupt nicht zur Diskussion. Ich sollte die Realschule besuchen und etwas „Ordentliches“ lernen. Die gymnasiale Karriere meines älteren Bruders war trotz zahlreicher Nachhilfestunden gescheitert, und er durchlief nun lustlos eine Lehre als Maschinenschlosser.
Meine Mutter und mein verstorbener Vater besaßen beide die Mittlere Reife. Meine Mutter war überzeugt, dass das von ihnen vererbte intellektuelle Potenzial vom Nachwuchs nicht überschritten werden könne. Der Fehlschlag bei den Bildungsbemühungen meines Bruders schien diese erbbiologisch geprägte Annahme zu bestätigen. Eine solche Entwicklung wollte sie sich und mir ersparen. Es kam aber anders.
Kurz vor Ende der Grundschulzeit drängte ich plötzlich darauf, das Gymnasium besuchen zu dürfen. Ich hatte mich unsterblich in Monika verliebt - ein Mädchen aus meiner Schule. Sie würde das Gymnasium besuchen, und ich wollte ihr dahin folgen, um weiterhin mit ihr zusammenzubleiben. Als ich zuhause erklärte, später einmal Lehrer werden und deshalb zur Oberschule gehen zu wollen - es war der einzige akademische Beruf, der mir eingefallen war - löste das sowohl Erstaunen, Freude, aber auch Zweifel aus. Gefangen im Zwiespalt zwischen dem Wunsch, dem Jüngsten Zugang zu höherer Bildung zu verschaffen und der pessimistischen Erfolgsaussicht, verstärkt durch die negative Erfahrung mit dem Erstgeborenen, berief meine Mutter eine Art Familienrat ein und lud ihren Cousin Rolf dazu. Er hatte den höchsten Bildungsgrad in unserer Familie erreicht, war in seiner schulischen Laufbahn bis zum Abitur gekommen, aber zweimal durch die Prüfung gefallen. Dennoch verlieh ihm das in den Augen meiner Mutter den Status eines Bildungssachverständigen.
Dieser Onkel Rolf sagte, dass ich einen sehr schwierigen, steinigen Weg gewählt hätte, und dass ich dabei Blut und Tränen schwitzen würde. Er ereiferte sich bei der Beschreibung der schulischen Anforderungen derart, dass man den Eindruck gewann, er wolle mit seinem Plädoyer gegen die gymnasiale Ausbildung das eigene schulische Versagen rechtfertigen. Nach längerer Aussprache - in der ich mein wirkliches Motiv schamhaft verschwieg - stand fest, ich würde das Gymnasium besuchen. Ich jubelte innerlich, konnte ich doch weiter mit Monika zusammen sein! Gleichzeitig hatte ich ein schlechtes Gewissen, alle so unverfroren belogen zu haben.
Meine Mutter sagte zum Abschluss sehr eindringlich, ich solle mir darüber im Klaren sein, dass ich es war, der diesen Schritt gewollt habe. Ich gab ihr das Versprechen, dass es nicht an Einsatz und Fleiß mangeln werde. Dabei ahnte ich dumpf, etwas auf mich genommen zu haben, was ich nicht so einfach abschütteln konnte.
Start ins Gymnasium
Nun sollte für mich der „Ernst des Lebens“ beginnen, wie man mir prophezeit hatte. Am ersten Tag des neuen Schuljahres stand ich beklommen und unsicher vor dem Gymnasium, ein Bau, einer großen Villa ähnlich, mit unfreundlicher grauer Fassade. Der Putz war großflächig abgefallen und überall befanden sich in der Mauer Einschusslöcher aus vergangenen Kriegshandlungen. Wie wenig einladend das alles wirkte! Grau, wie grauenhaft. Etwas krampfte sich in mir zusammen. Und meine Befürchtungen sollten sich bald als berechtigt erweisen.
Ich betrat mit gemischten Gefühlen das Gebäude. Innen war es nicht wesentlich freundlicher. Decke und Wände, früher einmal weiß, hatten im Laufe der Zeit einen schmutzigen Ton angenommen. Vom grauen Panel der Wände war die Farbe an vielen Stellen abgeblättert, und es hatten sich Flächen gebildet, die wie Landkarten aussahen - Kontinente einer Fantasiewelt, umgeben von grauen Ozeanen. Die Einschulung begann mit einer kleinen Feier. Die Direktorin begrüßte uns mit einer leblosen Einführungsrede. Ihre Kleidung war grau, der Gesichtsausdruck starr, die fahle Gesichtsfarbe und das ungepflegte graue Haar passten zum Gebäude und seiner Atmosphäre. Grau war wohl das Markenzeichen dieser Lehranstalt. Sie machte den Eindruck, als würde sie sich durch uns neue Schüler belästigt fühlen, die sie von Wichtigerem abhielten. Ein Ausdruck eines Willkommens war das nicht. Auch der Vortrag des Schülerchors konnte meine Stimmung nicht verbessern. Das alles wirkte lust- und lieblos. Aber wie konnte es in einer solchen freundlosen Umgebung anders sein? Während der ganzen Veranstaltung saß ich wie auf Kohlen, weil ich danach fieberte, Monika endlich wiederzusehen. Ich konnte sie aber nirgends entdecken. Nach Ende des ersten Schultages händigte mir eine Freundin Monikas einen Brief aus. Sein Inhalt war wie ein Faustschlag in den Magen. Dort stand, dass Monika mit ihren Eltern ins Ausland gezogen sei, wo ihr Vater Arbeit gefunden habe. Den Entschluss, auszuwandern, habe sie selbst erst wenige Tage vor der Abreise erfahren, als sie aus den Ferien bei den Großeltern auf dem Land zurückgekehrt war. Sie hatte geschwiegen, um nicht früher als notwendig mir mein Herz schwer zu machen. Eine Adresse hatte sie nicht hinterlassen. Sie sah keine Chance mehr für uns.
Mehrere Tage lang war ich krank. Eine unstillbare Sehnsucht peinigte mich: Ich erlebte, wie es ist, wenn jemand stirbt, den man liebt. War das die Strafe für meine Lüge? Ich benötigte etwa ein Jahr, bis die Gedanken an Monika nicht mehr schmerzten. Von ihr habe ich nie wieder etwas gehört.
Die Ironie des Schicksals bestand nun darin, dass ich die, die ich liebte verloren hatte, und das erhielt, was ich nie wollte. Ich war Gefangener meines Versprechens. Ich durfte nicht scheitern.
Gymnasiales Elend
Die nun folgenden schulischen Erfahrungen waren düster. Ich kam in dieser Schule nicht zurecht und schrammte gerade eben am Sitzenbleiben vorbei. Verantwortlich dafür war die Mischung aus meiner Interesselosigkeit, meinem gedrosselten Fleiß und den Eigenarten einiger Lehrer. Letztere machten mir schwer zu schaffen und verstärkten meinen schulischen Widerwillen - ein Teufelskreis. Vielleicht hätten sie mich motivieren und fördern können. Aber sie schüchterten mich wie viele meiner Schulkameraden gewollt oder ungewollt ein. Sie machten uns ständig klar, was für armselige Würstchen wir wären, und dass die meisten von uns nicht hier her-gehörten.
Ich erinnere mich noch sehr deutlich an zwei besonders engagierte und feinfühlige Pädagogen. Es handelt sich um sie graue Direktorin, die Mathematik unterrichtete und den ähnlich farblosen Lateinlehrer.
Die Direktorin hatte sich auf Einzelförderung spezialisiert
und mich dafür auserkoren. Ich wusste allerdings nicht, womit ich diesen Vorzug verdient hatte, dass sie mich zu Beginn jeder Unterrichtsstunde aufrief. Vielleicht hatte sie intuitiv meine spontane Antipathie gespürt. Offensichtlich wollte sie die Schere zwischen meinen schriftlichen und mündlichen Leistungen schließen. Erstere waren einigermaßen in Ordnung. Dabei ging sie wie folgt vor.
Ich musste aufstehen, sie musterte mich von oben bis unten mit kaltem Blick und stellte mir dann eine Aufgabe. Sie zu lösen, gelang mir schon deshalb nicht, weil ich sehr aufgeregt war. Ich hatte Probleme, meine Gedanken zu ordnen und selbst gut Gelerntes vollständig und zusammenhängend wiederzugeben. Von Mal zu Mal wuchs meine Aufregung. Ich errötete, stotterte und redete ungereimtes Zeug. Viele andere Lehrer hätten hier bereits aufgegeben, weil ihnen klar sein musste, dass ich so zu keiner vernünftigen Antwort in der Lage sein konnte. Nicht so die Direktorin. Sie ließ sich nicht beirren, sondern glaubte fest daran, dass sie in der Tiefe meines Bewusstseins doch noch auf solide mathematische Kenntnisse stoßen würde. Und so bohrte sie mit neuen Fragen beharrlich weiter. Vermutlich interpretierte sie meine Panik und meine Tränen als Versuch, meine Kenntnisse trotzig vor ihr verbergen zu wollen. Nach einiger Zeit ergebnisloser Befragung ließ sie dann doch von mir ab. Sie rief einen anderen Schüler auf und forderte diesen auf, die Lösung der mir gestellten Aufgabe herzuleiten. Dabei durfte ich weiterhin stehend dem Mitschüler lauschen und konnte so meine eigenen Defizite erkennen. Auf diesem Wege verschaffte sie mir eine wertvolle Orientierungshilfe, wie ich bei einer mathematischen Problemstellung vorzugehen hätte. Zum Abschluss dieses sensiblen pädagogischen Rituals, erklärte sie in launiger Art, dass sie weiterhin in diesem Topf rühren zu wollen. Und sie rührte fleißig. Jede Mathematikstunde. Sie gab mich nicht auf. Dennoch gelang es nicht, meine mündlichen Rechenleistungen zu verbessern. Meine Blockaden im Denken schienen unüberwindbar. Auch intensive Vorbereitungen auf diese Fördermaßnahme nutzten nichts. Ihre Ergebnisse verflüchtigten sich bereits auf dem Schulweg.
In vollkommener Verkennung des segensreichen Zwecks empfand ich diese Sonderförderung als demütigend und sadistisch. Kurz, ich litt wie ein Hund unter dieser Bevorzugung.
Eines Tages nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und wandte mich auf Anraten meines Bruders nach der Schulstunde direkt an sie. Ich spürte ihr Erstaunen, als ich sie bat, mir zu helfen, meine mündlichen Leistungen zu verbessern. Sie reagierte schroff und unwillig. Wahrscheinlich erlebte sie mich als undankbar und sagte, ich sollte mich mehr auf den Hosenboden setzen und lernen. Von diesem derart originellen Ratschlag war ich tief bewegt. Zu meinem Erstaunen folgte diesem Gespräch eine eindrucksvolle Veränderung. Von Stund’ an entfiel das unterhaltsame Eröffnungszeremoniell der Mathematikstunde, zum Bedauern einiger Schulkameraden. Die Direktorin behandelte mich nun wie jeden anderen Schüler. Ich stand noch eine Zeit lang unter starker Anspannung. Als diese langsam abflaute, begriff ich recht schnell und meldete mich sogar, wenn ich mich einer richtigen Lösung sicher wähnte. Meine Leistungen verbesserten sich. Das registrierte auch meine Förderin. Ich bin davon überzeugt, dass sie diese Veränderung ihren hoch entwickelten pädagogischen Fähigkeiten zugeschrieben hat. Eine andere Methode, die auch eher der Einschüchterung als erfolgreichem Lernen diente, durfte ich bei unserem Lateinlehrer erleben. Wir nannten ihn „Klöte“. Der Spitzname kam seinem tatsächlichen Namen phonetisch sehr nahe. Dieser knorrige, ältere Mann, immer bekleidet mit demselben grauen Anzug, besaß eine bemerkenswerte Angewohnheit: Stets patrouillierte er auf dem Mittelgang zwischen den Sitzreihen auf und ab. Besonders zu bedauern waren die am Gang sitzenden Schüler, weil er diese bevorzugt befragte. Ich besaß einen solchen Platz und niemand war bereit, ihn mit dem seinen zu tauschen. Bei einer falschen Antwort auf seine Fragen näherte sich „Klöte“ dem Gesicht des betroffenen Schülers und kreischte diesem ins Ohr: „Na, da haben wir wohl wieder mal mit Zitronen gehandelt!“ Dem folgte ein schrilles, höhnisches Lachen. Diese hilfreiche Aufmunterung erfuhr auch ich. Die Male, und es waren gar nicht wenige, als er seine Fragen an mich stellte, hatte ich das zweifelhafte Vergnügen seiner Nähe, und es traf mich nicht nur sein schrilles Lachen, sondern zusätzlich noch ein Schwall übelriechenden Mundgeruchs.
Erstaunlicherweise führte auch diese ausgeklügelte pädagogische Methode bei mir nicht zu Motivationsschüben und guten Lernergebnissen, steigerten aber meinen Handel mit Südfrüchten.
Es war einigen Lehrern gelungen, dass ich an meinen Fähigkeiten ernsthaft zweifelte. Insofern entsprach dieser Schulabschnitt der Einschätzung meines bildungssachverständigen Onkels. Kaum auszudenken, was ohne den Schutzschild meiner Interesselosigkeit geschehen wäre. Hätte ich, wie viele meiner Mitschüler Ehrgeiz besessen, ich wäre vermutlich an meinen Misserfolgen verzweifelt und hätte mein Versprechen gebrochen. Das aber durfte nicht geschehen.
Der Fairness wegen möchte ich abschließend noch einen Lehrer erwähnen, der mit seinem ungewöhnlichen Unterrichtsstil dazu beigetragen hatte, dass ich nicht aufgegeben habe. Durch ihn erfuhr ich ein bedeutsames Prinzip, dass ich erst viel später erkannte und dass mein Denken und Handeln stark beeinflusst hat.
Es war der Nachfolger des grauen, zynischen Lateinlehrers mit dem schlechten Mundgeruch. Auch der Neue war ein älterer Mann, besaß große Vitalität, Optimismus und Gelassenheit, galt aber als harter Hund. Alle nannten ihn nur den „Doktor“. Meine Leistungen waren von seinem Vorgänger als mangelhaft bewertet worden. In allen übrigen Fächer sah es mit einem mageren Ausreichend nur wenig besser aus, aber es reichte gerade noch für die Versetzung.
Der Doktor erklärte zu Beginn, er stehe uns als Angebot genau für die Dauer der Schulstunde zur Verfügung. Als Angebot! Ich dachte ich hätte mich verhört. Das war etwas ganz Neues und Ungewöhnliches in diesem verstaubten Laden. Das Erstaunlichste aber waren seine folgenden Aussagen: Er sei gern Lehrer und es mache ihm Spaß zu unterrichten. Den wolle er sich nicht durch lustlose und unwillige Schüler verderben lassen, die zudem interessierte Schüler am Mitmachen hinderten. Deshalb werde er es uns freistellen, sein Lehrangebot anzunehmen. Er sei verantwortlich für das, was wir lernten, aber nicht dafür, ob wir lernten. Das sei allein unsere Sache. Wer also nicht am Unterricht teilnehmen wolle, müsse sich zwar in der Lateinstunde im Raum aufhalten, könne sich aber mit anderen Dingen beschäftigen, wenn er dadurch andere nicht stört. Außerdem habe er die ganze Zeit über den Mund zu halten. Auf dem Zeugnis werde ein Mangelhaft als Zensur erscheinen.
Ich hielt dieses Angebot zunächst für einen Witz und war misstrauisch. Der Doktor aber wirkte vollkommen ernst. Ich fühlte mich angesprochen. Da ich im wahrsten Sinne des Wortes mit meinem Latein am Ende war, traute ich mir in diesem Fach keine Verbesserung mehr zu. Selbst wenn ein Pflänzchen Interesse an der lateinischen Sprache in mir aufgekeimt wäre, dann hätte es „Klöte“ mit seiner hämischen Freude am Versagen seiner Schüler gründlich zertrampelt.
Deshalb faszinierte mich diese Möglichkeit, aus dem Lateinunterricht auszusteigen. Ich meldete mich. Der „Doktor“ ließ mich meine Entscheidung noch einmal bekräftigen. An die anderen gewandt, wollte er wissen, ob sich mir noch jemand anzuschließen gedachte. Ich blieb der Einzige. Das machte mich ein wenig stolz.
Ich habe dann überlegt, was geschehen wäre, wenn alle Schüler oder eine große Anzahl sich gegen seinen Unterricht entschieden hätten? Ein Lehrer, der den meisten Schülern im Unterrichtsfach schlechte Zensuren verpasst, wäre doch im Schuldienst nicht tragbar. Aber wahrscheinlich getrauten sich nur Wenige, von seinem Angebot Gebrauch zu machen, und die meisten waren auch mit ihren Leistungen nicht so schwach wie ich. Damit wird er gerechnet haben. War ich vielleicht sogar sein erster Lateinverweigerer?
Im Verlauf des Unterrichts begriff ich, dass er sich damit die Mitarbeit der anderen Schüler gesichert hatte. Mit ihrem Verzicht auszusteigen, hatten sie ihm dafür indirekt eine Zusage gegeben, aktiv mitzumachen. Das war außerordentlich schlitzohrig. So erinnerte er unaufmerksame Schüler und solche, die die Hausaufgaben nicht gemacht hatten, an ihre Zusage mitzumachen. Anderenfalls müssten sie ja neben mir sitzen.
Der Erfolg trat ein. Verglichen mit dem Unterricht zuvor, gab sich jeder beim Doktor ernsthaft Mühe und man kam gut voran. Ich lernte durch ihn einen lebendigen und lockeren Unterrichtsstil kennen, der sich wohltuend von dem der meisten anderen Lehrer unterschied. Ich jedenfalls genoss meine Sonderrolle, fühlte mich frei und freute mich, dass ich nicht unter dem Joch des Vokabellernens und der lateinischen Grammatik stöhnen musste. Aber bereits nach der zweiten Woche hatte sich die Freude über meine exklusive Stellung merklich abgeschwächt. Ich begann mich zu langweilen und folgte immer öfter dem Unterricht. Wie einfach Latein doch war: Logisch, klar strukturiert, keine Zungenbrecher wie im Englischen und Französischen. Die Lateinstunden der nächsten Wochen vergingen quälend. Ich beantwortete jede Frage, übersetzte jeden Satz und ordnete die Fälle zu. Alles im Stillen und alles korrekt. Manchmal brachte mich die Begriffsstutzigkeit meiner Klassenkameraden fast zur Verzweiflung. Dann in der vierten Woche geschah es: Ein Satz sollte grammatikalisch analysiert werden. Eine ganz einfache Sache. Wieder einmal herrschte Schweigen aus Unkenntnis und Unsicherheit. Als es für mich unerträglich wurde, platzte ich laut mit der richtigen Lösung heraus. Der Doktor schaute mich strafend an, aber ehe er etwas sagen konnte, fragte ich, ob ich am Unterricht wieder teilnehmen dürfte. Ich erhielt ein kühles „in Ordnung“. Von nun an machte mir Latein Spaß und ich konnte bis zum Ende des Schuljahres ohne größeren Aufwand eine mehr als befriedigende Leistung erzielen. So bildete der Unterricht beim „Doktor“ einen der wenigen Glanzpunkte in diesem Schulabschnitt. An der Quälerei durch die anderen Lehrer konnte das aber nichts ändern. Als der „Doktor“ die Schule verließ, entschied ich mich für einen Mittelweg zwischen Aufgeben und Weitermachen. Ich wechselte zum Schulhalbjahr in ein anderes Gymnasium mit einer naturwissenschaftlichen Ausrichtung.
Der „Magier“
Auf dem Halbjahreszeugnis befanden sich für meine Verhältnisse erstaunlich gute Noten. Damit gelang mir ein ordentlicher Einstieg in die neue Schule. Es herrschte dort eine freundlichere Atmosphäre, die Lehrer waren angenehmer, lockerer und unterstützender. Was außerdem noch hinzukam, waren gemischte Klassen, Männchen und Weibchen lernten zusammen. Das war neu für mich und sehr spannend. In einigen Fächern brachte ich einen kleinen Kenntnisvorsprung mit und konnte so eine kurze Zeit von meinen bescheidenen Wissensvorräten zehren. Ich erlebte das erste Mal in meiner Oberschulzeit, frei von Druck und Sorgen zu sein. Meine Zensuren im folgenden Halbjahr verschlechterten sich zunächst nicht. Ich konnte mich sogar in einigen Fächern leicht verbessern. Aber schließlich kam es, wie es kommen musste: Bereits am Ende des nächsten Schuljahres bewegte ich mich auch in dieser Schule wieder an der Grenze des Sitzenbleibens. Wieder stand ich unter Druck.
Mein damaliger bester Freund aus der Klasse der alten Schule war zu einem Schulwechsel nicht zu bewegen gewesen. Er folgte dem Motto: „Lieber bekanntes Elend, als unbekanntes Glück“. Auch seine Schulkarriere hing an einem seidenen Faden. Wir trafen uns weiterhin regelmäßig, besuchten nicht nur Partys, sondern führten auch intensive Gespräche über unsere Lebenssituation, über Mädchen, Schule, Eltern und Zukunft.
Eines Tages entsprang einem solchen Gespräch eine verwegene Idee: Wir wollten unseren Horizont erweitern und in der Volkshochschule Kurse belegen. Diese Absicht war absurd. Uns fehlte es ja nicht an Erkenntnismöglichkeiten. Wir kamen schon mit denen nicht zurecht, die wir hätten nutzen sollen. Aber irgendwie reizte uns eine zusätzliche außerschulische Bildung. Sie sollte keinesfalls ein Schulfach betreffen. Zur Auswahl standen Philosophie- und Psychologiekurse. Keiner von uns hatte damals eine genaue Vorstellung, was es mit diesen Wissensgebieten auf sich hatte. Die kurzen Inhaltsangaben im Heft der Volkshochschule klangen gleichermaßen spannend. Wir entschieden wir uns für den Psychologiekurs.
Von den insgesamt zwölf Personen waren wir die einzigen männlichen Kursteilnehmer und die jüngsten. Unser Dozent, Herr M., Diplom-Psychologe seines Zeichens, sah nicht nur aus wie ein Magier, sondern war auch ein solcher. Er besaß eine ausgesprochen mystische Ausstrahlung: stets dunkel gekleidet, das schwarze, pomadige Haar straff nach hinten gekämmt, wo es ein kräftiges Haarpolster im Nacken bildete. Die dunklen, wachen Augen schienen alles zu durchbohren. Sein schmales Gesicht zierten ein an den Spitzen sorgfältig nach oben gezwirbelter Oberlippen- und ein schmaler Kinnbart. Körperlich war er ein sehr kleiner Mann, der trotz hoher Absätze, gerade eben die Marke von einhundertsechzig Zentimetern erreichte, aber er war ein Riese im Geist. Unglaublich, was er wortgewandt und eindringlich zu berichten wusste! Für mich hatte das durchaus den Charakter von Zauberei. Ich hing an seinen Lippen und war fasziniert.
Stellen Sie sich vor: Aus kleinsten Zeichen des Verhaltens, der Mimik und der Handschrift vermochte er Charakter, Denkweise und unbewusste Eigenarten eines Menschen abzulesen! Er analysierte vor allem berühmte Persönlichkeiten, beginnend mit den römischen Kaisern über Napoleon, Goethe, Bismarck bis zu Hitler und Stalin. Alle diese historischen Gestalten kamen auf seinen psychologischen Seziertisch, und er gewährte uns tiefe Einblicke in das Innenleben dieser Personen. Und was brachte er nicht alles zutage: uneingestandene Homosexualität, Neigungen zu Perversionen, Sadismus, verborgene erotische Liebe oder Hassgefühle gegen Elternteile und vieles mehr. Herr M. wandte jedoch niemals seine psychodiagnostischen Fähigkeiten auf uns, seine Zuhörer an. Wir waren wohl nicht ganz so bedeutend, wie die von ihm analysierten Größen der Geschichte.
Herr M. begegnete uns sehr freundlich und aufmerksam, ständig bemüht, auf Fragen einzugehen. Er begegnete uns auf Augenhöhe, wobei dieses Bild bei seiner Körpergröße nicht wörtlich genommen werden sollte. Eines jedenfalls stand für mich schon nach den ersten Stunden fest: Derartige Fähigkeiten und tiefgründige Erkenntnisse wollte ich unbedingt erwerben. So wurde ich sein gelehriger Schüler. Als einmal das Thema Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen nach der Lehre Alfred Adlers anstand, verwandte er als Beispiel die körperliche Unzulänglichkeit Kaiser Wilhelm II. Darin sah er die Ursache für Geltungssucht und Machtstreben des Monarchen. Ich betrachtete die Körpergröße unseres Dozenten. Psychologie als Ausgleich für Kleinwüchsigkeit? Galt das auch für mich? Nein, ich maß einen Meter und vierundachtzig. Diesbezüglich wähnte ich mich als unverdächtig. Aber versuchte ich nicht doch, die Löcher im Selbstbewusstsein und in der Leistungsfähigkeit mithilfe von psychologischen Kenntnissen zu stopfen?
Zu Beginn meiner Studien bei Herrn M. war ich besorgt, er könnte bis auf den Grund meiner schwarzen Seele blicken. Deshalb hielt ich Distanz und fühlte mich höchst unwohl, wenn er mich anblickte oder mir Fragen stellte. Eigentlich hätte ich schon gern gewusst, was er bei mir feststellen würde, getraute mich aber nicht, ihn direkt zu fragen. Seitdem kann ich mir gut vorstellen, wie sich mancher fühlt, wenn er privat oder beruflich mit einem Psychologen zu tun hat. Langsam fasste ich Vertrauen und konnte meine Unsicherheit und Besorgnis ablegen.
„Psychoterror“
Ich hatte Feuer gefangen. Mein Freund nicht. Dieser zog sich schon nach dem ersten Kurs wieder zurück, weil er den angebotenen Themen nichts abgewinnen konnte. Ich blieb damals bei der Stange, belegte sämtliche Kurse bei Herrn M. in Tiefenpsychologie und Grafologie, las Freud, Jung und Adler, besorgte mir Testverfahren und bastelte unbeschwert von Kenntnissen der Testtheorie und -methodik einige Verfahren nach Gutdünken. So ausgerüstet terrorisierte ich fortan Freunde und Bekannte in Schulklasse, Kneipe und Party. Niemand in meiner Umgebung blieb von meinen Testverfahren, graphologischen und psychologischen Analysen verschont. Ich zog durch meine Welt und warf mit Diagnosen um mich, wie ein Karnevalsprinz die Kamelle. Einwände der Betroffenen gegen die eine oder andere Deutung aus Handschrift oder Testergebnis ließ ich nicht gelten. Schließlich war ich der Experte. Ich argumentierte dann hauptsächlich mit dem Begriff des Widerstandes. Damit ist eine bewusste oder unbewusste Abwehr gemeint, unerwünschte Tatsachen zu leugnen. Wenn also jemand meinte, meine Deutung aus dem Zeichentest sei doch recht beliebig, so hielt ich ihm vor, dass er sich nur gegen eine neue, unangenehme Erkenntnis wehren wolle. Damit besaß ich die Lizenz zum uneingeschränkten Rechthaben.
So war es nicht ganz unverständlich, dass viele Leute bald die Lust verloren, sich mit meinen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. Alles in allem hatte ich wohl mit diesen Aktivitäten schon ungewollt ein Beispiel dafür geliefert, dass Psychologen und jene, die sich mit Psychologie befassen, recht suspekte Gestalten sind.
Ich setzte meine neuen Erkenntnisse und vermeintlichen psychologischen Fähigkeiten auch zur Werbung um das andere Geschlecht ein, in der Hoffnung, damit meine Attraktivität zu erhöhen. Dies erwies sich zur Herstellung von Liebesbeziehung jedoch als vollkommen erfolglos, ja sogar kontraindiziert, was ich erst später begriff.
In der neuen Schule hatte ich mich sogleich in den weiblichen Star der Klasse verliebt - eine recht glücklose Angelegenheit. Ich warb mit allen verfügbaren Mitteln um sie. Als Pseudopsychologe hörte ich mir viele Stunden ihre Probleme an. Sie sprach offen und detailreich über die Probleme und den Sex mit ihrem deutlich älteren Freund, der zudem noch Besitzer eines Autos war. Ich schwänzte mit ihr den Unterricht und verbrachte händchenhaltend diese Zeit mit endlosen Spaziergängen und ebenso langen „tiefgründigen“ Gesprächen. Oder ich schleppte sie, wenn sie wieder einmal mit ihrem Freund zerstritten war, auf Partys. Trotz psychologischer Beratung, Alkohol und Klammertanz lief nichts, außer einem bisschen Petting. Gegen den Freund kam ich nicht an. Dieser war zuständig für den Körper, ich für die Seele, der gute Kumpel und Freund. Was für eine grauenhafte Rolle! Ich lebte wie ein Hund, ständig die Wurst vor der Nase, ohne hinein beißen zu können. Verlogen verständnisvoll und ohne zu zeigen, dass ich vor Eifersucht zu bersten drohte, war ich ständig auf der Suche nach einer Fuge, um das Verhältnis zum Freund auseinander zu hebeln.
Sie fragen vielleicht, warum ich mir diesen Tort angetan und nicht losgelassen habe? Die Antwort lautet: Weil da immer ein Quäntchen Hoffnung bestand, durch Verständnis, Beständigkeit und Geduld, doch noch als der wahre und bessere Partner erkannt zu werden. Und solche Hoffnung wurde von ihr durchaus am Leben erhalten, indem sie ab und an ermutigende Zeichen setzte. Um im Bild zu bleiben, sie warf dem Hund einen winzigen Happen zu. Denn auch sie hatte ja Interesse, ihren Seelentröster zu behalten. Es war eine grausame Gefangenschaft, aus der zu entkommen, mir nur über eine andere Beziehung möglich war.
Später ist mir klargeworden, dass es vermutlich nichts Unerotischeres und Unattraktives gibt, als einen Mann, der seine Gefühle und sexuellen Absichten genau der Person gegenüber leugnet, die sie auslöst, der seine Bedürfnisse mit einer aufgeblähten, vor Fürsorglichkeit triefenden Helferrolle versteckt und dessen Interesse nicht auf die ganze Person, sondern scheinbar nur auf deren Schwierigkeiten gerichtet ist. So endeten all’ meine Bemühungen mit einem Fiasko, nicht nur bei dieser Frau. Wer will sich schon auf einen psychischen Kastraten einlassen?
In der Schule bewirkte die Beschäftigung mit dem neuen Interessengebiet jedoch Erstaunliches. Ich verbesserte deutlich meine Leistungen. Wann immer es möglich war, brachte ich meine gewonnenen Erkenntnisse in den Deutschunterricht ein. Die Lehrerin war über diesen plötzlichen ungewöhnlichen Wissenszuwachs und meine Mitarbeit sehr erfreut. Sie schätzte meine Beiträge und nach kurzer Zeit verlieh sie mir den Status eines Psychologieexperten. Diese neue Rolle und das damit gewachsene Selbstvertrauen strahlten auch auf andere Schulfächer aus. Ich fühlte mich sicherer, erfasste schneller Zusammenhänge und Prinzipien, antwortete mutiger. Ich stand nicht länger wie die Kuh vorm Tor oder sah den Wald vor Bäumen nicht. Offensichtlich hatte ich nach dem Grundsatz von Paul Watzlawik1 gehandelt, der in seinen Arbeiten unter anderem sinngemäß schreibt, wenn du nicht weiterkommst, tue nicht ein „Mehr Desselben“, tue etwas Anderes. Man kann diesen Mechanismus mit einer Erinnerungsblockade vergleichen: Trotz angestrengter Suche findet man einen geläufigen Begriff erst dann, wenn man aufhört zu grübeln und etwas Anderes denkt oder tut. Mein Psychologiefaible war das Andere.
Als wäre ich ein paar Schritte zurückgetreten und erhielte nun aus dieser Distanz einen größeren Überblick. Diese Distanz entängstigte mich und mobilisierte neue Kräfte. Das führte jedoch nicht dazu, dass ich ein guter Schüler wurde. Allerdings war die Gefahr des Sitzenbleibens erst einmal gebannt.
Damals habe ich dieses Prinzip nicht erkannt, erst später wurde es mir in vielen Fällen im Nachhinein bewusst. Mich bewegt heute noch die Frage, wie diese unbewusste Strategie des Umweges funktioniert. Wer oder was ist in mir so wachsam und klug, frühzeitig die Sackgasse zu erkennen, in die ich mich verrannt habe, um mich dann auf einen anderen, gangbaren Weg umzuleiten?
Ich bestand die Reifeprüfung beim ersten Anlauf. Die gesamte Schulzeit über war ich ein Grenzgänger zwischen Risiko des Scheiterns und geringstmöglichen Arbeitsaufwand. Weil mir diese Balance gelang, bin ich niemals sitzen geblieben. Das aber war mit einem hohen Preis verbunden, den ich bald zu zahlen hatte.
Das Studium
Nun war ich eingeschriebener Student der Psychologie. Im Studienführer hatte ich Seminar- und Vorlesungsthemen gefunden, die beim Magier Herrn M. nie eine Rolle gespielt hatten. Die Inhalte, die ich bei ihm gelernt hatte, waren gar nicht oder nur am Rande aufgeführt. Stattdessen gab es mehrteilige Kurse der Allgemeinen Psychologie mit den Bereichen Wahrnehmung, Gedächtnis, Sprache und Motivation, Seminare zu Erkenntnistheorien, zur Sozial-, Entwicklungs- und Betriebspsychologie sowie Statistik. Von Psychotherapie, Hypnose und autogenem Training war weit und breit nichts zu entdecken. Ganz am Rande wurde ein Kurs für Grafologie angeboten, bei dem man zwar einen Schein erwerben konnte, der aber für die Zulassung zum Vordiplom keine Bedeutung besaß. Dann gab es für Studierende nach dem Vordiplom drei Seminare mit dem Titel „Einführung in die Tiefenpsychologie“. Es war aber eher eine Ausführung aus dem Thema. Eine weitere Seminarreihe beschäftigte sich mit dem Thema Testtheorie und Testkonstruktion. Diese Angebote erschienen mir höchst merkwürdig und alarmierend.
Zu Beginn jedes Semesters fand ein sogenannter Institutskongress statt. Dort wurden Forschungs- und Diplomarbeiten von Institutsmitgliedern vorgestellt. Für Anfänger wie mich eine hervorragende Möglichkeit zu einer ersten Orientierung. Die Darbietungen lösten bei vielen Dozenten und Studenten große Begeisterung und Beifall aus. Mich dagegen sprachen sie nicht an. Ich kam mir vor wie im Physikunterricht. So wurde zum Beispiel in einem Experiment nachgewiesen, dass von sechs gleichlangen, nebeneinander aufgereihten Stäben der letzte von den meisten Versuchspersonen als kürzer eingeschätzt wurde. Dazu gab es dann noch eine Handvoll Erklärungen, die mir alle nichts sagten, und es begann eine lebhafte Diskussion, von der ich nichts verstand. Meine Güte, Herr M., wo war ich da hineingeraten, wohin haben Sie mich geführt? Meine so sicher geglaubte Wissensgrundlage, auf der mein Selbstbewusstsein ruhte, zerbröckelte zusehends. Mir war elend, und ich kam mir nackt und dumm vor, fühlte mich umzingelt von studentischen Geistesgrößen mit Bestnoten im Abitur, Studienaufenthalten im Ausland oder einem anderen Erststudium. Und dann waren da noch die Professoren und Dozenten - wissenschaftliche Lichtgestalten.
Mitten unter all diesen Leuten befand ich mich, als kleine flackernde Tranfunzel, die kaum Licht ausstrahlte. Ich kannte meine Leistungsmöglichkeiten nicht. Woher auch? Ohne an die eigenen Leistungsgrenzen zu gehen, sondern sich die gesamte Schulzeit nur durchzulavieren, war das nicht möglich. Mein intellektuelles Potenzial hielt ich für erbärmlich und war mehr darum bemüht, Wissenslücken zu kaschieren, anstatt sie aufzufüllen.
Dass ich meinen Fluchtimpulsen nicht nachgab, verdankte ich einem anderen Studienanfänger und späteren engen Freund. Ich traf ihn zur ersten Vorlesung und wir kamen ins Gespräch. Nach ein paar Semestern Medizin war er zur Psychologie übergewechselt. Er war sehr belesen und gut auf das neue Studium vorbereitet. Seine Bewertung der Inhalte des Studiengangs, seine Ironie und sein Witz ermutigten mich. Langsam ließ ich mich auf diese andere Psychologie ein. Bald konnte ich mich sogar für sie begeistern. Mich beeindruckten die Methoden zur Gewinnung gesicherter Erkenntnisse, ich bewunderte den kreativen Aufbau von Experimenten und fand Gefallen an der Diskussion über Erklärungsmodelle. Meine Vorstellung über Statistik als langweilige Erbsenzählerei wurde positiv enttäuscht. Ich lernte vielfältige Berechnungs- und Prüfmethoden kennen, mithilfe derer man abschätzen kann, ob und in welchem Maße bei Ergebnissen eines Experiments der Zufall seine Hand im Spiel hat und erhielt auf diesem Wege Kenntnisse in der Diagnostik und Testkonstruktion.
Ein Durchbruch zu wissenschaftlichem Arbeiten entstand, als ich zusammen mit besagtem Freund die Gelegenheit erhielt, ein umfangreiches Experiment zum Themenkreis „emotionales Lernen“ in weitgehend eigener Regie zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Mit seiner aufwändigen Versuchsanordnung, dem Einsatz einer damals noch sehr klobigen Videotechnik und sechzig Versuchspersonen, stellte es eine außerordentliche Herausforderung dar. Nach etwas mehr als einem Jahr konnten wir respektable Ergebnisse vorweisen.
Eine Sternstunde bildete dann noch der Besuch des Wissenschaftlers aus den USA, der dieses Forschungsgebiet entwickelt hatte. Er besichtigte unsere Versuchsanordnung, über die er sich sehr beeindruckt zeigte, und wir diskutierten mit ihm und unserem anleitenden Professor verschiedene theoretische und praktische Probleme.
Diese Arbeit hatte einen wissenschaftlichen Erkenntnishunger und den unbändigen Wunsch ausgelöst, weitere spannende psychologische Fragen zu beantworten.
Als nach Abschluss des Projektes der Studienalltag wieder eintrat und sich die Euphorie gelegt hatte, beschäftigte mich die Frage, wie es mit mir weitergehen sollte. Ich hatte für eine Karriere im Wissenschaftsbetrieb Feuer gefangen, wusste aber, dass nicht jeder Studienabsolvent eine Assistentenstelle würde erhalten können. Unter den Studierenden bestand ganz allgemein eine Unzufriedenheit über die wissenschaftliche Kopflastigkeit der Ausbildung, verbunden mit der Frage, was man damit nach dem Studium anfangen könne.
Erste Praxiserfahrungen
Zuvor galt es jedoch, gemäß der Ausbildungsordnung, praktische Praktika in drei psychologischen Praxisfeldern zu absolvieren. Sie lieferten mir nicht nur wichtige Eindrücke, sondern sie waren eine Art Wegweiser für meine späterer berufliche Ausrichtung.
Personalentwicklung
Das erste Praktikum konnte ich bereits nach dem zweiten Semester in der Personalabteilung eines großen Lebensmittelkonzerns in Hamburg antreten. Hier arbeitete ein Psychologe, der sich um die Auswahl des akademischen Führungsnachwuchses kümmerte - ein sehr freundlicher und nachdenklicher Mann. Er bereitete mir einen herzlichen Empfang und war um mein Wohlbefinden bei der Arbeit sehr bemüht. Ich fühlte mich wohl, obwohl mir bewusst war, dass ich keine Kenntnisse besaß, mit denen ich seine Arbeit unterstützen konnte. Meine Aufgabe bestand darin, den bisher verwandten, zeitaufwendigen Konzentrationstest mit einem anderen, zeitökonomischeren Verfahren zu vergleichen und zu klären, ob beide zu gleichen Ergebnissen führen würden. Träfe das zu, könnte das bisherige Verfahren ersetzt werden.
Mein Anleiter half mir und brachte mir viel statistische Methodik bei. Ich lernte Statistik in der konkreten Wirklichkeit anzuwenden, noch bevor ich entsprechende Seminare an der Uni belegt hatte. Über seine Hauptaufgabe, der Auswahl von Nachwuchskräften, erfuhr ich nur etwas aus seinen Berichten. Da in der Zeit meines Praktikums kein Auswahlverfahren stattfand, konnte ich an den dafür eingesetzten Einzel- und Gruppeninterviews, den Testverfahren und Auswertungsdiskussionen nicht teilnehmen. Er war jemand, der sich darum bemühte, die Auswahl seiner Methoden sorgfältig vorzunehmen und zu verfeinern - eine Tugend, die ich in der späteren Berufswirklichkeit nicht allzu oft angetroffen habe.
Das Ergebnis dieses Praktikums bestand nicht nur im fachlichen Kenntniserwerb. Einen entscheidenden Gewinn brachten die damit verbundenen Begleitumstände: Ich lebte und arbeitete das erste Mal in meinem Leben ganz allein in einer fremden Stadt, wohnte im Studentenheim und lernte dort eine Studentin kennen, mit der ich viele Abende in der Gemeinschaftsküche das Essen zubereitete, nachts das sehr schmale Bett teilte und oft mit ihr den damals noch nicht so berühmten Hamburger „Star Club“ besuchte. Diese Auswärtserfahrungen ließen mich kenntnisreicher, vor allem aber sehr viel selbstbewusster nach Hause zurückkehren, als ich von dort gestartet war.
Jugendgerichtshilfe
Das zweite Praktikum absolvierte ich in der Jugendgerichtshilfe. Diese Fachabteilung des Jugendamtes berät junge Straftäter und ihre Familien, nimmt an den Gerichtsverhandlungen teil, besitzt ein Vorschlagsrecht zum Urteil und zu übernimmt die Nachbetreuung der Jugendlichen. In diesem Rahmen lernte ich sehr viel soziales Elend kennen, erfuhr einiges über jugendliche und heranwachsende Straftäter, deren Beweggründe und deren Umfeld. Bei Hausbesuchen traf ich Eltern an, die sich kaum auszudrücken vermochten oder nur wenige Stunden am Tag nüchtern waren. Ich erlebte viele Arten von Verwahrlosung, sah Spuren von Gewalt und lernte Straftaten in allen Schattierungen kennen. Eine Wirklichkeit, mit der ich weder im elitären Studienzirkel des Volkspsychologen Herrn M., noch im Elfenbeinturm des Universitätsinstituts in Berührung gekommen war. Schließlich machte ich Erfahrungen mit dem Jugendgericht. Dies ist ein Bereich der Rechtsprechung, von dem die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Hier Einblicke zu gewinnen, war ausgesprochen eindrucksvoll. Ich nahm an Gerichtsterminen teil, bei denen ein Bericht über die Entwicklung des Straftäters gegeben werden musste. Er sollte Aussagen zur Entwicklungsreife und Prognose des Jugendlichen sowie Vorschläge zu erzieherischen Maßnahmen enthalten.
Ich wurde von erfahrenen Sozialarbeitern angeleitet, die mich in ihre tägliche Arbeit einbezogen und denen ich nicht nur Berichtsentwürfe vorlegen, sondern für die ich auch den endgültigen Bericht vor Gericht vortragen und vertreten musste. Das führte zunächst zu Lampenfieber, das sich aber bald legte. Dieses Praktikum erfüllte durch-aus meine Erwartungen bezüglich praktischen Handelns im sozialen Bereich, schien aber kaum Verbindungen zur akademischen Psychologie zu besitzen. Der psychologische Gehalt des Praktikums war eher gering. Mir fiel auf, dass in den Falldiskussionen mit meinen Anleitern kein Rückgriff auf psychologische Theorien oder auf sonstige psychologische Erkenntnisse stattfand. Man argumentierte auf der Grundlage von Erfahrungen und versuchte, mit konkreten Zielsetzungen und praktischen Maßnahmen, weitere Auffälligkeit der Jugendlichen oder Heranwachsenden zu verhindern. Allerdings setzten sich sowohl Sozialarbeiter als auch Jugendrichter in Aus- und Fortbildung mit psychologischen Fragestellungen auseinandersetzen. Das änderte jedoch nichts an meinem Eindruck, dass die Psychologie, wie ich sie bis dahin kannte, für diesen Bereich nicht viel zu bieten schien. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, hat mich diese Arbeit sehr beeindruckt und den Gedanken aufkommen lassen, möglicherweise später mit Straftätern zu arbeiten.
Erziehungsberatung
Die Vordiplomprüfung hatte ich erfolgreich hinter mich gebracht. Sie war die Voraussetzung, um ein Praktikum in einer Erziehungsberatungsstelle ableisten zu können. Ich erhielt einen Praktikumsplatz in einer staatlichen Einrichtung, in der eine Frau J. residierte. Sie war eine ältere, kinderlose, stämmige und resolute Psychologin - Herrscherin über eine Pädagogin und eine Bürokraft. Die Pädagogin, schüchtern, blutarm und altjüngferlich, fristete im Spielzimmer zwischen Bauklötzen und Stofftieren ein stilles, karges Dasein. Die Schreibkraft war eine freundliche, unsichere Frau mittleren Alters. Sie wurde mir vorgestellt, nicht ich ihr. Ich war ja schließlich angehender Psychologe. Der Standesdünkel von Frau J. erhob mich zu einem sachkundigen Kollegen, einem Assistenzarzt gleich, der den Chefarzt bei der Krankenvisite begleiten durfte. Sie erklärte mir bei diesem Kennenlernen, dass sie aus der Mitarbeiterin bereits eine wichtige psychologische Hilfskraft gemacht habe. Diese käme sehr gut mit den Eltern bei der Anmeldung zurecht und führe bereits die kleine Anamnese selbstständig durch. Dann schaute sie stolz auf ihren Zögling herab und lächelte diesem aufmunternd zu. Die so Gelobte nickte verlegen und lächelte gequält. Mir ging durch den Kopf, dass hier jemand erklärt, wie man Meerschweinchen füttert und großzieht. Kurz vor dem Verlassen des Büros blickte Frau J. noch kurz über den in der Schreibmaschine eingespannten Bogen und sagte beiläufig herablassend, dass da noch ein Komma fehle und rauschte mit mir im Gefolge aus dem Raum.
Später erfuhr ich, dass die sogenannte kleine Anamnese nicht mehr beinhaltete, als einige Stammdaten der Eltern und Erkrankungen der Kinder mittels Fragenkatalogs aufzunehmen.
Das Auftreten von Frau J. hatte etwas Imposantes. Sie trug bei den Beratungsgesprächen immer einen weißen Kittel und wusch sich nach jedem Gespräch die Hände, obwohl sie niemandem die Hand gereicht hatte. Alles was sie tat, strotzte vor Bedeutung, hatte nahezu rituellen Charakter: ihre Bewegungen, Sitzhaltung, die Art, wie sie die Brille auf- und absetzte, sich etwas notierte, die Eltern anblickte und ihnen Erklärungen zum Verhalten der Kinder gab. Das alles gebot größte Ehrfurcht. Zu den Ratsuchenden hielt sie große Distanz. Nie ein Zeichen warmer oder gar herzlicher Hinwendung. Ihre Miene war unbewegt und mit blasierter Ernsthaftigkeit wie in Stein gemeißelt. Eine Ausnahme allerdings gab es: Wurde Frau J. mit „Frau Doktor“ angesprochen, was die meisten Eltern schon wegen des ärztlichen Gehabes spontan taten, dann entkrampfte sich ihr Gesichtsausdruck zu einem sparsamen, freundlichen und leicht verlegenen Lächeln. Kokett wie ein Backfisch protestierte sie milde. Nein, sie sei nicht promoviert, sie hätte zwar begonnen …, aber der Krieg …, man wisse schon …! So nannte ich sie im Stillen Frau Doktor. Kinder mochte sie nicht besonders. Eine bemerkenswerte Eigenschaft für die Leiterin einer Erziehungsberatungsstelle. Sie sprach Kinder nie mit Namen an, hatte nur ein paar dürre Worte für sie übrig und schob sie schnell ins Spielzimmer der Pädagogin ab. Sie hielt Kinder wohl für eine Bande undisziplinierter Stoffwechsler, deren Lebenszweck es ist, Erwachsenen das Leben schwer zu machen.
Hin und wieder ließ sie sich in die Niederungen des Spielzimmers herab, um ein Bild vom Verhalten eines Kindes zu gewinnen. Hätte es einen Wettbewerb in Schnelldiagnostik gegeben, sie wäre als unangefochtene Siegerin daraus hervorgegangen. Ein, zwei Blicke, schon war alles klar, das Gesehene reichte ihr für eine profunde Diagnose. Ähnlich flink ging sie auch bei Erwachsenen zu Werk.
Unsere Fallgespräche vollzogen sich hauptsächlich nach folgendem Muster: Sie begannen mit der Frage, wie ich das Verhalten einer Person einschätzen würde. Noch ehe ich antworten konnte, verkündete sie bereits ihr Ergebnis und fügte ein kollegiales „nicht wahr?“ hinzu. Sie bemerkte mein Erstaunen, schien es als Bewunderung ihrer Treffsicherheit auszulegen und sagte mit einer Mischung aus Selbstgefälligkeit und Ermutigung, dass man diese Fähigkeit erst nach langjähriger Praxis entwickeln könne. Was sie nicht mitbekam, war, dass ich über die Art des Zustandekommens und den Inhalt ihrer Feststellungen entsetzt war. Wie völlig anders war das, was ich im Studium lernte! Dort brachte man uns bei, was notwendig war, um einigermaßen gesicherte Aussagen über Menschen zu treffen. Erforderlich sei ein erheblicher Zeitaufwand für sorgfältige und systematische Befragungen und Untersuchungsverfahren, die objektive, gültige und zuverlässige Ergebnisse erbringen. Aber wahrscheinlich hatten Leute, die so etwas lehrten, nicht die Höhen der Erkenntnis und Erfahrung von Frau Doktor erreicht. So waren auch vorsichtige Einwände zwecklos, Diskussionen darüber würgte sie ab. Ihr Wort galt, sie sprach „ex cathedra“. Ich war mehrmals anwesend, als sie mit der Pädagogin einen Fall erörterte. Gleichgültig, wie die Pädagogin das Verhalten des Kindes beschrieb und interpretierte und welche Maßnahmen sie erwog, sie wurde grundsätzlich von Frau Doktor unterbrochen und korrigiert. Stets verhielt es sich ganz anders. Die Pädagogin - offensichtlich im Umgang mit solchen Situationen geübt - antwortete jedes Mal in gleicher Weise: Mit dem Ausdruck erstaunten und erlösenden Erkennens sagte sie, dass man das ja tatsächlich so sehen müsse. Diese tiefgreifende selbstkritische Erkenntnis zauberte auf das meist teilnahmslose Gesicht ihrer Chefin einen freundlich-mitleidigen Ausdruck, der in Worte gefasst hätte lauten können: „Na siehst du, warum denn nicht gleich so?“ Als Amtsperson hatte Frau Doktor auch Gutachten für Gerichte zu erstellen, um Fragen nach der Erziehungsfähigkeit von Eltern zu beantworten. Sie stellte mir zu Lehrzwecken einige ihrer Arbeiten wohlwollend zur Verfügung. In den Gutachten fand ich eine unglaubliche Aneinanderreihung von wissenschaftlich anmutenden Sprachhülsen - ein gigantisches Wortgeklingel. Es strotzte voller Beliebigkeiten und Urteilen aus Vermutungen und Meinungen. Argumente und Folgerung zeigten logische Brüche, und es gab unübersehbare Hinweise auf Parteilichkeit der Gutachterin. Was hatte das mit dem zu tun, was ich in der Universität lernte?
„Entenschmidt“
Das Leben als Student gewann langsam eine gewisse Normalität. Die meiste Zeit verbrachte ich zusammen mit meinem Studienfreund am Psychologischen Institut oder wir besuchten Vorlesungen zu Nebenfächern Medizin, Biologie und Philosophie. Seit dem ersten Semester waren wir Mitglieder einer sechsköpfigen Studentengruppe, die von einer Tutorin geleitet wurde, einer Studentin aus einem höheren Semester.
Wir blieben auch nach Ende des Tutoriums als lockere Studiengemeinschaft zusammen. Meinem Freund wurde aufgrund seiner Eloquenz, seines Scharfsinns und seiner guten Fachkenntnisse bald eine Führungsrolle zugeschrieben. Das war vorteilhaft für mich, weil ich mit meinen intellektuellen Minderwertigkeitsgefühlen in seinem Kielwasser mitschwimmen konnte. Ein Gruppenmitglied erhielt von uns den Spitznamen „Entenschmidt“. Es war ein grobschlächtiger, schwerblütiger, freundlicher, junger Mann, der oft in sich versunken schien. Den Namen erhielt er, weil er mit Inbrunst und Kraft manchmal während der Vorlesungen Tiere in die Tischplatte ritzte und dabei recht laut zu stöhnen begann. Das Lieblingstier, das er auf diese Weise abbildete, war eine Ente. Schmidt besaß etwas Unbeirrbares, Stoisches. Wir mochten ihn gern, hatten aber den Eindruck, dass er im Studium nicht mitkommen würde. Er lebte immer häufiger in seiner eigenen Welt, kam nur noch selten zu den Vorlesungen und tauchte schließlich gar nicht mehr auf. Niemand wusste, wo er abgeblieben war.
Unsere Ausbildung umfasste auch eine Vorlesungsreihe in Psychiatrie. Das Besondere daran waren die Fallvorstellungen. Es war spannend und auch ein bisschen gruselig, wenn so eine arme Figur in den Vorlesungsraum gebracht wurde und der Professor, dessen Nazivergangenheit kaum zu ignorieren war, die Person auf ein bloßes Objekt der Erkenntnis reduzierte. Er sprach dann über dessen Entwicklung und Symptome und zeigte gelegentlich, ähnlich einem Dressurakt, wie die Person auf bestimmte Reize reagierte. Neben der Faszination hatten diese Zurschaustellungen etwas Trauriges und Entwürdigendes an sich. In einer der Vorlesungen sah ich „Entenschmidt“ wieder; nicht auf der Zuhörerbank, sondern als einen solchen Patienten, der in einem Rollstuhl in den Hörsaal gebracht wurde. Für mich wäre er kaum wieder zu erkennen gewesen, wenn der Professor nicht ohne Häme erwähnt hätte, dass es sich bei diesem Patienten um einen Psychologiestudenten handle. Schmidt war stark verändert. Sein sonst sehr kräftiger Körper schien geschrumpft und schlaff zu sein, das Gesicht besaß eine leicht gelbliche Färbung, die Wangen waren eingefallen. Obwohl er offensichtlich vollkommen wach war, zeigte er nicht die geringsten Reaktionen auf die Personen im Hörsaal und auch nicht auf die Provokationen des Professors. Dieser hatte schneidig eine katatone Schizophrenie diagnostiziert. Das ist eine Krankheitsform unbekannter Herkunft, bei der die Betroffenen durch Sprach- und Bewegungslosigkeit nicht auf ihre soziale Umwelt antworten. Dieses Wiedersehen war für mich verstörend und traurig. Normalerweise sind solche Patienten anonyme Fälle, bei denen man das Leben vor der Krankheit kaum kennt, geschweige darin selbst eine Rolle gespielt hat. Hier aber gab es eine kurze gemeinsame Geschichte und eine persönliche Beziehung. Ich stellte mir die Frage, wie weit ich psychisch vom ehemaligen Kommilitonen entfernt sei.
Die eigene Psychotherapie
Gelegentliche indirekte Hinweise und diskrete Bemerkungen meiner Leute aus der Studiengruppe machten mir deutlich, dass diese etwas miteinander verband, was sie mir nicht mitteilen wollten. Ich wurde hellhörig. Schließlich kam es ans Tageslicht: Alle außer mir befanden sich in psychotherapeutischer Behandlung.
Eigentlich hätte ich zufrieden sein können, als Einziger in dieser Truppe nicht, oder wenigstens nicht so stark psychisch lädiert zu sein, dass ich professionelle Hilfe in Anspruch hätte nehmen müssen. Aber im Gegenteil, dieser Umstand verstärkte mein Minderwertigkeitsgefühl. Ich betrachtete die Psychotherapie der anderen als eine Art exklusives studienbegleitendes Förderprogramm, von dem ich ausgeschlossen war. Dass es sich dabei um einen Versuch handelte, mit persönlichen Schwierigkeiten fertig zu werden, die man allein nicht zu bewältigen glaubte, hatte ich ausgeblendet.
Der Weg auf die Couch
So beschloss ich, mich ebenfalls in psychotherapeutische Behandlung zu begeben, musste die Hemmung überwinden, anderen und mir selbst Einblick in die vermutliche Leere meines Inneren zu gewähren. Das ließ mich die Anmeldung zur Therapie immer wieder aufs Neue verschieben. Schließlich raffte ich mich auf und bat meinen Hausarzt, mir eine solche Behandlung zu verordnen.
Es folgte eine vertrauensärztliche Untersuchung, von der abhing, ob eine Psychotherapie für mich angezeigt war. Bei Licht besehen, wiederholte sich in dieser Untersuchung eine frühere Situation. So wie mir Lügen und Halbwahrheiten vor dem „Familienrat“ damals zum Besuch des Gymnasiums verhalfen, erreichte ich auf ähnlichem Wege die Teilnahme an einer Psychotherapie. Ich gab wahrheitsgemäß an, unter Minderwertigkeitsgefühlen, Ängsten und Leistungsproblemen zu leiden. Das war aber nur ein Teil der Wahrheit. Eigentlich hätte ich erwähnen müssen, dass meine Kommilitonen eine solche Behandlung in Anspruch nahmen und ich mich benachteiligt fühlte. Aber wer sagt schon so etwas? Der müsste nun wirklich verrückt sein! War ich es? Bevor ich mich zu diesem Schritt entschlossen hatte, fragte ich mich ernsthaft, ob ich ohne diese Konstellation im Studium oder bei einem anderen Studiengang wegen meiner Schwierigkeiten im Leistungsbereich jemals eine Therapie in Anspruch genommen hätte. Einen richtigen Leidensdruck empfand ich nur selten, denn Minderwertigkeitsgefühle schüttelten mich ja nicht den lieben langen Tag. Im Gegenteil, in Bereichen außerhalb des Studiums war ich recht stabil und fühlte mich sicher. Ich hatte vor und während des Studiums Jobs angenommen, in denen ich hart arbeiten musste. Ich brauchte Geld. Die Arbeiten erledigte ich gut und wurde in den Semesterferien immer wieder vom Arbeitgeber angefordert. Mit meinem Verdienst hatte ich den Führerschein und ein kleines, gebrauchtes Auto erworben. Mit meiner Freundin war ich schon einige Jahre zusammen. Zwar kriselte es in der letzten Zeit immer stärker, weil ich mich von ihr eingeengt fühlte. Aber das war keine große Belastung, ich wollte nur frei sein. Ich hatte Freude am Sex und feierte gern Partys, besaß einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, in dem man meine Gesellschaft suchte und schätzte, allerdings erst, nachdem ich die Belästigungen mit den Psychotests eingestellt hatte. Aber selbst dort, wo ich neuen intellektuellen Anforderungen begegnete, hatte ich eines gelernt: So schwer mir der Start auch fiel, ich war sicher, dass ich im Laufe der Zeit ganz gut damit zurechtkommen würde. Das hatte mich die bisherige Erfahrung gelehrt. Schließlich war ich ja Spezialist im Durchmogeln. Dann kam mir der Gedanke, das Motiv der Benachteiligung vielleicht nur konstruiert zu haben, um mir eine Rechtfertigung für eine Psychotherapie zu verschaffen, weil unbewusste, stürmische und ungesunde Prozesse in mir tobten. Waren die Unsicherheit und das Minderwertigkeitsgefühl als Sendboten an die Oberfläche meines Bewusstseins geschickt worden? Dann wäre meine Entscheidung, mich in Behandlung zu begeben, eine Antwort auf stille innere Hilferufe, um mich von einer mir nicht bewussten neurotischen Störung zu befreien. Etwas leugnen, was man nicht kennt? Ja, so kompliziert kann Psychologie sein! Aber vielleicht war auch der knappe Hinweis des Kollegen entscheidend, dass die Therapie eine ganz spannende Angelegenheit sei. Ich sollte das ruhig machen. Das war eine Empfehlung wie für einen guten Film. Meine Mutter war bestürzt, als ich sie über meine Absicht informierte. Sie meinte, dass ich doch gar nicht verrückt sei und fragte, was mich so bedrücke. Ich erwiderte schroff, dass ihre ständige Fürsorge meiner Entwicklung im Wege stünde. Aber sie bemuttere mich doch gar nicht und schränke mich nicht ein, entgegnete sie betroffen. Besorgt darüber, ob in meiner Erziehung etwas schiefgelaufen sei, fragte sie, was sie denn falsch gemacht habe? Darauf wusste ich keine Antwort und sagte, es sei keine Frage von Richtig oder Falsch. Es gehe darum, mich von ihr abzunabeln, um meine eigenen Möglichkeiten entwickeln zu können. Sie verstand das nicht, sagte auch nichts mehr, war nur traurig und ich hatte wieder einmal ein schlechtes Gewissen. Sie sprach dieses Thema auch nicht wieder an. Einige Jahre später habe ich ihr in einem langen Brief einiges über die Therapie und meine damaligen Beweggründe berichtet. Nach der vertrauensärztlichen Untersuchung folgte eine längere, unbestimmte Wartezeit. Mir wurde von meinen kollegialen „Fachleuten“ empfohlen, die Wartezeit durch häufiges Nachfragen über einen bald möglichen Behandlungsbeginn zu verkürzen, da man ein solche Beharrlichkeit als Zeichen für einen starken Leidensdruck werte. Ich folgte diesem Ratschlag, rief fleißig bei dem psychotherapeutischen Institut an und präsentierte mich als schweren Fall. Dann war es so weit. Ich erhielt eine Adresse von einer Psychotherapeutin und einen Termin.
Leben auf der Couch
Die Psychotherapeutin war eine verhältnismäßig junge Frau, die gerade angefangen hatte zu praktizieren. Eine Anfängerin! Das kränkte mich. Alle meine Kollegen wurden von renommierten Fachleuten behandelt, darunter sogar Lehranalytiker - also Ausbilder von Therapeuten. Diese Tatsache war Wasser auf die Mühle meiner Benachteiligungsgefühle, die ja den Ausschlag für dieses Unternehmung gegeben hatten.
Die Rahmenbedingungen der Therapie waren einfach und klar: Drei Mal pro Woche pünktliches Erscheinen, Liegen auf der Couch, nicht handeln, Träume aufschreiben und Abwesenheitszeiten rechtzeitig vereinbaren. Der Gesprächsrahmen, den die Behandlungsmethode zubilligte, war außerordentlich schmal. Zusammen mit der Begrüßung und Verabschiedung erschöpften sich die Beiträge der Therapeutin in einer Handvoll Fragen: „Was fällt Ihnen dazu ein?“, „Was fühlen Sie jetzt?“ oder „Sie haben eben eine Person erwähnt, was für ein Gefühl löst diese in Ihnen aus, können Sie das näher beschreiben?“ Meist aber bestand das Verhalten der Therapeutin in einem stillen, duldenden Verstehen. Besonders zu schaffen machte mir die Verpflichtung, die Stunde zu eröffnen und alles aussprechen, was ich fühlte und was mir durch den Kopf ging. Oft genug begann die Stunde mit einem langen Schweigen, aus dem ich nicht erlöst wurde. Hinter mir blieb alles still. So verrann Zeit in spannungsgeladener Wortlosigkeit. Der Druck in mir wuchs und wuchs. Wenn ich aber diese Hemmschwelle überwunden hatte, eröffnete sich eine gewaltige gedankliche und sprachliche Freiheit ohne Beschränkungen durch Zensur und moralische Verurteilung. Diese Freiheit musste aber in jeder Stunde neu errungen werden. Dann ging es etwas holpernd in freier Assoziation quer durch Traum, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Wie es sich für eine klassisch psychoanalytisch ausgebildete Psychotherapeutin gehört, saß sie in einem Sessel seitlich hinter der Couch. Wie gern hätte ich mit ihr normal gesprochen und sie dabei angesehen. Das war nicht erlaubt. Wenigstens konnte ich während der „Liegungen“, wenn ich den Kopf etwas zur Seite drehte, einen Blick auf ihre schönen schlanken Beine erhaschen. Sie benutzte einen Schreibblock für Notizen und schrieb mit einem Füller, dessen Feder ein kratzendes Geräusch auf dem Papier machte. Sie schrieb nicht die ganze Zeit, sondern nur, wenn ich etwas für sie offenbar Bedeutungsvolles sagte. Ziemlich schnell hatte ich herausgefunden, was ich ansprechen musste, damit es hinter mir auf dem Papier schrabte. Meine Trefferquote wurde immer besser. Vielleicht, lieber Leser, werden Sie fragen, wie ich mich in diesen Stunden fühlte? Das ist schwierig zu sagen. Ich kann es nur mithilfe eines Bildes beschreiben: Wasser kann man exakt nach Temperatur, Farbe, Klarheit und darin gelösten Inhaltsstoffen beschreiben. Weitaus schwieriger ist es zu erläutern, wie man sich fühlt, wenn man sich darin aufhält. Übertragen auf die Therapie kann ich sagen, manchmal war es ein Baden, ein Abwaschen, eine Abkühlung, ein Planschen im flachen Wasser, ein Sich-Treiben-Lassen, ein Wettschwimmen, ein Schweben, ein Tauchgang und ein Strampeln, um nicht zu ertrinken. Kurz, es war ein Wechselbad der Gefühle.
Träume
Sie spielten in der Behandlung eine zentrale Rolle. Wegen ihrer Bedeutung für den Prozess habe ich drei Träume als Beispiel meinem damaligen „Therapiehefter“ entnommen. Traumdeutungsexperten können nun einen Blick in mein damaliges Innenleben werfen.
Traum 1
Ich befinde mich in einem bunten Gewirr von Menschen. Es ist eine Zirkustruppe. Man trägt mir die Rolle des Löwendompteurs an. Der richtige Löwenbändiger ist nicht mehr da. Als Preis dafür soll ich ein Mädchen aus der Gruppe zugesprochen bekommen, in das ich verliebt bin. Zunächst habe ich keine Angst, diese Aufgabe zu übernehmen. Dann aber verzögert sich alles. Ich bekomme zunächst keine Peitsche, und als ich sie endlich in der Hand halte, gelingt es mir nicht, damit zu knallen. Mir kommen Zweifel, ob ich als Dompteur nicht versagen werde, zumal ich meinen Kopf in den Rachen eines Löwen stecken muss. Dabei wird mir angst und bange, weil der Löwe mich ja nicht kennt. Jemand sagt mir, dass ich vor der eigentlichen Arbeit einmal durch die Arena gehen solle. Ich erkundige mich, was für Reizworte die Löwen kennen und welche Belohnungen sie nach einem Kunststück bekommen. Ich erhalte keine Antwort. Ein Freund kommt aus der Manege, auch er war ein Ersatzlöwenbändiger. Ich frage ihn, wie es ihm ergangen sei. Er tut so, als sei es ein Kinderspiel. Der Zeitpunkt für meinen Auftritt ist schon weit überschritten; das Publikum bereits ungeduldig. Ich melde mich beim Ansager, einem Clown, damit er mich ankündigen kann.
Traum 2
Ich komme zu einer Fabrik, ich glaube es ist eine Bäckerei. Es arbeiten dort Frauen. Eine davon gefällt mir gut und ich unterhalte mich mit ihr. Sie lässt sich zu einem Rendezvous überreden. Dabei habe ich das Gefühl, diese Verabredung gar nicht einhalten zu wollen. Dann kommen die Eltern dieser Frau in den Raum. Die Mutter ist sehr attraktiv, sie ist so gekleidet, als wolle sie zu einer exklusiven Gesellschaft gehen. Der Vater ist ziemlich groß. Die Familie begibt sich zu Tisch. Ich fühle mich plötzlich furchtbar überflüssig und weiß meine Verlegenheit nicht zu verbergen. Ich entschuldige mich und werde ganz klein. Ich kann grade noch über die Tischkante blicken. Mir scheint, man sieht es als einen großen Fauxpas an, dass ich mich um die Tochter bewerbe und mich damit der Familie aufdränge.
Ich gehe dann durch ein Industriegebiet und bin in guter Stimmung. Plötzlich springt mir etwas in die Hosentasche und fällt am Hosenbein herab. Es ist eine Maus. Mir fällt ein, dass es in dieser Gegend sehr viele Mäuse gibt.
Ich bin dann in einer Wohnung. Sie gehört einem mir unbekannten Mädchen. Ihr Freund ist auch dort. Das Mädchen steigt in eine Badewanne nur mit Strumpfhose und Büstenhalter bekleidet. Der Freund greift zwischen ihre Beine und berührt sie grob am Geschlechtsteil. Dann drückt er ihren Kopf unter Wasser. Dabei kann ich ihr Gesicht sehen. Es kommt mir irgendwie bekannt vor und ich befreie sie aus dieser Lage. Wir liegen dann beide auf einer Couch und küssen uns. Sie drängt sich dabei an mich. Ich freue mich darüber, dass ich sie getroffen habe, will mit ihr schlafen, aber erst später, wenn die Luft rein ist.
Ich mache mit einigen Freunden Musik auf der Straße. Ich spiele Trompete. Die anderen haben auch Trompeten und Posaunen. Wir machen einen gewaltigen Radau. Keiner von uns kann richtig spielen, aber es macht großen Spaß. Vom Blasen der Trompete habe ich eine stark geschwollene Oberlippe bekommen, sodass ich bald keinen Ton mehr herausbekomme.
Traum 3
Ich fahre in der Bahn. Es ist eine Strecke, die ich nicht kenne. An einer Station steige ich aus. Der Bahnsteig ist ein Bücherladen, eigentlich mehr ein Kunstgewerbegeschäft. Die Station heißt „News“, und ich bin erstaunt, wie viele Zeitschriftenartikel es hier gibt, wie sie in unserer Bibliothek im psychologischen Institut vorhanden sind.
Leute stehen an einem Tisch und würfeln. Es ist ein Glücksspiel. Dabei wird ein Würfelbecher verwandt, nur schüttelt man darin keine Würfel, sondern silberne Münzen. Vorher hat man eine Zahl anzusagen. Einer setzt auf die Vier und gewinnt ein Heftchen Briefmarken.
Auf der Straße ist ein Unfall geschehen. Ein riesiger Lastwagen kommt, um die Teile der zerstörten Autos einzusammeln. Ich will von den Teilen, die schon auf dem Wagen sind, eine neue Vorderachse für mein Auto billig kaufen. Man zeigt mir eine und nennt den Preis. Er ist nicht hoch, aber ich habe das Geld nicht bei mir. Außerdem fehlt an dieser Achse gerade das Teil, das bei meiner auch nicht in Ordnung ist.
Ein Chinese trägt auf der Straße Gedichte und Tänze vor. Ich bin davon sehr ergriffen. Er ist alt, hat eine Glatze und einen Fadenbart.
Ganz schön verrückt, nicht wahr? Was diese Träume zu bedeuten hatten, weiß ich nicht mehr. Einige betrafen das Studium und die Prüfungen, sicher auch die Therapie, wenn ich für die beschädigte Vorderachse meines Autos ein Ersatzteil aus dem Schrott suchte. Meine Minderwertigkeitsgefühle werden wohl im Schrumpfungsprozess bei Tisch sichtbar, und die Mäuse weisen wahrscheinlich auf geldliche Dinge hin. Ebenso ist das Thema Partnerschaft und Sexualität stark vertreten. Aber mit welchen anderen Problemen oder Lebensfragen sollte ich mich sonst befassen? In der Therapie habe ich gelernt, die einzelnen Traumbilder zu entschlüsseln. Das geschieht nicht mittels einfacher formelhafter Zuordnung, wie ich sie gerade vorgenommen habe, also Mäuse gleich Geld, Löwe gleich Prüfer, Peitsche, die nicht knallt, gleich Unfähigkeit und so weiter. Die Traumbilder und -symbole sind Ausgangspunkt zu gedanklichen Assoziationen, also spontanen Einfällen, Erinnerungen an reale Erlebnisse und Gefühle aus früherer oder der letzten Zeit - sogenannte Tagesreste. Man deutet sie im Wesentlichen selbst und entdeckt dabei unterschiedliche Erlebnis-, Problem- und Zeitebenen, die in einem Traumbild verdichtet sind.
Was wir nachts in unserem Kopf veranstalten, ist offenbar eine komplizierte, kreative und hochintelligente Verschlüsselungsleistung. Ich habe übrigens sehr schnell gelernt, meine Träume im Gedächtnis zu behalten, die im nächtlichen Heimkino zur Aufführung kamen.
Irgendwann kam mir der Gedanke, ob ich diese wirren Filme als Autor, Regisseur und Schauspieler speziell für die Therapie produzierte? Vielleicht wollte ich meiner Therapeutin etwas Spannendes und Kniffliges anbieten? Diese Frage wird wohl unbeantwortet bleiben müssen.
Ende der Therapie
Irgendwann war es genug. Meine Therapie entwickelte sich zu einem übergeordneten Zweitleben. Mehr und mehr durchdrang sie meinen Alltag, den sie allmählich zu zersetzen und zu ersetzen drohte. Sie nahm große Bereiche meines Bewusstseins in Beschlag, sog Aufmerksamkeit auf und lähmte Spontaneität. Es war, als würde das Verhalten und Erleben von einer höheren Warte genau überwacht werden. Ich fühlte mich dabei wie ein Gefangener beim Hofgang, der weiß, dass er beobachtet wird, bei allem was er tut, der aber auch gleichzeitig der beobachtende Posten auf dem Wachturm ist. Ich fühlte mich mehr und mehr von mir selbst eingeschränkt und kontrolliert. Außerdem begann ich, anstehende Handlungen und Entscheidungen in die Therapie zu tragen und dort zu besprechen. Das war zwar bequem, aber es brachte eine zunehmende Abhängigkeit mit sich. Auch heute treffe ich gelegentlich Menschen an, die meinen, vor jeder Entscheidung zuerst mit ihrem Therapeuten reden zu müssen. Ich wollte damals zurück in ein normales Leben. Dabei war eines sicher: Ich allein musste entscheiden, ob ich noch therapiebedürftig war oder nicht. Dies wollte ich nicht der Krankenkasse überlassen.
Den äußeren Auslöser für die Beendigung der Therapie bildete ein ganz banales Ereignis während der Therapiestunde. Es veränderte entscheidend die Rolle der Therapeutin und meine eigene. Danach gab es keine Therapeutin und auch keinen Patienten mehr. Was war geschehen? An der Wand, auf die ich im Liegen immer blickte, kroch eine ziemlich große Spinne langsam empor. Hinter mir spürte ich Unruhe und fragte die Therapeutin, ob sie die Spinne sehen würde. Ich bekam ein beunruhigtes „Ja“ als Antwort und die Bitte, die Spinne wegzumachen. Ich erlebte nun so etwas wie Genugtuung, dass sich bei dieser schweigsamen, unnahbaren Dame so etwas wie menschliche Züge zeigten. Ihrem Wunsch folgend stand ich auf, nahm die Spinne mit einem Taschentuch von der Wand, öffnete das Fenster und warf sie hinaus. Nach getaner Arbeit grinste ich meine Therapeutin ein wenig spöttisch an und schlug ihr vor, dass sie sich mal um ihre Spinnenphobie kümmern solle. Sie sagte nichts, sondern lächelte dankbar und verlegen zurück. In diesem Moment schien ein Bann gebrochen. Unsere Beziehung hatte sich plötzlich verändert. Unterwartet hielt ich das Heft des Handelns in der Hand, begegnete ihr nicht nur auf Augenhöhe, sondern fühlte mich in diesem Moment ihr überlegen. Spontan wurde mir klar, dass das der Zeitpunkt war, die Therapie zu beenden. Deshalb legte ich mich nicht mehr auf die Couch zurück, sondern sagte, dass ich bei dieser Gelegenheit die Therapie beenden wolle. Sie reagierte darauf gelassen, sehr freundlich und auch verständnisvoll. Offensichtlich hatte sie den Beweggrund meines Entschlusses verstanden. Ich bedankte und verabschiedete mich von ihr. Drei oder vier Stunden, die mir noch von der Krankenkasse zugestanden hätten, nahm ich nicht mehr in Anspruch. Ich fühlte mich befreit.
Kommentar
Schon während der Behandlung begann ich, mein Verhalten zu verändern. Ich wollte es mir, den anderen und wahrscheinlich auch der Therapeutin beweisen, dass ich dazu in der Lage war. Ich hatte einen Verhaltensgrundsatz gebildet, der auch heute noch gilt: Tue das, wovor du Angst hast, nur so kannst du dieser Angst Herr werden. Im privaten Bereich gelang es mir, mich von meiner langjährigen Freundin zu trennen. Es bestand nur noch ein liebloses, klebriges Verhältnis, dessen Fortbestehen weniger aus Zuneigung, sondern aus der Angst vor Einsamkeit gespeist wurde. Aus Mitleid und schlechtem Gewissen hatte ich es vorher nicht zu beenden gewagt. Außerdem zog ich von zu Hause aus in eine eigene Wohnung. Auch im Studium wandte ich dieses Prinzip erfolgreich an: Zunächst diskutierte ich mit meinen Studienkollegen offensiver, begann Referate öffentlich zu halten, führte mit einem jungen Mann im Rahmen einer realen Erziehungsberatung ein Untersuchungsgespräch, das direkt in den Hörsaal zu den übrigen Studenten und Lehrkräften übertragen wurde. Schließlich bestand ich Klausuren, erwarb die notwendigen Leistungsnachweise und fand Anerkennung bei Dozenten und Kommilitonen. In der unruhigen Zeit der Studentenproteste kandidierte ich als studentischer Institutssprecher und wurde gewählt. Ich hatte Versammlungen zu moderieren und setzte mich auf institutspolitischer Ebene öffentlich mit dem Institutsdirektor, den Dozenten und Kommilitonen auseinander. Das funktionierte erstaunlich gut, nachdem ich das Knieschlottern auf dem Weg zum Podium überwunden und den Frosch im Hals verschluckt hatte. Je öfter sich diese Situation wiederholte, desto leichter fiel es mir, meine Unsicherheit einzudämmen. Mein früheres, hinderliches Lampenfieber wandelte sich nach und nach zu einer angenehmen Empfindung, zu einem spannungsvollen Kribbeln, das mir bis heute treu geblieben ist.
Plötzlich hatte ich es eilig, mich vom Studienbetrieb zu verabschieden. Ich hatte die Nase voll, zumal eine interessante Arbeitsmöglichkeit in Aussicht stand. Das Mehr an Semestern, das ich wegen meiner Unsicherheit bis dahin benötigt hatte, konnte ich im zweiten Studienabschnitt nahezu ausgleichen und stellte mich nach etwas mehr als der vorgeschriebenen Mindestanzahl an Semestern der Diplomprüfung, die ich mit gutem Ergebnis bestand.
Bis dahin war mein Werdegang eine Erfolgsgeschichte. War die Therapie dafür verantwortlich? Und wenn sie es war, was genau hatte sie bewirkt?
Die Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, erforderte zunächst mein nachdrückliches Bekenntnis zur eigenen Unzulänglichkeit. Zusätzlich fühlte ich mich durch das Arrangement der Behandlung entmündigt und gedemütigt. Ich musste eine zwischenmenschlich groteske, einseitige Kommunikationssituation akzeptieren und mich starren Regeln unterwerfen. Es war, als hätte man mir ein zusätzliches schweres Gewicht auf den Rücken gelegt und es mich mit der Begründung schleppen lassen, dass es für mein Wohlbefinden gut und hilfreich sei.
Irgendwann begann ich gegen diese Last aufzubegehren, sammelte Kraft und Mut und entledigte mich ihrer. In diesem Moment fühlte ich mich befreit und war zu aufrechtem Gang in der Lage.
Kleingemacht zu werden, um die eigene Kraft herauszufordern und zu erfahren? Ist dies das paradoxe Wirkprinzip dieser Psychotherapie? Oder war es die Auflösung verdrängter Erlebnisinhalte und Gefühle, wie es die psychoanalytische Theorie behauptet? Bewusstwerdung, begleitet von starken Emotionen, habe ich nicht erlebt. Mir kam die Therapie vor, wie eine lange Entdeckungsreise in alle Bereiche meines damaligen und früheren Lebens. Dabei wurden Zusammenhänge zwischen Ereignissen, Handlungen und Gefühlen sichtbar. Sie durchzogen die persönliche Geschichte wie ein immer dichter werdendes Netz roter Fäden. Ich hatte über Dinge nachgedacht, die mir im wahrsten Sinne des Wortes im Traum nicht eingefallen waren.
Die neugewonnen schmerzlichen und erfreulichen Erkenntnisse über mich und meine Welt hatten im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Selbstbewusstsein geschaffen. War es dies, was es mir ermöglichte, Neues zu riskieren? Ergaben sich daraus die Fortschritte im Studium und privaten Leben? Waren sie Ursache oder Wirkung oder beides zugleich - ein sich gegenseitig aufschaukelnder Prozess? Diese schwierige Frage, wie viele andere auch, konnte ich nicht beantworten. Selbst wenn, was wäre gewonnen? Mir ging es gut, ich fühlte mich stark.
Wegen dieser positiven Erfahrungen teile ich nicht die sarkastische Bemerkung des österreichischen Literaten Karl Kraus aus dem Jahr 1913. Er behauptete, dass Psychoanalyse jene Geisteskrankheit sei, für deren Therapie sie sich hält. Dennoch ist meine Skepsis gegenüber den Theorien und Methoden der Psychoanalyse geblieben. Entscheidend für mich sind nicht die einzelnen Therapiemethoden und -theorien, sondern die in allen Formen vorhandene Selbsterfahrung, die durch eine neutrale, aufmerksame und sachkundige Begleitung initiiert und moderiert wird sowie die Ermutigung, neues Verhalten auszuprobieren und zu unterstützen.
Ich wünsche jedem, einen solchen Prozess zu durchlaufen, ohne sich selbst als Problemfall oder als psychisch krank definieren zu müssen. Das wäre dann eine Unterstützung der persönlichen Entwicklung oder eine Wellnesskur für die Seele.