Storyporting
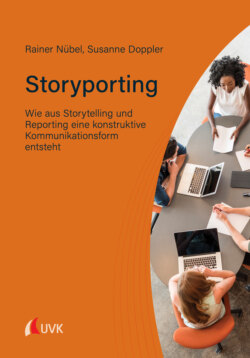
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Rainer Nübel. Storyporting
Inhalt
Vorwort
1 Heldenreisen, Erfahrungs- und Erfolgsstorys, Performance-Geschichten und der Clash der Narrative: Eine Bestandsaufnahme zum Einsatz von Storytelling
1.1 Fiktionales Erzählen in Filmen und Serien
Film trifft Journalismus
KonvergenzKonvergenz und PartizipationPartizipation
Die Heldenreise als narratives Grundmuster
Kritik am HeldenreiseHeldenreiseKritikn-Modell
Struktur des doppelten Weges: Individuum und Gemeinschaft
1.2 Medienpsychologische Perspektive
StimmungsmanagementStimmungsmanagement und SensationslustSensationslust
Identifizierung mit Story-Figuren
1.3 Storytelling in der KonfliktberatungKonfliktberatung
Konnex von Emotion und Ratio
1.4 Kommunikationswettbewerb in Werbung und MarketingMarketing
Golden CircleGolden Circle: Das Warum in Werbestorys
1.5 Storytelling im Kontext von EventsEvents und im TourismusTourismus
Storytelling und EventsEvents
Storytelling und Orientierung
Co-Kreation und Dramaturgie
Fiktionales Storytelling
Non-fiktionales StorytellingStorytellingnon-fiktionales
Faktenbasiertes StorytellingStorytellingfaktenbasiertes und InformationsdesignInformationsdesign
Biografische StorysStorysbiografische
Produktbezogene StorysStorysproduktbezogene
StorytellingStorytellingräumliches im Raum
Unternehmensbezogene StorysStorysunternehmensbezogene
StorytellingStorytellingHospitality im HospitalityHospitality-Kontext
Konstruiertes Reality-Storytelling
Verkürztes Reality-Storytelling
1.6 Faktuales StorytellingStorytellingfaktuales in den Informationsmedien
Struktur der NachrichtNachricht
Die Reportage als journalistisches Storytelling
Qualitätskriterien im journalistischen Erzählenjournalistisches Erzählen
Affinitäten zur HeldenreiseHeldenreise
Risiken der ReportageReportage
Feature, Report, Interview
Scrollytelling und user generated content
Wenn Meinung als Fakt rezipiert wird
Die Relotius-Affäre und der Grundverdacht des Manipulativen
Grenze zwischen Fiktion und Nichtfiktion bei filmischen Dokumentationen
VertrauensproblemeVertrauen der Informationsmedien
Vermittlung eines negativen Weltbildes
Konstruktiver JournalismusKonstruktiver Journalismus
1.7 Narration in der UnternehmenskommunikationUnternehmenskommunikation
Learning historieslearning histories
Kollektive Reflexion und Zugehörigkeitsgefühl
Erfahrungsgeschichten in Großunternehmen
Strategisches StorytellingStorytellingstrategisches in der FinanzwirtschaftFinanzwirtschaft
Narration im Kosten-Nutzen-KontextKosten-Nutzen-Kontext
Emotionales InvolvementInvolvement und IdentifizierungIdentifizierung
Narratives Identitätsmanagement
Wenn das faktische Handeln dem Unternehmensnarrativ widerspricht
1.8 Behördennarrative und ihre strategischen Wirkungsmuster
Das von Medien übernommene Narrativ der ‚Dönermorde‘
1.9 Politisches StorytellingStorytellingpolitisches
Gerhard Schröder bei der Elbeflut: ‚Alles wird gut‘
Angela Merkels „Wir schaffen das“
Zukunftsnarrative und StorylisteningStorylistening
Die Totalausleuchtung des Alltags
Strategische VerkürzungVerkürzung von Narrativen
Mit GegennarrativenGegennarrative gegen Extremismus?
Trumps Tabubrüche: Manipulativer Einsatz von Narrativen
1.10 Clash der Narrative in sozialen Medien
Empathie, HatespeechHatespeech: Die Ambilanz im Digitalen
Gefühlte WahrheitWahrheitgefühlte
Emotional ansteckende Geschichtenansteckende Geschichten
‚Singularitätswettbewerbe‘ um die Aufmerksamkeit
GegennarrativeGegennarrative zum Performancezwang
Utopie der ‚redaktionellen Gesellschaftredaktionelle Gesellschaft‘
1.11 Narrative Ansätze in Bildung und Wissenschaft
Aus ErfahrungsgeschichtenErfahrungsgeschichten lernen
Narrative Ansätze in PsychologiePsychologie und MedizinMedizin
Storytelling in der NachhaltigkeitNachhaltigkeitKommunikationskommunikation
1.12 Trends im StorytellingStorytellingTrends
Erzählen als Kunstform
1.13 SWOT-AnalyseSWOT-Analyse
Chancen erkennen, Stärken nutzen, Schwächen und Risiken minimieren
Forschungsfrage
2 StoryportingStoryporting als konzeptionelle map für ein Kommunikationsprinzip erwünschter Konvergenz
2.1 Herausforderungen der VUCA-Welt
2.2 Partizipation: Konvergenz von top down und bottom up
2.3 Annäherung von Narration und sachlich-nüchterner Analyse
2.4 Das BANI-FrameworkBANI-Framework für die Zeit des Chaos
2.5 RessourcenfixierungRessourcenfixierung und WeltbezugWeltbezug
2.6 Narrative Empathie trifft ökonomisches Prinzip
2.7 Analyse der Ressourcensituation als Basis eines Nachhaltigkeitsnarrativs
2.8 Das Primat des Besonderen in der ‚Gesellschaft der Singularitäten‘
2.9 Digitale Affektkultur der Extreme
2.10 Polaritäten in der Gegenwartsgesellschaft
2.11 Verbindendes in der Verschiedenheit
2.12 Der kommunikative Klimawandel
2.13 Storyporting: Storytelling und Reporting
2.14 Das Allgemeine im Besonderen, das Besondere im Allgemeinen
2.15 Zwischen Nicht-mehr und Noch-nicht
3 Die Storyporting-Methode
3.1 Erste Stufe: Narration – Storytelling und -listening
3.2 Zweite Stufe: Reporting
3.3 Dritte Stufe: StoryportingStoryporting
4 Anwendungsbeispiele, Tools und Formate
4.1 ZukunftscampZukunftscamps und -werkstätten mit der Storyporting-Methode. Wie wollen, sollen und werden wir in Zukunft leben und arbeiten?
Schimpfen, spinnen, schaffen
Digitale Zusammenarbeit im Mittelstand
Vom Zukunftstraum zur nachhaltigen Strategie
4.2 Die StoryportingStoryportingLine-Line
4.3 Lernen als Recherche
4.4 Der mediale StoryportStoryport und das etwas andere Talkshow-Format
Storylistening zu Beginn der Talkrunde
4.5 Der Kommunal- und Regional-Talk | Lia Hiller
4.6 StoryportingStoryporting im sozialen Bereich
4.7 Unite EuropeUnite Europe
Challenge Europa als Filmformat
4.8 Storyporting und szenisches Spielszenisches Spiel: „Play, plan & perform“ | Lia Hiller
4.9 Aufbrechen mit Kompetenz und Persönlichkeit
4.10 Die Nachhaltigkeits- und Transformationsshow
5 Die Verortung von StoryportingStoryporting in der wissenschaftlichen Methodik | Burkhard Schmidt
5.1 Methodisches Verständnis des Mixed-Methods-AnsatzMixed-Methods-Ansatzes
5.2 Einordnung von Storyporting im Mixed-Methods-Ansatz
Nachwort
Über die Autor:innen
Literatur
Register
Отрывок из книги
Gibt man den Begriff ‚Storytelling‘ bei Google ein, werden um die 100 Millionen Ergebnisse angezeigt. Die Methode der narrativen Darstellung und Vermittlung von Erfahrungswissen, Informationen, Themen, Ereignissen oder auch Produkten hat in Deutschland und international Hochkonjunktur, insbesondere im Bereich der Unternehmenskommunikation, speziell im Marketing, sowie in den sozialen Medien. Zahlreiche Fachbücher und Praxisratgeber empfehlen Storytelling, weil es Emotionen, Involvement, Identifizierung, recognition, Persuasion und schließlich Kaufinteresse stärker zu evozieren scheint als die nüchtern-sachliche, datenzentrierte oder auf Argumente setzende Darstellung (z. B. Müller 2014, S. 9–17).
In der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Narration und Storytelling wird häufig auf den anthropologischen Aspekt verwiesen, dass Menschen sich schon immer Geschichten erzählt haben, um Informationen auszutauschen, Erfahrungen und Traditionen weiterzugeben oder einfach um sich gegenseitig zu unterhalten (z. B. Müller 2020, S. 18ff.; Thier 2017, S. 3 u. 9.). Dass Menschen, soziale Gruppen und ganze Nationen Narrative haben und auch brauchen, um (Lebens-)Sinn und Identität zu generieren, gilt als unbestritten. Für den Soziologen Hartmut Rosa etwa sind soziale Gemeinschaften „Resonanzgemeinschaften“, weil sie „die gleichen Resonanzräume bewohnen“ (Rosa 2016, S. 267). Dies seien sie vor allem als „Narrationsgemeinschaften, die über ein gemeinsames, Resonanzen erzeugendes und steuerndes Geschichtenrepertoire verfügen“ (ebd.) Storytelling-Forscher Michael Müller ist der Überzeugung, große Massen erreiche man „mit Narrativen und Geschichten, die auf Resonanz stoßen“ (Müller 2020, S. 15).
.....
Für Werner, der Drehbücher sowohl für den Tatort als auch für die ZDF-Romantikserie Traumschiff schreibt, ist es zudem besonders wichtig, die ersten Szenenfolgen in beiden Genres so zu setzen und zu arrangieren, dass sich die Rezipient:innen ‚wohlfühlen‘. Er meint damit, dass das Publikum Situationen, Figuren und Zusammenhänge antrifft, die ihm vertraut sind. Man könnte auch sagen: die einer bekannten Ordnung entsprechen. Dazu dienen StereotypenStereotypen. Das David-Goliath-Prinzip gehört dazu. Jürgen Werner führt in diesem Kontext gerne die Figur des zerknautschten und notorisch unterschätzten Kommissars Columbo aus der gleichnamigen US-Krimiserie an. Dass Columbo am Anfang heillos überfordert und linkisch wirkt, am Ende aber den Mordfall auf seine eigene knitze Weise lösen wird, weiß das Publikum nach den ersten Folgen. „Das ist nicht langweilig“, sagt Werner, „vielmehr will das Publikum wissen, wie Columbo es schafft.“ Gängige Erzähltricks, gerade in Krimis, sind auch der Einsatz des ‚roten Herings‘ als Handlungselement, bei dem die Erwartungen der Rezipient:innen bewusst in die falsche Richtung gelenkt werden und Überraschung evoziert wird, wenn die falsche Fährte evident wird, oder die überraschende Wendung, der Plot-Twist.
Sprechen Drehbuchautor:innen darüber, wie sie erzählen, welchen Mustern sie folgen, fällt meist ein Schlüsselbegriff des filmischen Storytellings: hero’s journey – die HeldenreiseHeldenreise. Grundlage des im Filmbereich mitunter fast schon zu einem Erzählgesetz mutierten Modells sind die Forschungen des US-amerikanischen Literaturwissenschaftlers Joseph Campbell in den 1950er-Jahren zu Märchen, Mythen und modernen Erzählungen. Aus seiner Analyse Der Heros in tausend Gestalten leitete er die Heldenfahrt als Grundstruktur des Geschichtenerzählens ab, die der Hollywood-Berater, Film-Dozent und Autor Christopher Vogler Ende der 1990er-Jahre in seinem Buch Die Odyssee des Drehbuchschreibers in leichten Abänderungen auf den Film übertrug. Bekannte Filmemacher wie George Lucas, Steven Spielberg oder Francis Ford Coppola ließen sich von Campells Modell sehr stark inspirieren oder es zeigen sich in ihren Arbeiten Einflüsse davon (Vogler 2018, S. 35 u. 41).
.....