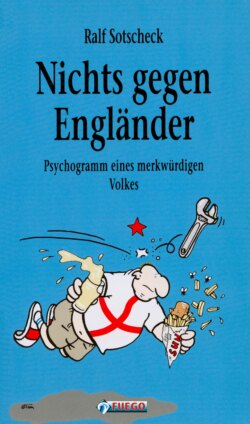Читать книгу Nichts gegen Engländer - Ralf Sotscheck - Страница 6
ОглавлениеMad Dogs And Englishmen
Der Engländer und seine Freizeitbeschäftigungen
Der Engländer an sich ist ein geräuschvolles Volk. Vor allem, wenn er trinkt. Der Richter Charles Harris beklagte, seine Landsleute seien so schlecht erzogen, dass sie keine akzeptablen Mengen an Alkohol wie anderswo in Europa – außer in Irland – zu sich nehmen können. »Je mehr es zu trinken gibt, und je mehr Zeit sie dafür haben, desto mehr werden sie trinken«, schrieb er in einem Gutachten über die Folgen der verlängerten Sperrstunde in England. »Eine Gallone ist normal, zwölf Pints keine Seltenheit. Und diese Mengen an Bier werden mit diversen Schnäpsen verdünnt. Die Lage ist ernst, wenn nicht sogar grotesk. Es grenzt an Wahnsinn, die Gelegenheit zu trinken noch auszudehnen. Es bedeutet, dass unsere Innenstädte jede Nacht Banden von kampflustigen, besoffenen, lärmenden und kotzenden Flegeln überlassen werden.«
Das typische Geräusch für eine englische Kleinstadt in einer beliebigen Samstagnacht sei das Reihern eines Trunkenboldes. In einer Studie ist es zum widerwärtigsten Geräusch der Welt erklärt worden. Akustik-Professor Trevor Cox von der Universität Salford hat das Ergebnis seiner einjährigen Untersuchung veröffentlicht. Er hat 1,1 Millionen Menschen befragt, um herauszufinden, warum bestimmte Geräusche so anstößig sind.
Bei der Verkündung des Ergebnisses demonstrierte ein Schauspieler den Sound des Übergebens mit Hilfe eines Eimers gebackener Bohnen.
Der brechende Engländer verwies den Zahnarztbohrer, das brüllende Baby, den Brunftschrei einer Katze, das Klingeln eines Handys und die Rückkopplung eines Mikrofons auf die Plätze. Schnarchen landete sogar nur auf dem 26. von 34 Plätzen. Hoch im Kurs der Ekelgeräusche stand dagegen das Kreischen einer Eisenbahn auf den Schienen. Das ist aufgrund der veralteten Bahnanlagen ein speziell englisches Problem. Dabei können die Engländer seit der Bahnprivatisierung froh sein, wenn die Züge überhaupt noch fahren.
Cox hatte eigentlich erwartet, dass das Quietschen eines Fingernagels auf einer Schiefertafel ganz oben rangieren würde, da es einen historischen Reflex auslöse: Das Geräusch ähnelt dem Schrei von Affen, die ihre Artgenossen vor Gefahr warnen wollen. Aber die Befragten empfanden es nicht schlimmer als das Hochziehen von Rotz oder das Zerknautschen von Styropor.
Die meisten Geräusche sind für Frauen unerträglicher als für Männer, lediglich bei lärmenden Babys gaben die Männer Höchstnoten in der Skala des Grauens. Auch das Alter spielt offenbar eine Rolle: Der Zahnarztbohrer ist für unter Zehnjährige und für Menschen zwischen 40 und 50 besonders unangenehm, weil sie in dem Alter ständig damit in Berührung kommen.
Was ist der Sinn der Umfrage? »Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus verstehen wir eigentlich gar nicht, warum manche Geräusche so schrecklich sind«, sagt Cox. »Wenn wir herausfinden, was die Leute stört, können wir Wissenschaftler die betreffenden Geräusche in manchen Fällen vielleicht eliminieren.« Ein guter Plan. Aber es ist vermutlich illegal, Millionen von Engländern zwischen 12 und 30, die an den Wochenenden die Bürgersteige vollkotzen, zu eliminieren.
Ebenso unangenehm wie brechende Engländer ist ihr Wetter. Dennoch reden sie sehr gerne darüber. Aber es trifft sie immer wieder unverhofft. Der Engländer läuft stets unbeschirmt durch den Regen, denn er rechnet trotz täglicher Belehrung eines Besseren nicht mit einem Schauer. Und erst recht nicht mit einer Hitzewelle. 2006 wurde der heißeste Julitag aller Zeiten gemessen – 36,3 Grad, das sind 0,3 Grad mehr als 1911 in Epsom.
Die britische Presse berichtete darüber wie aus einem Krieg. Vor allem die Boulevardpresse lief zur Hochform auf. Ob Mail, Mirror oder Sun – überall noch mehr spärlich bekleidete Damen als sonst.
Londons Busfahrern hingegen drohte die Entlassung, falls sie in kurzen Hosen zur Arbeit erschienen. Dabei herrschten in den Bussen Temperaturen von 52 Grad, empörte sich die Sun: »Das ist fast doppelt so viel, wie beim Rindertransport als Höchstwert zugelassen ist.«
Aber selbst Rinder, die nicht Bus fahren, drehten durch. In Dorset wurde eine Herde von einem Fliegenschwarm verrückt gemacht und trampelte bei einer Stampede einen Jogger nieder. Einen Jogger? Da bewahrheitet sich mal wieder das Sprichwort, wonach sich nur verrückte Kühe und Engländer hinaus in die Mittagssonne begeben. Im Originalsprichwort geht es um verrückte Hunde.
Die Daily Mail warnte vor einem anderen Phänomen. »Innerhalb einer Viertelstunde ist ein Bier so warm wie Badewasser«, schrieb das Blatt. Wie günstig! So trinkt es der Engländer doch am liebsten. Die Sun wies mit glühenden Bäckchen auf die Gefahr hin, dass Menschen bei lebendigem Leib geröstet werden könnten. »Wenn die Körpertemperatur 43-44 Grad erreicht, werden die Organe gekocht«, zitierte das Blatt den Medizinprofessor Bill Keatinge. »Das Hirn ist am ehesten betroffen. Es wird wie ein Ei gegart. Es kann danach nie mehr in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden. Das Kochen geht ganz schnell und richtet ungeheuren Schaden an.« Wie man an der Sun-Leserschaft unschwer erkennen kann. Das Blatt hatte einen Fotowettbewerb ausgerufen: Für das verschwitzteste Foto konnte man eine Reise nach Island gewinnen.
Auch der Guardian, der sich 2005 nicht nur vom Format her boulevardisiert hat, wollte von seinen Lesern Fotos und Geschichten rund um die Hitze haben. Ein gewisser Glurk fand die Temperaturen großartig: »Alle stinken nach Schweiß, da falle ich nicht weiter auf.« Archibald Strang berichtete, er habe sich ein Hemd mit Dutzenden kleiner Taschen nähen lassen, in die er Eiswürfel steckt. Und Little Jo schrieb: »Vor zwei Jahren war ich während einer Hitzewelle in Frankreich. Dort starben viele Omas. Die Leichenhallen waren überfüllt, weil die Verwandten zu geizig waren, ihren Urlaub abzubrechen und die Omas zu beerdigen.«
Apropos Oma: Auch die Queen meldete sich zu Wort. Sie beklagte, dass der Rasen vor dem Buckingham Palace nicht gesprengt worden sei. Man sollte die Gärtnereiabteilung von al-Qaida beauftragen. Die könnte gleich den ganzen Palast sprengen.
Die britische Regierung riet der Nation, sie möge die Sonne meiden und viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Oha, welch fundamentale Erkenntnis. Der Rat kommt allerdings zu spät. Die Kabinettshirne sind längst gargekocht. Man sollte sie mit warmem Bier servieren.
Das gilt auch für die Hirne der Angestellten bei Morgan Stanley. Die US-amerikanische Investment-Bank, die in Großbritannien eine Werbekampagne für ihre Platin-Kreditkarten führte, befürchtete, dass man die Bank mit einer Katze verwechseln könnte. Sie erhob Klage gegen die Baronin Penelope Cat of Nash, die eine Internetseite unter dem Namen mymorganstanleyplatinum.com angemeldet hat.
Die Bank hatte nachgeforscht, wer sich hinter der dubiosen Baronin verbirgt. Es stellte sich heraus, dass die Adlige als zweiten Vornamen »Miau« sowie als Adresse eine Scheune bei Tenbury Wells in Worcestershire angegeben hatte. Morgan Stanley rief den Vermittlungsausschuss zu Hilfe, der bei Internet-Streitigkeiten eingreift. Der entschied, dass eine Katze keine Domain registrieren lassen kann.
Der Vermittler Richard Hill begründete das recht einleuchtend: »Es ist wohlbekannt, dass eine Katze ein Raubtier ist, das vor langer Zeit domestiziert wurde.« Er fügte hinzu: »Es ist gleichermaßen wohlbekannt, dass eine Katze weder sprechen, noch schreiben kann. Entweder handelt es sich bei der Beschuldigten um eine besondere Art von Katze, wie jene aus dem Film ›Die Katze aus dem Weltraum‹, oder die Angaben der Katze, eine Katze zu sein, sind inkorrekt.« Falls es sich bei der Katze tatsächlich um ein außerirdisches Wesen handle, hätte das auf dem Antrag vermerkt werden müssen, um unnötige Verblüffung beim Vermittler zu vermeiden, schrieb der Vermittler.
Die Katze hatte laut Antrag einen Michael Woods bevollmächtigt, die Domain zu nutzen. Woods ist Firmenberater. Sein Spezialgebiet sind Vorträge vor Managern über die Notwendigkeit, offensichtliche Domain-Namen registrieren zu lassen, damit man keine böse Überraschung erlebt. Woods hatte zwei Jahre zuvor bereits den Domänennamen »Morganstanley.com« angemeldet. Das genehmigte der Vermittler Hill: Woods sei schließlich ein Mensch. Doch wenn eine außerirdische Katze verschweige, dass sie außerirdisch sei, habe sie offenbar etwas zu verbergen. Deshalb bekam die Bank in diesem Fall Recht. Andernfalls hätte die Gefahr bestanden, dass jemand Geld abheben will und statt dessen mit einer Katze nach Hause kommt.
Oder schlimmer noch: mit einem Catfish – zu deutsch: Wels. Auch bei diesem Tier muss man mit Namen vorsichtig sein. Sharron Killahena aus Poole in Dorset hatte ihren zwanzig Zentimeter langen Catfish leichtfertig »Kipper« getauft, was »Räucherhering« bedeutet. Ein durchaus passender Name, wie sich herausstellte. Als Kipper mal wieder im Aquarium herumtobte, löste das Spritzwasser einen Kurzschluss in der Aquariumsbeleuchtung aus, die überhitzte, so dass der Deckel schmolz.
Das heiße Plastik tropfte auf die Couch, die Feuer fing. Eine halbe Stunde später war das gesamte Haus niedergebrannt. Killahena und ihre beiden Kinder konnten sich in letzter Minute retten und wurden mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Kipper hatte weniger Glück: Er wurde zum Räucherfisch. Wie gut, dass sie das nasse Tier nicht »Killer« getauft hatte.
Oder steckte etwa ein Versicherungsbetrug dahinter? Es war zumindest eine grandiose Ausrede, aber darin sind die Engländer ohnehin Weltmeister. Die Erklärungen der privatisierten Eisenbahngesellschaften für das Chaos, das sie täglich anrichten, sind reizend: verbogene Schienen wegen der tropischen englischen Sommer, auf feuchtem Laub ausglitschende Züge im Herbst und die falsche Sorte Schnee im Winter. Im Grunde kann man lediglich im Frühjahr gefahrlos mit der Bahn fahren. Obwohl dann mit der Frühjahrsmüdigkeit der Lokomotivführer zu rechnen ist.
Mindestens ebenso phantasievoll sind die Ausreden für das Versagen englischer Sportler. Monty Python hat bereits vor mehr als 20 Jahren einen Sketch darüber gemacht. Es ging dabei um einen Schweizer Schiedsrichter bei einem Spiel der englischen Nationalmannschaft. Bei jedem Gegentor, das die Engländer kassierten, mutierte der Schweizer – zunächst zu einem an der deutschen Grenze wohnenden Schweizer, dann zu einem Deutsch-Schweizer, zu einem Deutschen und beim 0:4 zu einem Nazi. Dabei war es ein Schweizer, Gottfried Dienst, der den Engländern beim Endspiel 1966 gegen die Bundesrepublik Deutschland ein irreguläres Tor zuerkannt hat. Aber lassen wir das Thema.
Bei Schwimmwettkämpfen, bei denen man stets froh ist, wenn die englischen Teilnehmer nicht ertrinken, ist das zu harte Wasser schuld. Die englischen Radfahrer bei der Tour de France haben minderwertige Luft in ihren Rädern. Und bei Autorennen geben die Reifenhersteller der Konkurrenz immer die gute Ware und speisen die Engländer mit Ausschuss ab.
Den Preis für die abstruseste Ausrede hat sich jedoch die Tenniszunft verdient. Die englischen Spieler versagen seit Jahrzehnten bei internationalen Tennisturnieren, weil sie mit den falschen Bällen üben, sagte der Kapitän des englischen Daviscup-Teams, Jeremy Bates. Dass man darauf nicht früher gekommen ist! Die Bälle der Firma Slazenger, die seit mehr als hundert Jahren beim legendären Wimbledon-Turnier benutzt werden, fliegen laut Bates anders als andere Bälle, denn sie sind langsamer und schwerer – sie sind sozusagen die Medizinbälle der Tenniswelt. Um sie überhaupt über das Netz zu bringen, muss der Schläger weicher gespannt werden, damit sich der Spieler nicht den Arm bricht. Weil die Engländer an das Trumm gewöhnt sind, wundern sie sich natürlich, wenn ihnen im Ausland die federleichten Bälle um die Ohren zischen.
Der Wimbledon-Club hat die Bälle vor zehn Jahren noch schwerer gemacht, damit die Ballwechsel länger dauern und man für das Zeitlupen-Tennis mehr Geld von den Fernsehanstalten kassieren kann. »Der Ball ist steinhart«, sagt Bates. »Für mich ist es jedes Mal eine Freude, wenn ich mit etwas anderem spielen darf.« Mit einer elektrischen Eisenbahn vielleicht? Die bahntauglichen Ausreden hat er ja bereits parat. Bates verlangt nun die gleichen Bälle wie der Rest der Welt. Die Funktionäre haben angeblich eingelenkt. Slazenger gab dagegen bekannt, dass der englische Verband mehr schwere Bälle als je zuvor bestellt habe. Eine Frage bleibt offen: Wenn die Engländer als einzige an die übergewichtige Kugel gewöhnt sind, warum gewinnen sie dann nicht jedes Jahr das Wimbledon-Turnier?
Statt dessen erfinden sie lieber neue Sportarten, um die nationale Moral zu heben. Beim Moorschnorcheln und beim Käsewettlauf ist der Engländer unschlagbar, und der völlig sinnlose Dauerlauf am Rand von Hauptverkehrsstraßen hat auch vor England nicht haltgemacht. Ulkigerweise hat ihr Freizeitvergnügen einen traditionell deutschen Namen: »Jogging.«
Doch die Engländer würden ihrem Ruf nicht gerecht, hätten sie nicht auch hier eine perversere Variante zu bieten. Wer in Wessex ahnungslos durch die Wälder läuft, könnte unverhofft einem Hasen begegnen – allerdings einem zweibeinigen mit aufgeschnallten, braunen Schlappohren. Das ist ein Grund zur Beunruhigung, gehört der falsche Hase doch mit Sicherheit einem Team von Verrückten an, die regelmäßig Jagden organisieren. Die Regeln sind denkbar einfach: Drei Leute, denen der Sinn für Peinlichkeit längst abhanden gekommen ist, setzen sich die langen Ohren auf und legen für ein Rudel »Hunde« eine Fährte aus Sägespänen. Die Köter, die in Wahrheit nicht minder verrückte Zweibeiner sind und pausenlos »on on« bellen, hetzen hinter den »Hasen« durch Wasser, Wald und Wiese her, um sie zu fangen.
Die Jagd auf falsche Hasen ist übrigens keineswegs eine neue Erfindung, Engländer waren auch früher schon exzentrisch. Bereits Ende der dreißiger Jahre flitzten schlappohrige Kolonialherren – gefolgt von bellenden Aristokraten – durch die Wälder Malaysias, um sich die Langeweile zu vertreiben. Die Kolonialisten trafen sich im Selangor Club, den sie »Hash House« tauften – nicht etwa wegen gemeinsamen Drogenmissbrauchs, sondern wegen des Kantinenfraßes, der hauptsächlich aus Gehacktem, also Hash, bestand. Noch heute heißen die Hasenjagdclubs »Hash House Harriers«. Davon gibt es weltweit mehr als tausend, die meisten davon in Malaysia und den USA, aber auch im Gorki Park von Moskau, wo sich das britische Botschaftspersonal der Hasenhatz verschrieben hat.
In England sind 93 Vereine registriert. Freilich stößt ihr bizarrer Freizeitspaß nicht überall auf Verständnis. Die blauen Papierschnipsel, die dem Sägemehl beigemischt sind, um die Fährte deutlicher zu machen, haben des öfteren das Misstrauen der Bevölkerung erregt. Manchmal fegen Leute das Zeug einfach weg, weil sie es für Rattengift halten. In Dorset beschlagnahmte das Landratsamt gar die gesamte Fährte, um sie im Labor untersuchen zu lassen. Eine Zeitung hatte nämlich am Vortag mit der Schlagzeile aufgemacht: »Hundekiller treiben ihr Unwesen.«
Nichts liegt den Haschhäuslern jedoch ferner, als irgend jemandem ein Leid zuzufügen. »Das Ganze ist ein großartiger Gleichmacher«, sagt der 75jährige Rentner Phil Davies. »Wir haben Taxifahrer und Anwälte, Arbeitslose und Botschafter, aber wir sind alle gleich.« Die friedliche Jagd ist vermutlich das einzige Wettrennen, bei dem die Schnellsten und die Langsamsten gleichzeitig ins Ziel kommen, weil Kurzatmige Abkürzungen nehmen dürfen. Das Ziel ist stets eine Kneipe. »Hashing« sei eine Spülung des Geistes, sagt der Großmeister der »Wessex Hash House Harriers«. Mindestens ebenso wichtig ist ihnen die gemeinsame Spülung von Hunde- und Hasennieren im Pub nach der Hatz.
Auch mit Rosskastanien treibt der Engländer exzentrische Spielchen. Sie haben eine Meisterschaft rund um die Kapselfrucht erfunden. In Ashton in Northamptonshire gibt es seit 1964 die Weltmeisterschaften im »Conkers«, wie die Kastanien genannt werden. Eigentlich wollten die Stammgäste der Dorfkneipe damals angeln gehen, aber das Wetter war so miserabel, dass sie statt dessen Rosskastanien zerschlugen.
Das Spiel gibt es, seit die Kastanie im 16. Jahrhundert aus dem Balkan eingeschleppt wurde – sehr zur Freude der Schnecke übrigens, denn bis dahin benutzte man Schneckenhäuser für das Spiel. Die Regeln sind einfach: Man bohrt ein Loch in die Kastanie und zieht eine Schnur hindurch, die am Ende verknotet wird.
Der Verteidiger hält seine Kastanie mit ruhiger Hand in eine Höhe, die der Angreifer bestimmen darf. Der hat drei Versuche, um das gegnerische Spielgerät mit der eigenen Kastanie zu zerschmettern. Wenn einer der beiden Spieler seine Kastanie fallen lässt, kann der Gegner »stampfen« rufen und die Kastanie zertreten – es sei denn, der kastanienlose Spieler brüllt vorher »nicht stampfen«.
Der Ex-Weltmeister Chris Jones erklärte seine Taktik: »Genauigkeit ist wichtiger als Kraft, denn ein kräftiger Schlag kann deine eigene Kastanie beschädigen. Ich schlage stets von oben nach unten, dann trifft man besser als bei einem Hieb von der Seite.« Es gibt viele Tricks, um die Kastanien zu härten: Man kann sie backen, lackieren oder in Essig einlegen. Der zweifache Weltmeister Charlie Bray hat einen anderen Trick: Er verfüttert seine Kastanie an ein Schwein und wartet, bis sie wieder ausgeschieden wird. Bei Weltmeisterschaften ist das verboten.
John Hadman, Clubsekretär in Ashton, erklärte Conkers so: »Ein Spiel für zwei Personen, und es steckt voller Aggression. Die normale Reaktion ist es, beim Angriff zusammenzuzucken, aber das ist gegen die Regeln. Am besten schließt man die Augen und denkt an England.« Aber bloß nicht an Wimbledon und die schweren Bälle.
Ebenso wenig, wie der Engländer mit Tennisbällen fertig wird, schafft er es, Alltagsprobleme zu bewältigen. Frank zum Beispiel. Es war nicht sein Tag. Am Morgen wollte er eine Tüte Milch öffnen, um ein paar Tropfen davon in seinen Kaffee zu schütten, aber das Tetrapack ließ sich nicht so einfach bezwingen. Als er endlich seinen Zeigefinger in die kleine Öffnung gebohrt hatte, rutschte er ab und goss sich einen Liter Milch über die Hose. Beim Versuch, der weißen Dusche auszuweichen, warf er die Kaffeetasse um.
Nachdem Frank sich umgezogen hatte, klingelte der Postbote und brachte ihm ein Päckchen von einem Musikversand: die nicht mehr ganz so neue und deshalb herabgesetzte CD von U2. Frank fand den Zipfel des Bändchens nicht, mit dem man die Zellophanhülle aufreißen konnte, und rückte der Verpackung mit einem Messer zu Leibe. Dabei brach der Deckel der CD-Box am Scharnier ab, und die CD fiel auf den Fußboden. Frank beobachtete ungläubig, wie die Scheibe durch die Küche rollte und im Abflussgitter hinter der Waschmaschine verschwand. Was danach geschah, weiß ich nicht, da Frank mich hinauswarf, nachdem ich erklärt hatte, dass diese grässliche Band aus Dublin nun an ihrem Bestimmungsort angekommen sei.
Frank ist nicht ungeschickter als andere Engländer. Er hat, wie die meisten seiner Landsleute, lediglich Schwierigkeiten mit Objekten des täglichen Bedarfs. Ein paar clevere Geschäftsleute haben das ausgenutzt und das Unternehmen »User Vision« gegründet, das die Benutzerfreundlichkeit von Produkten untersucht und sich von den Herstellern dafür gut bezahlen lässt. Weit oben auf der Liste der Frustobjekte stehen Digitalkameras, gefolgt von Auto-Kindersitzen und Mobiltelefonen. Ein Unternehmen hat bereits darauf reagiert und ein Handy auf den Markt gebracht, mit dem man weder fotografieren, noch sich rasieren, sondern lediglich telefonieren kann.
Aber auch Dosenöffner, Waschmaschinen und Einwegwindeln treiben den Engländer zur Weißglut – ebenso wie Klebeband, bei dem nur die wenigsten der Testpersonen das Ende der Rolle fanden. Überraschenderweise stellte es die meisten auch vor eine unlösbare Aufgabe, ein Osterei auszuwickeln. Möglicherweise muss der Osterhase dafür büßen, denn Gewehre gehören nicht zu den Objekten, mit denen der Engländer seine Schwierigkeiten hat.
Am Abend schaute ich noch einmal bei Frank vorbei. Die CD hatte er aus dem Abfluss befreit, musste dazu aber das einzementierte Abflussgitter mit einem Schlagbohrer zerstückeln. Weil das eine Weile dauerte, hatte er den Videorecorder eingeschaltet, um seine Lieblingssendung aufzunehmen. Als er sie ansehen wollte, stellte er fest, dass er versehentlich einen Dokumentarfilm über Schönheitsreparaturen an einem Einfamilienhaus aufgenommen hatte. Das sei typisch englisch, meinte ich: »User Vision« habe herausgefunden, dass die Engländer den Videorecorder zum schwierigsten Objekt im Haushalt gewählt haben. Millionen seiner Landsleute würden jetzt beim Tapezieren eines Einfamilienhauses zusehen, weil sie das Gerät falsch bedient haben, erklärte ich Frank, bevor er mich erneut vor die Tür setzte.
Aber eins kann der Engländer: Großbritannien ist das Land der Wichser. So hoffte jedenfalls das Centre for Sex and Culture. Die in San Francisco beheimatete Organisation veranstaltete in London ein »Wankathon« und hatte dazu aufgerufen, massenhaft zum Masturbationsmarathon in die Drop Studios in der Clerkenwell Road zu kommen – für einen wohltätigen Zweck.
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin sollte sich Sponsoren suchen, die das Massenonanieren bezuschussen. Normalerweise sammeln Schulkinder auf diese Weise Geld für einen guten Zweck – natürlich nicht fürs Masturbieren. Sie lassen sich von den Nachbarn und Verwandten die Zusage für eine Spende geben, wenn sie im Freibad zehn Bahnen schwimmen oder in den Bergen fünf Kilometer laufen. Meistens geht das Geld an irgendwelche kirchlichen Organisationen. Mit dem »Wankathon« will der Klerus freilich nichts zu tun haben, die Marie-Stopes-Klinik dafür um so lieber. »Es ist vollkommen richtig, dass wir uns mit dieser risiko- und folgenlosen sexuellen Aktivität assoziieren«, begrüßte die Familienplanungsklinik das Ereignis.
In dem Aufruf hieß es zweideutig: »Kommt für einen guten Zeck.« In den Drop Studios gab es weiches Licht, weiche Möbel, entspannende Musik sowie drei Zonen: eine für Frauen, eine für Männer und eine gemischte Zone. Jede Zone enthielt auch Einzelwichserzellen für scheue Teilnehmer, die aber nicht beim offiziellen Wettbewerb mitmachen können. Wer die meisten Orgasmen hatte, und wer am längsten masturbieren konnte, bekam einen Preis – vermutlich eine Armbinde und einen Hund, denn Wichsen soll ja blind machen. Als Trostpreis wurde wohl eine Brille vergeben.
Die Regeln waren streng: Pro Stunde waren höchstens fünf Minuten Atempause – oder wie immer man es nennen möchte – erlaubt. Der bisherige Rekord stand bei achteinhalb Stunden. Diese Zeit konnte jedoch niemand überbieten: Das »Wankathon« dauerte von 14 bis 22 Uhr, also lediglich acht Stunden. Der Marathon der anderen Art wurde für Channel 4 aufgezeichnet. Offenbar hatte man sich bei dem unabhängigen Fernsehsender mit dem Thema angefreundet. Der Unterhaltungsredakteur Andrew MacKenzie erklärte, dass man eine kleine Serie daraus machen werde: »Die Woche der Wichser.«
MacKenzie, der 2005 die »Penis-Woche« veranstaltet hatte, sagte: »Das sind genau die provokanten Programme, die Channel 4 nachts um elf ausstrahlen sollte. Viele Menschen masturbieren, aber nicht so viele reden darüber.« Die Produktionsfirma Zig Zag fügte in einer Presseerklärung hinzu: »Es wird Zeit, dass wir herausfinden, ob die Oberlippe das einzige ist, das in Großbritannien steif sein darf.« Er dementierte, dass eine Folge der dreiteiligen Serie »Woche der Wichser« den damaligen Premierminister Tony Blair beim Regieren zeigen sollte.