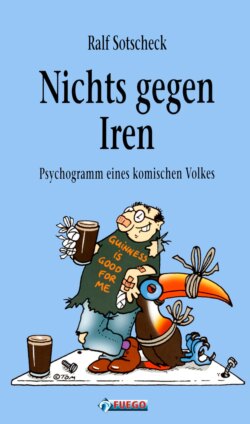Читать книгу Nichts gegen Iren - Ralf Sotscheck - Страница 4
Ein komisches Volk Der Ire an sich Eine Vorbemerkung
ОглавлениеIrland ist eine Insel und liegt westlich von Großbritannien. Soweit sind sich alle einig. Doch die Insel besteht aus dem Staat Irland und aus Nordirland, das zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland gehört. Wenn die Nordiren von ihrer Heimat sprechen, weiß man sofort, welcher Religion sie angehören: Unionistische Protestanten, die für den Verbleib bei Großbritannien sind, sprechen von Ulster. Das ist eine der vier irischen Provinzen, aber sie umfasst neben den sechs nordirischen Grafschaften auch drei Grafschaften, die zur Republik Irland gehören. Katholische Nordiren, die für die Wiedervereinigung beider Teile Irlands sind, nennen Nordirland deshalb »die sechs Grafschaften« oder einfach nur »The North«.
»Eire« ist der irische Name für die Republik Irland, er steht auch auf den Briefmarken. »Die pro-britische Mehrheit Nordirlands verwendet aus naheliegenden Gründen den Terminus ›Irland‹ für die Republik Irland nicht gerne«, schreibt Frank McNally in seinem Xenophobe´s Guide To The Irish. »Obwohl sie keine besonderen Sympathien für die irische Sprache hegen, benutzen sie oft den Namen ›Eire‹ im Englischen. Das wird von den Menschen in der Republik Irland als Beleidigung aufgefasst, und als solche ist es von den Unionisten auch gemeint, obwohl beide Seiten große Schwierigkeiten hätten, die Gründe dafür zu erklären.« Manchmal sagen die Nordiren auch einfach »The South«, wenn sie die Republik Irland meinen, obwohl der nördlichste Punkt des Südens – nämlich die Grafschaft Donegal – nördlicher liegt als der nördlichste Punkt des Nordens.
Möglicherweise hat Sigmund Freud also recht mit seiner Behauptung, dass die Iren das einzige Volk seien, dem durch Psychoanalyse nicht zu helfen sei. Sie seien voller Widersprüche und immun gegen rationale Denkprozesse. Und der englische Dichter G. K. Chesterton schrieb einmal: »Die großen Gälen von Irland sind die Menschen, die Gott verrückt gemacht hat, denn alle ihre Kriege sind fröhlich und alle ihre Lieder sind traurig.«
Ob jemand Ire oder Brite ist, hängt manchmal von anderen Dingen als dem Geburtsort ab. Als die Schauspielerin Brenda Fricker mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, war über Nacht vergessen und vergeben, dass sie Irin ist. Sie wurde von den britischen Medien als Britin vereinnahmt. »Wenn du sturzbesoffen auf einem Flughafen herumlümmelst, bist du Ire«, stellte sie fest. »Gewinnst du aber einen Oscar, bist du Brite.« Und Seamus Heaney fand sich, nachdem er den Literatur-Nobelpreis gewonnen hatte, plötzlich in einer Anthologie britischer Dichtung wieder. Er schrieb prompt ein Protestgedicht.
Noch unverfrorener funktioniert das im Sport. Der englische Sportkommentator Harry Carpenter machte sich über den irischen Golfspieler Christy O’Connor lustig, der nach der ersten Runde bei den britischen Open auf dem vorletzten Platz lag. Nach einer sensationellen letzten Runde war der flugs naturalisierte »britische Golfer O’Connor« plötzlich vorne. Und als die englische Fußball-Nationalmannschaft bei den Europameisterschaften 1988 in Deutschland gegen das irische Team ausschied, wurden die Iren umgehend zur »englischen B-Mannschaft« erklärt.
Andererseits neigt auch der Ire dazu, berühmte Ausländer für sich zu vereinnahmen – zum Beispiel Regierungschefs. Charles de Gaulle war eigentlich Ire, denn er hatte eine irische Urgroßmutter, und die Hälfte aller US-Präsidenten hat ebenfalls irische Wurzeln, von Washington und Jackson über Roosevelt und Kennedy bis hin zu Nixon, Reagan, Clinton und den Bushs. Natürlich ist auch Barack Obama im Grunde Ire. Der Pfarrer von Moneygall, einem Kaff in der Grafschaft Offaly, hat herausgefunden, dass ein Fulmuth Kearney in Moneygall geboren ist. Sein Vater war Schuhmacher. Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte in Irland eine furchtbare Hungersnot. So wanderte Fulmuth am 20. März 1850 an Bord der S.S. Marmion nach Amerika aus, er war damals 19. Er ließ sich in Ohio nieder und hatte mit seiner Frau acht Kinder. Eine der Töchter, Mary Ann, heiratete einen Jacob Dunham 1890 in Kansas. Deren Sohn Ralph Dunham hatte einen Sohn, Stanley Dunham, der wiederum eine Tochter hatte: Ann Dunham. Die heiratete einen Kenianer, der in Hawaii studierte und Barack Obama Senior hieß. Deren Sohn, der US-Präsident, ist also der Ur-Ur-Urenkel von Fulmuth Kearney aus Moneygall. Nun nennen sie ihn O’Bama in Irland.
Nur der Herzog von Wellington, der in Dublin geboren ist und später Napoleon besiegte, wehrte sich gegen die Zwangsirisierung. Als er in einer Zeitung als Ire bezeichnet wurde, empörte er sich: »Wer in einem Stall geboren ist, muss noch lange kein Pferd sein.« Aber 45 Millionen US-Amerikaner berufen sich freiwillig auf irische Wurzeln. »Das weist entweder auf einen phänomenalen Erfolg bei der Vermehrung hin«, schreibt Frank McNally, »oder es liegt wahrscheinlicher daran, dass sie aus ihren weit verstreuten Vorfahren sich die armen, unterdrückten Iren aussuchen, weil die ein günstiges soziales Prestige haben.«
Das ist auch einer der Gründe für die Beliebtheit der Iren bei den Deutschen. Sie hatten in Deutschland den Ruf, bemitleidenswert arm zu sein, ihre wenige Habe zu vertrinken und dabei melancholische Lieder zu singen. Heinrich Böll hat das in seinem »Irischen Tagebuch« festgehalten. Aber das Irland, das er beschrieb, gab es schon damals nicht so ganz, einiges hat er erfunden. Zum Beispiel die junge Arztfrau, die bangend am Fenster wartet, weil ihr Mann bei Sturm und Regen unterwegs zu einer Entbindung war. Als er zurückkam, hatte er einen Kupferkessel bei sich – sein Honorar. Die junge Arztfrau ist inzwischen über 70. »Den Kupferkessel hat sich der gute Heinrich ausgedacht«, sagt sie. »So rückständig waren wir damals nicht, es gab schon Geld in Irland.«
Aber rückständig waren sie trotzdem, und das machte für viele Deutsche den Reiz aus. »Das war es vielleicht, was wir an Irland so liebten«, schreibt der Journalist Christian Kranz. »Dass es eine Reise in die Vergangenheit war, dass Irland damals zwanzig Jahre hinter Deutschland zurück war, dass es so war wie bei uns, als noch nicht jeder ein Auto hatte und einen Fernseher.« Menschliches war wichtiger als Materielles. Und die Iren hatten Zeit.
Die Sympathien haben sich die Iren gründlich verscherzt. Anfang der neunziger Jahre zettelten sie hinterrücks einen Wirtschaftsboom an, Irland verzeichnete Wachstumsraten von bis zu zehn Prozent. Irland sei eine Art Schlaraffenland, schrieb die polnische Presse immer wieder, und das haben mehr als 200.000 Polen geglaubt. Der Schrei des keltischen Tigers, wie das irische Wirtschaftswunder genannt wird, hat sie auf die Grüne Insel gelockt. Dort machen sie nun fünf Prozent der Bevölkerung aus.
Irland hat sich durch den Aufschwung verändert – sehr zum Verdruss der alteingesessenen Irlandfans, die ihre Grüne Insel gerne in einer Zeitschleife bewahrt hätten. In den einschlägigen deutschen Irland-Foren war man überwiegend der Meinung, dass die Liebe zu Irland nun erkalten werde. Die Hauspreise und Mieten sind in schwindelerregende Höhen gestiegen, die Restaurants sind teuer, selbst das Guinness ist in vielen Ländern billiger zu haben als in der Stadt, wo es gebraut wird. Dublin ist längst die teuerste Hauptstadt in der Eurozone. Hinzu kommen Reglementierungen, die man bisher eher mit Deutschland in Verbindung gebracht hätte: Die Iren führten das strengste Rauchverbot Europas ein, Autos müssen sich neuerdings einem TÜV unterziehen, Geschwindigkeitskontrollen sind an der Tagesordnung.
Aber das irische Wirtschaftswunder hat das Land, und vor allem die Hauptstadt, aus ihrer Provinzialität gerissen. Boutiquen, Restaurants, italienische Feinkostläden und Kunstgalerien, Diskotheken und Rock-Cafes haben sich in der Innenstadt breitgemacht. Dublin ist eine junge Stadt, 40 Prozent der Bevölkerung sind unter 25, das Durchschnittsalter liegt bei 31. Das spiegelt sich im Nachtleben wider. Es ist eine internationale Stadt, es ist immer etwas los. Deshalb kommen inzwischen junge Deutsche, deren Irlandbild nicht durch Bölls »Irisches Tagebuch« geprägt ist. Sie studieren ein paar Semester, sie arbeiten als Au pair, oder sie jobben für ein paar Monate in einem der zahlreichen Call Centre, bevor sie wieder nach Hause fahren.
Die meisten fühlen sich wohl in Irland und sind von der Großzügigkeit der Einheimischen begeistert. Das beruht allerdings manchmal auf einem Missverständnis, weil sie – im Gegensatz zu den alteingesessenen Irlandfahrern – die Spielregeln im Pub nicht kennen: Wenn das erste Glas am Tisch leer ist, bestellt derjenige unaufgefordert die nächste Runde, der damit an der Reihe ist. Oder man steigt gar nicht erst in eine Runde ein.
Deutsche gelten in Irland als äußerst langsam, wenn es ums Zücken der Brieftasche geht. Manche stellen zur Sperrstunde erfreut fest, dass sie der Abend keinen Pfennig gekostet habe, weil sie ständig eingeladen worden seien. Andere halten sich stundenlang an einem Glas Bier fest – oder bestellen überhaupt nichts. Wenn man sie fragt, warum sie ins Wirtshaus gehen, antworten sie, dass sie die Atmosphäre mögen und sich gerne mit Leuten unterhalten.
Eine andere deutsche Unsitte wird von den Kellnern und Kellnerinnen in irischen Restaurants beklagt. Geht es ans Bezahlen, verlangen die meisten Deutschen eine getrennte Rechnung, auch wenn der Kassenbon jede Suppe und jedes Wässerchen einzeln aufführt. Manch deutsche Gruppe hat schon ganze Speisesäle lahmgelegt, weil Tante Martha aus Bottrop am Ende steif und fest behauptet, den dritten Irish Coffee nicht getrunken zu haben. Das wird dann in der Gruppe diskutiert, und dabei fällt Hans-Georg aus Recklinghausen die Bloody Mary auf seinem Zettel auf, wo er doch nur einen Wodka mit Tomatensaft und Tabasco zu sich genommen hat.
Iren haben es da leichter: Sie teilen die Summe durch die Zahl der Gäste. Das mag manchmal nicht ganz gerecht sein, ist ihnen aber lieber als die Pfennigfuchserei. Einige Lokale haben auf ihren Speisenkarten vermerkt, dass Einzelrechnungen leider nicht in Frage kämen, doch könne sich jeder anhand der verschiedenen Posten seinen Anteil ausrechnen, wenn er möchte. Der Hinweis ist zweisprachig: englisch und deutsch.
Der irische Boom hat auch Missgunst hervorgerufen. Schon 1998 schrieb der Spiegel: »Bonn überweist knapp 22 Milliarden Mark nach Brüssel und erhält 11,5 Milliarden.« Die Iren hingegen machen »ein sattes Plus von über 2,4 Milliarden Mark«. Irische Bauern beschäftigten sich im Grunde nur damit, »sich über den jeweils neuesten Stand der EU-Zuwendungen auf dem laufenden zu halten«. Der Spiegel-Autor warf ihnen »illegale Abzockerei« vor. Er hat festgestellt, dass es offenbar weniger Schafe in Irland gibt als angenommen. Die listigen Schnorrer treiben bei Inspektionen einfach dieselbe Herde auf »verschiedenen Bauernhöfen immer aufs neue zum Nachweis der Subventionsberechtigung« vorbei. Und dann rudern sie mit den Tieren nach Wales hinüber, um dort auch noch mal abzukassieren. Der Agrarinspektor, der ihnen auf die Schliche kommen könnte, lebe gefährlich und »muss im Dienst immer mit Prügel rechnen«.
Der Artikel rief in Irland nicht nur einen landesweiten Wutausbruch hervor, sondern man zahlte es mit gleicher Münze heim. Der Cork Examiner, ein Lokalblatt mit überregionalen Ambitionen, fand den Namen des Spiegel-Autors heraus: Dirk Koch besitze zwei Häuser im Süden der Grafschaft Cork, schrieb die Autorin Anne Lucey, und das sei typisch: »Hohe Mauern, höhere Tore, bellende Stimmen und Missachtung von Jahrhunderte altem Wegerecht.« Selbst die Nägel würden sie aus Deutschland importieren, wenn sie ihre Häuser bauten, weil ihnen die irischen Produkte nicht gut genug seien. »Sie wollen das Land für sich allein und würden uns am liebsten vertreiben.« Das vernichtende Urteil: Die Deutschen seien auch nicht besser als die Engländer, die früher die Köpfe der Iren vermessen haben, um nachzuweisen, dass sie eigentlich zu den Affen gehören.
Und undankbar sind die Affen obendrein. Nicht wenige EU-Politiker empörten sich, dass die Iren erst aus den EU-Töpfen abkassiert und dann im Sommer 2008 den EU-Reformvertrag von Lissabon per Referendum abgelehnt haben. Nicht ganz zu Unrecht wirft man den Iren außerdem vor, das europäische Finanzsystem ins Wanken gebracht zu haben. Irische Gesetze garantieren Steuerfreiheit für das Management, stellen geringe Anforderungen an die Kapitalunterlegungen und sehen keine aufsichtsrechtliche Hürden und eine vereinfachte Kotierung an der irischen Börse vor.
»Der Inselstaat ist langsam reif für den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde«, schrieb Tobias Bayer in der Financial Times Deutschland. »Ob EU-Referendum oder Bankenschieflagen, die Iren sind allgegenwärtig.«
Die Iren bemühen sich nach Kräften, alles wieder gut zu machen. Sie haben eingesehen, dass ein Wirtschaftsaufschwung nicht zu ihnen passt und ihr Image im Ausland ruiniert. So sind sie schneller und gründlicher in die Rezession gerauscht, als alle anderen.
Die Europäische Kommission prophezeit, dass Irland in den nächsten Jahren die zweitschwächste Wirtschaft aller EU-Länder haben wird, die Arbeitslosigkeit werde auf über zehn Prozent ansteigen. Die irische Regierung hat vorbildlich dazu beigetragen: Sie hat die satten Haushaltsüberschüsse der fetten Jahre für pompöse Straßenbauprojekte und für den Stimmenfang verpulvert, so dass nun nichts mehr übrig ist und allerorten gekürzt werden muss.
So waren die Boomjahre wohl lediglich ein kurzer Abstecher in den Reichtum – vom Armenhaus zum keltischen Tiger und wieder zurück zum Armenhaus? Die traditionellen Irlandfans aus aller Welt würde es freuen, wenn ihre Grüne Insel wieder zum Naturreservat für ausgebrannte Kapitalisten würde. Dann könnten sich die Iren endlich auf das Wesentliche konzentrieren: das Trinken des schwarzen Bieres, das Singen melancholischer Lieder und das Verfassen von Werken der Weltliteratur.