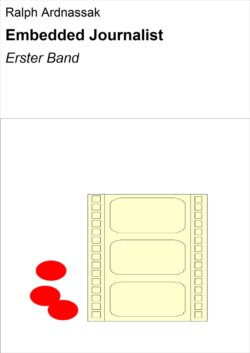Читать книгу Embedded Journalist - Ralph Ardnassak - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеEmbedded Journalists, zu Deutsch: Eingebetteter Journalist, heißen die zivilen und kontrollierten Kriegsberichterstatter, die in der Regel einer regulären, im Krieg kämpfenden Einheit, zugewiesen wurden.
Meist wird von den Embedded Journalists, die auch kurz als Embeds bezeichnet werden, verlangt, dass sie zunächst ein kurzes, aber intensives militärisches Spezialtraining absolvieren.
Die Todeswahrscheinlich für Embeds ist in den modernen Kriegen seit dem Irakkrieg des Jahres 2003 erstaunlich hoch. Die Möglichkeit, als Embed während der Kampfhandlungen sein Leben zu verlieren ist 45mal höher, als die Todeswahrscheinlichkeit eines regulären Soldaten.
Quelle: Wikipedia
Auf den ersten Blick ist es ein in Lebensgröße ausgeführtes bronzenes Denkmal eines Soldaten, wie es auf dem kleinen Hügel nahe beim Ausgang des Dorfes steht und die staubige schmale Dorfstraße hinab zu blicken scheint, die zwischen den Häusern hindurch und den Berg hinab führt.
Ein in Lebensgröße ausgeführtes bronzenes Denkmal eines Soldaten, der den Kampfanzug der amerikanischen Armee und einen Stahlhelm lässig auf dem Kopf trägt. Ein offensichtlich vollbärtiger Soldat, der eine Brille trägt und entschlossen, ja optimistisch, unter seinem Stahlhelm hervor und die Straße hinab zu blicken scheint. Die Taschen an der Hose seiner Kampfmontur beulen sich und er trägt ein Koppel, aber keine Waffe. Stattdessen jedoch hängt an seiner Schulter eine gewaltige Kamera mit unförmigem Teleobjektiv, wie sie Kriegsberichterstatter oft zu tragen pflegen. An seine linke Schulter aber presst er, behutsam mit seinen beiden Händen und Armen, ein kleines Mädchen.
Das Denkmal des bärtigen Soldaten, der ein Mädchen auf seinem Arm trägt, steht am Hang einer grünen Wiese, umgeben von den letzten Häusern des Dorfes und einigen offensichtlich schon sehr alten und knorrigen Kirschbäumen, durch deren streifig sich abschälende Rinde dicke bernsteinfarbene Tropfen von Harz austreten. Die Straße, die vorbei führt, ist mit hellem grobkörnigem Kies belegt. Und jedesmal, wenn ein Fahrzeug vorüber fährt, was oft geschieht, wird weißer Staub aufgewirbelt, der sich in den bronzenen Falten des Soldatendenkmals fest setzt und ihm bis zum nächsten Regenguss ein geradezu beklemmend realistisches Aussehen verleiht.
Das Denkmal steht auf einem flachen Granitsockel, an dem ein schmales Schild angebracht wurde, welches Auskunft über das Denkmal gibt. Dort steht: „Henry Armand, 1964 – 2001. Schriftsteller, Journalist, Ehemann und Vater. Einwohner von Klein Ehringen.“
Am Fuße des Denkmals: eine einzige verwitternde rote Rose, deren welke Blütenblätter vom Wind Stück um Stück hinweg getragen werden, bis nur noch der verwelkte grüne Stiel übrig bleibt, über den ganze Heere kleiner rotleibiger Ameisen emsig dahin laufen, ihre Eier auf den Rücken balancierend.
Unberührt von alledem, steht das Denkmal, blickt der bronzene Soldat, der das kleine Mädchen auf dem Arm trägt und die Kamera mit dem Teleobjektiv geschultert hat, unter seinem Stahlhelm hervor und die staubige Dorfstraße hinab, als ginge ihn die Szenerie nichts an und als würde er teilnahmslos auf etwas warten.
Dicht bei dem Denkmal jedoch, arbeitet eine junge Frau in kurzen Hosen mit einer durchdringend lärmenden Motorsense. Ihr dunkler Teint und ihr langes tiefschwarzes Haar verraten ihre offenbar ausländische Herkunft. Nur selten hält sie inne, um sich eine Strähne ihres langen Haares aus dem verschwitzten Gesicht zu wischen.
Unablässig schwingt sie die lärmende Motorsense, um das Gras, welches rund um das Denkmal des bronzenen Soldaten wuchert, der an dieser Stelle des kleinen thüringischen Dorfes irgendwie deplatziert wirkt, zu bändigen und kurz und gepflegt zu halten.
In der Redaktion der Mansfelder Zeitung herrscht hektische Betriebsamkeit. Die Mitarbeiter wissen, dass der neue Investor aus Süddeutschland, der das Blatt noch einmal vor der drohenden Insolvenz gerettet hat, dies nicht aus Barmherzigkeit tat. Der Chef vom Dienst wies die Belegschaft darauf hin, wo das Problem lag und was nun künftig von ihnen erwartet würde. Steigende Werbeeinnahmen und dies in einer strukturschwachen Gegend und ebenso eine deutliche Erhöhung der Zahlen von verkaufter Auflage und Abonnenten. Keine leichte Aufgabe in einer Region mit fast fünfundzwanzig Prozent Arbeitslosigkeit, in der Resignation und Abwanderung in den Westen der Republik zum trostlosen Alltag gehörten.
Auch fiel es schwer, die meist chronisch finanziell klammen kleinen Unternehmen und Handwerksfirmen, die das wirtschaftliche Rückgrat der Region darstellten, von der Sinnhaftigkeit teurer Zeitungsannoncen zu überzeugen.
Der redaktionelle Teil orientierte an der Zusammenarbeit mit den großen Nachrichtenagenturen, deren News beinahe in unveränderter Form abgedruckt werden. Im Lokalteil fanden sich die üblichen Mitteilungen: Artikel über Unfälle, Einbrüche und Brände im Einzugsgebiet. Ein wenig Sport und ein eher eintöniger Veranstaltungskalender mit Berichten von Wochenmärkten und Geflügel- sowie Kaninchenausstellungen.
Insgesamt unspektakuläre Themen und somit eher ungeeignet, um die berühmte Leser-Blatt-Bindung zu stärken, geschweige denn, um neue Abonnenten zu gewinnen, deren Zahl bereits seit Jahren absolut rückläufig war.
Der Chef vom Dienst kämpfte jedoch seit Jahren um den Erhalt des Blattes und der damit verbundenen Arbeitsplätze. Er tat dies vor allem auch aus Eigennutz. In fünf Jahren würde er in Rente gehen und bis dahin wollte er seinen Arbeitsplatz in der Region behaupten und nicht noch als Lohnschreiberling, wie er es zu nennen pflegte, bei einer der vielen und erfolgreicheren Zeitungen im Westen der Republik arbeiten müssen.
Ein Kracher musste her. Am besten eine Fortsetzungsgeschichte mit möglichst rührseligem Inhalt. Etwas über Heldenmut in trostlosen Zeiten. Eine Story, wie die des amerikanischen Flugkapitäns Chesley Burnett Sullenberger, der es fertig gebracht hatte, den vom doppelten Triebwerksausfall infolge Vogelschlages betroffenen US-Airways-Flug 1549 inmitten des Häusermeeres von New York sicher auf dem Hudson River zu landen, ohne dabei auch nur einen einzigen Menschen zu verlieren.
Diese Meldung hatte das in der Finanzkrise taumelnde Amerika nicht nur aufgerichtet, sondern den entsprechenden Nachrichtenagenturen auch Millionenumsätze beschert, da jeder begierig war, die Geschichte dieses Mannes, der als Vorbild für ein ganzes Land taugte, das gerade dabei war, sein Selbstvertrauen flächendeckend zu verlieren, möglichst aus erster Hand zu erfahren.
Der Chef vom Dienst pflegte daher bereits seit Wochen jede Redaktionssitzung mit der Mahnung zu beenden „Meine Damen und Herren: wenn Sie hier noch eine Weile arbeiten möchten, wovon ich doch aus gehen, dann machen Sie sich endlich Gedanken! Ich wiederhole es noch einmal: Machen Sie sich endlich Gedanken!“
Die Redakteure und Volontäre, die Praktikanten und Fotoreporter hatten es begriffen, eine Story musste her, die allen ans Herz ging und über die die kleine Mansfelder Zeitung möglichst exklusiv berichten würde. Etwas wahrhaft Herzzerreißendes.
Rainer Matthes, ein junger Journalist aus er Region, der seinen Abschluss vor noch nicht allzu langer Zeit an der Leipziger Universität gemacht hatte, war sich der Aufgabenstellung bewußt. Während andere Kollegen längst aufgegeben hatten, saß er jeden Freitag, nach der Redaktionssitzung, an seinem Schreibtisch, um zu grübeln.
Eine Story musste her. Aber welche?
Jeden Tag geschahen Familientragödien im Einzugsgebiet des Blattes. Es gab Selbstmorde und gelegentlich sogar Morde. Es gab Brände, Einbrüche in Gartenlauben, Verkehrsdelikte, Wahlkämpfe um den Posten des Landrats oder irgendeines ehrenamtlichen Bürgermeisters. Es gab Geschäftseröffnungen und Konkurse. Nichts jedoch, dass geeignet war, die Herzen der Menschen derartig anzurühren, dass es als allgemeines Lehrstück von Heldenmut und Selbstlosigkeit dienen konnte und zudem noch geeignet war, die wirtschaftliche Situation derjenigen Zeitung, die es schließlich bringen würde, nachhaltig zu verbessern.
Immer wieder tauchte Rainer Matthes in die Tiefen des Internets ab. Immer wieder versenkte er sich in die Geschichte der Region, forschte er nach Personen, Ereignissen und Zusammenhängen.
Immer wieder aufs Neue hatte er schließlich mit diversen Vorschlägen, von denen er allerdings auch nur halbherzig überzeugt war, vor dem Schreibtisch des Chefs vom Dienst gestanden.
Immer hatte er abschlägigen Bescheid erhalten: kein Neuigkeitswert, bereits ein alter Hut, nicht von allgemeinem Interesse und so weiter.
Als er schließlich dabei war, aufzugeben und sich in der Region nach einem neuen Arbeitsplatz als Journalist oder Redakteur umzusehen, war er schließlich in einem kleinen Anzeigenblatt auf die Mitteilung gestoßen, dass in Klein Ehringen, einem geradezu winzigen thüringischen Dorf mit knapp 300 Seelen, das Denkmal eines Embedded Journalists, eines Kriegsberichterstatters, eingeweiht worden war.
Matthes war sofort wie elektrisiert. Ein Kollege also! Wie kam ein junger Mann aus einem winzigen westthüringischen Dorf dazu, Kriegsberichterstatter zu werden und mit den amerikanischen Truppen nach Afghanistan zu ziehen?
Die Story wurde noch mysteriöser, als er erfuhr, dass jener Kriegsberichterstatter in Afghanistan bei der Rettung eines kleinen Mädchens ums Leben gekommen war, welches seine Familie schließlich adoptiert hatte. Was war dort, in Afghanistan geschehen? Und warum war es geschehen?
Der Chef vom Dienst brütete lange über der E-Mail, die Matthes ihm geschickt hatte. Er kaute an seinem Bleistift, während er auf den Bildschirm seines Computers starrte. Und Matthes, der vor dem Schreibtisch seines Vorgesetzten stand, fand Zeit, die Familienfotos in der Ecke des Schreibtisches zu studieren, das Bild, welches sein Enkelkind für den Chef vom Dienst gemalt hatte und welches nun an der Wand des Büros hing, den abgegriffenen Duden auf dem Tisch und die Batterie der Kugelschreiber und Filzstifte, der Bleistifte, Scheren und Textmarker, die ihre bunten Hinterteile in die Luft streckten, wie kleine startbereite Raketen.
Matthes fiel plötzlich auf, wie dick der Chef vom Dienst in der letzten Zeit geworden war.
„Hm, hm!“, machte der Chef vom Dienst jetzt: „Zweifellos ganz interessant! Zweifellos ganz interessant! Und ungewöhnlich!“
Schließlich musterte er Matthes von unten herauf misstrauisch: „Und es hat wirklich noch niemand über diese Ereignisse berichtet? Ganz sicher?“
Matthes schüttelte den Kopf. Er hatte gründlich recherchiert: „Noch niemand!“
„Ganz sicher?“, bohrte der Chef vom Dienst weiter, kaute dabei an seinem Bleistift und schlug sich mit dem Stift sacht gegen die vorgewölbte Unterlippe.
„Ganz sicher!“, bestätigte Matthes.
„Ok!“, seufzte der Chef vom Dienst, klopfte mit dem Bleistift auf die Tischplatte des Schreibtisches und nickte dabei: „Viel zu verlieren haben wir ja nicht!“
Als Matthes das Büro des Chefs vom Dienst verließ, fühlte er sich wie ein Sieger. Er klatschte in die Hände. Dann begann er, seine Sachen zusammen zu suchen.
Klein Ehringen: das waren etwa 60 Kilometer Fahrt von hier aus.
Der Weg nach Klein Ehringen führte Matthes durch die Landschaft der Goldenen Aue. Jene fruchtbare Auenlandschaft zwischen dem Südrand des Harzes und den Höhenzügen der Windleite und des Kyffhäusers, deren satte Böden und Wiesen von dem kleinen Fluss der Helme durchzogen wurden, wie ein schwerer Brokatstoff von einem kostbaren Silberfaden.
Der Name der Landschaft, Goldene Aue, gemeinhin für das gesamte Tal der Helme im Gebrauch, geht auf eine Überlieferung Martin Luthers zurück, wonach der von seiner Pilgerreise nach Jerusalem heim kehrende Graf Botho zu Stolberg einst verkündet haben soll, er bevorzuge sein eigenes Land, welches er die Güldene Aue nenne und sei dafür sogar bereit, das gelobte Land, aus dem er just heim kehrte, einem anderen zu überlassen.
Matthes fuhr entlang der alten Heerstraße, welche von Nordhausen bis nach Merseburg führte. Heute längst ersetzt durch die Bundesstraße 80 und die Autobahn A 38.
Er fuhr durch die einzigartige Gipskarstlandschaft, bekannt auch als Rastplatz für die Vogelzüge. Bekannt für die Schlossanlagen von Auleben, von Heringen, von Roßla und Wallhausen.
Bereits fast am Ende seiner Fahrt, erreicht Matthes bei Nordhausen die Hainleite.
Einen überwiegend bewaldeten Höhenzug aus Muschelkalk, der sich fast fünfhundert Meter über Normalhöhennull erhebt. Und er ertappt sich dabei, wie er sich fragt, was ein Kind dieser Region dazu bringt, nach Afghanistan zu gehen. Aber zugleich und beinahe noch im selben Augenblick, findet er auch selbst die Antwort. Es ist der Entdeckerdrang des Menschen, der unbändige Wunsch, unsterblich zu werden. Und hatten nicht auch in früheren Zeiten Einwohner dieser abgeschiedenen und einsamen ländlichen Gegend, wie jener Graf Botho von Stolberg, ihr Bündel geschnürt und waren in die Fremde aufgebrochen? Letzterer sogar bis nach Jerusalem und in das Heilige Land?
Und war nicht auch das ferne Afghanistan, von dem man beinahe täglich in den Zeitungen las und im Fernsehen sah und hörte, für seine Bewohner heiliges Land? War es nicht derjenige Boden, um welchen nach dem Einmarsch der Sowjets im Jahre 1979 die Mudschaheddin bis zur Selbstaufgabe ihren sogenannten asymmetrischen Krieg geführt hatten, in dem sie doch am Ende siegreich blieben?
War es nicht, der wörtlichen Bedeutung nach, das Land der Afghanen? Das Land jenes Volkes und jener Stämme, die sich Paschtunen nannten und die Regionen vom indischen Subkontinent bis in jenes Afghanistan seit alter Zeit bewohnten?
War es nicht für die Paschtunen schon im 16. Jahrhundert heiliges und gelobtes Land gewesen, als es in den tschagataischsprachigen Memoiren eines gewissen Zahir ad-Din Muhammad Babur, des Begründers des Mogulreiches, zum ersten Mal offiziell erwähnt wurde?
War es seinen Bewohnern nicht heilig, ob es die fremdländischen Kartographen aus Schottland oder aus anderen Ländern, die es bereist und vermessen, die seine Berge bestiegen hatten, gierig auf der Suche nach den Bodenschätzen, nun Afghanistan oder Kabulistan genannt wurde? Für die Paschtunen blieb es heiliger Boden, den sie schlicht und über die Jahrhunderte hinweg und durch die islamische Blütezeit unter den Persern hindurch, stets nur schlicht Chorasan genannt hatten.
Das Land Chorasan, jenes Gebiet im Norden und im Westen des heutigen Afghanistan, welches bei den Arabern Hurasan wa-Ma wara‘ an-nahr hieß und wörtlich Land der aufgehenden Sonne bedeutete, was wiederum auf den Osten eines Gebietes verwies.
Unter Kyros dem Großen hatte die Region zum Perserreich gehört. Unterteilt in die vier Satrapien von Baktrien, von Sogdien, von Choresmien und Parthien.
Alexander der Große hatte das Land schließlich zur makedonischen Kolonie gemacht, welche von Mazedonien aus verwalte wurde.
Unter den Kalifaten der Umayyaden und der Abbasiden war das Land schließlich um 651 arabisch geworden.
1220 überrannten die Mongolenhorden, die wilden Reiter der Steppe unter Dschingis Khan, die im Sattel lebten, das Land Chorasan und sie führten es zu einer neuen Blüte, die über Jahrhunderte hindurch anhalten sollte.
1598 kam es zum großen Teil unter den Safawiden in iranischen Besitz. Seit 1748 jedoch beherrschten es stets die paschtunischen Emire aus der Dynastie der Nachkommen von Ahmad Schah Durrani, die zahlreiche berühmte Mitglieder der königlichen Familie Afghanistans stellte. Aber auch bekannte Kaufleute, Bürokraten, Händler und Angestellte, die ihren starken persischen Einfluß nie verleugnet hatten und die dennoch ein ehrenwerter und würdiger Stamm waren.
Aber bereits 1884 streckte der gierige Vater des später ermordeten letzten russischen Zaren Nikolaus, seine Hand nach dem Lande Chorasan aus, in dem sich zu dieser Zeit die Völker, ihr Wissen, ihre Traditionen, ihre Ehrbegriffe und ihre Leidenschaften und Kulturen miteinander mischten, wie die Sandkörner in der Ebene und wie das Geröll der Flüsse im Frühjahr nach der Schneeschmelze.
Die Paschtunen aber, sie blieben Muslime. Wie schon seit je her. Und besonders jene unter ihnen, welche der hanafitischen Richtung anhingen, die eine der vier großen Madhahib, der Rechtsschulen des sunnitischen Islams darstellte, befolgten stets den Ehrenkodex des Paschtunwali.
Das Paschtunwali, das ist nicht weniger, als die Summe ihrer überlieferten Stammesgesetze, wie sie nicht nur ideell, religiös und kulturell von essentieller Bedeutung ist, sondern auch, nach dem Glauben der hanafitischen Paschtunen, eine regelrechte Schutzfunktion im täglichen Leben ausübt. Eine Schutzfunktion, die sich auf de Familie, auf den Stamm, auf die gesamte Nation und vor allem auf die Ehre des Einzelnen und der Gemeinschaft erstreckt.
Paschtunwali, Paschtu oder Afghanyat: Das ist die uralte und bereits vorislamische Summe jener Traditionen und Gebräuche, die seit der Antike vieles vom einzelnen Stammesmitglied verlangen. Dazu gehört die Vergeltung, der Badal, wie sie es nennen. Der Badal, der für Austausch steht. Für den Austausch nach einer Kränkung, was nicht zwingend die Tötung eines Widersachers bedeutet, sondern auch für Austausch oder Wiedergutmachung steht, die ebenso gut in Gestalt von Geld, von Waren oder von Heirat erfolgen kann.
Dazu gehört die Gastfreundschaft, die Melmastya, die im Paschtunischen über allen Werten rangiert. Die Melmastya schließt das uralte Asylrecht ebenso in sich ein, wie den Nanawati, den Einlass oder die Vergebung. Absolut jedem und damit auch dem ärgsten Feind, muss der Nanawati gewährt werden. So schreibt es das Paschtunwali vor.
Wer den Nanawati einem Anderen gewährt, der gilt sogleich als Ghairatman oder Nanyalay, als Edelmann. Wer den Nanawati jedoch nicht gewährt, gilt keinesfalls als Edelmann, sondern zieht, im Gegenteil, den Scharm, also die Scham und die Schande, auf sich selbst.
Nang ist die männliche Ehre des Paschtunen, die über Tura, das Schwert, gebietet und die oft nur durch das Schwert selbst zu erzielen ist. Namus hingegen steht für die weibliche Ehre und Unversehrtheit, die mit dem Schwert und der männlichen Ehre verteidigt werden muss.
Namus, die weibliche Ehre, gebietet auch den Schutz der Familie, des privaten Grund und Bodens und des eigenen Hauses. Und wer Tura leistet, dieses alles mit dem Schwert in der Hand mannhaft und unter Missachtung des eigenen Lebens verteidigt, der leistet nicht nur einen Dienst an seiner Familie, sondern an seinem Stamm, ja an der gesamten Nation und damit an der Allgemeinheit der Menschen im Lande Chorasan!
Wann immer der Paschtune sich mit seinesgleichen streitet, so wussten und beschrieben es schon die Vorfahren, geht es dabei meist um die Ursachen aller Zwietracht: um Zan, Zar und Zamin. Also um Frau, um Gold und um Boden.
Doch nicht immer muss dabei zum Schwert gegriffen werden. Ebenso legitim ist es auch, Dschirga, die Versammlung, einzuberufen oder sogar Loya Dschirga, die Große Versammlung. Damit diese zunächst die Gond, also die streitenden Parteien, durch Tiga oder Kana, durch die von Steinen markierte Demarkationslinie, voneinander trenne.
Die Dschirga muss die streitenden Parteien miteinander versöhnen, wobei die Beschlüsse der Dschirga bei Bedarf auch durch die Zalwechi, eine aus insgesamt 40 Männern bestehende Exekutive der Dschirga, mit schierer Gewalt durchgesetzt werden können.
Denn alle Beschlüsse der Dschirga sind de Kano kerscha: Mit dem Stein gezogen und daher allgemein verbindlich.
Und wie in der zweiten Sure des heiligen Korans, offenbart nach der Hidschra, welche heißt Al-Baqara oder die Kuh, geschrieben steht: 2. Dies ist ein vollkommenes Buch; es ist kein Zweifel darin: eine Richtschnur für die Rechtschaffenden; so glauben die Paschtunen seit alters her an den heiligen Koran und an den Kanon von Gesetzen und Verhaltensregeln, wie ihn das Paschtunwali vorschreibt, welches schon da war und für Ordnung und Existenzgarantie unter den Paschtunen sorgte, lange bevor jene bartlosen Männer aus Schottland oder aus Russland kamen und ihnen dasjenige brachten, was sich moderne Gesetzgebung nennt.
Das Paschtunwali aber kennt viele und für den bart- und gottlosen Fremden oft verwirrende Gesetze und Gebräuche. Und wie der heilige Koran selbst mit der Sure beginnt: Trag vor im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, so beginnt das Paschtunwali mit dem aller ersten Gesetz, mit der Melmastya. Diese gebietet die Gastfreundschaft und die Bereitschaft zur Erteilung von Asyl gegenüber jedermann ohne Erwartung auch nur der geringsten Art von Gegenleistung. Sie gebietet jedoch noch mehr, denn sie fordert von jedem Paschtunen, so er ein Ehrenmann sein will, seinen Gast unter Einsatz des eigenen Lebens gegen seine Feinde zu verteidigen.
Badal schließlich lautet das zweite Gesetz des Paschtunwali und es steht für das Recht und die Pflicht, an seinen Feinden Rache zu nehmen. Wem auch immer Ungerechtigkeit oder Böses widerfahren ist, dem fällt das Recht zu, Rache zu nehmen oder im Tausch für das erlittene Unrecht entschädigt zu werden.
Nanawatay aber lautet das dritte Gesetz des Paschtunwali. Und es steht wortwörtlich für das Hineingehen eines Besiegten in das Haus des Siegers, um dort um Vergebung zu bitten. Stets kann Nanawatay durch einen Besiegten eingefordert werden. Nur dann nicht, wenn eine Frau entweder entehrt oder aber verletzt wurde.
Nang oder Ehre, dies ist das vierte Gesetz des Paschtunwali und es schließt die zahlreichen nun folgenden Punkte ein, welche einzeln und in ihrer Gesamtheit die Ehre des Paschtunen und gleichzeitig die Ehre seiner Familie ausmachen.
Tor oder Schwarz gehört zur Ehre und beschreibt damit alles, was mit der Ehre der Frau des Paschtunen zusammen hängt. Tor oder Schwarz kann stets nur durch Spin oder Weiß abgewaschen werden, was immer für den Tod des Verursachers steht.
Tarboor oder Cousin steht in den Ehrbegriffen der Paschtunen für den Sohn des Bruders des Vaters, mit dem oft eine Feindschaft oder Rivalität besteht.
Jirga ist die Versammlung der Stammesältesten der Paschtunen. Sie tagt zu den verschiedenen Gelegenheiten oder sie wird einberufen, um Dispute zu führen und Streitigkeiten zu klären.
Laschkar jedoch ist die Stammesarmee der Jirga. Sie setzt sämtliche Entscheidungen der Jirga wenn notwendig mit Gewalt um.
Zalwesti steht für 40, denn die Jirga hat entschieden, dass jeder 40. Mann einer Stammesgemeinschaft ihr Mitglied zu sein hat. Neben Zalwesti existiert schließlich auch der Begriff des Kurram. Dieser steht für 20, denn die Jirga kann auch befinden, dass jeder 20. Mann einer Stammesgemeinschaft ihr Mitglied zu sein hat.
Teega oder Kanrei steht für den Stein. Dies ist ein festes Datum, zu dem sämtliche Feindseligkeiten innerhalb eines Paschtunenstammes unterbrochen sein müssen und ruhen.
Nikkat steht für Großvater und beschreibt den Rechtsgrundsatz, wonach sämtliche Profite und Verluste gleichermaßen gerecht unter sämtlichen Mitgliedern eines Paschtunenstammes verteilt werden müssen. Jede Generation schreibt diesen Verteilungsschlüssel für sich fest, was oft für Außenstehende des Stammes den Eindruck größter Ungerechtigkeit erwecken kann.
Badragga beschreibt die Stammeseskorte, die stets aus jungen und kräftigen Männern eines Paschtunenstammes besteht. Jeglicher Angriff auf eine Badragga kann sofort eine Stammesfehde nach sich ziehen.
Hamsaya bedeutet eigentlich Nachbar, umfasst jedoch eine Gruppe von Schutzbefohlenen. Stets begibt sich eine Hamsaya in die Obhut des stärksten Stammesmitgliedes und jeder Angriff auf eine Hamsaya wird unverzüglich mit dem Angriff des stärksten Stammesmitgliedes auf den Angreifer beantwortet.
Qalang steht für diejenige Miete oder Steuer, welche vom Gutsherrn gegenüber von den Mitgliedern eines Paschtunenstammes erhoben wird.
Malatar beschreibt diejenigen Mitglieder eines Paschtunenstammes, die mit oder ohne einen militärischen Führer, an einer bewaffneten Auseinandersetzung teilnehmen.
Mu‘ajib ist die halbjährliche oder jährlich vorgenommene Auszahlung von Geldsummen an die Mitglieder eines Paschtunenstammes, die der politische Machthaber vornimmt.
Lungi bedeutet hingegen, dass der politische Führer diese Geldsummen lediglich an die Unterführer auszahlt, nicht jedoch an den gesamten Stamm.
Nagha ist die Strafsumme, die durch den Stammesältesten festgesetzt wird und die ein dazu Verurteilter an den Stamm nach bestimmten Vergehen zu zahlen hat.
Rogha ist die erfolgreiche Schlichtung eines Disputs oder Streites zwischen streitenden Parteien.
Hujra beschreibt den Aufenthaltsort oder Schlafplatz, der Gästen und männlichen und unverheirateten Mitgliedern eines Stammes innerhalb eines Dorfes zusteht. Die Kosten dafür werden unter allen Bewohnern eines Paschtunendorfes aufgeteilt. Immer grenzt eine Hujra unmittelbar an eine Moschee.
Swara beschreibt die Sühne, welche bei Mord, Ehebruch oder Entführung durch den Schuldigen zu leisten ist. So kann die Jirga beschließen, dass eine Frau aus der Sippe des Täters mit einem Mann aus der Sippe des Opfers verheiratet wird, um den Streit auf diese Weise beizulegen.
Auch nach dem Einmarsch der Amerikaner in Afghanistan, nach dem 11. September 2001, besteht das Paschtunwali offiziell und zugleich inoffiziell fort.
Erst die Loya Jirga gab der Regierung des Hamid Karzai aus dem Clan der Popalzai, der ein direkter Nachfahre von Ahmad Schah Durrani ist, seine Legitimation als Präsident des Landes. Nicht die Amerikaner waren dies. Die Loya Jirga allein gab ihm die Legitimation für sein politisches Amt, niemand sonst!
Es ist ein heiliges Land, das Land gen Sonnenaufgang! Das uralte Land Chorasan! Es ist ein Land, das es erfordert Tura zu ergreifen, um es zu verteidigen, wie es schon die Ahnen taten, bis hinab zum aller ersten Menschen, der hier wandelte.
Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. O ihr Menschen, dienet eurem Herrn, der euch erschuf und die, die vor euch waren, auf dass ihr beschirmet seid.