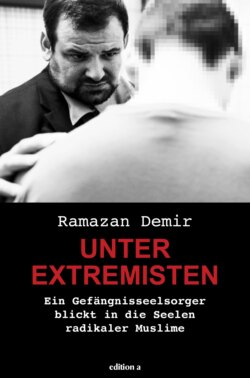Читать книгу Unter Extremisten - Ramazan Demir - Страница 5
MUSA
ОглавлениеSie töten dich, wenn sie dich finden.
Musa kauert in einer Ecke, den Kopf zwischen den Knien, die Hände flach an die Ohren gepresst. Ein Bild von Geborgenheit, auf einen ersten, flüchtigen Blick. Ähnlich dem eines Kindes, das beim Versteckspiel die Augen schließt im Glauben, für sich zu sein, selbst nicht gesehen zu werden. Doch Musas Kauern ist das genaue Gegenteil von Geborgenheit. Der untaugliche Versuch zur Abwehr einer Welt, die nicht länger sein darf. Auch ist Musa kein Kind. Und es ist auch nicht länger ein Spiel. Das ist es nie gewesen. Um ihn herum das erkaltete Gemäuer eines Einfamilienhauses oder das, was einmal vorgegeben hat, ein Einfamilienhaus zu sein.
Stockdunkel umhüllt den jungen Mann. Nicht weit von seinem löchrigen Unterschlupf, vielleicht fünfzig Schritte voraus, zerreißt Maschinengewehrfeuer die schwarze Luft. Nur allmählich verebbt das arrhythmische Tackern der Salven. Zögerlich. Als müsste die Luft erst für sich selbst befinden, ob sie diesem so schwer misshandelten Land eine Pause zum Verschnaufen gönnt oder nicht.
Sie töten dich, wenn sie dich finden.
Ja, denkt Musa, das werden sie. Denn Musa ist um keinen Deut besser als einer von denen, um nichts besser als ein kāfir, ein Ungläubiger, deren es unzählige gibt auf dieser Welt und die zu unterwerfen, zu bekehren oder am besten gleich auszurotten ist. Seinerzeit. Acht Monate liegt dieses Seinerzeit gerademal zurück. Seinerzeit hat er ernst gemacht, hat den theoretischen Beschwörungen der guten, gottgerechten Sache die Krone der Praxis aufgesetzt, ist endlich angetreten an der Front. Als Krieger Allahs. Hier in Syrien.
Wie viele hast du seither getötet?
Musa weiß es nicht. Bloß, dass ihm das MG 3, das sie ihm verpasst haben, zum treuesten Gefährten in diesen Monaten herangewachsen ist. Ein aalglattes, kühles Stück deutschen Maschinengewehrstahls, erbeutet in einem der blutigen Raubzüge des IS und von Anfang an hart am Mann. Unausgesetzt. Tagsüber. Nachtsüber. Ausschweifend lange Einweisungen am Gerät vor Ort hat es nicht gebraucht. Alles hundertfach trainiert. Und dann: einfach drauf losballern, Ego-Shooter-Routine. Ego-Shooter-Kitzel. Bloß in echt. Das Gute auf der Jagd nach dem Bösen. Das blindlings erfolgte Hinausjagen einer Salve um die andere. Ins Licht. Ins Dunkel. Bald schon hat er aufgehört, ihren satten Donner zu hören. Bald schon sieht er nur noch die Blitze, die von seinem stählernen Gefährten losfahren, ins Weiß, ins Schwarz, und bisweilen, wie zum bestätigenden Echo, als verzerrtes Wehklagen wiederkehren. Bizarre Schreie klingen auf. Als würden sie aus einer Spielkonsole generiert. Als wären sie nicht von dieser Welt. Und doch sind sie Bezeugungen eines im Hier und Jetzt gezeitigten Erfolges.
Musa nimmt die eine Hand vom Ohr, betastet die aufgeschürften Knie. Eben noch hat er in einem Haufen aus Schutt, Glas, zersplittertem Metall gekniet. Doch da ist kein Schmerz. Nur ein dumpfes Fühlen. Die Kälte kann seinem ausgemergelten Körper nicht an. Dünne Jacke hin, zerschlissene Hose her. Ebenso wenig Hunger oder Durst. Ströme von Adrenalin pumpen jedes Empfinden hinfort.
Stattdessen wehen Fetzen loser Gedanken heran, schütteln Musa durch. Wie Rückstöße der unkontrollierten Salven, die er eben noch in die Nacht gejagt hat. Hat er denn überhaupt? Er greift nach den Gedanken, bekommt eine Handvoll zu fassen. Andere lässt er unformuliert ziehen, spürt ihnen in einer Mischung aus Wehmut und Schaudern nach. Und auf einmal gewahrt er, dass er am ganzen Leib zittert. Ein Bibbern wie von Schüttelfrost. Ein Krampf durchfährt seinen Leib. Auch er kommt und geht frei von Schmerz. Abgetönt, wie in Watte. Der Tod ist nahe gerückt, verdammt nahe, sagt er sich. Und er weiß, dass es nicht jener Tod ist, auf den man ihn so lange so eindringlich vorbereitet und den zu fürchten er sich versagt hat. Es ist ein friendly fire, dem er ins Auge blickt, eines, das so gar nicht friendly daherkommt, so gar nicht unbeabsichtigt aus den eigenen Reihen erfolgt und auch nicht konform geht mit den Verheißungen.
Sie töten dich, wenn sie dich finden. Erst foltern sie dich. Endlos lange. Dann, irgendwann, richten sie dich hin.
Natürlich weiß einer wie Musa, was ihm blüht. Er kennt die eisernen Gesetze, die unerbittliche Härte nach außen und die noch um vieles unerbittlichere nach innen, kennt die Mechanismen der gnadenlosen Abrechnung mit jenen, die vom großen Traum der großen Sache abfallen. Die Abtrünnigen. Die Verräter. Sie sind schlimmer noch als jeder gottverdammte kāfir auf diesem Planeten. Und genau das ist er: ein Abtrünniger. Ein Verräter.
Musa hat seinen Traum bis ans Äußerste gelebt. Die Blase seines Traumes. Doch dann, in einem sehr bestimmten Augenblick, ist es zu viel gewesen. Und an die Stelle des unverrückbaren Guten in ihm ist die Fratze des Bösen getreten. Das Böse hat sich ihm zum Spiegelbild gemacht. Jenes Böse, das er mit jeder weiteren Kugel, jedem weiteren Toten erfolgreich zu bekämpfen geglaubt hat. All die wahllosen Übergriffe, Schändungen, Folterungen, Hinrichtungen, an denen er und Seinesgleichen euphorisch teilgehabt, haben unvermutet angefangen ihn zu umzingeln. Es ist ein innerer, doch schier unüberwindbarer Feind, der ihn da umfängt, ausgestattet mit der Gewalt der Ernüchterung, der zersetzenden Kraft eines jäh verblassenden Trugbildes. Die Kraft der Gerechtigkeit, die er auf alle Tage an seiner Seite getragen hat, ist implodiert unter einer machtvollen Detonation, und aus den rauchenden Trümmern seines Daseins belagern ihn die Versatzstücke der leergefegten Bühne: Unsicherheit. Enttäuschung. Und Angst. Sie über allem. Nackte, namenlose Angst.
Sie töten dich, wenn sie dich finden.
Sie. Seine vormaligen Freunde. Wer auch immer sie dann sein mögen. Mehr als einmal, erinnert er sich, hat er geholfen, Anti-IS-Schergen mit Seilen ans Heck eines Geländewagens zu knoten. Und ab, quer durch die Stadt. Jenen zur Warnung ins Stammbuch geschrieben, die meinen, sich gegen Allahs irdischen Arm zur Wehr setzen zu müssen. Abermals sieht Musa die Antlitze dieser Männer auftauchen. Sie stehen, knien an den Innenlidern seiner zusammengepressten Augen, blutüberströmt und schon jetzt halbtot um Gnade winselnd, ehe der wilde Ritt über staubige Straßen erst losgeht. Gnade? Das Wort Gnade findet keinen Widerhall in ihrer, seiner Sprache. Um Gnade zu flehen ist in ihrer, seiner Welt geradezu lachhaft. Ein Zeichen endloser Schwäche. Ein Zeichen von Selbstaufgabe.
Ein andermal hat Musa reglos zugesehen, wie Kämpfer seines Trupps eine Handvoll junger Männer hingerichtet haben. Vor den Augen ihrer im Schrecken verstummten Mütter. Es ist wirklich nichts Persönliches. Es ist bloß, weil der Verdacht von Spionage im Raum steht. Nichts Konkretes. Mehr ein vages Gerücht. Härte zeigen, einfach bloß, um gekeimten oder auch nur allfälligen Widerstand gegen den Islamischen Staat zu brechen. Schon nach ein paar Wochen hat sich die Wertigkeit eines Menschenlebens in ihm bedeutend verringert, und schon bald schrumpft die Halbwertszeit gegen Null. Jedes Tun, jedes Denken erfolgt nur noch wie unter einer einzigen, alles vereinnahmenden Wolke, die über Land und Leuten liegt. Sie steuert die Geschöpfe, Ereignisse, macht sie zu ameisenhaft winzigen Gefügigen im Geiste einer riesenhaften, übergeordneten Fügung, setzt die Impulse einer kollektiv entfesselten Lust an Gewalt und Macht – und setzt diese Impulse auch frei. Eine gemeinschaftliche Ohnmacht der Unbarmherzigkeit, die wie ein Leitstern auf ihrer aller fundamentalistischem Himmel steht. Und so hat der Mensch als des Menschen Wolf rasch auch in ihm, Musa, die Oberhand gewonnen. Das Tier hat gesiegt. Der Rausch des Triumphierens, die Triebe und der Instinkt des Überlebenwollens als alles bestimmende Faktoren.
Dann aber, inmitten dieses nicht enden wollenden Rausches und wie zur ungebetenen Nüchternheit, ist der Traum geplatzt. Plötzlich erscheint Musa Musa wieder als er selbst. Wenn auch nur unterschwellig und für niemand sonst erkennbar. Jener alte Musa, den es tief verborgen auch noch gibt. Der Hitze, Feuer, Kälte, Tod und Verderben ringsum überdauert hat wie ein Same, der endlos lange im Tiefschlaf ausharrt und nur dieses einen Tropfens Wasser bedarf, der ihn am rechten Ort zur rechten Zeit begießt, zum Keimen bringt.
Er sieht, wie ein Getreuer eine junge Mutter vor sich hertreibt, hin zu einem Abgang in eine Schutthalde, die einmal Zuhause geheißen hat. Musa weiß, was kommt. Die Waffe im Anschlag, wird der Kämpfer die Frau in Schach halten, sie nach Belieben missbrauchen. Auf welche Weise immer. Es gibt keinen Zweifel an dem, was folgt. Einziger Unsicherheitsfaktor allenthalben würde sein, wie oft er es tut.
Musa kennt diese Art von Schrei, der so anders klingt als alle übrigen, die eine Kehle freizusetzen weiß. Markdurchdringender, als jeder Regisseur eines Horrorstreifens es in Szene zu setzen wüsste. Das atemlose Herauswürgen von Hoffnungslosigkeit und Schrecken. Das sprachlose, keuchende Wissen, dass zwischen jetzt und dem erlösenden Tod nur noch endlose Bahnen des Grauens liegen. Musa blickt hin, sieht das lähmende Entsetzen im Antlitz dieser Frau. Ich werde, kann, darf mich nicht wehren, steht darin geschrieben. Was geschieht sonst mit meinen Kindern? Wer kümmert sich um sie, wenn ich nicht mehr …? Und auf einmal sieht Musa seine Mutter Maryam, sieht seine beiden jüngeren Schwestern. Hatija und Aisha. Sie starren ihm in die Augen, versinken nebelhaft im Boden. Seine von ihm so verherrlichte Mutter, die ihn und die Schwestern mangels Vater zeitlebens umsorgt, die sich die Hände blutig geschuftet hat, um sie alle durchzubringen. Irgendwo dort. Im fernen Mitteleuropa.
Und auf einmal weiß Musa, dass Schluss sein muss. Dass er nicht weitermachen kann. Es ist nicht bloß eine vage Einsicht. Es ist eine bodenlose Überwältigung, die ihn aufschaudern lässt, ihm die Knie erweicht, während die Schreie dieser anderen, unbekannten Mutter dumpf an sein Ohr dringen. Oh, nein, er denkt nicht darüber nach, sie zu retten. Nicht eine Sekunde. Wie absurd. Als würde ein einzelnes Sandkorn gegen einen Sandsturm aufbegehren. Nein. Musa denkt bloß daran, dass er nicht mehr kann. Dass er es nicht mehr ertragen kann. Das alles hier. Dass er weg muss. Jetzt. Andernfalls ist sein Verlorensein ein endgültiges, unendlich tiefer noch als jenes, in dem er bereits feststeckt.
Und so mobilisiert Musa alle Kräfte, stiehlt sich nachts heimlich aus den Reihen davon. Seine Flucht hat begonnen, es gibt kein Zurück, und dieser nackte Trieb des Fortbestehens peitscht ihn immer weiter fort. Bis hierher. In dieses zerschossene Stück Existenz. In dieses von Granaten und Gewehrkugeln zersiebte Haus.
Wie lange hat er schon nicht mehr nachgedacht? Musa hat nicht den Schimmer einer Ahnung. Bloß, dass er es jetzt wieder tut. Endlich wieder. Dass er sich fragt, was und wer er ist. Ja, er, Musa, Sohn einer Mutter. Bruder zweier Schwestern. Aber darüber hinaus? Ist er ein Mörder? Weil er andere Menschen getötet hat? Aus welchen Gründen? Sind es richtige Gründe? Ehrenhafte? Oder doch …? Gibt es überhaupt richtige, ehrenhafte Gründe, einen Menschen zu töten? Ein ums andere Mal schiebt Musa diese drängenden Fragen beiseite. Sie sind lästig, lenken ihn ab von seiner Aufgabe. Und diese Aufgabe hat nur einen Namen: Überleben.
Doch dann, wie zur ultimativen Prüfung seines aufgeweichten Gewissens, bedrängt ihn diese andere Frage: Wie hat es soweit kommen können? Wie mitunter, dass er zu zweifeln begonnen hat? Alles hat so leuchtend klar vor ihm gestanden. Seinerzeit. Zuhause. Er ist frei von Zweifel gewesen, wollte, würde dieser einen, richtigen Sache dienen. Gerade so, wie der Prediger es ihm prophezeit hat. Der Prediger. Dieser kluge, Ehrfurcht gebietende Mann. Dieser Vater, zu einem solchen aufzuschauen ihm nie vergönnt gewesen und der dieser fremde Mann ihm so selbstlos gewesen ist. Aus dem Koran hat er ihm vorgelesen. Auf Arabisch. Wiewohl Musa gerade das nicht kann: Arabisch. Doch es sind ihm wohlvertraute Klänge, die träumerisch aus seiner alten Heimat Tschetschenien heranwehen. Musas Sprache ist Deutsch. Die Sprache der neuen Heimat, die ihm nie zu einer geworden ist.
Bei ihm, dem weisen, wie allwissenden Prediger, hat Musa sich von Anbeginn geborgen gefühlt. Diese Wärme in der Brust, ernstgenommen zu werden. Er, Musa, ist nicht ein länger x-beliebiger lästiger, kraft seiner Herkunft missachteter Tschetschene in Wien. Musa ist mit einem Schlag Mensch. Man achtet ihn. Braucht ihn. Und wenn er zu dem Prediger von diesem Leben in Wien spricht, sieht ihm der Prediger tief in die Augen. Wie auch er dem Prediger tief in die Augen sieht, wenn der von seinen Dingen spricht. Seiner Sicht der Welt. Dem Übel. Und auch davon, dass Allah den Tod der Ungläubigen wünscht.
Er erzählt Musa von den Untaten, die Ungläubige in aller Welt begehen. Nicht bloß in Syrien. Nicht bloß im Irak. Rund um den Globus. Auch in Europa. Gerade in Europa, wo es oberstes Ziel sei, sich die Muslime untertan zu machen. Menschen wie ihn, Musa. Seine Brüder und Schwestern. Und dass es Männer und Frauen seiner Schlagkraft, seines noch zu festigenden Glaubens bedürfe, den Ungläubigen Einhalt zu gebieten. Dies allein sei Allahs Wille.
Ja, Musa hat die Wut des Predigers verstanden. Zunehmend mit jeder Faser seiner von Misstrauen, Ausgrenzung und Generalverdacht geleiteten Existenz. Wie er auch die Wut des Predigers über ihn und andere junge Muslime verstanden hat, die ihr Leben der Bequemlichkeit verschrieben hätten. Die in Sicherheit schliefen, während ihre Geschwister draußen in der Welt Leid und Ungerechtigkeit zu erdulden hätten. Und insgeheim hat er begonnen, das Lob des Predigers für jene, die ausziehen, um zu kämpfen, zu seinem eigenen Lob zu machen. Die Bomben in U-Bahn-schächten zünden. Die Ankunftshallen auf Flughäfen zu Kriegsschauplätzen wandeln. Die Lastwägen zu Waffen gegen Menschenmengen machen. Oder einfach nur in einem Zugabteil ein Messer zücken. Von London spricht der Prediger. London vor bald zehn Jahren. Juli 2005. Vier der Ihren, allesamt mit britischem Pass, die Sprengsätze zünden in U-Bahn und Bus und 56 Menschen in den Tod reißen. Weitere siebenhundert verletzt. Und er spricht von der jüngsten Vergangenheit. Brüssel im Mai 2014. Das Attentat im Jüdischen Museum.
Nicht alle Bilder zu den Taten trägt Musa in Erinnerung. Bei London ist er noch ein Kind am Übergang zur Hauptschule gewesen. Doch an Brüssel erinnert er sich nur zu gut. Brüssel ist allzu frisch. Wenige Wochen ist das damals her gewesen. Der Name Mehdi Nemmouche dringt erstmals an Musas Ohr. Ein Franzose algerischer Abstammung und Syrien-Heimkehrer. Einer von vielen, die sich fortan auf den Kampf in Europa eingeschworen haben. Wie eine Fackel des eisernen Widerstands glimmt der Name in den Augen des Predigers auf.
Musa indes hat andere Pläne. Längst hat er begonnen, zuhause seinen beiden kleinen Geschwistern von der Strahlkraft des IS zu berichten, von der famosen Idee der Errichtung eines Islamischen Staates. Es werde eine Zeit kommen, doziert er, da alle Muslime der Welt sich ihnen anschließen würden. Dann würden die schon sehen, wie stark sie seien. Wie stark wir sind. Mehr als eineinhalb Milliarden Muslime gebe es. Viele müssten erst für die Sache überzeugt werden. Doch dann. Und all jene, die sich gegen sie stellten, seien Verräter und würden die Konsequenzen ihres Verrates bitterlich zu tragen haben.
Längst ist da sein Entschluss herangereift. Ja, auch Musa will der richtigen Seite, der Seite der Gerechten angehören, will sein Teil beitragen, das weltweite Unrecht gegen Muslime auszurotten. Wo immer. Ihn jedoch zieht es ins Kernland des IS-Kampfes, von wo aus das neu errichtete Kalifat seinen Siegeszug um den Globus antreten wird: Syrien. Und vielleicht, später dann, Europa, um dort die ihm von Allah auferlegte Pflicht fortsetzen.
Angst vor dem Sterben glaubt Musa da schon lange keine mehr zu kennen. Der Tod, hat der Prediger ihm wieder und wieder eingetrichtert, sei bloß die heiß ersehnte Schwelle hinüber ins Paradies. Und Syrien, hat er angefügt, sei nichts als der Vorhof dieses Schlaraffenlandes. Die Männer dort seien tot oder geflohen, und die Frauen würden ihm und Seinesgleichen gehören. Desgleichen die unzähligen Villen im Land, die nun verwaist leer stünden, neuer Herren harrten. Syrien also, hat Musa befunden. Und als es dann acht Monate später in Paris zu Charlie Hebdo mit insgesamt zwölf Todesopfern kommt, den späteren Tod der beiden Attentäter nicht eingerechnet, ist er längst hier.
Musa schaudert auf. Die Heilsversprechen des Predigers von damals schießen ihm durch den Kopf. Jetzt auf einmal wie Giftpfeile. Und jedes Gegenserum erscheint wirkungslos, die Verheißungen am Horizont seiner Hoffnungen und Erwartungen in Trug und Rauch auflöst, verpufft zu einer diffusen Wolke aus Lügen und Propaganda. Das glorreiche Wissen, welches er einmal zu besitzen geglaubt hat, ist gänzlich verflogen. Was er noch hat, ist allein sein Instinkt als Mensch, der ihm verbietet, seinen Schutz aufzugeben. Zitternd vor Angst und Erschöpfung bleibt er noch geraume Zeit in Deckung. Das hier, weiß er, ist nicht ein Funke vom Paradies. Es ist die Entität des Feuers, das aus der Hölle zu ihm emporschlägt.
Irgendwann, im Schutz dieser bewölkten, ausnahmsweise sternenlosen arabischen Nacht, gelingt Musa der Ausbruch aus dieser Hölle. Unbemerkt kommt er davon, stolpert wie in Trance dem entgegen, was er einmal als Leben gekannt hat. Über die Türkei und den Balkan schlägt er sich durch bis Wien, steht, physisch und psychisch am Ende aller Kräfte, an Mutters Maryams Tür, die ihn längst verloren gegeben hat. Hier taucht er unter. Bei ihr und den Schwestern Aisha und Hatija. Kurze Zeit nach seiner Heimkehr, an einem verregnet kühlen Morgen, läutet es an der Tür. Beamte des Verfassungsschutzes. Erst jetzt hat Musas Flucht ihr tatsächliches Ende gefunden.
*
Das Gesicht des Häftlings ist schmal, fast eingefallen, und die markanten, hoch abstehenden Wangenknochen erwecken den Eindruck, als wollten sie einen Rest von Stolz hochhalten, Relikte aus verlorenen Tagen, vom übrigen Antlitz des jungen Mannes wie auch seinem Körper längst verworfen. Sein loser Händedruck fügt sich da ins Bild, ist wie der Griff in einen angefeuchteten Schwamm. Er ist von mittelgroßer, beinahe schmächtiger Statur, trägt das Haar kurz und wirr, und seine Augen sind ermattet dunkel, ein schales Schwarz, wie gebrochen. Ein alles in allem hageres Männchen ohne Kontur, das da vor mir steht, ohne Halt, und auch ohne Ziel, wie es scheint.
Die Wege sind verschlungen und weit, um einen wie Musa erstmals allein zu Gesicht zu bekommen. Unter vier Augen. Und nur im Fall des Falles ist ein weiteres Augenpaar zur Stelle. Endlos lange, endlos trostlose Korridore und Treppen haben mich hierher ins vierte Stockwerk geführt. Abteilung C. Ab und an ein Bild an der Wand, eine Bleistiftzeichnung, die meisten erstaunlicherweise von gar nicht ungelenkem Strich.
Erstaunlicherweise?
Irgendwo, mittendrin in diesem Nichts aus bezuglosen Längen und Etagen, ein nüchterner Aufenthaltsraum mit zerschlissener Gymnastikmatte. Ein Hometrainer. Ein Tischtennis-Tisch. Und weiter. Viele der Korridore sind mit gräulich marmorierten Kunststoffplatten ausgelegt. Andere mit Bahnen aus beigem Linoleum. Da wie dort durchwebt ein diffuser, grüngelblicher Schimmer die Gänge. Das Zusammenspiel von kaltem Deckenlicht und schmutzig weißen Wänden mit ebenso schmutzig weißen Türen macht es aus, sage ich mir. Manche Türen sind lindgrün umrahmt, manche paprikarot, über Kopf bis auf Hüfthöhe, andernorts auch Türblätter, die wie ihre Fassungen in durchgängigem, sattem Tannennadelgrün schimmern.
Die Zimmer hinter der Armada von Türen sind von weitgehend einheitlicher Größe und Grundausstattung. Kleinigkeiten machen den Unterschied aus. Persönliche Präferenzen wie auch Möglichkeiten. Die Fenster blicken zum Hof, einige sehen den Fußballplatz. Und wären die Zugänge nicht durch und durch aus Metall, und stünden die an ihrem Ende zu kleinen Bällen abgerundeten Türschnallen nicht auf seltsame Weise senkrecht nach oben ab, und fehlten ihre Gegenstücke nicht an den Türinnenseiten überhaupt, man könnte meinen, in einem aus der Zeit gefallenen Sanatorium gelandet zu sein. Oder einem aufgelassenen Provinzkrankenhaus aus den späten Sechzigern. Nur der markante, leicht süßliche Geruch von Chloroform fehlt. Doch hier ist nichts aufgelassen, nichts aus der Zeit gefallen, sieht man von den Gästen ab. Hier herrscht Vollbetrieb im 21. Jahrhundert. Von morgens bis abends. Montags bis sonntags. Ausgebucht bis aufs letzte Stahlrohrbett von Jänner bis Dezember, Tendenz: überbelegt. Ein Hotel mit Vollpension wider Willen.
Knapp 1100 Häftlinge sitzen hier ein, in der Justizanstalt (JA) Josefstadt in Wien, Österreichs größtem Gefängnis. Beinahe jeder dritte Insasse ist Muslim. Es ist Freitag, kurz nach dreizehn Uhr. Der Geruch vom Bratensaft liegt immer noch in der Luft. Instantware. Gulasch, wie ich mutmaße. An der Pinnwand, scharf neben der Türe, sehe ich den Aushang, dass ich zurzeit keine Zeit habe. Soll heißen, dass meine Kapazitäten für Gespräche wie das folgende restlos erschöpft sind. Keiner weiß das besser als ich. Musa hat Glück gehabt, gepaart mit einem Mix aus Eindringlichkeit und Aufdringlichkeit, die er im Vorfeld an den Tag gelegt hat, und wie ich rasch bemerke, weiß er sein Privileg auch zu schätzen. Handshake. Wir nicken einander stumm zu, dann erst betreten wir den Besprechungsraum. Die umfunktionierte Zelle, in die Musa und ich uns begeben, ist anders als die übrigen. Noch spartanischer. Zwei Stahlrohrsessel mit Holzauflage empfangen uns. Ein kleines Tischchen, das von der Türe aus jederzeit einsehbar ist und gerade ausreichend groß für zwei Paare gefalteter Hände ist. Bei Bedarf eine Gebetskette. Ein Koran. Mehr nicht. Einzig im legendären Café Hawelka in der Wiener Innenstadt fänden an solch minimalistischem Ort vier, vielleicht fünf Menschen Platz, die Schlichterqualitäten des alten, längst verstorbenen Ehepaars vorausgesetzt.
Tatsächlich sind zwei fast schon zu viel, und der knappest bemessene Raum ringsum führt die Sprache maximaler Reduktion beharrlich fort. Eine bessere Briefmarke mit Zu- und Abgang. Am hinteren Ende des Zimmerschlauchs zwei schmale, übereinander angeordnete Fenster, in dunklem Grün gerahmt. Jedes so groß wie ein Kopf. Das war’s.
Doch um ausschweifenden Raum oder heimelige Atmosphäre dreht es sich hier nicht. Hier geht es ausnahmslos um Lebensgeschichten. Um Welten und ihre subjektive Wahrnehmung und Darstellung. Und so habe ich fest im Sinn, auch Musas Geschichten – jene über Morde und Plünderungen und all die anderen Schreckenstaten während der langen Monate in Syrien – vielleicht nicht immer kommentarlos, doch auf jeden Fall frei von Wertung hinzunehmen als das, was sie sind: Erinnerungen, oftmals zu eigenen, befremdlichen Wahrheiten getrübt, die jäh, bisweilen auch im Zuge ein und desselben Gesprächs in völlig andere Wahrheiten kippen können. Manchmal schwingen sich da Beobachter in der Wiedergabe zu Tätern auf, dann wieder bezeugen sie eigene Untaten wie aus dritter Hand. Manchmal sind es bei Männern wie Musa offenkundige Prahlereien, die mir zu Ohren kommen, dann wieder Beschwichtigungen, stark herabgespielte Versionen tatsächlicher Gräuel, dazu angetan, ein mögliches Strafausmaß im Vorfeld zu lindern. Oder sei es, dass ihr Eigner sie in der Rückbeschau nicht anders zu ertragen wüsste.
Für mich spielt es keine Rolle. Denn weder bin ich Ankläger, noch Richter. Weder urteile ich darüber, was mir zugetragen wird, noch prüfe ich es auf seinen Wahrheitsgehalt, noch trage ich es weiter. Ich bewahre es bei mir. Und wenn ich es nun hier wiedergebe, so geschieht es in einer anonymisierter Form. Die Berichte sind allesamt echt. Die Menschen sind es auch. Wie auch die Bezüge zueinander. Nur nicht die Namen. Und doch stehen sie paradigmatisch für die vielen Gesichter von Radikalisierung und Terror, aber auch für die vielen Gesichter, die das Leben an Möglichkeiten zur Läuterung bereithält. Schweigen darüber, was jedem Einzelnen im Detail widerfahren ist, insbesondere aber, was er selbst anderen angetan hat – genau das ist meine Pflicht. Daher gebe ich die Geschichten dieser Menschen anonymisiert weiter – auch, damit wir, die Gesellschaft, etwas daraus lernen, unsere Schlüsse ziehen. Ich spreche die Sprache dieser jungen Gefangenen. Aber auch die Sprache ihrer Jugend, denn ich bin ähnlich jung wie die meisten von ihnen. Und ich bin Muslim wie sie. All das, in Summe, ist meine Eintrittskarte zu den Seelen von Menschen, die in aller Welt nichts als Angst und Schrecken verbreiten.
An diesem ersten Freitagmittag mit Musa stimmt etwas nicht. Und erst spät merke ich, dass ich es bin, der einigermaßen von der Rolle ist. Allzu kurz liegen die grauenvollen Attentate von Paris gerademal zurück. Die 130 Toten, ohne jede Gnade aus dem Leben gesprengt und niedergemetzelt auf dem Vorplatz des Stade de France, vor und in einigen Restaurants, insbesondere aber im Musikklub Bataclan am Boulevard Voltaire in der Stadt an der Seine, der irgendwann einmal jemand den Namen Stadt der Liebenden verpasst hat.
Es sind wie so oft die nichtig scheinenden Details, die allmählich an die Medien sickern und von dort zu den Menschen, um sich als schauderhafte Patina über die Seele zu legen, sich in ihr festzukrallen. Wie etwa, dass einer der Attentäter, ein vormaliger Busfahrer, inmitten des Schlachtens, inmitten der als Todesschwadronen losgesandten Maschinenpistolensalven die Bühne des Bataclan erreicht hat, um Xylophon zu spielen. Xylophon. Fast schon kind-haft-unschuldig anmutende Klänge wie zum Kontrast des unbegreiflichen Schreckens, Klänge, die das krasse Antlitz des Terrors nur noch stärker in die Erinnerung zementieren. Oder dass ein anderer Attentäter, den Sprengstoff an den Leib gegürtet, über dem Mantel eine Jacke mit Pelzbesatz und darüber eine Weste trägt und sich lächelnd bei den Gästen einer Brasserie entschuldigt, ehe er den Knopf drückt. Und wieder ein anderer, jetzt abermals im Bataclan, der gelegentlich am Laptop hantiert, während die Kollegen ihr Schlachten mit den Kalaschnikows ungerührt vollziehen. Bizarre Abfolgen von Linien und Zeichen seien auf dem Schirm zu sehen gewesen, sagt eine Zeugin später. Piktogramme einer Verschlüsselungssoftware, wie man bald weiß. Solche Dinge. Sie gehen nicht wieder weg, werden zu Sinnbildern sinnlosen Mordens.
Und so merke ich, während wir auf unsere Stühle sinken und Musa mich unsicher ansieht, dass ich ihn für einen kurzen Moment, unbewusst und auch ungewollt und auf eine rationell nicht nachvollziehbare Weise dafür, gerade dafür, was sich Stunden zuvor in Paris zugetragen hat, mit in die Pflicht nehme. Ob ich es nun will oder nicht, sagt eine Stimme in mir: Du bist einer von ihnen. Ob er nun in Paris mit von der blutrünstigen Partie war oder nicht. Ich besinne mich endlich.
»Rapid?«, frage ich. »Oder Austria Wien?« Der Klassiker zum Einstieg. Eisbrecher Fußball.
»Bayern«, sagt Musa.
»Ich auch«, erwidere ich, und alle beide lachen wir etwas spröde auf. Ausläufer eines Tattoos blitzen am linken Handgelenk auf, was es darstellt, bleibt Geheimnis seines Trägers und des langen Ärmels des schwarzen Kapuzensweaters, der die Abbildung verhüllt. Schon nach wenigen Minuten revidiere ich das Bild des farblosen Schwächlings, das ich bei der Begrüßung von ihm gefasst habe. Dieser Musa ist alles andere als gleichförmig. Alles andere als beliebig. Er scheint mir ein durchaus intelligenter Bursche zu sein. Wäre er in ein anderes Umfeld hineingeboren, überlege ich, wer weiß, vielleicht hätte er als Sohn eines Mittelschichtvaters eine ansprechende Karriere gemacht. Hätte womöglich studiert. Etwas mit Geisteswissenschaften, denn die Art, wie er sein eigenes Leben reflektiert, zu Fragen religiöser, aber auch allgemein philosophischer Natur Stellung bezieht, hebt sich von der seiner Mitbewohner entschieden ab.
Hat Musa nun vergewaltigt, gemordet? Hat er es »nur« bezeugt? Ich weiß es nicht, doch ich weiß, dass es mich nicht abhalten darf von dem, um dessentwillen ich herkommen bin. Junge Menschen wie er, achtzehn, vielleicht zwanzig Jahre, sind trotz ihres schon bewegten Lebens nicht unwiderruflich an ihre blutige Vergangenheit verloren. Der Kampf, sie zurückzuführen ans Licht, muss bis zuletzt gefochten werden. Lebenslanges Wegsperren ist in den meisten Fällen nicht möglich und auch nicht sinnvoll, wie ich anhand zahlreicher Beispiele noch darlegen werde. Dennoch wird einer wie Musa in absehbarer Zeit wieder in Freiheit sein. Die Möglichkeiten von Polizei und Staatsschutz, ihn und Seinesgleichen rund um die Uhr zu überwachen, sind endend wollend, und die Ängste der Bevölkerung allseits greifbar. Und diese als Radikale aktenkundigen Menschen sind auch überaus ernstzunehmen, wie wir noch sehen werden.
Viel Arbeit ist im Vorfeld einer Entlassung aus der Haft nötig, und im weiteren Kontext auch viel Vorwissen: Wie etwa, dass rund zwei Drittel jener, die als Extremisten Eingang in die Karteien gefunden haben, zwischen fünfzehn und fünfundzwanzig Jahre jung sind. Und dass die allergrößte Anfälligkeit zur Radikalisierung sich nicht zufällig in den Jahren rund um die Pubertät zeigt – jene Umbruchphase, die mit Beendigung der rein körperlichen Wandlung bei weitem nicht abgeschlossen ist. Oftmals hält sie noch jahrelang an, kann auch erst sehr verspätet einsetzen. Auch der renommierte französische Psychoanalytiker, Professor an der Universität Paris-Diderot Fethi Benslama, nimmt darauf in seinen Studien Bezug, legt alarmierende Zahlen für sein Heimatland vor, die über weite Strecken eins zu eins auf Resteuropa umzulegen sind. Er spricht von Adoleszenten oder jungen Erwachsenen, die sich in der Phase eines Moratoriums befinden, in dem die Adoleszenz möglicherweise ausgedehnt und die Krise verlängert wird.
Von größter Bedeutung ist an dieser Stelle aber auch etwas anderes, das ich für alle Beispiele vorausschicken möchte, die Ihnen in diesem Buch noch begegnen werden: Natürlich sind die jungen Menschen, oftmals Heimkehrer von Kriegsschauplätzen, traumatisiert und auf eine gewisse Weise Opfer.
Doch in jedem Fall sind jene, die sich tatsächlich aufmachen, die tatsächlich den Bau einer Bombe oder was immer in Angriff nehmen, immer auch Täter, die – Jugend hin, Blendkraft her – sich niemals aus ihrer Verantwortung stehlen können. Musa steht da mit seinen 20 Jahren gewissermaßen im Zenit dieses Altershorizonts einer ausgeprägten Gefährdung in punkto Radikalisierung.
Heranwachsende müssen sich erst selbst in Grundzügen kennenlernen, ihren Platz im Leben definieren und einnehmen, getrieben von Hormonen, Emotionen, dem Drang, alles infrage zu stellen, dem flammenden Bedürfnis, Neues zu definieren, und vor allem sind sie auf der Suche nach Idealen, für die zu leben es sich lohnt. Oft genug haben junge Radikale in ihrer Kindheit, Jugend einen Mangel an Vorbildern erlebt, es fehlt ihnen an Vätern, an denen sie sich erst aufrichten und später, auf der Jagd nach einer eigenen Identität, reiben können. Ein Aspekt allemal, der bisher vielleicht im Stillen beobachtet, doch kaum beachtet worden ist. Jugendliche werden bei ihrer Suche bisweilen auf sich selbst zurückgeworfen, auf die Ursprünge ihrer Existenz, und wenn sie an ihren Ausgangspunkt zurückkehren, zu Fragen des Seins und Sinns – wenn sie wissen wollen, was das Leben von ihnen will, ja, dann ist es gerade bei schwachen, wankelmütigen Charakteren für gewiefte Hassprediger ein Leichtes, sie genau dort abzuholen und auf die komplexesten Fragen die scheinbar simpelsten Antworten zu bieten. Labilen Seelen Struktur und Halt zu geben, ist eine Kernkompetenz von Religion, bloß dass hier der Missbrauch in der Maskerade des Bösen in Erscheinung tritt. Diesen Verführern ist es eine spielerische Selbstverständlichkeit, verirrte Menschen einzufangen wie der Rattenfänger die Kinder von Hameln. Der zu entrichtende Preis ist zum einen für die Gesellschaft, und zum andern für die Betroffenen selbst unbeschreiblich hoch. Sie verlieren ihre Jugend ohne den Zugewinn eines Erwachsenenlebens, das lohnt.
Erst vor zwei Jahren (!) hat man auf der verzweifelten Suche nach Ursachen und Gegenstrategien zur Radikalisierung begonnen, die in dem Zusammenhang bis dahin schon traditionellen Disziplinen, allen voran die Soziologie, auf wissenschaftlicher Ebene zu ergänzen. Es sind tiefgreifende, dringliche Aspekte, die man erst nach und nach zu beleuchten beginnt. Die systematische Zusammenführung herkömmlichen Wissens mit der Psychiatrie, der Psychologie und Psychoanalyse steht also erst am Anfang, während der Terror, sechzehn Jahre nach 9/11, auch in Europa längst eisenharte Wurzeln geschlagen hat. Natürlich sind soziokulturelle Bedingungen, Armut, Mangel an Bildung und gesellschaftliche Ausgrenzung wichtige Faktoren, die den Abfall eines Jugendlichen zum Extremismus begünstigen – doch sie sind bei weitem nicht die einzigen (dazu aber an anderer Stelle noch mehr).
*
Seit sieben Jahren bin ich nunmehr Imam hinter Gittern, sprich: Seelsorger für muslimische Häftlinge, und seit einiger Zeit auch der Leiter der Gefängnisseelsorge für ganz Österreich. Imam zu sein heißt, durchaus ähnliche Aufgaben und Funktionen zu übernehmen wie ein christlicher Pfarrer, sieht man von Beichte und Ölsalbung ab. Auch Imame sind religiöse Leiter und Respektspersonen einer kleineren oder größeren Gemeinde. Sie sind Vorbeter und Prediger bei den Freitagsgebeten. Und natürlich zu den beiden großen Festen des Islam – dem Fest des Fastenbrechens am Ende des Fastenmonats Ramadan und dem Opferfest, das etwa siebzig Tage danach in Erinnerung an die Bereitschaft des Propheten Abraham begangen wird, seinen Sohn zu opfern.
Nur zwei weitere Justizanstalten (Salzburg und Stein) verfügen neben der Josefstadt über eine eigene Moschee. Die in Wien ist die kleinste, somit auch die kleinste Österreichs und im Untergeschoss des Gefangenentraktes angesiedelt. Linkerhand der dunkelgrünen Stahltür, überfrachtet von silbrigen Heizungsrohren, die querüber an der niederen Kellerdecke verlaufen und einigermaßen Lärm absondern, sodass eine Predigt bei offener Tür kaum möglich ist, stehen schlichte, weiße Regale, die die Hausschuhe der Betenden aufnehmen. Darüber ein von Häftlingen gemaltes Bild in frohen, bunten Farben. Es stellt eine Moschee dar, umkränzt von flammender Sonne und Himmel in harmonischem Farbverlauf. Darüber, als wäre es für jene gedacht, die es nicht glauben wollen, steht in fetten Lettern das Wort: MOSCHEE. Und, wie zur Unterstreichung dieses sehr speziellen Ortes, liegt ein allgegenwärtiger Moder in der Luft, der typische Kombinationsgeruch von Keller, altem Haus und Heizung. Ein Mahnmal der Vergänglichkeit.
Der eigenen, mehr aber noch zum Zeichen der Baufälligkeit, unter der die JA Josefstadt seit Langem leidet. Zur Rechten des Zugangs eine weiße Wand mit schwarzer Kalligraphie. Es sind arabische, mit Pinsel aufgetragene Schriftzeichen, die ersten drei Verse der 23. Sure im Koran: Wahrlich erfolgreich sind die Muslime, die in ihren Gebeten voller Demut sind und sich von allem Sinnlosen fernhalten.
Der Gebetsraum selbst ist maximal schlicht und ohne jene Art von Aura, wie man sie aus den großen Moscheen dieser Welt kennt, beispielsweise in Mekka, Medina oder Jerusalem. Aber auch aus der Hagia Sophia in Istanbul oder der Mezquita im südspanischen Córdoba, die eine Sonderstellung einnimmt, weil dort eine christliche Kathedrale auf einer vormals islamischen Moschee gebaut wurde und alle beide Gotteshäuser – auf beeindruckende Weise ineinander verschmolzen – die Kriege und Jahrhunderte mit all ihren Kriegen und Auseinandersetzungen wie auch menschlichen Animositäten überdauert haben.
Hier jedoch, im Keller des Gefangenenhauses in der Josefstadt, ist funktionaler Minimalismus angesagt. Auf die Installation eines minbar, der für Moscheen typischen Kanzel, von wo aus der Imam üblicherweise die Predigt hält, habe ich aus akuter Platznot verzichtet. Der Boden ist bedeckt von einer Handvoll billiger Teppiche, an der einen Seite sickert trübes Licht aus einem schmalen Fensterschacht hinab. Zuvorderst abermals die farbenfrohe, gleichfalls von Gefangenen und mit viel Engagement und Leidenschaft an die Wand geworfene Darstellung einer Moschee. Über der Kuppel mit golden funkelndem Halbmond ein pyramidenförmiger Wolkenhimmel, darüber eine breite, bis unter die Decke reichende Fläche in mattem Sonnengelb. Zu Beginn jener Schriftzug, jene Bekundung von Gottergebenheit, die von Extremisten aufs Schändlichste missbraucht wird und somit in Augen und Ohren der Gesellschaft zum Schlachtruf religiös motivierten Mordens verkommen ist: Allahu akbar. Gott ist der Allergrößte. Zur Rechten der Moschee abermals arabische Schriftzeichen, in Rotbraun diesmal. Vier Botschaften in vier Zeilen empfangen die Gläubigen:
Zuallererst die basmala, die Anrufungsformel, die mit einer einzigen Ausnahme alle Suren im Koran einleitet: Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Allbarmherzigen.
Darunter Sure 4, Vers 103, aus dem Koran (4:103): Das Gebet ist eine Pflicht für jeden Muslim, die zu bestimmten Zeiten zu verrichten ist.
Dritte Zeile, Sure Ihlas (112:1-4): Gott ist Einer, ihm ebenbürtig ist keiner. Gott ist der Absolute (der ewige Unabhängige, von dem alles abhängt). Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden.
Vierte Zeile (16:44): Wir haben den Koran hinabgesandt, damit sie nachdenken (eine Sure, die meines Erachtens keinem einzigen IS-ler in ihrer Bedeutung eingängig oder wenigstens bekannt sein dürfte).
Die Fluktuation meiner Gemeinde ist naturgemäß groß, was im Wesen der JA Josefstadt begründet liegt. Potentiell sind es 350 Muslime. So viele muslimische Insassen zählt die Josefstadt bei Drucklegung dieses Textes, Ende Oktober 2017. Wer immer in Wien einer Straftat angeklagt wird, landet fürs Erste hier. Untersuchungshaft. Jene, die bloß kurze Strafen verbüßen, sind bald wieder weg. Jene, die besonders lange verbüßen – mehr als eineinhalb Jahre unbedingt – desgleichen, denn sie werden in andere Gefängnisse überstellt, wo sie den überwiegenden Teil ihrer Zeit hinter Gittern absitzen. Den einen oder anderen sehe ich wieder, wenn ich gleichsam auf Österreich-Rundfahrt gehe, soll heißen, meiner Aufgabe als Leiter der Gefangenen-Seelsorge im ganzen Land nachkomme. Die Josefstadt ist also gewissermaßen ein Zwischenlandeplatz für Gestrandete, und so entsteht meine rasch wechselnde Gemeinde größtenteils aus solchen, die auf ihren Prozess warten, oder solchen, die nach dem Urteilsspruch bald wieder wegdürfen.
Natürlich kommen und wollen nicht alle zum Gebet, doch der Andrang ist im Allgemeinen enorm. Ganz besonders zu den wichtigen islamischen Feiertagen. Viele muss ich dann abweisen, denn mehr als fünfunddreißig Gefangene dürfen am gemeinsamen Gebet aus Sicherheitsgründen nicht teilnehmen. Beim traditionellen Freitagsgebet (vergleichbar mit dem Sonntagsgottesdienst der Christen) habe ich eineinhalb Stunden Zeit für die Häftlinge. Vor dem Gebet folgt die khutba, die Predigt also, nach dem Gebet dann eine ausführliche Frage-Antwort-Runde. Für gewöhnlich öffnen sich die jungen Leute sehr rasch, denn sie wissen, dass hier keine Überwachung in Bild und Ton stattfindet (bloß eine Kamera ohne Mikrofon, die auch nicht aufzeichnet, bloß live mitfilmt, gedacht allein dafür, dass Wachpersonal im Notfall eines allfälligen Tumults während der Gebetsstunde einschreiten kann). Und sie wissen ferner, dass ich an meine Schweigepflicht gebunden bin. Sie vertrauen mir als einem der Ihren.
Neben Fragen eher allgemeiner, oftmals die Haftumstände umreißender Natur – »Ich möchte einen anderen Zellengenossen, Imam, können Sie mir helfen?« / »Warum gibt es kein Halal-Fleisch?« / »Könnten Sie meine Familie kontaktieren und sagen, dass es mir gutgeht?« / »Kann ich einen Gebetsteppich bekommen? Einen Koran in deutscher Sprache? Eine Gebetskette?« / »Ich habe noch nie gebetet, Imam, können Sie es mir zeigen?« / »Wie mache ich die rituelle Waschung vor dem Gebet?« / »Können Sie uns eine Kochplatte verschaffen, damit wir im Ramadan abends warmes Essen haben?« et cetera –, neben alledem also gibt es auch Themen, die den Insassen unter den Nägeln brennen, doch so persönlich sind, dass sie damit erst danach zu mir kommen.
Die Zettel mit Ansuchen für ein Vier-Augen-Gespräch türmen sich auf meinem Schreibtisch, den man mir dankenswerterweise von christlichen Seersorgern in der JA zur Verfügung gestellt hat, und ein Ende des Engpasses ist nicht in Sicht. Viele hunderte junge Muslime sind es mittlerweile, denen ich gleichsam in die Seele geblickt habe – und natürlich steigert die jahrelange Erfahrung die Effizienz der Betreuung entscheidend. Was ich vorfinde, folgt im Großen und Ganzen den immer gleichen Mustern, und so habe ich auch bereits ein Feingefühl dafür entwickelt, wem ich wie begegnen muss, um ihm zu bieten, wonach ihn dürstet: spiritueller Beistand durch einen Mentor, den er allein kraft seines Amtes respektiert, dem er vertrauen kann und der nichts will, außer Halt und Orientierung zu geben in einer ausnehmend diffizilen Lebenssituation. Egal, wie bedrückend und selbstverschuldet sie sein mag.
Nicht alle Mitglieder meiner ungewöhnlichen Gemeinde sind das, was man landläufig radikal nennt. Einige allerdings sind in hohem Maße gewaltbereit, gelten als brandgefährlich und stellen dies auch gelegentlich hinter den dicken, ansonsten verschwiegenen Mauern der JA unter Beweis. Sie alle subsumiert man unter dem Begriff »Islamisten« – eine Definition, die ich im täglichen Gebrauch aus meiner leidvollen Erfahrung des ständigen Vermengens von Islam und Islamismus ablehne (ich spreche also üblicherweise nicht von Islamisten, sondern von radikalen, oder gewaltbereiten Muslimen oder schlicht von Extremisten), eine Definition aber auch, mit der ich prinzipiell könnte, würfe sie nicht eine solche Vielzahl eklatanter Missverständnisse und Vorurteile auf, weil die Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus im Volksmund und in den Massenmedien oftmals keine ist. Jedes neuerliche Attentat, jede neue, zutiefst verachtungswürdige und durch nichts zu entschuldigende Bluttat unter dem Segel des Schlachtschiffs Islamismus – vorgeblich begangen im »Namen des Islam« – treibt einen zusätzlichen Keil in unsere längst multikulturelle Gesellschaft, reißt die Gräben nur noch weiter auf.
Gerade hier, bei der strikten Trennung von Islam und Islamismus, ist es besonders wichtig, den verstellten Blick freizuschaufeln, einen neuen, anderen Blick zu werfen, hinein in die Tiefe der Thematik, der natürlich auch ein Blick in die Geschichte dieses so genannten Islamismus ist. Das hat mit jahrhundertelanger, systematischer Ausbeuterei durch Kolonialstaaten ebenso zu tun wie mit archaischen Mustern und Rollenbildern so manch muslimisch geprägter Länder, was beispielsweise Erziehung und Status der Frau betrifft. Extremisten verstehen es auf oftmals beklemmend brillante Weise, sich diesen massiven Wandel der Gesellschaft in der jüngeren Weltgeschichte zunutze zu machen, indem sie die Veränderungen als Verlust eines religiösen Erbes beklagen – und mit aller Gewalt den Erhalt dieses Erbes vorantreiben, das in Wahrheit nichts anderes ist als ein Mix längst überkommener Traditionen und Kulturen. Die Religion wird als Mittel gegen den Zerfall nur vorgeschoben und damit aufs Schändlichste instrumentalisiert.
Und diese Geschichte des so genannten Islamismus (das macht sie mitunter zu einem zutiefst innerislamischen Problem) ist auch eng verknüpft mit der Geschichte der Versklavung der Frau, der Stigmatisierung alles Weiblichen schlechthin.Überspitzt könnte man es als Selbstbefruchtung bezeichnen, eine Art ungewollter Schwangerschaft, die die Geburt einer nur noch schwer zu bändigen Bestie gezeitigt hat. Dennoch ist der Islam – dies an dieser Stelle vorausgeschickt, weil es gar nicht oft genug betont werden kann – zu keiner Zeit eine frauenfeindliche Religion gewesen, und er ist es auch heute nicht.
Ich erkläre das meinen Häftlingen bei jeder Gelegenheit in einfachen, eingängigen Worten, wieder und wieder – zitiere gebetsmühlenartig Stellen aus dem Koran, die explizit auf Stellung und Bedeutung der Frau im Islam gemünzt sind, weil ich sehe, dass viele junge Männer, geprägt durch Elternhaus und Verwandtschaft in den Herkunftsländern, oftmals mit genau diesen alten Modellen aufwachsen. Schon zu Zeiten des Propheten Muhammad haben die Frauen in der islamischen Gesellschaft eine bedeutende Rolle gespielt. Und so haben wir es bei dem Phänomen Islamismus in erster Linie mit überkommenen Leitbildern zu tun, mit archaischen, vom Patriarchat geprägten Wertvorstellungen, die ins Kleid von Kultur und Tradition schlüpfen und dabei vorgeben, unabwendbarer Bestandteil der Religion zu sein. Damit wird ein grundfalsches Verständnis von dem vermittelt, was tatsächlich den Islam ausmacht, was tatsächlich im Koran festgeschrieben steht, was tatsächlich also der unverbrüchliche Wille Allahs ist.
Und noch etwas gehört hierher, weil untrennbar verbunden mit dem Phänomen Extremismus und dem politisch motivierten Missbrauch des Islam (in den Medien immer politischer Islam genannt) – es ist dies der Begriff der Heuchelei.
Seine Ursprünge reichen wiederum bis zu Napoleon und seinem Ägyptenfeldzug (1798) zurück, und seine Wirkmächtigkeit ist heute ausgeprägter denn je. Schon damals, in Berichten des reisenden Chronisten Henry Laurens beispielsweise, taucht immer wieder das Wort Heuchelei auf, wie auch der bereits erwähnte Psychoanalytiker Fethi Benslama aufzeigt. Der Begriff fußt auf dem arabischen munafiq, was ursprünglich jene beschrieben hat, die ihre Ungläubigkeit zu verschleiern versuchen, indem sie sich als Muslime ausgeben. Mehrfache missbräuchliche Umdeutung bzw. Verstärkung über die Jahrhunderte hat den Begriff im Bewusstsein heutiger Radikaler als das Übelste vom Üblen einzementiert. Er wird über all jene Glaubensbrüder gegossen, die sich – völlig zu Recht, wie ich meine – einer Politisierung ihrer friedfertigen Religion Islam verweigern, die Bestrebungen der Radikalen unterwandern und sich somit zu Todfeinden machen. Diese Heuchler stellen sich auf die falsche Seite, stehen in den Augen der Extremisten auf dem Podest des Verachtungswürdigen noch über den Ungläubigen.
Wie tief der Begriff Islamismus in den Köpfen vieler Menschen als Synonym für Islam Wurzeln geschlagen hat, zeigt auch folgendes, ausgenommen krasses Beispiel aus meinem eigenen Umfeld. Hätte ich es nicht selbst vom Betroffenen (im Nachhinein kleinmütig) bestätigt bekommen, bekäme ich es also bloß erzählt, ich würde es als launige, doch jeden Funken Wahrheit entbehrende Maskerade abtun.
Doch gerade dieses Beispiel zeigt eindringlich, was im Sprachgebrauch schieflaufen kann: Ein Kollege aus meinem ehemaligen Brotberuf islamischer Religionslehrer an einer Wiener Schule gerät eines Tages in Konflikt mit dem Vater eines Schülers. Anlass ist ein Missverständnis bei einer Gruppenarbeit, die als Aushang auf dem Schulgang gelandet ist und den Vater des Buben angesichts arabischer Schriftzeichen (im Unwissen, was die Schrift bedeutet) dazu anhält, heftig mit dem Lehrer zu diskutieren. Ein Wort ergibt das andere, eine Beschwerde bei der Direktorin folgt. Sie nimmt meinen Kollegen beiseite, fragt ihn eindringlich, ob es denn stimme, was der Vater behaupte, dass er nämlich zugegeben habe, ein Islamist zu sein.
»Natürlich bin ich Islamist«, ruft der Lehrer mit einiger Dynamik und auch Ernsthaftigkeit. »IslamIST. So wie ChrIST. Oder BuddhIST.«
Erst die Widerworte der Direktorin, welch fatale Wirkung Begriffe wie Islamist und Islamismus in unserer Gesellschaft zeitigen, bringt Aufklärung. Der Lehrer ist zutiefst bestürzt, auf welche – grundfalsche – Seite er sich (aus einigermaßen beschämendem Unwissen heraus) gestellt hat.
Apropos richtige oder falsche Seite: Richtig und Falsch sind Kategorien der Moral. Ich versuche in meinen Predigten und auch Einzelgesprächen, diese Moral von Anbeginn nicht wie einen unüberwindbaren Schild vor mir herzutragen.
Die Erfahrung lehrt mich, dass gerade das Antreten unter dem Panzer der Gerechtigkeit dazu führt, dass die allermeisten Gefangenen zwar wohlwollend nicken, doch augenblicklich zumachen. Sie machen zu, verpuppen sich zur Larve, die wider die Abläufe der Natur beschlossen hat, das Schlüpfen bleibenzulassen. Womit sich – mit dem Bild der Larve – der Bogen wieder auf den Tschetschenen Musa senkt.
Als Musa erstmals beim Freitagsgebet auftaucht, sticht er mir sofort ins Auge. Der Blick in eine Schar von fünfunddreißig Augenpaaren ist immer auch der Blick in die Gesichter der Proponenten gegenläufiger Strömungen und Ansichten. Da gibt es jene, die mit ehrlichem Eifer und angespannter Aufmerksamkeit bei der Sache sind, die ihrem Prediger jedes Wort von den Lippen ablesen und auch später in den Diskussionen viel preisgeben. Dann gibt es die Wankenden, die Unsicheren, die schon während der Predigt, scheint’s, ihren inneren Kampf ausfechten, wieder und wieder die Stirn in Falten legen, schließlich aber nicht den Mut aufbringen, sich in der anschließenden Gesprächsrunde mit Fragen oder Kommentaren einzubringen. Vertreter der Gruppe der Gleichgültigen gibt es so gut wie nie, denn sie haben kein Interesse, ihren gläubigen Brüdern einen Platz zu versitzen. Und dann, am anderen Ende der Skala, finden sich jene, die dir als Prediger von Anbeginn signalisieren, wie klein und mickrig, welch ein Nichts du in ihren Augen bist. Die ihre Mundwinkel verächtlich herabziehen, Körpersignale purer Ablehnung aussenden, wie Gurus Grüppchen Gleichgesinnter um sich scharen und nicht selten die Predigt durch provokante Zwischenrufe stören.
Musa erscheint mir als Vertreter des Typus Wankelmut, Tendenz Larve. Ich nehme ihn als neues Mitglied meiner Gemeinde zwischendurch vermehrt in Augenschein, und ich sehe, er folgt meinen Ausführungen mit einigem Interesse. Selbst zu Wort meldet er sich aber nicht. Erst nach der Frage-Antwort-Runde fasst er sich ein Herz, tritt in einem unbeobachteten Moment dicht an mich heran. »Imam, darf ich zu Ihnen kommen«, haucht er mir ins Ohr. »Jetzt?«
Ich muster ihn kurz, lehne dann höflich, aber bestimmt ab. Ich hätte ein anderes, längst vereinbartes Treffen mit einem Gefangenen, der gleich dort drüben stehe und warte.
»Es ist dringend, Imam. Wirklich dringend!«
Musa blickt beschämt zu Boden. Er ist aufgewühlt, nestelt am Bündchen seines Kapuzensweaters, dann gleiten seine Hände fahrig an den Hosennähten auf und ab. Ich überlege nicht lange, nehme den wartenden Häftling beiseite und bitte ihn um Verständnis. Ein Notfall. Wenig später treffe ich Musa im Besprechungsraum im vierten Stock wieder.
Ein andermal, Musa und ich sind schon so etwas wie alte Bekannte, sitzt er anfangs nur mit hängenden Schultern da. Beklemmendes Schweigen legt sich über uns wie eine Decke aus schwerem Brokat. »Sie sind doch Imam«, sagt er endlich.
Irritiert blicke ich ihn an. »Natürlich, das weißt du doch.«
»Sie wissen also, was richtig und ist und was nicht. Sie wissen, was Allah will.«
Zweifel keimen in mir auf. Eine Zeitlang habe ich wohl gedacht, Musa gehörte zu jenen, die dem Bösen bereits abgeschworen haben oder wenigstens auf bestem Wege dorthin sind. Doch nun hat es den Anschein, als sei der innere Kampf des jungen Mannes noch lange nicht ausgefochten, als erleide er gerade einen massiven Rückfall.
»Sie haben heute in der Predigt viel über den IS gesprochen.«
Tatsächlich ist der Islamische Staat Hauptthema meiner Predigt gewesen. Aus wie so oft aktuellem Anlass. Ich habe davon gesprochen, wie grauenvoll Angriffskriege etwa im Nahen Osten oder auch Terroranschläge im Herzen Europas seien, wie sehr sie dem Willen Allahs entgegenstünden und wie perfide Zitate aus dem Koran immer wieder hergenommen würden, um genau das zu rechtfertigen.
»Ja, Musa«, sage ich. »Du hast meine Worte bestimmt noch im Ohr. Auch das Versklaven von Frauen widerspricht den Botschaften Allahs im Koran. Und das Töten anderer Menschen ebenso.«
»Ich bin jetzt seit drei Monaten hier«, sagt Musa. »Die ganze Zeit in der Haft denke ich darüber nach, ob ich falsche Dinge getan habe. Wahrscheinlich habe ich das. Aber dann wieder denke ich …« Er verhält, sieht mich unsicher an.
Der Eindruck von Intelligenz und Einsicht, den Musa mir zuletzt vermittelt hat, scheint in diesem Augenblick wie weggewaschen, fortgespült unter den Ausläufern einer Masse von aufrührerischen Worten, mit denen einer oder mehrere Hassprediger ihm seinerzeit die Seele geflutet haben.
Der radikale Same aus Hass und Niedertracht wurzelt enorm tief, sodass er immer wieder aufkeimt. Und doch erkenne ich erste Anzeichen einer Reue, wiewohl auf noch sehr wackeligen Beinen stehend und permanent unterlaufen von Zweifeln – nicht zuletzt auch neu entfacht von radikalen Mitgefangenen, denen der allmähliche Sinneswandel ihres Mitbruders nicht zu entgehen scheint.
Doch Musa vertraut mir. Und so gibt er auch nach und nach preis, was sein früheres Leben ausgemacht, was diesen radikalen Wandel in ihm entfacht hat. Puzzlestein um Puzzlestein fällt Musas Weg – dieser durch und durch klassische Weg – zum Extremisten vor mir zu einem abgerundeten Bild zusammen.
Musas Eltern sind in den Neunzigern aus Tschetschenien geflohen. Er wie auch seine Schwestern Hatija und Aisha wachsen bereits in Wien auf. Es ist eine Geburt in die Unterschicht. Eine Geburt in die Unterprivilegiertheit. Ein Katapultstart in Armut und gesellschaftliche Ausgrenzung. Der Vater, Fabriksarbeiter, verlässt die Familie kurz nach der Niederkunft seiner Frau mit der jüngsten Tochter. Musa hat ihn nie mehr wiedergesehen, weiß auch nicht, wo er sich seither aufhält.
Musas Verhältnis zur Mutter ist seit jeher innig. Sie zieht die Kinder alleine groß, sorgt für den kümmerlichen Unterhalt. Tagsüber jobbt sie bei einer Reinigungsfirma, abends und wochenends putzt sie in Privathaushalten. »Mama war oft nicht da«, sagt Musa. »Sie arbeitete ununterbrochen, hatte meist Rückenschmerzen.«
Als die Schwestern noch klein sind, passt er oft in der engen Zwei-Zimmer-Wohnung auf sie auf. Sie leben draußen in einer Wiener Siedlung am südlichen Stadtrand Wiens, einer jener immer häufiger anzutreffenden, zum Minighetto mutierenden Gegenden, wo die Kaufkraft der Menschen weitflächig und dramatisch ins Bodenlose sinkt. Aus unterschiedlichsten Gründen. Arbeitslosigkeit. Kriminalität. Oftmals eine Mischung aus beidem.
Die Schule schmeißt Musa bald hin. Er hat nicht mal einen Hauptschulabschluss. »Ich war nicht gerne dort«, rechtfertigt er sich. Er habe keine richtigen Freunde gehabt in der Schule, man habe ihn nicht gemocht. Freunde gewinnt er dafür rasch anderswo. Im Park, unweit der Wohnung. Mit ihnen verbringt er zunehmend Zeit. Man trifft sich. Bald regelmäßig. Bald jeden Tag. Oft kommt Musa überhaupt nur noch zum Schlafen nachhause. Abhängen im Park ist angesagt. »Wir haben nichts Schlechts getan«, sagt Musa. Nein. Damals noch nicht.
Die Zugehörigkeit zur Gruppe verleiht dem gestutzten Selbstwertgefühl der Burschen neue Flügel. Zusammen fühlt man sich stark. Zusammen fühlt man sich sicher. Irgendwann geht der neue Stolz soweit, dass man auch nach außen hin proklamiert: »Hey, Mann, wir sind keine Österreicher. Wir sind Ausländer.« Das grenzt ab. Und gibt ein Empfinden von Stärke.
Den meisten von Musas Freunden ist es wie ihm ergangen. Kein Schulabschluss. Keine Lehrstelle. Keine Perspektive. Warum sie keinen Job gefunden haben? »Weil wir Muslime sind«, sagen sie sich, sagen sie jedem, der es hören will oder auch nicht. Man wolle nicht, dass sie hier etwas erreichen. Putzen. Drecksarbeit verrichten, sagen sie. Das ja. Mehr nicht. Niemand akzeptiere, niemand brauche sie. Sie wissen nicht, noch nicht, dass das so nicht stimmt. Dass sie längst bei Menschen mit ganz eigenen Interessen auf dem Schirm stehen.
Als zwei neue Burschen sich der Gruppe im Park zugesellen, nehmen Musa und die Gang sie rasch auf. Mehmet und Ismael heißen sie. Sie erzählen vom Sinn des Lebens. Von Gerechtigkeit. Und sehr bald erzählen sie auch von Allah. Musa hat mit Allah bis dahin nicht allzu viel am Hut. Er ist als Muslim das, was man bei Katholischen oder Evangelischen einen Taufscheinchristen nennt. Der Glaube hat in Musas Familie bis dahin keine tragende Rolle gespielt. Doch was Mehmet und Ismael zum Besten geben, hat Charme, hat verführerische Kräfte und zieht nicht bloß Musa rasch in den Bann. Erst zaudert er noch, als sie ihm den Gang zu einem coolen Prediger ans Herz legen. Es sei ganz in der Nähe. Ein winziger Raum in einem Hinterhof. Musa hat ein flaues Gefühl im Magen. Man hört so einiges von dieser Art von Predigern. Man hört auch, sie würden die Welten junger Menschen auf eine Weise verändern, die nicht immer die beste ist.
Doch dann schließen sich zwei seiner Freunde Mehmet und Ismael an. Sie kehren wieder mit ungeteilter Begeisterung, erzählen, wie klug, wie belesen, wie beredt, wie freundlich und gütig der Prediger sei.
Das überzeugt Musa letztlich. Wie auch die anderen aus der Gang. Musa wäre also der Einzige gewesen, der nicht mitgeht. Er weiß, er ist womöglich der Klügste unter ihnen. Doch er ist mitnichten der Stärkste. Und auch nicht der Charismatischste. Er ist einer, der eben mitgeht. Mitläuft. Der sich nicht gerne selbst ausgrenzt. Und so folgt er dem Beispiel, dem Druck der Gruppe.
Tatsächlich hat dieser Prediger etwas, das Musa elektrisiert. Er strahlt nichts Düsteres aus. Er verbreitet Zuversicht. Und Gewissheit. Eine Gewissheit, die Vertrauen begründet, die ihn unausgesprochen zu einer starken Persönlichkeit erhebt, einem Führer, ohne dass er hätte darauf pochen müssen. »Er war wie mein großer Bruder, den ich nie hatte«, sagt Musa. Weise. Stark. Unwiderstehlich.
Der Prediger ist aber nicht bloß großer Bruder. Er ist bedeutend mehr als das. Er ist auch Freund. Man trifft sich zum Paintball-Spielen. Man verabredet sich in einem Internet-Café, teilt den gemeinsamen Nervenkitzel bei Counter Strike, einem Egoshooter-Klassiker. Auch, insbesondere an schönen Tagen draußen im Park, lehrt er sie sein Wissen über Kampfsporttechniken. Und zwischendurch werden Allerweltspläne geschmiedet, wird gescherzt. Geplaudert. Über dies und das. Und über Allah. Später dann, in seinen Predigten, geht es schärfer, bedeutend konkreter zur Sache. Man hört von den Ungläubigen. Davon, dass sie nichts als den Tod verdienen. Davon, dass der Islamische Staat der richtige Weg, der einzig richtige Weg dorthin sei. Der Aufbau des IS sei in vollem Gange. Doch es brauche noch mehr Kämpfer. Unerschrockene, von Leben und Gesellschaft Benachteiligte wie sie alle.
Es ist dies ein durch und durch typischer Weg der schleichenden Radikalisierung, den Musa und seine Freunde da durchlaufen. Fast schon klischeehaft. Ein Klassiker, der in unzähligen Nuancen auftritt, letztlich aber, die immer selbe Maske des Bösen zeigt.
Bald schon ist Musa und seinen Freunden klar: Die Zeit des sinnbefreiten Abhängens ist vorüber. Ihr Leben muss endlich (wieder) einen Sinn bekommen. Man hat sie auserwählt.
Man gibt ihnen die einmalige Chance, sich nicht bloß als Rädchen mitzudrehen im knirschenden Weltgefüge, sondern selbst einzugreifen, selbst etwas mitzubestimmen, eine Aufgabe zu erfüllen. Eine Mission. Eine göttliche Mission. Man stellt ihnen ein Ideal vor Augen, das ausreichend groß ist, dass sie sich fügen und dahinter zurücktreten, als Einzelner, dass sie sich zum Teil einer Gemeinschaft machen, um letztlich darin zu verschmelzen.
Ja, sagen sie eines Tages. Sie wollen das jetzt auch. Der Prediger findet lobende Worte für sie. Dann wieder mahnt er sie, nicht vom gerade erst eingeschlagenen Pfad abzufallen. Höllenszenarien werden beschworen für jene, die es im letzten Moment doch tun, die Schwäche zeigen. Himmlische Fanfaren ausgebracht für jene, die sich unerschütterlich zeigen. Wechselbäder der Gefühle ergießen sich über sie. Doch Musa und seine Freunde bleiben standhaft. Jetzt erst recht.
Abermals lobt sie der Prediger. Und er zeigt sich auch auf andere Weise erkenntlich. Er organisiert ihnen ein Auto. Geld fürs Benzin. Es reicht weit. Unbehelligt erreichen sie die türkische Grenze zu Syrien. Hier nimmt alles seien Lauf. IS-Schergen nehmen den fleischlichen Nachschub in Empfang. Man gibt ihnen Waffen und klare Befehle. Tag eins von acht langen Monaten. Verabschiedung von der Familie hat es keine gegeben. Nur ein stilles Davonschleichen.
Irgendwann einmal, Wochen später, die eine oder andere Botschaft in die ehemalige Heimat. Damals denkt er nicht im Traum daran, er könnte sich eines Tages abermals klammheimlich aus seinem Leben davonstehlen.
Jetzt, hinter Gittern, will Musa Verantwortung übernehmen. Für seine Mutter. Für die Schwestern. »Ich habe sie im Stich gelassen, möchte für sie da sein. Was bin ich bloß für ein Mensch?« Sie denken bestimmt, hier im Gefängnis sei es ähnlich verheerend wie in einem Gefängnis in Tschetschenien. Ob ich vermittelnd einspringen könne? Zugleich beklagt er auch, dass es kein Halal-Fleisch gebe.
»Die Juden kriegen ihr koscheres Essen. Warum nicht auch wir?«
Musa fühlt sich als Opfer. Beim Thema halal kann ich ihm nicht helfen. Dafür gelingt es mir, ihn aus der Isolation der Einzelhaft zu holen, zu bewirken, dass er in eine Zwei-Mann-Zelle kommt. Musa erträgt die Einsamkeit nicht. Ein aus der Außensicht womöglich nichtiger Teilerfolg, doch er festigt Musas Vertrauen in mich zusätzlich.
Und so kommen wir abermals auf die Verantwortung zu sprechen – auf die Verantwortung abseits jener, die er neuerdings für seine Familie zu haben glaubt. Allzu rasch steht wieder das Wort Opfer im Raum. Unausgesprochen, doch klar umrissen wie ein Phantasma, das sich sichtbar macht, um jeden Zweifel über seine Existenz auszuräumen.
»Diese Verbrecher ziehen den Koran in den Dreck«, poltert er los.
Ich bin froh, dass er das so sieht. Doch dann, fast trotzig, setzt er hinterdrein: »Der Prediger ist schuld. Dieser Arsch!«
Wiederum einer dieser aufblitzenden Momente, da ich an seinem Prozess der Läuterung ernsthaft zweifle. Denn in diesen Momenten fühlt er sich nicht als Täter. Er ist, wenngleich er das Wort nicht in den Mund nimmt, Opfer. Opfer der Umstände. Zuerst die Sache im Park. »Wir haben uns gegenseitig hochgepuscht. Die Gruppe.«
Natürlich, denke ich. Nichts öffnet die Schleusen für Verführung und falsche Führung leichter und weiter als ein Gefühl von Verlorenheit, und doch kann und will ich ihn nicht aus der Pflicht seiner Täterschaft entlassen.
»Du hast also auch … hochgepuscht?«
»Ich habe nicht damit angefangen.«
»Nein?«
»Nein. Ich wollte bloß dazugehören.«
»Und dann?«
»Der Prediger. Er hat uns manipuliert. Er hat Gehirnwäsche mit uns betrieben. Ich habe das nie gewollt. Glauben Sie mir, Imam! Die anderen auch nicht.«
»Du bist kein Opfer«, sage ich, um hinterdrein zu denken: Du bist ein Täter. Ein Täter mit Ausrede. Wie alle anderen auch, die unverzüglich irgendwelche Ausreden ins Treffen führen. Doch das sage ich nicht, denn meine Aufgabe als Seelsorger besteht nicht in der Aburteilung von Straftätern (was ohnedies vor Gericht geschieht), sondern in der Aufgabe, die Menschen wie Musa die eigene Einsicht zu fördern, sie gezielt hinzuführen zu dem Wendepunkt, wo sie ein Einsehen haben, wo sie ihre Täterschaft begreifen, die Schwere ihrer Schuld erkennen und für sich anerkennen.
»Du selbst hast die Entscheidungen getroffen«, sage ich also. »Du selbst hast gehandelt. Du allein.«
Musa reagiert geradezu wehleidig. »Wieso sagen Sie das, Imam? Sie kennen meine Geschichte. Was bin ich sonst als ein Opfer?!«
»Sind denn immer bloß die anderen schuld, Musa?«
Manchmal hat Musa Tränen in den Augen. Es hat den Anschein, als überfordere ihn seine Rolle im syrischen Krieg in der Rückbeschau. Was ist er? Ein gnadenloser Mörder? Ein Hetzer? Dennoch: Meine Worte über den Koran, über Allahs Wunsch eines friedfertigen Miteinanders der Menschen aller Konfessionen und Hautfarben, fallen auf fruchtbare Erde bei ihm. Wiewohl ich mir bis zuletzt nicht sicher bin, wieweit dieser Same der Wiederkehr ins Gefüge einer demokratischen Gesellschaft und ihrer Werte in ihm gedeihen wird.
»Ich sehe in dir einen Menschen, der sich auf die Suche nach Allahs Vergebung begibt«, sage ich.
Dafür müsse er allerdings bereit sein, die Frage der Verantwortlichkeit aufzulösen. Er müsse sich bekennen zu dem, was er getan hat. Vor sich bekennen. Und natürlich vor Allah. »Nur wer echte Reue zeigt, dem vergibt Gott.«
Wenn du Reue zeigst, wird dir Allah vergeben. Das ist eine der Kernbotschaften, mit der ich in der JA Josefstadt arbeite. Vielleicht haben junge Männer wie Musa ihre Probleme damit, weil ein barmherziger Gott für sie so wenig greifbar ist, weil er dem widerspricht, was ihm und Seinesgleichen von klein auf als Gottesbild indoktriniert worden ist.
Nicht erst ein verführerischer, mit der Gewitztheit eines professionellen Schauspielers auftretender Prediger gibt Menschen wie Musa das Bild eines »Nur-Strafenden« Gottes ein.
Oftmals erfolgt dies bereits in frühester Kindheit – als schändlicher Auswuchs einer nach wie vor sprießenden Gepflogenheit, die vorgibt, getreulicher Ausdruck des Koran zu sein, tatsächlich aber das Abbild archaischer Machtstrukturen ist. Eine Ausformung von Angstpädagogik, die längst über Bord geworfen gehörte.
»Schau«, sage ich dann, »Allah ist der Allgerechte, und so zieht er die Menschen auch zur Rechenschaft – auf seine Weise.«
In solchen Augenblicken, da ich den Zweifel an der prinzipiellen Barmherzigkeit Allahs in den Augen meines Gegenübers aufblitzen sehe, muss ich an meinen Großvater denken. Daran, dass er es gewesen ist, der mich maßgeblich auf meinem Weg zum Imam geprägt und begleitet hat. An seine Anfänge im deutschen Ludwigshafen, wohin er – dreitausend Kilometer von der Heimat, einer anatolischen Kleinstadt, entfernt – in den Siebzigern gekommen ist. Als typischer Vertreter der Gastarbeitergeneration. Erst Jobs am Bau. Später beim Chemieriesen BASF. Der mühselige Aufbau eines Stückchens Lebenswelt. Erst der Mann als Vorhut aus der Türkei ins Ausland, später Frau und Kinder nachgeholt. Wie man es kennt.
Großvater ist seit jeher ein Mann der Tat, und als solcher lerne ich ihn auch kennen. Er bringt seinen Sohn, meinen Vater, ebenfalls bei BASF unter. Und auch mir, Ramazan, soll dergleichen widerfahren. »Sie suchen Mechatroniker«, sagt Vater eines Tages, als er von der Arbeit heimkehrt. Für ihn liegt der Fall, mein Fall, klar auf der Hand.
Meine Pläne indes sind andere. Sowohl eine Jobmöglichkeit dort wie auch ein Angebot von der Universitätsklinik zu Heidelberg, wo man mich als aktenschleppenden Zivildiener kennengelernt hat und auch übernehmen will, schlage ich zum Entsetzen meines Vaters aus. Auch Halal-Metzger will ich nicht werden. Eine Marktlücke, braust mein Vater auf. Ich würde Millionen machen. Ich lehne entschieden ab, denn mir steht anders im Sinn. Auch bin ich meilenweit entfernt, ein einziges Huhn schlachten zu können. Obwohl ich Huhn für mein Leben gerne esse, und es auch nicht frei von humorvoller Pikanterie ist – aus heutiger Sicht –, dass meine Eltern mich ausgerechnet Ramazan genannt haben, benannt nach dem Fastenmonat Ramadan.
Das Thema Halal-Metzger scheint vom Tisch. Bis mein Vater mich am Vorabend meiner Abreise nach Wien (wohin es mich der Liebe wegen verschlägt) vom Abschiedfeiern mit meinen Freunden nachhause holt. Im Wohnzimmer blicke ich in sieben todernste Mienen. Mein Vater schweigt die ganze Zeit, die anderen jedoch, allesamt seine Freunde, beginnen, auf mich einzureden. Teils blumige, teils eindringliche Worte. Der Druck wächst und wächst. Ein Argument stichhaltiger als das andere. Ich müsse bloß die Ausbildung machen, sie würden den Rest organisieren. Alles würden sie auf die Beine stellen. Bis hin zum Schlachthof.
Ab und zu, wenn ich einen jungen Muslim vor mir sitzen habe, mir seine Geschichte anhöre – Abkehr vom Weg, Werdegang der Radikalisierung –, muss ich genau daran denken. An die grimmig entschlossenen Gesichter der Freunde meines Vaters, die dann erneut vor mir erstehen. An die Flut ihrer Argumente, die mich rumkriegen sollen. Natürlich ist die Karriere eines angehenden Halal-Metzgers mit der eines Extremisten nicht gleichzusetzen, doch ich sehe es als Parabel auf das Leben – dafür, wie wichtig es ist, sich nicht leichtfertig den Vorstellungen von Einflüste rern zu ergeben. Niemand kommt als Radikaler zur Welt. Erst die Umstände machen einen Menschen dazu, insbesondere aber die Aufgabe der Treue zu sich selbst und die Missachtung einer natürlichen inneren Stimme, die zur Vorsicht mahnt.
Nein, Halal-Metzger ist nicht mein. Stattdessen fliege ich nach Wien, folge dem Vorschlag eines Freundes, Islam zu studieren. Sein Rat fällt bei mir auf einen Boden, den mein Großvater da schon längst zu bestellen begonnen hat. Zwanzig Jahre zuvor, als er mir die ersten Prophetengeschichten vorgelesen oder aus dem Gedächtnis erzählt hat. Großvater ist selbst Imam. Wenngleich ehrenamtlich. Er lehrte mir: »Bete nicht aus Angst vor der Hölle. Bete nicht aus Gier zum Paradies. Bete aus Liebe zu Allah.« Unvergessliche Worte – im Übrigen der Leitsatz von Rabia Al Adawiyya, einer großen muslimischen Mystikerin, die einige Jahrhunderte nach Muhammad gelebt und gewirkt hat.
In ihm, Großvater, habe ich schon als kleiner Junge meinen privaten Religionslehrer erster Güte. Und diese Güte ist es auch, mit der er mir von Anfang an zur Seite steht, als sich mein Weg zu manifestieren beginnt. Auch heute noch schwingen die spirituellen Reden meines Großvaters über den Islam in mir fort. Als ich eines Tages, selbst längst Imam, offenbare, mit einem Rabbiner nach Jerusalem reisen zu wollen im Sinne einer interkonfessionellen Verständigung, raten Teile der Familie mir ab, allen voran mein Vater aus Angst, mir könnte im Nahen Osten etwas zustoßen. Abermals ist es Großvater, der mich bestärkt. Er hat mein Bild von Religion, von Zusammengehörigkeit aller Menschen früh geformt. Wie auch jenes eines barmherzigen, ganz und gar nicht »Nur-Strafenden« Gottes. Und auch, dass Allah all jenen vergibt, die aufrichtige Reue zeigen. Was immer sie getan haben.
Wenn du Reue zeigst, wird dir Allah vergeben.
Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, ob Musa diese Schwelle zur Reue, zur uneingeschränkten Einsicht überwunden hat oder nicht. Das Gericht hat ihn zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, als einen, der sich in Österreich nach § 278b des Strafgesetzbuches zu verantworten haben, dem so genannten Terrorparagraphen, der Schlagworte wie Hochverrat, Verhetzung, Terrorismus führt. Tage nach dem Richterspruch wird Musa in ein anderes Gefängnis verlegt, in Gemäuer außerhalb Wiens. Ich habe ihn bis zum heutigen Tage nicht wiedergesehen – und doch wird er noch einmal in mein Leben treten. Auf eine hochdramatische, mein Dasein als Gefängnisseelsorger massiv beeinflussende Art und Weise.