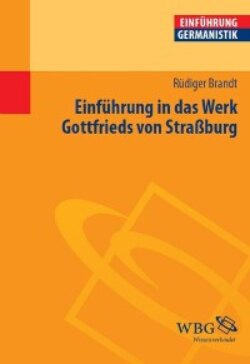Читать книгу Einführung in das Werk Gottfrieds von Straßburg - Rüdiger Brandt - Страница 10
2. Autor und Texte in der Überlieferung
ОглавлениеTexte unter Gottfrieds Namen
Neben dem Tristan gibt es noch sechs weitere Texte, die mit Gottfried als Autor in Verbindung gebracht wurden oder werden; fünf davon gehören der Lyrik an. Zu unterscheiden ist zwischen mittelalterlicher und neuzeitlicher (wissenschaftlicher) Zuschreibung:
| Text | Überlieferungsträger | zugewiesen in/von |
| 1. Sangspruch ‚Vom gläsernen Glück’ (1 Strophe) | Hs. C, dort unter Ulrich von Liechtenstein | Forschung auf Grundlage von Rudolf von Ems, Alexander 20.621–20.631 |
| 2. Sangspruch ‚Mein und Dein’ (1 Strophe) | Hs. C, hinter Nr. 1., ebenfalls unter Ulrich von Liechtenstein | Forschung (Teil-‚Zitat’ [?] in Rudolfs von Ems Willehalm von Orlens) |
| 3. Lied Diuzftist wunneclich (C 6 Strophen, A 5 Strophen) | Hs. C, Hs. A | Hs. C unter ‚Gottfried’ als erster Text; Hs. A unter ‚Gottfried’ als einziger Text |
| 4. Marienlob (C 63 Strophen, B 36 Strophen, K 11 Strophen) | Hs. C (ohne Verfassernamen und in abw. Fassungen auch in B = Stuttgart-Weingartner Liederhs. und K = St. Georgen, LB Karlsruhe Cod. Perg. Germ. XXXVIII) | Hs. C unter ‚Gottfried’ nach Nr. 3 |
| 5. (religiös-didakt.) Lied von der Armut (13 Strophen) | Hs. C | Hs. C unter ‚Gottfried’ nach Nr. 4 |
| 6. Konrad von Würzburg: Herzmaere | Hss. A und W von Konrads Herzmaere (14. bzw. Anf. 15. Jh.) | Schreiber der Herzmaere-Hss. A undW |
Außer Betracht bleiben kann die Zuschreibung von Konrads Herzmaere, da es sich bei ihr um einen Irrtum handelt, der aus der Nennung Gottfrieds im Prolog resultiert. Von den anderen Texten ist nur der Tristan im Mittelalter überregional bekannt. Selektive Autorrezeption wäre kein Spezifikum Gottfrieds. So divergent wie etwa bei Konrad von Würzburg gestaltet sich die Situation bei Gottfried allerdings nicht – dafür ist die Tristan-Überlieferung quantitativ und in Bezug auf ihre Verbreitung zu dominant; die Verbindung der lyrischen Texte mit seinem Namen beschränkt sich auf ein regional enges Umfeld.
Prinzipielle Zuordnungsschwierigkeiten
Bei der Zuordnung mittelalterlicher Texte zu Autoren können sich folgende Probleme ergeben: 1.Texte sind ohne Autornamen überliefert. 2. In Quellen finden sich Autornamen, denen man keine Texte zuordnen kann. 3. Identischen Texte sind in verschiedenen Überlieferungsträgern verschiedene Autornamen zugeordnet. 4. Texte existieren in verschiedenen Fassungen, die inhaltlich so divergent sind, dass man sie nach neuzeitlichen Maßstäben kaum einem Autor zuordnen möchte. 5. Texte, die mit dem Namen eines auch durch andere Texte bekannten Autors überliefert sind, ‚passen’ nach verschiedenen Kriterien nicht zu Letzteren.
Lyrische Texte Konrads sind im Fall des Lieds von der Armut und des Marienlobs zusammen mit seinem Namen in Handschriften nur je einmal überliefert; das Minnelied findet sich unter seinem Namen mit unterschiedlichem Strophenbestand in zwei Handschriften; der Sangspruch ‚Vom gläsernen Glück’ steht in einer Handschrift unter einem anderen Autornamen und wird nur von Rudolf von Ems mit Gottfried in Verbindung gebracht; im Mittelalter überhaupt nicht als Text Gottfrieds reklamiert wurde der Sangspruch ‚Mein und Dein’.
Varianten und ihr Einfluss auf Deutungen
Vom Tristan dagegen sind 34 Textzeugen überliefert bzw. in einem Fall durch eine Abschrift nachweisbar (verschollene Hs. *S; das derzeit kompletteste Handschriftenverzeichnis – nur das u.a. Fragment ist natürlich noch nicht enthalten – bietet K. Klein 2006, 215f.): 11 mehr oder weniger vollständige Handschriften sowie 23 Fragmente. Das vorerst letzte Fragment wurde erst im Sommer 2012 im Hessischen Hauptstaatsarchiv gefunden. Bevor man einen Text interpretiert, muss man sich darüber klar werden, wie dieser Text zustande gekommen ist. Keine der überlieferten Hss. ist als Original identifizierbar. Es stellt sich also die Frage, auf welche(n) Überlieferungsträger sich Textdeutungen stützen sollen. Interpreten beziehen sich i.d.R. auf bereits vorliegende Editionen. Das ist unter arbeitspraktischen Gesichtspunkten verständlich, aber nicht unproblematisch, weil damit schon eine Entscheidung für bestimmte Überlieferungsträger übernommen wird und Eingriffe der Herausgeber nicht mehr zur Diskussion stehen. Ein Beispiel: Eine gewichtige Rolle bei Tristan-Interpretationen spielt der Prolog. An dessen Beginn findet man Überlegungen über die Verpflichtung von Menschen, Dankbarkeit für ‚Gutes’ dadurch zu zeigen, dass man sich erinnert. In den heute gängigsten Editionen findet sich für die ersten vier Verse folgender Wortlaut:
| Ausgabe Marold | Ausgabe Ranke |
| Gedenkt man ir ze guote niht, von den der werlde guot geschiht, sô waere ez allez alse niht, swaz guotes in der werlde geschiht. | Gedaehte mans ze guote niht, von dem der werlde guot geschiht, sô waere ez allez alse niht, swaz guotes in der werlde geschiht. |
Die Divergenzen in den beiden ersten Versen werden umso relevanter, je mehr man dem Prolog eine Lenkungsfunktion für alles Folgende aufbürdet, in ihm ein Programm sieht, für das man dann nach Bestätigungen sucht. Im Text nach Marold wird zur Dankbarkeit gegenüber einer Gruppe aufgefordert. Da durch den Prolog nach der Lehre der Rhetorik das Publikum ‚wohlwollend’ gemacht werden soll, wird ein solches potenzielles Wohlwollen durch Evozierung einer Gruppe (ir nach Hs. M = ‚ihrer’) weniger direkt auf den Autor dieses speziellen Textes gelenkt; dieser ordnet sich vielmehr in ein Kollektiv von ‚Literaten’ ein und kommt damit der ebenfalls traditionellen Verpflichtung zur Bescheidenheit nach. Dies ist auch der Fall in Hs. E, wo der (Genitiv Plural = ‚derer’) steht. mans bei Ranke ist aus metrischen Gründen verkürzt aus man des (Hs. M). Die Übersetzungen fassen des als Genitiv von der auf (Kaprizierung auf den Autor). Aber des kann auch Genitiv von daz sein; dann wäre zu übersetzen: ‚Würde man etwas nicht als gut bewerten, durch das der Welt Gutes geschieht’; damit kann entweder ein bestimmtes Werk gemeint sein oder allgemein die Literatur, was wieder einen Akzentunterschied ausmacht. Ähnlich problematisch für jemand, der an ‚Konsistenz’ einer Deutung interessiert ist: In zwei Hss. (F, O) fehlt der betr. Passus zusammen mit weiteren Prologteilen ganz. Und das Bild, das sich bezüglich dieses Textstücks bietet, lässt sich mit anderen Beispielen ausbauen. So präsentiert etwa ausgerechnet die wahrscheinlich älteste überlieferte vollständige Hs. (M) eine viel kürzere Fassung als die anderen. Wenn man also von ‚Gottfrieds Tristan’ spricht, dann ist das eigentlich nur eine Abbreviatur für: ‚der in der Überlieferung und in der Wissenschaft unter Gottfrieds Namen kursierende Text, der sich erst in verschiedenen, untereinander nie völlig identischen Handschriftenfassungen konkretisiert’. Zwar gilt die „Kernüberlieferung“ von Gottfrieds Tristan als vergleichsweise „homogen“ (Huber 22001, 11); es gibt aber keinen Anlass, Varianten nicht ernst zu nehmen. Je subtiler oder weitreichender Interpretationen ausfallen, desto sorgfältiger muss man sich darüber orientieren, ob die Überlieferung Thesen trägt. Was für heutige Herausgeber nicht mehr als statthaft gilt – in Editionen verschiedene Hss. zu künstlichen Texten zu kontaminieren –, das war im Mittelalter gängig und lässt sich auch am Tristan beobachten: Eine Reihe von Schreibern hat sich offenbar auf verschiedene Vorlagen bezogen. Diese Texte durch ‚kritische’ Operationen wieder voneinander zu lösen, besitzt keinen literarhistorischen Erkenntniswert.
Das ‚Leben’ von Texten in der Überlieferung
Neben der Vergewisserung über den Text hat die Überlieferungswissenschaft noch eine zweite Aufgabe: Sie untersucht, wie ein Text in einer bestimmten Zeit, in bestimmten geographischen Bereichen und in jeweiligen sozialen Kontexten ‚gelebt’ hat, gibt also Aufschluss über seine Rezeption. Mit dem Autor des Originals hat das kaum noch etwas zu tun – allenfalls mit Bildern, die man sich von diesem machte oder die man zu erinnern glaubte. Angesichts der Heterogenität der literarischen Rezeptionsräume im Mittelalter, die unter der Sigle ‚deutsches Sprachgebiet’ nur abstrakt zusammenfassbar sind, gibt eine Analyse der Textüberlieferung aber konkretere Aufschlüsse über die geographischen Bewegungen eines Textes bzw. seiner Abschriften:
Die lyrischen Texte unter Gottfrieds Namen waren regional nicht verbreitet. Die Hs. C mit Minnelied, Lied von der Armut und Marienlob ist für diese Zusammenstellung ein unikaler Überlieferungsträger; sie ist ab ca. 1300 entstanden, und zwar wahrscheinlich in Zürich. Hs. A bietet das Minnelied mit einer Strophe weniger; die Hs. ist wohl etwas älter als C, als wahrscheinlichster Entstehungsraum gilt das Elsass, als Ort käme Straßburg in Frage. Beides hat zu Spekulationen über eine dort noch vorhandene spezielle Gottfried-Tradition geführt, die dann die Sammler von C beeinflusst habe. Offen bliebe dann, woher die Mehrkenntnisse von C (zwei zusätzliche Texte, eine zusätzliche Strophe) stammen. In den alemannischen Raum verweisen auch die St. Georgener Hs. LB Karlsruhe Cod. Perg. Germ. XXXVIII und die Stuttgart-Weingartner Liederhs. (Konstanz?); sie enthalten Fassungen des Marienlobs – aber ohne Zuweisung an Gottfried, so dass sie in die Diskussion nicht einbezogen werden können. Daher ergeben sich im Fall der Lyrik keine klaren Überlieferungsprofile. Anders beim Tristan. Aus den oben erwähnten Handschriften und Fragmenten lässt sich u.a. Folgendes ablesen:
Überlieferung: quantitativ und regional
Von der Zahl der Überlieferungsträger her gehört der Text zu den verbreitetesten deutschsprachigen Romanen des Mittelalters, weit übertroffen zwar von Wolframs Parzival (16 Hss., 66 Fragm., ein Druck), aber doch eindeutig in einer Spitzengruppe. Der Schwerpunkt der Handschriftenentstehung liegt im Westen und Südwesten Deutschlands (gegenüber K. Klein 1988 aktualisierte Karte der Überlieferung bei Tomasek 2007 b, 50, wo andererseits die bei Klein 2006 aufgeführten Fragmente noch nicht alle berücksichtigt werden konnten). Grundlage für diese Erkenntnis sind dialektale Befunde, die insofern nicht ganz stichhaltige Belege bieten, als Schreiber z.T. ihre heimischen Schreibdialekte in einem neuen Umfeld beibehalten oder regionale Schreibweisen aus ihren Vorlagen übernehmen. Angesichts der relativ breiten Grundlage an Überlieferungsträgern ist die geographische Einordnung aber wohl im Ganzen zutreffend. Ohne Überlieferungszeugen bleiben damit der niederdeutsche und der bairisch-österreichische Bereich. So weit zu gehen, der Überlieferung eine „fast provinzielle Beschränktheit“ zu attestieren (K. Klein 1988, 125), halte ich für überzogen: Immerhin ist im nd. und bair.-österr. Sprachraum der Besitz von Tristan-Hss. nachweisbar, und die Zufälligkeiten der Überlieferung lassen mit dem einen oder anderen Verlust durchaus rechnen. Auch haben die wegen der sehr aktiven Förderer von Großepik in Thüringen, Bayern und Ostfranken vermutbaren speziellen literarischen Geschmacksausprägungen nichts mit Provinzialität anderer Räume zu tun, sondern eher mit einer Art von ‚Blockade’ von Texten durch dominante Prägungen literarischer Regionen. Gegenüber diesem Gesamtbild umso auffälliger ist dann allerdings eine regionale Abweichung vom westsüdwestdeutschen Schwerpunkt: Vom 13. bis 15. Jh., also über den gesamten Zeitraum der mittelalterlichen Tristan-Überlieferung – mit einer (vielleicht allerdings verlustbedingten) Lücke in der 2. H. des 14. Jhs. – lassen sich eine Hs. und fünf Fragmente, davon zwei zu einer Hs. gehörend, auch im Gebiet zwischen Sachsen und Böhmen lokalisieren (Dialekte: ostmd.-böhmisch, ostfränk.). Erklärt wurde das mit speziellen Literaturinteressen am Hof der Böhmerkönige Wenzel II., Karl I. (als dt. Kaiser Karl IV), Wenzel IV Naheliegender als Grund ist der Verweis auf die Tristan-Fortsetzung Heinrichs von Freiberg (zw. 1270 und 1300), der als Auftraggeber den böhmischen Adligen Reinmunt von Liuchtenburg nennt (Heinrich von Freiberg, Tristan 77, 75): Diese Fortsetzung hat der Tristan-Rezeption möglicherweise einen neuen Schub gegeben, der sich aber nicht nur auf den ostmd. Bereich auswirkte, sondern auch auf den ostalem. (Hs. E) und moselfränk.-rheinhess. (Hs. O).
Zeitlich stammen von den 11 vollständigen Hss. zwei aus dem 13., vier aus dem 14. und fünf aus dem 15. Jh. Bei den Fragmenten ist der Trend umgekehrt: Die deutliche Mehrzahl stammt aus dem 13. Jh., auch wenn man einige Fragmente nicht mit einbezieht, deren Datierung schwankt. Für die Beurteilung der zeitlichen Überlieferungsgegebenheiten ist der Unterschied irrelevant – man muss natürlich Fragmente und Hss. zusammenrechnen.
Stemma und Co-Überlieferung
Die stemmatologische Aufarbeitung der Überlieferung, rund 80 Jahre lang dominiert vom Modell Rankes (zwei Hauptüberlieferungszweige), ist in Bewegung geraten durch ein alternatives Modell von Wetzel, das von drei Hauptzweigen ausgeht. Die Diskussion ist nicht abgeschlossen, wird es auch vielleicht nie sein. Was die Co-Überlieferung betrifft, so ist diese in den meisten Handschriften homogen: Es dominieren Zusammenstellungen mit den Fortsetzungen Ulrichs von Türheim und Heinrichs von Freiberg, zweimal wurde in Gottfried-Hss. der Tristan als Mönch aufgenommen, einmal Eilharts von Oberge Tristrant. In vier Fällen dagegen finden sich Zusammenstellungen mit Hartmanns Iwein (Hs. F), Wolframs Parzival (Fragm. z/z1), der Sächsischen Weltchronik (Hs. N; hier zusätzlich Lyrik und didaktische Kleinformen) und Freidanks Sprichwörtersammlung Bescheidenheit (Hs. H).
Fazit: Die Überlieferungsträger des Tristan sind vergleichsweise zahlreich – insbesondere dann, wenn man sie mit denen der Vorläufer vergleicht. Demgegenüber ist die regionale Verbreitung begrenzter. Eine Prosabearbeitung wie Eilharts Tristrant hat Gottfrieds Werk nicht erfahren, es ist auch nicht mehr in den Druck gelangt. Der Autor Gottfried war also auch mit dem Tristan im Mittelalter weniger einflussreich, als man das angesichts der Tristan-Emphase in der Neuzeit vermuten könnte. Andererseits war es fast ausschließlich dieser Roman, der für eine relative Kontinuität von Gottfrieds Bekanntheit gesorgt und zu lobenden Erwähnungen des Autors bei anderen Autoren geführt hat.