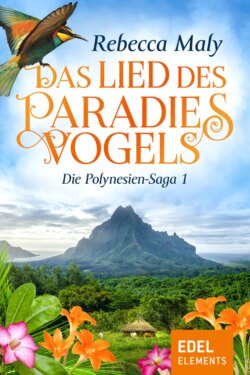Читать книгу Das Lied des Paradiesvogels 1 - Rebecca Maly - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1
ОглавлениеHamburg 1884
Dorothea zog die schweren, dunkelgrünen Brokatvorhänge zurück. Sofort wurde der gesamte Raum mit Sonnenlicht geflutet. Sie blinzelte mehrfach, bis sich ihre Augen daran gewöhnt hatten. Die Fenster reichten von der Decke bis zum Fußboden und stammten ursprünglich aus einer Orangerie, in der vornehme Herrschaften einst exotische Pflanzen aus aller Herren Länder gepflegt hatten. Nun gehörten sie hierher, als wäre es nie anders gewesen. Vater hatte sie gebraucht gekauft und für sein Fotostudio verbauen lassen.
Ihr Bruder Daniel schätzte das natürliche Licht für seine großflächige Malerei, die er im Nachbaratelier betrieb. Dort entstanden die aufwendigen Kulissen für Vaters Porträtfotografie, für die er mittlerweile weit über Hamburgs Grenzen hinaus bekannt war.
Daniel bekam Dorotheas Meinung nach viel zu wenig Anerkennung. Ihm schien das nichts auszumachen. Er ging ganz in seiner Kunst auf, ganz gleich, was andere darüber dachten.
Dorothea sah sich im Atelier um. Hier musste noch viel erledigt werden, bevor die Kundschaft kam.
Im hereinfallenden Licht tanzte der Staub wie Schwärme winziger Insekten. Sie öffnete die Fenster, um ihn von einer frischen Brise vertreiben zu lassen, und musste prompt niesen.
Mittlerweile überließ Vater es ihr hin und wieder, eine Kulisse für die Porträts auszusuchen. Heute sollte eine Familie kommen: Vater, Mutter und zwei Söhne. Dorothea ging zu einem großen, eigens angefertigten Ständer, in dem die Hintergründe aufbewahrt wurden.
Daniel hatte sein ganzes Talent in die Malereien gelegt. Es gab weite Blumenwiesen, Berglandschaften, Seen, aber auch Straßenansichten und anderes. Schließlich wählte sie die Gartenansicht irgendeines Schlosses, mit geometrisch geschnittenen Hecken und Büschen, deren lineare Anordnung der Fotografie später Tiefe verleihen würde.
Auf einer Leiter stehend, befestigte sie zuerst die Leinwand, dann einen schweren Vorhang, der diese zum Teil verdeckte und so das Augenmerk auf die Familie lenken würde. Davor stellte sie einen schlanken Tisch mit einer kleinen Karaffe und zwei Stühle. Fertig.
Sie trat zurück und musterte ihr Werk. Noch ein Stückchen zurück, bis sie neben der großen Kamera ihres Vaters stand. Beinahe zärtlich strich sie über das lackschwarze Gehäuse. Sie wusste genau, wie sie damit umzugehen hatte, wie sie Nass- oder Trockenplatten einlegen musste.
In ihren Träumen war sie eine berühmte Fotografin. Doch in der Realität würde das niemals passieren. Eher würde sie die Ehefrau eines solchen und, wenn sie Glück hatte, dort die gleichen Handlangerdienste vollbringen dürfen wie jetzt.
„Irgendwann“, flüsterte Dorothea der Apparatur zu, „irgendwann.“ Dann widmete sie sich wieder ihrer Aufgabe und brachte das Atelier so weit in Ordnung, dass die Kunden kommen konnten.
Mit einem Seufzer kehrte sie dem Raum den Rücken und folgte dem Geruch von Ölfarben durch einen schmalen Flur in das Reich ihres Bruders.
Daniel saß konzentriert an seinem Schreibtisch und schien sein Werk zu bewachen wie ein Greifvogel, der seine Beute mit ausgebreiteten Flügeln schirmte.
Eine Weile sah sie ihm zu, und es wurde ihr wieder einmal klar, wie lieb sie ihn hatte. Sie hatten von jeher alles geteilt, nicht nur den Leib ihrer Mutter. Ein unsichtbares Band schien zwischen ihnen gespannt, das sie empfänglich füreinander machte.
Auch jetzt dauerte es nicht lange, bis Daniel ihre Anwesenheit spürte. „Bist du wieder neugierig, Thea?“, fragte er, ohne sich umzudrehen. Sie hörte das Lächeln in seiner Stimme.
„Darf ich schauen?“
„Du kennst die Antwort.“
Außer ihr durfte niemand seine unfertigen Bilder sehen. Während sie näher herantrat, fuhr er sich grüblerisch durchs Haar. Es war von einer Farbe irgendwo zwischen Blond und Braun, störrisch und leicht gelockt, genau wie ihres. Beide waren sie von schmaler Statur, waren sogar fast gleich groß, nur ihre Augen unterschieden sich völlig. Während Daniel mit strahlend blauen zu ihr aufsah und auf ihr Urteil wartete, waren ihre eigenen von einem warmen Braun.
Dorothea legte ihrem Bruder die Hände auf die Schultern. Unter ihren Fingern konnte sie seine Verspannung spüren. „Wie lange kauerst du denn schon hier?“
„Weiß nicht“, nuschelte er, weil er das Kinn in die Hand stützte und beinahe grimmig auf die winzige Porträtmalerei starrte.
„Du warst nicht beim Frühstück, hast du überhaupt etwas gegessen?“ Sie wusste, dass er es nicht getan hatte. „Irgendwann bist du so dünn, dass dich der Wind einfach davonweht.“
„Musst du gerade sagen, Bohnenstange“, gab er zurück und drückte ihre Hand. „Hast ja recht, gleich esse ich was. Ich muss nur eben …“
„Jaja. Das sagst du doch immer. Darf ich mal schauen?“
„Hast du doch schon“, meinte er lächelnd, verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich mit einem Stöhnen zurück. Anscheinend merkte er jetzt erst, dass er schon viel zu lange in derselben Haltung dagesessen hatte.
Fasziniert betrachtete Dorothea das winzige Abbild eines jungen Mannes. Schwarzhaarig und dunkeläugig blickte er ihr scheinbar forsch entgegen. Sein Gesicht war gebräunt, und die Uniform ließ auf einen Seemann schließen.
Daniel reichte ihr ungefragt eine große Lupe, die er benutzte, um Details zu malen. Dorothea beugte sich konzentriert vor. Nun konnte sie das verschmitzte Lächeln auf dem jugendlichen Gesicht erkennen.
„Du bist ein Künstler, Brüderchen. Wie abenteuerlustig dieser Mann aussieht. Man meint, ihn sofort kennenzulernen, und ich habe den Eindruck, ich würde ihn vom ersten Moment an mögen.“
Daniel lachte. „Oh, das würdest du auch.“ Er zeigte ihr eine Fotografie, viermal so groß wie sein Porträt.
„Das ist er? Du hast ihn wirklich gut getroffen, aber lass Vater nicht sehen, dass du nur Fotografien erstellst, damit sie dir als Gedächtnisstütze dienen.“
„Wenn du mich nicht verrätst?“
„Niemals, bei mir ist dein kleines Geheimnis sicher. Versprochen.“
Er küsste ihr die Hand und stand auf. „Komm, lass uns etwas essen, Thea, ich sterbe vor Hunger.“
***
Leopold Saarner ging hektisch im Flur auf und ab. Er konnte es nicht mehr ertragen, wie seine Mutter schrie.
Am liebsten wäre er weggelaufen oder hätte sich die Ohren zugehalten. Seit Tagen ging das nun so.
Im Hause Saarner schlief niemand mehr. Verschiedene Ärzte gaben sich die Klinke in die Hand. Jeder von ihnen machte das gleiche betretene Gesicht. Jeder, bis auf einen Quacksalber, der für die Wunderheilung Unsummen verlangte. Dass Vater ihn nicht die Treppe hinuntergestoßen hatte, überraschte Leopold, er hätte es fast selbst getan.
Seine Nerven lagen blank, waren bis zum Zerreißen gespannt. Er konnte nicht mehr warten, wollte sich nicht mehr ohnmächtig fühlen angesichts der Leiden seiner geliebten Mama. Er hatte zu Gott gebetet, was er sonst nie tat, hatte die Ärzte angefleht, irgendetwas zu tun.
Nun war er einfach nur noch müde.
Für Mama gab es keine Rettung mehr, das war ihm mittlerweile völlig klar. Warum aber ließ das Schicksal oder Gott sie vor dem unausweichlichen Tod derart leiden?
Sie war eine so herzensgute, wunderbare Frau. Sie hatte nichts falsch gemacht, sich nie etwas zuschulden kommen lassen, außer vielleicht, ihrem Ehemann nur ein einziges Kind geboren zu haben. Aber das warf Vater ihr nicht vor.
Sie lebte ein vorbildliches Leben, war immer tüchtig, engagierte sich sogar in einem Komitee für Waisenkinder aus dem Gängeviertel, in dem die Armen wohnten.
Und nun litt sie, wie kein Mensch leiden sollte. Nicht einmal den schlimmsten Verbrechern wünschte Leopold eine derartige Pein.
Die Bauchschmerzen hatten vor drei Tagen wie aus heiterem Himmel begonnen und sich bald zu Krämpfen und Koliken ausgewachsen. Sie waren erst noch erträglich gewesen. Leopold erinnerte sich noch gut an Mamas Scherze, sie habe sich beim Kaffeekränzchen an zu viel Sahnetorte den Magen verdorben. Am Abend des ersten Tages riefen sie dann doch einen Arzt. Er gab ihr ein Abführmittel und für später Laudanum, damit sie schlafen konnte.
Sie schlief nicht, niemand tat das.
Mittlerweile half kein Laudanum mehr und auch sonst nichts.
Leopold durchmaß den langen Flur mit großen Schritten, als ihm auf einmal klar wurde, dass er schon seit einer ganzen Weile nichts mehr von ihr gehört hatte.
Schlagartig wurde ihm die Brust eng. War der Moment, den er so gefürchtet und zugleich in einem stillen Winkel seines Herzens herbeigesehnt hatte, etwa gekommen?
Schnell war er bei der verschlossenen Schlafzimmertür seiner Eltern. Als er die Hand auf die Klinke legte, hörte er sie. Mutter sprach leise und mit vom Schreien heiserer Stimme. Sie lebte!
Als Vater ebenso leise antwortete, trat er zurück, um das Zwiegespräch seiner Eltern nicht zu belauschen.
Die beiden hatten um ein wenig Zeit für sich gebeten, nachdem Vater und Sohn die ganze Nacht hindurch gemeinsam bei ihr ausgeharrt hatten. Rastlos nahm er seine unermüdliche Wanderung durch den Flur wieder auf.
Als es an der Haustür klingelte, schrie Mutter gellend auf. Leopold zuckte zusammen, dann eilte er hinab ins Erdgeschoss, um zu öffnen. Es war der Pastor der Gemeinde. Ein alter, gebrechlicher Mann, den Leopold bereits aus Kindertagen kannte. Schon damals war sein Schädel kahl, die Haut faltig und der üppige Bart grau gewesen.
Mittlerweile musste er fast achtzig Jahre alt sein. Warum starb er nicht statt der Mutter, warum durfte er doppelt so lange auf der Erde verweilen wie sie?
„Herr Erpenbek, gut, dass Sie kommen konnten.“
Draußen regnete es in Strömen, der Schirm des Pastors war triefnass.
Erpenbek schien es nichts auszumachen. Er sah Leopold mitfühlend an – mit diesem Gesichtsausdruck, den alle aufsetzten, die oft mit der Trauer anderer umgehen mussten. Der Pfarrer gab ihm die regennasse Hand und legte ihm zugleich die Linke auf die Schulter. „Meine aufrichtige Anteilnahme, Herr Saarner.“
„Sie ist doch nicht tot!“, schoss es aus Leopold heraus. „Noch nicht“, setzte er leiser nach.
„Ich werde ihr Trost spenden.“ Er trat ein und ließ sich aus dem Mantel helfen. „Was ist denn nur geschehen? Ich sah Ihre Mutter doch noch vergangenen Sonntag im Gottesdienst. Wir haben danach kurz geplauscht, es ging ihr gut.“
„Die Ärzte meinen, es sei der Darm. Etwas sei gerissen oder verschlungen. Ihr Körper vergifte sich nun selbst.“
„Der Blinddarm“, meinte Erpenbek wissend. „Er hat schon viele gute Menschen vor ihrer Zeit zu Gott gerufen.“
Wieder hallte Mutters Schrei durchs Haus. Erpenbek hörte es zum ersten Mal und wurde schlagartig blass. Gleich einem düsteren Omen begannen auf der Straße Hunde zu bellen.
„Eilen wir uns“, sagte der Pastor und umklammerte das Treppengeländer.
Leopold stieg vor ihm hinauf, musste aber bei jeder dritten Stufe innehalten, um auf den Pastor zu warten. Wenn er weiterhin so trödelt, ist Mutter tot, bevor er sie gesegnet hat, dachte er grimmig.
Leopold klopfte und trat mit dem Pastor ein. Vater sah auf, er hielt Mamas Hand, und seine Wangen waren nass vor Tränen. Als er den Gast bemerkte, wandte er sich ab, um Fassung zu gewinnen.
„Der Herr Pastor Erpenbek ist gekommen“, sagte Leopold leise und strich seiner Mutter über die Wange. In den letzten Tagen war sie um Jahre gealtert. Ihr blasses Gesicht von tiefen Furchen gezeichnet. Er dachte schon, dass sie ihn gar nicht wahrgenommen hätte, doch dann hielt sie plötzlich seine Hand fest. Aber ihr Griff war kraftlos und löste sich fast augenblicklich wieder.
Leopold sank neben dem Bett auf die Knie und schmiegte ihre Hand an seine Wange.
„Mein Junge“, sagte sie schwach. „Komm her.“
„Mama, spar dir deine Kräfte.“
„Komm“, flüsterte sie und seufzte tief.
Er lehnte sich so weit vor, dass sein Ohr ganz dicht über ihrem Mund war. „Versprich mir etwas.“
„Alles.“
„Hör auf deinen Vater, er ist ein guter Mann, und er will nur das Beste für dich. Es wird ein Tag kommen, an dem du etwas erfahren wirst, was dich vielleicht wütend machen wird. Aber denke daran, dass wir dich lieben. Wenn ich deinem Vater verzeihen kann, dann musst du es auch, schwöre es mir.“
Leopold verstand nicht, wovon sie sprach, konnte nicht einmal vermuten, worauf ihre Worte abzielten. War es etwas, was er ihr schwören konnte, ohne überhaupt zu ahnen, worum es ging? Ihr flehender Blick war deutlich. Er musste es tun. Gerade, als er ihr versprechen wollte, Vater alles zu verzeihen und immer ein gehorsamer Sohn zu sein, krümmte sie sich. Krämpfe durchliefen ihren Körper, als würde sie von einer gewaltigen Kraft durchgeschüttelt.
Leopold war wie erstarrt. Vater schob ihn zur Seite und drückte Mutter an sich, wiegte sie in den Armen wie ein kleines Kind und machte leise, beruhigende Geräusche.
Ihre Schreie verebbten zu einem Wimmern. Fast unmerklich bedeutete sie dem Pastor, zu ihr ans Bett zu treten.
Leopold wich zurück, bis er mit dem Rücken gegen einen Kleiderschrank stieß. Geräusche und Stimmen traten in den Hintergrund. Sein Kopf fühlte sich plötzlich merkwürdig leicht an. Ein dumpfer Druck lag auf seinen Ohren, als wären sie mit Watte vollgestopft, und dann war da nur noch dieses hohe Fiepen, das sich gleich einem Schrei in ihn hineinfraß.
Seine Knie wurden weich, doch nein, er durfte keinesfalls ohnmächtig werden.
Der Pastor hielt die Bibel in der einen Hand und hatte Mutter die andere auf die Stirn gelegt. Sein Mund bewegte sich, doch die Worte drangen nicht bis zu Leopold durch.
Gebannt beobachtete er, wie die Krämpfe langsam nachließen, seine Mutter immer ruhiger wurde. Dann öffnete sie die Augen noch ein letztes Mal, wie um sich von ihnen zu verabschieden. Sie strahlte nun großen inneren Frieden aus. Dann erschlaffte ihr Körper, und Daniel glaubte zu spüren, wie die Seele ihren Körper verließ.
Er meinte sie dort schweben zu sehen, ein helles Licht nur, das für einen Augenblick aufblitzte.
Endlich löste sich Leopold aus seiner Starre. Noch immer in der Stille gefangen, ging er zum Fenster, zerrte die Vorhänge zurück und riss es auf.
Die hereinströmende Luft schien Mutters Seele mitzunehmen und draußen in der Weite der Natur in eine unendliche Freiheit zu entlassen.
Fort. Sie war fort.
***
Deutsches Protektorat – Papua-Neuguinea
Der Weg vor ihm war knochentrocken. Baptiste klopfte dem Pferd mit den Fersen in die Seiten, doch die Stute schnaubte nur und legte die Ohren an. Es war brütend heiß, und in der windstillen Luft sirrten die Fliegen. Die Hufe wirbelten Staub auf, der sich hinter ihm wie eine Armee von Geistern aufrichtete.
Mutter Naian hatte ihm viele Geschichten erzählt, von Toten, die in der Welt umhergingen, weil sie den Weg ins Jenseits nicht fanden. Tote, die weit fort von der Heimat auf den Plantagen gestorben waren.
Unter der gleißenden Sonne fiel es ihm schwer, daran zu glauben. Geister, das war etwas für lange Nächte und nebelige Morgen.
Noch einmal versuchte er, die Stute anzutreiben. Sie legte die Ohren an, ließ die Zähne hörbar aufeinanderschlagen und trottete dann zügiger.
Hier grasten noch Rinder links und rechts des Weges, doch nicht allzu weit vor ihm ragte ein gleichförmiger Hain aus Kokospalmen auf. Die dunkelgrüne Wand verhieß endlich Schatten, das musste doch auch sein widerspenstiger Gaul kapieren!
Schon von Weitem konnte er die Arbeiter singen hören. Unermüdlich kletterten sie die hohen Stämme hinauf und drehten die Nüsse ab. Andere schleppten sie in Tragekörben zu einem Ochsenkarren, der beinahe fertig beladen war. Baptiste hatte seinen Zieheltern versprochen, auf der Plantage nach dem Rechten zu sehen. Das kam ihm noch immer etwas seltsam vor, war seine Haut doch beinahe genauso dunkel wie die der Arbeiter.
Endlich tauchte er in den Schatten der Palmwedel ein. Er lehnte sich im Sattel zurück, und die Stute wurde langsamer. Im gemütlichen Schritt erreichte er schließlich den Ochsenkarren und stieg ab. Die Zügel band er an einen Busch, dann ging er zu Fuß weiter. Zwischen den Palmen wuchs üppiges Gras, während es woanders schon verdorrt war. Dafür sorgten hier die Kanäle, welche die Palmen mit Wasser versorgten.
Hier war die Luft auch gleich angenehmer.
Baptiste folgte einem kleinen Trampelpfad. Er schwitzte in seinen Schuhen und hätte sie am liebsten ausgezogen. Die Arbeiter waren alle barfuß. Als er sie erreichte, hockten sechs von ihnen im Schatten auf dem Boden und teilten ein karges Mittagsmahl aus frischen Kokosnüssen und Kochbananen, die sie in der Asche eines kleinen Feuers gegart hatten.
Der Geruch weckte Erinnerungen an die bescheidene Hütte am Meer, wo er geboren worden war, an seine Mutter Naian und an die Wellen, deren Klang ihn wie ein zweiter Herzschlag begleitet hatte.
Auch er hatte als Kind oft tagelang nichts anderes zu essen bekommen als Kochbananen und hin oder wieder einen winzigen gebratenen Fisch, der zu klein war, um verkauft zu werden. Die Armut, in der sie leben mussten, hatte er nie bewusst wahrgenommen. Er wusste nur, dass er keinen Vater wie die anderen Kinder hatte, der auf das Meer hinausfuhr und Fisch fing. Sein Vater war nur eine Geschichte, die seine Mutter traurig machte, mehr nicht.
Sobald die Männer ihn bemerkten, hielten sie inne. Doch Baptiste war keiner der gewöhnlichen Aufseher, die regelrecht gefürchtet wurden. Die sechs hatten keine Angst vor ihm, obwohl sein Wort mehr galt als das der anderen Angestellten.
Aber das war Baptiste nur recht. Er hatte genauso wenig wie sie vergessen, dass er in derselben kleinen Siedlung in der Bucht zur Welt gekommen war.
Einige der Arbeiter waren seine besten Freunde. Für sie machte es keinen Unterschied, dass Baptiste der Bastardsohn eines Weißen war. Solange niemand etwas gegen seinen Vater sagte, war alles gut.
„Wie läuft es mit der Ernte, Baku?“, fragte er.
Der Angesprochene stand auf. Er war im gleichen Alter wie Baptiste, aber einen Kopf kleiner. Sie waren zusammen in die Missionsschule gegangen und – soweit er sich erinnern konnte – stets gute Freunde gewesen.
„Gut, wir haben bei Morgengrauen angefangen und sind nun fast fertig. Das dort ist der vierte und letzte Wagen.“
„Sehr gut, die Hitze ist heute übel, gebt acht, dass ihr genug Pausen macht.“
Er wusste, dass die Männer das nicht gerne hörten. Keiner von ihnen würde Schwäche eingestehen. „Es ist niemandem gedient, wenn einer von euch vom Baum fällt.“
Solche Unfälle geschahen bedauerlicherweise fast jedes Jahr. Baptiste war selbst bereits einmal abgestürzt und hatte Glück gehabt, war mit nur einem gebrochenen Arm davongekommen. Das lag bereits Jahre zurück, dennoch meinte er hin und wieder, sein Arm sei seitdem ein wenig schief.
Er wandte sich an Arnoldo, einen alten Arbeiter, unter dessen faltiger Haut sich sehnige Muskeln wölbten. Er schaffte noch fast genauso viel wie die Jüngeren, aber es fiel ihm nicht mehr so leicht. Seine Füße waren knotig und verformt von den zahllosen Stämmen, die er hinaufgestiegen war. Baptiste hatte seinen Ziehvater überzeugen können, den erfahrenen Erntehelfer zum Vorarbeiter zu machen. So musste er weniger schwer schuften und behielt sein Ansehen.
Nun koordinierte er für seinen Trupp, wann und wo geerntet wurde.
„Arnoldo, wie sieht es mit der Kopra aus? Ist das geriebene Kokos gut verpackt? Morgen soll wieder ein Schiff gehen.“
„Die Frauen nähen heute die Säcke zu“, meinte er und strich sich über den kahlen Schädel, auf dem nur noch einzelne graue Haare sprossen. „Ich denke, heute Abend, sobald es nicht mehr so heiß ist, können wir alles zum Hafen bringen.“
„Sehr gut. Dann will ich euch nicht weiter aufhalten.“ Er wandte sich noch einmal an Baku. „Sehen wir uns nachher?“
Sein Gegenüber grinste nur breit. Das war Antwort genug. Baptiste schulterte einen der Körbe, die bis zum Bersten mit grünen Nüssen gefüllt waren, und trug ihn zum Ochsenkarren. Das Gewicht auf den Schultern war vertraut. Früher hatte er darauf bestanden, auf der Plantage zu schuften wie alle anderen auch. Und auf gewisse Weise vermisste er die Arbeit hier.
Polternd fielen die Nüsse in den Karren. Baptiste griff nach einer bereitliegenden Machete und schlug einer Nuss die Spitze ab. Das Wasser darin war angenehm erfrischend. Den süßen und ein wenig mineralischen Geschmack würde er wohl niemals leid.
Die Stute war mittlerweile eingeschlafen. Als er sich ihr näherte und sie losband, gähnte sie mehrfach.
Er führte sie zu einem Bewässerungsgraben und ließ sie saufen, was er eigentlich sofort hätte machen sollen. Das Tier trank lange und geräuschvoll.
Schließlich stieg Baptiste wieder in den Sattel und ritt durch die gesamte Anpflanzung. Immer im wohltuenden Schatten der Kokospalmen und mit dem Rascheln der Wedel in den Ohren.
Je tiefer er in die Palmenhaine eindrang, desto grüner wurde es. Der Boden war mit dichter Vegetation bedeckt. An den Stämmen der alten Palmen rankten Schlingpflanzen hinauf. In der feuchten, warmen Luft wurde der Duft der Pflanzen so intensiv, dass er beinahe greifbar war.
Bedauerlicherweise gefiel die Windstille auch den Plagegeistern, und so wurden Ross und Reiter von zahllosen Fliegen und Stechinsekten umschwirrt.
Baptiste sah bei jeder Erntegruppe nach dem Rechten, genau wie er es seinem Oheim versprochen hatte. Auf der Plantage schufteten über einhundert Menschen. Fast jeder Bewohner der kleinen Siedlung in der Bucht, der alt genug dazu war. Das war schon so gewesen, als er auf die Welt gekommen war, und würde sich vermutlich auch nicht ändern. Die Jungen fingen mit zwölf Jahren als Erntehelfer an, die Mädchen je nachdem, ob sie sich noch um kleinere Geschwister kümmern mussten, etwas später. Den Frauen und Alten oblag es, die Nüsse aufzuschlagen, das Mark herauszukratzen und zu trocknen.
Als von der Küste der Klang von Kirchenglocken herübertrieb und die dritte Stunde des Nachmittags meldete, kehrte Baptiste der Anpflanzung endgültig den Rücken. Für heute hatte er seine Pflicht getan.
Die Stute schlug von allein den Pfad zum Dorf ein. Er führte über den Rücken einer kleinen Erhebung und ermöglichte einen Blick auf die Hütten aus Holz und Sagopalmblättern, die sich perfekt dem grünen Dschungel anpassten. Im Halbrund verlief er um eine Bucht aus weißem Sand. Korallenbänke ließen die Wellen weiter draußen gischtend brechen, bevor sie beinahe schon sanft an den Strand rollten und ihre ewige Reise beendeten.
Vorsichtig setzte die Stute einen Huf vor den anderen. Der steile Pfad war trotz der Hitze schlammig, und sie rutschte immer wieder aus. Baptiste nahm seinen Hut ab und fächelte sich Luft zu.
Gleich neben der Siedlung gab es einen weiten Platz, der fast zu jeder Tageszeit der brennenden Sonne ausgesetzt war. Von hier oben sah er gleißend weiß aus. Dort trocknete das Fleisch der Kokosnüsse, in feine Fasern zerrieben, zu Kopra. Ein leicht zu transportierender Rohstoff, aus dem im fernen Europa mit großen Mühlen das Öl herausgepresst wurde. Tonnen davon trockneten dort unten.
Plantagen gab es auf Papua Dutzende, und fast jede stellte Kopra für die Neuguinea-Kompagnie her. Dieser Zusammenschluss von deutschen Händlern hatte sich auf der Inselgruppe breitgemacht und beanspruchte ein riesiges Protektoratsgebiet. Kaiser-Wilhelms-Land. Gerüchten nach sollte es vielleicht bald Kolonie des Deutschen Kaiserreichs werden, aber noch war der Hunger nach Überseegebieten nicht groß genug. Baptiste hatte nur eine vage Vorstellung von dem Herkunftsland seines Vaters, doch es musste ein wahrer Wunderort sein, voller Menschen und Maschinen und technischer Neuerungen. Er hatte in Büchern von Dampfmaschinen gelesen, die sogar Wolle spinnen konnten, und die großen Frachtschiffe mit ihren stählernen Rümpfen mit eigenen Augen gesehen.
Seine eigene Welt kam ihm daher klein und rückständig vor, obwohl er nie eine andere besucht hatte.
Neben dem Platz für die trocknende Kopra gab es Unterstände aus Palmwedeln und dünnen Holzgestängen. Dort saßen die Frauen und Männer, die zu alt für die Plantagenarbeit waren. Sie spalteten die angelieferten Nüsse und kratzten das Fleisch heraus. Er grüßte im Vorbeireiten. Seine Mutter Naian war nicht dort, also lenkte er das Pferd zu ihrer Hütte. Sie stand in einem kleinen Garten, umgeben von gelblich blühenden Manioksträuchern, üppigen Bananenstauden sowie einer hoch aufragenden Papaya, und war ganz aus Holz. Die Wände bestanden aus dünnem Flechtwerk, das sich mit einigen Handgriffen entfernen ließ. In besonders heißen Nächten fiel auch der Sichtschutz, damit die Meeresbrise die Schlafenden kühlen konnte.
Baptistes Onkel hatte die Hütte gebaut, nachdem Mutter sich geweigert hatte, einen alten Witwer aus dem Nachbarort zu heiraten.
Wie immer erwachte in Baptistes Brust ein leises Ziehen, sobald er sich seinem alten Zuhause näherte. Der Geruch des Kochfeuers war vertraut, genau wie die Muster der Flechtwände.
Das stete Meeresrauschen übertönte die Hufgeräusche seines Pferdes, und so bemerkte Naian nicht, dass sie Besuch bekam. Sie saß im Schatten einiger Bananenstauden auf dem Boden und briet kleine Fische über einem Feuer aus Treibholz. Der Duft ließ Baptiste das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Er stieg ab und ging näher, dann hielt er wenige Schritt von ihr entfernt inne. Er würde gerne hier bei ihr wohnen, und doch respektierte er den Wunsch seines Vaters.
Vor vierzehn Jahren war er auf einer seiner Reisen um die Welt hergekommen und hatte dafür gesorgt, dass Baptiste nicht in der ärmlichen Siedlung, sondern bei Weißen auf einer Plantage aufwuchs. So war er als Mündel zu den Oudebooms gekommen. Es war eine Gelegenheit, die nur wenige Bastardkinder bekamen. Und er war seinem Vater dankbar.
Der Tag, an dem sie ihn weggebracht hatten, war dennoch ein immer wiederkehrender Albtraum, der ihn besonders in schwülen Vollmondnächten plagte. Als Kind hatte er nicht verstanden, warum sie ihn festhielten, warum seine Mama weinte und zugleich lächelte, als Vater ihn aufs Pferd hob. Von seinen starken Armen umfasst, ging der Ritt zur Plantage. Margarete und Ingmar Oudeboom waren zwei deutsche Auswanderer, deren Ehe kinderlos geblieben war. Sie erklärten sich bereit, Baptiste so zu erziehen, wie es sonst Weißen vorbehalten war. Er bekam einen eigenen Lehrer, Musik- und Reitunterricht. Dennoch zog ihn seine Seele immer wieder hierher, an genau diesen Ort. Als fließe in seinem Blut mehr von einer Papua als von einem Weißen.
„Habe ich doch gespürt, dass du da bist“, sagte Naian plötzlich und riss ihn aus seinen Gedanken.
Langsam wandte sie sich um, und ihre Miene war ganz Freude und Glück. Sie hatte ein rundliches Gesicht, obwohl sie eine kleine, zarte Frau war. Ihr Haar besaß noch immer den glänzend schwarzen Ton eines jungen Mädchens, und ihre Augen kannten kein Alter, besonders dann nicht, wenn ihr einziger Sohn zu Besuch kam.
„Woher wusstest du, dass ich hier bin?“, fragte Baptiste und ging zu ihr, um ihr einen Kuss auf die Wange zu geben.
„Großvater hat es mir verraten“, sagte sie leichthin.
„Das ist Unsinn, er ist schon seit elf Jahren tot.“
„Tot, aber nicht fort. Er wacht über uns, auch über dich, mein sturer Junge.“
Er verzog den Mund, mochte es nicht, wenn sie ihn noch immer einen Jungen nannte, obwohl er schon neunzehn Jahre alt war. Noch weniger mochte er es, wenn sie ihre Geistergeschichten erzählte. Das war Unsinn. Aber was wusste sie schon? Sie war nur einige Jahre zur Schule gegangen. Ihr Wissen war anderer Natur als seines, aber ebenso unerschöpflich wie das der Bücher im Lesezimmer der Plantage.
Er setzte sich im Schneidersitz neben sie. Auch im Sitzen überragte er sie noch um einen Kopf.
„Ich kann deinen Magen knurren hören“, sagte sie und sah ihn beinahe schon besorgt an. „Geben die feinen Leute dir nicht genug zu essen?“
„Mutter ...“ Baptiste seufzte. „Bis ich hier war, hatte ich gar keinen Hunger. Aber wenn ich dein Essen rieche, vergesse ich alles.“
„Ah … bist also doch noch mein Sohn.“
„Immer.“ Es würde sich nie etwas ändern zwischen ihnen. Nie. Auch wenn es vieles gab, was er gerne an ihr ändern würde. Zum Beispiel, dass sie nicht immer wie eine Wilde halbnackt herumlief. Auch jetzt trug sie über der bloßen Brust nur einige Ketten, ein Beutelchen mit einem kleinen Messer darin und eine Girlande aus weißen Blüten, die schon ein wenig welk waren, aber noch immer einen intensiven süßen Duft verströmten.
Um die Hüften trug sie einen Rock aus Pflanzenfasern. Sie hatte ihn selbst angefertigt, wie all ihre Kleidung. Mama weigerte sich fast immer, die Kleidung der Europäer zu tragen, außer wenn sie sich in der Mission etwas dazuverdiente. Ihrer Meinung nach war alles schmutzig und stank schnell. Von dem Waschmittel bekam sie auch noch Ausschlag.
Baptiste hielt das für Unsinn, an den sie nur glaubte, weil sie stur war. Doch diese Sturheit hatte er von ihr geerbt, und so redeten sie sich oft stundenlang die Köpfe heiß, ohne zu einem Ergebnis zu kommen.
Als sie ihm nun wortlos einen Bambusspieß mit einem gebratenen Fisch reichte, war an eine Diskussion oder gar Streit nicht mehr zu denken. Genussvoll zupfte er etwas von dem weichen Fleisch ab und schob es sich in den Mund. Es war saftig und scharf gewürzt.
Baptiste blickte hinaus aufs Meer, das unablässig neue Wellen an den Strand warf. Weit draußen waren Einbäume auszumachen, die zwischen den verstreuten bewaldeten Inseln klein wie Spielzeuge wirkten.
In diesem Moment konnte er sich nicht vorstellen, je von hier wegzugehen, dabei ersehnte er oft nichts anderes als genau das. Er wollte die Welt umsegeln, wie sein Vater, fremde Städte sehen und Länder, in denen es so kalt war, dass das Wasser gefroren vom Himmel fiel und man sich in die wärmsten Felle hüllen musste.
„Gehst du bald fischen?“, brach Naian das Schweigen, und er merkte erst jetzt, dass sie für sich selbst nur einen winzigen Fisch und ein paar Muscheln behalten hatte.
„Wenn das Wasser so warm ist, kommen die großen Fische nicht mehr nah genug in die Bucht.“
„Deshalb sind die anderen hinten bei der Schildkröteninsel.“ Dort gab es eine besondere Strömung, die kühleres Wasser nach oben trug und mit sich die großen Raubfische wie Thun und Bonito.
„Ich gehe noch heute und bringe dir alles!“, versprach er. „Hier, ich war doch nicht so hungrig.“
Er reichte ihr den halb aufgegessenen Fisch, und sie nahm ihn, ohne zu fragen. Sie wusste, dass er ihn geschafft hätte, aber Baptiste würde nachher in seinem anderen Zuhause noch einen gedeckten Tisch vorfinden.
„Es ist ein Frachtschiff gekommen, schon gestern“, sagte Mutter. Baptistes Herz tat einen aufgeregten Satz. „Gestern schon? Hat er … Gibt es einen Brief für mich?“
„Ach, Baptiste“, seufzte sie. „Nur weil dein Vater einmal hier war seit deiner Geburt, heißt es nicht, dass er ständig nur an seinen Bastardsohn in der Ferne denkt.“
„Sag so etwas nicht! Er hat mir geschrieben.“
„Vor zwei Jahren! Ich bin mir sicher, er hat noch andere Kinder, daheim von seiner Ehefrau, und dazu in jedem dritten Hafen eines. Deine Zukunft ist hier! Nicht da drin!“ Sie tippte ihm an die Schläfe. Er wich ihr zornig aus und war mit einem Satz auf den Beinen.
„Baptiste, ich habe es nicht so gemeint.“
„Ich geh fischen!“
„Baptiste!“
***