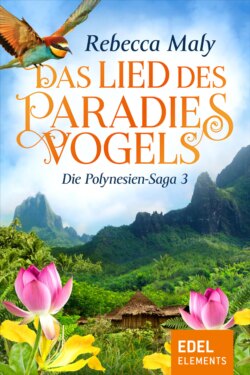Читать книгу Das Lied des Paradiesvogels 3 - Rebecca Maly - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 10
ОглавлениеEs war still, so still.
Das Fieber wütete noch immer in ihrem Körper, aber es war erträglich. Ein feuchtes Tuch kühlte ihre Stirn, Wind strich darüber.
Ob man mich an Deck gebracht hat?, überlegte Thea im Halbschlaf. Doch warum höre ich dann das Meer nicht? Und Wellen? Wo war die Wellenbewegung?
Nach und nach entkam sie dem Dämmerzustand, in dem das Fieber sie gefangen hielt. Sie öffnete die Augen, nur einen winzigen Spalt. Es war hell. Licht flutete durch ein Fenster herein, das den Blick auf einen diesig blauen Himmel frei gab. Weiß gekalkte Wände neben und über ihr. Als einzige Zierde hing ein Kreuz an der Wand. Der Jesus sah gemartert zu ihr herab, sein Körper verdreht und mit blutigen Wunden übersät. Thea wandte sich ab, schaute wieder zum Fenster hin.
Sie war nicht mehr auf dem Schiff, aber wo war sie dann? Ein Hospital? Neben ihrem Krankenlager stand ein Stuhl. Sicher hatte Daniel bis gerade eben dort ausgeharrt und würde gleich wieder zurück sein. Dann würde sie ihn fragen.
Erleichtert ließ sich Thea in die Kissen zurücksinken. Sie war sich sicher gewesen, auf dem Schiff sterben zu müssen, aber nun keimte wieder Hoffnung in ihr auf. In einem Hospital würde man ihr helfen können.
Wenn nur der Durst nicht so schlimm gewesen wäre. Gleich dort, auf einem kleinen Tischchen, standen ein schlichter Krug und daneben ein Glas. Das war ihre Erlösung. Sie würden warten, bis ihr jemand half.
Doch ihr Mund war so trocken. Der Durst wurde schier übermächtig. Als sie sich aufstützte, wurde ihr sofort schwindelig. Das dünne Tuch, mit dem sie zugedeckt war, schien sie regelrecht festzuhalten. Sie zerrte es zurück und schob vorsichtig ein Bein nach dem anderen über die Kante. Wieder drehte sich alles. Thea brauchte alle Kraft, um sitzen zu bleiben. Sie krallte ihre Hände in die Bettkante und sah an sich hinab. Ihre bloßen Beine waren nur noch halb so breit wie früher. Auch ihre Arme waren schmal geworden.
Wie lange war sie schon hier? Es war beängstigend, denn ihr fehlte jede Erinnerung daran, wie sie an diesen Ort gekommen war.
Durst.
Sie musste trinken, aber sie traute ihrem eigenen, fremd gewordenen Körper nicht mehr. Vorsichtig griff sie nach dem Glas und stieß es beinahe um. Es glich einem Kraftakt, ihrem zitternden Arm eine kontrollierte Bewegung abzuringen.
Dann endlich hatte sie es. Das Gefäß mit beiden Händen haltend, trank sie in winzigen Schlucken. Und auch das war anstrengend, aber es tat unendlich gut.
Sie fühlte sich gleich ein wenig besser, doch ihr Eindruck wurde Lügen gestraft, denn als sie das Glas wieder abstellen wollte, fiel es ihr auf halbem Wege aus der Hand.
Mit lautem Klirren zersprang es in zahllose Scherben.
Thea dachte nicht nach. Ihr erster Gedanke war, das Malheur zu beseitigen. Sie bückte sich nach einer großen Scherbe, und dann ging alles ganz schnell.
Schwindel überfiel sie, sie verlor den Halt, und im nächsten Augenblick fand sie sich auf dem Boden wieder. In ihrer Hand steckte eine Scherbe, und die Holzdielen unter ihr begannen zu schwanken, als sei sie erneut auf einem Schiff.
Schritte wurden laut, draußen rannte jemand. Die Tür wurde aufgestoßen, und ein großer Mann in einer langen Kutte kam herein. „Fräulein!“, rief er überrascht, dann war er auch schon bei ihr, fasste ihr beherzt unter die Arme und hob sie hoch.
Er setzte Thea auf die Bettkante und hielt sie stützend an den Schultern fest. „Geht es wieder?“
„Ja, danke, ich weiß auch nicht, wie … Ich war so durstig, es tut mir leid.“
„Das macht doch nichts.“ Er nahm ihre Hand und zog vorsichtig die Scherbe heraus. „Zum Glück nicht tief, aber wir müssen es trotzdem verbinden.“
„Wo ist mein Bruder, Daniel …“
„Ich bin Bruder Bernhard, Sie sind bei uns in guten Händen, Fräulein Klawitt.“ Der Mann hatte ein gutmütiges, rundliches Gesicht, das etwas zu breit für seinen schmalen Körper zu sein schien. Sein Haar war hell, fast weiß, die Haut gerötet statt gebräunt, wie es in diesen Breitengraden sonst üblich war.
„Sind Sie aus Bayern?“
„Man hört es mir also immer noch an“, meinte er und schmunzelte. „Ich hole Verbandsmaterial und bin gleich wieder zurück. Ich freue mich, dass Sie endlich auf dem Weg der Besserung sind, Fräulein Klawitt.“
Bevor sie etwas antworten konnte, war er schon aus dem Zimmer. Die Tür hatte er offen stehen lassen. Thea meinte, draußen Menschen vorbeigehen zu hören. Wahrscheinlich würde Daniel auch bald zurück sein.
Sie würde einfach nur warten. Das war anstrengend genug. Die Wunde in ihrer Handfläche tat kaum weh. Sie drückte sie mit einem Finger zu, damit das Blut nicht auf ihr Nachthemd tropfte. Es fühlte sich warm an, als habe ihr Blut mehr Fieber als sie selbst.
Wieder wanderte ihr Blick zum Fenster. Palmen bewegten ihre Wedel in einer sachten Brise. Auf den Blattspreiten turnten kleine Vögel herum.
„Schon zurück, junge Frau!“, ließ Bruder Bernhard verlauten.
Sie zuckte zusammen. „Haben Sie meinem Bruder Bescheid gegeben?“
Er schien einen Moment nachdenken zu müssen. „Noch nicht, Fräulein. Jetzt kümmern wir uns erst einmal um Ihre Hand, und dann gibt es etwas zu essen. Wie klingt das?“
„Ich habe keinen Hunger“, erwiderte sie.
„Aber Sie müssen etwas essen. Sie haben schon zehn Tage nichts zu sich genommen. Ihr Körper braucht Nahrung, wenn Sie gesund werden wollen, und das wollen Sie doch.“
„Zehn Tage?“, wiederholte Thea erstaunt. „Ich kann mich nicht erinnern.“
„So lange sind Sie schon hier. In den ersten Tagen sah es sehr schlecht aus. Sie hatten eine schwere Entzündung im Leib. Wir konnten Ihnen nur Kräutertränke verabreichen, hoffen, warten und beten. Aber Gott hat offenbar ein Einsehen gehabt und lässt Sie noch eine Weile auf Erden weilen.“
„Also werde ich wieder gesund?“ Auf gewisse Weise hatte sich Thea bereits damit abgefunden gehabt zu sterben. Dass sie noch eine Chance bekam, fand sie irritierend. Freude konnte sie in diesem Augenblick keine empfinden. Bruder Bernhard war unterdessen mit dem Verbinden ihrer Hand fertig geworden.
„Wo bin ich?“, wollte sie wissen.
„In der Mission des Heiligen Michael. Zu siebt sind wir vor einigen Jahren ausgezogen, um den Heiden Gottes Wort zu predigen.“
„Ich möchte mich waschen“, sagte Thea nur, die mit einem Mal glaubte, den Schweiß der vergangenen zehn Tage, die sie im Fieber verbracht hatte, als klebrige Schicht auf der Haut zu spüren.
„Natürlich, ich werde nach einer Frau schicken lassen, die Ihnen hilft.“
„Danke, aber geben Sie bitte auch meinem Bruder Bescheid, er wird sicher ungeduldig auf eine Nachricht warten.“
Der Mönch faltete die Hände vor der Brust. Sein gerötetes Gesicht verlor die Farbe. „Ich weiß nicht recht, wie ich es Ihnen schonend beibringen soll, Fräulein. Gerne hätte ich damit noch gewartet …“
Thea durchlief ein eisiger Schauer. „Ist er tot? Ist Daniel etwas zugestoßen? Sagen Sie es mir!“ Die letzten Worte hatte sie regelrecht geschrien. Nun rang sie nach Atem.
„Tot, nein, Gott bewahre. Er wird wiederkommen. Nur nicht heute oder morgen. Er hat versprochen, dass die Nordstern auf dem Rückweg noch einmal hier Halt machen wird.“
In Thea zerbrach etwas. Plötzlich hatte sie keine Kraft mehr. Sie sank zurück auf ihr Kissen. Der Mönch hob ihre Beine auf das Bett und deckte sie zu. Erst als er das Zimmer verlassen hatte, begann Thea zu weinen.
Unzertrennlich. Von wegen unzertrennlich. In so einer Situation hätte sie Daniel niemals allein gelassen. Besonders dann nicht, wenn er mit dem Tode rang.
Und nun war sie allein. In irgendeiner Missionsstation am Ende der Welt. Sie weinte, bis sie selbst dafür zu erschöpft war. Dann fiel sie in einen unruhigen Schlaf voller Albträume.
***
Port Moresby war die größte Stadt, die Baptiste je gesehen hatte. Seit seinem letzten Besuch vor fast sechs Jahren war sie noch weiter angewachsen. Erst vor Kurzem war sie zur Hauptstadt des Britischen Kolonialgebietes British New Guinea erklärt worden, was ihr zu weiterem Aufschwung verholfen hatte.
Der Hafen war weitläufig, mit mehreren Kais und einem eigenen Trockendock. Dutzende Warenhäuser reihten sich aneinander. Es gab ein stetes Kommen und Gehen. Große Frachtschiffe wechselten sich mit Fischerbooten und kleinen Schaluppen ab. Baptiste und Baku hatten eine Weile suchen müssen, um einen freien Anlegeplatz zu finden, und mussten für jeden Tag, den sie dort lagen, eine Gebühr an den Hafenmeister entrichten.
Es war leicht gewesen, die verirrte Fracht der Oudebooms zu finden. Hier wurde alles gründlich aufgeschrieben und in Listen notiert. Auch für die Lagerzeit fielen Gebühren an.
Nachdem all das erledigt war, sahen sie sich die Stadt an. Es gab Steinhäuser und richtige Straßen, auf denen sich Kutschen und Karren drängten.
Baku blieb nach jedem dritten Schritt staunend stehen und wies auf eine neue Sensation, die seine Aufmerksamkeit erregte. Das konnte alles sein: eine bestickte Fahne, der vergoldete Äskulapstab über einer Apotheke, ein besonders auffallendes Kleid oder schöne Pferde. Für ihn musste der Ort noch viel wundersamer sein als für Baptiste, der in den Büchern der Mission und auf Fotografien der Oudebooms bereits Städte gesehen hatte.
Er fasste seinen Freund dann regelmäßig am Arm und zog ihn weiter. Nach einigen Rundgängen waren sie sich beide einig, dass Port Moresby zwar ein beeindruckender Ort war, sie ihre kleine Siedlung aber vorzogen. Dort stank es nicht, man musste nicht ständig darauf achten, dass man niemandem vor die Füße lief, und den wenigen Menschen, die man nicht mochte, konnte man leicht aus dem Weg gehen.
Am letzten Tag nahm sich Baptiste die Bitte seiner Ziehmutter zu Herzen und machte sich auf die Suche nach einem Schneider. Doch zuerst kehrte er bei einem Barbier ein. Der Mann verstand kein Wort Deutsch, und mit seiner Muttersprache versuchte er es gar nicht erst. So verließ er den Laden umweht von einer Fahne aus Rasierschaum und Pomade. Sein Haar war nun kurz und lag in leichten Wellen am Kopf, die Wangen waren so glatt rasiert wie wohl noch nie in seinem Leben.
Der Gehilfe des Barbiers, ein dünner Junge von vielleicht zwölf Jahren, der die ganze Zeit über nichts anderes tat, als Haare zusammenzufegen, hatte ihm die Adresse eines deutschen Schneiders genannt.
Auf dem Weg dorthin kam Baptiste sich ein wenig fremd vor. Verstohlen musterte er sein Spiegelbild in den Fensterscheiben eines Geschäfts. Er sah beinahe aus wie ein Herr. Nur die zu kurzen Hosen, die um seine schmalen Beine schlackerten, störten das Bild. Vor zwei Jahren hatten sie noch gepasst. Er musste noch ein Stück gewachsen sein und hatte es nicht bemerkt.
Schließlich fand er das Geschäft. Franzen stand oben auf dem Schild und darunter Tailor / Schneider.
Baptiste trat ein, und eine helle Glocke ertönte. Im Inneren stand ein breiter Tresen, hinter dem sich in Regalen erlesene Stoffe stapelten. Gleich neben der Tür war ein weiteres Regal, hier lagen die einfacheren Gewebe.
Er musste nicht lange warten, bis ein kleiner Mann mit Backenbart aus dem Hinterzimmer trat und ihn von oben bis unten musterte, als nehme er bereits Maß. Er trug einen perfekt sitzenden Anzug nach neuester Mode. Um seinen Hals baumelten ein Bandmaß und eine Brille.
„Guten Tag, Herr Franzen“, sagte Baptiste. „Sie wurden mir empfohlen.“
„Oh, meine Muttersprache aus Ihrem Mund zu hören ist eine Überraschung, eine angenehme, Herr …?“
„Baptiste“, sagte er schnell und zögerte dann. Nach wem sollte er sich nennen? Schließlich gab er sich einen Ruck. „Baptiste Oudeboom.“
„Oudeboom? Sieh an, sieh an. Sie sehen nicht aus wie ein Oudeboom, wenn ich das sagen darf.“
Er verkniff sich eine bissige Erwiderung. Bislang hatte alles so gut geklappt, seit sie in der Stadt angekommen waren, hatte niemand seine Autorität infrage gestellt, nur weil seine Haut dunkler war. Aber jetzt kam ihm der Verdacht, dass dies dem Umstand geschuldet war, dass sie ihn für den Dienstmann eines Plantagenbesitzers gehalten hatten.
„Tut das was zur Sache?“, fragte er so ruhig wie möglich.
Der Mann verzog den Mund zu einem falschen Lächeln. „Selbstverständlich nicht, Herr Oudeboom.“ Er zog den Nachnamen in die Länge, als habe er einen miesen Beigeschmack.
„Ich brauche zwei schlichte Garnituren und eine bessere.“
„Eine bessere, wie Sie wünschen. Das wird Sie nicht wenig kosten, Herr Oudeboom. Bei mir können Sie nicht anschreiben lassen wie in einem Krämerladen.“
„Das habe ich auch nicht vor. Ist mein Geld schlechter als das eines weißen Mannes?“
Franzen trat von einem Bein auf das andere, als müsse er darüber nachdenken. Schließlich wurde es Baptiste zu bunt. Wenn er seiner Ziehmutter nicht versprochen hätte, sich ordentlich einzukleiden, dann wäre er spätestens jetzt aus der Schneiderei gestürmt. Stattdessen hatte er tief durchgeatmet und dem Mann sein Geld gezeigt.
„Ah, der junge Herr ist vermögend“, sagte Franzen mit spöttischem Unterton und schob sich die Brille auf die Nase. „Na, dann wollen wir mal.“
In den folgenden Stunden musste Baptiste abwechselnd auf einem kleinen Podest stehen und in die Knie gehen, während der Schneider maß, korrigierte, Nähte auftrennte und wieder neu zusammenfügte.
Dazwischen blieb viel zu viel Zeit, die der Schneider mit Gesprächen füllen wollte. „Dass Sie so gut Deutsch sprechen“, sagte er immer wieder und schüttelte den Kopf.
Irgendwann reichte es Baptiste. „Unsere Siedlung liegt im Protektoratsgebiet der Neuguinea-Kompagnie, außerdem bin ich in einer Mission in die Schule gegangen. Die Mönche sind fast alle aus Bayern.“ Die Oudebooms erwähnte er nicht. Es ging niemanden etwas an, wessen Kind er war oder in wessen Haus er die letzten Jahre verbracht hatte.
„Und Sie sind durch die Jagd auf Vögel zu Geld gekommen, nicht wahr? Die Modewelt drüben muss ganz verrückt nach den bunten Federchen sein.“
Baptiste antwortete einsilbig, bis Franzen schließlich schweigend weiterarbeitete.
Als schließlich der Abend dämmerte, überreichte Baptiste dem Schneider fast sein gesamtes Geld und ging mit einem Paket maßgeschneiderter Kleidung, darunter sogar vier Hemden, zum Boot.
Zwischenzeitlich war er sich wie ein völlig anderer vorgekommen. In dem dunklen Anzug mit passender Weste sah er aus wie ein richtiger Herr. Wenn er je seinem leiblichen Vater gegenübertreten musste, dann würde er es in diesem Anzug tun. Schämen musste er sich dann nicht mehr, oder?
Vielleicht würde er dann endlich einen Nachnamen erhalten, mit dem er sich vorstellen konnte, statt den der Oudebooms zu borgen. Es hatte sich wie eine Lüge angefühlt, und das war es ja auch.
Baku erwartete ihn bereits. Der Spott über sein neues Äußeres, mit dem er eigentlich gerechnet hatte, blieb aus. Sein Freund musterte ihn nur einmal und nickte, als habe sich etwas bestätigt, das er längst vermutet hatte.
„Ich muss schnell raus aus diesen Sachen“, sagte Baptiste.
„Ja, und dann lass uns von hier verschwinden, Bruder“, meinte Baku irgendwie gehetzt. „Dieser Ort, er ist nicht gut für das Herz. Die Ahnen hören uns hier nicht.“
Baptiste hatte dem nichts hinzuzufügen. Sie verluden alles auf ihren Segler. Es war bereits sehr dunkel, als sie schließlich aus dem Hafen hinausruderten. Nach den ruhigen Tagen tat es gut, sich anzustrengen. Sie ruderten so schnell, als sei der Teufel hinter ihnen her. Bald brannten ihre Muskeln, und sie mussten über ihre überstürzte Flucht lachen.
Im Licht des aufgehenden Mondes steuerten sie das Boot die Küste entlang bis zu einer kleinen, einladenden Bucht. Die Lichter der Stadt verschwanden hinter dichten Mangroven und einem kleinen Felsbuckel. Sie ankerten zwischen Korallenbänken. Baptiste legte sich auf den Bauch und sah hinab in die Welt der Fische, Anemonen und Krebse. Dort unten glühten nun auch kleine Lichter. Schlanke grüne Pfeile schossen umher, und etwas bewegte sich rötlich pulsierend über den Grund.
„Morgen früh tauche ich als Erstes da runter und fange uns etwas zu essen. Ich kann den Fraß aus Port Moresby nicht mehr sehen.“
Baku lachte. „Die Würste waren aber nicht schlecht.“
Baptiste gab ihm einen Stoß gegen die Schulter, und sein Freund ließ sich einfach nach hinten fallen.
Auf dem Rücken liegend sahen sie gemeinsam zum Mond hinauf, der als Sichel über das Firmament zog. „Baku?“
„Hmm?“
„Oudebooms wollen am Fluss ein Sägewerk errichten.“
„Ist das gut?“
„Ich weiß es nicht. Sie werden den Wald abholzen. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, die großen Bäume stehen zu lassen. Ich wünschte, sie würden sich mit den Ältesten der Siedlung beraten, aber das werden sie nicht.“
Baku seufzte und faltete die Hände über der Brust. „Du weißt, wie ich darüber denke. Es ist das Land unserer Ahnen, unserer Familien.“
„Oudebooms haben Papiere, in denen anderes steht. Es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt.“
„Wir vielleicht nicht, aber du.“
„Ich? Ja, vielleicht.“
„Du wirst einen Weg finden, mein Freund, und nun lass uns schlafen.“
Baptiste wünschte, er hätte so viel Zuversicht wie Baku.
In dieser Nacht lag er wach und überlegte, wie er eine Lösung finden konnte, die für alle gut war. Wenn Oudebooms ihn tatsächlich zu ihrem Nachfolger bestimmten, könnte er das Schicksal des Waldes vielleicht wenden. Aber bis dahin würde noch viel Zeit vergehen, und womöglich war dann nicht mehr viel da, das sich retten ließ.
***
Thea war erschöpft von all dem Weinen. Daniels Verrat schmerzte so sehr. Sie einfach zum Sterben hierzulassen, wie konnte er nur?
Als es schließlich an der Tür klopfte, hatte sie keine Tränen mehr. Sie fühlte sich völlig leer, und auf ihrer Brust schien ein Stein zu liegen.
Eine kleine Frau trat ein, mit warmbrauner Haut und schwarzem krausen Haar, das sie zu einem strammen Zopf zusammengefasst hatte. Sie war in einen schlichten Leinenkittel gekleidet und trug einen Eimer mit dampfendem Wasser und Handtücher mit sich. Zögernd trat sie näher.
„Fräulein, ich soll helfen?“, fragte sie.
„Ja, bitte, ich bin so schwach. Ich bin Thea.“
„Man nennt mich Naian.“
„Vielen Dank für Ihre Hilfe, Naian“, sagte Thea, weil sie nicht unhöflich sein wollte. Eigentlich hätte sie am liebsten kein einziges Wort gesagt und keinen Menschen gesehen, aber sie brauchte wirklich Hilfe.
Naian schien ein Gespür dafür zu haben, wie sie sich fühlte, und so gab sie ihr erst zu trinken und half ihr danach, sich zu waschen. Auch das Haar seifte sie ihr ein und rieb es danach sanft trocken.
Zum Anziehen bekam Thea ein schlichtes, ungefärbtes Leinengewand, wie die Frau selbst eines trug.
Glocken läuteten. Kurz darauf wurde an die Tür geklopft. Naian nahm einen kleinen Tontopf und einen Kanten Brot entgegen. Der säuerliche, warme Duft des Graubrots weckte nun doch Theas Lebensgeister.
Sie drückte den Kanten an ihre Nase. „Echtes Brot, ach, wie habe ich das vermisst.“ Auf dem Schiff hatte es oft nur Zwieback gegeben, nachdem der Sauerteigansatz auf der Hälfte der Fahrt verdorben war. In dem Topf war eine kräftige Rindfleischbrühe.
Thea aß vorsichtig von beidem, während Naian sie stützte. Viel bekam sie nicht herunter.
„Gut, sehr gut“, lobte ihre Helferin dennoch und strich ihr über den Kopf, wie ihre Mutter das früher oft getan hatte.
Langsam, ganz langsam überlagerte Zorn ihre Enttäuschung.
Ich werde leben, dachte sie, und wenn es nur deshalb war, um Daniel die Meinung zu sagen. Damit er sich für seinen miesen Verrat schämte.
Zwischen ihnen würde es nie wieder so sein wie früher.
In den nächsten Tagen schwand das Fieber. Thea schlief viel und aß wenig. Dennoch ging es ihr ganz allmählich besser. Am vierten Tag konnte sie mit Naians Hilfe aufstehen und ein Stückchen gehen. „Können wir an die frische Luft, nach draußen?“ Naian führte sie durch einen Flur in einen Kreuzgang, der um einen Kräutergarten herum angelegt war, bis zu einer kleinen Terrasse.
Die Sonne war gleißend hell. Geblendet ließ sich Thea zu einer Bank führen und rieb sich die Augen. Der Ausblick raubte ihr den Atem. Offenbar war die Mission auf einer kleinen Kuppe erbaut. Von der Terrasse aus konnte sie auf eine weite Bucht hinabsehen. Das Wasser schillerte in Blau- und Türkistönen. Unter den sachten Wellen zeichneten sich Flecken und Muster ab, wo die Korallen fast bis zur Oberfläche hinaufragten. Schlanke Kanus dümpelten auf dem Wasser. Am weiten Strand spielten Kinder, und Frauen bereiteten an kleinen Kochfeuern Essen zu.
Es gab Palmen und blühende Bäume, unter denen einfache Häuser errichtet waren. Sie standen auf Stelzen, sodass sich das Leben nicht nur auf, sondern auch unter ihnen abspielte.
In Theas Brust erwuchs eine seltsame Liebe zu diesem Ort, den sie doch eigentlich gar nicht kannte. Es war, als sei sie angekommen. Bei ihrer Sehnsucht, in die Fremde zu gehen, hatte sie wohl von so einem Ort geträumt. Und nun gab es ihn wirklich.
„Leben Sie dort, Naian?“
„Ja, das ist mein Haus, sehen Sie, das ganz am Rand“, erklärte ihr Naian und zeigte in die Richtung.
Thea seufzte. „Ich würde Sie gerne einmal dort besuchen.“
„Jederzeit, Fräulein Thea“, erwiderte sie.
„Danke. Und ich wünschte, mein Bruder hätte sich meiner nicht nur einfach hier entledigt, sondern mir eine Fotokamera dagelassen.“
„Ich weiß zwar nicht, wie so etwas aussieht, aber mit Ihnen wurden drei Seekisten hergebracht. Die heiligen Männer bewachen sie.“
„Die heiligen Männer?“ Damit meinte sie wohl die Mönche. Schlagartig war sie wieder etwas mit Daniel versöhnt. Sie zweifelte nicht am Inhalt der Seekisten. Ihre Kleidung passte vollständig in eine, demnach mussten die anderen ihre Ausrüstung enthalten. Also hatte er doch nicht mit ihrem Tod gerechnet. „Bringen Sie mich zu den Kisten, Naian. Sofort!“
***