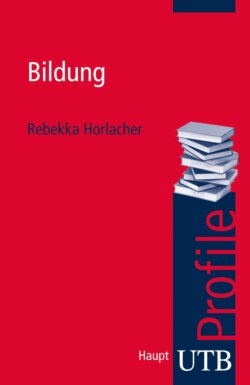Читать книгу Bildung - Rebekka Horlacher - Страница 7
ОглавлениеWarum Bildung?
Sind wir noch das Volk der Dichter und Denker? ist der Titel zweier unterschiedlicher Publikationen, die im Jahre 1964 in Hamburg und 2004 in Heidelberg erschienen sind. Die Wahl des Titels weist auf ein bestimmtes kulturelles Selbstverständnis, das Geist, Kultur und Kunst als zentrale Aspekte der eigenen Identität begreift. Der Titel beansprucht keine Originalität, lehnt er sich doch an ein von Madame de Staël geprägtes Diktum an, das aus in ihrem 1813 in London erschienenen Buch De l’Allemagne stammt. Die französische Schriftstellerin und Salonière bezeichnete darin – das Buch war eigentlich schon 1810 erschienen, aber sogleich von der Zensur verboten worden – die Deutschen als «Peuple des poètes et penseurs», was von ihr durchaus polemisch gemeint war: Das tiefsinnige und geistig-poetische Deutschland wurde dem verkommenen Frankreich Napoleons als Vorbild entgegengesetzt.
In den 1960er-Jahren griff der Hessische Rundfunk diese Frage auf und stellte sie bei 14 Personen des öffentlichen Lebens, Philologen, Philosophen, Soziologen und Schriftstellern zur Diskussion, die sich in kürzeren oder längeren Abhandlungen dazu äußerten. Die Absicht dahinter war, einen Slogan zu entmystifizieren, der zwar vordergründig schmeichelhaft sei, so der Herausgeber in der Einleitung, in Wahrheit aber das Verhältnis zur eigenen Geschichte und zur eigenen Tradition verstelle und damit Einsicht im Sinne von Selbsterkenntnis verhindere. Die Vorstellung, ein industrialisiertes, technisiertes und sich im Aufbruch befindliches Land werde von einer Gruppe von schöngeistigen Literaten geführt, sei ohnehin eine eher beängstigende Vorstellung. Die Absicht des Herausgebers war es deshalb auch, die in der Wissenschaft schon stattgefundene Aufarbeitung der Verklärung der eigenen Vergangenheit einem breiteren Publikum bekannt zu machen um auf dieser Basis – wahrhaft aufgeklärt – «zukunftsfähig» zu werden.
Anders sieht die Ausgangslage bei der neueren Publikation aus dem Jahre 2004 aus. Standen im ersten Buch der Aufbruch der OECD und die Anpassung an ihre Forderungen nach mehr Investitionen in die Bildungssysteme im Vordergrund, präsentiert sich die 2004- Publikation als Gegenreaktion auf PISA als Flaggschiff der OECD. Diesem Buch liegt eine Vortragsreihe an der Universität Heidelberg zugrunde, die im Anschluss an die Publikation der Ergebnisse der PISA-Studie 2001 sowie des internationalen Hochschulrankings konzipiert worden war. Die Studie und das Ranking hätten in Deutschland im Stil einer «Katastrophenmeldung» eingeschlagen, so die Herausgeber in der Einleitung, und das Selbstverständnis Vieler infrage gestellt, da die deutsche Schule nach wie vor als Ort der Bildung gelte. Der Titel wird hier nicht als Mythos verstanden, der dekonstruiert werden soll, sondern eher als normative Leitlinie, der unter geänderten gesellschaftlichen Voraussetzungen immer noch zu folgen sei. Die «Aufklärung» in den 1960er-Jahren scheint demnach höchstens partiell erfolgreich gewesen zu sein, da der damit verbundene Mythos – Deutschland als Ort, in dem Bildung möglich ist – immer noch dominant ist. Zudem wird er auch als stark genug angesehen, um auf eine als Krise empfundene Situation reagieren zu können und den eigenen (bildungs-)politischen Lösungsvorschlägen Bedeutung zu verleihen.
Was ist Bildung?
Die Übereinstimmung der beiden Titel mag Zufall sein, verweist aber gerade deswegen auch auf ein Phänomen, das genauer analysiert werden muss, da damit ein bestimmtes kulturelles Selbstverständnis – Bildung – zum Ausdruck kommt. Mit dem Begriff Bildung wird in der Regel auf etwas hingewiesen, das die Begriffe Erziehung, Sozialisation und Unterricht nicht vollumfänglich beschreiben (können). Bildung bezeichnet in diesem Verständnis das Ziel eines gelingenden Lebens, wobei sich Bildung im Verlauf dieses gelingenden Lebens immer mehr vervollkommnet. Mit Bildung wird ein nicht-quantifizierbarer «Mehrwert» beschrieben, der zwar an der Schule oder an der Universität stattfinden und damit durchaus institutionell abgesichert sein kann, der aber ebenso als flüchtig, unsicher und undefinierbar erscheint. «Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn alles vergessen wurde, was man gelernt hat», ist denn auch ein beliebtes Bonmot, um zu umschreiben, was mit Bildung gemeint ist. Doch ungeachtet dessen, dass dieses Bonmot nicht wirklich dabei hilft, irgendeine Unklarheit in Bezug auf Bildung zu beseitigen, besitzt der Begriff eine nicht nachlassende Anziehungskraft, fehlt das Stichwort Bildung doch in keinem einschlägigen Wörterbuch, Lexikon oder Einführungswerk für Studienanfänger der Erziehungswissenschaft, ja es erscheinen sogar Bücher, die ausschließlich auf diesen Begriff setzen.
Mit dem Bildungsbegriff werden aber nicht nur bestimmte Aspekte der erzieherischen und schulischen Praxis bezeichnet, er findet auch in der öffentlichen und in der wissenschaftlichen Debatte Verwendung: Die Bildungstheorie gilt als Teilgebiet der Allgemeinen Pädagogik und kennt eigene Professuren mit dieser Denomination. Der Begriff Bildung ist aber auch in der empirischen Bildungsforschung sowie in der Bildungsverwaltung enthalten. Privatschulen werben mit dem Begriff für ihr Angebot und Bildung ist ein politisches Thema, wenn es darum geht zu klären, wer wie viel wofür zu bezahlen hat und ob es zumutbar und im Sinne der Chancengleichheit verträglich sei, ein Hochschulstudium teilweise über Studiengebühren zu finanzieren.
Bildung ist zudem in der Rhetorik der internationalen und globalisierten Ökonomie zu einem unverzichtbaren Bestandteil geworden und wird als Rohstoff für arme Länder angepriesen. Die Entwicklung der Ressource Bildung ermöglicht ökonomisches Wachstum und damit Wohlstand, so die Überzeugung der Weltbank aber auch vieler anderer global tätiger Organisationen. Damit wird Bildung als Möglichkeit gesehen, die ökonomischen Unterschiede in einer globalisierten Welt zu verkleinern und Wohlstand breiter zu verteilen, womit auch die Hoffnung verbunden ist, dass kein Land den Anschluss an die Wissensgesellschaft verliert. Der Begriff Bildung und die damit verbundenen Überzeugungen werden so zu einer Chiffre, die den Einstieg in eine bessere Zukunft verspricht.
Aber was ist Bildung? Wie entsteht Bildung und woher kommt der Begriff? Wer hat Bildung erfunden und wie kam es dazu, dass Bildung diese prominente Stellung im Reden über Erziehung einnehmen konnte und zu einem der Grundbegriffe der Pädagogik geworden ist, zumindest im deutschsprachigen Raum?
Bildung hat, so die These, die hier im Weiteren verfolgt werden soll, vielfältige Wurzeln in den religiösen und philosophischen Diskussionen im politischen und gesellschaftlich-kulturellen Kontext des 18. Jahrhunderts. Die Kulturgeschichte Englands erweist sich dabei als besonders wirkungsmächtig, durchlebte die englische Gesellschaft doch im 17. Jahrhundert einschneidende politische und soziale Veränderungen. Diese fanden ihren Niederschlag in Publikationen, welche in einem interessanten Transformationsprozess in Deutschland anschlussfähig wurden. Im Zentrum dieser Publikationen stand das Konzept der Politeness, das im deutschen Sprachraum große Beachtung fand (Kapitel 1). Diese verschiedenen Ansätze und Anregungen wurden gegen Ende des 18. Jahrhunderts systematisiert und fanden Eingang in die pädagogische Diskussion (Kapitel 2). Gleichzeitig wurde Bildung aber auch durch die damals dominanten kulturellen Ansprüche, Vorstellungen und Erwartungen zu einem Unterscheidungsmerkmal im Kontext der nationalen Identitätsfindung. Diese Verbindung prägt das Reden über Bildung bis heute (Kapitel 3). Im 19. Jahrhundert wurde der Begriff zudem zu einer Möglichkeit der sozialen Unterscheidung und brachte mit dem «Bildungsbürger» einen eigenen «Stand» hervor, wobei diese Entwicklung auch Kritik hervorrief (Kapitel 4). Der Bildungsbegriff spielte im 19. Jahrhundert aber auch disziplinpolitisch eine große Rolle, da darauf Bezug genommen wurde, um die Geisteswissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften zu profilieren.
Die Erziehungswissenschaft nutzte dieses Angebot und entwickelte mit der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik ein wissenschaftliches Selbstverständnis, das den Bildungsbegriff in Rückgriff auf die Diskussionen um 1800 zu einem ihrer Grundpfeiler machte (Kapitel 5). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Bildungsbegriff «kritisch». Damit ist seine Verwendung im Rahmen der Kritischen Theorie angesprochen, die – wiederum auf die Debatten um 1800 zurückgreifend – Bildung von den historischen Verfälschungen reinigen wollte und in diesem Bildungsbegriff eine Möglichkeit sah, eine bessere – im Sinne einer gerechteren und demokratischen – Gesellschaft zu generieren (Kapitel 6). An der Wende zum 21. Jahrhundert erlebt der Bildungsbegriff erneut ein Revival. Mit dem Begriff der Bildung wird diesmal gegen die Ökonomisierung der Welt argumentiert, aber auch konservative Erziehungsvorstellungen vertreten (Kapitel 7). Dabei zeigt sich, dass der Begriff immer dann intensiv diskutiert bzw. politisch aufgeladen verwendet wird, wenn es darum geht, Lösungen für eine als Krise empfundene Situation zu formulieren.
Vor diesem Hintergrund soll Bildung hier nicht als Begriff endgültig geklärt, definiert und systematisch beschrieben werden, sondern es geht darum zu zeigen, wie und in welchen Kontexten er weshalb und wie verwendet wurde. Damit können die impliziten Erwartungen und Ideen, die mit dem Bildungsbegriff verbunden sind, sichtbar gemacht werden. Es wird zu zeigen sein, dass sich mit dem Begriff «Bildung» Vorstellungen von Innerlichkeit und Selbstbildung verbinden, dass er als ästhetisches Ideal gilt und dass er sowohl unpolitisch im Sinne einer Abgrenzung von der Gesellschaft als auch als politischer Kampfbegriff verwendet werden kann. Damit zeigt sich auch die große Anpassungsfähigkeit dieses Begriffes, der sich damit als perfektes Beispiel dafür erweist, was der britische Erziehungsphilosoph Israel Scheffler in seinem 1960 erschienenen Buch The Language of Education als «pädagogischen Slogan» bezeichnet hat.
Diese Einführung konzentriert sich – bedingt durch die Geschichte des Begriffs – auf die deutschsprachige Diskussion, die wesentlich von Deutschland bestimmt wurde. Eine Ausnahme bilden die Diskussionen im 18. Jahrhundert, da hier die europäische Herkunft des Bildungsbegriffs nachgezeichnet wird, die von der deutschsprachigen Entwicklung genutzt wurde, um den Bildungsbegriff in expliziter Abgrenzung dazu als eigenen Begriff neu zu definieren. Eine weitere Ausnahme ist auch das siebte Kapitel, das sich mit der zeitgenössischen Verwendung des Bildungsbegriffs befasst. Sowohl in der englischen als auch in der skandinavischen Philosophy of Education lassen sich nämlich Bemühungen finden, Bildung als Konzept für die eigene Theoriediskussion fruchtbar zu machen. Bildung ist aber auch im spanischen Kontext zu einem Begriff geworden, und auch hier zeigt sich, dass mit dem Begriff der Bildung Politik betrieben werden kann.
Bildung hat in der deutsch(sprachig)en Diskussion offenbar das Potenzial, sich verschiedenen historischen, sozialen und kulturellen Kontexten anzupassen, ohne dadurch seine Bedeutungs- und Strahlkraft einzubüßen. Die Stärke von Bildung dürfte wohl gerade in dieser Wandelbarkeit, Offenheit oder Beliebigkeit liegen. Zudem scheint mit den Versuchen, Bildung in der postmodernen Gesellschaft als Konzept zu formulieren, das als Citizenship Education den Menschen befähigt, vernünftig, selbst bestimmt und verantwortlich in einer komplexen Gesellschaft zu agieren, auch der Sprung ins 21. Jahrhundert zu gelingen.
Literatur
Ehrenpreis, Stefan (2010): Schule und Bildung im vormodernen Rheinland. Überlegungen zur Periodisierung und regionalen Vernetzung. In: Andreas Rutz (Hg.): Das Rheinland als Schul- und Bildungslandschaft (1250 – 1750). Köln: Böhlau, S. 295 – 325
Koselleck, Reinhart (1990): Einleitung – Zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bildung. In: Reinhart Koselleck (Hg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil II: Bildungsgüter und Bildungswissen. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 11 – 46
Manhart, Sebastian (2009): Der Preis der Freiheit. Bildung, Wissen, Organisation. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 29, H. 1, S. 80 – 96