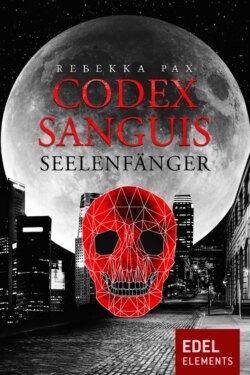Читать книгу Codex Sanguis – Seelenfänger - Rebekka Pax - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1
ОглавлениеJulius
Es war April und einer der wenigen Regentage, die L.A. im Jahr zu bieten hat. Die Tropfen fielen so dicht, dass man kaum seine eigene Hand vor Augen erkennen konnte.
Ich genoss den Regen. Das Wasser wusch all den Staub und Dreck davon, und schon jetzt roch die Luft sauberer, fast rein.
Brandon, Christina und ich drängten uns auf der kleinen Veranda eines Bungalows in der besseren Wohngegend von Pasadena. Wir sahen aus wie ganz normale Besucher: Zwei Männer und die einzige Tochter des Hauses warteten darauf, dass ihnen geöffnet wurde. Christinas Elternhaus fiel zwischen den anderen nicht auf. Der weiß gestrichene Holzbau war von einem liebevoll gepflegten Garten umgeben. Im Rasen nahe dem Bürgersteig steckte ein Schild, das potenzielle Einbrecher vor wachsamen Nachbarn warnte. Es war genau die Sorte von Vorstadtidylle, die mich anwiderte: bieder, gläubig und fest in republikanischer Hand. Eines der wenigen Viertel L.A.s, in denen Trump die Mehrheit geholt hatte. Ich hob den Blick zu einer überdimensionierten Flagge, die vom Regen durchweicht wurde, und schob die Hände in die Hosentaschen.
Ich war noch nie hier gewesen und bereute diesen Ausflug schon jetzt. Denn wenn Christinas Eltern genauso waren wie die Nachbarschaft, dann war er vollkommen sinnlos. Aber wie sollte ich einer Freundin die Bitte um Beistand ausschlagen, besonders, wo doch ich verantwortlich für die Misere war, in der sie sich befand?
„Bist du sicher, dass du das wirklich tun willst?“, fragte ich Christina noch einmal.
Sie nickte mit zusammengepressten Lippen, so heftig, dass ihre dunklen Haare auf und ab wippten. Für eine Latina war sie ungewöhnlich blass, seitdem ich sie vor einem halben Jahr zu einer von uns gemacht hatte, um ihr das Leben zu retten.
Statt wie nach einer Verwandlung üblich ihren eigenen Tod vorzutäuschen, bestand Christina darauf, ihren Eltern die Wahrheit zu sagen. Deshalb waren wir nun hier.
Seit sie eine Unsterbliche war, hatte sie ihre streng katholische Familie gemieden, doch inzwischen waren ihr die Ausreden ausgegangen.
„Wenn du das durchziehen möchtest, solltest du klingeln“, brummte Brandon.
Er kannte die Eltern seiner Freundin seit Langem, da Chris vor ihrem Tod seine Geliebte und Dienerin gewesen war. Eine engere Bindung als diese konnten Mensch und Vampir nicht eingehen.
Ich selbst war daran gescheitert, ein solches Band zu knüpfen. Bei dem Gedanken breitete sich ein dumpfer Schmerz hinter meinem Brustbein aus. Amber hatte mich verlassen, weil sie nicht ertragen konnte, was ich war.
Während ich versuchte, mir das lästige Pochen aus der Brust zu reiben, starrte Chris noch immer den Klingelknopf an, als sei er ein gefährliches Ungeheuer. Genug. Ich schob die Hand an ihr vorbei und schellte.
Schon bald waren Schritte zu hören. Christina nahm Reißaus und versteckte sich hinter Brandon und mir. „Vielleicht ist das Ganze doch keine so gute Idee gewesen“, flüsterte sie.
Doch es war zu spät: Die Tür wurde geöffnet und heraus schaute das Gesicht einer freundlichen, etwas rundlichen Mexikanerin. Bodenständig sah sie aus, ganz anders als die zierliche, aber durchsetzungsfähige junge Frau, die Chris vor der Verwandlung gewesen war. Derzeit war sie wie viele Neuerschaffene noch unsicher und unterwürfig, doch das würde sich mit der Zeit geben.
„Christina! Und Brandon, wie schön, dass du mitgekommen bist“, sagte Mrs Reyes freudig, gab aber zuerst mir die Hand. „Und Sie müssen der gute Freund sein, von dem meine Tochter so oft gesprochen hat.“
„Julius Lawhead“, stellte ich mich vor.
Die Augen der Hausherrin hingen bereits an Christina, die halb von mir verdeckt wurde. Mit dem untrüglichen Gefühl einer Mutter erkannte sie sofort, dass etwas mit ihrer Tochter nicht stimmte. „Chris, komm her, willst du deiner Mama nicht Hallo sagen?“ Sie breitete die Arme aus. „Mein Gott, bist du blass, niña, fehlt dir etwas?“
Christina trat näher, doch sie konnte die Schwelle ihres einstigen Elternhauses nicht überqueren, ohne hineingebeten zu werden. Sie wollte zu ihrer Mutter, doch ohne eine Einladung hätte sich ihre eigene Aura gegen sie gewendet und ihren Körper zerschnitten wie scharfes Glas.
Wenn der Zustand lange genug anhielt, konnte er tödlich enden. Tränen traten ihr in die Augen. Ihre Angst schmeckte metallisch, kalt.
„Dürfen Chris und ich reinkommen?“, fragte ich schnell.
„Aber natürlich“, antwortete Mrs Reyes verwirrt.
Brandon stand bereits im Flur. Er hatte die Einladung schon vor Jahren erhalten, und sie würde bis zu dem Tag gelten, an dem sie jemand widerrief.
Während Christina ihrer Mutter in die Arme fiel, folgte ich Brandon durch den Flur ins Wohnzimmer, wo wir Chris’ Großmutter überraschten, die auf dem Sofa eingenickt war.
Ich hatte schon viele Geschichten über Mama Reyes gehört. Sie war angeblich in der Lage, Geister zu sehen, und empfing, selbstverständlich mit der Hilfe Gottes und diverser Heiliger, Botschaften aus dem Jenseits. Als sie jetzt aufschrak und mich aus trüben Augen ansah, glaubte ich mit einem Schlag jedes Wort, das ich über sie gehört hatte. Gleich einem unsichtbaren zweiten Körper schwebte Macht über ihrem kleinen, abgemagerten Leib. Mehr Macht, als sie womöglich ahnte.
„Wer sind Sie? Was tun Sie da?!“, schimpfte sie empört und stieß die Wolldecke zu Boden, die bislang auf ihren Knien gelegen hatte.
Ich drehte mich um und sah, wie Brandon zwei Kreuze von der Wand pflückte. Ich beschloss, es mit der Wahrheit zu versuchen. „Wir sind Freunde von Christina. Sie hat sich verändert und kann den Anblick solcher Gegenstände im Moment nicht ertragen.“
Die alte Frau bekreuzigte sich hektisch, und ihre Lippen bewegten sich in einem stummen Gebet.
Brandon legte die Kreuze auf den Sessel, schob ein plüschiges Kissen darüber und ging zu der alten Dame hinüber. Er streckte ihr die Rechte entgegen. „Guten Abend, Mama Reyes.“
Verdattert gab sie ihm die Hand. „Brandon, du bist das! Jetzt erkenne ich dich erst. Was ist hier nur los?“
„Das wird Christina Ihnen gleich erklären, kein Grund zur Sorge.“ Er nutzte die Macht seiner Stimme, um die alte Dame zu beruhigen. Sie vertraute ihm, das machte es einfacher für ihn.
„Wo ist Fredo?“, fragte er, sobald sich Christinas Großmutter vom ersten Schrecken erholt hatte, und lenkte ihre Aufmerksamkeit damit geschickt auf etwas anderes.
„Besorgungen machen“, antwortete sie und ließ sich von Brandon helfen, der die Decke aufhob und wieder über ihre Knie legte.
Fredo, so erriet ich, war Christinas Vater.
Ich setzte mich auf die Sesselkante vor das Kissen, unter dem die Kreuze lagen, und schirmte sie so mit meinem Körper ab. Über mich als Ungläubigen hatten christliche Symbole keine Macht. Ich spürte lediglich ein lauwarmes magisches Strahlen in meinem Rücken.
Brandon setzte sich ebenfalls und warf mir einen zweifelnden Blick zu, dann warteten wir alle auf Chris.
Als sie schließlich kam, hielt sie ihre Mutter an der Hand. Mrs Reyes’ Blick fiel sofort auf die Stellen an der Wand, an denen die abgenommenen Kreuze helle Schatten hinterlassen hatten.
Kurz erstarrte sie, dann flüchtete sie sich in die Banalität, indem sie fragte: „Möchten Sie etwas trinken?“
„Nein danke“, antworteten wir im Chor.
„Mi niña, willst du mich nicht begrüßen?“
Christina schluckte und ging mit steifen Schritten zu ihrer Großmutter. Der Geschmack ihrer Angst hing zäh in der Luft. Jedem, der auch nur das geringste Talent für Übernatürliches besaß, hätten spätestens jetzt die Haare zu Berge gestanden. Die greise Mexikanerin enttäuschte uns leider nicht. Sie legte ihre faltigen, mit Altersflecken übersäten Hände an die Wangen ihrer Enkelin und starrte in deren Augen, als könnte sie in ihrer Seele lesen. Erschrocken fuhr sie zurück und rang mit einem kleinen Japsen nach Luft.
Chris stolperte fort und flüchtete sich in Brandons Arme.
„Chris“, mahnte ich leise, als ihre Verwandten sie verwundert anstarrten. Ihr Rücken versteifte sich, dann drehte sie sich gehorsam um.
„Wie lange warst du nicht mehr bei der Beichte?“, fragte Mama Reyes in die Stille hinein. Sie hatte ihren Blick keinen Moment von ihrer Enkelin gewendet und beobachtete auch uns aufmerksam.
„Ein halbes Jahr“, stotterte Christina. „Es tut mir leid.“
Das Schweigen, das darauf folgte, schien sich endlos hinzuziehen. Leider war ich ratlos, wie man so ein Gespräch am besten begann. Nachdem ich verwandelt worden war, hatten meine Eltern nur einen Abschiedsbrief gefunden.
Ein Schlüssel wurde im Schloss gedreht und schreckte uns alle auf. Christinas Vater kam herein. Er war klein und im Gegensatz zu seiner Frau hager. Die Selbstverständlichkeit, mit der er Autorität ausstrahlte, erinnerte mich an Curtis. Mr Reyes trug Hemd und Sakko, als sei er direkt aus dem Büro seiner kleinen Importfirma gekommen.
Seine Frau und auch seine Mutter schienen wie selbstverständlich zu erwarten, dass er nun das Reden übernahm.
Nach einem kurzen Blick in die Runde und einer prüfenden Musterung seiner Tochter begrüßte er uns wortkarg und setzte sich, nachdem er jedem von uns ein Glas Rotwein eingegossen hatte. Ich nippte einen winzigen Tropfen und ließ die köstliche Flüssigkeit durch meinen Mund gleiten. Brandon tat es mir nach, aber Christina war noch zu jung, um dieses etwas schmerzhafte Experiment zu wagen.
Falls Fredo Reyes das Fehlen der Kruzifixe bemerkt hatte, ließ er sich nichts anmerken.
„Wir sind heute hergekommen, weil Christina Ihnen etwas sagen möchte“, eröffnete Brandon das Gespräch.
Plötzlich waren alle Augen auf ihn gerichtet. Mrs Reyes lächelte selig und tätschelte ihrem Mann die Hand. Sofort war alles Ungewöhnliche vergessen. Doch wenn sie auf eine Verlobung hoffte, würde sie gleich bitter enttäuscht werden.
Brandon rieb seiner Freundin den Rücken, und Christina richtete sich auf. „Vor … vor einem halben Jahr ist etwas passiert, Mama“, begann sie mit zitternder Stimme. „Ich habe euch nicht mehr besucht, weil ich mich verändert habe. Die alte Christina ist tot.“
In diesem Moment ließ sie die Magie, die sie wie einen normalen Menschen aussehen ließ, mit einem Schlag von sich abfallen.
Dann hob sie den Kopf und sah mit dunklen Augen in die Runde, Augen, in denen jetzt ein tödliches Feuer loderte.
„Ich bin ein Vampir geworden, Mama!“
So direkt hätte ich es nicht ausgedrückt. Die Reaktion war dementsprechend. Die Großmutter bekreuzigte sich, und dem Vater stieg die Röte ins Gesicht. „Unsinn“, sagte er mit fester Stimme. „So etwas gibt es nicht.“
Nur Chris’ Großmutter begriff sofort. „Es ist wahr! María, Santa Señora, hilf uns“, wimmerte sie.
Mrs Reyes starrte sie stumm vor Schrecken an. Die Großmutter genoss großes Ansehen, ihr Wort wurde nicht infrage gestellt.
„Meister, bitte“, flehte Christina. Ich nickte und gab Brandon ebenfalls die Erlaubnis. Auch wir zeigten nun unsere wirkliche Gestalt: Todesblässe, scharfe Reißzähne und Raubtieraugen, die bei jedem starken Gefühl heller oder dunkler wurden.
„Es stimmt, was Christina sagt. Wir sind Vampire, alle drei, wie wir hier sitzen. Aber Sie müssen keine Angst vor uns haben“, erklärte ich ruhig.
Mr Reyes riss ein Kreuz hervor, das er bis zu diesem Zeitpunkt an einer Kette um seinen Hals getragen hatte, und hielt es in meine Richtung.
Es reagierte auf Christinas Glauben und begann, aus eigener Kraft schwach zu leuchten. Chris schrie vor Schmerzen markerschütternd auf und versteckte ihren Kopf an Brandons Brust. Er schirmte ihren Blick mit beiden Händen ab und bleckte unwillkürlich die Zähne in Richtung des Kreuzes.
„Brandon!“, warnte ich. Er senkte den Blick, und die tödliche Spannung, die den Raum für einen Moment beherrscht hatte, verschwand. Jetzt war es an mir, die Wogen zu glätten.
Vater Reyes reckte mir noch immer das Kreuz entgegen, als hätte er zu oft Der Exorzist gesehen. Der Rest der Familie schien gebannt darauf zu warten, dass ich mich in Rauch auflöste oder zumindest dämonisches Gekreisch ausstieß. Doch ich tat nichts dergleichen.
„Stecken Sie bitte das Kreuz weg, Mr Reyes. Sehen Sie denn nicht, dass Sie Ihrer Tochter wehtun?“, fragte ich ruhig, doch der Mann war wie versteinert.
„Papa, Papa, bitte“, wimmerte Christina, ohne hinzusehen. Ich musste dieser lächerlichen Szene ein Ende bereiten. Es sah nicht so aus, als würde Fredo Reyes mit sich reden lassen, und ich bekam zum ersten Mal eine Ahnung, woher Chris ihren Starrsinn hatte. Ich beugte mich vor und löste das Kruzifix vorsichtig aus den verkrampften Fingern des Mannes. Unter den erstaunten Blicken der Sterblichen schloss ich meine Faust darum, streifte Mr Reyes die Kette vom Hals und es geschah – nichts.
„Es ist weg, Chris.“
Sie sah sich zögernd um und strich sich die Haare aus dem blassen, verschwitzten Gesicht. Für einen Augenblick sah sie aus wie eine Sterbenskranke, nach der der Tod bereits seine Hand ausgestreckt hatte.
„Warum“, klagte die Mutter, „warum nur?“
„Ich wäre sonst gestorben, Mama. Wäre dir das lieber gewesen?“
„Aber deine Seele, niña, deine Seele“, schluchzte Mrs Reyes.
„Wir sind keine Ungeheuer oder Dämonen. Christina hat ihre Seele noch“, mischte ich mich ein. „Sie kehrt jeden Abend nach Sonnenuntergang in ihren Körper zurück.“
„Und am Tag?“, fragte ihr Vater, der noch immer wie paralysiert auf meine Faust starrte, in der das Kreuz verborgen lag.
„Sind wir tot und die Seelen fort“, antwortete ich nüchtern. Ich hielt die ganze Nummer, Chris’ Eltern die Wahrheit zu sagen, für einen gewaltigen Fehler. Unsere Existenz war ein jahrhundertealtes Geheimnis, und jetzt saßen wir hier und posaunten es in die Welt, nur weil es heutzutage von den meisten als Spinnerei abgetan wurde und leichter zu vertuschen war.
„Ich kann das nicht glauben, das ist doch alles großer Unsinn!“, dröhnte Fredo Reyes.
Christina starrte ihren Vater an, hob ihren Arm zum Mund und biss ohne Vorwarnung hinein. Die Mutter schrie, als sie das Blut sah, sprang auf und lief zu ihrer Tochter, um ein Taschentuch auf die Wunde zu pressen.
Chris schob die helfenden Hände zur Seite, wischte das Blut ab, und wir alle wurden Zeugen, wie sich die Wunde binnen Sekunden schloss. Diese Art von Schocktherapie war überzeugend.
Großmutter Reyes war nun vollständig in ihre Muttersprache verfallen und betete auf Spanisch, aber Worte konnten Christina nicht wehtun, und so beachtete ich die alte Dame nicht weiter.
„Wer war das, wer hat dir das angetan?“, fragte Mrs Reyes ihre Tochter mit bebender Stimme. Ihr erster Blick fiel auf Brandon. Zuneigung war zu bitterem Hass geworden. „All die Jahre haben wir dich in unserer Familie willkommen geheißen, und du, du …“ Sie war kurz davor, sich auf ihn zu stürzen.
„Ich habe es getan“, sagte ich ruhig. „Ich habe sie auf unsere Seite geholt.“
Köpfe fuhren herum. Alle starrten mich an.
„Warum?“, fragte der Vater nur.
„Christina ist angeschossen worden. Kein Arzt hätte sie mehr retten können. Auch ich würde sie lieber unter den Sterblichen sehen, aber das Schicksal hat anders entschieden. Brandon und Ihre Tochter baten mich darum. Ich habe diesem Wunsch entsprochen, obwohl ich mir geschworen hatte, niemals einen Menschen zu verwandeln.“
„Haben Sie Brandon das Gleiche angetan?“, fragte Frau Reyes und legte ihrer Tochter vorsichtig eine Hand auf die Schulter.
„Ich bin 106 Jahre alt“, antwortete er, bevor ich verneinen konnte. „Ich wurde von jemand anderem zu dem gemacht, der ich bin. Christina wird für immer jung bleiben, wie ich, wie Julius. Sie wird niemals alt, niemals krank.“
„Dios mío, hilf unserem armen Kind“, sagte die Mutter und bekreuzigte sich.
Christina zuckte zusammen. „Mama, hör auf damit, bitte.“
„Warum können Sie ein Kreuz in den Händen halten, und meine arme Tochter fürchtet das Zeichen unseres Herrn?“, fragte mich Mr Reyes, der scheinbar ein wenig an Fassung zurückgewonnen hatte.
„Christina ist gläubig, deshalb bereitet es ihr Schmerzen. Ich bin Atheist, mir können Ihre heiligen Zeichen nichts anhaben. Verteufeln Sie uns nicht, es gibt viele fromme, christliche Vampire.“ Ich gab mir Mühe, geduldig zu bleiben und alles zu erklären, doch Mr Reyes’ Gesichtsausdruck verhieß nichts Gutes.
„Kreaturen des Satans! Das ist es, was ihr seid. Der Satan hat mir meine Tochter gestohlen“, spuckte er uns entgegen.
Christina fing sofort wieder an zu weinen.
Hier war nichts mehr zu retten. Ich stand auf. „Es ist besser, wenn wir gehen“, sagte ich. „Los, verschwinden wir. Jetzt!“
Brandon zog seine Freundin auf die Beine. Während er sie zur Tür führte, blieb ich bei den aufgebrachten Eltern stehen. „Tun Sie Chris das nicht an“, bat ich, „verstoßen Sie nicht Ihre eigene Tochter.“
Als Mr Reyes auf die Tür zeigte, ahnte ich, was als Nächstes kommen würde. „Raus!“, schrie er.
Die Luft verdichtete sich mit einem Schlag, und im gleichen Moment kam der Schmerz. Es fühlte sich an, als würde sich eine unsichtbare Hand um mich legen und mit aller Kraft zudrücken. Meine Aura zersprang in tausend Splitter, die mich zu zerfetzen schienen.
„Fort aus meinem Haus!“, wiederholte Mr Reyes, ohne zu ahnen, welch eine Wirkung diese Worte auf mich hatten. Die Pein potenzierte sich und ließ mich straucheln. Ich rannte die wenigen Schritte, als sei der Teufel hinter mir her, und überholte Chris und Brandon kurz vor der Tür.
Erst als ich von der Veranda sprang, ließ der heftige Schmerz nach. Erlösender Regen kühlte meine brennende Haut. Von meiner linken Hand tropfte Blut aus einem Schnitt, und auch auf meinem Rücken mischte sich eine warme Flüssigkeit mit dem Regen.
Brandon ließ Christina stehen und eilte zu mir. „Sehr schlimm?“
Ich schüttelte den Kopf, konnte noch nicht sprechen.
„Du blutest“, sagte er und berührte meinen Arm.
„Scheiße“, fluchte ich leise und mit viel Gefühl, drückte den Rücken durch und sah mich um. Christina stand auf dem Rasen vor dem Haus und weinte. „Es tut mir leid, Meister. Ich habe gedacht, sie … er …“
Ihre Eltern beobachteten uns derweil durch den Schutz gardinenverhangener Fenster. Besser, wir verschwanden, bevor sich Fredo Reyes daran erinnerte, dass er noch irgendwo eine Schrotflinte versteckt hatte.
In einem kurzen Anflug von Zorn trat ich ein Trump-Schild um, das im Rasen steckte. Hier waren wir fertig. Wir hätten nie herkommen sollen. Ich legte Christina einen Arm um die Schulter. „Fahren wir nach Hause.“
Brandon schlang ihr seinen Arm von der anderen Seite um die Taille, dann stapften wir durch den Regen, zurück zu Brandons mattschwarzem 77er Firebird, mit dem wir gekommen waren.
***
Im Verborgenen …
Blut rann stetig wie eine glitzernde Perlenschnur vom Tisch und tropfte in eine gelbe Plastikschüssel auf dem Boden. Die Männer arbeiteten schweigend, einzig begleitet vom schmatzenden Geräusch der Messer, die durch Fleisch schnitten, und dem gleichmäßigen Rhythmus der Tropfen, die in die Schüssel fielen.
Von einem Brett starrte der Kopf eines Mannes aus toten Augen. Seine im Todeskampf verzerrten Lippen entblößten vier scharfe Reißzähne.
Die Hände des Vampirs lagen sorgfältig abgetrennt daneben, die Füße nur ein Stückchen weiter.
Die Männer sahen auf. Die Frau kam. Schritte und das leise Klirren zahlloser Glasfläschchen kündigten sie an. Sie schwieg ebenso wie ihre Komplizen. Lautlos hockte sie sich neben den Tisch zur fast vollen Schüssel und begann mit ihrer Arbeit.
Sie benutzte eine Soßenkelle und einen kleinen Trichter, um die Fläschchen mit Blut zu befüllen. Dabei ging sie so geschickt vor, dass kaum ein Tropfen verloren ging.
„Wann bringen sie den Nächsten?“, fragte die Frau.
„Morgen.“ Der Mann sah nicht von seinem blutigen Handwerk auf. Routiniert wie ein Metzger, der die Anatomie seiner Schlachttiere aufs Genauste kennt, löste er den entfleischten Oberarm von den letzten Sehnen und legte ihn auf einen Stapel rosig schimmernder Knochen. Der Mann hielt inne, wetzte sein Messer und seufzte.
Der Rumpf war noch vollständig, sie hatten viel zu tun.
***
Julius
Fast eine Stunde nach dem übereilten Aufbruch aus Pasadena erreichten wir unser Haus. Direkt gegenüber der Eingangstür erhob sich die meterhohe Außenmauer des Hollywood Forever Cemetery, der jahrzehntelang meine Heimat gewesen war.
Jetzt lebte ich in einem gewöhnlichen Haus nebenan. Die beiden Orte waren nur einen Katzensprung und doch Welten voneinander entfernt, die Mauer trennte grünes Paradies und graue Tristesse voneinander.
Brandon parkte neben einer dürren Palme, die ihre drei überlebenden Wedel in den schwachen Wind reckte. Alles in dieser Straße wirkte abweisend.
Den Platz vor unserer Garage nahm ein großer Schuttcontainer in Beschlag, der sich täglich mit mehr Erde füllte. Arbeiter gruben Tunnel unter dem Haus und eine zweite Schlafkammer direkt unter dem Friedhof.
Der hohe, blickdichte Holzzaun, mit dem ich das Grundstück hatte umgeben lassen, stank noch immer nach Farbe.
Es war keine schöne Gegend, aber aller Anfang ist schwer, wie man so schön sagt.
Das kleine Revier in Hollywood, das mir mein Meister vor vielen Jahrzehnten zugewiesen hatte, musste jetzt für drei reichen.
Brandon schloss die Tür auf. Als wir den Hausflur betraten und ich den Brief sah, der auf der Kommode stand, sank meine Stimmung. Das geprägte Wappen war unverkennbar. Der aufgerichtete Löwe war das Zeichen von Fürst Andrassy, dem mit Abstand ältesten und mächtigsten Unsterblichen von Los Angeles. Nicht einmal mein Schöpfer konnte ihm eine Bitte ausschlagen, geschweige denn einen Befehl, wie ihn dieser Brief mit Sicherheit enthielt. Ich hatte meine Pflicht zu tun.
„Ich muss noch einmal weg“, sagte ich.
Auch Brandon wusste den Brief sofort einzuordnen. „Ich hol dir deine Tasche“, sagte er, während ich den Umschlag aufriss.
Vor mir lag die Kopie eines eiligen Gerichtsurteils. Es ging um die Todesstrafe für einen neugeborenen Vampir, durchzuführen von mir, und das möglichst noch heute.
Seit Monaten war ich der einzige Jäger von ganz L.A. und würde es auch so lange bleiben, bis der Neue seine Ausbildung bei mir abgeschlossen hatte. Was hoffentlich bald der Fall sein würde, denn seit einer Weile wurde die Stadt von einer wahren Plage an Neugeborenen heimgesucht: So gut wie jede Nacht musste ich meinem blutigen Handwerk nachgehen. Doch wer den Nachwuchs erschuf, hatte der Rat bislang noch nicht herausfinden können.
Brandon kam mit dem Lederkoffer zurück, in dem ich das Werkzeug für meine blutige Arbeit aufbewahrte. Er stellte ihn auf die Kommode und sah mich abwartend an, dann glitt sein Blick an mir vorbei zu Christina.
Sie stand wie ein Häufchen Elend in der Ecke und streifte sich langsam die Schuhe von den Hacken. Es war geschehen, was wir alle insgeheim erwartet hatten: Sie war von ihrer Familie verstoßen worden. Aber sie konnte nicht verstehen – wollte nicht. Der Schock war noch zu frisch.
Doch wir hatten jetzt keine Zeit mehr dafür. „Chris, kommst du alleine klar? Ich benötige bei dieser Sache Brandons Hilfe.“
„Geht nur, ich schau ein bisschen fern.“ Sie nickte mir müde zu und hauchte Brandon einen Kuss auf die Wange. Ihn hatte ich nicht gefragt. Ich brauchte Brandon, also würde er mich begleiten. Manchmal machten klare Hierarchien die Dinge einfacher.
Brandon war mein Freund, mein bester, einziger, aber er war zugleich auch mein Gefolgsmann und hatte mir Treue geschworen, wenn es sein musste, bis in den Tod.
Dem Schicksal hatte es gefallen, unsere Schwüre auf die Probe zu stellen, und wir hatten den Test beide bestanden. Seitdem herrschte stilles Einvernehmen. Die Zeit des Streitens war vorbei. Ich musste keine Stärke mehr beweisen, er keine Demut, und doch waren unsere Positionen klar. Ich war der Meister, er schwurgebunden. Dennoch fühlte er sich in meiner Gefolgschaft so frei wie nie, das hatte er mir erst kürzlich anvertraut.
Da mein Oberhemd nass und nach dem Rauswurf aus dem Haus der Reyes für immer durch Blutflecke ruiniert war, nahm ich ein frisches Shirt aus dem Schrank, der wie so viele Möbel provisorisch in der Diele stand, und zog mich eilig um. Das verdreckte Hemd warf ich einfach in die Ecke. Dann verkündete ich: „Ich bin so weit.“
„Wohin?“, fragte Brandon auf dem Weg nach draußen. Er trug meine Tasche und öffnete mir die Tür.
„Zu Andrassy.“
Die Residenz des Fürsten in den Hügeln von Malibu war zugleich oberster Gerichtsort, Gefängnis und Zuflucht für die Vampire der Clans, die sich auf verschiedene Stadtteile und Reviere verteilten.
Die Fahrt dorthin dauerte um diese Uhrzeit nur etwas länger als eine halbe Stunde. Brandon saß wieder am Steuer. Genau wie ich war er diesen Weg schon oft gefahren.
Es regnete noch immer. Die Straßen glänzten festlich in diesem seltenen Kleid. Tropfen prasselten laut auf das Autodach und gaben uns das Gefühl, in einer Zeitkapsel zu sitzen, abgeschnitten vom Rest der Welt.
In den letzten Monaten hatte ich viel Zeit mit Brandon verbracht. Er brauchte oft jemanden zum Reden. Seiner Freundin wollte er nichts von seinen Albträumen erzählen. Vielleicht hatte er Angst, dass sie ihn mit anderen Augen betrachten würde, wenn sie erfuhr, was ihm sein alter Meister Nathaniel Coe angetan hatte, als er ihn im vergangenen Winter für kurze Zeit noch einmal in seine Gewalt bekam.
Wenngleich Brandon äußerlich normal wirkte, lag seine Seele in Trümmern. Durch den indianischen Sonnentanz, den er durchgeführt hatte, nachdem Coe ihn entführt, gefoltert und vergewaltigt hatte, war er zwar so weit geheilt, dass er wieder funktionierte, aber eine Seele zu heilen, dauert oft länger als ein Menschenleben.
Wir verließen L.A.s Lichtermeer und tauchten in eine hügelige, nachtgrüne Küstenlandschaft. Bislang war kein einziges Wort zwischen uns gefallen. Brandon brach das Schweigen als Erster.
„Du hast gesagt, du brauchst mich. Wofür?“, fragte er mit weicher, tiefer Stimme und sah mich an. Diese Tonlage benutzte er, wenn er freundlich erscheinen wollte, passiv.
Ich wusste sofort, dass ihm etwas Angst machte. Der falsche Klang seiner Worte verriet ihn.
Ich seufzte. „Der verwilderte Vampir stammt wieder aus dem Revier, das Kerí Arany übernehmen soll, sobald seine Ausbildung abgeschlossen ist. Ich habe keine Lust mehr, seine Hinrichtungen für ihn zu erledigen, wenngleich wir das Geld brauchen können. Kerí ist heute Nacht da. Ich will ihm zeigen, wie man es macht, aber ich möchte, dass du den Verurteilten betäubst, damit ich mich ganz auf meinen Schüler konzentrieren kann.“
Brandon nickte erleichtert. „Das kann ich tun.“
Vor uns schälte sich ein großes Eisentor aus der Nacht und öffnete sich. Wir fuhren über einen Kiesweg den Hügel hinauf zu Fürst Andrassys Wohnsitz. Der Bau unterschied sich deutlich von den Villen der Filmstars und anderer Neureicher, die sich hier und da an die Hänge schmiegten und den Stil europäischer Herrenhäuser nur kopierten. Andrassys Wohnsitz hingegen sah aus, als hätte man eines der alten Anwesen einfach hierhertransportiert und wiederaufgebaut. Nichts wirkte unecht oder neu.
Hundert Jahre alte, armdicke Weinreben rankten über ein Tor aus Backstein. Im geometrisch angelegten Innenhof erwarteten uns kunstvoll gestaltete Gärten mit Buchsbaumhecken und Rosenbeeten.
„Ich fühle mich hier immer schäbig“, sagte Brandon. In seinen Augen glitzerten die Lichter der Laternen, während er den Wagen fast ehrfürchtig über den leise knisternden Kies lenkte. Ich zuckte mit den Schultern, mir ging es da nicht anders als ihm.
Wir hielten direkt vor der Freitreppe, stiegen aus, und Brandon reichte einem livrierten Diener den Schlüssel zu seinem alten Pontiac.
Jeder hier kannte mich und wusste, weshalb ich kam. Ein stattlicher Kerl von Andrassys ungarischer Wachmannschaft ging voraus und führte uns zu den Verliesen.
Nachdem wir einige marmorgeschmückte Flure durchschritten hatten, wurden die Dekorationen karger und die verschlossenen Türen häufiger.
Brandon ging wie ein großer, schweigender Schatten an meiner Seite. Diesen Teil des Gebäudes hatte er noch nie mit eigenen Augen gesehen, denn öffentliche Hinrichtungen fanden direkt im Gerichtssaal statt. Was ich jetzt zu tun hatte, war aber nicht mehr als eine Aktennotiz. Jemand hatte einen Menschen verwandelt und ihn dann seinem Schicksal überlassen, traurig, aber keine Seltenheit. Der Weg eines solchen Wesens war vorprogrammiert. Niemand lehrte sie zu jagen, niemand zügelte ihren Hunger. Die jungen Vampire wurden Opfer ihrer eigenen Gier, verloren den Verstand, töteten und landeten über kurz oder lang in meinen Händen. Meist schon nach ihrer ersten Nacht.
Wir stiegen eine lange Treppe hinunter. Ein schwacher Wind kroch die Stufen hinauf. Er roch nach Angst, Hunger und Tod. Der muffige, fast metallische Geschmack setzte sich in Nase und Hals fest, als habe er einen eigenen Willen. Grelle Leuchtstoffröhren erwachten flackernd zum Leben und erhellten einen weiten, rechteckigen Raum, von dem ein knappes Dutzend eiserner Türen abging. Brandon sah sich blinzelnd um.
Der Wächter wies auf eine Tür, die sich durch nichts von den anderen unterschied. „Er ist da drin.“
„Wir bereiten ihn vor. Rufen Sie bitte Kerí Arany her, wir warten auf ihn.“
Der Wachmann nickte nur und eilte die Treppe hinauf. Dem Rhythmus seiner Schritte war zu entnehmen, dass er es nicht erwarten konnte, dem Keller zu entfliehen.
Nachdem die Tür am Treppenende geräuschvoll ins Schloss gefallen war, öffneten sich meine Ohren für die Laute, die die Gefangenen von sich gaben: Schritte, Schluchzen, leises Weinen.
Brandon drehte sich um die eigene Achse. Die Verliese mussten ihn an seine eigene Gefangenschaft erinnern, die nur wenige Monate zurücklag. Als ich zu ihm trat und ihm eine Hand auf die Schulter legte, zuckte er unter meiner Berührung zusammen.
„Entschuldige, Julius, ich bin ein totales Wrack“, sagte er bitter und presste zwei Finger gegen die Augen, als wollte er Gedankenbilder vertreiben, die von ihm Besitz ergriffen hatten.
„Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dich nicht mitnehmen sollen, so kurz nach …“
„Es geht schon wieder“, sagte er schnell und straffte die Schultern. Dann fragte er, nun wieder ganz Herr seiner selbst: „Wie soll die Hinrichtung ablaufen?“
„Im Urteil steht nichts über die Art des Todes. Ich kann also frei wählen. Kerí ist gut mit dem Schwert, deswegen nehmen wir den Pflock, damit braucht er noch Übung.“
Ich schob eine Bahre mit daran befestigten Lederriemen aus einer Nische in die Mitte des Raums. Brandon stand still da, beobachtete mich und sog die grauenhafte Atmosphäre des Gewölbes auf wie ein Schwamm.
Wäre ich alleine gekommen und hätte ich nicht einen Henker-Lehrling unterrichten müssen, wäre ich einfach in die Zelle hineingegangen und hätte den Verurteilten enthauptet.
Die Bahre quietschte. Das Geräusch hallte durch den hohen Raum, und plötzlich schrie jemand: „Lawhead ist hier!“
Ein anderer nahm den Ruf auf. „Der Tod ist gekommen!“
„Ruhe!“, rief ich und unterstrich den Befehl mit Totenmagie.
Ein Gefangener schrie gepeinigt auf, dann nichts mehr.
„Was jetzt?“ Brandon rieb sich fröstelnd die Arme. Die absolute Stille, die sich fast greifbar gegen die Zellentüren presste, war noch unangenehmer als die leisen Geräusche der Gefangenen zuvor.
„Ich hole ihn raus.“
Zwei Schlüssel hingen am Rahmen, einer für die Tür und einer für die Fesseln des Verurteilten. Ich öffnete die Zelle und schaltete das Licht ein.
Der Anblick, der sich mir bot, überraschte mich nicht. Das, was da vor mir auf dem Boden kauerte, war weder Mensch noch Vampir. Aus einem blutverklebten Gesicht starrten mich zwei riesige, helle Augen an.
Ich schätzte den Mann auf Anfang vierzig. Sein Haar war kurz geschnitten, die Finger verrieten, dass er noch kurz vor seiner Verwandlung bei der Maniküre gewesen sein musste.
„Was wollen Sie von mir, wo bin ich überhaupt?“ Das frische Blut an seinem Kinn ließ nur einen Schluss zu: Der Mord, der ihn hinter Gitter gebracht hatte, war erst heute Abend geschehen. Jemand musste ihn auf frischer Tat ertappt haben.
Ich sah dem neugeborenen Vampir in die Augen und löschte die letzten eigenen Gedanken seines kurzen Lebens.
„Komm!“ Nur dieses eine Wort.
Der Mann stand unter meiner Führung auf. Mit langsamen Schritten, den Blick immer auf meine Augen gerichtet, folgte er mir aus der Zelle bis zu der Bahre. Mit der Linken schob ich die Gurte zur Seite. Der Verurteilte setzte sich ohne Zögern und legte sich auf sein letztes Bett.
Brandon starrte uns an. Sein Blick sprang von meinem Gefangenen zu mir, dem Henker. „Aber er kann doch gar nichts dafür!“
„Du weißt, dass immer so vorgegangen wird“, sagte ich. „Wir können ihn nicht so herumlaufen lassen, er wird wieder töten, jede Nacht. Wer soll sich um die ganzen Verwilderten kümmern? Vor allem jetzt, wo wir fast jede Nacht einen haben? Du vielleicht?“
„Nein, natürlich nicht.“ Brandon schüttelte den Kopf und drehte mir den Rücken zu. „Ich hoffe nur, sie finden das Schwein, das ihm das angetan hat.“
„Ich werde es versuchen, Bran, aber du weißt, dass seinen Schöpfer nicht mehr als eine Geldstrafe erwartet.“ Verwilderte Vampire bedeuteten eine Gefahr für uns, da sie unsere Entdeckung wahrscheinlicher machten. Deswegen erhielt der Täter durch seinen Clanherrn üblicherweise eine weitere, weitaus schwerere Strafe, was manchmal sogar den Tod bedeuten konnte. Aber etwas ließ mich zweifeln, dass wir es hier mit einem Vampir zu tun hatten, der einem Clan angehörte.
Ich hielt den jungen Vampir noch immer im Bann, während ich einen Gurt nach dem anderen festzurrte.
„Gib mir bitte ein kleines Messer aus der Tasche.“
Ich hörte Brandon niederknien und die Verschlüsse öffnen. Kurz darauf reichte er mir die gewünschte Klinge. Im Stahl der Schneide war ein guter Teil Silber enthalten, wodurch das Messer auf unsereins dieselbe Wirkung hatte wie normaler Stahl auf Menschen.
Brandon behagte es nicht, mich damit zu sehen. „Was hast du vor?“
„Ich versuche herauszufinden, wer ihn erschaffen hat.“
Die linke Hand des Verurteilten war noch nicht angekettet. Ich wischte mit meinem Ärmel über die verdreckte Haut, schnitt dem Mann ins Handgelenk und leckte das Blut von der Klinge. Ich biss ihn nicht, um Hautkontakt zu vermeiden, denn das verfälschte das Blut mit den Gerüchen seines alten Lebens, seines Opfers und des Drecks der Straße.
Ich sog mir den Blutgeschmack aus den Ritzen zwischen den Zähnen und sah auf den betäubten Vampir hinab, der von alldem nichts mitbekam.
„Sein Schöpfer ist fremd, wie ich gedacht hatte. Kein Meister, aber auch nicht mehr jung. Auf jeden Fall alt genug, um zu wissen, was er ihnen antut. Willst du probieren?“, fragte ich und hielt Brandon den blutenden Arm hin. Er sah mich mit einer Mischung aus Überraschung und Ekel an, dann fing er einige Tropfen mit dem Zeigefinger auf und leckte sie ab. „Kenne ich nicht“, sagte er nur, dann nahm er seine Wanderung durch den Raum wieder auf.
„Es wird Zeit, dass dieser Kerí kommt“, sagte er ungeduldig und sah zur Treppe.
Wir warteten noch einige Minuten und schwiegen. Einzige Geräusche waren das leise, ruhige Atmen des Verurteilten und das Tropfen seines Blutes auf den Betonboden.
Endlich hörten wir Schritte.
Kerí hatte seinen eigenen Koffer dabei. Er gehörte zum Clan von Liliana Mereley, einer meiner engsten Verbündeten und ehemaligen Geliebten. Wie sie war er groß, feingliedrig und schlank, mit leuchtend blauen Augen und dunklem Haar, das ihm tief in die Stirn fiel. Hohe Wangenknochen verrieten seine ungarische Herkunft.
„Guten Abend, Meister Lawhead“, begrüßte er mich und neigte den Kopf in meine Richtung. „Guten Abend, Brandon.“
Er trat neben mich an die Bahre und sah auf den betäubten Verurteilten hinab, der mich mit glasigem Blick anstierte.
„Wir üben heute die Arbeit mit dem Pflock.“
Kerí war nervös. Er war erst wenige Monate alt. Keiner von uns hatte je einen mächtigeren Neugeborenen gesehen. Er war nicht, wie sonst üblich, von einem niederen Vampir oder schwachen Meister gezeugt worden, nein, in seinen Adern floss das Blut des mächtigsten und ältesten Vampirs von ganz Los Angeles: Fürst Andrassy. Ursprünglich hatte Kerí zur menschlichen Leibgarde des Fürsten gehört, bis Liliana ihn zu ihrem Liebhaber erkor und kurz darauf darum bat, ihn zu einem Vampir in ihrem Clan zu machen. Andrassy hatte die Verwandlung an eine Bedingung geknüpft: Kerí musste den vakanten Posten des ermordeten Jägers übernehmen.
Brandon beendete seine ruhelose Wanderschaft und trat zu uns. Ohne ein Wort zu verlieren, legte er seine Hand an die Wange des Verurteilten und zwang ihn mit sanfter Gewalt dazu, ihm seinen Blick zuzuwenden. Mein Bann brach, der Mann kämpfte kurz gegen die Fesseln, dann fühlte ich Brandons Magie aufflammen und der neu erschaffene Vampir lag wieder still. Jetzt konnte ich mich ganz auf Kerí konzentrieren.
„Einen Vampir unter deinen Bann zu zwingen kannst du mit Liliana üben. Sie hat doch andere junge Unsterbliche bei sich, oder?“, fragte ich.
„Ja, die schaffe ich schon lange“, antwortete Kerí nicht ohne Stolz in der Stimme. Er bückte sich nach seinem Koffer und nahm Hammer und Pflock heraus. Es war ein schlichtes angespitztes Rundholz, das später in der Leiche verbleiben konnte.
„Zeig mir, wo du ansetzen würdest.“
Mein Schüler riss das ohnehin zerfetzte Shirt des Verurteilten ganz entzwei und setzte den Pflock zielgenau an die richtige Stelle zwischen zwei Rippen, direkt über dem Herzen.
„Soll ich?“, fragte Kerí unsicher.
„Brandon, bist du so weit?“
„Er schläft wie ein Baby“, antwortete mein Erster, erhöhte den Magiefluss sicherheitshalber aber noch einmal.
„Dann los. Kurze, starke Schläge, nicht mehr als drei.“
Kerí presste die Lippen aufeinander und beging dabei den Anfängerfehler, den Todgeweihten noch einmal anzusehen, ehe er zuschlug. Obwohl er viel zu weit ausholte, hatten die Hammerschläge nicht genügend Kraft. Schon beim ersten wusste ich, dass es schiefgehen würde.
Der Pflock rutschte an einer Rippe vorbei, und der Verurteilte begann, wie Espenlaub zu zittern. Ich hielt Kerís Hand fest, ehe er dem Mann noch mehr Leid zufügen konnte. „Schluss, es reicht! Gib mir einen neuen Pflock, schnell!“
Kerí folgte meiner Anweisung hektisch. Ich nahm ihm auch den Hammer ab und senkte das Holz mit zwei gezielten Schlägen ins Herz und tiefer, bis ich spürte, dass es die Bahre darunter berührte. Dann warf ich den Hammer zurück in Kerís Koffer.
Brandon gab ein gequältes Geräusch von sich und verließ hastig den Raum. Seine Aufgabe war erfüllt.
Den toten Körper auf der Bahre durchliefen die letzten Zuckungen, dann lag er endgültig still.
Kerí sah mich entsetzt an, seine Hände zitterten, er verkrampfte sie zu Fäusten, auf und zu, auf und zu. Er war verzweifelt. „Was … was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht?“
„Du hast danebengeschlagen, Kerí. Sei froh, dass Brandon dabei war, sonst hätte der arme Kerl hier alles zusammengeschrien.“
Und damit nahm ich meine Tasche und ließ ihn stehen, um nach Brandon zu sehen.
Ich rannte Gänge hinunter, die von Tür zu Tür freundlicher und wohnlicher wurden, doch von meinem Freund fehlte jede Spur. Was hatte ich mir nur dabei gedacht, ihn in seinem zerbrechlichen Zustand zu einer Hinrichtung mitzunehmen?
Schließlich fand ich ihn in der großen Eingangshalle. Curtis, Oberhaupt des Leonhardt-Clans und damit unser beider Herr, war bei ihm und hielt ihn an den Schultern fest.
Ich verlangsamte meinen Schritt, strich meine Kleidung glatt und trat zu ihnen. „Ich wusste gar nicht, dass du hier bist“, sagte ich zu Curtis und neigte meinen Kopf vor ihm.
„Alle sechs Clanherren sind versammelt. Wir beraten über die Neubesetzung des Reviers in Downtown.“
Besagtes Revier stand leer, seitdem der Rat dem Meister Daniel Gordon und seinem Clan den Krieg erklärt und ich den Clanführer zur Strecke gebracht hatte. Jetzt gab es keinen einzigen Unsterblichen mehr in South Central, und soweit ich wusste, zeigte auch keiner der bestehenden Clans Interesse daran, dieses Dreckloch zu übernehmen.
„Was plant Andrassy?“, fragte ich.
„Wir überlegen, einen Clan von auswärts einzuladen, wenn sich einer findet. Nur der Fürst hat Meister in seinem Gefolge, die stark genug sind, ein eigenes Revier dieser Größe zu übernehmen, und die haben anscheinend kein Interesse.“
Ich nickte zustimmend. „Hätte ich auch nicht, selbst wenn ich stark genug wäre!“
„Das habe ich heute schon oft gehört, wie du dir denken kannst.“
Ich suchte Brandons Blick. Seine Augen waren warm, nicht mehr angstdunkel, doch als sein Meister konnte ich deutlich fühlen, dass seine Seele noch immer in Aufruhr war.
Curtis sah von mir zu meinem Schwurgebundenen. „Fahrt nach Hause, Julius. Ich sehe zu, dass dein Geld angewiesen wird. Wenn du Brandon in den nächsten Tagen entbehren kannst, schick ihn zu mir, mein Wagen macht mir Probleme. Vielleicht findet er den Fehler. Ich zahle auch gut. Ich weiß, dass ihr im Moment knapp bei Kasse seid.“
Ich sah Brandon fragend an, und er nickte. „Ich komme gerne.“
„Dann ist es abgemacht“, sagte Curtis und gab uns beiden zum Abschied die Hand.
Schweigend verließen wir das Gebäude und warteten, bis ein Angestellter Brandons Wagen vorfuhr. Als die dunklen Hügel im Rückspiegel kleiner wurden und der orangefarbene Dunst der Großstadt vor uns an Kraft gewann, hatten wir noch immer kein Wort gewechselt.
„Ich hätte dich nicht darum bitten sollen“, sagte ich schließlich.
„Es ist okay, Julius, wirklich. Du musst nicht ständig auf mich Rücksicht nehmen“, erwiderte er gefasst, die Hände um das Lenkrad gekrampft. Die Erinnerung an die Folter bei Coe plagte ihn auch jetzt, doch er schien gewillt, ihr die Stirn zu bieten.
„Versprich mir nur, dass du es mir in Zukunft sagst, wenn ich dich um etwas bitte, wofür du noch nicht bereit bist.“
Er sah mich mit wundem Blick an. „Coe wird mein Schatten bleiben, auf lange Zeit. Es gibt nur eines, was ich nicht will.“
Ich wartete ab.
„Ich will niemals Henker sein. Ich hoffe, du hast mich nicht deshalb …“
„Nein, versprochen“, erwiderte ich schnell. Selbst ich trug schon schwer daran, Unschuldige töten zu müssen. Brandon, das war mir nur allzu bewusst, wäre an dieser Last sofort zerbrochen.
***
Amber
Leises Weinen drang zu mir hinauf. Ich drehte mich im Bett auf den Rücken und starrte mit offenen Augen aus dem Dachfenster.
Ich lag schon eine ganze Weile wach. An das Schluchzen meiner Mutter hatte ich mich längst gewöhnt, es störte meinen Schlaf nicht mehr. Etwas anderes hatte mich aufgeweckt.
Seit ich aus Arizona zurück war und mich endgültig von Julius getrennt hatte, gehörten schlaflose Nächte für mich zum Alltag. Die Bilder kehrten immer wieder, ob am Tage, wenn ich sie am wenigsten erwartete, oder nachts als Albträume. Ich erinnerte mich an jedes Detail. An das grelle Wüstenlicht, das feudale Anwesen, zu dem ich mir Zugang verschafft hatte, aber vor allem an das gequälte Gesicht des Dieners und die Schmerzensschreie seines Meisters Coe, als ich den alten Vampir in seinem Sarg verbrannte.
Wieder und wieder wandelte ich durch eine selbst geschaffene Hölle, und es gab keine Möglichkeit, meiner Schuld zu entrinnen.
Die Bilder von Brandons Folter hatten eine Bestie in mir geweckt, von deren Existenz ich zuvor nicht einmal die leiseste Ahnung gehabt hatte. Ich durfte sie nie, nie wieder an die Oberfläche lassen.
Es war geschehen, nachdem Julius Brandon aus den Händen des brutalen Meisters Nathaniel Coe freigekauft hatte – um den Preis des jungen, ahnungslosen Vampirs Steven, den Julius zum Tausch geboten hatte.
Damals konnte ich nicht glauben, dass Julius zu einem derart herzlosen Akt fähig war. Natürlich wollte auch ich Brandon befreien, aber doch nicht auf diese Weise!
Mittlerweile, nach zahllosen Gesprächen mit Christina, wusste ich aber, dass junge Meister tatsächlich nicht gegen das Schutzgelübde handeln konnten, das sie einem Vampir gegeben hatten.
Hätte ich Julius nur deswegen verlassen, wäre ich vermutlich längst wieder zu ihm zurückgekehrt. Denn meine Gefühle für ihn wurden mit jedem Tag mehr, nicht weniger.
Doch wovor ich mich wirklich ängstigte, das war ich selbst, das Monster in mir.
In dem Moment, als ich Coe ermordete, war ich ein völlig anderer Mensch gewesen, wie ferngesteuert. In mir hatte ein schrecklicher und brennender Hass gewütet und mich dazu gebracht, einem anderen Menschen ein Messer in den Leib zu rammen, seinen Kopf bis zur Unkenntlichkeit zu zerschießen und dann einen wehrlosen Vampir bei vollem Bewusstsein in seinem Sarg zu verbrennen, während seine Schreie durch meine Ohren gellten.
Wie sehr ich mich auch dagegen wehrte, seit ich Julius kennengelernt hatte, war ich eine andere geworden. Jemand, der mich selbst ängstigte.
Und das war erst der Anfang. Wer würde ich in ein paar Jahren sein? Wer, wenn ich die zwei fehlenden Siegel annehmen würde? Nur der Tod würde uns dann noch auseinanderbringen können. Julius würde noch mehr ein Teil von mir sein und auch über größere Distanz jederzeit meine Lebenskraft anzapfen können. In meinen Adern würde so viel unsterbliches Blut fließen, dass auch ich vor der Zeit geschützt wäre, fast wie ein lebendiger Vampir.
Vergeblich nach Trost suchend klammerte ich mich an der Bettdecke fest.
Julius. Seit Monaten hatte ich ihn nicht mehr gesehen, und wie versprochen hatte er die Siegel nicht benutzt.
Dennoch kreisten meine Gedanken, wenn sie nicht gerade bei Coe waren, stets um ihn.
Ständig sah ich ihn vor mir, seine hellbraunen Augen, sein verführerisches Lächeln mit den spitzen Zähnen. Ich erinnerte mich genau, wie sich sein Haar anfühlte, das er jetzt angeblich kurz geschnitten trug.
Ich presste die Lippen zusammen und schluckte an dem Schmerz vorbei, der in meiner Kehle saß und nach Tränen schmeckte. Alles in mir schrie danach, Julius jetzt sofort zu kontaktieren.
Wie sollte ich ihn je vergessen? War das überhaupt möglich? Vielleicht hielt ich mich selbst zum Narren.
Aber wenn ich mein Glück in der Liebe damit erkaufen musste, mich in eine Mörderin zu verwandeln, dann wusste ich, wie meine Entscheidung ausfallen würde, wie sie ausfallen musste.
Ich drehte mich auf die Seite und versuchte, den ewigen Gedankenkreislauf zu durchbrechen. Eine Weile betrachtete ich die Wolken, die vom Meer kommend über den dunklen Nachthimmel zogen, dann schloss ich die Augen.
Schlafen konnte ich immer noch nicht. Zu groß war die Angst vor Coes Tod und seinen Schmerzensschreien, die mich bereits erwarteten.
Ich schlug die Decke zurück und stand auf. Mit leisen Schritten schlich ich aus dem Raum und die Treppe hinunter, bis ich an Mas Zimmer kam. Die Tür stand einen kleinen Spalt offen und es brannte Licht. Im schwachen Schein der Nachttischlampe lag ein Stapel Taschentücher neben einem silbergerahmten Foto von meinem verstorbenen Bruder Frederik.
Nicht hinsehen. Keinen weiteren Albträumen Nahrung geben.
Charly lag tief in den Kissen vergraben und gab leise, schmerzvolle Laute von sich. Sie weinte im Schlaf, wie so oft. Als ich sie so daliegen sah, fragte ich mich, warum ich nicht früher gekommen war. Warum ich all die Nächte alleine wach gelegen hatte.
Charly war meine Mutter, und so sehr mich ihre laute Art zu trauern auch abstoßen mochte, waren wir doch noch immer eine Familie, oder wenigstens der kleine Rest, der davon übrig war.
„Nicht mehr weinen, Ma“, flüsterte ich, kroch zu ihr ins Bett und kuschelte mich an sie.
***
Im Verborgenen …
„Nun mach doch endlich!“, maulte der Beifahrer ungehalten, schob sich ein Stückchen Kolanuss in den Mund und begann, laut zu kauen.
„Hauptsache, er sucht sich nicht wieder so einen Muskelprotz aus. Ich will nicht so viel schleppen.“
„Der Hexer wäre froh.“
„Ja. Wahrscheinlich hat Agaja das sogar in den Zauber miteingewebt.“
Die Männer verfielen in Schweigen und sahen wieder aus dem Fenster. Sie beobachteten den Vampir schon eine geschlagene Stunde, und er hatte noch immer kein Opfer gewählt. Wie ein Getriebener lief er die Straßen und Boulevards entlang, musterte die Passanten, berührte den ein oder anderen flüchtig und schien sich nicht entscheiden zu können. Jetzt verließ er den überfüllten Sunset Boulevard und stieg durch gewundene Straßen höher in die Hügel über Hollywood hinauf. Es wurde schwieriger, dem Vampir zu folgen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.
„Glaubst du, er ahnt was?“, fragte der Fahrer, lenkte den Wagen langsam näher und dann in eine Parklücke.
„Vielleicht. Aber gegen Agajas Voodoo kommt niemand an, auch kein Untoter. Trotzdem kommt es mir so vor, als würde er sich dagegen wehren. Wahrscheinlich braucht er deshalb so lange.“
„Da, jetzt hat er einen.“
Der dunkelhaarige Vampir hatte einen jungen Gärtner angesprochen, der trotz der hereingebrochenen Dunkelheit noch Blätter in einer Einfahrt fegte. Sie unterhielten sich kurz, dann schien der Vampir sein Opfer unter Kontrolle gebracht zu haben. Der Gärtner ließ achtlos seinen Besen fallen und folgte dem Unsterblichen weiter die Straße hinauf, bis sie eine unbewohnte Gegend erreichten. Unbeirrt steuerte der Vampir auf einen kleinen Schuppen zu.
„Na bitte“, sagte der Fahrer zufrieden, als beide Männer in dem Holzverschlag verschwunden waren.
„Ich schätze, der wiegt ungefähr hundertsechzig Pfund“, grübelte der Beifahrer und spuckte dunkel verfärbten Speichel aus dem Fenster.
„Los, fahren wir eben was essen. Es wird eine Weile dauern, bis alles bereit ist und sein Opfer sich verwandelt hat.“
***
Julius
Es war noch früh am Abend, als wir gesättigt vom Blut unvorsichtiger Teenager nach Hause kamen. Christina war es zu unserem Erstaunen gelungen, ihr unbedarftes Opfer, einen angetrunkenen Jungen, so weit zu betäuben, dass er nicht mehr allzu viel mitbekam. Sie hatte zum ersten Mal keine Hilfe bei der Jagd gebraucht.
Die meisten jungen Vampire benötigten fast ein volles Jahr, um ihre Fertigkeiten so weit zu schulen. Das bedeutete entweder, dass unser Küken das Zeug zur Meisterin hatte, oder dass ich ihr bei der Verwandlung sehr viel Kraft von mir mitgegeben hatte. So oder so kam ich nicht umhin, ein wenig stolz auf sie zu sein. Sie war bestens für die Unendlichkeit gewappnet.
Nun lief sie vor uns her die Gower Street entlang. Die Trauer über das Verhalten ihrer Familie hatte die Freude über ihre Leistung schnell wieder überschattet.
Brandon und ich hielten Abstand, um ihr etwas Zeit für sich zu lassen. Doch unsere Blicke folgten ihr, ihren geschmeidigen Bewegungen, dem wiegenden Haar.
Christina war von einer exotischen Schönheit, wie ich sie selten gesehen hatte, und ich war wieder einmal froh, dass ich sie verwandelt und nicht dem Tod überlassen hatte.
Brandon sah mich an. Beobachtete mich, während ich seine Freundin auf eine Weise musterte, die sich für mich nicht gehörte. Verdammt. Mir schoss die Röte ins Gesicht, und Brandon atmete tief ein. „Ich weiß genau, was du denkst, wenn du sie ansiehst, Julius“, sagte er so leise, dass Christina ihn nicht hören konnte.
„Ich wollte nicht … Brandon …“ Beschämt starrte ich an ihm vorbei zu Chris, die sich in diesem Moment umdrehte und uns ein verhaltenes Lächeln schenkte.
„Geh schon mal vor ins Haus, ich muss noch mit Julius reden“, rief Brandon ihr zu.
Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, trat er näher und schenkte mir einen seltsam zerrissenen Blick.
„Ich verspreche dir, ich würde niemals …“, hob ich wieder an, doch er schnitt mir mit einer Handbewegung das Wort ab.
Wir standen direkt neben der Friedhofsmauer. Ich lehnte mich gegen den kalten Beton. Ich war froh, während dieses Gesprächs etwas Festes im Rücken zu haben.
Brandon ging einige Schritte auf und ab, dann schien er die richtigen Worte gefunden zu haben. „Sie sieht dich genauso an wie du sie“, sagte er traurig.
Ich hatte Wut erwartet, aber da war keine. „Das ist nicht … ich …“
„Julius, lass mich ausreden bitte … Meister.“
Sein Tonfall ließ mich aufhorchen. Er wollte mich gar nicht zur Rede stellen!
Plötzlich erinnerte alles, seine Körperhaltung, sein Blick, sogar der schwache Angstgeruch seiner Haut an die ersten Tage nach seiner Befreiung aus Coes Gewalt. Brandons Augen waren schwarz vor Schmerz.
„Wenn ich mit Christina alleine bin …“, begann er zögernd, dann setzte er neu an: „Ich kann sie nicht glücklich machen, Julius. Es gibt einen Punkt, da kommen die Erinnerungen zurück. Ich kann es nicht aufhalten, nichts kann sie aufhalten.“
Plötzlich ahnte ich, worauf dieses Gespräch hinauslaufen würde, und es gefiel mir gar nicht. „Der Sonnentanz hat nicht alles geheilt. So etwas braucht Zeit. Christina versteht das sicherlich.“
„Ich möchte, dass sie glücklich ist. Ich weiß, dass du sie begehrst und sie dich. Gib ihr, was ich ihr nicht geben kann.“
„Christina ist eine schöne Frau, aber ich würde nie …“
Brandon kam zu mir und legte mir die Hände auf die Schultern. „Ich will nicht, dass Chris ihr Herz an einen anderen verliert. Bei dir weiß ich, dass das nicht passieren wird. Du liebst Amber, auch wenn sie fort ist. Chris schätzt dich, wie man seinen Meister und einen guten Freund schätzt, aber sie ist nicht in dich verliebt.“
„Brandon, wir werden die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht länger zusammen verbringen. Ich kann nicht … wir können nicht einfach so etwas tun und dann alles vergessen.“
„Dann werde ich wohl damit leben müssen, ohne zu vergessen.“
Sein Blick tastete mein Gesicht ab, als würde die Antwort dort irgendwo geschrieben stehen. Ich konnte ihn nicht anlügen. Er wusste, dass ich seine Freundin attraktiv fand, und durch seine Worte hatte er eine Tür in meinem Kopf aufgestoßen, hinter der diese Anziehungskraft bislang sicher verwahrt gewesen war.
Ich flüchtete mich in eine Frage. „Und was sagt Chris zu deinen Plänen?“
„Ich habe deinen Namen nicht genannt, aber sie kennt mein Herz.“
„Hast du ihr jetzt endlich gesagt, was Coe dir ange…“
Brandon zuckte mit dem Kopf zur Seite, als hätte ich ihn geschlagen. „Nein, habe ich nicht.“
Er drehte mir den Rücken zu und trat den Weg zu unserem Haus an. Ich folgte ihm mit wenigen Schritten Abstand. Den Kopf in den Nacken gelehnt, sah ich hinauf zu den wenigen Sternen, die es durch die Smogschicht geschafft hatten. Die Luft war warm und erfüllt vom Gesang der Zikaden. Durch das schmiedeeiserne Friedhofstor wehte der Duft von frisch gemähtem Gras.
Kurz vor der Haustür drehte sich Brandon noch einmal zu mir um. „Du weißt jetzt, was du wissen musst, Julius. Mach daraus, was du willst.“
Mit diesen Worten ließ er mich stehen.
Mein Handy klingelte, und während ich es aus meiner Hosentasche fischte, ging ich über das kleine, zerfurchte Stückchen Wiese vor unserem Haus. Meine Schritte führten mich zu zwei Oleanderbüschen, die ihre tödlichen weißen Blütensterne in der sachten Brise schaukelten. Die Stimme am anderen Ende der Leitung war mir wohlbekannt, und ich musste trotz des ernsten Gesprächs mit Brandon grinsen. „Liliana, womit habe ich denn diese Ehre verdient?“
Sie lachte ihr tiefes, kehliges Lachen und wusste dabei genau, was für eine Wirkung es auf mich hatte. Erinnerungen leuchteten auf. Schlaglichter vergangener Jahre, vergangener Liebschaften. Die Zeit mit ihr war schön gewesen.
„Julius, mein Schatz, ich habe hier so einen frisch gemachten kleinen Blutsauger in meinem Revier. Der Mistkerl versteckt sich in einem Gärtnerschuppen. Ich würde ihm ja gerne selbst den Hals umdrehen, aber ich bin brav und halte mich an die Regeln. Du musst es also für mich tun.“
Ich riss mich zusammen. Konzentrierte mich auf die Bedeutung der Worte anstelle ihres betörenden Klangs. Lust war Lilianas Werkzeug und der Motor, der sie antrieb. Nach der Einsamkeit der vergangenen Monate reagierte mein Leib sofort auf ihren lockenden Tonfall.
Ich verdrängte den Gedanken an Lilianas Körper mit der Tatsache, dass ich wieder einen Unschuldigen töten sollte. Die bittere Realität half.
„Gibt es ein Urteil?“, fragte ich, meine Stimme so rau, dass ich mich räuspern musste.
Liliana lachte, denn sie wusste genau, was sie mir antat.
„Der Papierkram ist erledigt und unterwegs. Bis du hier bist, passt Sally auf, dass er nicht wegläuft.“
„Gut, ich beeile mich.“
„Auf Wiedersehen, mein Jäger. Denk hin und wieder mal an mich.“
„Lieber nicht zu oft, Meisterin“, entgegnete ich und rieb die Hand über den rauen Stoff meines Pullovers. Für einen Augenblick hatte ich Lilianas nackte Haut so deutlich vor mir gehabt, dass ich meinte, sie zu berühren.
Liliana lachte erneut, dann war die Leitung zu meiner Erleichterung tot.
Ich ging ins Haus, holte meine Waffen, zog eine leichte Jacke über und machte mich auf den Weg. Weder Brandon noch Christina kamen mir in die Quere, und ich war froh, den beiden nicht ins Gesicht sehen zu müssen.
Brandons Worte spukten mir noch immer im Kopf herum. Er hatte mich mehr oder minder direkt darum gebeten, mit seiner Freundin zu schlafen. So absurd es war, ich konnte seine Gedanken sogar nachvollziehen. Er fürchtete, dass sie ihn verlassen würde, wenn sie sich auf ihrer Suche nach Nähe neu verliebte. Besonders junge Vampire hatten mit verstärkten Emotionen zu kämpfen: mehr Angst, mehr Lust, mehr Lebenshunger und auch mehr Zweifel.
Bei mir war er sicher, da hatte er recht.
Die meisten Vampire lebten ohnehin nicht monogam. Die Worte „Bis in alle Ewigkeit“ bekommen eine ganz andere Bedeutung, wenn man unsterblich ist. Und wie es schien, hatten Brandon und Christina längst eine Vereinbarung getroffen. Aber ich war doch ihr Meister, verflucht!
War sie nicht wie ein Kind für mich?
Ich schüttelte den Gedanken ab. Meine Überlegungen würden warten müssen, bis ich meine Arbeit getan hatte.
Ein Fahrdienst brachte mich in die Hollywood Hills. An einer winzigen, völlig verwinkelten Kreuzung bat ich den Mann anzuhalten. Meine Haut prickelte wie elektrisiert.
Ich fühlte die Kraft einer Unsterblichen.
Vermutlich Sally, die den Neuerschaffenen bewachte, aber sicher sein konnte ich mir nie. Eine Hand unter der Jacke verborgen, joggte ich die enge, gewundene Straße hinauf. Zur Linken war der Hügel so steil, dass selbst die findigsten Architekten keine Möglichkeit gefunden hatten, ihn zu bebauen. Auf der rechten Seite trennte eine kleine, weiß gestrichene Mauer den Verkehr vom Abgrund.
Vor mir öffnete sich eine kleine Haltebucht, die von Steineichen bestanden war. Dort parkte ein schnittiger silberner Sportwagen.
Wie ich vermutet hatte, saß hinter dem Steuer Sally. Erleichtert verlangsamte ich meinen Schritt und hob zum Gruß die Hand. Sie winkte zurück. Als ich am Wagen ankam, war sie bereits ausgestiegen. Sie war schlank, mit dunklen langen Locken, das ebenmäßige Gesicht so perfekt geschminkt, dass sie sehr lebendig aussah. In ihren Augen blitzte es gefährlich. Alle Mereley besaßen dieses tödliche Funkeln. Sally und ich waren fast gleichaltrig, und ich kannte sie schon, seitdem ich mit Curtis in die Stadt der Engel gekommen war.
„Julius, das ging ja wirklich schnell.“
Ich begrüßte sie mit einem flüchtigen Kuss, dann spähte ich den Hang hinauf. Er war steil und wie alles hier von hohem vergilbten Gras und Büschen bedeckt. Unter einer Dreiergruppe hartblättriger Eichen, nicht weit vom Parkplatz entfernt, gab es einen kleinen Schuppen. Die Tür stand ein Stück offen, das Schloss war zerschlagen.
„Da hat er sich aber einen schönen Platz ausgesucht.“
Sally folgte meinem Blick. „Während ich auf dich gewartet habe, sind nur zwei Autos vorbeigekommen. Falls du befürchtest, dass du gesehen werden könntest, das brauchst du nicht. Der Hügel verdeckt die Sicht, und die beiden Häuser da oben haben meterhohe Hecken.“
„Dein Wort in Gottes Ohr, Sally.“
„Soll ich warten?“
„Nicht nötig. Grüß deine Herrin von mir.“
„Das mache ich.“ Sie reichte mir zum Abschied die benötigten Papiere.
Ich wartete noch, bis sie gewendet hatte und die Rücklichter bergauf hinter der nächsten Kurve verschwunden waren, dann öffnete ich mich für die Eindrücke der Nacht.
Eine Weile stand ich mit geschlossenen Augen da und lauschte. Die Zikaden zirpten in den Bäumen, der Wind strich durch trockenes Gras und die Luft schmeckte nach einem neugeborenen Vampir.
Er war erst wenige Stunden alt und hatte noch nicht einmal getrunken.
Seitdem wir so gut wie jede Nacht einen Neuen hatten, waren unsere Gesetze bis aufs Äußerste gedehnt worden. Üblicherweise wurde ich erst gerufen, wenn die Jungen schon eine Weile verwildert waren, was bedeutete, dass sie mindestens einen Menschen getötet hatten und zwischen den Revieren umherstreiften. Aber dass der Vampir in der Hütte diesen Weg einschlagen würde, war eine Tatsache und seine Beseitigung damit rechtens, auch wenn er noch kein Leben auf dem Gewissen hatte.
Aus dem Tal klang Autolärm hinauf. Hier oben hingegen war es gespenstisch still, nur ein Hund kläffte, aber sein Bellen war weit weg und galt nicht mir.
Ich seufzte und zog meine kleine Armbrust aus einer Umhängetasche. Wenn ich einen Auftrag im Freien hatte, war sie die Waffe meiner Wahl. Mit ihr war mir noch nie ein Verurteilter entkommen. Ich legte einen Bolzen ein, befestigte einen Draht an dessen Ende und spannte die Armbrust.
Mein Herzschlag beschleunigte sich. Ich genoss, wie beim Gedanken an den bevorstehenden Kampf Adrenalin meinen Körper flutete und mit Hitze erfüllte.
Ich atmete einmal tief durch, bleckte die Zähne, wie es dem Raubtier tief in mir gefiel, und ließ es aus seinem Käfig. Die Jagd war eröffnet!
Das noch nicht ausgeklappte Schwert in der Rechten, die Armbrust in der Linken, machte ich mich an den kurzen Aufstieg. Aus meiner Haut floss ein stetiger Strom beruhigender Magie. Sie log, gaukelte vor, dass ich dem Fremden freundlich gesinnt war.
Vorsichtig stieß ich mit dem Fuß die Tür auf.
Ich konnte ihn atmen hören. Der Rhythmus seines Herzschlags war betäubend laut in meinen Ohren. Er war hier, aber noch sah ich ihn nicht.
In dem kleinen Raum war es stockfinster. Es roch nach frisch gemähtem Rasen und Benzin. In dem Durcheinander aus Kanistern, Rasenmähern, Rechen und anderem Gerät konnte ich nichts erkennen, und ich hatte keine Lust zu suchen. Fauchend ließ ich die Maske freundlicher Magie fallen.
Im nächsten Augenblick fühlte er, was ich war: alt und tödlich.
Mit einem metallischen Klicken fuhr die Schwertklinge aus ihrem Bett.
Der Vampir floh aus seiner Deckung und brach durch die Rückwand des Schuppens. Die morschen Bretter gaben einfach nach. Ich sprang hinter ihm durch die neu entstandene Öffnung, bevor der Schuppen wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzte.
Der Mann floh den Hügel hinauf und strauchelte dabei immer wieder. Er war schwach vom Blutverlust. Es schien, als hätte jemand die Zeit für mich angehalten, Sekunden schienen sich zu kleinen Ewigkeiten zu dehnen. Ich ließ mein Schwert fallen und zielte mit ausgestreckten Armen.
Klack.
Der Bolzen war auf seinem Weg und zog den feinen Metalldraht wie einen Spinnenfaden hinter sich her. Stahl traf auf Fleisch, bohrte sich tief hinein. Der Mann schrie, kippte nach vorn und bremste seinen Fall mit den Händen ab. Trockene Blätter rutschten als kleine Lawine den Hang hinab, mir entgegen.
Ich sah mich kurz um, doch wir waren allein.
Das schwache Licht des Neumonds glänzte auf dem feinen Draht, der den Bolzen mit der Armbrust verband. Ich betätigte einen kleinen Hebel und arretierte damit die Spule. Sobald der Vampir aufzuspringen versuchte, gab ich der Waffe einen scharfen Ruck.
Er fiel und krallte seine Hände in den trockenen Boden. So sehr er auch kämpfte, er kam nicht gegen den kurzen Pfeil an, der sich in seiner Schulter verkeilt hatte.
Er fauchte, bleckte seine neuen Reißzähne in meine Richtung. Als er eine Hand nach dem Pfeil streckte, machte ich dem Schauspiel ein Ende. Ein zweiter Ruck, und er stürzte rückwärts den Berg hinunter.
Ich ließ die Armbrust fallen, rannte ein Stück und bremste seinen Fall mit dem Fuß.
Der Mann wimmerte um Gnade und grub die Hände ins Laub, während ich ihn an seinem grünen Overall, auf dem das Logo einer Gärtnerei prangte, hinter die zerbrochene Hütte zog. Der Draht hatte sich beim Sturz um seinen Oberkörper gewickelt und fesselte die Arme daran, als hätte ich es geplant. Während ich den Mann weiterzerrte, hob ich mein Schwert vom Boden auf. Sobald wir in Deckung waren, drehte ich ihn auf den Rücken und ließ ihn los.
„Sieh mich an!“
Dunkle, erschrockene Augen richteten sich auf mich. Ich nahm ihm die Angst und die Schmerzen und den Gedanken an Flucht, wischte alles aus seinem Verstand wie Kreide von einer Tafel. Der Mann wurde ruhig und leer, sah aus, als schliefe er mit offenen Augen.
Ich wickelte den verhedderten Draht auf und löste den Bolzen aus seiner Schulter. Mein Opfer spürte nichts. Als ich das Schwert zum entscheidenden Schlag hob, blieb der Mann still wie eine Puppe. Ich enthauptete ihn und begrub den Körper unter einer Schicht aus trockenem Laub vom Vorjahr.
Es würde keine Stunde dauern, bis sie ihn abholten, und Sally hatte recht, diese Gegend war wirklich wie ausgestorben.
Als ich mich an den Abstieg machte, kam ein vereinzeltes Auto den Berg hinauf. Ich klopfte mir das Laub von der Kleidung und sah mich noch einmal um. Die zusammengestürzte Hütte und der Blätterhaufen verbargen die Leiche zuverlässig.
Ich überprüfte, ob meine Waffen gut versteckt waren, dann eilte ich mit langen Schritten die Straße hinunter.
Wieder ein junger Vampir weniger, wieder einer, der nie den ersten köstlichen Tropfen Blut schmecken würde. Bedauerlich für ihn, beruhigend für mich.
Als ich durch die Tür trat, war unser Haus erfüllt von Essensdüften. „Yiska?“ Es musste unser sterblicher Mitbewohner sein. Er war der Einzige, der hin und wieder die Küche benutzte. Ich hörte Dampf aus einem Topf zischen, aber niemand antwortete. Ich streifte die Schuhe ab und ging barfuß den Flur hinunter, als mich lautes Schluchzen überraschte. „Chris, bist du das?“
Ich betrat die Küche und blieb wie angewurzelt stehen. Auf dem Esstisch stand ein fertiger Kuchen, im Ofen schmorte ein Braten vor sich hin. Ich roch Pudding, mexikanischen Eintopf, Obstsalat und noch vieles mehr.
In einem Topf kochten Kartoffeln.
Christina saß auf dem Boden vor dem Kühlschrank und weinte. Sie trug eine Schürze, ihre Hände waren voller heller Flecken, und sogar in ihrem Haar klebte Teig.
Ich erinnerte mich, dass Brandon vorhin gesagt hatte, er wolle gleich zu Curtis fahren, um sich wie versprochen das Auto anzusehen. Lautlos fluchte ich in mich hinein. Wir hätten Chris in diesem Zustand nicht so lange alleinlassen dürfen.
Ich schaltete den Herd aus, ließ mich vor ihr auf den Boden sinken und zog sie einfach in meine Arme. Sie wehrte sich, schrie, schlug auf mich ein. Ich packte ihre Fäuste und ließ sie toben. Ich wusste, dass sie wütend war. Wütend auf die Welt, auf sich und am meisten auf mich, der sie zu dem gemacht hatte, was sie war.
„Du bist schuld, du bist schuld!“, wiederholte sie. „Hättest du mich doch nur sterben lassen, verdammt, warum hast du mich nicht sterben lassen?!“
Ihre Worte taten weh, berührten den Punkt tief in mir, an dem auch ich meine Existenz verfluchte. „Du hast es gewollt, Chris, es war dein Wunsch.“
Ihr Widerstand erlahmte, und ich zog sie an mich.
„Ich will sterben!“
„Nein, das willst du nicht, es geht vorbei“, versicherte ich ruhig und lehnte mich gegen die Wand, um Chris besser halten zu können, während ihr Körper zuckte und krampfte, als würde die Trauer ihr Inneres in Stücke reißen. Ganz langsam wurde es besser.
„Nichts, was ich tue, hat noch einen Sinn, nichts macht mir mehr Freude, und meine Mama, meine Mama hasst mich …“
„Ich habe meine Eltern nach der Verwandlung nie wiedergesehen, Chris. Sie dachten, ich sei tot. Ich durfte nicht einmal Abschied nehmen. Du solltest dankbar sein, dass sich die Zeiten geändert haben.“
Schließlich ließ sie sich ermattet gegen mich sinken und schlang ihre Arme um mich, als sei ich ihr Rettungsanker. Und vielleicht war ich der auch. „Meister“, wisperte sie, während sie ihren Kopf fest gegen meinen Brustkorb presste und sich ganz dem beruhigenden Rhythmus meines Herzens überließ.
„Am Anfang ist es schrecklich schwer, ich weiß“, flüsterte ich, während ich ihr den Rücken rieb. Schlagartig wurde mir bewusst, wie nah wir uns waren. Ihr Haar duftete.
Ich drückte einen Kuss auf ihren Scheitel und ließ meine Lippen über ihre dunklen Locken gleiten. Sie roch wie etwas Vertrautes, Ureigenes, wie Heimat. „Christina, Christina Reyes. Mein Blut bist du, mein.“
Ehe ich mich versah, küsste ich die Tränen von ihren Wangen, schmeckte in dem salzigen Wasser meine eigene Kraft und berauschte mich daran. Ich hatte sie geschaffen, ich ganz allein.
„Julius, was tust du?“, fragte sie leise.
„Ich tröste dich“, flüsterte ich und küsste die Lider ihrer trauerdunklen Augen, deren Wimpern als nasse schwarze Bögen schimmern. Sie hielt den Mund halb geöffnet. Mit dem Finger strich ich ihre Lippen entlang, bis ihre Reißzähne sichtbar wurden. Mein Blut hatte das getan, meines. Dieses wunderschöne Geschöpf war mein.
„Sag nie wieder, dass du sterben willst, Chris, das lasse ich nicht zu.“
„Versprochen“, flüsterte sie, und in ihrer Stimme lag plötzlich etwas anderes als Trauer: ein süßes Versprechen.
Ich hielt den Atem an. Versuchte herauszufinden, ob sie es ehrlich meinte. Christina hob langsam ihre Hand, streifte mein Gesicht und vergrub die Finger in meinem Haar. Ihre Nägel schickten einen angenehmen Schauer durch meinen Körper und entlockten mir ein leises Keuchen.
Ich wusste, wenn ich meine Augen jetzt öffnete, würden sie bernsteingelb aufleuchten. Jede Faser meines ausgehungerten Körpers wollte, dass sie weitermachte.
„Es ist falsch“, sagte Christina und hielt inne.
„Ich weiß.“
Wir hatten den Punkt erreicht, an dem wir uns entscheiden mussten. Ich schwieg, wartete auf ihr Nein, doch es kam nicht.
Christina suchte in meinem Gesicht nach einer Antwort, doch ich wusste nicht mehr, was ich wollte, was richtig oder falsch war. Sie legte die Hände an meine Wangen, zögerte, dann presste sie ihre Lippen auf meine. Der Kuss war hart und gewaltsam.
Ich schmeckte unsere Verzweiflung, während unsere Zähne Wunden in die Lippen des anderen rissen. Der Schmerz brachte uns langsam zur Besinnung.
Ich schob Christina von mir, drängte meine ganze aufgestaute Sehnsucht, mich in einer Frau zu verlieren, in den Hintergrund. „Nicht hier, Chris.“
Sie hielt inne und sog sich das Blut von den Lippen, während ich einen Arm unter ihre Knie schob und sie hochhob. Ich trug sie durch das dunkle Haus, die Treppe hinauf in mein Zimmer. Christina hatte eine Hand auf meinen Puls gelegt und küsste meine Kehle. Wohliger Schauder. Ein Fünkchen Gefahr, auch wenn ich wusste, dass sie es nicht wagen würde, mich zu beißen.
Mein Büro war das einzige fertig renovierte Zimmer im Haus.
Ein antikes französisches Bett passte genau in eine angeschlossene Kammer. Mit Christina in den Armen ging ich zu dem Bett, das ich einst mit dem Gedanken bestellt hatte, Amber darin zu lieben. Jetzt würde es Chris sein.
Kurz zerrte die Sehnsucht nach Amber an meinem Inneren, dann küsste mich Christina wild und hungrig. Raubtierküsse. Wir tranken vom Mund des anderen, während wir einander ungestüm auszogen. Im nächsten Moment saß sie rittlings auf mir, die Augen geschlossen, und von ihrem Mund lief ein dünnes rotes Rinnsal. Durch die heruntergelassenen Jalousien fiel das Großstadtlicht und zeichnete warme Streifen auf ihre vollen Brüste. Mit ihren schlanken Fingern tastete sie über meinen Oberkörper, während ich ihre üppigen Kurven nachzeichnete. Weich, so weich.
Christina begann sich auf mir zu bewegen, und der Rausch riss uns beide fort.
Schweigend lagen wir nebeneinander, während die Lust langsam einer wohligen Schwere wich. Wir hatten uns die Decke nur bis über die Hüften gezogen und genossen den Nachtwind, der uns kühlte. Christina hatte sich von mir abgewandt und starrte aus dem geöffneten Kippfenster.
Beide hörten wir plötzlich das charakteristische Brummen von Brandons Pontiac. Christinas Körper verkrampfte sich bei dem Geräusch.
„Er weiß es, Chris, er wird nicht böse sein.“
Der Motor ging aus. Brandon lief die wenigen Schritte zur Tür, dann schloss er auf. Wir hörten, wie er im Flur stehen blieb. Jetzt wusste er, wo wir waren und dass wir getan hatten, worum er mich gebeten hatte. Ich erwartete, dass er kehrtmachen und das Haus verlassen würde, doch stattdessen waren Schritte auf der Treppe zu hören.
„Er kommt hierher.“ Leichte Panik ließ Christinas Stimme höher klingen. Sie zog sich die Decke bis zum Kinn. Auch mein Herz klopfte schneller. Was wollte Brandon hier? Wollte er sich das wirklich antun? Oder hatte er es sich anders überlegt und kam, um uns zur Rede zu stellen? Mir blieb keine Zeit mehr zu grübeln, denn in diesem Moment ging die Tür auf.
Der Geruch von Benzin und Motoröl mischte sich mit unserem. Brandon blieb in seinem blauen, fleckenübersäten Overall bewegungslos stehen und blickte uns an.
Sein Gesicht zeigte keine Regung. Ich konnte nur ahnen, wie es in seinem Inneren aussah, welcher Widerstreit dort stattfand. Ich hatte ja selbst nicht geglaubt, dass ich es wirklich tun würde.
Christina drückte ihr Gesicht in die Kissen, um Brandon nicht ansehen zu müssen. Als er erkannte, wie sehr sie sich schämte, löste er sich aus seiner starren Haltung. Ich konnte mir ausmalen, wie viel Überwindung es ihn kostete, näher zu kommen. Langsam ging er neben dem Bett in die Knie. Seine Nasenflügel bebten.
„Es ist okay, Chris“, sagte er leise. Die Worte fielen ihm schwer. Er strich ihr über die Wange. Seine großen Hände waren voller Ölstreifen und rochen nach Benzin.
Ich fühlte mich furchtbar, als hätte ich sie beide betrogen. Am liebsten hätte ich das Weite gesucht, doch etwas sagte mir, dass ich das, was sich gerade zwischen ihnen abspielte, nicht unterbrechen durfte.
Vorsichtig zog ich meinen Arm weg, der bislang um Christinas Taille gelegen hatte, und drehte mich auf den Rücken. Brandon und Chris schirmten sich von mir ab. Wenn ich die Augen schloss, war es fast, als seien sie nicht da.
Sie benutzten Telepathie. Brandon beugte sich vor und küsste Chris auf die Stirn, nahm ihre zitternden Hände und berührte jeden einzelnen Knöchel sacht mit dem Mund. Sie atmete auf, streckte sich nach ihm und löste einen Träger seines Overalls. Brandon erstarrte, während sie auch den zweiten öffnete.
Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, doch Christina schien einen Plan zu verfolgen. Schließlich stand Brandon in T-Shirt und Shorts vor uns. Er hatte seine Bedenken scheinbar schneller überwunden als ich.
„Rutsch mal, Julius“, sagte Christina.
Ich machte Platz, Brandon kletterte neben ihr ins Bett, und sie schmiegte sich an ihn. Selten hatte ich mich so deplatziert gefühlt.
„Ich lasse euch allein“, beschloss ich laut und richtete mich auf.
„Nein, bleib bitte“, sagte Brandon.
Ich fischte nach meiner Unterhose, zog sie an und ließ mich in die Kissen zurückfallen. Verlegen starrte ich an die Decke, weil ich nicht wusste, wo ich hinschauen sollte, bis Christina meine Hand nahm und sie zurück auf ihre Hüfte legte, wo sie gewesen war, bevor Brandon kam. Eine Weile lagen wir so da und lauschten Atem und Herzschlag der anderen, bis wir ein Wesen waren, eine Familie, eine Camarilla. Der Gedanke an Scham oder Lust schien bald meilenweit entfernt.
Mit einem Mal rief mich Brandon mithilfe des Eides. „Sag es ihr, Julius. Aber lautlos und ohne Bilder, und sie soll es danach nie wieder erwähnen. Doch erfahren muss sie es, damit hast du recht.“
„Ich bin froh, dass du so entschieden hast.“
„Wer flüstert, lügt“, sagte Christina in die Stille hinein und lächelte unsicher.
Sie hatte gespürt, dass wir uns unterhielten.
„Brandon hat mich gebeten, dir etwas zu sagen, Chris. Öffne dich für mich.“
Christina drehte sich auf den Rücken und sah mich überrascht an, dann fielen ihre Schilde und wir kommunizierten mit Gedanken. „Warum auf diese Weise, Meister?“
„Weil er es nicht erträgt, wenn man darüber redet. Er will nicht, dass du ihn jemals darauf ansprichst, das musst du mir schwören.“
Ihr Herz begann zu rasen. „Es geht um Coe?“
Brandon lag wie tot neben uns, er atmete nicht einmal mehr.
„Ich verspreche, dass ich ihn nicht danach frage, was auch immer es ist.“
Ich entschloss mich für die kürzeste der möglichen Varianten. Selbst mir fiel es schwer, darüber zu sprechen.
„Brandon hat versucht, seine Vergangenheit zu vergessen, aber sie hat ihn nicht vergessen. Als er als Junge zu Coe kam, wurde er von ihm missbraucht, die ganzen vielen Jahre, die er bei ihm lebte. Und das Schwein hat es wieder getan, als er ihn im Frühjahr in seiner Gewalt hatte.“
„Er hat …?“
„Ja, Chris. Und nicht nur einmal.“
Sie starrte mich fassungslos an. „Nein“, sagte sie nur, dann traten Tränen in ihre Augen und sie wandte sich von mir ab. Sie bebte am ganzen Körper, als sie sich an Brandon drängte und immer wieder das Gleiche flüsterte. „Nein, nein, nein.“
Brandon drückte Christinas Hand und hielt die Augen fest geschlossen. „Deshalb kann ich nicht, ich kann nicht …“, stotterte er und zog sie an sich.
„Und ich habe gedacht, du magst mich nicht mehr“, schluchzte Christina. „Ich bin nicht mehr sterblich, die Siegel sind fort. Seit meiner Verwandlung ist alles so anders geworden. Ich dachte …“ Sie verschluckte die letzten Worte und vergrub ihr Gesicht in seinem Haar.
Ich stand auf, sammelte meine Kleidung vom Boden und schlich leise aus dem Raum.
Yiska war in der Küche. Keiner von uns hatte bemerkt, wie er von seinem Schauspielkurs zurückgekehrt war, in den er sich eingeschrieben hatte, nachdem er uns aus dem Reservat in Arizona nach L.A. begleitet hatte.
Ich blieb in der Tür stehen und beobachtete ihn einen Moment. Der junge Navajo saß am Esstisch vor einem geleerten Teller, auf dem noch Reste von Bratensoße zu erkennen waren. Also hatten Christinas Kochkünste wenigstens einen dankbaren Abnehmer gefunden.
Yiska bemerkte mich und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück.
„Willst du von mir trinken, Julius?“
Ich schrak hoch. „Bitte?“
„Ob du von mir trinken möchtest, habe ich gefragt.“ Yiska musterte mich ernst.
„Ich habe schon gejagt, danke“, antwortete ich schnell, aber mein Blick richtete sich unweigerlich auf die dünne, braun gebrannte Haut an seinem Hals, unter der der Puls so verheißungsvoll klopfte. „Wann hast du das letzte Mal gegeben?“
„Vor zehn, nein, elf Tagen, aber es war nur wenig, bloß ein Schluck, weil Chris so lange auf die Jagd warten musste.“
Ich schüttelte den Kopf, doch Yiska war schon aufgestanden und stand nun groß und schlank vor mir. „Bitte, Julius. Es gibt für mich nichts Schöneres … Doch, eine Sache wüsste ich da noch.“ Er grinste und wurde rot.
„Pass auf, dass dir nicht zu viel Blut in den Kopf steigt“, warnte ich ihn lachend.
Meine Bedenken waren dahin. Er fühlte sich gesund an, strotzte vor Leben. Ich würde es tun. „Knie dich vor mich, den Rücken zu mir.“
Ich hatte noch nie von ihm getrunken, aber ich wusste, dass meine Vampire es beide schon getan hatten. Yiska gehörte zu uns, war zum festen Teil unserer kleinen Familie geworden, seit er sich uns angeschlossen hatte. Menschen wie er wurden oft irgendwann Diener oder, wie in Kerí Aranys Fall, sogar Vampire.
Yiska sank mit feierlichem Schweigen auf die Knie und entblößte seinen Nacken für mich.
Ich lehnte mich vor und legte einen Arm um seinen Oberkörper.
„Wie viel willst du fühlen?“, flüsterte ich gegen seine Haut.
„So viel wie ohne Schmerzen möglich“, erwiderte er ruhig.
Ich drückte seinen Kopf zur Seite und biss zu. Heute Nacht war ich großzügig und teilte alles.
Das Gefühl, wie es war, sein Leben in meinen Händen zu halten, das Blut durch seinen Körper rauschen zu hören und die Lebensenergie zu sehen, die als goldener Kern über seinem Herzen ruhte. Dann tauchte ich in seine Erinnerungen, zog mit jedem Schluck neue, schöne Bilder hervor und legte sie wie Postkarten vor ihm hin. Sein Blut war dick und süß und lag schwer in meinem Mund.
Yiska seufzte und lehnte sich gegen meine Knie. Als er sich nach mir umsah, war sein Blick glasig. „Das war unglaublich, genial … der Wahnsinn!“
„Ihr Navajo schmeckt besser als der beste Wein“, erwiderte ich lachend und sog die letzten Blutreste zwischen den Zähnen hervor. „Entschuldige, ich wollte nicht unhöflich sein.“
„Kein Problem. Die Mischung macht’s, halb Navajo, halb Lakota“, sagte er und grinste träge. „War das das volle Programm oder gibt es noch mehr?“
„Wenn du eine Frau wärst, gäbe es mehr, aber ich denke, darauf können wir beide verzichten.“
Yiska starrte zu mir hoch und nickte dann übertrieben. „Ja, und nein danke.“
„Habe ich mir gedacht.“
Er rutschte ein Stück von mir weg und lehnte sich gegen einen Schrank. Als er mich ansah, wurde er rot. „Kennst du denn eine Unsterbliche, die das kann, was du kannst, und vielleicht …“
Ich musste unweigerlich an Liliana mit ihrer unersättlichen Lust auf neue junge Liebhaber denken. Ich war mir sicher, dass sie Yiska begehrenswert finden würde. Aber Liliana war schwere Kost, selbst für Vampire. Für sie waren Schmerz und Lust eins. Und Yiska schien beinahe süchtig nach dem Magierausch zu sein, der mit der Blutspende einherging – in Kombination mit der Gier der Meisterin der Mereley ein eher ungünstiger Wesenszug. Ich nahm mir vor, ein Auge darauf zu haben, dass Yiska seine Gesundheit nicht in Gefahr brachte, und erwähnte Liliana vorsichtshalber nicht.
Mein Handy klingelte. Die Nummer war mir unbekannt. „Ja“, meldete ich mich gereizt. Es sah nicht so aus, als würde ich die restliche Nacht ungestört verbringen dürfen.
„Vitus Steen. Wissen Sie, wer ich bin?“
„Ich kenne eine Claire Steen.“
„Sie steht neben mir. Die Leiche ist nicht da, Mr Lawhead. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Rufen Sie uns bitte nur an, wenn Sie Ihren Auftrag auch erfüllt haben.“
Hier stimmte etwas nicht. „Hören Sie, ich habe den Mann enthauptet. Der geht nirgendwo mehr hin.“
Yiska, der das Telefonat mit anhörte, riss bei meinen Worten die Augen auf.
„Hier ist eine Menge Blut, aber keine Leiche. Wie erklären Sie sich das?“
„Ich weiß nicht, ich komme hin.“
„Beeilen Sie sich. Wir warten.“
Um diese Uhrzeit waren die Straßen wie leergefegt. Ein unauffälliger grauer Van, der am Straßenrand parkte, verriet mir, dass die Steens noch immer vor Ort waren. Kurz darauf konnte ich ihre Energie spüren. Ich parkte hinter ihrem Fahrzeug, an dessen Nummernschild wie zufällig die Farbe abgeblättert war, und stieg aus.
Sie standen vor der Motorhaube und rauchten. Die Frage, ob Vitus Claires Ehemann oder Bruder war, erübrigte sich auf den ersten Blick.
Vitus sah aus wie ihre exakte Kopie, nur in männlich. Zwillinge. Beide hatten mittelbraunes Haar, das sie kurz geschnitten trugen, beide waren von schwerem Knochenbau, und die Gesichter waren so ebenmäßig und gewöhnlich, dass man sie schon nach kürzester Zeit wieder vergaß.
Dadurch eigneten sie sich geradezu perfekt für die Aufgabe, die ihnen der Rat übertragen hatte.
Ich schüttelte beiden die Hand und erklärte schon währenddessen: „Ich habe ihn dort hinter die Hütte unter die Eichen gelegt, den Kopf zwischen den Beinen, das Urteil lag auf der Brust, wie immer.“ Ich wies mit der Hand auf die dichtbelaubte Stelle oberhalb der Straße. Gemeinsam stiegen wir das kurze, steile Stück hinauf.
„Etwas anderes bin ich von Ihnen auch nicht gewohnt“, sagte Claire versöhnlich. „Mein Bruder war sonst immer für den zweiten Jäger zuständig.“
Eine deutlichere Entschuldigung konnte ich von den beiden wohl nicht erwarten. Ich ließ die Worte stehen und beugte mich über das Gebüsch. Der Boden war getränkt mit Blut, dessen metallischer Geruch schwer zwischen den Zweigen hing.
„Wir sind keine Jäger, Mr Lawhead“, sagte Vitus Steen und trat nervös von einem Fuß auf den anderen. „Ich kann nicht erkennen, was hier passiert ist.“
„Wann waren Sie hier?“, fragte ich.
„Zehn nach zwölf.“ Claire sah auf ihr Handy und tippte darauf herum, bis sie meine Nachricht fand. „Das sind nur achtzehn Minuten, nachdem Sie mich benachrichtigt haben. Wir wussten, in welchem Stadtteil Sie sein würden, und haben uns bereitgehalten.“
„In so kurzer Zeit kann die Polizei keinesfalls hier gewesen sein und ihre Arbeit getan haben. Ein kopfloser Vampir geht nirgendwo mehr hin, und das kann nur bedeuten, dass jemand die Leiche gestohlen hat.“
„Aber wer tut so etwas?“, fragte Vitus regelrecht angewidert.
Ich zuckte mit den Schultern. „Das werde ich wohl herausfinden müssen.“
Ich bückte mich wieder, hob eine Handvoll Laub auf und hielt es mir an die Nase. Nichts. „Wenn es der Schöpfer gewesen wäre, könnte ich ihn riechen“, sagte ich, ließ die Blätter fallen und wischte die Finger an der Hose ab.
„Können wir fahren?“, sagte Claire plötzlich.
Ich sah sie überrascht an. „Ich dachte, wir suchen hier gemeinsam nach Hinweisen.“
„Das ist nicht unsere Aufgabe, Mr Lawhead. Unser Weg ist noch weit und die Sonne geht bald auf.“ Vitus scharrte wieder mit den Füßen und zerstörte damit womöglich Spuren. Ich gab beiden erneut die Hand und schickte sie nach Hause. Allein würde ich sowieso besser arbeiten können.
Als sie an mir vorbeifuhren, wandte ich mich ab, damit die Autoscheinwerfer meine Nachtsicht nicht ruinierten. Im fahlen Blau des erwachenden Morgens lief ich dicht gebeugt zwischen den Bäumen umher und versuchte herauszufinden, wer hier Vampirleichen stahl. Ich roch keinen einzigen fremden Unsterblichen außer den Steens, mir und dem Toten. Sonst waren nur Sterbliche hier gewesen. Menschen, die in die Büsche gepinkelt hatten, Menschen, die vorbeigelaufen waren, und dann der wiederkehrende Geruch eines Mannes und einer Frau, die ganz nahe am Toten gewesen sein mussten.
Ihre Spur brach da ab, wo ein Fahrzeug geparkt hatte. Die Reifenabdrücke zeichneten sich im trockenen, sandigen Boden deutlich ab. Sie waren breit und ließen mich an einen Transporter denken, wie ihn auch die Steens fuhren. Schatten gruben sich in die Vertiefungen, wurden minütlich schärfer.
Verdammt. Die Sonne ging auf.
Ich war so in meine Arbeit vertieft gewesen, dass ich ihr keine Beachtung geschenkt hatte, bis meine Instinkte Alarm schlugen. Eilig ging ich zurück zu meinem Wagen und fuhr, so schnell es die vielen Kurven erlaubten, die Hügel hinauf.
Das zunehmende Licht ließ mein Herz rasen. Mit heulendem Motor und quietschenden Reifen nahm ich die letzte Kehre, dann sah ich es mit Erleichterung vor mir: ein Anwesen, das in seiner spektakulären Ausgefallenheit typisch war für die Hügel über Hollywood. Es bestand fast nur aus Dach und lehnte sich auf Stelzen weit über den Abgrund wie ein übermütiger Kletterer.
Ich parkte an der Straße, sprang aus dem Wagen und hastete bis zum Eingang, wo ich mich in den Schatten des weiß gestrichenen Gebäudes ducken konnte. Ich drückte die Klingel, und ein grimmig dreinblickender Ungar bat mich hinein.
Drinnen eilte Sallys Dienerin Sarah die Treppe hinauf und ließ mich überrascht innehalten. Sie lächelte, als sie mich sah, und verlangsamte ihren Schritt zu einem geschmeidigen Gleiten.
„Sarah. Was für eine Überraschung!“, sagte ich mit gemischten Gefühlen, denn ihre Zeiten als Dienerin waren offenbar vorbei.
Ich musterte sie von oben bis unten. Sie sah aus wie Mitte zwanzig und hätte Sallys jüngere Schwester sein können. In Bluejeans, einer gemusterten luftigen Bluse und mit ihren blutrot geschminkten Lippen wirkte sie wie eine unbeschwerte Studentin, die sie nun für immer bleiben würde. „Neulich noch das blühende Leben, und jetzt bist du tot?“
Sie ergriff meine Hände und lachte breit. In ihren Wangen bildeten sich Grübchen, und ihre neuen spitzen Zähne glänzten wie poliert.
„Sally hat es gemacht“, antwortete sie stolz.
Ich drückte sie an mich, und sie erwiderte meine Umarmung.
„Ich hoffe, du bereust es nie.“
„Bestimmt nicht“, antwortete sie ernst, dann löste sie sich von mir. „Die Sonne geht auf.“
„Ja, ich weiß, geh nur.“
Sie lächelte noch einmal, dann verschwand sie die Treppe hinunter. Ich sah ihr nach und atmete den Geruch dieses vertrauten Ortes ein.
Ich war lange nicht mehr hier gewesen, aber es hatte sich kaum etwas verändert. Alles sah aus wie immer. Von einer Empore blickte ich hinab ins Wohnzimmer. Die Südseite bestand vollständig aus Fenstern, die bereits von Jalousien verdunkelt wurden.
„Julius! Das ist aber eine Überraschung!“, tönte eine weiche, tiefe Frauenstimme von unten. Ich lief eine enge Wendeltreppe hinab, und dort saß sie auf einem der weißen Sofas: Liliana, die Meisterin der Hollywood Hills, schön wie eh und je.
Ich ergriff ihre Hand und hauchte einen Kuss über zarte Knöchel. Sie trug ein langes graues Kleid, das ihre Schultern freiließ. Über ihre Arme flossen dunkelblaue Ornamente, keltische Tätowierungen, lebendig wie Schlangen.
„Nicht so förmlich, Julius“, lachte sie, zog ihre Hände aus meinen und umarmte mich.
„Hast du ein Plätzchen frei? Der Tag bricht an und es ist zu weit zu meinem Haus.“
„Aber natürlich, du bist jederzeit willkommen, und das weißt du. Wollen wir hinuntergehen?“
„Gerne, Herrin.“ Ich kannte den Weg hinab in den Felsen, wo die Schlafkammern lagen, und geleitete Liliana am Arm die Treppe entlang.
„Was hat dich so spät in unsere Gegend verschlagen? Laut Sally hast du den Neuen doch schon vor Stunden erledigt.“
Ich berichtete ihr kurz, was ich über die gestohlenen Leichen wusste.
„Das ist in der Tat merkwürdig“, sagte sie und runzelte nachdenklich die Stirn, ließ das Thema aber auf sich beruhen.
Ich war lange nicht mehr hier unten gewesen, doch in den Jahren hatte sich kaum etwas geändert. Wir waren in einem kurzen Flur angelangt, von dem drei Türen abgingen. Aus zwei der Räume klangen Stimmen.
„Ich würde mich freuen, wenn du bei mir bleibst, aber ich habe auch einen freien Sarg bei den anderen.“
Anstatt zu antworten, öffnete ich die Tür zu Lilianas Kammer und trat ein. Nach dem Intermezzo mit Christina war ich mir sicher, mich Lilianas Avancen heute problemlos widersetzen zu können. Die Meisterin folgte mir und schaltete eine Lampe an, die einen schwachen, warmen Lichtschein verbreitete.
Lilianas Kammer war klein, aber geschmackvoll. Drei Wände waren weiß verputzt, die vierte roher Fels, dunkles Parkett glänzte frisch geölt. Ein modernes schwarzes Sofa zeigte, dass die Meisterin zu den wenigen alten Vampiren zählte, die nicht in der Vergangenheit lebten.
Das riesige, neue Ölgemälde über ihrem Sarg sprach allerdings eine andere Sprache. Dort stand eine keltische Kriegsgöttin nackt auf den aufgetürmten, blutenden Leichen ihrer Feinde und lachte in einen finsteren Himmel. Morrigan. Die Todesgöttin auf dem Bild besaß erschreckende Ähnlichkeit mit der Frau an meiner Seite. Der Name der Göttin bedeutet Terror, und genau das war Liliana in den Augen ihrer Feinde.
„Gefällt es dir, mein Jäger?“, säuselte sie und schlang ihre Arme um mich.
Ich lehnte meinen Kopf gegen ihren. „Das Gemälde wird deiner Schönheit nicht gerecht, aber es macht hungrig.“
Liliana lachte und zeigte ihre scharfen Zähne, dann ließ sie mich los und huschte zu ihrem Sarg, so schnell, dass ich kaum mit den Augen folgen konnte. Sie öffnete den Deckel, streifte mit einer eleganten Handbewegung die dünnen Träger ihres Kleides von den Schultern und stand plötzlich in Unterwäsche vor mir. Ich starrte.
„Komm, beeil dich, dann können wir uns noch ein bisschen … unterhalten.“
Augenblicke später lag ich neben ihr im Sarg auf dem Rücken und die Meisterin bettete den Kopf auf meine Schulter.
Ihre langen schwarzen Haare waren seidenweich. Meine Finger ertasteten die hauchfeinen Erhebungen, die die Tätowierungen unter ihrer Haut verrieten. Es war eine vertraute Berührung, doch heute löste sie kaum etwas in mir aus.
„Was macht eigentlich deine Dienerin?“, fragte Liliana, als sie meine Zurückhaltung spürte.
Beklommenheit legte sich auf meine Brust. Amber. „Das ist keine gute Frage, nicht jetzt.“
Sacht legte Liliana ihre Lippen auf den Puls an meiner Kehle. Ihre Berührung ließ mich wohlig erschauern.
„Das heißt, kein Sex nach dem Aufwachen?“
Ihre Direktheit ließ mich kurz auflachen. Ich küsste sie auf die Stirn. „Nein. Du hast genug Liebhaber in deinem Clan, Liliana.“
„Findest du? Wie schade.“ Sie lachte, dann kam der Tod zu uns.
***
Im Verborgenen …
Grelle Neonröhren radierten jeden Schatten vom Körper des neugeborenen Vampirs. Ihr Licht brach sich in der kleinen Lache Flüssigkeit, die aus dem Stumpf sickerte, der einmal sein Hals gewesen war.
Zwei Männer standen bei dem Metalltisch und betrachteten den Toten. Einer hielt bereits ein Messer in der Hand und schützte seine Kleidung durch eine Plastikschürze. Sein Gegenüber trug ein altmodisches rotes Gewand, in dessen breiter Schärpe ein verzierter Dolch und mehrere kleine Holzpuppen steckten.
„Als wir ankamen, war er leider schon völlig ausgeblutet“, sagte der mit den Messern.
„Daran können wir jetzt nichts mehr ändern“, erwiderte der Voodoo-Priester, während er den Metalltisch mit der Vampirleiche umrundete. Er trat näher, drehte den abgetrennten Kopf um und schob dessen Oberlippe hoch.
„Die sind nicht lang genug, das verringert den Preis.“
„Dieser Killer war zu schnell da“, erwiderte der Fahrer, der jetzt den Job eines Metzgers übernommen hatte, entschuldigend.
„Fangt an.“
„Ja, sofort.“ Mit raschen Bewegungen trennte der Fahrer die Hände an den Gelenken ab und legte sie auf ein kleines Tablett.
Der Voodoo-Priester hatte ihm den Rücken zugedreht und war im Begriff, den Raum zu verlassen. Erst als der Fahrer den Hexer nicht mehr sah, löste sich der unangenehme Druck in seinem Magen. Ohne zu säumen, machte er sich daran, den Körper des Vampirs zu zerlegen.
***
Julius
Als meine Seele in den Körper zurückkehrte, musste Liliana schon eine Weile wach neben mir gelegen haben. Ich hatte geträumt, Amber sei zu mir zurückgekommen. So erlag ich kurz der Vorstellung, dass sie es war, die neben mir ruhte. Ich bemerkte meinen Irrtum schnell.
Lilianas Körper war kalt wie der Felsen, in dem ihre Kammer lag. Anstelle von Wärme entwich ihrer Haut der frostige Hauch eines Vampirs.
Doch zumindest nahm sie mir den Schmerz des Erwachens, massierte mir die Hände, bis sie wieder Gefühl hatten.
Aus den anderen Räumen drangen Gesprächsfetzen und die Geräusche sich öffnender Särge. Auch Liliana stieß den Deckel auf und angelte nach einer Fernbedienung. Gedimmtes Licht ließ die Schwärze verblassen und graue Form gewinnen.
„Wie macht sich Kerí?“, fragte sie unvermittelt.
Ich zuckte mit den Schultern. „Ehrliche Antwort?“
„Ja, bitte.“
„Es wäre besser gewesen, einen älteren Unsterblichen als neuen Jäger auszuwählen. Kerí ist zwar stark, aber ihm fehlt etwas.“
„Das Talent.“ Eine Feststellung. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Liliana war anzusehen, wie sehr es ihr missfiel, dass ihr junger Liebhaber den Anforderungen nicht genügte.
„Hast du nicht jemand anderen im Clan, jemanden, der besser passt?“
„Ich würde den Posten ja gerne selbst übernehmen, aber ich darf nicht. Clanherrin zu sein, ist nicht immer von Vorteil. Ich werde mir etwas überlegen. Mein Schöpfer hat mir zwei ältere Vampire aus Frankreich geschickt. Vielleicht ist einer von ihnen besser geeignet. Ich habe sie dir noch gar nicht vorgestellt.“
„Ich würde mich freuen, sie kennenzulernen. Das ist großzügig von Monsieur Martell.“
„Ja. Nachdem ich im Kampf gegen Gordon so viele verloren hatte …“ Sie sprach nicht weiter, und ich rührte nicht an den schmerzhaften Erinnerungen.
Nachdem wir uns frisch gemacht hatten, gingen wir ins Wohnzimmer, und Liliana rief ihre Neuen herbei. Es waren ein Mann und eine Frau, die ihr sterbliches Leben beide mit Ende dreißig beendet hatten.
Liliana stellte mir zuerst Marlis vor, eine zierliche, mittelblonde Frau mit rundlichem Gesicht, wie es auf alten Gemälden oft zu sehen war. Ihre großen, ausdrucksstarken Augen schienen Welten zu beherbergen, aber die Entschlossenheit, die die Arbeit als Henker erforderte, fand ich in ihnen nicht.
„Und das ist Jean. An ihn hatte ich gedacht.“
Ich gab Jean die Hand und musterte ihn. Er war so alt wie ich und hatte eine sehnige Statur, eine auffällige Adlernase und einen schmalen Mund. Seine Energie war stark und stetig.
Ich nickte Liliana unmerklich zu, und sie teilte Jean unsere Überlegungen mit.
Er schien nicht überrascht. „Ich habe vor einigen Jahren unserem Scharfrichter assistiert. Ich würde diese Aufgabe durchaus übernehmen, ich liebe die Jagd.“ Seine Stimme war von einem schweren Akzent gefärbt.
Ich musterte ihn. Konnte es wirklich so einfach sein? „Jäger sind hier nicht gerne gesehen“, warnte ich.
„Das schlechte Ansehen schreckt mich nicht“, erwiderte Jean und straffte die Schultern.
Liliana lächelte. „Gut, dann spreche ich mit dem Fürsten. Vielleicht trefft ihr euch bald mal für ein Probetraining.“
Ich nickte und verabschiedete mich.
Wenigstens eines meiner Probleme schien sich gerade in Wohlgefallen aufzulösen.
***
Nicolas
Nicolas Sarno saß auf seinem Sarg und starrte vor sich hin. Er zupfte an den geflochtenen Bändern, die fest um seinen Oberarm geknotet waren. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie sie dorthin gekommen waren, aber sie verhinderten, dass andere Vampire seine Energie spürten.
Er wanderte durch ihre Reviere, als sei er unsichtbar. Den einen oder anderen Unsterblichen hatte er sogar gesehen und ihm direkt in die Augen geblickt. Sie erkannten ihn nicht.
Eigentlich war Nicolas nach Los Angeles gekommen, um in einem der sechs großen Clans Aufnahme zu erbitten.
Er war einhundertdreiundachtzig Jahre alt, kein Meister, aber auch nicht schwach für diese Zahl an Jahren. Am liebsten wäre er für immer in seiner Heimatstadt Vail in den Bergen Colorados geblieben. Doch dann war sein Schöpfer in die Sonne gegangen. Trauer legte sich wie eine würgende Hand um Nicolas’ Hals. Er hatte keine Tränen mehr und der Schmerz zwang ihn nicht mehr in die Knie, doch er fühlte sich furchtbar allein. Wie hatte sein Meister das nur tun können?
Nicolas erinnerte sich noch genau, wie seine Seele plötzlich in den toten Körper zurückgerissen wurde, weil gerade etwas Schreckliches mit seinem Schöpfer geschah.
Keinem Vampir im Clan war entgangen, dass der Meister müde geworden war. Seine Seele hatte genug gesehen, sein Geist genug erlebt, genug erschaffen und zerstört. Alle Vampire in seinem Clan hofften, dass die Stimmung vorübergehen würde, doch die Zeit des Meisters war gekommen. Gemeinsam mit seinem Diener war er in die Berge gefahren. Dort hatte er sich auf eine Klippe gesetzt, das Gesicht nach Osten gewandt und den Tod erwartet. Er schirmte seine Vampire von dem Schmerz ab, doch sie alle wurden Zeuge, wie die Sonne aufging und ihn verbrannte. Es geschah langsam, denn zu Anfang war das Licht noch schwach gewesen.
Der Diener des Meisters stand die ganze Zeit dabei. Sah, wie sich die Haare seines Herrn in Asche auflösten, wie sein Gesicht brannte und seine Hände zitterten, während sich das Licht durch seinen Körper fraß. Als die Seele den geschundenen Leib endlich verließ, brach der Diener weinend in die Knie.
Mit einem Aufschrei stieß er sich eine Klinge ins Herz und kippte, den brennenden Körper seines Herrn mit sich ziehend, in eine Bergspalte.
Sie hatten es gut geplant, doch beide gingen sie ohne ein Wort, ohne eine Botschaft für die Zurückgebliebenen.
Die Vampire erwachten am Abend, die Herzen erfüllt von Trauer und Schmerz, die Seelen ohne Halt.
Nicolas war leer. Dort, wo seit unzähligen Jahren das feste Band gewesen war, das ihn an seinen Schöpfer schmiedete, war nichts mehr.
Es fühlte sich an, als würde ein Loch in seiner Seele klaffen. Anders konnte er es nicht beschreiben. Fortan wurde er von dem Bedürfnis getrieben, dieses Loch zu stopfen. Er brauchte einen neuen Herrn. Einen neuen Schwur, der ihn schützte und heilte.
Der Clan in Vail war klein gewesen, und die Mitglieder merkten schnell, dass sie nichts aneinander gebunden hatte außer dem Herrn, dem sie alle dienten.
Es gab keine Freundschaft und bis auf ein Paar auch keine Liebe. Keiner der Unsterblichen war stark genug, um selbst Clanherr zu werden. Die beiden jüngsten Vampire verloren den Verstand, und die übrigen taten sich zusammen, um sie zu töten. Gemeinsam tranken sie, bis die Herzen ihrer Opfer stehen blieben, dann schafften sie die bewusstlosen Vampire hinauf auf das Dach ihres Hauses, von wo sie nicht mehr fliehen konnten, und warteten auf den Morgen, darauf, dass die Sonne die beiden zu sich holte. Keiner hatte sie getötet, und doch waren sie alle zu Mördern geworden.
Mit diesem Wissen war Nicolas aufgebrochen, nach Westen, nach Kalifornien.
Seit Monaten gingen Geschichten vom Krieg der Clans umher, der in Los Angeles gewütet hatte. Die Gerüchte sprachen von Dutzenden, wenn nicht gar Hunderten toter Vampire, und das gab Nicolas Hoffnung.
Er wollte fort von den Bergen, fort von Colorado und allem, was ihn an sein vergangenes Dasein erinnerte. Die Chancen, in Los Angeles einen neuen Meister zu finden, standen besser denn je. Sicher hatte jeder Clan Verluste zu beklagen. Ein Vampir, der mehr als hundert Jahre zählte, war immer gern gesehen, besonders wenn es den Meister keine hohen Summen kostete, ihn aus einem anderen Herrschaftsverhältnis auszulösen.
Mit dieser Aussicht war er nach Los Angeles gekommen, doch jetzt hatte ihn der Mut verlassen.
Niemand würde ihn mehr wollen. Ein seltsamer Hunger, der fast schon an Raserei grenzte, hatte ihn befallen.
In den ersten Tagen war es noch nicht so gewesen. Aber jetzt konnte er nicht mehr jagen, ohne zu töten. Jedes Mal dachte er, es würde nicht wieder geschehen und dass er bei klarem Verstand und alt genug war, um seine Triebe unter Kontrolle zu haben. Doch dann passierte es erneut.
Sobald er zugebissen hatte, konnte er nicht mehr aufhören. Er trank das Blut, aber mehr noch das Leben, sog und zerrte daran, bis es ganz ihm gehörte, bis der Rausch kam und das Herz zu schlagen aufhörte und sich Nicolas’ Lippen wie von alleine von dem plötzlich toten Körper lösten.
Danach war Nicolas mit einem Mal wieder bei klarem Verstand und wusste, was zu tun war. Er verwandelte sein Opfer, denn wenn er es nicht tat, war er des Todes. Ein Jäger würde ihn aufspüren und hinrichten, weil er Menschen getötet hatte. So lautete das Gesetz, und er wusste darum und hielt es für richtig. Also schenkte er den Toten sein Blut, obwohl ihm klar war, dass er sie damit nur zu einem zweiten Tod verurteilte. Denn er konnte und durfte sich nicht um die Neugeborenen kümmern.
Nicolas durfte keine neuen Vampire schaffen. Er war meister- und heimatlos. Wenn er in einem fremden Revier begann, seine eigene Machtbasis zu schaffen, ohne die geringste Aussicht, sie verteidigen zu können, war alles verloren. Sie würden ihn schlachten und die jungen Vampire mit ihm. Nein, er durfte nicht mehr töten, und er brauchte einen neuen Herrn. Dringend!
Ein Meister würde die Leere in ihm füllen und ihm helfen können, seinen schrecklichen Hunger zu besiegen.
Nicolas beschloss, in der nächsten Nacht nicht auf die Jagd zu gehen. Vielleicht gelang es ihm, so lange zu hungern oder sich von Tieren zu ernähren, bis ein wenig Gras über die Sache gewachsen war und die Clanherren ihn nicht mehr mit den vielen Verwandlungen in Verbindung bringen würden. Wenn es gelang, hatte er noch eine Chance.
Doch wie lange würde er von Tieren leben können, ehe er den Verstand verlor und selbst zu einem wurde?
***
Julius
Ich hatte auf dem Rückweg von der Zuflucht der Mereleys gejagt, und nun kreiste das Blut einer Blondine warm und angenehm schwer in meinem Magen.
Als ich den Blinker setzte und vom überfüllten Santa Monica Boulevard abbog, wurde mir mulmig zumute. Ich fuhr im Schritttempo an der Friedhofsmauer entlang und parkte in Sichtweite unseres Hauses.
Wie Christina wohl auf mich reagieren würde, nach dem, was zwischen uns passiert war? Und Brandon … bereute er unser Gespräch schon? Mir war elend. Auch wenn es in den meisten Clans und Camarillas vorkam, dass sich Vampire wechselnde Liebschaften suchten, war unsere kleine Familie noch sehr fragil. Ich wünschte schon jetzt, all das wäre nie geschehen.
Als eine Windbö die Palmen am Straßenrand zum Schwanken brachte und ein Schauer reifer Früchte auf das Autodach trommelte, sah ich das als Aufforderung. Ich stieg aus und ging die wenigen Schritte bis zu unserem Heim.
Die Arbeiter waren tagsüber wie immer fleißig gewesen. Im Container lag ein Berg frischen Aushubs, und es waren Steine für die Kellerwände geliefert worden.
Meine Hand mit dem Schlüssel verharrte auf halbem Weg zur Haustür.
Ein erschreckend vertrauter Geruch hing in der Luft und weckte in mir ein Durcheinander der Gefühle.
Amber! Sofort flammte in jeder Faser meines Körpers Sehnsucht auf. Gleichzeitig fürchtete ich eine Begegnung aber auch.
Was tat sie hier? Ich wusste, dass sie sich hin und wieder mit Christina traf, aber nie hier im Haus. Und das ausgerechnet jetzt?! Wie sollte ich ihr unter die Augen treten? War zuvor meine größte Sorge noch das Zusammentreffen mit Chris und Brandon gewesen, so war mein Berg aus Problemen gerade zum Himalaja angewachsen.
Meine Gedanken überschlugen sich, ich wollte fliehen, doch ich musste sie sehen. Musste! Ich schloss auf und drückte die Tür auf, fast so zögerlich, als hätte mir jemand den Zugang zu meinem eigenen Haus versagt.
Als ich schließlich in den Flur trat und Ambers Duft an Intensität gewann, blieb ich wie berauscht stehen und schloss kurz die Augen. „Hallo?“
„Julius, Amber ist hier!“, rief mir Christina entgegen, als hätte ich nicht schon längst Bescheid gewusst. Dann rief sie mich über unsere Bindung. „Es tut mir so leid, Meister. Wir waren verabredet, und ich wollte schon absagen, aber Amber ließ sich nicht umstimmen, und sie hat darauf bestanden, herzukommen. Ich weiß selbst nicht … ich dachte, du seist nicht da … ich …“
„Schht, Chris. Hast du ihr davon erzählt?“
Entsetzen drang zu mir durch. „Nein, um Himmels willen, natürlich nicht. Und ich flehe dich an, es ebenfalls nicht zu tun!“
„Keine Sorge, ich habe noch mehr zu verlieren als du“, versicherte ich Chris.
Ich schloss die telepathische Bindung. Meine Schritte führten mich wie von selbst zur Küche, und da saß sie: meine Amber. Nach all den Wochen, ja Monaten ohne sie bekam ich bei ihrem Anblick weiche Knie. Unsicher lehnte ich mich neben der Tür an die Wand.
Amber trug wie so oft Schwarz, eine Jeans und ein T-Shirt mit einem mexikanischen Motiv. Eine kurze Lederjacke hing über dem Stuhl neben ihr. Das rotblonde Haar fiel ihr in leichten Wellen über die Schultern. Grünblaue Augen musterten mich mit der gleichen Intensität wie ich sie.
Schließlich sagte Amber: „Ich … ich dachte, du wärst nicht hier.“
„Soll ich wieder gehen?“
Sie schüttelte langsam den Kopf und sah auf ihren Teller.
„Wo warst du?“, fragte sie schließlich.
Ich konnte mir denken, dass sie eifersüchtig auf Liliana sein würde, denn Amber wusste von unserer Romanze. Aber das war seit vielen Jahren Vergangenheit. Und als wir noch ein Paar gewesen waren, hatten Amber und ich einander versprochen, ehrlich zueinander zu sein. „Ich habe den Tag in der Zuflucht der Mereleys verbracht“, sagte ich daher. „Ich hatte ganz in der Nähe zu tun und der Sonnenaufgang war schon zu nah, um die Rückfahrt zu riskieren.“
Skeptisch zog Amber die Augenbrauen hoch. Es fiel ihr sichtlich schwer, sich einen Kommentar zu verkneifen, und das machte mich froh. Demnach hatte sie noch Gefühle für mich.
Christina blickte von Amber zu mir. „Darf ich gehen, Meister?“ Die förmliche Anrede zeigte, dass sie wirklich nervös war. Die feinen Härchen auf ihren Armen hatten sich aufgerichtet. Ihr war die Situation noch unangenehmer als mir.
„Sicher, tu, was du willst, Chris.“
Sie flüchtete förmlich aus dem Raum. Amber sah ihr kurz hinterher, als wollte sie nicht mit mir allein sein, dann richtete sie den Blick auf ihre Hände.
Ich zog meine dünne Jacke aus und hängte sie über die Lehne eines freien Stuhls, dann legte ich das Schwert vor mir auf den Tisch.
Ambers Blick folgte meinen Fingern, die über den glatten Holzgriff strichen. Früher hätte sie beim Anblick der Waffe wohl einen giftigen Spruch von sich gegeben, aber heute schwieg sie. Scheinbar hatte sie meine Bestimmung zum Jäger und Henker akzeptiert, oder es war ihr seit unserer Trennung unwichtig geworden. Ablenkend sagte sie: „Du hast dir also wirklich die Haare abgeschnitten.“
Ich sah ihr an, dass sie ihr lang besser gefallen hatten, und strich mir durch die kurzen Strähnen. Wahrscheinlich war das einer der Gründe, warum ich es gemacht hatte. „Ich brauchte eine Veränderung.“
Sie nickte. So viele unausgesprochene Worte lagen zwischen uns.
„Wie geht es dir?“, fragte ich vorsichtig.
Sie zuckte mit den Schultern. „Meine Mutter hat sich gefreut, dass ich zurückgekommen bin, aber es ist nicht leicht. Auf der Arbeit ist alles wie immer. Wir haben zurzeit gut zu tun, ich bin meistens bis abends dort.“
„Jetzt weiß ich, wie es Charly geht und wie die Arbeit läuft. Aber was ist mit dir?“
Sie starrte mich an. Ihre Augen glänzten feucht, und ich bereute meine Frage sofort. „Ich kann nicht vergessen“, sagte sie mit leerer Stimme.
Ich ahnte, was sie meinte, fragte aber nicht nach, sondern ließ ihr Zeit, um nach den richtigen Worten zu suchen.
„Es ist Coe. Ich träume jede Nacht, wie er schreit und verbrennt, und dann dieser schreckliche Geruch. Wenn ich aufwache, habe ich den Eindruck, dass mein Zimmer danach stinkt, und ich, ich kann nicht …“
Ich beugte mich über den Tisch und nahm ihre linke Hand in meine. „Es tut mir leid, Amber.“
Sie versuchte, ihre Hand wegzuziehen, aber ich ließ nicht los. Ihre Schultern bebten. Ich wollte ihr helfen, wollte sie trösten, aber ich wusste nicht, wie.
„Darf ich die Siegel öffnen?“
„Nein“, sagte sie, doch es klang nicht überzeugend.
„Bitte.“
Sie hätte mich abwehren können, doch sie tat es nicht. Ich verrammelte jede Erinnerung an die Nacht mit Chris in meinen Gedanken, schloss die Augen und konzentrierte mich. Es war nicht wie früher. Ich hatte die Siegel dauerhaft geschlossen. Curtis hatte mir dabei geholfen, die Tore zuzumauern, die mich mit Amber verbanden. Nun fühlte ich sie nicht einmal mehr, außer, ich konzentrierte mich darauf. Deshalb hatte ich keine Ahnung von Ambers Albträumen.
Ich riss die Mauern ein. Als ich das erste Siegel befreite, atmete Amber auf, als sei eine große Last von ihr genommen worden. Zwei weitere Blockaden fielen, dann wurde ich vorsichtiger.
Sacht schob ich warme Lebenskraft hindurch und mit ihr meine Freude, Amber wiederzusehen.
Ihr Körper sog die positiven Gefühle auf wie ein Schwamm. Sie wurde ruhiger. Als sie schließlich ihre verweinten Augen öffnete, waren diese so gläsern und ozeantief wie an dem Tag auf dem Friedhof, als wir uns auf der Beerdigung ihres Bruders zum ersten Mal begegneten.
Sie sah mich an und legte ihre andere Hand auf die meine, drückte sie. „Danke.“
Ich wusste nicht, wo ich hinsehen sollte, und starrte schließlich auf die Holzmaserung des Küchentischs, verfolgte helle und dunkle Linien, suchte Symmetrie, wo es keine gab, nur, um nicht Amber anschauen zu müssen.
Sie schwieg und ich fühlte ihren Blick auf mir ruhen, als hätte er ein eigenes Gewicht. Wieder suchte mich mein schlechtes Gewissen heim. Ahnte sie etwas? Nein.
„Es ist schrecklich einsam ohne dich“, sagte ich leise.
„Julius, nicht.“ Sofort zog sie ihre Hand weg und drückte sie an sich, als wäre meine Berührung plötzlich schmerzhaft geworden.
„Entschuldige, ich wollte nicht …“, stammelte ich und hätte meine Worte am liebsten vergessen gemacht.
„Ist schon gut“, erwiderte sie weich.
„Wenn du wirklich vergessen möchtest, könnte Curtis dir helfen. Der Meister ist wahrscheinlich stark genug, um die Erinnerungen für immer zu verbannen.“
Sie schüttelte den Kopf. „Nein. Ich muss auch so damit klarkommen, ohne irgendwelche Zaubertricks. Zu vergessen ändert nichts daran, dass ich es getan habe. Leugnen wäre noch schlimmer. Ich will nur wieder ein ganz normales Leben führen, Julius. Ohne Vampire und Untote.“
Das erschreckte mich. „Aber du hast doch gesagt, du willst den Kontakt zu uns aufrechterhalten und brauchst nur ein wenig Zeit für dich. Ich dachte, wenn du dich wieder sortiert hast, könnten wir zumindest Freunde sein!“
Sie sah mich lange an. „Wir sind jetzt drei Monate getrennt, und wenn ich dich ansehe, tut es so weh, als seien erst zwei Tage vergangen. Ich weiß nicht, wie eine Freundschaft funktionieren soll, ohne dass wir leiden.“
Wut verdrängte meine Trauer. „Ich kann die Gefühle für dich auch nicht einfach so abtöten, Amber.“ Ich stieß den Stuhl zurück und stand auf.
Wie erstarrt blieb sie sitzen. „Vielleicht suchst du dir einfach eine neue Freundin, dann kann ich dich hassen und es fällt uns beiden leichter.“
Mein Zorn entlud sich mit einem Faustschlag gegen den Türrahmen, doch die Wut verpuffte so schnell wieder, wie sie gekommen war. Ich lehnte meine Stirn gegen das glatte, kühle Holz. Schlaglichtartig blitzten Erinnerungen an Christinas nackten Körper auf und trafen mich wie ein Hieb in den Magen. Ich kam mir wie ein Betrüger vor. Aber waren wir nicht getrennt? Amber hatte mich verlassen, auch wenn es mir bis zu diesem Augenblick vielleicht nicht hundertprozentig klar gewesen war.
Es war aus. Aus und vorbei!
Die Haustür wurde geöffnet und Brandon kam in seinem schmutzigen Overall herein. Nicht auch noch er, nicht ausgerechnet jetzt! Er stellte seinen Werkzeugkoffer ab und zog die ölverschmierten Schuhe aus.
„Ist Amber da?“, fragte er und reckte sein Gesicht kaum merklich in den schwachen Windzug, der durch den Flur schwebte.
„Ja, sie ist hier in der Küche.“ Ich riss mich zusammen und setzte mich wieder auf den Stuhl, als sei nichts gewesen.
Brandon kam nach mir herein und reckte Amber seine Hand entgegen. „Entschuldige, ist schon gewaschen, aber das Öl ist hartnäckig“, sagte er und grinste. „Schön, dich mal wieder zu sehen.“
„Ja, ist eine Weile her. Du siehst besser aus, wie geht es dir?“
Er zuckte mit den Schultern, und das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht. Es gelang Brandon, sämtliche Gefühle aus seiner Miene zu verbannen, und ihm dabei zuzusehen war geradezu unheimlich. Ich witterte nach seinen Emotionen. Trug er mir nach, was geschehen war? Zu meinem Erstaunen nicht. Seine Treue war unverbrüchlich. Er hatte jedes Wort so gemeint, wie er es gesagt hatte. Nach einem Blick zu mir, der mir wohl zu verstehen geben sollte, dass alles in Ordnung war, wandte er sich Amber zu.
„Es geht. Wird schon“, brachte er hervor, dann musterte er uns prüfend. Er konnte Trauer und Wut riechen.
„Störe ich euch?“
Ich schüttelte gleichzeitig mit Amber den Kopf.
Brandon gewann seine gute Laune erstaunlich schnell zurück. Er griff in seinen Overall, zog ein Bündel Dollarscheine hervor und legte sie vor mir auf den Tisch. „Für das Haus“, sagte er stolz.
„Behalte es und richte damit die Zimmer für dich und Chris ein. Es ist höchste Zeit.“
„Danke, Julius!“ Er strahlte über das ganze Gesicht und steckte das Geld ein. Einen Augenblick lang hätte man meinen können, ihm sei nie etwas Böses widerfahren. „Der Discounter hat noch auf, vielleicht bekommen wir heute Nacht noch Farbe“, fuhr er fort. Er griff erneut in seinen Overall und reichte mir einen Umschlag.
„Sorry“, sagte er nur und ging.
Amber sah ihm nach, dann traf mich ihr kritischer Blick. „Muss er sein Geld bei dir abgeben wie bei einem Gangsterboss?“
Ich ignorierte ihren schnippischen Tonfall und erklärte: „Das Gericht in Phoenix hat die Hälfte meines Besitzes gefordert, um die Todesstrafe gegen ihn aufzuheben. Danach reichte es gerade eben so für dieses Haus und die ersten Umbauten. Jetzt bin ich so ziemlich pleite. Wir machen schon so viel wie möglich selbst, aber Andrassy lässt sich seine Arbeiter gut bezahlen. Brandon besteht darauf, das Geld bei mir abzustottern, das scheint für ihn eine Frage der Ehre zu sein.“
„Das wird er wohl nicht so schnell schaffen“, sagte Amber und lächelte zögernd.
„Nein, aber das ist egal. Ich hätte alles gegeben, um ihn freizukaufen, selbst wenn wir danach nackt in der Erde hätten schlafen müssen.“
Sie nickte ernst. „Ganz gleich, was Curtis sagt, ich glaube, du bist ein guter Meister.“
Ihre Worte taten wohl, aber ich wusste um die Wahrheit. „Ich mache Fehler, und davon nicht wenige. Curtis findet, ich lasse es an der nötigen Distanz fehlen, aber ich habe in all den Jahren bei ihm nichts mehr ersehnt als Nähe. Ich glaube, es funktioniert auch anders. Warum sollten sie mich weniger akzeptieren, nur weil sie mich nicht ständig fürchten müssen? Es gibt auch so schon genug Vampire, die Angst vor mir haben, weil ich Jäger bin.“
Unwillkürlich senkte sich mein Blick auf den Umschlag vor mir. Wieder ein Todesurteil.
Amber schien meine Gedanken gelesen zu haben. „Du starrst das Ding an, als ob du Post vom Teufel höchstpersönlich bekommen hast.“
Ich überlegte, was ich sagen sollte, und entschied mich für die Wahrheit. „Ein unbekannter Vampir verwandelt seine Opfer und lässt sie dann im Stich. Seit Tagen bekomme ich jeden Abend einen Brief wie diesen.“
„Hinrichtungsbefehle?“
„Ja. Und nicht für erfahrene Vampire, die ein Verbrechen begangen haben, sondern für Neuerschaffene, die es nicht besser wussten. Sie müssen verschwinden, aber sie tun mir auch leid.“
Amber nickte. Sie wollte nicht mehr wissen. Ihr Blick fiel auf mein Schwert und blieb daran haften. Ja, auch heute Nacht würde wieder Blut die Klinge röten.
„Und als sei das noch nicht genug, stiehlt jemand die Leichen“, fuhr ich fort.
Überrascht blickte Amber auf. „Warum?“
„Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es hängt beides miteinander zusammen. Der Vampir und der Dieb machen gemeinsame Sache.“
„Musst du herausfinden, wer es ist?“
„Ich muss nicht, ich will. Aber ich weiß nicht, wie. Ich wüsste, was zu tun wäre, damit sie die Toten nicht bekommen: einfach so lange dableiben, bis sie von den richtigen Leuten weggeholt werden. Aber dadurch verlagert sich das Problem nur.“
Amber schwieg nachdenklich und zog die Brauen zusammen. „Könntest du mit einer Dienerin an deiner Seite mehr ausrichten?“, fragte sie zögerlich.
„Dadurch hätte ich natürlich mehr Optionen.“ Hoffnung schlich sich in mein Herz, doch ich hatte Amber ein Versprechen gegeben. „Aber es wird auch so gehen. Ich will es uns nicht noch schwerer machen, und du hast eine Entscheidung getroffen, die ich zu akzeptieren gedenke.“
„Noch bin ich deine Dienerin, Julius, Abstand hin oder her. Wenn du mich wirklich brauchst und ich dadurch keine weiteren Albträume bekomme, mache ich es.“
„Danke.“ Ich starrte auf meine Hände. Ich wusste selbst nicht, was ich wollte. Es tat weh, Amber hier sitzen zu sehen und zu wissen, dass sie nicht mein war, dass ich sie nicht berühren durfte und wir unsere Zukunft nicht teilen würden.
„Du müsstest dich dort verstecken und ich würde sie durch deine Augen beobachten. Dann könnte ich herausfinden, wer und vor allem was sie sind.“
„Dann hätte ich dich also wieder in meinem Kopf, wie früher?“
„Nur ein paar Minuten, eine halbe Stunde vielleicht, nicht mehr.“
„Gut, aber ich habe eine Bedingung. Du schwörst mir, weder meine Gedanken anzurühren noch meine Gefühle.“
„Versprochen.“ Mir war das im Augenblick nur recht so. Die Erinnerung an Christina war aufwühlend und noch zu frisch. Wenn ich Ambers Gedanken las, würde sie womöglich auch einen Blick in meine erhaschen. Das durfte nicht sein, nicht, bevor ich meinen Ausrutscher mit Chris im hintersten Winkel meines Herzens verschlossen hatte.
Ich griff nach dem Umschlag und schlitzte ihn mit einem Küchenmesser auf. Es war das Schreiben, das ich erwartet hatte. Ich seufzte.
„Und?“
„Nicht weit von hier, fast schon bei dir, Silverlake. Das ist das Revier von Cottington, die Meisterin meldet eine Verwandlung. Es gab noch keinen Toten, aber das wird sich mit Sicherheit ändern, wenn ich nicht vorher eingreifen kann.“
„Woher weiß man ohne Toten überhaupt davon?“
„Das Clanoberhaupt fühlt die Magie, wenn eine Verwandlung stattfindet, und in Cottingtons Revier dürfen Vampire nur mit ihrer Erlaubnis neue Unsterbliche schaffen.“
„Warum bringt sie ihn dann nicht selbst um?“
„Sie darf nicht. Sie ist keine Jägerin. Die Zeiten, in denen man Neugeschaffene einfach töten konnte, wenn man sie fand, sind vorbei. Ihr Menschen habt ja auch keine Lynchjustiz mehr.“
Amber nickte. „Gut, dann lass uns aufbrechen.“
Ich war erleichtert. „Danke, ich hole meine Sachen. Ich schwöre, dass ich es so kurz halte wie möglich.“
Ich eilte die Treppe hinauf in meinen Raum. Das Bett war noch immer zerwühlt, schrie geradezu heraus, was sich hier abgespielt hatte. Bevor ich zu meinem Waffenschrank ging, zog ich die Bettdecke gerade und schüttelte die Kissen auf. Jetzt sah es zumindest unbenutzt aus.
Als ich gerade dabei war, neue Bolzen für die kleine Armbrust zusammenzusuchen, stand Amber im Türrahmen. „Hier versteckst du dich also.“
„Komm ruhig rein.“
Als Amber das Bett in Augenschein nahm, wäre ich vor Scham am liebsten im Boden versunken. Auf dem hohen Kopfteil prangten zwei geschnitzte Greife, die verschlungene Ranken in ihren Klauen hielten. Masken starrten von den vier Pfosten hinab, die den Himmel hielten.
„Das ist schön“, sagte sie und strich über die dunkelblauen Samtvorhänge. „Historismus, oder?“
„Zwischen 1850 und 1870, französisch, ein Hochzeitsbett“, presste ich hervor. „Ich habe es gekauft, bevor ich die Strafe antrat, als ich noch Geld hatte. Die Lieferung aus Übersee hat lange gedauert.“
Ich ging zu Amber und blieb unsicher vor ihr stehen. „Ich konnte ja nicht wissen, dass …“
„… dass wir nicht mehr zusammen sein werden“, vervollständigte sie meinen Satz.
Ich nickte.
Wir sahen uns tief in die Augen, und für einen Herzschlag dachte ich, dass sie mich küssen würde, doch dann drehte sie mir den Rücken zu und starrte auf die Regale mit meinen Büchern. Ich wartete darauf, dass sie sich wieder umdrehte, aber das tat sie nicht.
Ich erklärte Amber, wo der neugeborene Vampir vermutet wurde, und wir brachten die Fahrt schnell hinter uns. Ich fühlte den Unsterblichen bereits, als ich noch einige Häuser weit entfernt war. Es war eine schäbige, kleine Straße mit einigen Läden. Schwere Eisengitter versperrten um diese Zeit Eingänge und Schaufenster.
Ich las die Reklameschilder. Eine Bäckerei, Pfandläden, Second-Hand-Kleidung und schließlich ein Schlüsselmacher und Graveur. Neben einigen Müllcontainern hielt Amber kurz an und ließ mich aussteigen, dann fuhr sie weiter.
Der Geruch faulender Abfälle färbte die Luft und ließ mich auf das Atmen verzichten. Die Erschütterungen, die meine lautlosen Schritte verursachten, trieben die Kakerlaken in Wellen vor mir her, bis sie in einer Ritze oder Mauerspalte verschwanden.
Ich war stehen geblieben und verglich die Hausnummer mit der auf meinem Zettel. Sie stimmten überein.
Dass der Vampir noch immer in dem Gebäude war, verrieten mir meine Instinkte. Seine Energie war fühlbar wie ein steter, kalter Windhauch.
Außer ihm befand sich niemand in dem Haus – jedenfalls niemand, der noch lebte. Der feine Duft von Blut reizte meine Sinne. Es war nicht mehr ganz frisch, zu alt, um hungrig zu machen.
Der Tod hatte dieses Haus schon eine Weile vor mir besucht.
Ich blickte mich noch einmal um, dann besah ich mir das Türschloss genauer. Es war von einfacher Machart. Ein wenig absurd war es schon, dass ich ausgerechnet bei einem Schlüsselmacher einbrach.
Kurz suchte ich in meinem Etui nach dem richtigen Werkzeug, dann sprang die Tür unter leisem Klacken auf. Ich schlich hinein und schloss sie hinter mir, ohne aufgehalten zu werden. Es waren tatsächlich alle Bewohner tot, keine Magie hinderte mich daran, die menschliche Behausung ungefragt zu betreten.
Ich fühlte den Vampir irgendwo unter mir. Er war im Keller, und er hatte Angst.
Die Klinge meines Schwertes sprang wie von selbst aus dem Griff.
Mit lautlosen Schritten trat ich in den Flur. Durch ein Milchglasfenster fiel das matte Licht der Nacht. Der Blutgeruch wurde mit jedem Schritt stärker.
Als ich die Kellertreppe erreichte, war ich mir sicher, dass der Vampir sein Opfer noch immer bei sich hatte. Ich war jetzt sehr nah. Wenn er mich auch nicht hörte, fühlen konnte er mich schon.
„Hallo? Ist da unten jemand?“, rief ich. „Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen, ich weiß, was mit Ihnen passiert. Keine Angst.“ Ich nutzte die Macht meiner Stimme und wiegte den anderen in Sicherheit. Er ließ sich von mir beruhigen wie ein ahnungsloser Mensch.
Im Flur brannte eine Lampe. Ihr schwaches Licht erhellte das untere Drittel der Treppe. Vorsichtig schlich ich in die Waschküche und weiter zu einem Kellerraum, der mit einer Brettertür abgeteilt war. Und dort hockte er zwischen Umzugskartons und einem verstaubten Schrank. Blutspritzer bedeckten Boden und Wände.
Er hielt etwas an seinen Körper gedrückt. Was ich in dem Dämmerlicht zuerst für einen Haufen Wäsche gehalten hatte, entpuppte sich als Körper einer zierlichen Frau. Der Vampir presste sie an sich und streichelte wie mechanisch ihr dunkles, blutverklebtes Haar. Er hatte untersetzte, schwere Züge und trug ein gelbes Shirt mit dem Namen seines Geschäfts, der sich um einen großen, lachenden Schlüssel wand.
„Wer ist das?“, fragte ich ruhig und wies auf die Tote.
„Meine Frau“, wimmerte er. „Ich habe sie umgebracht. Ich bin ein Monster.“
„Nein, Monster sind die, die dich zu dem gemacht haben, was du bist.“
Er starrte mich mit großen rabenschwarzen Augen an und verstand nichts.
„Lass sie los und komm zu mir.“ Ich streckte ihm einladend die Hand entgegen. Ich, der Tod.
Der Mann kam. Er erhob sich, als sei er unendlich müde, und schwankte auf dem kurzen Weg zu mir. Ich legte mein Schwert auf einem alten Kabinettschrank ab und trat um den untoten Schlüsselmacher herum.
Ich trank mit geschlossenen Augen von ihm.
Der neugeborene Vampir schmeckte nach dem gleichen Meister wie die anderen, aber vor allem nach Furcht und bitterer Schuld.
Ich schluckte und wuchs an seiner Kraft, während ich mich durch seine Erinnerung wühlte wie durch einen Stapel Papier. Schließlich, als sein Herz mit letzter Kraft schlug, fand ich seinen Schöpfer und Henker. Der Vampir war männlich. Ein Weißer Anfang vierzig, fast so neutral und schnell zu vergessen wie die Steens. Grüne Augen, viel grüner noch als Ambers, und ein Siegelring mit einem roten Stein waren das Auffälligste an ihm.
Der sterbende Vampir zitterte und brach zusammen. Ich ging mit ihm in die Knie, ertrank schier im Rausch seines Todes.
Die Waschküche verwandelte sich in den schönsten Palast, alles erglänzte, leuchtete, und ich schmeckte den letzten Herzschlag wie den verklingenden Ton einer wunderschönen Melodie.
Schließlich verblassten die Farben.
Ich stand auf, fasste den leblosen Körper an einem Arm und zog ihn ein Stück, bis er gerade auf dem Rücken lag.
Die dunklen Augen sahen bereits tot aus. Fischaugen.
Ich nahm das Schwert auf und enthauptete mein Opfer mit einem Streich. Der Kopf rollte zur Seite. Ich griff ins Haar, hob ihn hoch und platzierte das Haupt zwischen den Beinen.
Dann nahm ich das Gerichtsurteil aus der Tasche, faltete es zusammen und legte es auf die Brust des Mannes.
Nachdem ich mich an einem Waschbecken gereinigt und mir den Mund ausgespült hatte, öffnete ich die Siegel. „Ich bin fertig.“
Ich verließ das Haus durch die Vordertür und schickte Claire Steen meinen Standort. Ich vermutete, dass die Leichendiebe irgendwie meine Nachrichten abfingen. Mit etwas Glück würden sie also bald hier sein.
Ich bog in die nächste schmale Seitenstraße ab, nutzte eine Lücke zwischen einem Transporter und einigen hohen Büschen und war damit von der Hauptstraße aus nicht mehr zu sehen. Dann schloss ich die Augen und versuchte, Verbindung zu Amber aufzunehmen, die mich auch sofort erhörte. Sie hielt direkt gegenüber dem Laden auf einem Parkplatz und stand mit dem Heck zur Straße. Tief in den Sitz gepresst, war sie quasi unsichtbar, hatte aber über die Außenspiegel alles im Blick.
Es war ein traumhaftes Gefühl, endlich wieder in ihren Körper zu tauchen. Jede Faser von ihr begrüßte mich wie einen lang vermissten Freund, und einmal mehr konnte ich spüren, was es bedeutete, eine Dienerin zu haben.
Ihr Leib war mein, und meiner gehörte ihr. Wie mochte es sich erst anfühlen, alle fünf Siegel mit einem Menschen zu tauschen?
Ihr Körper verriet mir, dass sie sich seit unserer Trennung matt gefühlt hatte. Ein steter, dumpfer Schmerz laugte sie aus. Jetzt verschwand er. Die Siegel waren letztlich nicht dafür gemacht, dauerhaft verschlossen zu werden, auch wenn es möglich war.
Amber drückte wohlig den Rücken durch und wollte gerade die Augen schließen, als ihr plötzlich bewusst wurde, was sie im Begriff war zu tun.
Panik huschte durch ihren Verstand. „Was machst du mit mir?“
„Nichts, ich halte mich an unsere Abmachung. Es sind die Siegel. Nach der langen Trennung fühlt es sich merkwürdig an. Ich spüre es auch.“
„Wag es nicht, in meinen Gedanken herumzupfuschen.“
„Versprochen. Konzentrieren wir uns auf unsere Aufgabe.“
Minuten verstrichen, in denen sie den Laden des Schlüsselmachers beobachtete und ich versuchte, mich möglichst still und heimlich an ihrem Körper zu erfreuen. Er erschien meinem Geist wie ein zweites, ungleich schöneres Zuhause.
„Schau, da kommt jemand … oder nein, das ist nur irgendein privater Wachdienst.“
Ich sah, was sie sah: einen dunkelblauen Transporter mit der Aufschrift „C & R Security Services“. Der Wagen fuhr langsam die Straße hinunter.
„Ein Wachdienst in dieser Gegend? Das glaube ich nicht. Die Reifenspuren könnten zu dem Auto passen, mit dem die Leiche in den Hollywood Hills abtransportiert wurde.“
Amber drückte sich noch tiefer in den Sitz. Ihr Körper bebte vor Anspannung.
Der Wagen hielt direkt vor dem Geschäft des toten Schlüsselmachers.
Zwei Personen stiegen aus. Ich konnte sie in der Dunkelheit durch den Rückspiegel kaum erkennen.
„Das wird sich jetzt vielleicht etwas komisch anfühlen, Amber“, warnte ich.
„Was hast du vor?“
„Ich benutze meine Kräfte durch dich. Ich muss wissen, was das für Leute sind, aber wenn meine Magie direkt zu ihnen vordringt, erkennen sie mich vielleicht und fliehen.“ Mit den letzten Worten schickte ich meine Kraft durch die Siegel in Ambers Herz.
„Es ist kalt!“, sagte Amber erschrocken und presste beide Hände auf die Brust.
Es war unangenehm für sie, und doch wehrte sie sich nicht.
„Schrecklich kalt“, wiederholte sie nur mit klappernden Zähnen.
„Ist gleich vorbei“, beruhigte ich sie.
Ich sah durch Ambers Körper. Schwach war noch die Energie des toten Vampirs zu fühlen, doch darüber, viel dominanter, brannten die Leben der beiden falschen Wachleute.
Amber zitterte mittlerweile am ganzen Körper. Ich fühlte, wie sie müde wurde, ihr Kopf nickte vor, sie schlief ein.
„Es sind einfach nur Menschen!“, rief ich erfreut und zog meine Magie wieder zurück. Schlagartig ruckte Amber wieder hoch.
Ich würde die beiden Männer aufhalten und zur Rede stellen können, ohne Verstärkung anfordern zu müssen. Mit dem Fuß spannte ich meine Armbrust, legte einen Bolzen ein und verband ihn mit dem Metallfaden der Spule.
„Rühr dich nicht, ich komme!“, rief ich Amber zu, dann schloss ich die Siegel. Sie sollte nicht wissen, wie sehr ich es genießen würde, den beiden Männern aufzulauern und sie zu jagen, und auch nicht, dass mich der Gedanke an Blutvergießen berauschte.
Ich lief aus der Gasse auf die menschenleere Straße und sah den Transporter schon von Weitem. Die Hecktüren standen offen. Was ich beobachtete, tilgte meine letzten Zweifel, ob wir die Richtigen verdächtigten. Die Männer hievten eine mannslange Holzkiste aus dem Wagen und trugen sie ins Haus. Darin wollten sie mit Sicherheit die Leiche transportieren.
Ich versteckte mich in einem Hauseingang und wartete, bis sie außer Sicht waren. Mit einem letzten Blick zu Amber verschwand ich hinter ihnen im Laden. Sie waren im Keller und unterhielten sich in einer tiefen, kehligen Sprache. Ich konnte nur raten, dass sie vom afrikanischen Kontinent stammten.
Lautlos durchquerte ich den Laden und verbarg mich auf der Treppe, die ins Obergeschoss führte.
Ich wollte sie überraschen, wenn sie auf dem Rückweg waren und den Toten trugen. Dann mussten sie die Kiste erst abstellen oder fallen lassen, bevor sie eine Waffe ziehen konnten. Ich drückte mich im Schatten an die Wand und wartete. Schleifgeräusche. Offenbar bewegten sie die Leiche gerade. Was sie wohl mit ihr vorhatten? Wofür brauchte jemand tote Vampire?
Ich hörte, wie der Körper mit einem dumpfen Poltern in der Holzkiste landete. Der Kopf folgte, dann wurde der Deckel wieder aufgesetzt. Mein Finger lag ruhig auf dem Abzugshahn. Ich hatte eine ideale Position, freien Blick auf die Treppe und dennoch ausreichend Deckung, falls mein Vorhaben schieflaufen sollte.
Die hölzernen Stufen knarrten unter schweren Schritten. Der erste Mann schälte sich aus der Dunkelheit. Seine Haut war schwarz wie Ebenholz, die leuchtenden Augen waren vor Anstrengung zu Schlitzen verengt. Er war groß, drahtig. An den bloßen Unterarmen spannten sich die Sehnen. Narben von Schnittverletzungen glänzten im schwachen Licht.
Der zweite Mann stützte die schwere Kiste mit der Schulter. Als ich auch ihn zur Gänze sehen konnte, richtete ich meine Waffe auf sie und gab mich zu erkennen.
„Stehen bleiben! Den hier bekommt ihr nicht!“
Die Männer erstarrten in ihren Bewegungen. Der vordere sah zu mir auf, als sei er nicht überrascht, mich zu sehen, doch ich konnte riechen, dass er es trotzdem war. Unter dem merkwürdigen Kräuterdunst, der ihn umgab, nahm ich Adrenalin wahr. Ich machte eine Bewegung mit der Armbrust.
„Ganz langsam weitergehen“, befahl ich.
Die Männer gehorchten ohne Widerspruch. Ich ging die Treppe hinunter und folgte ihnen in geringem Abstand.
Plötzlich schrie der Hintere der beiden etwas.
Sie ließen die Kiste fallen und rannten los. Ich zielte auf die Rippen des Näheren, schoss und traf.
Der Bolzen bohrte sich mit einem dumpfen Knall in den Körper. Der Mann taumelte, fing sich und rannte weiter, dann arretierte das Seil und löste eine Mechanik aus. Die Spitze des Bolzens sprang auf und saß wie ein Anker hinter den Rippen. Der Mann wurde zurückgerissen und fiel der Länge nach hin. Ich fixierte die Armbrust an der Tür neben mir und lief mit gezücktem Schwert zu meiner Beute. Doch der Mann war nicht bereit, so schnell aufzugeben.
Geduckt wie eine Katze ging er in Lauerstellung. Eine große Klinge blitzte in seiner Hand. Wo kam die verdammte Machete her?
Er sprang auf mich zu und führte einen Angriff von unten. Ich parierte beidhändig und brachte mich in eine bessere Position. Mit einigen Schritten war ich tiefer im Laden. Der Mann folgte mir und griff erneut an, aber der Draht bot keinen Spielraum mehr und riss meinen Gegner auf die Knie. Ich schlug mit der flachen Seite der Schneide auf den Metallfaden und zwang den Mann damit auf den Rücken. Jetzt schrie er zum ersten Mal.
Ich sah mich rasch nach dem anderen um, doch ich hatte den Gegner zu meinen Füßen unterschätzt: Er nutzte die Gelegenheit, mit letzter Kraft die Machete zu schwingen. Ein scharfer Schmerz riss mich von den Beinen. Im Fallen rammte ich reflexartig den Stahl in die Brust meines Angreifers. Er zuckte und wand sich – dann nichts mehr.
Ich versuchte aufzustehen, doch meine Beine versagten. Plötzlich war der zweite Mann da und beugte sich über mich. Ich versuchte, mein Schwert freizubekommen, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig.
„Stirb, Dämon!“, schrie er und spuckte mich an.
Weißer Staub, Schmerz. Ich fiel.
***
Amber
Gerade noch hatte ich der gespenstischen Stille in der Straße gelauscht und darüber gegrübelt, wie ich so dumm sein konnte, überhaupt hier zu sein und Julius erneut bei seinem tödlichen Handwerk zu assistieren, nur um in seiner Nähe zu sein, als ich es fühlte: Etwas Schreckliches musste geschehen sein. Julius war fort! Die Siegel plötzlich leer!
Ich sprang aus dem Wagen und hielt inne. Ein Mann kam aus dem Laden gerannt, stieg in den Transporter und raste davon.
Sobald er außer Sicht war, überquerte ich die Straße und stieß die Haustür auf. „Julius!“
Er antwortete nicht. Mein Blick zuckte über die Ladeneinrichtung, Regale mit Pokalen, eine Theke, Werkbänke. Von hier aus konnte ich nichts erkennen. Als ich weiter hineinging, sah ich reglose Körper hinter einer großen Kiste liegen.
Einer von ihnen war Julius. Er lag verrenkt auf dem Rücken und blutete aus einer klaffenden Wunde am Unterschenkel. Sein Gesicht war mit einem weißen Puder bedeckt, in dem grüne Stückchen klebten. Die Augen hielt er weit aufgerissen, sie waren feuerrot. Ich sank neben ihm auf die Knie und schüttelte ihn an den Schultern.
„Verdammt, Julius, wach auf. Sie sind fort! Wach auf!“
Sein Körper war so steif, als sei bereits vor Stunden die Sonne aufgegangen. Ich ließ meine Hände über seine Arme gleiten, auch hier das Gleiche. Sie waren hart wie Holz – Totenstarre.
„Ruhig durchatmen, Amber. Das kannst du besser“, sagte ich leise. „Er ist nicht tot, nicht wirklich.“
Ich war mir sicher, dass ich seinen Tod durch die Siegel deutlich empfunden hätte. Vorsichtig legte ich eine Hand auf seine Brust, und wie erwartet herrschte Stille. Weder Atmung noch Herzschlag waren zu spüren. Dann fand ich die kleine Flamme, die auch bei Tag in Vampiren brennt, und durch meinen Körper strömte eine Welle der Erleichterung.
„Da bist du ja.“
Ich erinnerte mich daran, dass Julius Claire Steen angerufen hatte, und das war schon eine Weile her. Hilfe war also unterwegs. Kurzerhand zerriss ich Julius’ Shirt, band mit einer Hälfte das Bein ab und wischte mit der anderen das seltsame Pulver von seinem Gesicht, das scharf nach Kräutern roch. Was auch immer hier geschehen war – es hatte vermutlich mit diesem Zeug zu tun.
Julius’ Gesicht war verzerrt, als hätte er Schmerzen gehabt, während ihn die Totenstarre überraschte.
„Ich bin hier, ich bin bei dir, halte durch, Julius“, flüsterte ich und legte dabei meine Hand auf seine Brust, fühlte die erhärteten Muskeln, ließ sie über das Schlüsselbein gleiten, das etwas hervorragte, ertastete die Muttermale, die ich so gut kannte.
In Julius’ Nähe traute ich mir selbst nicht über den Weg. Ich hatte mich heute nicht grundlos unter Vorwänden in sein Haus eingeladen, obwohl ich spürte, dass es Chris überhaupt nicht recht war. Und ich hatte Julius auch nicht grundlos angeboten, ihm zu helfen. Die traurige Wahrheit lautete, dass ich es einfach nicht mehr ausgehalten hatte, ihn nicht zu sehen. Selbst jetzt, im toten Zustand, übte er noch eine gerade beängstigende Anziehungskraft auf mich aus. Würde ich denn niemals von ihm loskommen?
Ich hatte immer gewusst, dass in mir noch Gefühle für diesen Mann schlummerten, doch erst die nagenden Momente der Angst um sein Leben zeigten mir nun, wie tief sie wirklich waren. Von einer Sekunde auf die andere hatte ich vergessen, dass er gerade getötet hatte und in der Holzkiste neben ihm sein Opfer lag, kopflos, ausgeblutet. Vergaß ich, dass auch ich wegen ihm getötet hatte. Es war mir seltsam egal. Waren die Siegel schuld an alledem? Ließen sie nicht zu, dass ich die Liebe in mir abtötete?
Eines war sicher: Als ich Julius vor wenigen Stunden in die Küche treten sah, mit seinem traurigen Blick und all der Sehnsucht nach mir, die er zu verbergen versuchte, war mir klar geworden, dass ich nicht weniger für ihn empfand als noch vor Monaten, sondern mehr.
Ich hatte Tage verbracht, ohne ein einziges Mal an ihn zu denken, mich sogar einmal mit einem anderen Mann getroffen. Doch all das war mit einem Schlag wie ausgelöscht. Als Julius die Siegel öffnete, um mich zu trösten, hätte ich vor Freude weinen können, so wunderbar war das Gefühl. Dennoch lauerte dahinter wie ein Schatten noch immer die Erinnerung an Coe. Wieder betrachtete ich Julius, den schmerzverzerrten Mund, die zu Klauen gekrümmten Hände.
„Diese Mistkerle haben dir wehgetan.“ Ein flaues Gefühl stieg in mir auf. Sorge. Das, was mit ihm geschehen war, schien mehr zu sein als ein verfrühter Schlaf. Aber was? Wenn jemand Rat wusste, dann Curtis.
Zum ersten Mal schenkte ich dem Mann, der neben Julius lag, wirkliche Beachtung. Seine Haut war tiefschwarz, und in seiner Brust, genau im Herzen, steckte Julius’ Schwert.
Der Vampir, den Julius zuvor hingerichtet hatte, musste in der Holzkiste daneben liegen. Aus dem Boden des roh gezimmerten Sargs sickerte Blut. Ich wunderte mich, dass ich es jetzt erst bemerkte. Gerade als ich den Mut gefasst hatte, den Deckel zu heben, hörte ich ein Auto näher kommen.
Erleichtert hastete ich zur Tür. Ein grauer Van fuhr langsam die Straße entlang. Das musste Claire Steen sein! Wer sonst würde um diese Uhrzeit im Schleichtempo durch diese Gegend fahren?
Ich winkte zögernd. Der Wagen wurde noch langsamer und hielt dann an. Auf der Beifahrerseite senkte sich das getönte Fenster mit leisem Summen. Ich trat zögernd an den Bordstein.
Im Fahrzeug saßen ein Mann und eine Frau, die einander wie aus dem Gesicht geschnitten waren und mich mit einer derart gelassenen Gleichgültigkeit ansahen, dass ich ihnen am liebsten in die gelangweilten Gesichter geschrien hätte. Aus dieser Nähe spürte ich sofort, dass es Vampire waren, wenn auch die unspektakulärsten, die ich je gesehen hatte.
Sogar Steven und Christina, die nur wenige Jahre oder gar Monate alt waren, umwehte etwas Mystisches, Geheimnisvolles. Doch diese beiden hier hatten die Unauffälligkeit derart perfektioniert, dass man sie sogar hätte übersehen können, wenn man direkt vor ihnen stand.
„Claire Steen?“, fragte ich unsicher.
„Wer will das wissen?“, erwiderte der Mann, der auf der Beifahrerseite saß und mich aus blassen Augen von unbestimmter Farbe musterte.
„Amber Connan, ich bin Julius Lawheads Dienerin. Es hat einen Kampf gegeben, er ist bewusstlos und verletzt, würden Sie mir bitte helfen?“
Plötzlich kam Leben in die Unsterblichen. Sie stiegen aus und folgten mir ins Haus. Claire untersuchte Julius, während ihr Partner, der sich als ihr Bruder Vitus Steen vorgestellt hatte, erst den Schwarzen mit dem Fuß anstieß und dann einen Blick in die Holzkiste warf.
„Der Jäger ist tot“, sagte Claire nüchtern und richtete sich auf. „Aber spätestens morgen Abend sollte er wieder wach sein.“
„Haben Sie so etwas schon mal gesehen?“, fragte ich unsicher. „Ich meine, so von einem Schlag auf den anderen?“
„Ja. Manche von uns können Lebensenergie rauben. Das Opfer fällt dann in eine Starre wie diese.“
„Aber die Männer waren keine Unsterblichen!“
„Der Effekt scheint der gleiche. Fahren Sie Ihren Wagen ans Gebäude, wir helfen beim Einladen, und dann bringen Sie Ihren Herrn in die Zuflucht der Leonhardt. Wir können uns nicht um ihn kümmern, hier ist bis Sonnenaufgang noch viel zu tun.“
Mir blieb nichts anderes übrig, als zu machen, was Claire Steen gesagt hatte. Als ich rückwärts an das Gebäude fuhr, trug ihr Bruder Julius bereits heraus. Körper und Oberschenkel waren gerade, die Unterschenkel dicht darangeklappt. Die Stellung, in der Julius gestorben war, ließ sich nicht verändern. Noch ehe ich überlegten konnte, wie Julius am besten zu transportieren sei, ohne dass jeder Polizist aufmerksam wurde, öffnete Claire die Kofferraumklappe.
„Nicht da rein! Das können Sie doch nicht machen!“, protestiere ich und stieg aus.
Doch Vitus Steen wuchtete Julius unbeeindruckt in den Kofferraum, hob ihn noch einmal an und schob Warndreieck und Verbandskasten zur Seite.
Claire legte Julius’ Schwert, seine Armbrust und eine Kette, die er offensichtlich bei sich gehabt hatte, neben den starren Körper und schlug den Kofferraumdeckel zu.
„Seien Sie nur vorsichtig in den Kurven“, sagte Claire. Damit schien das Thema für die Unsterbliche abgehakt und sie verschwand mit ihrem Bruder im Laden.
So vorsichtig, wie ich nur konnte, fuhr ich durch die Straßen. Niemand behelligte mich, obwohl ich die ganze Zeit befürchtete, angehalten zu werden.
Erleichtert atmete ich auf, als ich schließlich auf den Parkplatz hinter dem Lafayette einbog. Ich hielt direkt an der kleinen Treppe, die zur Hintertür hinaufführte.
Robert stand in der geöffneten Tür und wartete bereits auf mich.
Ich hatte ihn angerufen, sobald ich losgefahren war.
Er warf seine Zigarette weg und eilte zu mir. „Wo ist er?“
„Im Kofferraum.“
Curtis traf ein, als ich gerade die Heckklappe hob.
Seine Miene war leer, ein deutliches Zeichen dafür, wie besorgt er war. Er beugte sich hinunter. Seine Hände flatterten über Julius’ Körper und verharrten an verschiedenen Stellen. Der Sinn seines Bemühens war mir nicht ganz klar, vielleicht tastete er nach der Aura.
Robert wartete, bis der Meister fertig war, dann fasste er Julius unter der Schulter, doch Curtis schob den Arm seines Dieners zur Seite. „Lass mich, ich mache das.“
Vorsichtig hob der Meister Julius hinaus. Er sah dabei aus wie ein Vater, der liebevoll seinen Sohn trug. Robert nahm die Waffen und die Kette an sich und eilte voran, um die Tür zu öffnen.
Mit einem Mal kam ich mir überflüssig vor. Ich schloss den Wagen ab und folgte den Männern hinein.
Ich hatte die Zuflucht des Leonhardt-Clans seit der Trennung von Julius nicht mehr betreten. Der wohlbekannte Geruch des Lafayette nach Staub, Holz und vielen glücklichen Stunden empfing mich wie ein alter Freund. Ich kannte jedes der silbergerahmten Filmposter, die die Wände pflasterten, jeden Menschen und jeden Vampir, der hier lebte.
Das Lafayette zu betreten war wie ein Nachhausekommen, das wurde mir schlagartig klar. In den letzten Monaten hatte ich mich bemüht, die Welt der Vampire hinter mir zu lassen und zu meinem alten Leben zurückzukehren. Jetzt fühlte es sich an, als sei ich nie von hier fortgegangen.
Curtis hatte Julius ins große Versammlungszimmer gebracht. Es war im ehemaligen Vorführsaal des Kinos untergebracht. An den Wänden hingen noch immer die dicken roten Samtvorhänge aus alten Zeiten, aber die Sitzreihen hatten einem gewaltigen Konferenztisch aus dunklem Holz weichen müssen.
Julius lag darauf, noch immer gefangen in seiner seltsamen Körperhaltung. Robert und sein Herr arbeiteten schweigend, während ich zögerlich näher trat. Jeder wusste, was er tun musste und was der andere tat. Ich beobachtete eine Vertrautheit zwischen den Männern, die über Jahrzehnte gewachsen war. Nie hatte ich Curtis seinem Diener gegenüber ein lautes Wort oder gar einen Befehl äußern hören. Es schien, als sei zwischen den beiden eine wahre Partnerschaft entstanden.
War diese Harmonie das Ergebnis, wenn man mit seinem Vampir alle fünf Siegel getauscht hatte?
Robert wickelte den provisorischen Verband von Julius’ Unterschenkel und riss das Hosenbein auf, während der Meister den Körper anhob und sich zugleich über Julius beugte und leise auf ihn einsprach.
„Entschuldigt, wenn ich störe, aber wie geht es ihm?“
Robert drehte sich um und nickte mir aufmunternd zu. „Komm näher und sieh es dir selbst an.“
Ich folgte seiner Einladung. Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich entdeckte, dass der breite Schnitt in Julius’ Bein nicht mehr blutete und bereits von einer dicken Schorfschicht bedeckt war. „Dann war es kein Silber?“
„Nein, eine Stahlklinge, aber trotzdem ein tiefer Schnitt. Gut, dass du ihn abgebunden hast.“
„Wie lange bleibt Julius … so?“
Curtis legte eine Hand auf dessen Stirn. „Vermutlich bis morgen Abend. Jemand hat ihm alle Kraft gestohlen. Bei einem derartigen Angriff wird die Lebensenergie mit einem Schlag freigesetzt oder geht auf den Angreifer über. Auf jeden Fall ist es nicht permanent.“
Seine Erklärung erleichterte mich ein wenig. „Julius hat gesagt, diese Leichendiebe wären Menschen, Sterbliche.“
„Vielleicht war einer von ihnen ein Diener und sein Meister hat durch ihn gewirkt.“
„Ich dachte, Julius könnte den Unterschied spüren“, sagte ich verwundert.
Robert und Curtis tauschten einen wissenden Blick. „Wenn es vor Julius’ Augen verborgen geblieben ist“, sagte der Diener, „dann haben wir vielleicht ein ernsthaftes Problem.“
„Womöglich brauchen wir aber auch nicht länger nach einem neuen Clan für Downtown und South Central zu suchen.“
„Du meinst, ein Clanherr sondiert das neue Terrain? Und versucht es auf die alte Art?“, überlegte Robert.
„Vielleicht will er auch nicht die Katze im Sack kaufen und agiert verdeckt.“
Ich blickte zwischen den Männern hin und her. „Und warum klaut er dann die Leichen? Das ergibt doch keinen Sinn! Und was ist mit diesem Pulver? Es war überall auf seinem Gesicht. Ich habe es entfernt, so gut ich konnte, aber er hat bestimmt auch etwas davon eingeatmet.“
Curtis und Robert zuckten mit den Schultern, eine synchrone Bewegung. „Vielleicht irgendein Gift“, sagte Curtis. „Aber eigentlich sind wir dagegen immun.“ Er berührte Julius’ Haar mit spitzen Fingern. Feiner Staub rieselte hinaus. „Ich spüre nichts.“
„Vorsicht“, mahnte Robert.
„Kümmern wir uns erst einmal um den Jungen. Wenn es ihm besser geht, überlegen wir, was wir mit den Übeltätern anstellen“, sagte Curtis und legte Julius wieder die Hand auf die Brust.
Robert beobachtete ihn dabei und warf mir dann einen Seitenblick zu, der nichts Gutes verhieß.
Für einen Augenblick prickelte meine Haut. Die Luft wurde schwer von Magie, dann verschwand sie wieder.
„Ich erreiche Julius nicht, da, wo er jetzt ist. Ich kann seine Seele nicht finden, aber er ist noch hier.“ Curtis trat zurück. „Es ist anders als bei einem Energieraub, wie ich ihn kenne. Amber, versuche du es, bitte.“
„Was soll ich tun?“
„Nutz die Siegel, ruf ihn durch eure Bindung, als wolltest du während des Tages mit ihm Kontakt aufnehmen.“
Ich war froh, etwas tun zu können, trat an den Tisch und schloss die Augen. Vorsichtig legte ich meine Hand über Julius’ Herz und fühlte dem Funken nach, dann öffnete ich mich weit.
„Julius, komm zu mir. Ich brauche dich. Wir machen uns Sorgen“, rief ich in Gedanken, doch es kam keine Antwort, auch wenn ich fühlte, dass er dort irgendwo war. „Es ist, als ob seine Seele schlafen würde“, erklärte ich. „Das tut sie nie.“
„Das Gleiche fühle ich auch“, stimmte Curtis zu, dann waren Herr und Diener still. Sie nutzten Telepathie, um sich zu beraten. Gänsehaut kroch mir den Rücken hinauf, und meine Muskeln verspannten sich. Die Männer sprachen über mich.
Curtis’ Augen wurden kalt. Er starrte mich an, in mich hinein, als sei ich aus Glas! Die Situation wurde mir immer unheimlicher. Planten die Männer etwas? Wenn ja, dann hatte es mit mir zu tun, und so wie Curtis und Robert sich verhielten, würde es mir sicher nicht gefallen.
„Was ist?“, fragte ich und musste mich zusammennehmen, um meinen Tonfall zu zügeln.
„Keine Angst, wir wollen ihm alle nur helfen. Du doch auch, oder?“, fragte Curtis.
„Ja, natürlich, aber ich dachte, Julius schläft nur.“
„Nein, da ist mehr. Hier ist Magie am Werk, eine Kraft, die uns fremd ist.“
„Und was jetzt?“ Ich sah wieder auf Julius’ schmerzverzerrte Lippen. Litt er, während wir hier debattierten?
Curtis trat neben mich an den Tisch. „Du bist seine Dienerin. Auch wenn ihr kein Paar mehr seid, Blut und Wort binden euch“, sagte er ruhig und sah mich dabei unverwandt an. Die Erwähnung von „Blut und Wort“ brachte etwas in mir zum Klingen. Etwas, das Curtis antwortete, ihm und nicht Julius!
Ich verspürte ein merkwürdiges Ziehen an den Siegeln, als versuche er, sie in seine Gewalt zu bekommen.
Erschrocken wich ich zurück. „Das darfst du nicht!“ Ich presste eine Hand auf die Brust und ahnte plötzlich Robert hinter mir.
„Es wäre einfacher, wenn sie alle fünf Siegel trüge“, sagte der Diener. „Hab keine Angst, Mädchen.“
„Was? Wovor soll ich keine Angst haben?“ Erwachende Panik ließ meine Stimme stolpern. Ich sah wieder zu Curtis, und seine Augen waren plötzlich hellgrau, als brenne ein unheimliches Licht in ihnen.
„Komm her zu mir, Amber Connan, Dienerin meines Schwurgebundenen, komm.“
So sehr ich mich auch gegen seine Magie stemmte, ich hatte keine Chance.
Die Worte packten mich bei meinem Herzen und zogen an mir. Es tat weh und war zugleich wie Fliegen. Scheinbar schwerelos taumelte ich durch den Raum, weiter und weiter auf Curtis zu, bis seine Hand schließlich bleiern auf meiner Schulter ruhte.
Seine Berührung wärmte mich, gab mir Halt. Auf einmal vertraute ich ihm, obwohl ich zugleich wusste, dass er mich manipulierte.
„Ich mache mir Sorgen um Julius“, sagte Curtis. „Und ich weiß, dass du es auch tust.“
„Was soll ich machen?“, fragte ich leise.
„Wir werden ihn rufen, du und ich. Dein Blut und mein Blut, wir gemeinsam.“
„Ja“, sagte ich. Tief in mir ahnte ich, dass es auch eine andere Antwort gab, aber das Wort wollte mir einfach nicht in den Sinn kommen.
„Keine Angst“, sagte der Meister wieder. Die Spannung wich aus meinem Körper und machte einer wohligen Wärme Platz. Curtis drückte mich an sich. Ich fühlte seinen festen Oberkörper in meinem Rücken und wusste nicht, wie ich dorthin gekommen war. Dann strich er etwas Rotes auf Julius’ Lippen.
Blut. Meine Hände lagen auf der Brust meines Geliebten. Meines Geliebten? Waren das meine eigenen Worte? Hatte ich mich nicht von ihm getrennt? Aber es war die Wahrheit, oder nicht?
„Es wird nicht wehtun“, flüsterte Curtis.
Ich fühlte den Luftzug seiner Worte an meiner Wange. Er war so nah.
Als ich meinen Blick wieder auf den reglosen Julius vor mir richtete, lag nur noch eine Hand auf seiner Brust. Wo war die andere? Dann spürte ich einen schwachen Schmerz, und jemand massierte meinen Arm. Etwas Warmes, Seidiges floss über meine Haut. Und schon war die Hand wieder in meinem Blickfeld. Jemand hielt sie über Julius’ Gesicht. Sein Mund war gerötet wie von verschmiertem Lippenstift. Mein Blut. Ich selbst schenkte es ihm, um ihn wie Dornröschen aus dem Schlaf zu wecken.
Wach auf, mein Prinz, dachte ich matt. Sprechen konnte ich nicht. Meine Lippen waren taub und schwer, schon der Gedanke an ein gesprochenes Wort war ermüdend.
„Das Blut ist die Brücke“, sagte Curtis feierlich.
„Ja“, antwortete ich nur, als seine Lippen bereits über meine Kehle tasteten und er mich fester an sich drückte.
Das darf er nicht, wurde mir klar. Es ist Frevel, Beleidigung! Doch in mir wollte kein Zorn aufkommen. Zorn existierte nicht, solange ich unter Curtis’ Bann stand. Ein matter Druck, dann spürte ich seine Zähne nadelspitz in meinem Hals.
Er trank. Mein Leben floss davon, und das Einzige, was ich wollte, war, dieses Gefühl für immer zu bewahren. Mit der Melodie seines Hungers im Ohr zu sterben. Ich ließ mich gegen ihn fallen, wollte in seinen Armen liegen, doch Curtis hielt mich nüchtern auf Abstand.
Dann weckte er mich aus dem Rausch, und meine Gedanken wurden wieder klarer.
„Hilf mir, Julius zu rufen, hilf mir, ihn zu wecken, zusammen sind wir stark genug“, wiederholte Curtis eindringlich. „Dies geschieht nicht, um dich zu entehren oder mir Freude zu bereiten. Öffne deine Siegel und rufe unseren Julius. Rufe ihn. Ich sorge mich!“ Die Wahrheit in seinen Worten traf mich wie ein Schwall kalten Wassers.
Ich versuchte, nicht mehr daran zu denken, dass er von mir trank, und starrte auf meine Linke, aus der ebenfalls rote Flüssigkeit rann und in Julius’ Mund tropfte. Ich öffnete die Siegel und fühlte Curtis’ Macht aufflammen. Die Magie war jahrhundertealt und ganz anders als die wilde, ungestüme, fast schon chaotische Kraft von Julius.
Curtis hatte die Magie vollständig seinem Willen unterworfen. Er formte sie zu einem festen Ding. Wie mit einer Hand griff er durch den Biss in meinen Körper und durch die Siegel weiter in Julius.
Dort angekommen, rüttelte er ihn unsanft wach. Ich begleitete ihn auf dieser Reise durch mein Inneres. Durch die magischen Tore, die mich mit Julius verbanden, roch ich Kräuter, Puder und matten Tod. Der Geruch legte sich in meine Lungen und schien mich ersticken zu wollen. Was war das nur? Angst schnürte mir die Kehle zu.
„Ruf ihn! Rufe ihn jetzt!“
„Julius!“ Immer wieder nur sein Name. „Julius!“ Curtis rief mit mir.
Unsere Stimmen verbanden sich, und plötzlich war das Wort mehr als nur ein Name. Es hatte eigene Kraft, einen eigenen Willen.
Endlich lichtete sich der Nebel. Der Geruch verschwand, und dann war ich mit einem Mal wieder vollständig zurück in meinem Körper.
Die Benommenheit blieb noch eine Weile, und es kam mir vor, als beobachtete ich das Geschehen von einer hohen Warte aus. Ich nahm teil und doch wieder nicht.
Curtis hielt mich nicht mehr fest. Ich saß neben Julius’ Körper auf dem Tisch. Wie ich dorthin gekommen war, wurde mir nicht ganz klar. Robert tupfte mir das Handgelenk mit einem Stück Gaze sauber und wischte auch über meinen Hals. Das Tuch war angenehm kühl auf der Haut. Ich beobachtete, wie Curtis mit seinem Daumen über eine Klinge strich. Blut quoll hervor, doch er verzog keine Miene. Er rieb mir die roten Tropfen in die Bisse an Handgelenk und Hals. Heiße kleine Brände heilten die Wunden in Sekundenschnelle, und dann war ich mit einem Schlag hellwach.
Julius’ Beine waren ausgestreckt. Die Starre war vergangen und er nicht mehr tot.
„Das hast du gut gemacht“, lobte Curtis, wich aber meinem Blick aus. An seiner Lippe klebte noch immer mein Blut. Gerade als ich ihm die Meinung sagen wollte, zitterten Julius’ Augenlider. Ich sprang auf und beugte mich über ihn.
„Julius, kannst du mich hören?“
Er reagierte nicht, aber unter der Hand, die ich ihm auf die Brust gelegt hatte, fühlte ich seinen Körper wieder weich werden.
Die Totenstarre wich ihm aus den Gliedern, als sei gerade die Sonne untergegangen.
„Er wird jetzt bis zum Morgen schlafen, dann verlässt seine Seele wie üblich den Körper, und nach der Zeit im Sarg sollte er wieder gesund sein. Der Bann ist gebrochen.“
„Der Bann? Du hast es also auch gespürt? Dann hat ihm doch kein Vampir die Kraft geraubt, sondern es war dieses weißliche Zeug!“
Curtis nickte, beugte sich vor und roch an Julius’ Gesicht. Seine Nasenflügel bebten, als er die Luft einsog. „Ich frage mich, was das ist. Was seine Seele in Schlaf versetzt hat, war auf jeden Fall dieses Pulver und nicht die Kraft eines Untoten.“
In diesem Moment wurde die Tür aufgestoßen. Brandon stürmte in den Raum, dicht gefolgt von Christina.
Curtis machte Platz und ließ die Unsterblichen zu ihrem Meister durch. Schweigend tastete Brandon über Julius’ Oberkörper. Christina stand wie erstarrt neben ihm, hatte die Hand ihres Schöpfers ergriffen und starrte ihn an. Ihre Verzweiflung war groß.
Brandon fing sich zuerst, wandte sich zu Curtis um und begrüßte den Clanherren, indem er den Kopf vor ihm neigte.
„Was ist mit ihm?“
„Eine seltsame Starre hatte ihn befallen, jetzt schläft er“, erklärte Curtis. „Keine Angst, eurem Meister geht es bald wieder gut. Aber ihr könnt ihn nicht mitnehmen. Julius wird den Tag hier verbringen.“
„Dürfen wir bei ihm bleiben?“, fragte Brandon schnell.
Curtis nickte und lächelte.
Ich trat zurück. Hier gab es nichts mehr für mich zu tun, das glaubte ich zumindest. Julius ging es wieder gut. Er brauchte nur noch Ruhe.
Ich musste dringend über das Geschehene nachdenken, solange ich noch einen klaren Kopf hatte. Die Anziehung, die Julius auf mich ausübte, wurde immer stärker, und das, obwohl er bewusstlos war. Ich musste fort aus dem Lafayette. Denn wenn ich länger blieb, riskierte ich damit, dass die Siegel die Entscheidung für mich trafen. Jede verstreichende Minute mit Julius würde eine erneute Trennung schwerer machen.
Curtis beobachtete mich, während ich mit meinen Gefühlen im Widerstreit lag. Auch die Nähe des Clanoberhauptes wurde mir stetig unangenehmer.
Ich hatte seinen Hunger gefühlt, seine Macht, die um ein schreckliches Maß stärker war als die von Julius. Und galt das, was er getan hatte, nicht als Frevel und Beleidigung? Curtis hatte die Siegel benutzt, als sei ich seine Dienerin und nicht Julius’. Vielleicht hatte die extreme Situation so extreme Maßnahmen erfordert. Dennoch bestand kein Zweifel daran, dass er mich manipulieren konnte, wie es ihm gerade gefiel. Sogar meine Gefühle hatte er angetastet.
Die Augen, mit denen er mich jetzt musterte, hatten wieder ihre übliche stahlgraue Farbe angenommen, doch als er den Arm nach mir ausstreckte, wich ich automatisch zurück.
„Du musst müde sein, Amber. Ich habe ein Zimmer für dich vorbereiten lassen.“
„Nein! Danke, aber ich fahre nach Hause!“
Er nickte schweigend, dann schob er nach: „Vielleicht ist es besser so.“
***
Im Verborgenen …
Kerzenlicht warf die Schatten zweier Männer auf eine Wand und ließ sie riesig erscheinen.
„Gut, dass du es hergebracht hast“, sagte der hagere Voodoo-Priester.
Er hantierte mit einer Machete, auf deren Klinge getrocknetes Blut klebte. Gewissenhaft schabte er es ab.
„Er wird sich noch wünschen, sich nie in unsere Angelegenheiten eingemischt zu haben. Von jetzt an wird uns der Vampirhenker nicht mehr aufhalten.“
Der Beobachter saß auf dem Boden neben ihm und lächelte grimmig. Seine Hände spielten mit einer dünnen rot-weißen Perlenkette.
Als der Hexer Agaja fertig war und sich das Blut als feines braunes Häufchen Staub auf einem Stück weißen Stoffs erhob, faltete er das Tuch zusammen und stopfte es in eine ausgehöhlte Kolanuss. Seine Lippen formten stumm Formeln. Er umwickelte alles mit einem Stückchen Schnur und legte die Nuss in eine Kalebasse.
Begleitet von einem Helfer trat er vor den Schrein, der von zwei mannshohen hölzernen Soldaten flankiert wurde, und legte die Kalebasse auf die nach vorne gereckten Hände des linken Holzwächters.
„Wie lange wird es dauern, Agaja?“
„Es beginnt, sobald die Sonne aufgeht“, antwortete der Priester. „Wenn ich ihn besitze, wird er mich mächtig machen vor Menschen und Göttern.“
„Das ist gut.“
„Ja, das ist es. Und jetzt bring mir mein Opfermesser und die beiden größten Hunde, die wir haben.“