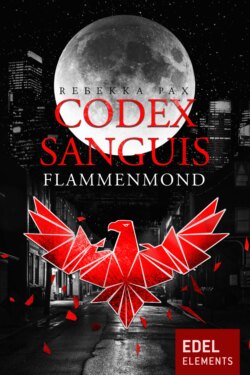Читать книгу Codex Sanguis – Flammenmond - Rebekka Pax - Страница 5
KAPITEL 1
ОглавлениеAmber
In unserer kleinen Werkstatt war es still geworden.
Meine Augen taten weh, von den Fingern ganz zu schweigen. Aber ich wollte den Bilderrahmen heute um jeden Preis fertigstellen. Er war mit Abstand die beste Arbeit, die ich in meiner Zeit als Vergolderin je abgeliefert hatte.
Die Figuren, die den Rahmen zierten, hatte ich in tagelanger Feinarbeit neu modelliert und in die alten Ornamente eingefügt. Jetzt galt es nur noch, die letzten matten Stellen mit Achat zu polieren, bis das neu aufgetragene Blattgold glänzte, als sei es aus massivem Edelmetall.
Zum wiederholten Mal legte ich den Polierstein aus der Hand, um meine verkrampften Finger zu lockern. Da klopfte es leise an der Tür.
„Ja bitte?“
„Ich bin’s, wollte mal sehen, ob du nicht schon vor Erschöpfung zusammengeklappt bist.“ John Lapiccola schob seinen Kopf durch den Türspalt. Mein Chef sah aus, als sei er mit einem Sack Mehl zusammengestoßen. Seine grauen Haare und auch der Bart waren durch den Kalkstaub noch eine Nuance heller geworden.
Würziger, weicher Kaffeeduft wehte in den Raum. John kam herein, reichte mir einen dampfenden Becher und rieb die schwielige Hand an seiner Arbeitsschürze ab, wo sich der Kaffeefleck in Dutzenden anderen verlor.
Ich hielt mir genießerisch die Tasse unter die Nase. „Oh, danke. Genau den habe ich jetzt gebraucht.“ Der Kaffeeduft weckte meine Lebensgeister.
Doch sobald John näher an die Werkbank trat, wurde ich nervös.
„Ich bin noch nicht ganz fertig.“
„Natürlich bist du fertig, fertiger geht es nicht!“ Er strich sich über den dichten Bart, rückte dann seine Brille zurecht und beugte sich über den Rahmen. „Das hier ist hervorragende Arbeit, Amber Connan, aber das muss ich dir nicht sagen, nicht wahr? Unser Auftraggeber wird mehr als zufrieden sein.“
„Danke.“ Ich war schrecklich erleichtert. Sein Lob, mit dem er sehr sparsam umging, ließ mich erröten.
„Wüsste ich nicht, welche Teile ergänzt wurden, ich könnte es beim besten Willen nicht unterscheiden. Womit wir bei einer anderen Sache wären. Hast du dieses Wochenende schon etwas vor, Amber?“
Ich sah ihn irritiert an. Seit wann interessierte sich John dafür, wie ich meine freien Tage verbrachte?
Unweigerlich drifteten meine Gedanken zu Julius. Mit ihm konnte ich sicher nichts unternehmen. Die Gesetze seines Clans wurden auch für gelangweilte Freundinnen nicht gelockert. Julius hatte gegen einen Befehl seines Meisters verstoßen und war deshalb auf unbestimmte Zeit in einen Sarg eingesperrt worden. Mittlerweile waren über zwei Monate verstrichen, und noch immer war kein Ende der Strafe in Sicht.
Mit Freunden unternahm ich nur selten etwas, noch seltener, seitdem ich mit den Unsterblichen von Santa Monica Umgang pflegte. „Nein, ich hab nichts vor.“
„Erinnerst du dich, worüber wir vor einer Weile gesprochen haben? Dass du gerne auch Skulpturen restaurieren würdest?“
Mir stockte der Atem. Das war mein großer Traum, seit jeher. „Na klar!“
„Wenn du mir über das Wochenende ein paar aussagekräftige Tonmodelle anfertigst, können wir darüber reden. Ich habe am Montag einen Besichtigungstermin. Auf meine alten Hände kann ich mich leider nicht mehr zu hundert Prozent verlassen, und wenn du mir etwas lieferst, das mich überzeugt …“
Mein Herz tat einen begeisterten Satz, und ich fiel meinem Chef um den Hals. „Oh, das wäre Wahnsinn!“
„Dann nimm dir eine Packung von dem feinen weißen Ton mit, und alles, was du an Werkzeug brauchst. Und dann ab mit dir nach Hause.“
Ich war schon beim Werkzeugschrank, bevor John zu Ende gesprochen hatte. „In welche Richtung soll es denn gehen?“, fragte ich, ohne aufzusehen, während ich ein Sortiment Spatel zusammensuchte.
„Stell dich auf barocke Sakralkunst ein und überrasch mich.“
„Eine Hand?“
„Zum Beispiel“, sagte John mit einem Lachen. Meine Begeisterung schien ihn zu amüsieren. Er prostete mir mit dem Kaffeebecher zu. „Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ich mache mich auf den Heimweg. Wir sehen uns Montag.“
„Ja, dir auch, John. Und danke. Danke!“
Ich lauschte darauf, wie er die Werkstatt verließ, und atmete tief durch. Sobald ich alleine war, stieß ich einen Jubelschrei aus und hüpfte ausgelassen durch den Raum. Endlich! Endlich bekam ich die Chance, auf die ich so lange gewartet hatte!
„Glückwunsch!“, tönte plötzlich eine vertraute Stimme durch meine Gedanken, die in meinem Kopf einen Widerhall erzeugte wie in einer Kathedrale.
Ich zuckte zusammen. „Verdammt! Wie lange hast du schon gelauscht?“
„Lange genug, um zu wissen, dass du einen Klumpen Ton meiner Gesellschaft vorziehst.“
„Du bist unfair, Julius.“
„Deine Freude war so intensiv, dass sie bis zu mir gedrungen ist, da musste ich einfach nachschauen.“ Er schickte mir eine Erinnerung an sein Lachen. „Ich freue mich für dich, ich freue mich wirklich. Aber versprich mir, dass du dich nicht bei deiner Mom in Silverlake versteckst. Komm zu mir, wir können uns unterhalten, während du bastelst.“
„In dein finsteres Loch?“
„Ich lasse Lampen holen, so viele du brauchst, Liebes. Es tut mir so gut, deine Stimme nicht nur in meinem Kopf zu hören.“
Ich musste an Ma denken. Schon das letzte Wochenende hatte ich in der Zuflucht der Vampire verbracht. Für diesen Samstag hatte ich ihr versprochen, dass wir gemeinsam zu Frederiks Grab fahren würden.
„Du kannst sie am Nachmittag besuchen, Amber.“
„Julius, pfusch nicht in meinen Gedanken rum!“
„Entschuldige“, murmelte er ein wenig gekränkt.
Ich fühlte, wie er sich zurückzog und die magische Verbindung der Siegel schloss, als zöge er vorsichtig Türen zu, peinlich darauf bedacht, kein Geräusch zu verursachen.
Prompt hatte ich ein schlechtes Gewissen. Aber wie sollte ich auch gelassen bleiben, wenn er sich seit Wochen ständig in meinen Kopf einschlich? Ich hatte das Gefühl, keinen einzigen Moment des Tages mehr alleine zu sein. Zwar hatte ich gelernt, mich vor derlei Überfällen zu schützen, doch noch war all das so neu für mich, dass ich diesen gedanklichen Schutzwall bewusst aufrichten musste, und an Tagen wie diesem vergaß ich es leider viel zu oft.
Rasch zog ich einen weißen Tonblock aus dem Regal, schnitt mir ein Stück ab und wickelte es in Frischhaltefolie. Als ich kurz darauf die Werkstatt verließ und die Tür abschloss, war die Freude über meine unverhoffte Chance zurück. Dem irritierten Blick der Dame aus dem Nachbarhaus nach zu urteilen, strahlte ich über das ganze Gesicht.
***
Julius
In meinen Körper zurückzukehren war jedes Mal aufs Neue ein Schock. Zehn Wochen und zwei Tage waren vergangen, seitdem mein Meister mich in einen Sarg verbannt hatte. Sechs schwere Eisenriegel und eine Kette mit Silberlegierung hielten mich davon ab, mein Gefängnis zu sprengen.
Das war die Strafe für meinen Ungehorsam, für den Hochmut, meinem Meister einen Vampir aus seinem Clan zu rauben. Ich hatte es verdient, das war mir bewusst. Aber ich hatte mit Tagen und Wochen gerechnet, niemals mit über zwei Monaten.
Mein Körper hatte sich nach und nach an die Gefangenschaft gewöhnt und hielt nun eine Art Winterschlaf. Der Hunger war da, doch er brannte schon lange nicht mehr. Am Anfang hatte er mich fast wahnsinnig gemacht, wütete und zerrte an mir, doch jetzt war er zu einem dumpfen Schmerz zusammengeschrumpft, der als kleine, steinerne Kugel in meinen Eingeweiden lag und den Tag meiner Freilassung ersehnte.
Wenn ich über meine Arme und Brust tastete, fühlte ich die ausgetrockneten Muskeln wie zähe Drähte unter der Haut.
Eine Tür knarrte.
Flüsterleise Schritte huschten über den Parkettboden. Sie waren mir ebenso vertraut wie die mit ihnen nahende Magie. Treueeide, die ich geleistet hatte, entflammten zum Leben. Der Besucher war Curtis Leonhardt, mein Schöpfer. Sein erster Gang nach dem Aufwachen führte ihn stets zu meinem Gefängnis. Er strich über den Sarg, und es fühlte sich an, als berühre er meinen Kopf.
„Guten Abend, Julius“, sagte er freundlich.
„Meister“, entgegnete ich in Gedanken. Meinen verdorrten Stimmbändern verständliche Laute zu entlocken, war unmöglich.
„Dein Herz schlägt nicht.“
Das hatte ich noch gar nicht bemerkt. So weit war es also schon gekommen.
Curtis kniete sich hin, und dann regnete auch schon warme Lebenskraft zu mir hinab. Die Kälte in meinen Gliedern wich nur langsam. Ich öffnete die Augen.
Der Anblick war der gleiche wie in den letzten Wochen und Monaten: totale Finsternis. Panik kochte in mir hoch und stemmte sich gegen Curtis’ Energie.
„Bitte, lass mich frei. Ich verspreche, mich nie wieder gegen dich zu stellen.“
Die tröstende Kraft verschwand mit einem Schlag. Ich hörte, wie er aufstand. „Noch nicht, Julius!“
„Warum?“
Meine Finger kratzten über das zerrissene Innenfutter, während meiner Kehle heisere Zischlaute entwichen. Curtis verschwand, wie immer, wenn unser Gespräch diesen Punkt erreichte. Die Tür schlug zu, und er war fort.
Ich beruhigte mich schnell wieder. Wenn ich eines in den letzten Wochen gelernt hatte, dann, wie ich meinen Körper zur Ruhe zwingen konnte. Es war unmöglich, dem Sarg zu entkommen.
Die Polsterung und die Seide hingen bereits in Fetzen. An vielen Stellen hatte ich das blanke Holz freigelegt, Späne herausgekratzt, bis meine Hände nur noch blutige Klumpen waren. Ohne frisches Blut waren sie nur langsam geheilt. Es war mir eine Lehre gewesen.
Ich schob meinen Kopf auf den Kissen zurecht, faltete die Finger über der Brust und verfiel wieder in meinen Dämmerzustand. Das Einzige, womit ich mich ablenken konnte, waren meine Erinnerungen, die Bilder aus meiner Vergangenheit und die Gedanken meiner Lieben.
Ich entsann mich noch gut an meine erste Verurteilung, die ich im Sarg verbüßte, vor all diesen vielen, vielen Jahren in Paris. Damals hatte ich noch so wenig gewusst, jede Nacht in Panik verbracht, jede Nacht geschrien, getobt und mich selbst verletzt.
Curtis hatte recht behalten. Dieses Mal war es anders, einfacher. Ich hatte mich meistens unter Kontrolle, und der Hunger war erträglich. Ich brauchte nicht mehr so dringend Blut, sondern konnte von der Energie meiner Vampire zehren. So blieb ich bei klarem Verstand.
Genau in diesem Moment, da ich an ihn dachte, erwachte Brandon, der Unsterbliche, den ich von Curtis gestohlen hatte und der nun mir die Treue hielt. Bluttausch und Eide verbanden unsere Körper, und so spürte ich, wie der Funke, der Seele und Leben ist, in seinen schlafenden Leib einkehrte.
An seiner Stelle hätte ich als Erstes den Sargdeckel aufgestoßen, um frei atmen zu können; Brandon tat das nicht.
Er öffnete die Augen, bewegte seine Hände und schmiegte seine Wange in die Kissen, ganz wie ein Mensch, der sich nach dem Weckerklingeln noch einmal umdreht.
Er wartete auf Christina. Seine Freundin würde als jüngere Unsterbliche frühestens in einer Viertelstunde erwachen.
Christina war eine schöne Latina mit kastanienbraunen, langen Haaren und Augen, so dunkel, dass sie mitunter schwarz aussahen, wenn sie wütend oder hungrig war. Ihre kleine Gestalt mit den fraulichen Rundungen hatte schon manchen Mann verführt und zu Leichtsinn getrieben, den er dann bitter bereute. Denn in Christina steckte viel mehr, als es auf den ersten Blick schien. Sie war schlagfertig, mit Fäusten und Worten gleichermaßen.
Ich hatte sie wenige Wochen, bevor ich meine Strafe antrat, verwandelt. Damals lag sie nach einem Kampf im Sterben, und Brandon hatte mich auf Knien angefleht, seine menschliche Dienerin zu retten und zu einer von uns zu machen.
Ich tat es und brach damit mein Versprechen mir selbst gegenüber, niemals Vampire zu schaffen. Seitdem war Christina mein, wie auch er.
Die Verwandlung hatte sie verändert. Sie war schüchtern, ängstlich und unterwürfig geworden, wie alle Neugeborenen. Doch die alte Christina war nicht vollständig verschwunden.
Ich bin in meinem Leben Zeuge vieler erfolgreicher Verwandlungen gewesen, und jedes Mal war es eine Freude zu erleben, wie die Neuen nach den gefährlichen ersten Jahren Stück für Stück zu ihrem alten Ich zurückfanden.
Christina hatte noch viel vor sich. Sie musste lernen zu jagen, lernen, ihren Hunger zu kontrollieren. Junge Vampire starben wie die Fliegen, sei es, weil der Hunger ihren Verstand zerstörte, oder weil andere sie töteten. Eigentlich sollte ich sie schützen, aber ich lag eingesperrt in dieser Kiste, und so hatte Brandon diese Aufgabe übernommen.
„Julius, bist du da?“, flüsterte er nun in die Tintenschwärze.
„Ja.“
„Wie geht es dir?“
„Wie schon? Hier gibt es nicht viel Ablenkung.“
„War Curtis bei dir?“
„Natürlich, wie immer.“ Ich konnte die Bitterkeit in meinen Worten nicht ganz verbergen, und Brandon war meine Stimmung nicht entgangen. Sein Herz schlug aus Mitgefühl schneller. „Wenn ich nicht so weit weg wäre, würde ich zu dir kommen.“
„Ich weiß, danke.“
Brandon und Christina waren in Arizona.
Als er mir vor einer Weile von seiner entbehrungsreichen Kindheit im Reservat und seinem Wunsch erzählte, noch einmal an seinen Geburtsort zurückzukehren und den Geistern seiner Vergangenheit einen Besuch abzustatten, hatte ich ihn dazu ermuntert.
„Wo seid ihr jetzt?“
„Na´ní´á Hasání.“
„Also in Cameron?“
„Ja, auf einem Campingplatz nicht weit von meinem Heimatort. Vor Sonnenaufgang war nicht mehr genug Zeit. Wir bleiben eine Nacht, um alles anzusehen, dann kommen wir heim.“
„Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, Brandon.“
„Ja, werde ich, danke, Meister.“
Er stand auf, legte seine Hände flach auf den Boden des Wohnwagens und machte einen Katzenbuckel, um seinen Körper nach der langen Schlafesstarre zu lockern. Sein langes rabenschwarzes Haar fiel wie ein dunkler Wasserfall vornüber.
Ich biss mir auf die Zunge vor Neid. Wie gerne hätte ich auch nur die Beine angewinkelt, aber dafür war der Sarg nicht hoch genug. Wütend schlug ich mit der Faust gegen die Seitenwand, dass die Riegel schepperten.
„Julius?“ Brandon richtete sich auf. „Was ist denn?“
„Nichts. Gar nichts.“
In den vergangenen Wochen war Brandon nach der Jagd immer zu mir gekommen und hatte die Kraft geteilt, die er aus dem Blut seiner Opfer zog. Wir verbrachten Stunden in der Meditation und wuchsen als Meister und Schwurgebundener zusammen. Es war eine gute Gelegenheit gewesen, einander besser kennenzulernen und die Fähigkeiten zu üben, die mit meinem neuen Status einhergingen.
Unsere Verbindung war einer Art Unfall geschuldet. Ich hatte lange wie ein Außenseiter im Clan gelebt. Aus den kleinen Rangeleien zwischen den übrigen Mitgliedern hatte ich mich immer herausgehalten. Dennoch neideten sie mir meine Position direkt nach Curtis und legten mir meine Passivität als Schwäche aus. Brandon war einer von ihnen gewesen. Er provozierte mich immer wieder, und ich ließ es lange ungestraft.
Als mir schließlich der Kragen platzte, geriet ich im Streit in einen solchen Rausch, dass Brandon schließlich gezwungen war, mich als seinen neuen Herrn und Meister anzuerkennen. Als ich danach begriff, was ich getan hatte, war es für eine Rückkehr zu spät.
Durch meine Unbesonnenheit hatte ich Curtis’ Autorität infrage gestellt – nicht nur innerhalb der Leonhardt, sondern auch vor den Oberhäuptern der anderen Clans. Bestrafung war die logische Folge. Und so sehr ich hier in meinem Gefängnis auch leiden mochte, konnte ich mich doch glücklich schätzen. Andere Clanherren hätten mein Vergehen mit dem Tode bestraft.
Vor dem Tag, der alles veränderte, hatte etwas wie Feindschaft zwischen Brandon und mir bestanden. Jetzt war alles anders. Als sein Meister liebte ich Brandon wie ein Vater sein Kind. Sich gegen diese Gefühle aufzulehnen, war hoffnungslos. Sie wurden von den Schwüren, die ich zu seinem Schutz geleistet hatte, ebenso bestimmt wie von der Magie, die all unserem Handeln zugrunde liegt.
Hin und wieder tobte ich innerlich, weil ich mich in dem engmaschigen Netz aus Gehorsam und Treue gefangen glaubte, aber ich hatte keine Wahl. Nicht, bevor ich weitere zweihundert Jahre existiert hatte und damit endlich stark genug war, um mich vom Clan loszusagen.
***
Amber
Ich war meinem Gefühl gefolgt. Der Besuch bei dem kleinen Auktionshaus hatte sich gelohnt. Zwei der angebotenen Skulpturen im Fenster stammten aus dem 17. Jahrhundert. Das Geschäft war zwar schon geschlossen gewesen, doch ich hatte Detailfotos machen können, die mir später als Inspiration für mein Modell dienen würden. Nun führten mich meine Schritte durch die Fußgängerzone von Santa Monica.
Ich schlenderte an den Schaufenstern vorbei und beobachtete die Menschen, die sich in den großen Glasflächen wie Geister spiegelten. Es war zum Verrücktwerden. Paare, überall Paare. Lachende, scherzende Frauen und Männer, die sich berührten, küssten.
Ich konnte Julius weder berühren noch küssen. Wir hatten gerade erst angefangen uns kennenzulernen, als er seine Strafe antrat. Reden, das war das Einzige, was uns blieb. Er hatte mehr Zeit im Sarg verbracht als mit mir.
Hin und wieder glaubte ich, Julius’ Gesicht zu vergessen, doch dann sah ich ihn plötzlich wieder vor mir, so real, dass ich meinte, meine Hände in seinen dunklen Locken vergraben zu können. Noch immer manövrierten wir beide vorsichtig um Worte herum, die unsere Beziehung bezeichnet hätten. Freunde, ja. Etwas mehr als das, auch ja. Ein Paar? Womöglich. Vielleicht irgendwann.
Ich war ein gebranntes Kind, was Männer anging, und Julius hatte im Moment weiß Gott andere Probleme als seinen Beziehungsstatus. Die anderen Unsterblichen sahen das scheinbar ohnehin nicht so eng. Nach ein paar Jahrhunderten Lebensdauer waren vermutlich andere Dinge wichtig. Und was zwischen Julius und mir wirklich zählte, waren die Siegel – eine Verbindung, für die es kaum Worte gab und die uns doch enger aneinanderband als irgendetwas sonst, das ich jemals für einen anderen Menschen empfunden hatte.
Ich vermisste seine Berührungen, den besonderen Geruch seiner Haut, erdig, kalt und frisch, sein Lachen, die gemeinsamen Abendspaziergänge.
Viele der vergangenen Nächte hatte ich auf einem kleinen Bett neben Julius’ hölzernem Gefängnis geschlafen, einerseits, um in seiner Nähe zu sein, und andererseits, um nicht zu Hause sein zu müssen.
Bei Ma in Silverlake war der Tod meines Bruders Frederik allgegenwärtig. Sie hatte die Wände mit Bildern von ihm gepflastert und brach alle paar Stunden in Tränen aus.
Die Erinnerungen und der kühle Abendwind ließen mich schaudern. Ich konnte es kaum ertragen, Ma weinen zu sehen, denn das erinnerte mich unweigerlich an Frederiks Ende. Er war zu einem zombieartigen Wesen geworden, bösartig und mordlüstern. Ich hatte ihm eigenhändig mit einem Schwert den Kopf abgeschlagen und bereute die Tat nicht. Frederik war mir mit Sicherheit dankbar. Seine Seele war nun frei.
Dennoch floh ich vor den Erinnerungen und der Trauer, die einen Aufenthalt daheim so unerträglich machten. Ich schämte mich dafür, so selten für Ma da zu sein, aber ich kam nicht dagegen an.
Die Straßen leerten sich. Die Menschen gingen nach Hause oder kehrten in Bars ein. Ich hatte wieder zu trödeln begonnen. Dabei wurde ich von Julius schon sehnsüchtig erwartet. Obwohl die Siegel, die uns verbanden, fast vollständig geschlossen waren, hallten seine Gefühle in mir wider, und ich konnte deutlich spüren, dass seine Gedanken gerade bei mir waren.
Der Bluttausch, der mit der Gabe der Siegel einhergegangen war, hatte mich verändert.
Ich war stärker, schneller und gesünder geworden. Meine Sinne schienen besser entwickelt, und ich hatte mich selbst häufiger dabei erwischt, dass ich Gespräche belauschte, die eigentlich in sicherer Entfernung geführt wurden.
Aber die Siegel hatten auch ihre negativen Seiten. Ich konnte Julius zwar mit einiger Mühe aus meinen Gedanken heraushalten, aber ich war noch nicht dazu in der Lage zu verhindern, dass er sich jederzeit meiner Kraft bedienen konnte – wenn er nicht achtgab, sogar bis zu dem Punkt, an dem ich einfach zusammenbrach.
Die Siegel waren Fluch und Segen zugleich, und ich hatte Julius nie gänzlich verziehen, dass er mir das erste aufgezwungen hatte. Auch wenn ich mittlerweile wusste, dass er auf Curtis’ Befehl gehandelt hatte, dem er sich eigentlich nicht widersetzen konnte.
Das zweite und dritte Siegel hatte er sich wie ein Jahrmarktspieler durch simple Tricks ergaunert.
Doch jetzt war Schluss. Meine Worte waren deutlich ausgefallen. Noch eine Trickserei, noch ein Versuch, mich mit Vampirmagie gefügig zu machen, um mir das vierte Siegel abzuluchsen, und wir würden getrennte Wege gehen.
Julius hatte Ruhe gegeben. Für die fehlenden zwei Siegel brauchte er meine Mitarbeit, und die bekam er nicht. Nicht in hundert Jahren!
***
Brandon
Brandon hatte Christina aus ihrem Sarg gehoben und zur Tür getragen. Sie schlief noch. Nun saß er auf den Stufen des Wohnwagens und sah hinaus. Der Schatten des Airstream schützte ihn vor dem schwächer werdenden Licht der Abenddämmerung.
Während Christinas Körper in seinen Armen weicher wurde, genoss er die Stille und den Anblick endloser Weite.
Die Wüste erstreckte sich bis zum Horizont. Gras neigte sich im Wind. Knorrige Büsche, gebeugt wie alte Krieger, trieben winzige blaue Blüten. Im kleinen Ort Cameron war alles noch so wie in den Tagen seiner Kindheit, als er Schafe gehütet und Tiere mit der Schleuder erlegt hatte, um ihre Felle zu verkaufen. Viel zu schnell würde er nach Los Angeles zurückfahren und dem Land seiner Vorväter den Rücken kehren müssen.
Der Gedanke an die Großstadt brachte unweigerlich auch den an seinen neuen Meister mit sich. Kurz darauf fühlte Brandon dessen Präsenz.
„Nimm von meiner Kraft, so viel du brauchst“, bot er Julius sogleich an.
„Wenn ich hier wieder rauskomme, hast du verdammt viel gut bei mir“, antwortete dieser.
„Du bist mein Meister … und mein Freund.“
Es fiel Brandon schwer, diese beiden Worte in einem Atemzug zu nennen. Sein Schöpfer, der alte Meistervampir Nathaniel Coe, war ein sadistisches Monster gewesen, und nach dessen Tod und Jahren des Herumirrens war Brandon kühl und scheinbar ohne großes Interesse von Curtis in den Clan der Leonhardt aufgenommen worden. Mit Julius als Herrn schien nun ein neues Zeitalter angebrochen zu sein.
„Mir hat es damals gutgetan, meine alte Heimat wiederzusehen, auch wenn mein Elternhaus längst nicht mehr steht“, sagte Julius, während er einen steten Energiestrom aus Brandons Körper sog.
„Ich weiß nicht, ob es sinnvoll war herzukommen. Es fällt mir schwer zu trennen. Die Erinnerungen vermischen sich. Coe ist überall. Ich dachte, ich könnte die verdammte Vergangenheit einfach in mir vergraben und vergessen. Doch es geht nicht, es geht einfach nicht!“, antwortete Brandon.
„Christina ist bei dir. Rede mit ihr.“
„Sie hat doch keine Ahnung, du hast damals bei unserem Kampf mehr erfahren als jeder andere.“
„Ich hätte deine Erinnerungen niemals so ans Tageslicht zerren dürfen.“
„Bereust du es?“
„Frag nicht.“
Brandon wartete dennoch auf eine Antwort.
„Ich bereue zutiefst, mich Curtis widersetzt zu haben. Wenn du hören willst, ob ich dein Meister sein will, dann ja, das tue ich. Doch wenn Curtis mir die Wahl unter seinen Vampiren gelassen hätte, so wäre sie nicht auf dich gefallen, und das weißt du, Brandon.“
„Ja, ist mir klar.“ Er rieb sich die Schläfen und sah in das Gesicht seiner Freundin, die noch immer ganz in den Klauen des Todes gefangen war.
„Manches passiert nicht, weil wir es wollen, Brandon, sondern weil es so für uns bestimmt wurde“, sagte Julius und löste sich aus der Bindung.
Zurück blieb ein kurzes Schwächegefühl und angenehme Wärme.
Fast im selben Moment zuckte Christina unter dem ersten Herzschlag.
Als sie Minuten später die Augen öffnete, hatte Brandon Zeit gehabt, sich zu sammeln und die schlechten Erinnerungen zu verbannen.
„Hungrig?“, fragte er weich und strich ihr die Haare aus der Stirn.
Christina lächelte. „Immer.“
„Dann komm. In der Lodge sind viele Menschen.“
Sie waren schnell fündig geworden und hatten den Durst gestillt. Jetzt waren sie unterwegs, um zu besichtigen, was nach über neunzig Jahren von Brandons Geburtshaus geblieben war. Der Pfad, der zu der verlassenen Hütte hinaufführte, war schon seit Jahren unbenutzt, doch im Licht zahlloser Sterne fiel es leicht, ihn zu finden. Die karge Flora aus niedrigen Kakteen und mageren Kreosotbüschen brauchte lange, um Spuren auszumerzen.
Brandon und Christina gingen zügig. Wüstensand knirschte leise unter ihren Schuhen. Mit jeder Bewegung klapperte Brandons lange Kette aus Türkisen und Tierzähnen gegen seinen breiten Silbergürtel. Garderobe und Schmuck waren sorgfältig gewählt, um das Wohlwollen seiner Ahnen zu erhalten, wenn er ihr Heim betrat.
Christina ging schweigend an Brandons Seite. Hin und wieder fühlte er ihren Blick auf sich ruhen.
Aus dem Schatten des Felsmassivs schälten sich bald die Ruinen eines Blockhauses. Die Hölzer waren von Sonne und Wind gebleicht und rissig und weiß wie alte Knochen geworden.
Brandon räusperte sich. „Dort drüben war der Schafspferch“, erklärte er, weil er meinte, etwas sagen zu müssen, und wies auf eine lückenhafte Reihe kurzer Pfähle, die wie Ertrinkende gerade noch aus einer Sandwehe hervorragten. Christina betrat neugierig die Hütte. Im Gegensatz zu ihr hatte Brandon das Gefühl, sich keinen Schritt mehr bewegen zu können, als türme sich eine unsichtbare Wand aus Erinnerungen vor ihm auf. Es waren allesamt schlechte.
Dort auf der Veranda hatte sein Vater immer gesessen und getrunken, die Flinte auf dem Schoß und den schmerzenden, verkrüppelten Fuß weit von sich gestreckt. Seitdem ihm eine Eisenbahnschiene darauf gefallen war, hatte sich der ehemalige Gleisarbeiter aufgegeben. Das Leben im Reservat war für ihn die Hölle auf Erden gewesen.
„War das hier dein Bett?“, hallte es aus dem Blockhaus.
Brandon atmete einmal tief durch und trat ein. Es nutzte nichts. Jetzt war er hier, und wenn er sich den Erinnerungen nicht stellte, würde er es später bereuen.
Christina stand neben einer roh gezimmerten Pritsche.
„Das ist Vaters Bett gewesen, ich hatte nur ein paar Decken, hier.“
Er wies auf einen Winkel neben dem Ofen. „Aber meistens, vor allem in den letzten Jahren vor meinem Weggang, habe ich draußen beim Vieh kampiert. Ich vermied es, heimzukommen.“
Christina wusste fast alles über sein früheres Leben als Mensch. Auch, dass er als Kind von seinem Vater verprügelt worden war. Die Wut des Alten auf die Welt, die ihm so übel mitspielte, die Wut auf die Europäer, die sein Volk von ihrem Land vertrieben und ins Elend gestürzt hatten, sie hatte in dem Jungen ein Ventil gefunden.
Brandons Mutter war eine irischstämmige Bardame gewesen. Er hatte Sandy nie kennengelernt, wusste nur, was die Nachbarn über sie redeten. Sandy Dawney war vor dem Elend des Lebens im Reservat und der Schande, ein Mischlingskind geboren zu haben, geflohen, bevor er ein Jahr alt war.
„Lass uns bitte von hier verschwinden, Chris. Julius hatte unrecht, es war nicht gut, nach all der Zeit herzukommen. Das hier zu sehen, macht nichts besser.“
Aber Christina wollte sich noch nicht trennen. Sie fuhr staunend mit der Hand über die Wände, wischte mit dem Fuß durch den Ruß der Feuerstelle.
Brandon trat allein ins Freie und legte den Kopf in den Nacken. Der Anblick des schimmernden Sternenteppichs ließ ihn ruhiger werden. Die Hütte hier war Vergangenheit, seit über neunzig Jahren vorbei. Was zählte, waren seine Zukunft und das Hier und Jetzt.
Christina sprang die kleine Verandastufe herunter und landete in seinen Armen. Sie lächelte aufmunternd, und ihre Reißzähne blitzten zwischen den vollen Lippen hervor.
Brandon küsste sie innig und zog sie von den Ruinen seiner Vergangenheit fort.
„Müssen wir sofort zurück? Können wir nicht noch ein wenig bleiben?“
„Doch, sicher“, antwortete er schnell. „Es ist nicht weit bis zur Hängebrücke über den Colorado. Ich habe miterlebt, wie sie gebaut wurde.“
„Wirklich?“
„Wirklich!“
***
Amber
Vor mir erhob sich der wuchtige Bau des Lafayette-Kinos.
Im Baldachin über dem Eingang, der noch aus den glorreicheren Tagen des Hauses stammte, war eine weitere Birne kaputtgegangen, wie ich geistesabwesend bemerkte.
Eigentlich war das Gebäude ein beeindruckendes Beispiel für L.A.s Art-déco-Stil, doch die Vampire legten offensichtlich keinen Wert darauf, ihr Heim instand zu halten. Während innen alles in altem Glanz und Gloria erstrahlte, bröckelte draußen der Putz von der Fassade, und die Steinchen der Mosaikverzierungen wurden täglich weniger. Aber wahrscheinlich war der äußere Verfall beabsichtigt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Clanherr Curtis Leonhardt auch nur irgendetwas dem Zufall überließ.
Da ich meinen Beruf als Vergolderin und Restauratorin mit Leidenschaft ausübte, wurde ich jeden Abend aufs Neue wütend, wenn ich das Kino betrat. Was für eine Schande, es so verkommen zu lassen! Am liebsten hätte ich Curtis mal die Meinung gegeigt. Auch wenn die Gegenwart des uralten Meisters mir jedes Mal einen eisigen Schauder über den Rücken jagte – kriechen würde ich vor ihm niemals, das hatte ich mir fest vorgenommen.
„Guten Abend, Miss Connan“, wurde ich freundlich begrüßt. Ein Mann, der zur Wachmannschaft der Zuflucht gehörte, hielt mir die Tür auf.
Das alte Kino wirkte heute Abend wie ausgestorben. Die hohe, zweiflügelige Tür zum Versammlungsraum war geschlossen. Also hatte Curtis wieder einmal seinen Clan zusammengerufen. Aber sicher nicht, um die Renovierung der Fassade zu besprechen.
Ich schlich an der Tür vorbei zu den Treppen, die in die Untergeschosse führten, und erreichte bald darauf Julius’ Kammer.
Die Tür stand auf, und mir stieg der Duft von Rosen in die Nase.
„Hallo, Amber! Entschuldige bitte, dass ich vorhin in deinen Gedanken war. Ich hätte mich ankündigen sollen“, hörte ich Julius’ Stimme in meinem Kopf.
„Schon vergessen.“
Ich stellte meine Tasche ab, warf meinen Mantel auf das Bett und hockte mich neben den Sarg. Kurz schnürte Zorn mir die Kehle zu. Ich hasste Curtis für das, was er Julius antat. Doch dann breitete sich das wohlige Gefühl von Geborgenheit in mir aus. Noch nie hatte ich für einen Mann derart stark empfunden, wenngleich ich noch immer nicht genau wusste, was ich da eigentlich empfand: Freundschaft? Die Siegel? Oder vielleicht doch Liebe?
Sehnsüchtig legte ich eine Hand auf das glattpolierte Holz und verbot mir jeden Gedanken an Mitleid, denn Julius verabscheute nichts mehr als das.
„Wie geht es dir?“, fragte ich leise.
„Alles okay hier drin.“
Mein Blick glitt zu dem riesigen Blumenstrauß, der auf einem mir bislang unbekannten Schreibtisch stand. Es waren Dutzende Rosen, alte englische Sorten in Champagner und Rosé, die wunderbar dufteten.
„Gefallen sie dir? Ich dachte, du könntest ein wenig Frühling gebrauchen, wenn du es schon so tapfer hier unten bei mir aushältst.“
Ich stand noch einmal auf, sog den Duft der Rosen tief ein und berührte die samtigen Blütenblätter. „Danke, ich glaube, so einen schönen Strauß habe ich noch nie bekommen. Und was ist mit dem Tisch?“
„Ist ausgeliehen. Damit du arbeiten kannst. Robert besorgt noch Lampen, sie müssen gleich da sein. Sag ihm einfach, was du sonst noch benötigst, und er holt es dir.“
„Danke, Julius, das ist toll!“
Er schickte mir erneut die stille Variante seines Lachens, doch schon im nächsten Moment fühlte ich seinen Hunger. Julius versuchte, es vor mir zu verbergen, doch die Siegel hatten einen eigenen Willen und teilten mir sein Bedürfnis dennoch mit. Als hätte ich nicht auch ohne sie genau gewusst, wie sehr er auf meine Lebenskraft angewiesen war, um in seinem engen Gefängnis nicht vollends zu verfallen und den Verstand zu verlieren.
„Gleich, Julius, lass mich erst einmal ankommen“, seufzte ich.
„Du musst nicht …“
„Ist schon gut.“ Ich nahm eine Decke vom Fußende meines Bettes und breitete sie neben dem Sarg aus.
***
Brandon
Brandon und Christina wanderten auf einem alten Schafspfad an der Schlucht entlang. Er erzählte, wie ihm einmal ein Tier auf der steilen Klippe abgestürzt war und er sich deshalb tagelang nicht nach Hause getraut hatte.
„Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles ausprobieren wollte. Ich war kurz davor, mir ein Schaf von unserem Nachbarn auszuleihen, aber der war schon zu einem anderen Weideplatz gezogen. Rate, was passiert ist, als ich heimkam?“
Christina sah ihn mitfühlend an.
„Es gab ein Festessen!“
Als Brandon das verdutzte Gesicht seiner Freundin bemerkte, fuhr er fort: „Vaters Jungendfreund Two Feathers war nach langen Jahren ins Reservat zurückgekommen. Stell dir vor, Chris, ich habe ganz umsonst Schiss gehabt! Vater wusste überhaupt nicht, wie viel Schafe wir besaßen. Sobald ich die Herde in den Pferch gebracht hatte, wählte er den fettesten Hammel aus. Den hat er dann Two Feathers zu Ehren geschlachtet. Sie haben die ganze Nacht erzählt, und Vater trank keinen einzigen Tropfen Alkohol. Ich hatte seit Langem das erste Mal wieder Achtung vor ihm.“
„Dieser Two Feathers muss ein eindrucksvoller Mann gewesen sein.“
„Oh ja, das war er. Er hat nie für die Weißen gearbeitet wie Vater, sondern ist als junger Mann aus dem Reservat abgehauen. Weißt du, nach dem Massaker von Wounded Knee 1890 hatten die meisten die Hoffnung verloren, weil es deutlich gemacht hatte, dass unsere Leben für die Weißen keinerlei Wert hatten und sie bereit waren, mit aller Grausamkeit gegen uns vorzugehen, wenn wir uns ihrem Willen nicht beugten. Nicht so Two Feathers. Er wollte um jeden Preis kämpfen. Wenn er nicht in den Süden zu den Apachen gegangen wäre, hätte er wohl einen Ein-Mann-Feldzug gestartet.“ Brandon lachte.
„Und die Apachen haben noch gekämpft?“, fragte Christina erstaunt.
Brandon zuckte mit den Schultern. „Bis in die Dreißigerjahre gab es noch ein paar Kriegerverbände, die in Mexiko unterwegs waren. Two Feathers hat mir gezeigt, dass auch ein Junge aus einem Reservat seine Träume leben konnte, wenn er es nur genug wollte. Von jener denkwürdigen Nacht an kannte ich nur noch ein Ziel: abhauen und ein Krieger werden. Und ich hätte es auch geschafft, wenn Coe nicht …“
Brandons Blick ging in die Ferne, dann fuhr er sich über die Stirn.
Christina schloss ihre Hand um seine und drückte sie zärtlich, ihre Finger strichen in einem langsamen, beruhigenden Rhythmus über seinen Puls.
„Komm, lass uns an was anderes denken. Das ist zig Jahre her.“
Brandon versuchte, all die Bilder, die wie unruhige Geister in seinem Kopf herumspukten, zu verbannen, und mit einem Mal wurde ihm tatsächlich leichter ums Herz.
Er packte Christina, drückte sie fest an sich und sog den Duft ihrer Haut ein. Sie war die beste Medizin, die allerbeste! Während Christina noch erleichtert seufzte, stieß er sie wieder von sich und bleckte spielerisch die Zähne.
„Lauf weg!“
Sie machte einige unsichere Schritte. „Wirklich?“
„Na, mach schon! Lass mich sehen, wie schnell dich Julius’ Blut gemacht hat. Keine Angst, hier beobachtet uns niemand.“
Mit dem nächsten Wimpernschlag war sie auf und davon. Brandon ließ einen Moment verstreichen, dann folgte er ihr.
Es tat so gut zu laufen, die alten Pfade entlang, durch ein trockenes Bachbett und immer den Geruch würzigen Salbeis in der Nase, des heiligen Krauts, das hier überall wuchs.
Als angewehter Sand seine Schritte schwerer werden ließ, überbrückte Brandon das kurze Stück, das ihn von Christina trennte, und riss sie zu Boden. Lachend rutschten sie durch den feinen Sand.
„Schau“, sagte Brandon atemlos und wies nach oben. „Das habe ich wirklich vermisst!“
Die Milchstraße zog sich wie ein diamantbestickter Schleier durch den Nachthimmel.
„Meine Großmutter Dolores kannte ein Fadenspiel, in dem die Sternbilder abgebildet waren. So war es für uns Kinder leicht, sie zu lernen.“
Christina kuschelte sich in seine Armbeuge und blickte in die Richtung, die ihr Brandons Finger wies. „Dort ist der große Wagen, wir nennen ihn Náhookos Bika´ii, ‚der Mann des Nordens‘. Er ist der Vater oder der Beschützer des Heims.“
„Hat er auch eine Frau?“, fragte Christina. Sie ließ ihre Hand über seine Brust gleiten, tiefer wandern, bis er scharf Luft einsog und lachte. „Natürlich hat er eine.“
„Und wie heißt die?“
„Das errätst du nie! Náhookos Bi´áadii, ‚Frau des Nordens‘, natürlich!“
Christina stützte sich auf. „Besserwisser“, flüsterte sie und gab ihm einen schnellen Kuss auf den Mund. „Und der Morgenstern?“
„Ma´ii Bizo´.“
„Und das heißt?“
„Und das heißt, und das heißt“, äffte Brandon sie grinsend nach und zog sie in seine Arme. „Das ist Coyotes Stern, und wenn du nicht aufpasst, klaut Coyote dich, wie er den ersten Menschen die Sterne geklaut hat, und rennt mit dir davon!“
Im nächsten Augenblick rollte er sich auf sie und drückte sie in den Sand. Christina keuchte überrascht, vergrub die Hände in seinem langen Haar und zog seinen Kopf näher, um ihn leidenschaftlich zu küssen.
Als sie schließlich den Rückweg angetreten hatten und schon eine Weile gegangen waren, zerfraß plötzlich anschwellender Motorenlärm die Stille. Ein Pick-up fuhr die Piste herauf und kam ihnen genau entgegen.
Scheinwerferlicht zuckte über die Büsche.
„Was will der denn hier?“, fragte Christina verwundert und schmiegte sich enger an Brandon.
„Da ist nur jemand spät auf dem Heimweg. In den Hügeln gibt es überall kleine Hütten und Trailer.“
Ein zweiter Wagen näherte sich von der Gegenseite. Die starken Scheinwerfer blendeten.
Brandon blieb stehen, zog Christina von der Piste hinunter und beschattete seine empfindlichen Augen. Dann spürte er auf einmal die Nähe anderer Unsterblicher. Das kalte, magische Gefühl ging von beiden Fahrzeugen aus.
Die Geländewagen steuerten nun direkt auf sie zu.
„Oh Gott!“ Christina hatte nun auch bemerkt, dass es sich bei den Ankömmlingen zumindest teilweise um Vampire handelte.
Brandon legte ihr schützend seinen Arm um die Schulter und lächelte aufmunternd. „Hey, sie wollen uns sicher nur kontrollieren. Wir haben ein Recht, hier zu sein, sie dürfen uns nichts tun. Und die Zeiten, in denen jeder Babyvampir einfach abgemurkst wurde, sind vorbei. Entspann dich.“
„Hast du die Papiere auch wirklich dabei? Bran, was machen sie, wenn …“
Er brachte sie mit einem Kuss zum Schweigen und zog triumphierend das Dokument aus seiner Hosentasche. „In ein paar Minuten sind die sicher wieder weg. Dann darfst du dir aussuchen, was wir den Rest der Nacht machen.“
Erleichtert fühlte er Christinas Furcht schwinden. Sie erwiderte sein Lächeln zaghaft. „Ich wüsste da was.“
„Was denn?“
„Wir könnten zum Abschluss bringen, womit wir vorhin angefangen haben.“
Brandon drückte sie zur Antwort fest an sich und musste sich zusammenreißen, um den Fremden mit gebührender Höflichkeit entgegenzutreten.
Die Wagen bremsten abrupt und hüllten sie in Staub. Die Luft schmeckte plötzlich mineralisch.
„Alberne Cowboys“, kommentierte Brandon das Manöver abfällig und rührte sich nicht vom Fleck. Hinter ihm und Christina gähnte die Schlucht des Colorado River, und tief unten in der Nachtschwärze rauschte der Fluss. Die Fahrzeuge blockierten den Fluchtweg.
In den Autos saßen zwei Unsterbliche. Brandon konnte sie gegen das grelle Scheinwerferlicht nicht erkennen, doch er fühlte Alter und Anzahl. Einer war sehr stark, ein Meister.
Mit ruhiger Bewegung hob Brandon die Reisegenehmigung mit dem Ratssiegel hoch und hielt die Seite mit dem Zeichen ins Licht. „Christina Reyes und Brandon Flying Crow, Haus Lawhead, Clan Leonhardt aus Los Angeles. Wir haben Reise- und Jagderlaubnis in Arizona.“
Sie warteten vergeblich auf Antwort. Brandon hielt weiterhin mit der Rechten das Dokument von sich gestreckt, sein linker Arm ruhte um Christinas Schulter.
„Bitte überprüfen Sie unsere Dokumente, Meister. Wir haben Recht und Gesetz geachtet.“ Brandon wurde langsam unsicher. Wie lange sollte er noch in die grellen Lichter starren und die Dokumente hochhalten, wenn sie offensichtlich niemand prüfen wollte?
„Was wollen Sie von uns?“, rief er gegen die lärmenden Motoren an.
Ein Mann stieg aus. Sein Gesicht sah merkwürdig aus. Wie das einer Wachsfigur, die Hitze ausgesetzt worden war. Zerflossen, irgendwie schemenhaft und doch körperlich. Es war ein Vampir mit alten Brandwunden.
Der Fremde begann höhnisch zu lachen.
Es klang erschreckend vertraut und ballte Brandons Eingeweide zu einem schmerzenden Klumpen zusammen. Das war nicht … das konnte nicht sein!
„Kommt mein entlaufener Köter also doch endlich nach Hause geschlichen!“
„Nein! Du bist tot!“, schrie Brandon.
„Das hast du dir wohl gewünscht!“
„Das kann nicht sein, das kann nicht sein“, wiederholte Brandon leise, dann verkümmerte seine Stimme zu einem Flüstern.
Er nahm Christina, die sich mit aller Kraft an ihn klammerte, kaum noch wahr. Sie verstand nicht, was in ihn gefahren war. „Bran, wer ist das? Wir haben doch kein Unrecht getan, oder?“
Brandon konnte ihr nicht antworten. Er war wie gelähmt. Es gab nur ein Wesen, dessen bloßer Anblick diesen Terror in ihm hervorrufen konnte: seinen alten Meister und Schöpfer – Nathaniel Coe. Der totgeglaubte Inbegriff seiner Albträume. „Du ahnst ja gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe, als Conway zufällig die aktuelle Liste der Durchreisenden überflog und ausgerechnet deinen Namen darauf gefunden hat“, sagte Coe und trat nun vollends ins Licht.
Brandon schrie bei seinem Anblick, als habe er in glühende Kohlen gefasst. Er kam zu sich. „Chris, lauf weg!“ Er stieß sie fort und rief seine Magie herauf, obwohl ihm klar war, dass er gegen Coe chancenlos war.
Vielleicht konnte er ihn zumindest so lange aufhalten, bis Christina außer Gefahr war. Doch die dachte gar nicht daran, ihn im Stich zu lassen. „Du wagst es!“, brüllte Coe, als Brandon sich ihm mit dem Mut der Verzweiflung entgegenwarf.
Brandon schaffte zwei Schritte, dann fuhr ein Blitz in sein Herz und schien es schier zu zerreißen. Sein Körper ergab sich vor dem Schmerz und brach zusammen. Ein samtiger Geschmack füllte seinen Mund, dann lief Blut seine Lippen herab und rann aus seinen Augen. Die Nacht färbte sich rot.
Coe durfte Christina nicht das Gleiche antun!
Brandons Lungen füllten sich unwillig, als er mit letzter Kraft Luft hineinzwang, dann keuchte er noch einmal: „Lauf weg von hier, Chris, verschwinde.“
Brandon starrte auf Coes Stiefelspitzen. Der Meister stand direkt neben ihm. Christina behandelte er zum Glück wie Luft. Brandon hätte so gerne gegen ihn gekämpft, wäre für einen letzten Triumph bereitwillig gestorben, doch seine Muskeln verweigerten den Dienst. Sein Blut erkannte den Schöpfer, so sehr er ihn auch verabscheute.
Coe spuckte ihm ins Gesicht.
Dann explodierte Schmerz in seinem Magen. Die Heftigkeit, mit der sein Schöpfer zutrat, schleuderte Brandon in die Nähe des Abgrunds. Reflexartig zog er Arme und Beine an den krampfenden Körper.
„Gnade, bitte, bitte, Gnade!“, flehte Christina wie aus weiter Ferne.
„Er gehört mir“, knurrte Coe, „und ich mache mit ihm, was mir gefällt.“
Als Brandon klar wurde, wo er sich befand, versuchte er, unauffällig weiter zum Rand zu kriechen. Schon wurde das verheißungsvolle Rauschen des Colorado lauter. Lieber in die Tiefe stürzen, als zu seinem alten Meister zurückzukehren! Alles war leichter zu ertragen als Coe. Brandons Hände fanden kaum Halt im Sand, er kroch, zog sich an scharfen Gräsern vorwärts, zerschnitt sich die Hände.
Dann kam Coe, und die Chance war vertan. Er packte zu und riss Brandon mit einer Gewalt an den Haaren vom Steilhang fort, die beinahe die Haut vom Schädel trennte. Brandon schrie verzweifelt. Der Tod, der schon seine freundlichen Arme nach ihm ausgestreckt hatte, rückte in weite Ferne. Ein Tritt in den Rücken stieß ihn weiter Richtung Jeep.
„Wag es nie wieder!“, brüllte Coe. „Ich habe dich erschaffen! Dein Leben gehört mir, mir ganz allein! Ich entscheide, wann und wie es endet!“
***
Julius
Ich schrie aus Leibeskräften. Meine Panik flutete durch die offenen Siegel in Ambers Körper, und sie schrie mit mir. In ihrer Verzweiflung riss sie an dem Schloss, das die Kette meines Sargs hielt, und schlug mit bloßen Händen darauf ein.
Fußgetrappel ertönte auf der Treppe. Vampire und Menschen stürmten in unsere Kammer. Ich schlug und trat gegen die Sargwände. Immer wieder brannte Brandons Hilferuf durch meinen Körper, zerrte an dem Gelübde.
„Er hat ihn, er hat ihn!“, brüllte ich. „Er darf ihn nicht bekommen!“
Curtis kam, endlich. „Julius, beruhige dich, verdammt!“
Ich war keines klaren Gedankens mehr fähig und tobte weiter.
Die Vampirin Ann riss Amber von meinem Sarg fort und hielt sie fest. Das durfte sie nicht! Ich stach mit Magie nach ihr. Ann schrie gepeinigt, riss im Taumel Ambers Tisch mit der halbfertigen Plastik um und brach zusammen.
Wütend schlug Curtis mit beiden Händen auf den Sarg. Mit dem Knall stieß er seine Magie in meinen Körper. „Still, habe ich gesagt!“
Ein Schmerz, schneidend wie Messer, dann erstarrten meine Glieder. Mein Geist war plötzlich taub, meine Gedanken schwammen langsam wie durch zähen Sirup.
„Kannst du mich hören, Julius?“
„Ja, Meister“, krächzte ich. Echte Worte von meinen Lippen. Amber weinte.
„Dann gehorche mir auch.“
„Ja, Meister, das will ich.“
Meine Welt geriet ins Wanken. Der Sarg bewegte sich! Steven und Ann trugen ihn. Curtis ging voran. Ich erriet, wohin man mich brachte: in die Räume des Meisters unter der alten Kinobühne. Dorthin, wo der Sarg normalerweise stand.
Unterdessen geschah etwas mit meiner Bindung zu Brandon. Sie schwand. Dichter Nebel kroch hinein und verstopfte sie. Ich hörte ihn nicht mehr, wurde taub für seine Angst, und dann vergaß ich gänzlich, was mich so in Aufregung versetzt hatte.
Vom nächsten Moment an zählte nur noch eines: Ich kam frei! Ich kam endlich frei!
An der Tür zu seinem Büro blieb Curtis stehen. „Amber, du musst hier warten, bis du eingelassen wirst. Es ist zu gefährlich für eine Sterbliche.“
„Nein, ich will dabei sein. Ich will bei ihm sein!“
„Amber, bitte, mach, was der Meister sagt. Ich will dir nicht wehtun“, sagte ich lautlos.
„Du würdest mir nie wehtun, Julius!“
„Doch, du weißt ja nicht, was aus mir geworden ist!“
Amber gab auf. Schluchzend lehnte sie sich gegen die Wand und rutschte zu Boden.
Sie trugen mich hinein und setzten den Sarg auf einem kleinen Podest ab. Mehr und mehr Vampire kamen. Erstaunt fühlte ich auch Lilianas Anwesenheit. Die Meisterin des Mereley-Clans war zu einer Beratung mit Curtis hergekommen und wollte nun offenbar bleiben, um zu helfen. Seit Jahrzehnten verband uns eine tiefe Freundschaft, und sie hatte mich während meiner Gefangenschaft mehrfach besucht.
Die Vorbereitungen für meine Freilassung kamen voran. Ich hörte leise Schritte, unterdrücktes Gemurmel, Curtis’ Befehl, die Fesseln zu bringen.
Ich würde endlich trinken können.
Frisches Blut! Der Gedanke an neue Lebenskraft ließ alles andere in den Schatten treten. Mein Unterleib krampfte, und die Welt war plötzlich blutroter Schmerz.
Lilianas kalte Energie rauschte in mein Gefängnis, doch ich wehrte mich. Sie durfte mich nicht betäuben! Ich wollte Freiheit, endlich Freiheit! Ich riss meine Schilde hoch und verbarg mich dahinter wie in einer Festung aus Glas. Es war dumm. Liliana wollte mir helfen, doch ich hatte alle Vernunft hinter mir gelassen.
„Julius!“ Das war Curtis. Es klang wie eine Drohung.
Ich riss mich augenblicklich zusammen. Er würde es fertigbringen und meine Freilassung im letzten Moment aufheben.
Also ließ ich meine Schutzschilde wieder fallen und erlaubte Liliana, nach meiner Seele zu greifen. Es tat überraschend gut. Sie vertrieb den Schmerz aus meinem Leib und machte die Messer des Dämons Hunger stumpf.
„Bleib ruhig“, flüsterte sie. „Ich bin bei dir, ich passe auf dich auf. Schließ die Augen.“
Ein Schlüssel klirrte. Kurz darauf wurden an den beiden Längsseiten des Sargs Fächer geöffnet. Ich krampfte die Augen zusammen. Das hereinfallende Kerzenlicht brannte wie tausend Sonnen.
Hände langten durch die Öffnungen und tasteten über meinen Körper. Die Berührungen waren nach all der Zeit ungewohnt. Ich konnte das Blut in ihren Adern dröhnen hören, aber Lilianas Magie zog mich von der Klippe fort und hielt mich davon ab, wie ein tollwütiger Hund zuzuschnappen.
Die Helfer zogen einen breiten Lederriemen über meine Brust und zerrten ihn fest, bis ich glaubte, meine Rippen würden unter dem Druck brechen. Dann legten sie mir Fesseln an die Handgelenke.
Ich zwang mich, gleichmäßig zu atmen, versuchte, auf Lilianas Herzschlag zu hören und meinen dem ihren anzupassen.
Herzklopfen. Überall klopften Herzen, pumpten Blut durch Adergeflechte. Aber es waren nur Vampire mit mir im Raum, nur tote Körper.
Ich erahnte Amber und die anderen Diener im Haus, und ich begehrte sie, begehrte ihr Leben, ihre Wärme. Sie schienen der einzige Weg aus meiner Finsternis, die einzigen Lichter. Blut! Ich brauchte ihr Blut. Ich wollte Leben trinken. Wollte. Musste!
„Er verliert sich“, hörte ich Liliana sagen, und ja, ich verlor gegen den Hunger. Er tobte in dem kleinen Winkel, in den ich ihn verbannt hatte, und ich würde ihn nicht mehr lange halten können.
„Julius Lawhead, hast du deine Taten überdacht?“
Ich versuchte, mich zu konzentrieren. Mein Schöpfer hatte mir die entscheidende Frage gestellt. Ich musste antworten.
„Ja, Meister, ich bereue. Gib mir die Chance, dir meine Treue zu beweisen.“
„Gut. Holen wir ihn da raus.“
Sobald Curtis die Worte gesprochen hatte, war es aus mit mir. Ich konnte meinen Dämon nicht mehr halten und schrie. Die Ketten rasselten durch die Riegel. Schneller, warum ging das nicht schneller? Ich fauchte, bleckte die Zähne, biss mir in meiner Raserei in die Lippen und schrie mir die Seele aus dem Leib.
Viele Hände halfen mit. Die sechs Riegel wurden zurückgeschoben. Ich wollte aufspringen und hätte es trotz all der Zeit der Bewegungslosigkeit vermocht, wenn der Lederriemen mich nicht ins Kissen gepresst hätte.
Ich fauchte wieder, schrie, kämpfte dagegen an, doch ich war zu schwach.
Dann wurde der Deckel endlich geöffnet.
Helligkeit! Es war unerträglich hell!
Nach und nach lösten sich Gesichter aus dem grellen Weiß. Liliana, Steven, Curtis, Kathryn und noch mehr. Doch all diese vertrauten Wesen nahm ich nur als Gefäße voller Blut wahr. Ihre Leiber enthielten, was mir gehörte, mir! Ich wollte sie zerreißen, zerstören, in ihrem purpurnen Leben baden!
„Julius, mein Sohn“, sagte Curtis ruhig, „trink und kehre zurück zu mir.“
Ich fand kein Wort des Dankes. Sobald sein Handgelenk in Reichweite war, schlug ich meine Fänge hinein und trank.
Curtis’ Energie schwappte in meinen Körper und dämpfte die Schmerzen, bis sie erträglich wurden.
„Genug“, warnte er, doch ich konnte nicht aufhören. Steven umfasste meinen Kopf und bog meine Kiefer auseinander. Ich keuchte.
Es war noch nicht genug! Noch nicht!
„Mehr!“, bettelte ich heiser, doch Curtis’ Gabe war vollendet.
„Warte einen Augenblick, und du sollst so viel bekommen, wie du trinken kannst.“
Ich beruhigte mich und leckte das köstliche Nass von meinen Lippen.
Langsam klärte sich mein Blick. Das Licht, das mich so geblendet hatte, stammte von einer einzelnen Kerze, die weit weg auf Curtis’ Schreibtisch stand. Ich blinzelte und sah von einem zum anderen.
Curtis hielt sein Handgelenk umklammert. Er nickte Kathryn zu. Sie kniete sich neben den Sarg und löste den Riemen, der sich über meine Brust spannte.
Liliana half mir dabei, mich aufzusetzen. Ihre Nähe war berauschend. Sie hielt mir das Handgelenk hin, doch was ich wirklich begehrte, war ihre Kehle. Die Meisterin verstand. Sie musterte mich, und über ihre sonst so beherrschten, kühlen Züge huschte ein Ausdruck des Mitgefühls. Im Gegensatz zu den meisten anderen Vampiren, die nur ihren Ruf als erbarmungslose Kriegerin kannten, wusste ich um ihre weichere Seite. Sie war mir eine treue Freundin. Als sie sich neben den Sarg kniete, war mein Meister alarmiert.
„Liliana, nicht!“
„Lass das meine Sorge sein, Curtis“, antwortete sie kühl.
Mein Hunger peitschte wieder an die Oberfläche, und wäre ich nicht gefesselt gewesen, hätte ich Liliana einfach an mich gerissen. Sie neigte ihren Kopf und beugte sich in meine Reichweite.
Der plötzliche Schmerz ließ sie nach Atem ringen. Dieser Trank war fast noch köstlicher als der erste. Liliana hielt mich in den Armen, während ich ihr Geschenk empfing. Endlich, endlich!
Hitze rauschte durch meine Glieder. Ich sog ihre Kraft auf wie ein Schwamm.
„Julius, das reicht!“, sagte Curtis scharf.
„Er weiß selbst, wann genug ist“, entgegnete Liliana mit schmerzgefärbter Stimme.
Sie hatten beide recht. Ich hatte sie mehr als genug beansprucht und tat ihr weh, auch wenn sie es mich nicht spüren ließ.
Ich ließ von ihr ab, und als sich die Wunde geschlossen hatte, drückte ich ihr einen Kuss auf die Kehle. „Danke.“
***
Amber
Ich hielt den Atem an und starrte wie gebannt durch das Schlüsselloch.
In Curtis’ Räumen spielten sich gespenstische Szenen ab.
Aus dem Sarg stieg eine klapperdürre Gestalt, bei der es sich ohne Zweifel um Julius handelte. Der Anblick war schrecklich, und dennoch wünschte ich mir nichts sehnlicher, als in diesem Moment bei ihm zu sein, an seiner Seite.
Ich verstand noch immer nicht, warum man mich ausgesperrt hatte, ausgerechnet mich! Sogar die Siegel waren geschlossen. Das war Curtis zu verdanken, da war ich mir sicher. Er wollte nicht, dass ich an Julius’ Freilassung teilhatte. Julius schwankte, dann stützte er sich auf Liliana.
Im Raum wurden mehr Kerzen angezündet, und ich konnte weitere Einzelheiten erkennen. Unter dem abwartenden Blick von sechs Vampiren der Leonhardt führte Liliana Julius im Kreis. Seine Schritte waren unsicher. Die Kleidung hing in Fetzen und schlackerte an seinem mageren Leib.
Einmal, als sie der Tür recht nahe kamen, blieb Julius plötzlich stehen. Sein Kopf ruckte herum, und er bleckte die Zähne. Die Augen leuchteten gespenstisch in den Höhlen.
Er wusste, dass ich da war, wusste es genau!
Liliana zerrte ihn weiter, führte den Widerstrebenden zum nächsten Vampir, der ihm daraufhin das Handgelenk entgegenhielt.
Es dauerte über eine Stunde und drei weitere Blutgaben, bis ich glaubte, wieder den Mann vor mir zu sehen, der vor beinahe drei Monaten die Strafe angetreten hatte.
Julius’ Schritte wurden immer geschmeidiger, schneller.
Er kniete vor seinem Meister nieder, und ich hörte ihn sprechen. Mit rauer Stimme bekräftigte er seine Treue und wurde von seinem Schöpfer in die Arme geschlossen.
War es jetzt so weit? Durfte ich jetzt endlich zu ihm? „Julius?“, flüsterte ich.
Sein Kopf ruckte herum. Dann raste er mit übernatürlicher Geschwindigkeit zur Tür und prallte dagegen.
Ich schrak zurück. Das Holz zitterte noch, als ich mich wieder vorwagte und vorsichtig eine Hand an die Tür legte.
„Hey“, flüsterte ich, „geht es dir gut?“
Julius’ Finger kratzten über das Holz. Er rüttelte an der Klinke, drückte sie immer wieder, als verstünde er nicht, dass die Tür abgeschlossen war.
„Ich bin hier!“, wisperte er, dann sah ich ihn durch das Schlüsselloch. Er begegnete meinem Blick mit geröteten Augen.
„Verdammt, Julius. Warum darf ich nicht zu dir? Warum lassen sie mich nicht hinein?“
„Ich … ich will dir nicht wehtun“, erwiderte er, und da fühlte ich, wie die Blockade der Siegel schwand und sich unsere Verbindung wieder öffnete.
Nun empfand ich seinen Hunger und wie sich schon bei dem Gedanken an mich alles in ihm zusammenkrampfte. Julius verlangte es mit aller Macht nach menschlichem Blut!
Kurz glaubte ich, mich auf der anderen Seite zu befinden. Ich erlebte, wie er sich verzweifelt gegen die Tür drückte, sich sogar einbildete, meine Wärme im Holz spüren zu können. Wie er die Tür streichelte wie ein verliebter Narr und seine Wange über die glatte Oberfläche rieb.
„Julius, hör auf, du darfst noch nicht zu ihr. Du weißt, was letztes Mal passiert ist.“ Liliana fasste ihn an den Schultern und zog ihn entschieden fort.
Sofort wurde meine Verbindung zu ihm schwächer. Fluchend nahm ich wieder meine Position vor dem Schlüsselloch ein.
„Trink noch einmal, dann kannst du zu ihr. Ich bleibe bei dir und passe auf“, hörte ich Liliana sagen, die Julius mit festem Griff am Arm hielt.
Julius fing sich schnell wieder. Er schaute sich suchend um, dann streckte er seinen Arm nach Ann aus. Nachdem er von ihr getrunken hatte, schien er endgültig gesättigt zu sein.
„Darf ich jetzt gehen, Meister?“, fragte er mit sicherer Stimme.
Als Curtis daraufhin nickte und einen Schlüssel aus seiner Tasche zog, klopfte mein Herz zum Zerspringen.
***
Julius
Lilianas Arm glitt um mich, während Curtis die Tür aufschloss. Die Meisterin wappnete sich, mich aufzuhalten, falls ich etwas Unüberlegtes tat.
Und dann sah ich sie. Amber.
Sie machte unsicher einen Schritt zurück. Ihr sorgender Blick glitt über meinen ausgelaugten Körper. Sie schien etwas sagen zu wollen, schwieg aber.
Der Wunsch, sie in den Armen zu halten, den Duft ihrer Haare zu atmen und ihre weiche Haut zu berühren, war beinahe überwältigend. Verzweifelt krampfte ich meine Hand in Lilianas.
„Komm ihm nicht zu nahe, Amber“, warnte Curtis und schob seinen Arm zwischen sie und mich, gerade als sie die trennende Distanz überbrücken wollte.
Ich wollte sie! Meine Sicht trübte sich, und ich nahm nur noch die kostbare Flüssigkeit wahr, die durch Ambers Adern pumpte. Das Herz war gleich dort. Ich musste nur danach greifen, und schon wäre es mein.
Dann wurde mir mit einem Schlag bewusst, dass ich darüber phantasierte, meiner Dienerin das Herz aus der Brust zu reißen.
„Liliana, hilf mir!“
Die Meisterin zog mich an sich, und ich krümmte mich in ihren Armen. Der köstliche Duft von Angst lag in der Luft. Ambers Angst. Genauso roch Beute, und ich bleckte gegen meinen Willen die Zähne.
Amber blickte unschlüssig von der Meisterin zu mir.
„Was hältst du davon, deinem Herrn ein Bad einzulassen, Amber?“, fragte Liliana. Ihre Worte klangen mehr nach einem Befehl als einer Bitte.
„Ja, natürlich.“
„Kein elektrisches Licht, seine Augen vertragen das noch nicht.“
Liliana wartete, bis Amber außer Sicht war, dann lockerte sie ihren Griff, und wir erklommen die Treppe gemeinsam. Ich war dankbar für ihre Hilfe.
Ambers Duft hing in der Luft.
„Ich habe schrecklichen Hunger nach ihr“, flüsterte ich.
Liliana nickte. „Ich lasse euch nicht allein.“
Amber wartete im Flur und hielt die Tür zum Bad auf. Mehrere dicke weiße Kerzen standen auf den marmornen Waschbecken und am Rand der feudalen Badewanne. Das Wasser lief aus zwei Hähnen und füllte sie rasch. Es roch nach Jasmin und Lavendel, und plötzlich ersehnte ich nichts mehr, als meinen kalten, ausgelaugten Körper in das warme Wasser gleiten zu lassen. „Was soll ich tun?“, fragte Amber unsicher.
„Bring mir ein paar frische Sachen, bitte“, sagte ich und las ihre Enttäuschung darüber, dass ich sie wieder fortschickte.
Doch dann kehrte der Hunger zurück, und ich brauchte alle Kraft, um Amber nicht anzufallen. „Erklär es ihr, Liliana“, stöhnte ich krampfend und drehte mich von den beiden Frauen weg.
Sie ließen mich allein, und es wurde sofort besser.
Zögernd näherte ich mich einem der beschlagenen barocken Spiegel, wischte eine Ecke frei – und starrte ein Monstrum an. Die Augen waren raubtiergelb und blickten aus tiefen Höhlen, die Wangen waren eingefallen. Das Bild verschwand erneut im Wasserdampf.
***
Brandon
Motorenlärm drang als stetig lauter werdendes Brummen in sein Bewusstsein. Als Brandon wieder zu sich kam, tat ihm alles weh. Er wurde durchgeschüttelt, etwas schlug immer wieder gegen seine Stirn. Er lag auf der rostigen Ladefläche eines Pick-ups, der über Wüstenpfade rumpelte.
Sie hatten ihm die Arme in einem schmerzhaften Winkel auf den Rücken gefesselt. Die Kette war mit seinem Hals verbunden, und er würgte sich selbst beim Versuch, die tauben Hände zu bewegen.
Doch Coe hatte noch etwas mit ihm getan: Die Bindung zu Julius war fort! Brandon konnte seinen Meister weder fühlen noch Kontakt zu ihm aufnehmen. Turmalin. Nur der Halbedelstein besaß diese Wirkung. Er fraß die Kraft von Vampiren und verstopfte die Schwurbindung mit zähem Schleim.
Brandon schluckte an der würgenden Enge in seiner Kehle vorbei. Vielleicht war es auch besser, Julius nicht mehr spüren zu können. Denn aus Coes Klauen gab es kein Entkommen.
***
Julius
Es hatte eine weitere Blutgabe gebraucht, bis Liliana es für sicher befand, mich in Ambers Nähe zu lassen. An der Kehle meiner Dienerin tat ich die letzten heilenden Züge.
Kurz darauf führten mich meine Schritte in Curtis’ Büro. Amber war mir nicht mehr von der Seite gewichen.
Der Meister war noch nicht da.
Der Sarg, in dem ich monatelang ausgeharrt hatte, stand wieder an seinem Platz in der Ecke und war halb von Säulen und Schatten verborgen. Mein ehemaliges Gefängnis sonderte einen dumpfen, muffigen Geruch ab.
Unbewusst griff ich nach Ambers Hand.
Sie trat vor mich, und sobald ich in das Ozeangrün ihrer Augen sah, wurde ich ruhiger.
„Es ist vorbei“, sagte sie sanft, „du musst nicht wieder dort hinein.“
Curtis’ Schritte näherten sich. Ich drückte einen letzten Kuss auf Ambers Puls und drehte mich um.
Der Meister öffnete die Tür, trat ein und schloss sie hinter sich. Anscheinend hatte er Liliana Mereley persönlich verabschiedet. Jetzt streifte er im Vorbeigehen meine Schulter und musterte mich von oben bis unten. „Du hast dich schnell erholt. Setzt euch.“
Curtis glitt um seinen großen Schreibtisch herum und ließ sich in seinen Sessel fallen.
Amber und ich nahmen auf den wesentlich unbequemeren barocken Stühlen Platz, die diesseits des Tisches standen. Abgeschabter Brokatstoff, Löwenköpfe, Gold. Ich kannte diese Möbel seit meiner Geburt in die Dunkelheit, und meine Hände begrüßten die geschnitzten Lehnen wie zwei alte Freunde.
„Eigentlich solltest du volle drei Monate darin bleiben“, sagte Curtis unvermittelt und wies mit einer eleganten Kopfbewegung in Richtung Sarg. Die kleine Geste reichte aus, um mich schaudern zu lassen.
„Soll ich die Strafe jetzt doch vollenden?“
„Nein, nein“, Curtis hob abwehrend die Hände. „Ich hoffe, ich werde dich niemals wieder dort hineinstecken müssen.“
Die Spannung fiel von mir ab.
„Was hat dich deinen Plan ändern lassen?“, fragte ich mit echter Neugier.
„Erinnerst du dich nicht mehr?“
Ich schüttelte verwirrt den Kopf. Wovon redete er da?
„Du hast geschrien, getobt. Ich dachte, du bringst dich da drin endgültig um.“ Curtis musterte mich forschend.
Ich wich seinem stechenden Blick aus und versuchte, die Zeit, bevor sie den Sarg hierhergebracht hatten, Revue passieren zu lassen. Doch da war nichts, nur vollkommene Leere.
Ich zuckte mit den Schultern.
„Du hast immer das Gleiche geschrien“, erklärte Amber. „‚Er darf ihn nicht bekommen!‘ Was oder wen du damit meinst, hast du aber nicht verraten.“
Ich musterte sie alarmiert. Wenn es so schlimm gewesen war, dass Curtis meine Strafe abbrach, musste ich wirklich außer mir gewesen sein, aber ich hatte keine Ahnung, warum!
„Hast du gestern Abend eigentlich etwas von Brandon gehört?“, fragte Curtis und hielt dabei meinen Blick.
„Sie sind in Cameron … nein …“
Und dann traf es mich wie ein Hammerschlag. „Nathaniel Coe.“ Der Name war wie aus dem Nichts in meinem Kopf aufgetaucht.
Curtis hob überrascht die Brauen. „Brandons alter Meister? Aber er ist tot, oder nicht?“
Auf einmal war alles wieder da. „Coe ist nicht tot!“ Ich sprang auf und riss dabei fast den Stuhl um. „Coe lebt. Und er hat Brandon!“ Ich musste ihn retten!
Jetzt, wo mein Hunger nicht mehr alle übrigen Sorgen übertünchte, tauchten Brandons schreckliche Erinnerungen an Erniedrigung, Missbrauch und Folter vor meinem geistigen Auge auf, als hätte sich eine Tür in meinem Verstand geöffnet. Er durfte Coe keinen Augenblick länger ausgeliefert sein! Am liebsten wäre ich sofort losgestürmt.
Ich wusste nicht, wann Curtis aufgestanden war, aber plötzlich stand er vor mir und fasste mich energisch an den Schultern.
„Sieh mich an, Julius!“
Ich starrte in die stahlgrauen Augen meines Meisters. „Brandon ist von meinem Blut. Dieses Monstrum hat kein Recht, er darf nicht …“, stotterte ich und hielt mich an Curtis’ Blick fest, als sei er meine einzige Rettung.
„Wenn es wirklich Nathaniel Coe ist, dann hat er leider jedes Recht, Brandon für sich zu beanspruchen. Er ist sein Schöpfer“, antwortete Curtis ruhig und bestätigte damit, was ich insgeheim gefürchtet hatte.
„Nein, er wird ihm das nicht noch einmal antun. Ich, ich …“ Ich wollte es nicht wahrhaben.
Curtis’ Griff wurde fester, meine Muskeln protestierten unter der groben Behandlung. „Ich habe niemals so tief in Brandons Erinnerungen geschaut wie du“, sagte er. „Aber ich weiß genug, um dir und ihm helfen zu wollen, hörst du? Wenn es einen Weg gibt, ihn zurückzuholen, dann unterstütze ich dich mit allem, was die Leonhardt geben können, ohne selbst dem Tod anheimzufallen.“
„Nathaniel Coe ist schlimmer als der Tod“, erwiderte ich rau.
„Kannst du Brandon spüren?“, fragte Curtis.
Ich ging in mich, tief in den stillen, lichten Raum in meinem Herzen, wo die Siegel mit Amber lagen und auch die Fesseln aus Blut und Wort, die mich mit meinen Vampiren verbanden.
Brandon.
Ich rief, doch ich fand ihn nicht. Jemand hatte das Band durchtrennt! Nein, nicht durchtrennt. Anders. Es war, als liefe es unter einer geschlossenen Tür hindurch, die ich nicht durchschreiten konnte. Meine Magie prallte nutzlos daran ab. Ich öffnete die Siegel, griff nach Ambers Lebenskraft, bündelte sie mit meiner und versuchte es noch einmal.
Wieder nichts.
„Was ist das?“ Amber war ebenfalls aufgestanden und starrte mich verwundert an. Sie hatte genau gespürt, was ich versucht hatte. „Es war wie eine Mauer.“
„Eine Mauer, sagt ihr?“ Curtis lief auf und ab, während er überlegte. „Seine alten Schwüre Coe gegenüber sind vergangen. Er hat sich mit ganzem Herzen dir gegeben und ist nach wie vor dein. Ich …“
„Sieh nach“, forderte ich und knetete meine Hände. „Bitte, Curtis, du musst!“ Im nächsten Atemzug ließ ich meine Schilde fallen und mein Meister war in meinem Herzen. Seine Energie wusch durch meinen Körper und fand die Schwüre, dann war Curtis’ Macht wieder fort.
Ich stolperte rückwärts, fühlte mich ohne seinen Einfluss einen Moment verloren. Amber stützte mich.
Curtis hatte uns den Rücken zugedreht und lachte auf. Er lachte?
„Dieser Nathaniel Coe ist dumm“, sagte er im Brustton der Überzeugung. „Er hat eure Bindung gar nicht zerstört! Dabei wäre das für ihn als Brandons Schöpfer so einfach. Ich an seiner Stelle hätte mit Blut und Schmerz jede Erinnerung aus Brandons Geist gewaschen, bis er rein wäre wie ein leeres Gefäß, das ich neu füllen könnte.“
Ich kannte Curtis’ Stärke, und Aussprüche wie dieser waren es, die mich manchmal wieder daran erinnerten, wie gefährlich er wirklich war.
„Was bedeutet das?“, stellte Amber meine Frage für mich. „Was hat er getan?“
„Ich tippe auf schwarzen Turmalin.“
„Der Edelstein?“
„Ja, genau. Schwarzer Turmalin verhindert den Gedankenaustausch. Er stört den Energiefluss zwischen zwei Wesen, blockiert die Aura“, erwiderte Curtis. Dann fixierte er wieder mich. „Was ist mit Christina? Wenn dieser Coe sie ebenfalls in seiner Gewalt hat, ist das ein Verstoß gegen den Codex und wir können gegen ihn vorgehen. Such die Bindung zu ihr. Ich hoffe für uns, für Brandon, dass du sie nicht findest.“
Ich konzentrierte mich wieder auf den Raum in meinem Herzen und entdeckte Christina sofort. Ihren Schmerz, ihre Angst. Sie weinte so sehr, dass sie kaum Luft bekam. Ihre Hände krampften sich um ein Lenkrad. Sie fuhr über den Freeway. Durch die Windschutzscheibe konnte ich eine nächtliche Skyline ausmachen, die mir bekannt vorkam. „Sie ist auf dem Weg zu uns, bald müsste sie hier sein. Ich kann Coes Magie in ihr spüren. Er hat ihr einen Befehl eingepflanzt: Heimkehr.“
Deshalb hatte sie sich vorher nicht gemeldet. Sie stand noch immer unter seinem Einfluss, aber er hatte sie nicht geraubt und also nicht gegen den Codex verstoßen.
„Verdammt!“ Curtis nahm seine Wanderungen durch das Zimmer wieder auf und schlug mit der flachen Hand gegen eine Säule.
„Curtis, ich muss zu Brandon!“, sagte ich.
„Du wirst nirgendwo hingehen!“, donnerte er. „Nicht, wenn ich es nicht erlaube.“
Ich zuckte zusammen. Panik und Enge. Curtis schickte mir meine eigene Erinnerung an den Sarg. Ich taumelte mit gebleckten Zähnen rückwärts. Im nächsten Augenblick stand mein Meister wie aus dem Nichts vor mir, fasste nach meiner Kehle und drückte meinen Kopf hoch. Er zwang mich, ihm in die Augen zu sehen. Seine Iris waren zu hellem Grau geworden, einer Farbe wie von schmutzigem Schnee.
„Du wirst dich meinem Willen nicht widersetzen, Julius Lawhead.“
„Nein, das werde ich nicht.“
Curtis’ Augen wurden schnell wieder dunkler, seine Wut verschwand. „Wir machen es auf meine Weise“, erklärte er ruhig und lockerte den Griff um meine Kehle. Mein Puls trommelte, angefeuert von Adrenalin, gegen seine Hand. Ich war noch weit davon entfernt, meine Gefühle so vollständig zu kontrollieren wie mein Meister. „Ich werde dir in allen Dingen folgen“, erwiderte ich und senkte den Blick.
Curtis’ Hand glitt fort von meinem Hals, ruhte auf meiner Schulter.
„Versteh mich nicht falsch, Julius. Ich will Brandon genauso befreien wie du. Aber ich kann nicht erlauben, dass du einfach nach Arizona fährst und dem hohen Rat von Phoenix einen guten Grund lieferst, dich umzubringen.“
„Und was soll ich dann bitte tun?“, fragte ich.
Amber drängte sich zwischen uns. „Wir lassen ihn nicht einfach so im Stich! Er ist unser Freund. Das mache ich nicht mit!“
Curtis setzte sich wieder an seinen Tisch. Jetzt war er ganz in seinem Element, plante, wägte ab. „Ich werde als Erstes beim Rat von Phoenix sichere Passage für euch erbitten, damit niemand auf die Idee kommt, ihr wolltet ein fremdes Territorium übernehmen. So jung du als Meister auch sein magst, Julius, du bist eine Bedrohung für die bestehenden Strukturen in Arizona. Du wirst nach Phoenix fahren und versuchen, beim Rat ein Urteil gegen Coe zu erwirken. Er hat viele Menschen getötet, wir beide wissen das aus Brandons Erinnerungen. Allerdings sind das dürftige Beweise, und ich zweifle, dass sie für eine Anklage ausreichen. Versuchen müssen wir es dennoch.“
„Und wenn die Ratsmitglieder eine Verurteilung ablehnen?“
„Dann wirst du alles daransetzen, Brandon von Nathaniel Coe freizukaufen.“ „Oder einen anderen Vampir gegen ihn austauschen, wenn du das fertigbringst“, ergänzte er in Gedanken, und sein Blick flackerte kurz zu Amber.
Er wusste, wie wenig Verständnis sie für unsere Gesetze hatte. Dennoch war auch ich schockiert. Wie sollte ich einen anderen Unsterblichen dem ausliefern, was Brandon geschehen war? Und an wen dachte Curtis dabei überhaupt?
„Steven wird euch begleiten“, beantwortete er meine unausgesprochene Frage.
„Nein!“ Nicht ausgerechnet Steven. Er war nach Christina der Jüngste im Clan und wie ein kleiner Bruder für mich. Ich hatte ihn sein ganzes, kurzes Leben als Vampir über begleitet. Dass er es zu seinem Vorteil genutzt hatte, als Curtis mich nach meinem Vergehen mit Missachtung strafte, hatte ich dem Jungen längst verziehen.
„Doch, Julius, und ich dränge dich außerdem, Ann noch vor deinem Aufbruch die Commendatio abzunehmen. Du brauchst sie nicht nach Arizona mitzunehmen, aber der Rat dort wird sofort spüren, wie groß deine Camarilla ist, und du solltest so stark und mächtig erscheinen wie möglich.“
„Aber ich will sie nicht, Curtis“, protestierte ich. Die Commendatio, der Treueeid, war nicht so einfach wieder aufzuheben. Ich trug an der Verantwortung für Brandon und Christina schon schwer genug.
„Ich verspreche dir, dass ich dir Ann abnehmen werde, sobald ihr zurück seid. Ich habe sie in den vergangenen Monaten geprüft und nehme sie gerne auf. Sie ist vielleicht nicht stark, aber sie hat ein gutes Herz.“
„Und du denkst, das Ganze ist wirklich nötig?“
„Ja.“
„Okay, dann mache ich es eben“, murrte ich widerwillig.
Curtis nickte zufrieden. „Ich werde Steven noch nichts sagen, außer, dass er dich begleiten soll. Ann bleibt hier. Wenn du mit deiner ganzen Camarilla reist, würde das zu viele Fragen aufwerfen. Arizona ist dünn besiedelt. Es gibt dort weite Landstriche, in denen keine Vampire leben. Falls sie auf die Idee kämen, du würdest nach einem eigenen Territorium suchen …“
„Aber bin ich dafür nicht zu jung?“
„In einer Großstadt definitiv, aber auf dem Land ticken die Uhren anders. Mit meiner Erlaubnis könntest du ein Revier besetzen. Aber es gibt kaum genug Nahrung. Selbst die mächtigsten Clans leben in kleinen Gruppen verteilt.“
„Das klingt aber alles andere als einladend.“
„Geh und kümmere dich um Christina. Ich werde alles vorbereiten.“ Er sah auf die Uhr. „Wir haben noch eineinhalb Stunden bis zum Sonnenaufgang. Ich rufe Zeugen in den Versammlungsraum.“
Amber und ich hasteten die Treppe hinauf.
In Gedanken suchte ich die Vampirin Ann und tat ihr meinen Willen kund, ihr den Eid abzunehmen.
Sie beantwortete mein Angebot mit einem rauschhaften Glücksgefühl. Ich schob es beiseite, um mich auf Christinas Ankunft vorzubereiten.
Amber und ich erwarteten sie an der Hintertür des Lafayette, und schon bald ertönte das laute Brummen eines Pick-ups aus der Seitenstraße.
Der schwarze Dodge Ram zog einen glänzend silbernen Airstream-Wohnwagen hinter sich her, der ausreichend Platz für vier Vampire und zwei Diener bot.
Das Gespann rollte in die Einfahrt des Hinterhofs. Sobald Christina uns entdeckte, erstarb der Motor.
Amber machte sich von mir los und lief auf den Wagen zu. Als sie die Fahrertür erreicht hatte, fühlte ich Christinas unbändigen Hunger aufbranden und brüllte: „Weg! Weg vom Wagen, Amber!“
Alles geschah in Sekundenbruchteilen, zu schnell für meinen noch immer geschwächten Körper, um einzugreifen. Amber verharrte mitten im Lauf. Christina stürzte aus der Tür und direkt auf sie zu.
Amber nutzte den kraftvollen Angriff der Vampirin und wandte ihn mit einem gekonnten Griff gegen ihre Gegnerin. Chris stürzte zu Boden.
Amber sprang blitzschnell auf den Fahrersitz und verriegelte die Tür. Sie war in Sicherheit. Ich atmete auf.
Ehe ich mich versah, war Christina wieder auf den Füßen und starrte meine Dienerin durch die geschlossene Scheibe gierig an. Sie schlug mit den Händen gegen das kugelsichere Glas und kratzte mit den Fingernägeln über die Dichtungen.
„Chris, Christina!“ Ich ging betont langsam auf sie zu. Sie durfte jetzt auf keinen Fall weglaufen! Wenn sie sich nicht sofort wieder in den Griff bekam, würde ich bei unserem Wiedersehen vermutlich ihren Hinrichtungsbefehl in der Tasche tragen.
Sie sah auf und zischte mich an.
Ich fing ihren Blick ein, sandte meine Energie aus und tastete nach ihrem Herzen. Der Muskel lag tot in ihrer Brust, wie ich es befürchtet hatte. Coes Angriff musste heftig gewesen sein und wirkte noch immer nach. Er hatte sie völlig ausgelaugt.
Christina wandte mir ihre Aufmerksamkeit zu, aber sie erkannte mich nicht. Die Instinkte junger Vampire sprachen eine klare Sprache: Halte dich fern von den Alten, sie sind gefährlich, sie töten dich.
Und gerade an meinen Händen klebte das Blut unzähliger Neugeborener.
Aus dem Wageninneren warf mir Amber hektische Blicke zu.
Mittlerweile war ich bis auf wenige Schritte an Christina herangekommen. Sie fauchte wieder und duckte sich, hin- und hergerissen zwischen ihrer vermeintlichen Mahlzeit Amber und mir, dem Tod.
„Chris, erkennst du mich nicht?“ Ich konzentrierte mich auf die Eide, gab ihnen mehr Kraft und erhielt dennoch keine Antwort.
„Christina, bitte!“, flehte ich und streckte beide Arme nach ihr aus. Einmal mehr wurde mir klar, wie viel ich als Meister noch zu lernen hatte.
Plötzlich spürte ich Curtis’ Nähe, und allein der Gedanke an ihn öffnete eine geistige Brücke. „Was schmiedet dich an sie?“
„Blut und Wort“, antwortete ich laut, und schlagartig kannte ich die Lösung.
Christina hatte sich wieder der Autotür zugewandt und versuchte erfolglos, ihre Finger in die Ritze zwischen Tür und Blech zu quetschen.
Ich schlitzte mir mit einem Eckzahn das Handgelenk auf und reckte es in ihre Richtung. Die ersten Blutstropfen fielen auf den Beton, und plötzlich hatte ich ihre volle Aufmerksamkeit.
Ihre Pupillen waren riesig. Wie tiefe Tümpel schwebten sie in ihrem blassen Gesicht. Gierig verfolgten sie jeden Tropfen, der auf den Boden fiel.
„Bei meinem Blut rufe ich dich zu mir, Christina Reyes, denn ich bin dein Meister und dein Schöpfer“, sagte ich ruhig und machte langsam einen Schritt auf sie zu.
Plötzlich flackerte Erkennen in ihren Augen. Sie zischte wieder, doch dann presste sie erschrocken eine Hand auf den Mund. „Julius, was …? Ich …?“
Sie sah kurz zu Amber, dann wieder auf meinen Arm. Die Blutung hatte fast aufgehört, und die Haut schloss sich mit kaltem, magischem Kribbeln.
„Komm zu mir, komm und trink von mir.“
Mit zwei raschen Schritten überbrückte Christina die Distanz. Ich presste ihren eiskalten Körper an mich, bot ihr mein Handgelenk, und sie schlug ihre Zähne hinein.
Sobald sie Christina trinken sah, öffnete Amber die Autotür. Meine Schutzbefohlene schluckte laut und weinte zur gleichen Zeit. Ich führte sie langsam vom Auto fort, die Treppen hinauf.
Amber hielt uns die Tür auf. „Was ist mit ihr?“
„Der Kampf mit Coe hat ihre Energie geraubt. Sie war völlig ausgehungert“, antwortete ich und strich Christina durch die langen Locken.
Mein Blick streifte den orangegrauen Nachthimmel.
Die Zeit drängte. Ich konnte den kommenden Morgen zwar erst erahnen, aber es gab noch so viel zu tun.
Christina starrte mich an. „Brandon wurde entführt, er …“
„Ich weiß“, sagte ich schnell. „Wir werden ihn befreien, wir brechen noch heute auf, Curtis hilft uns.“
„Wirklich?“
„Ich werde alles dafür tun.“ Ich schob sie weiter.
Gemeinsam betraten wir den Versammlungsraum. Auf den Tischen und in den Wandhalterungen brannten Kerzen. Der ehemalige Vorführsaal des Kinos wirkte festlich wie eine Thronhalle. Räucherwerk tränkte die Luft mit schweren Düften.
Sechs Vampire standen am Ende des Raumes Spalier und flankierten einen roten Läufer mit eingewebten schwarzen Schriftzeichen.
Auf einem Kissen kniete Ann. Sie trug ein bodenlanges Abendkleid.
Curtis hatte sich selbst übertroffen. In den wenigen Minuten, die ich an der Hintertür auf Christina gewartet hatte, war hier alles vorbereitet worden, um Anns Treuegelöbnis einen schönen Rahmen zu verleihen.
Ich dachte kurz an die improvisierte Zeremonie auf einem Parkplatz, wo ich Brandon zu meinem Gefolgsmann gemacht hatte. Wie sehr wäre ihm, gerade ihm, dem Traditionsbewusstesten im Clan der Leonhardt, eine so feierliche Stimmung wie diese gerecht geworden.
„Geh mit Amber“, flüsterte ich Christina ins Ohr.
Curtis stand an Anns Seite und gab mir ein Zeichen. Ich atmete tief durch, dann lenkte ich meine Schritte zu den anderen.
Ann strahlte wie eine zukünftige Braut. Vor drei Monaten hatte ich sie beinahe getötet. Sie war die einzige Überlebende des einstmals größten Clans von Los Angeles, dem Gordon-Clan, und war bei den letzten Kämpfen zu den Leonhardt übergelaufen.
„Die Leonhardt zum Zeugen!“, rief Curtis feierlich und die anwesenden Vampire richteten ihre aufmerksamen Blicke auf uns.
Ann kniete zu meinen Füßen und glättete verlegen ihr tadellos sitzendes Kleid.
Ich lächelte aufmunternd. Beruhigt faltete sie ihre schlanken Hände vor dem Körper.
„Ann Gilfillian, geboren 1932 in New Orleans, gestorben und wiedergeboren 1968 im Blute Daniel Gordons. Du bist ohne einen Meister, ohne einen Clan. Julius Lawhead hat …“
Ich konnte Curtis’ Worten nicht recht folgen. Meine Gedanken wanderten zu Brandon. Mir ging das alles hier nicht schnell genug.
„Julius, jetzt!“, fuhr Curtis’ Stimme mahnend durch meinen Geist.
Ich rief meine Magie herauf und stieß sie mit sanfter Gewalt in Anns Herz. Ihre Erinnerungen gehörten mir. Kindheit, Liebe, Verwandlung – alles. Sie hatte keine Geheimnisse mehr.
Ann leistete ihren Schwur, dann sagte ich meinen Teil auf, wie er seit jeher im Codex geschrieben war. Ein paar Tropfen Blut, ein Kuss auf Puls und Stirn, und Ann Gilfillian war mein.
Seite an Seite schritten wir die Reihen der Zeugen ab und ließen uns gratulieren, dann trieb mich der nahende Sonnenaufgang zur Eile.
Nachdem wir Christina zu ihrem Sarg begleitet hatten, betraten Amber und ich meine Kammer.
Wir küssten uns lange und innig, doch mein Blick huschte immer wieder zum Sarg. Er machte mich nervös.
„Wenn du möchtest, kannst du bei mir im Bett schlafen.“
Ich sah sie überrascht an. „Das würdest du wirklich tun? Neben mir schlafen, während ich für die Welt gestorben bin?“
„Wenn dadurch der Schmerz aus deinen Augen verschwindet, ja.“
„Aber dann bin ich tot“, wandte ich ein. Dennoch sorgte bereits Ambers bloßes Angebot dafür, dass das Spannungsgefühl zwischen meinen Schultern verschwand.
„Ich habe nicht gesagt, dass ich es genießen würde, Julius“, erwiderte sie lachend.
Meine Beine wurden schwer, mir lief die Zeit davon. Ich überwand meine Furcht, taumelte zu meinem Sarg und kroch mit letzter Kraft hinein. Ich wusste, wie sehr Amber den Anblick meines starren Körpers fürchtete, wollte ihr das nicht zumuten.
Doch zu meiner Überraschung streifte sie ihre Schuhe ab und stieg zu mir.
***
Amber
Sobald Julius eingeschlafen war – der Gedanke, dass er jeden Tag starb, widerstrebte mir immer noch zutiefst –, stieg ich aus seinem Sarg und blieb müde daneben sitzen.
Noch konnte ich meinen Blick nicht abwenden. Julius sah furchtbar krank aus. Bleich war er sonst auch, aber nicht so schrecklich mager.
Ich strich ihm die Locken aus dem Gesicht, die nach seinem Bad zu einem wilden Durcheinander getrocknet waren, und zeichnete mit dem Finger die Kontur seiner eingefallenen Wangen nach.
Dann glitt mein Blick durch den Raum. Der Schreibtisch, an dem ich gearbeitet hatte, bis Julius plötzlich zu toben begann, lag umgestürzt auf der Seite.
Das halbfertige Tonmodell war irgendwo unter dem Chaos vergraben, sofern überhaupt noch mehr davon übrig war als ein unförmiger Klumpen.
Ich schluckte meine aufkeimende Enttäuschung hinunter. Da ging sie dahin, meine Chance, eine richtige Restauratorin zu werden. Ich würde weder eine Arbeitsprobe abgeben können, noch am Montag überhaupt in der Werkstatt erscheinen.
Wahrscheinlich würde ich nun nie wieder die Möglichkeit bekommen herauszufinden, ob ich überhaupt gut genug war, um antike Skulpturen zu restaurieren, oder mich mein Leben lang mit Bilderrahmen und Spiegeln würde zufriedengeben müssen.
Ich atmete tief durch. Die Erfüllung eines beruflichen Traums erschien nach den Ereignissen der letzten Stunden unwichtig. Ein Luxus. Ich beschloss, noch schnell das Chaos in der Kammer zu beseitigen, damit ich nicht gleich beim Aufstehen an meine vertane Chance denken musste.
Ich drückte Julius einen flüchtigen Kuss auf den Mund und stand auf. Zuerst stellte ich den Tisch und den Stuhl, der durch den halben Raum gerutscht war, wieder hin. Dann hielt ich inne.
Die Hand mit dem Lorbeer, an der ich gearbeitet hatte, lag in einer Pfütze Blumenwasser auf dem Boden. Überall waren Scherben der zu Bruch gegangenen Vase, eine steckte sogar im Ton.
Aber so hinüber war das Modell gar nicht. Vielleicht war es ja noch zu retten! Meine Müdigkeit war mit einem Schlag wie weggeblasen. Bis zu unserem Aufbruch waren es noch sechs Stunden. Zeit genug, um zumindest ein Modell fertigzustellen.
Hastig verfrachtete ich die Rosen ins Waschbecken, sammelte die Scherben auf und machte mich daran, die zerdrückte Tonskulptur wieder in Form zu biegen. Irgendein gnädiger Gott schien ein wenig Mitleid mit mir gehabt zu haben, denn dank des vergossenen Blumenwassers war der Ton nicht allzu angetrocknet.
Meine Hände arbeiteten wie von allein, fügten hier etwas an, glätteten dort, formten Stängel und Blätter der Ranke neu. Doch auch nach Stunden war und blieb es nur ein einziges Tonmodell.
Würde das reichen, um meinen Chef und den Auftraggeber zu überzeugen, obwohl John doch um mehrere Arbeitsproben gebeten hatte? Einen Versuch war es wert, auch wenn ich die Skulptur noch nicht einmal selbst würde abgeben können.
Als ich glaubte, die Augen gar nicht mehr aufhalten zu können, klingelte mein Handy. Auf dem Display leuchtete eine bekannte Nummer.
Kurz überlegte ich, nicht zu antworten, doch mein schlechtes Gewissen behielt die Oberhand.
„Ma, es tut mir leid“, sagte ich schnell, bevor Charly überhaupt einen Ton herausbrachte.
„Weißt du, wie spät es ist, Amber?“
„Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht.“
„Du wolltest vor einer Stunde hier sein! Wo bleibst du denn?“
„Bei Julius.“
„Du fährst zu deinem Freund? Heute? Ist er dir so viel wichtiger als Frederik, als ich?“
„Ma, bitte.“ Ich atmete tief durch. „Ich schaffe es heute nicht mehr.“
„Du hältst dich nie an unsere Verabredungen!“
„Das stimmt doch gar nicht. Letztes Mal …“
„Wir wollten zum Friedhof. Ich habe extra Blumen gekauft. Du hast es mir versprochen. Du musst ja nicht mit mir essen, aber steig ins Auto und komm her … Bitte!“ Sie begann zu schluchzen.
„Ma, ich muss wirklich arbeiten. Frederik würde das verstehen.“
„Dann morgen früh?“
„Morgen habe ich keine Zeit, tut mir leid.“
„Was kann am Sonntag so Wichtiges sein, dass du deinen Bruder nicht besuchst?“, fragte Ma.
„Ein Freund steckt in Schwierigkeiten, und ich muss ihm helfen. Und hör bitte auf, so zu tun, als sei Freddy noch lebendig. Er ist tot! Er wartet nicht auf uns. Er hat jetzt alle Zeit der Welt.“
Klack. Charly hatte aufgelegt.
Was war ich nur für eine Idiotin. Ich wusste doch genau, wie schlecht Ma mit der Wahrheit zurechtkam.
Ich atmete tief durch und wählte unsere Festnetznummer, dann lauschte ich gebannt auf das Freizeichen. Ein-, zwei-, fünfmal, aber keiner nahm ab.
Leider konnte ich mir nur allzu lebhaft vorstellen, was jetzt passierte. Charly ging zur Anrichte in der Küche, wo sie in der linken Schublade ganz hinten unter den Servietten ihre Tabletten verborgen hatte. Es war eines von vielen Verstecken, die über das ganze Haus verteilt waren. Charly würde eine Pille schlucken, womöglich auch zwei, und versuchen, ihre Trauer in traumlosem Schlaf zu ertränken.
Und diesmal war weder mein untreuer Vater noch Frederik daran schuld, sondern ich. Ganz allein ich!
Es klopfte an der Tür.
Ich schrak hoch und wäre beinahe vom Stuhl gekippt, auf dem ich über den Tisch gebeugt eingeschlafen war. Ein Blick auf die Uhr jagte mir den nächsten Schrecken ein.
Es war schon nach zwölf, viel zu spät!
Erneutes Klopfen.
„Wir wollen den Sarg abholen“, rief Robert. In seiner Stimme klang Eile mit, und ich hatte sofort das mürrische, aber liebenswerte Gesicht von Curtis’ Diener vor Augen.
„Ja, ja, sofort.“
Als ich die Tür aufschloss, warteten Robert und zwei andere Männer davor. Ihnen stand der Schweiß auf der Stirn. Anscheinend hatten sie die anderen beiden Särge bereits verladen und Julius’ als letzten vorgesehen.
Missbilligend trat Robert an mir vorbei und musterte den offen stehenden Sarg und die Metallbolzen, die es Julius eigentlich ermöglichten, diesen von innen so sicher wie einen Tresor zu verschließen.
„Er hat ihn nicht verriegelt? Wozu ist alles Hightech der Welt gut, wenn man es nicht benutzt?“
„Würdest du nach zweieinhalb Monaten Eingesperrtsein freiwillig da drin schlafen wollen?“, gab ich zu bedenken. Nach einem letzten Blick auf Julius’ dunkel schimmernde Augenlider schloss ich den Deckel, und Robert verkniff sich jeden weiteren Kommentar.
Die beiden Männer machten sich daran, die Ecken des Sargs mit Schaumstoffwinkeln abzupolstern, die wohl eigentlich für den Transport von Kunstwerken gedacht waren. Der Sarg, ein Geschenk von Curtis, war mit seinen Intarsien und Malereien allerdings ohnehin ein solches.
Ich überließ den Männern das Feld, während ich Kleidung für Julius und mich selbst in zwei Reisetaschen packte.
Die Träger hatten ihre Vorbereitungen schnell abgeschlossen und waren im Begriff, Gurte in die Griffe einzuhaken. Robert überprüfte ihre Arbeit noch einmal und bedeckte den Sarg dann mit einer schweren roten Brokatdecke. „Seid vorsichtig. Wenn der Macken bekommt, könnt ihr euch von ein paar Fingern verabschieden.“
Die Männer lachten.
„Ab in die Sonne mit dem Blutsauger“, scherzte der Größere, dann hoben die Männer ihre Last an. Unter Fluchen bugsierten sie Julius in seiner Ruhestätte aus der Kammer.
Als ich einige Zeit später mit einer Tasche in jeder Hand und noch nassen Haaren ins Entrée eilte, standen zwei der Särge noch immer dort.
Sonne flutete durch die weit geöffnete Flügeltür, die in den Hinterhof führte, und füllte den Raum mit tanzendem Staub.
Ich blinzelte und schob mir die Sonnenbrille über die Augen.
Die Luft war warm für einen Januartag. Es hatte vor Kurzem geregnet, und so besaß sie noch die besondere Frische, die man in Los Angeles nur an wenigen Tagen im Jahr genießen kann. Ich glaubte, den fernen Duft von Oleander und Eukalyptus wahrzunehmen, und natürlich das Aroma des Meeres, denn der Strand war nah.
Ich nahm den kurzen Weg über den Hof zu dem großen Airstream-Wohnwagen, der silbern glänzend auf seine Fracht wartete, und stieg die Stufen hinauf. Drinnen lud ich die Taschen ab und spähte in den Kühlschrank.
Robert ging an mir vorbei und berührte mich an der Schulter. „Alles okay oder soll ich dir doch lieber einen Fahrer mitgeben? Du siehst müde aus.“
„Ich hab wirklich nicht viel geschlafen. Aber ich schaffe das schon, danke. Es ist nicht das erste Mal, dass ich so ein Ding fahre, und ich werde viele Pausen machen.“
Robert nickte und warf mir einen prüfenden Blick zu. Ich nahm ihm seine Skepsis nicht übel, denn ein Unfall mit einem Wohnwagen voller ruhender Vampire konnte unangenehme Folgen haben. Schließlich zog er eine Ledermappe aus einem kleinen Regal und öffnete sie.
„Hier ist alles drin, was du brauchst“, erklärte er und wies auf eine seltsame Mischung aus ausgedruckter E-Mail und mittelalterlicher Schriftrolle. „Das ist eure Einreisegenehmigung für Arizona und für alle Fälle die Durchreiseerlaubnis für Nevada und Utah. Die Mail ist vom Rat aus Phoenix. Curtis hat sie gesiegelt. Falls du an der Grenze aufgehalten wirst, zeigst du das Dokument vor.“
„Wie läuft das alles?“
„Es gibt eine ständig aktualisierte Liste, in die alle Clanherrn und Meister im Staat Einsicht haben. Für euch wichtig ist die Urkunde. Sie kann notfalls mit der Liste abgeglichen werden.“ Ich nickte, aber Robert war noch nicht fertig. „Sie verlangen eine Friedgeisel für Gastfreundschaft und Jagdrechte. Weißt du, was das heißt?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Es ist wie eine Bürgschaft. Julius übergibt Steven dem Rat von Phoenix. Falls er gegen ein Gesetz verstößt, muss Steven dafür geradestehen.“
„Aber das ist unfair!“
„Glaub mir, Amber, es ist besser so. Auch, weil sich Julius eher geneigt fühlen wird, den Gesetzen treu zu bleiben, wenn er nicht nur seine eigene Sicherheit, sondern auch die eines anderen aufs Spiel setzt. Deshalb hast du hier also auch Stevens Papiere und eine Urkunde, die Julius später unterzeichnen muss, aber er kennt sich damit aus. Ich habe dir das Navi im Dodge schon eingestellt, es wird dich direkt zum Ratssitz in Phoenix leiten. Ihr habt Glück, dass wir heute den ersten Samstag im Monat haben, da tagt der Rat ohnehin. Bei eurer Ankunft werden die drei wach sein. Also halte vorher irgendwo an, wo sie jagen können.“
Ich nickte. „Ich kriege das schon hin. Weiß Steven schon …?
„Curtis wollte es ihm übermitteln.“
In diesem Moment wuchteten die Männer Julius’ Sarg durch die Tür des Wohnwagens und stellten ihn keuchend auf dem Boden ab. „Herrgott, was ist denn da drin, Robert?“, fluchte der Blonde. Der Schweiß lief ihm in Strömen aus dem Haar.
„Spezialanfertigung!“, erwiderte der Diener grinsend.
Ich beobachtete, wie eine Klappe im Boden geöffnet wurde und Julius’ Sarg darin verschwand. Von außen war nichts zu erkennen.
Robert bezahlte die beiden Helfer und verabschiedete sie. Dann drückte er mir ein Tütchen mit verschiedenfarbigen Pillen in die Hand.
„Du hast dein Frühstück vergessen.“
Ich verzog den Mund, suchte mir eine Kombination aus Mineraltabletten und Vitaminen zusammen und schluckte sie hinunter.
„Ich esse eigentlich auch so genug Grünzeug“, murmelte ich, doch genau diese Diskussion hatte ich mit Robert schon oft genug geführt, um zu wissen, dass es unnütz war, erneut damit anzufangen. Er erwartete von allen, die den Vampiren regelmäßig Blut spendeten, dass sie ihre Ernährung künstlich aufbesserten. Schicksalsergeben stopfte ich mir brav die restlichen Pillen in die Hosentasche und sah mich um.
Bei der Vorstellung, den Pick-up mitsamt dem Wohnwagen rückwärts aus dem schmalen Hoftor bugsieren zu müssen, bekam ich dann doch leichte Magenschmerzen.
„Soll ich für dich raussetzen?“, fragte Robert, lächelte und saß im nächsten Moment schon am Steuer des Dodge.
„Du bist ein Schatz“, rief ich gegen den Motorenlärm.
Souverän manövrierte Robert das Gespann durch die enge Lücke. Dann war der Zeitpunkt des Aufbruchs endgültig gekommen.
Robert stieg aus und ließ den Motor laufen. Ich liebte diesen Ton, liebte die großen, schweren SUVs, auch wenn mich manchmal mein Umweltbewusstsein plagte. Langsam begann ich die Aussicht auf eine Fahrt mit dem Dodge zu genießen.
„Es ist Kaffee im Wagen, außerdem Schokolade und Sandwichs“, sagte Robert und wies auf eine kleine rote Kühlbox auf der Beifahrerseite.
Ich umarmte ihn kurz, dann ließ ich mich auf den Fahrersitz gleiten. „Danke für alles. Und du denkst dran, mein Modell bei der Werkstatt abzugeben?“
„Auf jeden Fall, verlass dich auf mich. Viel Glück. Ich hoffe, ihr findet Brandon. Und pass auf, dass Julius’ Temperament nicht mit ihm durchgeht.“
„Ich gebe mir Mühe“, seufzte ich.
„Das meine ich ernst, Amber.“
„Ich auch.“
Robert nickte. Ich schlug die Tür zu und richtete den Sitz auf meine Größe ein.
„Wenn etwas ist, ruf mich einfach an“, rief er mir durch das offene Fenster zu. Ich legte den ersten Gang ein, dann rollte ich vorsichtig die schmale Zufahrt hinunter.
Eine Stunde später kämpfte ich mich noch immer durch das Verkehrschaos von L.A., doch je weiter ich Richtung Pasadena kam, desto besser wurde es. Als endlich das Schild mit den Wegweisern zum Highway 10 auftauchte, hatte ich fast zwei Stunden im Stau verloren. Das Stop-and-go war zermürbend gewesen und hatte meinen Gedanken Raum gegeben, von einer Sorge zur nächsten zu springen.
Ich war überrascht, wie sehr ich um Brandon bangte, der sich bei unseren ersten Begegnungen noch eine Freude daraus gemacht hatte, mir Angst einzujagen. Doch seitdem er Julius den Gefolgschaftseid geleistet hatte, war das anders. Brandon war nicht mehr wiederzuerkennen.
Er war freundlich und still geworden, manchmal konnte er sogar richtig witzig sein. Dennoch wirkte er selbst in Gegenwart seiner Freundin Chris immer ein wenig zu kalt, zu kontrolliert. Es musste an seiner Vergangenheit liegen.
Über Jahrzehnte hinweg war er von seinem Schöpfer Nathaniel Coe gequält worden, das hatte Julius mir erzählt. Aber baute nicht die gesamte Gesellschaft der Unsterblichen auf Gewalt auf? Da verwunderte es doch nicht, dass so mancher über die Stränge schlug.
Die anderen im Clan und auch Julius schienen nicht einen Gedanken daran zu verschwenden, ob es richtig war, Schwächeren seinen Willen aufzuzwingen. Und der Gehorsam, mit dem alle Lebewesen, seien es Menschen oder Vampire, Curtis’ Anweisungen Folge leisteten, ohne seine Entscheidungen auch nur zu hinterfragen, war mir erst recht ein Gräuel. Nicht mal ich selbst konnte mich einem klaren Befehl des alten Vampirs widersetzen.
Als ich Christina ganz zu Anfang einmal gebeten hatte, mir zu zeigen, wie ich mich vor Curtis’ Einmischung schützen konnte, hatte sie erst gelacht und dann einfach nur den Kopf geschüttelt.
Curtis zu entkommen war unmöglich.
***
Brandon
Brandons Seele träumte.
Die Geister der Vergangenheit hatten ihn fest in ihren Klauen, zerrten ihn zurück in eine Zeit, in der die Straßen, die durch das Reservat führten, noch Pfade oder sandige Pisten waren. Brandon war elf Jahre alt und verbrachte die Tage statt in der Schule mit dem Hüten der Schafe.
Es war Abend. Die Tiere blökten in den Pferchen.
Nachdem Brandon auch das alte Pferd versorgt hatte und sich sein Körper nur noch nach einer Schüssel Maisbrei und Schlaf sehnte, ging er zur Hütte hinauf. Wie immer beschlich ihn eine gewisse Unsicherheit. Er konnte nie wissen, ob sein Vater heute einen guten oder einen schlechten Tag hatte.
Es war ein schlechter.
Sobald er die Tür öffnete, traf Brandon ein Faustschlag mitten ins Gesicht und schickte ihn zu Boden.
Ein Schauer kleiner, harter Gegenstände hagelte auf ihn nieder. Münzen.
„Du verdammter Dieb!“, brüllte sein Vater und schwankte gefährlich.
Brandon wusste sofort, was geschehen war. Der Alte hatte sein Geldversteck gefunden. Die paar Cent, die er sich mit der Arbeit im Handelsposten und dem Verkauf von Fellen verdient hatte, um irgendwann genug gespart zu haben, um von daheim wegzugehen. Jetzt war es verloren!
„Ich bin kein Dieb, ich habe nichts gestohlen.“
„Lüg mich nicht an! Ich war heute bei den weißen Halsabschneidern vom Handelsposten. Stell dir vor, was sie gesagt haben. Mein Sohn würde ein guter Jäger werden, und ich könne froh sein, dass du etwas dazuverdienst.“ Er holte tief Luft. „Du stiehlst! Du bestiehlst deinen eigenen Vater! Auf wessen Land hast du die Tiere gejagt?“
„Auf deinem“, antwortete Brandon kleinlaut.
„Dann sind es auch meine Felle, oder nicht?“
Brandon war klar, dass er keine Chance hatte. „Ja, es sind deine.“
„Gibst du es also doch zu! Verschwinde, du Balg. Verschwinde wie die weiße Schlampe, die dich geboren hat! Ich will dich hier nicht mehr sehen!“
„Aber Vater …“
„Verschwinde, habe ich gesagt!“
Brandon starrte ihn ungläubig an. Das konnte er nicht ernst meinen. Er war doch ein guter Sohn gewesen, hatte sich bislang um alles gekümmert, die Tiere versorgt, das Haus in Schuss gehalten und sogar seinen Vater ins Bett gebracht, wenn dieser wieder einmal zu betrunken war, um den Weg dorthin allein zu bewältigen.
Schlagartig wurde ihm bewusst, dass er nur zwei Optionen hatte: für immer so weiterzumachen oder abzuhauen und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, wie Two Feathers es getan hatte. Er würde seinem Pfad folgen! Er würde nach Süden gehen zu den Apachen und die verfluchten Weißen bekämpfen, die seinen Vater zum Säufer und Krüppel gemacht und seinem Volk die Seele geraubt hatten!
„Weißt du was? Ich gehe, ich gehe wirklich, und ich komme nie wieder!“
Brandon bückte sich und begann, das Geld vom Boden aufzulesen.
„Was machst du da?“
„Ich nehme, was mir gehört! Ich habe es selbst verdient. Das Land gehört uns allen, die Tiere waren wild. Die Weißen haben deinen Verstand vergiftet mit ihrem Besitzdenken und dem verdammten Alkohol.“
Wie zur Bestätigung nahm George Flying Crow einen letzten Schluck aus der Schnapsflasche und warf sie seinem Sohn an den Kopf. Brandon, der sich gerade aufrichten wollte, knickte ein und kam nicht mehr rechtzeitig auf die Beine. Tritte und Schläge prasselten auf ihn nieder. Er rollte sich zusammen, schützte den Kopf, so gut er konnte, und harrte aus. Keine Träne, kein Schrei. Sein Vater würde ihn niemals weinen sehen!
Als Brandon wieder zu sich kam, lag der Alte auf der Pritsche und schlief seinen Rausch aus.
Brandon konnte sich vor Schmerzen nur mühsam rühren. Sein linkes Auge war zugeschwollen, und irgendetwas stimmte mit seinen Rippen nicht. Trotzdem stand sein Beschluss fest. Er würde keinen Tag länger bleiben. So leise er konnte, sammelte er die restlichen Münzen ein, die überall verstreut lagen, raffte ein paar Kleidungsstücke zusammen und schlich hinaus.
Sein Weg führte ihn nach Süden. Er lief die halbe Nacht, bis die Schmerzen in seinen Rippen unerträglich wurden und er ermattet am Wegesrand niedersank. Nur ein wenig ausruhen, etwas verschnaufen wollte er, als er mit einem Mal ein Pferd wiehern hörte.
Laternen schwankten in der Dunkelheit, und bald konnte Brandon zwei Kutschen und einen Reiter ausmachen, die in seine Richtung unterwegs waren. Zu schwach, um aufzustehen, hoffte er, einfach übersehen zu werden.
Der erste Wagen rollte an ihm vorbei. Er wurde von einem Schwarzen gelenkt, dessen Anblick Brandon mehr faszinierte als die schönen Pferde und die teure Kutsche. Menschen mit dunkler Hautfarbe hatte er im Reservat nur ein Mal gesehen.
Doch dann hielt ein Reiter neben ihm, und Brandons Aufmerksamkeit war sofort gefesselt. Was für ein vornehmer Mann! Sein Pferd war von der Farbe fetter Milch, und die Augen des Tieres waren genauso blau wie die seines Herrn.
Er war ungewöhnlich blass und trug einen blonden, perfekt gestutzten Bart. „Anhalten!“, rief der Fremde. Alle Pferde blieben ruckartig stehen.
Der Vorhang der Kutsche wurde zur Seite geschoben, und eine nicht minder blasse Frau sah hinaus. „Was ist denn los, Nathaniel?“
„Da ist Ersatz für Jason.“
Die Frau musterte Brandon und verzog missbilligend das Gesicht. „Ich weiß nicht, ob der nach meinem Geschmack ist.“
„Die Gier deiner Tochter ist schuld, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Man soll nehmen, was einem das Schicksal vor die Füße wirft.“ Dann wandte er sich an Brandon und strich dabei über seine maßgeschneiderte grüne Weste. „Steh auf!“
In einem Moment glaubte Brandon noch, vor Schmerzen zu keiner Bewegung fähig zu sein, und im nächsten stand er, überrascht, was für ein Zauberer ihm da begegnet war, der seinen Körper einfach so herumkommandieren konnte.
„Wie alt bist du?“
„Fast zwölf Jahre, Herr.“
„Alt genug und lang wie eine Bohnenstange. Du kommst mit mir, als mein Knecht. Hast du das verstanden?“
„Ja, Herr“, sagte Brandon schnell. Er konnte sein Glück kaum fassen. Wenn er für den Mann arbeitete, würde er womöglich bald genug Geld haben, um sich ein eigenes Pferd und ein Gewehr leisten zu können. Dann käme er nicht als Bittsteller, sondern als Krieger zu den Apachen!
Was war er damals ahnungslos gewesen, und ohne Angst.
Er scheute die harte Arbeit nicht, die er im Dienst seines Brotherrn verrichten musste. Er kümmerte sich um die Pferde und die Wagen, trug Gepäck, wusch und putzte. Und auch, wenn er ahnte, dass etwas nicht stimmte mit seinem merkwürdigen Herrn, der tags schlief und nachts von Ort zu Ort zog, verbot er sich doch, allzu genau darüber nachzudenken, so sicher war er, dass er bald schon genug verdient haben würde, um eigener Wege zu gehen.
Heute wusste der Mann, der sich träumend an diese Begebenheit erinnerte, was ein halbes Jahr später geschehen war, als der Fremde sein wahres Gesicht zeigte.
Der Terror, den die Erinnerung auslöste, trieb Brandons Seele zurück in den Körper.
Er erwachte am helllichten Tag, mit dem Geruch von Erde und dem Gestank seiner eigenen Furcht in der Nase.
In dem Gebäude, in dem Coes Camarilla kampierte, war es totenstill. Brandon sehnte sich danach, wieder einzuschlafen, doch den Gefallen tat ihm sein Körper nicht. Unweigerlich drängte sich die nächste Erinnerung auf. Die Nacht, in der seine Existenz endgültig zu dem Martyrium wurde, das er danach jahrzehntelang hatte durchleiden müssen.
Es war eine schwüle Sommernacht gewesen. Seit Sonnenuntergang hatten sie fast nicht gerastet, und die verschwitzten Pferde konnten kaum noch einen Huf vor den anderen setzen.
Nathaniel Coe ließ ausspannen. Dann schickte er seinen weißen Diener Conway und den schwarzen Rod zu seiner Frau, die mit ihrer Tochter in der Kutsche saß.
„Du kommst mit mir!“
Brandon folgte ihm ahnungslos in die Wüste. Coe fluchte noch immer, weil sie nicht wie geplant auf einer Farm haltgemacht hatten. Die Gebäude waren verlassen gewesen, als der kleine Treck sie erreichte. Danach waren sie mit größerer Eile weitergezogen. Brandon verstand nicht, was so falsch daran war, in der Wildnis zu kampieren. Als Brandon und sein Dienstherr ein leeres Bachbett erreichten, an dessen Saum hohe Büsche aufragten, riss ihn Coe plötzlich zurück. Der Schmerz, der dann folgte, vermischte sich mit anderen Erinnerungen zu wahrer Folter. Der Mann hatte Brandon ohne Betäubung in die Kehle gebissen, machte jeden Schluck zur Qual und weidete sich an dem Leid seines Opfers. Als Brandon aufhörte, sich zu wehren, und sich in dem Glauben, sterben zu müssen, in sein Schicksal fügte, stieß Coe ihn von sich.
Blutend fiel Brandon vor ihm in den Sand, doch Coe war noch nicht fertig mit ihm. Er riss ihm die Hose herunter und drückte ihn mühelos mit einer Hand zu Boden, während er sich an ihm verging.
Die Erinnerung an diese erste Vergewaltigung war durch den Blutverlust getrübt, doch es war später noch oft passiert, zahllose Male, und sein Peiniger ging immer gleich vor.
Erst trank er kurz von ihm, dann kam der Missbrauch, und schließlich biss er noch einmal zu, wenn das Blut noch stärker nach Angst und Schmerz schmeckte.
Brandons Geist floh, sobald er die Lust seines Herrn ahnte.
Er lernte, die Tür in seinem Innersten zu schließen, die ihn mit dem Körper verband. All die Widerwärtigkeiten geschahen nicht ihm, sondern nur seinem Leib. Als er noch ein Junge war, träumte er sich fort. Später, als Mann, ersetzten Rachegelüste die alten Kinderträume.
Sobald Coe von ihm abließ, öffnete sich die Tür in Brandons Innerem und sein bedauernswerter Körper gehörte wieder ihm. Oft folgten auf die Vergewaltigung Prügel, denn Coe schämte sich seiner Triebe, die er als widernatürlich erachtete, und gab Brandon die Schuld. Er beschimpfte sein Opfer, schlug und trat zu, bis er sich abreagiert hatte. Dann vergingen einige Tage, manchmal auch Wochen bis zum nächsten Mal.
Brandon hatte versucht wegzulaufen, immer wieder. Aber jedes Mal hatten sie ihn gefunden, und jedes Mal war die Strafe schlimmer ausgefallen.
Und dann verschwammen die Jahre, und er vergaß, wer er war und wo er herkam. Er unterschied nur noch zwischen sehr schlimmen und erträglichen Tagen. Die Zeit kroch dahin und wollte einfach nicht vergehen.
Als er achtundzwanzig Jahre alt war, versuchte er ein letztes Mal zu fliehen. Coe hatte ihn eingefangen und zur Strafe fast totgeschlagen. Brandon erinnerte sich noch genau daran. Er lag in einem Haus auf einem abgetretenen Holzboden, umringt von den wenigen Mitgliedern der Camarilla. Sie starrten ihn an, seinen seltsam verrenkten Leib. Er war dem Tode nah.
Coe wütete. Zerbrach Möbel, wie er zuvor Brandon gebrochen hatte. Dann hatte er seinen Entschluss gefasst.
„Tu es nicht!“, schrie seine Frau. „Lass ihn verrecken.“
Im nächsten Augenblick packte er Brandon an der Kehle und riss ihn empor. Coe zerfetzte seine Schlagader und sog ihm das letzte Leben aus dem Leib.
Am nächsten Abend erwachte Brandon angekettet in einem rohen Lehmkeller.
Jetzt, da er selbst zum Vampir geworden war, hatte Coe sogar noch mehr Macht über ihn. Er ließ ihn hungern, tagelang, manchmal über eine Woche, bis Brandon auch seinen letzten Stolz aufgab und seinen Peiniger anflehte, ihm ein menschliches Opfer zu bringen. Der Preis, seinen Durst zu stillen, war sein Körper.
***
Julius
Als ich wach wurde, stand der Airstream. Amber telefonierte und ging langsam im Wohnwagen auf und ab.
„Tut mir leid wegen heute Morgen, Ma. Ich habe es wirklich nicht so gemeint … Sobald wir wieder zurück sind … ja … ich hab dich lieb.“
Sobald mein Sehvermögen zurückkehrte, stellte ich erleichtert fest, dass sie den Sarg nach oben gefahren und den Deckel geöffnet hatte.
„Guten Abend“, sagte sie müde, legte das Handy auf den Tisch und kniete sich auf den Boden. Sie trug ein halblanges schwarzes Sommerkleid mit aufgedruckten roten Ornamenten, das mir besonders gut gefiel.
Ich rang mir ein Blinzeln ab. „Guten Abend, mein Stern, du siehst wundervoll aus.“
„Lügner! Wenn ich so ausschaue, wie ich mich fühle, bin ich eine Vogelscheuche.“ Sie lächelte dennoch.
Ich ließ meinen Blick über ihren Körper wandern. Der Rock war ein Stück hochgerutscht und entblößte ihre blassen Knie, auf die sich ein paar Sommersprossen verirrt hatten.
„Schöne Grüße von meiner Ma.“
„Danke“, flüsterte ich mein erstes richtiges Wort in die junge Nacht und lächelte sie an. Sie beugte sich zu mir und küsste mich. „Du siehst schon fast wieder aus wie früher.“
Ich betastete meine Arme. Die geschwollenen Adern waren verschwunden und mein Fleisch wieder normal. Ich seufzte erleichtert.
„Laut Navi sind wir eine Dreiviertelstunde vom Ratssitz in Phoenix entfernt und haben noch fast zwei Stunden Zeit bis zur Anhörung“, sagte Amber.
„Wo hast du gehalten?“ Ich setzte mich auf und strich mir die verstrubbelten Haare glatt.
„Eine Tankstelle. Es gibt auch ein Restaurant. Ziemlich viele Menschen, aber wir parken etwas abseits. Ich denke, es ist gut geeignet für … du weißt schon.“
Ja, ich wusste schon. Wir mussten noch jagen, bevor wir mit dem hohen Rat von Phoenix zusammentrafen.
„Ich bin mir sicher, du hast den perfekten Ort gefunden“, antwortete ich und stand auf. Mit ein paar Handgriffen verschwand der Sarg unter dem Parkettboden des Airstream und die Luke war nicht mehr zu erkennen.
Amber zog mich zu sich. Wir hielten uns eine Weile in den Armen.
Ich vergrub mein Gesicht in ihrem duftenden Haar und legte die Lippen auf ihren Puls. Die Ader flatterte aufgeregt unter meiner Berührung, doch Amber wich nicht zurück. Sie vertraute mir. Vorsichtig tastete ich mit den Zähnen ihren Hals hinauf, entlockte ihr ein leises Seufzen und küsste mich den Weg wieder zurück.
Mein Hunger war da, wie er es immer war, doch heute hatte ich keine Mühe, ihn zu kontrollieren. Amber presste mich an sich, als wollte sie in meinen Körper hineinkriechen. Ich schloss die Augen und öffnete die Siegel, bis sich unsere Energien mischten.
„Julius“, flüsterte sie. „Ich habe dich so vermisst.“ Ich grub meine Hand in Ambers Haar und küsste sie. Doch schnell holte mich die Sorge um Brandon wieder ein. Nur deshalb war ich meiner Gefangenschaft im Sarg zwei Wochen eher als geplant entkommen. Jede Minute, die er mit seinem alten Meister zubringen musste, war eine zu viel.
Ich hielt inne, auch wenn ich mich sehr nach Amber gesehnt hatte. „Später …“, vertröstete ich sie geistesabwesend.
Sie seufzte. „Ich mag deine Wolfsaugen trotzdem, und mittlerweile weiß ich sehr wohl, was sie bedeuten.“
Ertappt lächelte ich. Ja, ich hatte mich sehr nach ihr gesehnt. „Wäre Brandon nicht entführt worden …“
„Du brauchst dich nicht zu erklären. Ein Freund von uns ist in Gefahr, retten wir ihn. Danach können wir unser Wiedersehen immer noch feiern.“
Ich nickte. Wenn es doch nur so einfach und schnell gegangen wäre! Mein Bauchgefühl in dieser Sache war mies. Aussprechen wollte ich es dennoch nicht.
„Weg sind sie. Schade“, meinte Amber und strich mir mit dem Zeigefinger über die linke Braue. „Ich verstehe nicht, warum du sie nicht magst.“
„Wenn sie dir gefallen, gefallen sie mir auch.“
Plötzlich bemerkte ich, wie das Leben als kleiner Funke in Stevens Leib zurückkehrte. Christina würde nur Minuten später dran sein.
„Sie werden wach.“
Mein Blick fiel auf eine Mappe aus schwarzem Leder, auf deren Einband Curtis’ Initialen und sein Wappen prangten. Löwe, Speer und Herz, vervollständigt durch drei kleine französische Lilien. Ich griff danach und lehnte mich gegen die kleine Küchenzeile.
„Kannst du bitte die Särge hochfahren und öffnen?“
„Klar.“ Amber klappte zwei Abdeckungen hoch, die zu einer U-förmigen Sitzecke gehörten, und betätigte einen Schalter. Eine Hydraulik beförderte die beiden Särge hinauf.
Achtlos blätterte ich durch die Ein- und Durchreisegenehmigungen, an die jeweils Curtis’ Siegel angehängt war, und überflog die gefaxte Unterschrift eines gewissen Norton Kenley, der anscheinend die rechte Hand des Phoenixer Ratsherrn Dominik Kangra war.
Ich ging zu dem kleinen Sekretär, den Curtis in den Airstream hatte einbauen lassen, und nahm Siegelwachs und Feuerzeug aus einem Fach.
Amber spähte mir interessiert über die Schulter, während ich meinen Ring vom Finger zog, Papiere unterschrieb und mein Siegel neben das von Curtis setzte.
Mein Zeichen konnte nicht mit einem Wappen aufwarten. Es bestand aus den verschlungenen Initialen meines längst verstorbenen Vaters, die zum Glück auch meine eigenen waren, ergänzt durch eine stilisierte Lilie, allerdings keine französische.
„Mein Gott, ihr seid echt so altmodisch!“, stöhnte Amber.
Sie nahm meinen Ring vom Tisch, und ich nutzte die Gelegenheit, um die Urkunden zu lesen, die mir Macht über Stevens Schicksal verliehen. Es lief mir eisig den Rücken hinunter. Bei jedem anderen wäre es mir leichter gefallen als bei meinem inoffiziellen Schützling Steven.
Ich wollte ihm das nicht antun, doch mein Herz kannte klare Prioritäten. Ich hatte bei Ehre und Blut geschworen, Brandon zu schützen. Die Schwüre beraubten mich meiner Entscheidungsfreiheit. So wie Brandon keine andere Wahl hatte, als meinen Befehlen zu folgen, hatte ich keine andere, als ihn zu schützen. Mit einer Unterschrift von mir und einem Anruf von Curtis konnte ich Steven jetzt gegen Brandon austauschen, wenn Nathaniel Coe sich auf diesen Deal einließ. Ich mochte gar nicht an die Konsequenzen denken, sollte es zum Äußersten kommen.
„Ich glaube, da musst du auch noch unterschreiben“, sagte Amber und tippte auf ein weiteres Papier, das ich bislang nicht bemerkt hatte. Ich erkannte das Formular sofort.
„Was? Die in Phoenix wollen eine Friedgeisel?“
„Ja.“ Amber musterte mich ernst. „Und Curtis lässt dir durch Robert ausrichten, ich zitiere: ‚Wenn du Steven brauchst, soll Ann seinen Platz einnehmen‘, was auch immer das bedeutet.“
„Ich weiß schon.“ Missmutig siegelte ich auch die Friedgeisel-Vereinbarung und streifte mir den noch warmen Ring wieder über. Da erwachte Steven mit einem leisen Schrei. Christinas Herz begann nur einen Augenblick später zu schlagen.
Ich sah auf die Uhr. „Wir jagen, und dann müssen wir los, sonst kommen wir doch noch zu spät.“
Amber drehte sich um, zog eine Pfanne aus dem Schrank und stellte sie auf den Herd. „Ich würde ja für euch kochen, aber ihr geht ja wie immer lieber auswärts essen“, sagte sie trocken.
Christina setzte sich in ihrem Sarg auf, und ich war im nächsten Moment bei ihr.
„Brandon?“, fragte sie mit zitternder Stimme. Ich nahm ihre Hände in meine. Ihr Blick war unstet, suchend.
„Wir sind auf dem Weg, ihn zu holen, Christina.“
Ihr Blick blieb an meinem Gesicht hängen, und die Orientierungslosigkeit verschwand.
„Julius? Du bist hier?“, fragte sie verwundert.
„Ja, Christina. Ich wache über dich, ich bin dein Meister.“ Beim letzten Wort wurde ihr Atem schlagartig ruhiger.
Steven war längst auf, öffnete eine der Jalousien und blickte hinaus in die anbrechende Nacht. „Wow, ein Jack in the Box, die haben Spitzen-Pommes.“
„Wieder keine Pommes heute, Steven“, sagte ich.
„Du gönnst mir aber auch gar nichts!“ Er drehte sich um, stemmte seine Hände in die Hüften und lächelte sein jungenhaftes Unschuldslächeln.
Er ahnte nichts.
***
Brandon
Bis auf einen feinen Lichtstreifen, der unter der Metalltür hindurchfiel, war es stockfinster.
Den Rücken gegen die Wand des winzigen Raums gelehnt, starrte Brandon auf die helle Linie. Er konnte noch immer nicht ganz begreifen, was geschehen war, doch die Wirklichkeit ließ sich nicht ausblenden.
Die Prügel hatten ihre Spuren hinterlassen, und dort, wo Knochen gebrochen und Muskeln gerissen waren, hatte auch die Tagesruhe nicht alles heilen können.
Brandon nahm sich vor, nicht aufzugeben und seinen Stolz zu bewahren, solange es ging. Diesmal sollte Coe ihn nicht brechen. Er würde kämpfen. Durch Kraft allein war er dem Clanherrn nicht gewachsen, damit würde er seinen alten Meister nur dazu anstacheln, ihn erneut zusammenzuschlagen. Es musste eine andere Lösung geben. Er musste Coe dazu bringen, ihn mit anderen Augen zu betrachten. Doch wie? Während Brandon wie ein Besessener nach einer Idee forschte, schlich sich immer wieder das Gestern in seinen Kopf. Dann schrumpften die vergangenen Jahrzehnte zusammen, als sei die Zeit ohne seinen brutalen Schöpfer nur ein Traum gewesen.
Der Eid, den er Curtis geleistet hatte, war nichtig, der Schwur Julius gegenüber eine Lüge.
All die Jahre, in denen er sich frei gefühlt hatte, war Coes Schatten ihm gefolgt. Jeden Tag hatte er ihn mit Erinnerungen geplagt, bis Brandon beschlossen hatte, ein anderer zu werden, nicht länger das Opfer zu bleiben, das er unter Coes Knechtschaft gewesen war.
Entschlossen verscheuchte Brandon den Geist seines alten Ichs. Das war nicht mehr er, würde er nie wieder sein. Er war gewachsen und nicht gebrochen! Entschlossen ballte er die Fäuste. Er war besser als Coes schwarzer Vampirsklave Darren! Besser als die kriecherischen Weißen, die Coe um sich einte! Und er würde es ihm beweisen! Wenn das verdammte Schicksal beschlossen hatte, grausame Spiele mit ihm zu spielen, dann würde er eben mitspielen, aber mit erhobenem Kopf und mit einer Figur in der Farbe seiner Wahl. Der neue Brandon, jener Mann, der er in Los Angeles geworden war, war seine Trumpfkarte.
Er war zur Schule gegangen, hatte studiert, zwei Abschlüsse gemacht und die Sprache seiner Ahnen wiedererlernt, die er seit seiner Kindheit nicht benutzt hatte. Curtis hatte regelmäßiges Kampftraining für wichtig erachtet, und Brandon war dem Aufruf mit Freude gefolgt. Er war der Krieger geworden, der er als Kind immer hatte sein wollen, und er war gut. Coe würde das nicht ignorieren können.
Dennoch, die Angst war geblieben, und Brandon hasste sich für diese Schwäche. Sie befiel seinen Körper, entlud sich in einem kurzen, heftigen Zittern und setzte sich in seinen verkrampften Schultern fest, bis er die Zähne zusammenbiss und sie gänzlich niederrang.
Mit der verstreichenden Zeit kamen andere Gedanken.
Christina. Er wünschte, er hätte noch einmal mit ihr sprechen können, um sich zu verabschieden und ihr zu sagen, wie sehr er sie liebte und wie viel er ihr verdankte. Sie war der Schatz, den Coe ihm niemals würde nehmen können.
Und Julius, sein Meister, der ihn Freund nannte. Beide Bindungen ruhten noch immer in Brandons Brust, doch sie waren so unerreichbar, als ob sie hinter verbarrikadierten Türen lägen.
Der Turmalin fraß alles. Brandon berührte die Kette an seinem Hals. Daran hingen der schwarze Stein und ein Schloss. Unverrückbar. Es gefiel Coe, ihn auch damit zu quälen, mit der Sehnsucht nach seinem Meister und den Leonhardt, die in ihm brennen würde, bis ein neuer Eid sie tilgte. Doch in Coes Welt hatten nur Weiße ein Anrecht auf den Eid, und sicher hatte sich seine Einstellung dazu nicht geändert. Coe würde versuchen, ihn so weit einzuschüchtern, bis Brandon ihm die Treue schwor, ohne dafür im Gegenzug ein Schutzversprechen zu erhalten.
Rechtlich bewegte er sich damit in einer Grauzone, denn ohne Schwur schützte der Codex Brandon nicht. Dass Coe auf diese Weise auch keinen Machtzuwachs errang, fiel für den Meister wohl weniger ins Gewicht. Wahrscheinlich hatte er in Page so viele weitere Vampire in seinem Clan vereint, dass die beiden Sklaven, die er sich mit Brandon und Darren hielt, keinen großen Unterschied gemacht hätten.
Brandon horchte auf.
Im Nebenraum erklangen Geräusche. Zwei Personen liefen die Treppe herunter, und offensichtlich stritten sie.
„Nathaniel, warte bitte“, forderte eine Frauenstimme. „Ich will nicht noch jemanden in unserer Camarilla. Nur du und ich, hast du versprochen. Reicht dir der Schwarze nicht für deine …“
„Judith! Pass auf, was du sagst.“
„Ich bin deine Frau, Nathaniel, verbiete mir nicht den Mund.“
„Und ich bin dein Schöpfer“, entgegnete er kalt, „das solltest du nicht vergessen.“
Brandon hörte die Vampirin aufschluchzen, dann eine Weile nichts. Coe schien sie zu trösten, etwas, was er diesem Monstrum nicht zugetraut hätte. Was Brandon da belauschte, weckte Hoffnung. Vielleicht konnte ihm diese Frau irgendwie helfen. Sie wollte ihn nicht in der Camarilla haben. Womöglich würde es ihr gelingen, Coe zu überzeugen, ihn wieder gehen zu lassen. Oder ihn notfalls einem anderen Meister innerhalb des Clans zu überlassen.
Schritte näherten sich.
Alles wäre besser, als Coe direkt unterstellt zu sein.
Brandon erhob sich hastig und klopfte die letzten Erdreste von seiner Kleidung. Sobald sich der Schlüssel im Schloss drehte, schwand sein Mut.
Die Tür schwang auf, und er sank mit geneigtem Kopf in die Knie. Er versuchte, so ruhig zu bleiben, als begrüße er Julius oder Curtis auf traditionelle Weise. Doch die hätten ihn sofort mit einer freundlichen Geste gebeten aufzustehen.
„Guten Abend, Meister.“
Nathaniel Coe starrte überrascht zu ihm hinab. Brandon erwiderte den Blick vorsichtig und musterte die zierliche blonde Frau an Coes Seite.
„Was soll das sein? Hast du in L.A. etwa Manieren gelernt, Rothaut?“, spottete Coe kalt. „Glaub nicht, dass dir das hilft.“
Brandon nahm all seinen Mut zusammen. „Ich bin ein anderer geworden, Meister. Ich habe gelernt, studiert, ich …“
Coes Blick wurde eisig. Er betrachtete den vor ihm knienden Mann wie einen Hund, der überraschend einen Zirkustrick gezeigt hatte. Seine Rechte schnellte vor, fasste die grobe Kette, die um Brandons Hals hing, und drehte sie zusammen. Er keuchte, doch er blieb aufrecht und erwiderte stur Coes Blick.
„Das Einzige, was dich über deinesgleichen hinaushebt, ist das, was in deinen Adern fließt. Mein Blut!“ Coe brüllte die letzten Worte, während er die Kette mit dem Turmalin noch enger drehte.
Brandon zwang sich zur Ruhe. Der Schmerz war heftig, aber als Vampir musste er nicht atmen. Langsam hob er seinem Schöpfer die Arme entgegen und drehte die Handgelenke nach oben.
Coe sollte sein verdammtes Blut haben, aber nicht seine Würde, nie wieder seine Würde!
***
Julius
Wir steuerten auf einen kleinen Park zu, den man neben dem Fast-Food-Restaurant angelegt hatte. Menschen liefen daran vorbei, und es war einfach, sie von dort ins Gebüsch zu locken.
Christina krümmte sich in meinem Arm und fluchte leise.
„Scht, scht, ist ja gleich vorbei.“ Beruhigend drückte ich sie noch enger an mich, dann schob ich sie Steven in den Arm. „Gib acht auf Chris!“
Ich machte mich auf die Suche, und Minuten später kehrte ich in Begleitung eines braun gebrannten Truckers zurück, der bereits unter meinem Bann stand und mir mit einem entrückten Lächeln im Gesicht folgte.
Christina wartete auf meine Erlaubnis, dann biss sie zu.
Steven beobachtete sie beim Trinken und seufzte neidisch.
„Du kannst gehen. Ich brauche dich hier nicht mehr.“
Er war im nächsten Moment verschwunden.
Christina trank eine Viertelstunde, dann ließ sie von ihrem Opfer ab, und ich lobte ihre Disziplin. Wir platzierten den Mann auf einer Sitzbank, ehe ich ihn aus dem Bann weckte. Christina kehrte allein zum Airstream zurück, während ich mich selbst auf die Suche nach einer Mahlzeit machte.
Sobald auch ich fertig war, überbrückte ich das kurze Stück zum Wohnwagen im Laufschritt. Schon von draußen konnte ich Christina weinen hören.
Chris kauerte auf einer Bank und schluchzte heftig. Steven und Amber hatten sie in ihre Mitte genommen und versuchten, sie zu beruhigen, aber sie war jenseits von Worten und zitterte am ganzen Leib.
Steven sah mich ratlos an, während er Christina in kreisenden Bewegungen über den Rücken strich. Amber reichte ihr ein neues Taschentuch und sammelte die alten ein, um sie wegzuwerfen.
„Ich glaube, ihr lasst uns besser allein“, sagte ich und erntete dafür dankbare Blicke. „Wir müssen sowieso aufbrechen.“
Steven war sofort auf den Beinen und auf dem Weg zur Tür. Amber drückte noch einmal Christinas Hand und gab mir im Vorbeigehen einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
Sobald die beiden vorne im Dodge verschwunden waren und wir uns schaukelnd in Bewegung gesetzt hatten, nahm ich neben Christina auf der Bank Platz. Sie schlang ihre Arme um meine Mitte und legte ihren Kopf an meine Brust. Andächtig lauschte sie meinem Herzschlag.
„Ich kann ihn nicht hören, ich kann ihn nicht hören“, wimmerte sie leise. „Ist er tot, Julius?“
„Nein, Brandon lebt. Coe benutzt einen Turmalin, damit er keinen Kontakt aufnehmen kann.“
„Wir holen ihn?“
„Ja, das machen wir“, versicherte ich und versuchte, überzeugend zu klingen.
„Hoffentlich tut er ihm nicht weh.“
Ich musterte Christina. Wie viel wusste sie von der Hölle, die er bei seinem Schöpfer durchlebt hatte? Von dem Missbrauch hatte er ihr nichts erzählt, aber was war mit all den anderen Grausamkeiten?
„Als dieser Coe auftauchte, habe ich Brandon nicht mehr wiedererkannt“, berichtete sie mit brüchiger Stimme. „Er hatte so schreckliche Angst, Julius, es war furchtbar, und er hat mich fortgeschickt. Ich sollte einfach gehen.“
„Er wollte dich schützen. Brandon hatte keine andere Wahl. Coe ist sein Schöpfer. Seine Eide zählen stärker als die meinen.“
„Wirst du Brandon bestrafen, wenn wir ihn finden?“, fragte sie unsicher.
Was für ein absurder Gedanke. Ich schüttelte den Kopf. „Nein, natürlich nicht.“
„Versprochen?“
„Ja, bei meinem Ehrenwort.“
Ich ließ einige Minuten verstreichen, bevor ich Christina mit meinem Wunsch konfrontierte. „Bevor wir den Rat erreichen, musst du deine Erinnerung mit mir teilen.“
Als ich ihren Kopf sanft zu mir drehte, wehrte sie sich kurz, dann tauchte ich durch ihre verweinten Augen ins Gestern.
Christina lag wie tot in meinen Armen.
Ich schauderte. Ich hatte alles gesehen, alles. Wie Brandon versuchte, Christina zu schützen, wie Coe ihn erst mit seiner Magie angriff und dann zusammenschlug.
Brandons Versuch, sich mit einem Sturz in die Tiefe umzubringen, hatte seine Freundin scheinbar nicht einmal bewusst bemerkt. In mir weckte es eine neue Angst. Würden wir rechtzeitig da sein?
Hätte ich Brandon nur nicht gedrängt, die Reise anzutreten! Dann hätte Coe womöglich niemals herausgefunden, wo er war und dass es ihn noch gab.
Curtis hatte für mich Nachforschungen anstellen lassen.
Fünfzig Jahre, etwas mehr sogar, waren vergangen, seitdem Coe und sein damaliger Clan durch einen Vampirjäger angegriffen wurden, der ein Feuer an ihrem Schlafplatz legte. Es hatte alle Vampire vernichtet, die in Särgen ruhten.
Brandon und ein schwarzer Unsterblicher namens Rod überstanden den Anschlag, weil sie auf Coes Geheiß in der Erde schlafen mussten. Der Meister selbst konnte schwer verletzt entkommen – was bis vor einigen Jahren sein wohlgehütetes Geheimnis geblieben war. Als einziger Überlebender und mit schweren Verbrennungen war er nicht mehr mächtig genug für ein eigenes Revier. Also hatte er im Verborgenen gelebt, abgewartet, bis die Zeit seine Wunden heilte, und sich einen neuen Clan aufgebaut. Ein Vampir seines Alters schloss sich nicht einfach einem anderen Meister an.
Brandon und Rod waren in verschiedene Himmelsrichtungen geflohen, um sich endlich ein eigenes Leben aufzubauen. Ohne einen Eid, wie er im Codex stand, konnten sie nicht fühlen, dass Coe noch lebte. Als Coe endlich wieder stark genug war, unterwarf er den kleinen Clan, der sich in seinem ehemaligen Territorium angesiedelt hatte, mühelos und gewann so noch weiter an Macht. In den Annalen von Arizona war das nicht mehr als eine Randnotiz, nichts, was über die Staatsgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt hätte. Und so hatten weder Curtis noch Brandon oder ich etwas von der Wiederauferstehung des Nathaniel Coe erfahren.
Coe musste geglaubt haben, dass Brandon tot war, bis sein Name vor wenigen Tagen in der Liste der Durchreisenden auftauchte. Von da an brauchte Coe nur noch auf ihn zu warten.
Welch eine unglückliche Verkettung der Ereignisse.
Ich atmete tief durch.
Wir steckten mitten im Feierabendverkehr von Phoenix. Lichter fielen durch die Fenster und tauchten das Innere des Airstreams in wechselnde Farben.
Bald würde ich mit dem Rat der Stadt zusammentreffen, und ich wusste immer noch nicht genau, was ich sagen sollte, sagen musste, um Brandon zu befreien und Coe zu verurteilen.
Vorsichtig schob ich Christina aus meinen Armen und stand auf.
Wir sprachen kein Wort, während ich mich umzog, um dem Rat in angemessener Weise entgegentreten zu können. Ein schwarzer moderner Gehrock über einem weißen Hemd mit Manschetten, dazu zwei lange Silberklingen. Eine an jedem Unterarm. Als Meister hatte ich das Recht, bewaffnet zu erscheinen. Wenngleich kaum jemand von dieser Befugnis Gebrauch machte, ich würde es tun.
Während der Airstream durch die Innenstadt von Phoenix schaukelte, las ich noch einmal die Unterlagen durch.
Meine Nerven lagen blank. Ich hatte Curtis bislang nur in Gerichtssachen vertreten, deren Ausgang sicher war. Jetzt würde ich als Kläger in eigener Sache vor einem Rat fremder Unsterblicher sprechen müssen. Nervös drehte ich den Siegelring an meiner rechten Hand, bis mir die Bewegung selbst auf die Nerven ging.
„Darf ich mitkommen?“, fragte Christina. Sie saß noch immer wie ein Häufchen Elend auf der Bank und blickte mich mit großen, leeren Augen an.
„Ja, natürlich, Chris. Du gehörst zu mir.“
Sie nickte langsam und stand auf. „Dann sollte ich mich wohl in einen passablen Zustand bringen.“
„Das wird schon.“
„Du bist ein schlechter Lügner, Julius. Aber danke für den Versuch.“
***
Amber
Ich war erleichtert, das Gespann nicht durch den dichten Verkehr steuern zu müssen.
Steven schien äußerlich ganz ruhig, wenngleich ich an der Art, wie er das Lenkrad packte, merkte, dass er mit der Gesamtsituation alles andere als zufrieden war.
„Hey Steven, du hast noch gar nichts gesagt.“
„Muss ich denn?“, entgegnete er, ohne den Blick von der Straße zu wenden.
„Nein, natürlich nicht.“
Er fuhr sich durchs Haar und seufzte. „Ach, weißt du, mir ist nicht nach Reden. Ich fühl mich nicht wohl als Pfandobjekt.“
„Ich bin sicher, dir passiert nichts“, antwortete ich schnell, zu schnell, dann musterte ich ihn. „Tut mir ehrlich leid, Steven. Wenn ich nur könnte, ich würde eure verdammten Gesetze verbieten. Es ist doch bescheuert, jemanden für einen anderen geradestehen zu lassen.“
Meine heftige Reaktion entlockte ihm ein Lächeln. „Amber, die kleine Rebellin. Ich wünschte, du könntest es, ich wünschte es wirklich.“
Wir schwiegen eine Weile und beobachteten den immer dichter werdenden Verkehr. Die Straßen waren völlig verstopft.
„Weißt du, es ist nur …“ Steven rang nach Worten. Mit seiner Ruhe war es vorbei. Er errötete. „Eigentlich wollte ich mich morgen wieder mit Arturo treffen.“
„Oh, wann ist das denn passiert? Erst schwärmst du mir wochenlang von deinem unerreichbaren Traumprinzen vor, dann kommt nichts mehr, und jetzt trefft ihr euch wieder?“
Steven grinste verlegen. „Wir sind seit letzter Woche zusammen.“
„Das ist ja wunderbar! Und wann stellst du ihn mir vor?“
„Wahrscheinlich gar nicht, weil ich ihn jetzt versetzen muss. Was soll ich ihm denn sagen? Dass ich untot bin und als Prügelknabe nach Phoenix geschickt werde?“
„Steven! Dir wird doch wohl irgendwas einfallen. Für so unkreativ halte ich dich nicht.“
„Wenn du wüsstest.“ Er sah mich an, grinste verschmitzt und wurde dann wieder ernst. „Dir ist es nicht egal, was mit mir passiert, nicht wahr?“
„Nein, natürlich nicht! Verlass dich drauf, ich werde nicht zulassen, dass Julius irgendwas Unrechtes tut.“ Ich lächelte aufmunternd. „Keine Sorge, du wirst dein Date mit Arturo mit den schönen Augen schon noch bekommen. Nur eben etwas später.“
Steven seufzte erleichtert. „Ich bin echt froh, dass Julius dich gebunden hat.“
Ich richtete den Blick aus dem Fenster, um ihn nicht sehen zu lassen, was für eine Angst ich um ihn hatte.
***
Brandon
Jemand bewegte sich. Da war Berührung, das Geräusch von reißendem Stoff. Die Besinnungslosigkeit wich und machte Schwäche und Schmerz Platz. Brandon öffnete die Augen und hatte das Gesicht des schwarzen Vampirs vor sich, den er bereits am Tag zuvor kennengelernt hatte.
Der Mann wickelte Stoffstreifen um Brandons Arme und knotete sie fest.
Brandon bleckte abwehrend die Zähne.
„Du bist schwach. Du wirst zu viel Blut verlieren, wenn ich die Wunden nicht abbinde.“
„Danke“, krächzte Brandon. Jetzt erinnerte er sich wieder. Coe hatte ihn gebissen, und auch dessen Frau Judith hatte von ihm getrunken.
Mit seinem Blut waren seine Kraft und seine Magie davongeflossen, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass er nun offensichtlich nicht einmal mehr in der Lage war, die kleinsten Wunden zu heilen.
Er setzte sich auf.
„Du bist angekettet“, warnte der andere nüchtern.
Brandons Rechte tastete zum Hals, dann ließ er sie entmutigt sinken.
Zum ersten Mal sah er sich in seinem neuen Quartier um. Es war ein Kellerraum mit einem winzigen Fenster. Der Boden war aus Erde und völlig zerwühlt. Offenbar hatte Coe seine Methoden über die Jahre nicht geändert. Schon früher hatte es nur für die weißen Mitglieder des Clans Särge gegeben, die anderen mussten sich eingraben wie die Tiere.
In der Mitte des Raums stand ein roh gezimmerter Tisch, auf dem eine einzelne Kerze flackerte. In deren Licht setzte sich nun Brandons Leidensgenosse, ein hagerer Schwarzer in schmutziger Leinenkleidung, dessen Blick Bände sprach.
Um seinen Hals war ein schwerer Eisenring gebogen, den er erfolglos mit einem Tuch zu kaschieren versuchte. Er war nicht angebunden, doch in Coes Reich waren Ketten niemals weit.
„Ich bin Darren“, sagte er schließlich. „Die Herrschaften sind jagen. Wir sind allein.“
Das weckte Brandons Lebensgeister. Wackelig kam er auf die Beine, lief den Raum ab, prüfte die Tür. Seine Kette bestimmte den Radius und zerrte ihn immer wieder zurück.
Darren blieb sitzen und beobachtete ihn. „Du kommst hier nicht raus, vergiss es.“
Brandon sank neben der Tür in die Knie. Im Staub lag alles, was er bei sich gehabt hatte. Der Brustschmuck aus Knochenröhrchen, den er zu Ehren seiner Vorväter angelegt hatte, war zerrissen, seine Ringe und Armreife verbogen und die Türkise fort.
„Ich sollte die Sachen kaputtmachen, es tut mir leid.“
Brandon starrte ihn nur schweigend an.
Wenig später hörten sie, wie die Haustür aufgeschlossen wurde. Schritte näherten sich zielstrebig. Coe.
Brandon erhob sich, um seinen neuen, alten Herrn erneut förmlich zu begrüßen, Darren hingegen rutschte tiefer in einen Winkel hinein und duckte sich.
Als sich die Tür öffnete, verbeugte sich Brandon elegant und neigte den Kopf.
Coe musterte ihn von oben bis unten und schnaubte abfällig.
„Das Getue wird dir schon noch vergehen. Darren, heiz die Esse an!“
Der Angesprochene sprang auf und rannte hinaus.
Die Erkenntnis, was Coes Worte bedeuteten, traf Brandon wie ein Schlag.
„Nein!“
Coe grinste hämisch. „Hast du geglaubt, du könntest ein paar Bücklinge machen und dann wie meinesgleichen leben? Am Ende noch meiner Frau befehlen, weil sie jünger ist?“ Er blieb nah vor Brandon stehen und brüllte ihm ins Gesicht. „Hast du das geglaubt, du untreues Vieh?“
Coes Faustschlag traf Brandons Kehle und der Indianer fiel der Länge nach hin, kam aber sofort wieder hoch. „Meister! Ich bin einhundert Jahre alt. Sprecht mit Curtis Leonhardt, er wird Euch sagen können …“
Der nächste Hieb zielte auf seine Schläfe. Coe lachte, während sich Brandon erneut aufrappelte und sich aufrecht vor ihn kniete. Blut lief von seiner Stirn. „Der Eid, Meister, nehmt ihn mir ab!“
„Nein, sicher nicht.“
„Bitte.“
„Oh, ich glaube, mir gefällt, was sie in L.A. mit dir angestellt haben. Es wird mir eine Freude sein, dir den Kopf wieder zurechtzurücken.“
Coe löste die Kette, während Brandon mit wachsender Verzweiflung versuchte, Haltung zu bewahren. Die paar Schläge waren nichts gegen das, was ihm in wenigen Minuten bevorstand, wenn es ihm nicht gelang, den Meister davon zu überzeugen, ihn als Vampir und nicht als unsterblichen Sklaven zu sehen. Coe musste ihm den Treueeid abnehmen, wie er im Codex stand, nur dessen Magie konnte Brandon schützen.
„Den Eid, Meister!“
„Niemals!“ Coe riss an der Kette. „Halt den Mund und komm!“
Die Panik fühlte sich genauso an wie vor all den Jahrzehnten.
***
Julius
Der Wohnwagen schaukelte um eine Kurve, wurde langsamer und steuerte auf eine Villa zu, die sich inmitten eines Gartens mit riesigen Kakteen und Palmen erhob.
Wie dichter Morgennebel kroch Magie über den Boden und tastete nach mir.
Die Clanherren hatten unsere Ankunft bemerkt und streckten ihre Fühler aus. Es waren sieben Ordensmeister anwesend, und allein die Ahnung ihrer Macht ließ mich ehrfürchtig den Atem anhalten.
Der Parkplatz stand voller Fahrzeuge. Die Fenster der Villa waren hell erleuchtet. Ich war offensichtlich nicht der Einzige, der heute Abend um ein Urteil ersuchte.
Während uns ein Wächter in eine Parklücke einwies, entdeckte ich eine Gruppe Unsterblicher, die eine Gefangene die Stufen zum Eingang hinaufzerrten. Eine zweite Gruppe folgte und schien sich mit der ersten ein heftiges Wortgefecht zu liefern.
Kaum hatten wir gehalten, betraten auch schon Amber und Steven den Wohnwagen.
„Kann nicht Christina hier in Phoenix bleiben?“, maulte Steven, während er seine Reisetasche aus dem Schrank zog.
„Schluss jetzt!“ Der Zorn in meiner Stimme ließ ihn zusammenzucken. So kannte er mich nicht. Er wich mit eingezogenem Kopf zurück und schlug die Augen nieder.
„So sind die Dinge nun einmal“, beschwichtigte ich. „Weißt du, wie oft ich Friedgeisel sein musste?“
Steven schüttelte den Kopf, mied aber meinen Blick.
„Verdammt oft, und es waren nicht unbedingt schlechte Erfahrungen. Nutze die Zeit, um Kontakte zu knüpfen. Ich bin sicher nicht der einzige Meister, der gerade durch Arizona reist. Es werden noch andere junge Vampire da sein.“
Rasch schloss ich den Sekretär auf und legte die Urkunde über Stevens Friedgeiselstatus in eine gesonderte Mappe, die ich ihm in die Hand drückte.
„Okay, bereit?“
Alle nickten.
Wir verließen den Airstream.
In der Zwischenzeit waren weitere Vampire eingetroffen, und die Luft schwirrte vor Magie. Wir folgten dem beleuchteten Weg, der vom Parkplatz zum Haus führte, und warteten, bis ein junger Mann auf uns zukam.
„Guten Abend“, sagte er freundlich. „Darf ich Ihren Namen erfahren?“
„Julius Lawhead.“
Er ging zu einem kleinen Pult und bedeutete uns zu folgen. „Meister Lawhead, Clan Leonhardt, aus Los Angeles?“, fragte er nach und ich nickte.
Er hakte etwas auf einer Liste ab.
„Das Anliegen?“
„Reise und Jagderlaubnis sowie eine Gerichtssache.“
„Gut. Folgen Sie mir bitte, Ihr Fall ist der dritte heute Abend. Ein Treuebruch wird bereits verhandelt, ein Mordfall folgt, danach sind Sie dran.“
Wir liefen einen Gang entlang. Auf beiden Seiten hingen italienische Landschaftsbilder über antiken Tischchen und Bänken. Ich reckte den Hals. Vor uns lag ein Saal, dessen Flügeltür weit geöffnet stand.
Leise traten wir hinein.
In dem Raum warteten fast vierzig Personen, und die wenigsten davon waren Menschen. Auf einem Podest stand ein langer schwerer Tisch, hinter dem der hohe Rat von Phoenix saß, vier Männer und drei Frauen. Äußerlich waren sie zwischen dreißig und Mitte fünfzig, doch die Wahrheit rauschte als kalter Sturm über meine Haut.
Die Meisterin, die heute Abend den Vorsitz führte, war niemand anderes als Vivien Le Roux, und sie war weit älter als Curtis, etwas über neun Jahrhunderte. Ich kannte sie aus Paris. Sie hatte damals das Urteil gefällt, in dessen Folge ich ein halbes Jahr im Sarg verbrachte. Bei meiner Freilassung hatte ich rasend vor Hunger meine Geliebte Marie ermordet.
Amber drückte meinen Arm und blickte fragend zu mir auf. „Julius, was ist?“
Ich schüttelte den Kopf. Ich konnte es ihr jetzt nicht erklären.
Gerade warf sich ein junger Meister vor ihr zu Boden, der sein Clanoberhaupt betrogen hatte. Vivien Le Roux drehte sich nach ihren Beratern um und erhob sich dann.
„Für deine Ehrlosigkeit wird dir dein Meisterstatus aberkannt, und dein Herr wird von dir trinken, bis du der Niedrigste der Seinen bist. So wirst du zwanzig Jahre lang dienen. Nach Ablauf dieser Frist musst du wieder vor diesem Rat erscheinen, und dein Fall wird erneut geprüft.“
Es gab Zurufe aus dem Publikum, doch ich sah nur den Verurteilten. Er hatte Geringeres verbrochen als ich, und ich stand bereits wieder hier, nach weniger als drei Monaten. Langsam wurde mir klar, wie dankbar ich Curtis für die vergleichsweise milde Strafe sein konnte.
Stille breitete sich im Saal aus. Durch eine Seitentür wurde die Gefangene hereingeführt, die mir schon im Hof aufgefallen war. Ihre Kleidung hing in Fetzen an ihrem Körper. Sie hatte lange nicht mehr getrunken, und ihre Furcht und ihr Hunger peitschten durch den hohen Raum. Neugierig reckten die Zuschauer die Gesichter in den schwachen Luftzug.
Die Gefangene trug Handschellen und eine Kette um den Hals, an der sie unbarmherzig vorwärtsgezerrt wurde. Die beiden Gerichtsdiener, die sie hereingebracht hatten, befestigten die Kette an einem Haken im Boden. Sie war etwas zu kurz und zwang die Gefangene in eine demütigende Haltung.
Die Vampirin verrenkte den Kopf, um die Richter anblicken zu können.
„Eliza Laszra!“, wurde ihr Name ausgerufen. Mehrere Vampire fauchten, manche spuckten die Gefangene an. Kein Zweifel, das war der Mordfall. Der Hass, der von den Vampiren ausging, hing schwer in der Luft.
Ambers Puls raste, ich konnte ihr Herz klopfen hören.
„Was auch geschieht, wir können nichts daran ändern“, flüsterte ich ihr durch die Siegel zu. Meine Dienerin kniff den Mund zu einem dünnen Strich und nickte gequält.
Die Verhandlung begann. Ein Vampir, der für den Rat arbeitete, erklärte die Sachlage. „Die Beklagte Eliza Laszra ist geständig, den Mord an ihrem langjährigen Geliebten Thomas Marix begangen zu haben. Der Meister der Mörderin beantragt, die Todesstrafe aufzuheben und stattdessen Blutgeld zu zahlen.“
Die verfeindeten Parteien standen zu beiden Seiten der Frau. Es war klar, dass sich diese Clans seit langer Zeit feindlich gesinnt waren.
Der Meister der Mörderin trat vor und verneigte sich vor dem Rat. „Verehrte Ratsvorsitzende. Eliza Laszra ist ein geschätztes Mitglied meiner Camarilla. Ich möchte sie nicht verlieren. Bitte überlassen Sie es mir, über sie zu richten. Ich bin vermögend und willens, Blutgeld in angemessener Höhe zu zahlen.“ Er trat zurück und nickte der Verurteilten hoffnungsvoll zu.
„Eure Stellungnahme, Bernard Locker“, wandte sich Vivien Le Roux dem Meister des Ermordeten zu. „Seid Ihr bereit, ein Blutgeld zu akzeptieren, dessen Höhe vom Rat festgesetzt wird?“
Der Vampir trat vor und funkelte die andere Partei wütend an. „Niemals“, zischte er. „Eher friert die Hölle zu.“
Alle um uns herum jubelten. Die Verurteilte aber schwankte und ging in die Knie.
„Ruhe!“, schrie die oberste Richterin. Ihr Blick war eisig. „Eliza Laszra, ich verurteile dich zum Tod durch den Pflock. Die Hinrichtung findet ohne Verzug statt.“
Niemand wagte etwas zu sagen, nur die Verurteilte weinte leise.
Ich drückte Ambers Hand und hoffte inständig, dass sie die Nerven behielt.
Wieder öffnete sich die Seitentür, und zwei Gerichtsdiener schoben eine Art Bahre hinein, eine Henkersbank. Das Gerät war aus Holz und mit festen Lederriemen und Ketten versehen.
Sie würden Eliza Laszra darauf festschnallen. Ich kannte die Prozedur nur zu genau. In Los Angeles war ich derjenige, der den Verurteilen das Herz durchbohrte.
Dann erschien eine blonde Schönheit in schlichter schwarzer Kleidung in der Seitentür. Ihre Art, sich von den Gefühlen anderer abzuschirmen, und nicht zuletzt der Koffer in ihrer Hand verrieten, wen ich vor mir hatte: Claudine Galow, die Jägerin des Rates von Phoenix. Sie grüßte die Vorsitzenden mit einem schnellen Kopfnicken und schenkte den Zuschauern keine Beachtung. Dann reichte sie den Koffer einem Gerichtsdiener und wandte sich ohne Umschweife ihrer Aufgabe zu.
Mit ruhigen Bewegungen löste sie Eliza Laszra von der Kette, hob die Verurteilte hoch und legte sie auf ihr letztes Bett.
So ruhig, wie die Todgeweihte blieb, vermutete ich, dass die Jägerin Magie anwendete. Und richtig, während die Gerichtsdiener Riemen um Riemen festschnürten, starrte Eliza unverwandt in die Augen der Henkerin.
Ich war erleichtert: Anscheinend ließ das Gericht Betäubung zu, und die Jägerin behandelte die Verurteilte sanft. Ich hatte Hinrichtungen erlebt und auch selbst durchführen müssen, die als grausames Exempel gedacht waren.
Die Erinnerungen verfolgten mich bis heute.
„Das dürfen sie nicht tun!“, sagte Amber energisch.
Ich fasste sie an den Schultern, drehte sie zu mir und barg ihr Gesicht in meinen Händen. Sie presste wütend die Zähne aufeinander.
„Wir sind hier, um Brandon zu retten, vergiss das nicht!“, ermahnte ich sie.
„Julius, ich kann das nicht einfach so mitansehen!“
„Aber das musst du, ich brauche dich hier!“ Ich nutzte Ambers Zorn als Zugang und war im nächsten Augenblick in ihrem Geist. Sie wusste, was ich vorhatte, das konnte ich spüren. Dennoch wehrte sie sich nicht. Gegen ihren Widerstand hätte ich sie durch die drei Siegel, die uns verbanden, nur unter größten Schwierigkeiten beeinflussen können. Doch sie empfing meine Magie wie ein erlösendes Geschenk. Sobald sie unter meinem Bann stand, wurde sie still. Mir fiel ein Stein vom Herzen.
Es wurde unruhig im Saal. Plötzlich schrie jemand. Es gab einen lauten Knall, und im nächsten Moment raste eine Energiewelle über uns hinweg. Junge Vampire drängten ängstlich zum Ausgang, andere kauerten sich auf den Boden, dann wurde mir klar, was geschehen war.
Die Henkersbank mit der Mörderin war umgestürzt, die Jägerin lag reglos daneben, und der Meister der Todgeweihten kämpfte einen aussichtslosen Kampf gegen zwei Ratsmitglieder. Der Richter Hermann Roth stieg von der Empore und ging auf den Meister zu. Er lächelte glatt wie eine Schlange. Ich meinte, Magie zu spüren. Sobald er den Mann erreicht hatte, rang er ihn kraft seines Blickes nieder. Etwas geschah. Ich verstand nicht was, aber der Unterlegene begann, sich zu winden, als würde ihn etwas angreifen, das seinem eigenen Inneren entsprang.
Als Roth schließlich von ihm abließ, war das Gesicht des Mannes tränenüberströmt. Widerstandslos ließ er sich abführen.
Nach und nach kehrte Ruhe ein. Man sah nach der Jägerin, trug sie davon und stellte die Bank wieder auf. Die Ratsmitglieder, die den verzweifelten Meister gebändigt hatten, kehrten auf ihre Plätze zurück.
„Die Hinrichtung muss verschoben werden“, verkündete Vivien Le Roux. Sie machte keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung.
Ich straffte meine Schultern und wollte Amber gerade aus dem Bann befreien, als ein anderer Ratsherr das Wort ergriff. Es war Dominik Kangra, grauhaarig, mit gepflegtem Bart und maskulinen Zügen.
„Die Hinrichtung kann sehr wohl stattfinden!“, sagte er mit tiefer Stimme, und mir schwante Übles, als er seinen Blick suchend durch den Saal wandern ließ. „Der Zufall will es, dass heute Abend ein zweiter Jäger bei uns ist. Meister Julius Lawhead aus Los Angeles, Kalifornien.“
„Scheiße“, fluchte ich leise und hätte mich am liebsten in irgendeinem dunklen Winkel verkrochen, aber dafür war es jetzt zu spät.
„Mr Lawhead? Treten Sie bitte vor den Richtertisch.“
Ich schob Amber in Stevens Arme. „Tu, was du kannst“, beschwor ich ihn, „sie darf es auf keinen Fall mitansehen.“
Steven nickte nervös. „Ich geb mir Mühe.“
Die anderen Vampire starrten mich an, während ich mit erhobenem Kopf an ihnen vorbeiging.
Der hohe Richtertisch reichte mir bis zur Brust. Ich musste den Kopf in den Nacken legen, um den sieben Meistern ins Gesicht blicken zu können.
Der alte Vampir Dominik Kangra nickte mir freundlich zu, während mich die anderen Unsterblichen weiterhin furchtsam anstarrten wie einen Löwen inmitten einer Schafherde.
„Hoher Rat.“ Ich verbeugte mich vor den Ältesten und schaute in erwartungsvolle Gesichter.
„Julius Lawhead, Sie besitzen die Privilegien unseres allseits geschätzten Fürsten Andrassy aus Los Angeles. Wie lange üben Sie Ihr Amt als Jäger aus?“, fragte Kangra. Ich wusste, dass er und Curtis einander in Freundschaft verbunden waren. Wahrscheinlich hatte mein Meister direkt mit ihm gesprochen, als er meine Reise vorbereitete.
„Im April werden es vierundfünfzig Jahre, Herr“, beantwortete ich seine Frage.
„Würden Sie die Güte haben, uns auszuhelfen?“
„Wie Sie wünschen.“ Ich hatte keine andere Wahl.
„Dann bitte.“ Er wies auf die Verurteilte. Sie konnte ihren Kopf kaum rühren und rollte verzweifelt mit den Augen, um einen Blick auf mich zu erhaschen.
Wie stets vermied ich es, die Verurteilte anzusehen. Ein Gerichtsdiener half mir aus meinem Gehrock und brachte mir den Koffer der Jägerin. Dutzende Augenpaare ruhten auf mir, während ich die Manschettenknöpfe löste und die Ärmel höherschob.
Ich hoffte, Eliza Laszra würde uns beiden die Prozedur so leicht wie möglich machen. Bislang war sie ruhig geblieben, doch als ich den Koffer öffnete, begann sie leise um Gnade zu flehen. Die Sache konnte unangenehm werden. „Ist Gnadenerweis vorgesehen? Wenn ja, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich bin so weit.“
Viviens Gesicht blieb kalt. „Kein Gnadenerweis!“
Nichts anderes hatte ich erwartet. Nur selten wurden die Verurteilten vor der tatsächlichen Hinrichtung betäubt. Die kleine Manipulation, die Claudine Galow zuvor durchgeführt hatte, lag im Ermessen des Jägers und sorgte für einen reibungslosen Ablauf.
Ich bückte mich nach Pflock und Hammer und spähte zu Steven und Amber hinüber. Er starrte sie an wie eine Schlange, die krampfhaft versucht, eine Maus zu hypnotisieren. Noch hielt der Bann, die Frage war, wie lange noch? Eile war geboten.
Ich trat an die Bahre.
Die Todgeweihte hatte kastanienbraunes Haar und ein exotisches Gesicht mit vor Angst geweiteten grünen Augen. „Bitte, bitte, bitte“, wiederholte sie immer lauter und verzweifelter.
„Es ist gleich vorbei, du wirst nicht leiden“, versprach ich mit ruhiger Stimme.
Ihre weiße Bluse war über dem Herzen zerrissen, und ihr Brustkorb hob und senkte sich verzweifelt gegen die Fesseln. Sobald ich meine Hände hob, fing sie an zu schreien.
Jetzt war der Pflock in ihrem Blickfeld. Sie kämpfte gegen die Fesseln, doch die Gerichtsdiener hatten saubere Arbeit geleistet. Ihr Oberkörper rührte sich nicht. Aus dem Augenwinkel nahm ich allerdings eine Bewegung von Amber wahr. Nicht gut!
Blitzschnell setzte ich mit der Linken den Pflock an. Eliza Laszra schrie aus Leibeskräften. Ich drückte das Holz ins Fleisch und trieb es dann mit zwei schnellen Schlägen durch das Herz der Mörderin und tiefer, bis der Pflock die darunterliegende Bahre berührte. Die Schreie brachen abrupt ab. Eliza Laszra war nicht mehr.
Ein Diener nahm mir das blutige Werkzeug ab und reichte mir im Tausch ein feuchtes Handtuch. Ich rieb mir die Blutspritzer von Händen und Armen und drehte mich nach Amber um. Sie war wach, doch anscheinend erfasste sie nicht ganz, was gerade geschehen war.
Im gleichen Augenblick wurde die Leiche auf der Bahre durch die Seitentür hinausgeschoben und war endlich fort.
„Schnell und präzise, vielen Dank, Mr Lawhead“, sagte Kangra.
„Es war meine Pflicht“, antwortete ich nüchtern, schob eilig meine Hemdsärmel herunter und ließ mir die Jacke reichen. „Wie geht es Ihrer Jägerin?“
Dominik Kangras Blick verklärte sich einen Moment, als er nach ihrem Bewusstsein tastete, dann entspannte er sich. „Sie ist geschwächt, aber spätestens in einigen Tagen wieder vollkommen wohlauf.“
„Das freut mich“, antwortete ich höflich.
Es war schon seit einer Weile unruhig im Saal.
Jetzt, da die Hauptattraktion des Abends, die Hinrichtung, vorbei war, verschwanden die meisten Vampire, und auch vier der sieben Richter verließen ihre Plätze.
Ich fühlte mich ein wenig leer, wie immer, wenn ich meiner Aufgabe als Henker nachgekommen war. Meine Schuldgefühle hatte ich schon lange abgelegt.
„Julius Lawhead, das bist wirklich du, oder? Leonhardts kleiner Liebling.“
Ich hob den Kopf und blickte direkt in die gefährlich blauen Augen von Richterin Vivien Le Roux. Also erinnerte sie sich doch!
„Wir sind uns schon einmal begegnet, das ist richtig. 1868 in Paris.“
„Tritt näher!“
Ich kam ihrem Befehl nach, und sie versuchte, mich zu lesen, doch ich wehrte sie ab. Sie hatte kein Recht dazu, und hier in der Gegenwart anderer Ratsmitglieder konnte sie mich auch nicht zwingen. Vivien Le Roux bleckte entrüstet die Zähne.
Kangra legte eine Hand auf ihre. „Du bist zu neugierig, meine Liebe.“
Sie schnaubte verächtlich und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf mich. „Du hast dich gemacht seit damals.“
„Vielen Dank!“, erwiderte ich betont höflich.
Nachdem ich ihr den Blick in meine Gedanken verwehrt hatte, begnügte sie sich damit, zu lesen, was meine Magie preisgab. „Ich sehe eine Dienerin, die noch nicht die volle Zahl der Siegel trägt, und zwei, nein, drei Unsterbliche von deinem Blut. Die Zeichen sind unklar, Julius. Wie viele nennst du nun dein Eigen, zwei oder drei?“, fragte sie lauernd.
Wortlos rief ich die anderen zu mir. Amber blieb an meiner Seite stehen. Christina versteckte sich beinahe hinter mir, so sehr fürchtete sie die Alten. Ich fasste sie am Arm und hieß sie vortreten.
„Christina Reyes, die erste aus meinem Blut Geborene“, stellte ich sie vor. „Ann Gilfillian reist nicht mit uns, doch auch sie zähle ich zu den Meinen. Sie stammt aus Daniel Gordons Haus und hat mir geschworen. “
„Es geht um den dritten“, unterbrach mich die Meisterin. „Um den Indianer, der vor wenigen Tagen hier war. Er hat die Neue damals nicht mit hereingebracht. Beide erhielten eine Reiseerlaubnis. Was ist geschehen?“
Ich erzählte von Brandons Verhältnis zu seinem alten Meister, wie er ihn verlor und von ihm gefunden wurde. „Ich will ihn wiederhaben“, schloss ich.
Vivien Le Roux lachte. Sie lachte, und ich hasste sie dafür.
„Was ist so komisch? Willst du uns nicht einweihen, Vivien?“, fragte Kangra. „Wie mir scheint, verbindet dich einiges mit diesem jungen Meister.“
Die Richterin wurde augenblicklich still. „Julius Lawhead und mich verbindet nichts, außer einem kleinen Déjà-vu. Damals, vor vielen Jahren in Paris, kam Meister Leonhardt mit diesem jungen Bengel zu mir. Er hatte ihn wieder eingefangen, nachdem er aus seinem Haus davongelaufen war. Mr Lawhead hier hinterging seinen Meister, weil er sich verliebt hatte. An Leonhardts Stelle hätte ich ihn töten lassen, doch er wollte seinen Liebling behalten. Da stehst du also nach all den Jahren wieder vor mir, Lawhead, um einen Treuebruch anzuklagen, ausgerechnet du. Gib zu, die Situation entbehrt nicht einer gewissen Komik, oder?“
„Ich will keinen Treuebruch anklagen. Brandon Flying Crow hat sich keines Vergehens schuldig gemacht. Mir geht es um Nathaniel Coe.“
„Der Meister war lange verschollen“, warf das dritte Ratsmitglied Hermann Roth ein. Der Mann hatte kurze dunkelblonde Haare und schwammige Züge, die ihm etwas Gutmütiges verliehen. Doch sein Raubtierblick strafte den ersten Eindruck Lügen, und nachdem ich gesehen hatte, wie er mit dem aufsässigen Clanherrn umgegangen war, nahm ich mich vor ihm in Acht.
„Es ist sechs Jahre her, dass er den Ort Page und das Gebiet um den Lake Powell als sein angestammtes Revier zurückgefordert hat. Bis zu jenem Tag hat niemand gewusst, dass er den Anschlag des Vampirjägers überlebt hat.“
„Ich möchte einen Hinrichtungsbefehl gegen Coe erwirken“, sagte ich.
„Aus welchem Grund, Lawhead?“, fragte die Vorsitzende neugierig.
„Coe hat Menschen getötet.“
„Das hast du, das habe ich, das haben wir alle, Lawhead, alle, die wir vor der Reformation geschaffen wurden. Aber wann ist es geschehen, und wie willst du es beweisen?“
„Ich weiß nicht genau, wie lange es her ist“, gab ich zu. „Mindestens fünfzig Jahre, vielleicht sechzig. Ich weiß es aus Brandons Erinn…“
„Lawhead, hör auf!“, fuhr mich die Richterin an. „Das sind doch keine Beweise!“
„So gerne, wie ich Ihnen den Befehl ausstellen würde“, meldete sich Dominik Kangra zu Wort, „die Beweise reichen tatsächlich nicht aus. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich Coe gerne für immer von dieser Erde getilgt sehen würde, doch dafür brauchen wir eindeutiges Belastungsmaterial.“
„Ich verstehe“, antwortete ich und blickte betreten zu Boden.
„Wir werden Coe über Ihr Kommen unterrichten, doch er wird sich nicht mit wenig Geld zufriedengeben.“
Ich sah Kangra an, der mich gutmütig musterte. „Brandon Flying Crow war meinem Meister lange ein loyaler Gefolgsmann.“
„Dann wird es wohl kein Problem sein, die Summe aufzubringen, die Leonhardt sind ein wohlhabender Clan. Senden Sie Curtis meine Grüße, wenn Sie zurückkehren.“
„Gerne“, erwiderte ich und wurde ruhiger. Wenn sich Kangra so sicher war, dass Coe positiv auf den Vorschlag einer Auslösung reagieren würde, dann standen unsere Chancen wohl besser als erwartet. Ich war bereit, mein gesamtes Vermögen zu opfern.
Vivien Le Roux lehnte sich in ihrem Sitz vor und schaute zu mir hinab. „Ich hoffe, es vergehen nicht erneut einhundertfünfzig Jahre, bis wir uns wiedersehen, Lawhead.“
„Nein, sicher nicht.“ Ich wich ihrem gefährlichen Blick aus.
Steven trat unsicher von einem Bein auf das andere. Ich nickte ihm auffordernd zu, und er tat langsam einen Schritt nach vorne.
„Steven Brenton wird für meine Ehre zeugen.“
„Ich werde mich des jungen Mannes annehmen, es soll ihm an nichts fehlen“, meinte Kangra, und mir fiel ein Stein vom Herzen. „Doch sagen Sie, Mr Lawhead, was verlangen Sie für Ihre Dienste?“
Mein Blick huschte zu Amber. Sie schien völlig ahnungslos.
„Nichts, ich habe dem ehrenwerten Rat von Phoenix gerne gedient.“
„Dann ist ja alles geklärt“, verkündete Vivien kalt. „Wenden wir uns dem nächsten Fall zu. Die Nächte dauern nicht ewig, auch wenn wir uns das wünschen.“
Steven nahm Abschied von uns und trug gemeinsam mit einem Helfer seinen Sarg zu seinem Heim auf Zeit. Ich verließ den Wohnwagen und entdeckte Amber, die sich gegen dessen silbrige Außenhülle lehnte.
Den Kopf weit im Nacken, starrte sie in den Himmel, dessen eine Hälfte sternübersät war. Die andere trug eine ähnlich scheußliche Farbe zur Schau wie der Smoghimmel über L.A.
Gemeinsam beobachteten wir, wie Steven in der Villa verschwand.
Amber seufzte. „Hoffentlich dauert es nicht lange. Wusstest du, dass er sich verliebt hat?“, fragte sie.
„Nein. Ein Mensch?“
„Ja. Ich denke, es hat ihn richtig schlimm erwischt.“
„Das erklärt seine schlechte Laune. Wir müssen jetzt los“, sagte ich und streifte ihre Hand mit den Fingerspitzen.
„Was ist da drinnen passiert, Julius? Mir fehlt ein Stück meiner Erinnerung.“
„Ich denke, du weißt es, sonst hättest du es nicht mit dir geschehen lassen.“
Amber drehte sich zu mir um. „Du hast mich gebannt, richtig? Damit ich nicht mitkriege, wie das Todesurteil vollstreckt wird.“
„Ja“, gab ich zu. So ähnlich. „Ich weiß doch, wie du darüber denkst. Du hättest dich am liebsten mit dem ganzen Rat angelegt.“
„Nicht für eine wildfremde Mörderin. Ein bisschen Verstand habe ich schon noch beisammen. Aber ich … ich bin froh, dass ich es nicht miterleben musste, danke.“
Amber fasste meine Hand, und gemeinsam kehrten wir in den Wohnwagen zurück.
Christina hatte alles aufgeräumt und saß nun ganz allein wartend am kleinen Esstisch. Der Anblick gab mir einen Stich ins Herz. Ein wichtiger Teil von ihr schien zu fehlen. Christina ohne Brandon, das war, als betrachte man ein Gemälde, das in der Mitte durchgerissen war.
„Lasst uns aufbrechen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Fährst du vorne bei uns mit, Chris?“
Eine halbe Stunde später hatten wir die Tristesse von Phoenix hinter uns gelassen und fuhren auf der Interstate 17 Richtung Flagstaff, mitten durch die Wüste, immer weiter nach Norden.
Als die letzten Lichter hinter uns verblassten, klingelte mein Smartphone. Amber fand es im Handschuhfach und ging dran. Nachdem sie einen Moment zugehört hatte, wurde sie plötzlich ganz hektisch.
„Es ist einer von den Richtern“, flüsterte sie. „Dominik irgendwas.“
Ich riss ihr das Telefon aus der Hand. „Meister Kangra, ich höre!“
„Mr Lawhead? Ich habe gerade mit Nathaniel Coe gesprochen und ihn über Ihr Kommen unterrichtet. Er ist bereit, Sie zu empfangen und sich anzuhören, was Sie anzubieten haben.“
Mir schlug das Herz bis zum Hals. „Wo? Wann?“
„Er ist zurzeit auf Reservatsland unterwegs. Er schlägt Cameron vor, morgen Nacht um eins in der … warten Sie … ich habe es mir notiert … in einem Hotel, Trading Post.“
„Cameron, Trading Post, um eins“, wiederholte ich ungläubig.
Amber lächelte und reckte beide Daumen hoch.
„Ich wünsche Ihnen viel Erfolg“, sagte Kangra nach einer kurzen Pause.
„Danke.“
Er hatte bereits aufgelegt.
Christina war aus ihrer Apathie erwacht und beugte sich neugierig vor. „Hat er tatsächlich mit Coe gesprochen?“
Ich war mir sicher, dass sie alles mitangehört hatte, trotzdem nickte ich. „Ja, er wird uns morgen Nacht treffen.“
„Und wir sollen in ein Hotel kommen?“, hakte Amber nach. „Das ist doch gut, oder? Da sind viele Menschen, das heißt, er will wirklich verhandeln.“
Ich betete inständig, dass sie mit ihrer Vermutung richtiglag. Für mein Empfinden lief die Sache zu glatt. Es fühlte sich an, als liefen wir geradewegs in eine Falle.