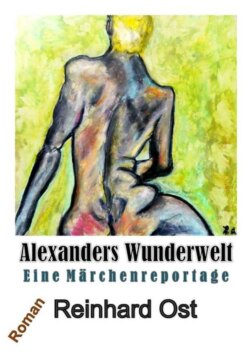Читать книгу Alexanders Wunderwelt - Reinhard Ost - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Geburt und Kindheit
Оглавление
Das hat man nun davon, wenn man sich mit Literatur, Musik oder Malerei einlässt. Man ist nicht mehr Herr seiner selbst. Wahrnehmungen, Gedanken, Ideen und Phantasien machen sich selbstständig und fortwährend an dem fest, was es bereits schon in ästhetisch ansprechender Form gibt. Das Leben scheint wie verdoppelt und bildhaft vorgezeichnet zu sein.
Der Schriftsteller Alexander Kappel macht sich auf den morgendlichen Weg zu seinem Schreibtisch. Es ist die Strecke von der Küche über den langen Flur bis ins Arbeitszimmer, wo seine vielen Bücherregale stehen. Das Arbeitszimmer ist verqualmt, wie immer eigentlich. Fenster zu öffnen und zu lüften nutzt nicht mehr viel, weil der süßliche Geruchsgeschmack schon in alle Bücher und Manuskripte eingezogen ist. Selbst die leichte Gardine flattert nicht mehr im Wind. Er kann einfach nicht auf das Rauchen verzichten. Das würde seine Konzentrationsfähigkeit vermindern, sagt er. Hoffnung allerdings besteht. Immerhin hat der Maler Emil Nolde am Ende seines Lebens gesagt, er habe es über 2000 Mal geschafft, „endlich“ mit dem Rauchen aufzuhören.
Alexander ist immer wie derjenige, den er sich gerade ausmalt, den er bearbeitet, den er verwandelt. Er ist sozusagen alle in einer Person. Im Augenblick ist er Emil Nolde aus Schleswig-Holstein, der im Jahr 1867 geboren und im Jahr 1956 verstorben ist, einer der führenden Maler und Aquarellisten des deutschen Expressionismus. Wie man allerdings einen Roman als Aquarell schreiben könnte, weiß er noch nicht genau. So etwas Kompliziertes ergibt sich für ihn immer erst ganz von allein, wenn er es ausprobiert und herumexperimentiert. Gestern war er der Philosoph Arthur Schopenhauer, vorgestern Cornelia Funke, und heute ist er eben Emil Nolde. So geht das fortwährend, Tag für Tag, rückwärtsgewandt, in die Vergangenheit zurück, weil er natürlich auch diejenigen Künstler ausprobiert, die schon lange verstorben sind. Alles was geschrieben und komponiert wird, ist für ihn Vor- und Nachzeichnung. Sein Ich ist vielfältig und buntfarbig, eben nicht nur an eine einzelne Person gebunden oder gar nur an ihn selbst. Oft fragt er sich, ob er möglicherweise zu häufig den Sender Arte im Deutschen Fernsehen einschaltet, die Folgen von „1000 Meisterwerke” zum Beispiel. Und immer sucht er dann die Meisterschaft auch bei sich selbst. Er scheitert natürlich unaufhörlich. Das produktive Scheitern ist gewissermaßen schon sein Lebensmotto geworden. Darin fühlt er sich inzwischen wohl, wie in einer warmen Badewanne, in der das Wasser über den Rand läuft, weil unterhalb der Wannenkante kein vernünftiges Überlaufventil existiert.
Er wohnt schon eine ganze Weile mit Erika Schmitz zusammen. Erika hat ihren kleinen Sohn Wolf mit in die Beziehungsgemeinschaft gebracht. Und dieser Wolf ist inzwischen sein „Ein und Alles“ geworden. Mit ihm versteht er sich fabelhaft. Vor allem versteht Wolf umgekehrt auch ihn sehr gut. Wolfs Aufmerksamkeit und seine Phantasie sind einzigartig. Sieben Jahre alt ist er. Alles, was Alexander ihm erzählt, kann der Junge in eine neue Wundergeschichte verwandeln und allem eine besondere Wendung geben. Das hilft ihm bei seiner Schriftstellerarbeit in hohem Maße. Manchmal schreibt er sich Wolfs Erzählungen wortwörtlich auf und versucht sie hinterher literarisch zu verarbeiten, ein Roman als direkte Nacherzählung gewissermaßen. Wolf ist sein Medium, nicht ein andere oder gar x-beliebige Person, sondern im Grunde auch er selbst.
Haben Kinder mehr Phantasie als Erwachsene? Warum haben Kinder so viel mehr Phantasie als Erwachsene? Sie haben doch viel weniger erlebt, fragt er sich. Sie besitzen doch wesentlich weniger Anhaltspunkte, an denen ihre Gedanken- und Gefühlswelt anknüpfen kann. Alexander ist zum Resultat gekommen, dass Kinder sich im Regelfall sehr viel mehr zutrauen als Erwachsene, weil sie noch nicht so stark domestiziert sind und noch jenen Mut besitzen, den ein erwachsener Mensch längst verloren zu haben glaubt.
Er seinerseits möchte eigentlich immer kindlich bleiben, hofft er, denn sonst könnte er niemals ein guter Schriftsteller sein, der etwas Vernünftiges über die Geheimnisse der Kindheit zu schreiben vermag. So banal es klingt, die ständige Entwicklung und Verwandlung sind seine feste Überzeugung. Deswegen kann er sich, tagtäglich immer wieder neu, in einen anderen Menschen hineinversetzen. Jeden Tag möglichst nur einer oder maximal zwei, so plant er, was ihm aber nicht gelingt.
Alexander ist darüber hinaus auch deshalb wie ein Kind geblieben, weil er fest daran glaubt, seine Kindheit, seine Jugendjahre, seine Bildungs- und Ausbildungszeit und vor allem die ersten zwei Jahre im Job gut überstanden zu haben, als er noch Lektor in einem großen Belletristik-Verlag war. Erst als man dort glaubte, man würde keine Lektoren mehr, sondern nur noch Entscheider, benötigen, reifte der Entschluss, seine eigenen „Geschäfte“ machen zu wollen. Das Eigene, so nennt er seinen derzeitigen Zustand, in welchem die Anderen und das Andere in ihn hineingespeist werden. Er kann selbst bestimmen, wie viel er davon benötigt, verdaut und wieder ausscheidet. Das ist sein Ich-Gefühl. Sein Leben ist diesbezüglich eine streng körperliche Angelegenheit, insbesondere sein Verdauungsprozess und auch seine Sexualität. Sein Verdauen ist das Vertrauen in die Naturgegebenheit und Richtigkeit der Aufbewahrung der Dinge in seinem Körper und in seinem Kopf, welche Partnerin oder welcher Partner ihm zum Beispiel gefällt und welches Buch er gerade liest, was man vergessen kann. Was allerdings die Sexualität im Allgemeinen für ein merkwürdiges Phänomen ist, hat er im Grunde noch nie richtig verstanden. Nur dass sie sich körperlich stark bemerkbar machen und sich furchtbar in den Vordergrund schieben kann, das weiß er genau.
Die Dinge, die Wolf ihm erzählt, woher der Junge sie auch immer herhaben mag, von den Gebrüdern Grimm vielleicht, von Hans Christian Andersen, von Wilhelm Busch oder aus Fantasy-Filmen, alle ist auch schon Teil seines Ichs geworden, kleine Bausteine, die er niemals freiwillig wieder herausrücken würde. Erst, wenn er alles verdaut und sozusagen preisgegeben hat, wird er zufrieden sein können. Gestalten aus vielen Märchen und Sagen sind in ihm drin, ein Teil seines Ichs. Speziell mit Rübezahl hat er keine Probleme. Das ist er selbst. Mit dem kann er Nützliches verbinden. Er ist Rübezahl, weil er die Königstochter Erika eines Tages heiraten und sie dann endgültig in sein unterirdisches Reich entführen wird. Mit Hilfe von Rüben kann er sie schon jetzt in jede gewünschte Gestalt verwandeln und zum Beispiel die Sehnsucht nach einem gemütlichen Zuhause stillen. Wie ein Berggeist macht er sich tagtäglich an die Arbeit, damit die Anzahl der Rüben stimmt. Er zählt mindestens zwei Mal. Und jedes Mal kommt ein anderes Ergebnis heraus. Macht nichts. Immer wieder versucht Erika, seine freiwillige „Gefangene“, in seiner eigenen Imagination wie ein Zuckerrübenpferd zu entfliehen. Manchmal verspottet sie ihn sogar, wenn sie ihn mit seinem Märchennamen Rübezahl anredet. Er wird nicht zornig, nein, auch wenn er Märchennamen als Spottnamen überhaupt nicht mag. Als Rübezahl ist er schließlich nur ein geschwänzter Dämon, der aus dem Riesengebirge stammt, wobei die Schneekoppe auch eine botanische Rarität aus der Apotheke sein kann. So ist er der Geist des Widersprüchlichen, der in einem Moment gerecht und hilfsbereit, im nächsten allerdings auch arglistig und launenhaft sein kann. Alexander Rübezahl ist eben launisch, ungestüm, sonderbar, roh, unbescheiden, stolz, eitel, schalkhaft, bieder, störrisch, wankelmütig. Der wärmste Freund und ein eiskalter Bengel kann er sein. Wenn nicht im alltäglichen Leben, so dann doch wenigstens in seinen Romanen. Wolf hat einmal gesagt, dass er ihn als Mönch mit grauer Kutte am allerbesten findet, wenn er unerwartet Blitze und Donner abschießt und danach großzügig die armen Leute beschenkt. Aber, dass er aus Äpfeln oder gar Laub Gold machen könne, wird leider das Wunder in einem Märchenbuch bleiben müssen. Allerdings, umgekehrt betrachtet, geht es schon ganz gut. Alexander kann Geld auf unspektakuläre Weise in eine wertlose Währung verwandeln. Er kann es vor Wolfs Augen demonstrativ in den Papierkorb werfen. Er weiß allerdings, dass Wolf das Geld dann hinter seinem Rücken wieder herausrausholt, wenn er auf die Toilette muss. Eine Stunde später ist durch Wolf das Geld dann wieder rückrückverwandelt.
Für Alexander Kappel gibt es einen ganz bestimmten Autor, den er über alle Maßen bewusst missverstehen will. Warum das so ist, wird er vielleicht noch genauer herausbekommen. Bruno Bettelheim heißt der Wissenschaftler. Er hat ein weithin berühmtes Buch geschrieben, welches „Kinder brauchen Märchen“ heißt. Das Buch ist für ihn das spektakuläre Anti-Antimärchenbuch. Es stört ihn wahnsinnig, wenn der bekannteste Märchenerzähler Oberösterreichs, Helmut Wittmann, in den Oberösterreichischen Nachrichten schreibt, dass Bruno Bettelheims Klassiker bis heute nichts von seiner Aktualität verloren habe. Bis 1973 lehrte Bettelheim übrigens als Professor in Chicago, wo denn auch sonst.
Weil Märchen grausam und Instrumente bürgerlicher Repression seien, müsse man sie aus der Kindererziehung verbannen, erklärten noch vor wenigen Jahrzehnten die ganz fortschrittlichen deutschen Pädagogen, zum Beispiel während der Heidelberger Märchentage im Jahr 1972. Die entgegengesetzte Ansicht vertritt nun der amerikanische Psychoanalytiker Bettelheim. Um Therapieerfolge bei seelisch schwer gestörten Kindern zu erzielen, würden Märchen sehr gut weiterhelfen. Das Chaos in ihrem Unbewussten könne bewältigt werden. Realistisch betrachtet, seien die Geschichten zwar manchmal grausamer, als der Reporter des Satans sie ersinnen könnte, aber dennoch therapeutisch wichtig. Zwei Jungen werden zur Strafe für ihre Naschhaftigkeit geschrotet und gebacken. Ein kleines Mädchen wird lebendigen Leibes von einem wilden Tier verschlungen, ein anderes sogar von einem Schwein begattet. Eine böse Frau will unentwegt ihr Stiefkind vergiften. Ein alter Mann beschläft jede Nacht eine neue Jungfrau und lässt sie im Morgengrauen töten. Verbrechen, Sadismus, Neid, Hass, Kannibalismus und Sodomie gehören zum gefährlichen Repertoire in den Wunderwelten der Märchen, in denen viele Helden auf grausame Weise den Sieg erkämpfen. Soll das etwa pädagogisch wertvoll sein?
Bettelheim hat an autistische Kinder und geisteskranke Erwachsene gedacht, als er über Märchen im Allgemeinen, aber im Grunde speziell über die Märchenhasser schrieb, findet Alexander. So fällt dann Bettelheims Urteil für ihn auch sehr drastisch aus. Die Märchenwelt entspräche dem kindlichem Erleben und Denken. Dabei, so argumentiert er, seien die Strukturen von Märchen mit kindlichem Denken, die Märcheninhalte mit Entwicklungsaufgaben und die Märchenthemen mit kindlichen Entwicklungskrisen verbunden. Vergiftete Stiefkinder? Getötete Jungfrauen? Geschrotete Knaben? Eingesperrte Prinzessinnen? Eigenartig findet Alexander auch den zweiten Teil in Bettelheims Märchenbuch, wenn er Märchen aus psychoanalytischer Sicht deutet, wenn Märchen und Wunder bei ihm entwicklungsfördernde Projektionshilfen werden, die Erkenntnisse des Lebens von innen her böten. Am meisten stört Alexander, dass er selbst nun beileibe kein Kind mehr ist, weder autistisch noch geisteskrank, aber gerade ihm helfen die Märchen voranzukommen. Alle Märchen und auch Bettelheims Märcheninterpretationen haben in seinem Kopf einen festen Platz gefunden. Wie er meint, kommen Märchen in seiner eigenen Märchenwelt sogar in Gestalt täglicher Nachrichten für Erwachsene daher. Tagtäglich werden in immer neuen Formen und Variationen Märchenstunden erfunden und Märchen nacherzählt. Schließlich sind es Erwachsene, wie er, die im Regelfall Märchen sammeln, aufschreiben, erzählen und auch darüber berichten.
Was hatte Bruno Bettelheim für ein Bild von der Kindheit? Ist es das Bild von Kindheit in einem psychoanalytischen Gruselgemälde, in dem autistische, „behinderte“, therapier- und resozialisierbare Kinder gemalt werden? Weit gefehlt wahrscheinlich, aber irgendwie doch auch zutreffend, wie Alexander meint.
Für ihn sind Wunder, Kinder und Märchenwelt lediglich die Wirklichkeit selbst, wie man sie sieht und für sich sowie den eigenen Gebrauch entsprechend zubereitet, um mit dem eigenen Leben besser klarzukommen. Der Wissenschaftler Bruno Bettelheim wollte jedenfalls realitätsnah und empirisch forschen. So entstand dann seine eigene verwandelte Wirklichkeit.
Kappel als Mensch und Autor unterscheidet grundsätzlich nicht zwischen Kinder-, Erwachsenen- und anderen Märchengeschichten. Warum sollte man das auch tun? Erwachsene spielen unentwegt ihre Kindheit aus, und Kinder leben in der Welt ihrer Eltern und Lehrer. Hänsel hält der blinden Hexenlehrerin statt seines Fingers nur ein kahles Stöckchen hin, um ihr zu zeigen, dass er immer noch viel zu mager zum Verspeisen sei.
Für Alexander wollen Kinder niemals Grausamkeiten erleben, sondern nur wie Odysseus durch die weite Welt reisen. Sie wollen Abenteurer sein, um Jason zu treffen, der seine Argonauten, die besten Spezialisten aus allen wichtigen Fachgebieten, um sich schart, um für alle Eventualitäten des Lebens gerüstet zu sein.
Wahrscheinlich haben die meisten Menschen noch nie ernsthaft daran geglaubt, Märchen, Sagen und Legenden wären wirklich frei erfunden. Die phantastische Form entspricht der Phantasie des Erzählers, der Geschichten aus der Wirklichkeit erzählt. Die guten Autoren und Erzähler erfinden noch zusätzlich klug handelnde Tiere und die Zauberwelt von Riesen, Zwergen, Geistern, Einhörnern oder Drachen mit dazu. Diese zauberhaften Wunderweltautoren gab es natürlich schon immer, von der Antike bis in die Gegenwart und weit in die Zukunft hinein vorausgedacht. Nicht erst seit der Zeit, in der wir ordentlich schreiben und drucken gelernt haben, existieren diese wundervollen Geschichten. Schon der Steinzeitmensch konnte Phantasie an die Felswand malen.
Die „Rettung“ der Märchen durch die Brüder Grimm ist für Alexander ein wissenschaftliches Zivilisierungsmärchen, welches vor allem an die Entwicklung der Schriftsprache geknüpft ist, aber auch an die Erfindung der Germanistik und die Sammelleidenschaft der Bibliothekare in der Berliner Universität. Ein jähes Ende, wie das der Gegner des kleinen Hobbit, kann er allerdings all den Versuchen, Märchen wirklich zivilisieren zu wollen, schon voraussagen. Sein Verstehen von Märchen und Märchenwelten ist eine reine Welt der Kunst und der Phantasie, jene Welt, die prinzipiell nur aus einzelnen kleinen Schöpfungen besteht. Es sind die Schöpfungen aller Menschen, die tagtäglich fantastische Wundergeschichten vom Unwirklichen und der Realität, von verschiedenen Weltanschauungen und der Romantik hören, erfinden und erzählen. Das, was Interesse weckt und weiterhilft, ist für Alexander ein bedeutender Teil des Wesens der Märchen. Die koboldhaften Gestalten sind die Märchenschreiber, Erzähler und Leser, die wie Märchenfiguren verzaubern, wobei der Märchenton und auch die Märchenlautstärke den wertvollen Gehalt einer einzelnen Geschichte ausmachen können.
„Peterchens Mondfahrt“ ist das Abenteuer des Maikäfers Sumsemann, der mit Peter und Anneliese zum Mond fliegt, um von dort sein verlorengegangenes sechstes Beinchen wieder zu holen. Der Autor und seine Figuren sind Schöpfung und Schöpfer zugleich. Gerdt von Bassewitz hatte sich als Vorbild die Geschwister Peter und Anneliese genommen, jene gleichnamigen Kinder vom Ärzteehepaar Eva und Oskar Kohnstamm, denen er 1911 im Sanatorium, wo er sich zur Kur aufhielt, begegnete. Wer ist Schöpfer? Wer ist Schöpfung? Entscheidend ist, was Bassewitz aus Peter und Anneliese geformt hat, wie er sie kunstvoll umgestaltet und verwandelt hat.
„Die Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“, von der die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf erzählt, ist ein gutes Lesebuch für die Schule, um nicht nur den schwedischen Schulkindern die Heimatkunde nahezubringen. Aber nicht nur deshalb gibt es die bösen Streiche des Wichtelmännchens und den zahmen Gänserich, der über die Ostsee herüberkommt und nach Lappland fliegen will. Nils sitzt auf dem Gänserücken in Freiheit und will lieber mit den Wildgänsen durch Schweden ziehen, als dass er als kleiner Mensch auf der Schulbank sitzt. Er erlebt gefährliche Abenteuer, wobei er oft über moralische Fragen zu entscheiden hat und sich bewähren muss, so als säße er in der Schule. Als Nils mit den Wildgänsen aus Lappland zurückkehrt, bevor sie dann über die Ostsee nach Pommern weiterfliegen wollen, schleichen sich Nils und sein Gänserich auf den Hof von Nils’ Eltern. Nils kann auf keinen Fall zulassen, dass seine Eltern den Gänserich töten. Warum sollten die eigenen Eltern sie so etwas Schreckliches tun? Allerdings erst nachdem er seine Schamhaftigkeit besiegt hat, weil er so winzig klein ist, wird er schließlich ein größerer Mensch. Was ist das Wunder, das Märchenhafte? Es ist die schlichte alltägliche Verwandlungsmöglichkeit, die jeder Mensch nun einmal hat und von der man wundersam erzählen kann. Größer werden und sich kleiner fühlen ist die alltäglichste Sache der Welt. Zum allergrößten Glück haben gerade Schulkinder diese fabelhafte Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, Wandlungen und verschiedene Größen auszuprobieren.
Über Märchenparodien kann sich Alexander Kappel furchtbar aufregen. Was hatte der Politikwissenschaftler Iring Fetscher eigentlich davon ein „Märchen-Verwirrbuch“ zu schreiben und sich zu fragen, wer denn das reale „Dornröschen“ wachgeküsst habe? Was bewegte Mary M. Kaye dazu, unbedingt eine ganz gewöhnliche Prinzessin konstruieren zu müssen? Welche Erkenntnis will Peter Rühmkorf übermitteln, wenn er sich als „Hüter des Misthaufens“ sieht? Was hat man überhaupt davon, Märchen als aufgeklärt oder weniger aufgeklärt darzustellen?
Schlimm verbogen ist für Alexander ein computer-animierter, amerikanischer Familienfilm aus dem Jahr 2005 mit dem Namen „Die Rotkäppchen-Verschwörung“. Ein Märchen in einen Krimi umgemünzt. Den hätte ein frecher Regisseur auch schon nach der Veröffentlichung von Bettelheims psychoanalytischem Märchenbuch drehen können. Könnte es sein, dass Parodien grundsätzlich auch am Elend und den vielen Übeln in der Welt beteiligt sind? Niemals würde Alexander Kappel als Autor ein Parodist sein wollen, wie Charlie Chaplin, der verkleidet als deutscher Reichskanzler „Der große Diktator“ Adolf Hitler ist. Eine Hollywoodfigur brüllt vor sich hin und spielt mit der Erdkugel als Luftballon herum. Oder wie jener Schulaufführer, dem die Aufführung seiner anvertrauten Schülerinnen und Schüler immer wieder misslingt, weil die Schüler den Text ironisch empfinden, ihn nicht ernst genug nehmen und das Leben überhaupt so furchtbar komisch sei. In echten Märchen gibt es dagegen kaum diese Beziehungsfalle Ironie, nur wenn man Märchen möglicherweise falsch erzählt.
Die modernen digitalen Formen der vielen Fantasy-Spiele in Film, Funk, Fernsehen und Computer sind besser als nichts, sagt sich Alexander, aber häufig genug bleibt die Phantasie auf jener Strecke, die man zurücklegen müsste, weil man sie nicht nur beiläufig mitnehmen kann. Wenn er intensiv über Parodien nachdenkt, fragt er sich, gibt es sogar einen Parodismus. Zwei Filme scheinen ihm dann doch sehr gut gelungen zu sein. Der eine ist „Spaceballs“ von Mel Brooks, der ein anderes Film-Epos auf den Arm nimmt. Der andere Film heißt „Das Leben des Brian“ von Monty Python, die sich erfolgreich an Jesus und den Bibelgeschichten zu schaffen machen. Sie schaffen jene steile Gradwanderung über die Gebirgskette der ironisierenden Phantasie hinweg, weil sie die richtige, versöhnliche Form finden, wie man eben das Kind auf den Arm nimmt, welches man nicht so tiefgründig, ernst und schwer nehmen sollte.
Wolf mag inzwischen im Fernsehen die langen Serien mit vielen Folgen am allerliebsten. Er wird eben auch älter, glaubt Alexander. Wolf sagt, dass Serien immer eine Fortsetzung böten, weil man eigentlich kein Ende sucht oder findet. Die normalen Märchenfilme seien ihm inzwischen viel zu kurz geraten, wie zum Beispiel „Die Unendliche Geschichte“ von Michael Ende oder auch die Geschichte von „Momo“, in der die Phantasiediebe in allerkürzester Zeit besiegt werden und dann alles wieder in Ordnung zu sein scheint. Nichts ist in Ordnung. Alles geht immer weiter, sogar der Diebstahl der Zeit. Alexander sagt zu Wolf, dass auch der Tod immer nur ein vorläufiges Ende ist, weil alles in vielen Formen und Gestalten weiterlebt. „Michael Ende ist im August 1995 in Filderstadt gestorben. Beerdigt wurde er auf dem Waldfriedhof in München. In seinen Geschichten wird er noch eine unendlich lange Zeit weiterleben.“
In japanischen und chinesischen Märchen ist für Alexander vieles anders geordnet. Häufig sind es dort Chroniken, in denen die einzelnen Lebensgeschichten und Abenteuer eingebunden werden. Auch die Verstorbenen leben weiter, wie die Götter in der griechischen Mythologie. Alles auf der Welt existiert schon vor der Entstehung der Phantasie des jeweiligen Erzählers. Besonderen Wert legen die Asiaten auf genealogische Verbindungen zwischen Göttern, Herrscherpersönlichkeiten und normalen Alltagsmenschen. Wunder werden dadurch zu einer menschlich-göttlichen Übernatur, zu einer Vererbungslehre gewissermaßen, die uns von einer Generation zur nächsten trägt.
Maos Geschichte
„Wie waren die Roten Garden so?“, fragt ein Chinese. „Wir haben fürchterliche Verwüstungen angerichtet. Wir haben gegen unsere Schulrektoren, gegen unsere Lehrer, gegen unsere Nachbarn, sogar gegen unsere eigenen Eltern gekämpft. Wir haben sie auf die Straße getrieben. Wir haben sie erniedrigt und gedemütigt. Wir haben sie öffentlich zur Schau gestellt. Wir haben sie zu Tode geprügelt. Alles wegen unseres Führers, dem großen Vorsitzenden Mao. Wir haben gezwungenermaßen bewiesen, dass wir Mao mehr liebten als unsere Familie. Allerdings haben wir ihn auch wie einen großen alten Ahnen verehrt.
Dann starb Mao eines natürlichen Todes, aber er lebt in uns weiter. Wir haben nun durch ihn die Hebel der Geschichte in der Hand. Wir sind durch ihn ein engagiertes System und endgültig das Reich der Mitte geworden. Wir haben die Macht erkannt, die unsere Träume wahr machen kann. Allein, noch wissen wir nicht ganz genau, was unsere Träume eigentlich bedeuten. Wir wissen nur, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen können, wenn wir es wollen.“
Nach dem Sieg der Alliierten Mächte über Nazideutschland und dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist auch in Europa die Generationenfrage umfangreich aufgearbeitet worden. Wir Deutsche möchten uns eigentlich nicht mehr an die Ideen der Nationalsozialisten erinnern, deshalb beschäftigen wir uns viel mit ihnen, weil wir sie dadurch noch nachträglich bekämpfen wollen. Vielleicht sogar weil wir wissen, dass wir zuvor zutiefst versagt haben. Nicht einmal an die Idee des Widerstandkampfes gegen die Nazis wollen einige mehr erinnert werden. Ansonsten aber sind wir Deutsche gute wissenschaftliche Aufarbeiter unserer schrecklichen Vergangenheit. Vermutlich sind wir sogar historische Mentalitätsführer, was uns dabei behilflich sein könnte, uns selbst durch das Fremde im eigenen Ich zu führen.
Was ist das alles für ein merkwürdiges Kuddelmuddel in der Geschichte?
Wir Deutschen sind nach dem letzten großen Krieg, den wir eigenwillig angezettelt haben, eigentlich immer noch gutmütig krakeelende Seeleute. Wir sind betrunkene Matrosen, wie „Kuttel Daddeldu“, den einst der Lyriker Joachim Ringelnatz erfand. Kuttel ist jener deutsche Leichtmatrose, den man vor ein Artilleriegeschütz setzen kann und auf die große Reise in den Krieg schickt, den man mit ihm nicht gewinnen kann.
Kuttel
Wir singen moritatenhafte Seemannslieder, in denen Kuttel von wilden Seefahrten und chaotischen Landgängen berichtet, von Bordellen und Hafenkneipen, von seiner Braut Marie, die aus Bayern stammt, und nicht zu vergessen, die Berichte über seine verstreuten Kinder in aller Welt. Die Abenteuer des Seemanns und der Lokomotivführer sind das Sitzfleisch, mit dem wir, wie auf Schienen, durch das Land reisen. Es sind die Märchenvisionen vom täglichen Beruf in unserer männlich-deutschen Kindheit früher einmal gewesen. Heutzutage scheint es die Kuttelvision vom modernen Computerfachmann zu sein, der im Chaos-Club organisiert ist und ein weltweit einflussreicher Hacker werden möchte. Die deutsche Frau, die Kuttlerin dagegen ist etwas anderes. Sie ist die ewig deutsche berufstätige Hausfrau, Geliebte und Krankenschwester, die nach dem Kampf aufräumt und mit ihren Händen die Gedärme sortiert. In Deutschland ist vieles von schlichter und einfacher Natur, wie alle Berufsvisionen eigentlich. Die Verse in der Metrik wirken zwar uneinheitlich, aber die Reime sind durch hohe Geschlossenheit gekennzeichnet. Kuttel zeigt uns die Welt aus Sicht der vermeintlich kleinen Leute: Außenseiter, Deklassierte, Arme, Hartz IV-Empfänger. Die Reichen und Gebildeten haben sie erfunden. So sind wir Deutsche eben. Deutsche Armut wird mit parodistischem Ideenreichtum bekämpft. Der tägliche Existenzkampf wird hauptsächlich mit dem Mundwerk gemeistert. Keiner schert sich groß um Kon v ention und Etikette, nur wenn man sie uns streng befiehlt. Das breite Publikum beschert Kuttel stets den überwältigenden Erfolg.
Die Nationalsozialisten schätzten seinerzeit den anarchischen Frohsinn des Seemanns Daddeldu nicht und setzten die Balladen von Ringelnatz auf ihre „Schwarze Liste“. Wir Deutschen sind nämlich die allerbesten Listenschreiber.
Sind wir Deutsche noch größere Verlierer als die Chinesen, weil wir immer auch gegen uns selbst noch einmal verlieren? Genügend Bildung scheint uns nicht aus der Patsche helfen zu können. In Maos Reich dagegen sieht alles klipp und klar aus:
Maos Geschichte (Fortsetzung )
„Geht aufs Land. Wir gingen aufs Land. Lest das kleine rote Buch. Wir haben es gelesen. Wir verließen unsere Wohnungen in der Stadt und mussten die örtlichen Beamten bestechen, um wieder in die Städte zurückkehren zu können, in denen wir aufgewachsen und zu Hause sind.“
Ist das nicht ebenfalls schlicht und einfach? Ist das nicht das Märchen von „Frau Holle“? Goldmarie muss ordentlich belohnt und Pechmarie ordentlich bestraft werden.
Die schrecklichen, ganz einfachen Lehrmärchen in den jüngsten deutschen Elterngenerationen sind Hitler, Stalin und Mao. Ihre mörderischen Weltmachtträume in jener Welt, die man erobern und politisch verändern müsse, sind Teil von uns allen, ob wir nun wollen oder nicht. Wölfchen versteht so etwas schon sehr gut. Alexander hat ihm nämlich vom Gruseln in den Soldatenmärchen erzählt. Der Gruseleffekt reicht aber leider immer nur für etwa eine Woche, wenn überhaupt. Dann möchte Wolf doch lieber wieder Fantasy-Serien gucken oder an seinem Handy herumspielen, um den Vogel abzuschießen oder ein neues virtuelles Imperium aufzubauen.
Fast selbsterklärend scheint dagegen zu sein, wenn man als historisch begabter Wissenschaftler einen sogenannten Märchen-Index erstellt, ein Realitätsmärchen gewissermaßen. Antti Aarne hat für die internationale Erzählforschung einen Index erstellt. Stith Thompson ergänzte die Klassifikation der Märchen- und Schwankgruppen. Aber erst als der deutsche Erzählforscher Hans-Jörg Uther aus dem Harz, im Jahr 2004, den Märchenindex überarbeitet hatte, trug er von da an die bekannte Markenbezeichnung ATU, Aarne-Thompson-Uther. 2005 hat Uther den Europäischen Märchenpreis der Walter Kahn Märchen-Stiftung bekommen und im Jahr 2010 den Brüder-Grimm-Preis der Philipps-Universität Marburg. Wofür wurde er damals ausgezeichnet?
Wie schön und aufschlussreich, dass es das Wunder der Indexierung gibt. Man hat alles und nichts schnurstracks auf einen Blick. Man hat einen sogenannten Index. Man hat die Märchenwelt in rationelle Stichworte eingepasst und aufgelistet - fast ein Stichwortmärchen:
Der Märchenindex
Entstehung und Aufbau - Bedeutung und Kritik - Beispiele - ein Typenkatalog - übernatürliche Gegenspieler - übernatürliche und verzauberte Ehefrauen oder andere Verwandte - Ehemann, Bruder oder Schwester - übernatürliche Aufgaben - übernatürliche Helfer - magische Gegenstände - übernatürliche Kraft und Wissen.
Das Märchenhafte kann man also auch in totalitärer Form festhalten. Der Geist der Liste leuchtet uns den Weg. Welchen Weg? Das weiß keiner so recht. Nur die ganz intelligenten und strebsamen kleinen Nachwuchswissenschaftler in der Schule, wird er möglicherweise ein wenig erleuchten können.
Alexander hasst Listenschreiben wie die schlimmen Symptome einer schweren Krankheit. Warum sollte man so etwas Grausames tun? Er selbst hat nur ein einziges Mal in seinem Leben eine längere Liste von Märchen und Wundern zusammengestellt. Es ging schief. Er wollte sehen, ob es vielleicht doch einige wundersame Gemeinsamkeiten zu entdecken gäbe. Allerdings, seine Liste war ausschweifend, international und weltumspannend. Man denkt nur am Anfang, dass Märchen überall ähnlich klingen, wegen der Überschriften wahrscheinlich. Überall gibt es Prinzessinnen und arme Menschen, die sich in Tiere und Kaiser verwandeln. Ganz sonderbare Wesen haben sich als Männer, Frauen und Kinder verkleidet und tragen originelle Namen.
Alexanders kurze Liste
„Kwaku Ananse und die Weisheit (Ghana), Legende der Prinzessin von Guatavita (Kolumbien), Die Prinzessin auf der Erbse (Dänemark), Der Wanderer (Indonesien), Wie das Krokodil zu seinen Zähnen kam (Malaysia), Vom dummen Honza (Tschechien), Das Krokodil und der Affe (Indien), Die vier Freunde (Indien), Ein wirklicher Freund (Indien), Gagliuso (Italien), Das Beutelchen mit zwei Talern (Rumänien), Lappi und Loppi (Estland).“
Am Ende hat Alexander seine listige Anstrengung schnell wieder beendet, weil ihm im Grunde schon vorher klar war, dass Listen unendlich lang werden können, aber die kleinste oder jüngste Tochter nicht unbedingt immer die schönste sein muss. Auch die Armen, Benachteiligten und Phantasielosen werden am Ende nicht überall siegreich oder erfolglos sein können. Neue Freunde und Feinde werden sie überall finden. Das Allerjüngste der sieben Geißlein entkommt dem bösen Wolf, aber auf keinen Fall wegen einer ordentlichen Auflistung.
Nun, wie sieht es mit der Weisheit in Wundermärchen aus?
Man unterstellt oft, dass Märchen von sich aus weise seien, eine Seelennahrung ohne Anstrengung gewissermaßen, welche Kindern zentrale Weisheiten und Werte naherbringt. Tua res agitur. Genau diese Sache wird verhandelt.
Joana Feroh, eine Sängerin jiddischer Chansons aus der Schweiz, sagt, mit Kindern müsse man Geschichten suchen und sie dadurch gleichzeitig neu erfinden. Das sei etwas ganz Normales. „Wer mit offenen Augen durch den Alltag geht, kann sich eine aufwändige Suche ersparen. Denn: Geschichten liegen überall herum, man braucht sie nur aufzuheben!“
Ist das möglicherweise das Wunder der Weisheit? Alexander hat intensiv darüber nachgedacht. Liegt die Weisheit wirklich überall herum? Muss man sie wirklich nur noch aufsammeln?
In den 1970er Jahren wurden im Westen Deutschland wenig Volksmärchen erzählt, weil man Kinder vor Grausamkeiten und bösen Geistern beschützen wollte. Einige Literaten erfanden in dieser Zeit allerdings auch neue gesellschaftskritische Märchen. Man wollte die schreckliche Nazizeit hinter sich lassen. Man wollte nichts Unwahres mehr erzählen. Doch wenn man vor dem Bösen in der eigenen Geschichte zurückschreckt, dann erschrickt man gleichsam auch vor sich selbst. Die Märchen selbst hingegen sind stets nur verkleidete Geschichte. Sie zeigen vor allem Auswege, sodass am Ende das Gute das Böse doch besiegen kann. Sie sind Aufmunterung, für das Bessere zu kämpfen, weil man das Gute sucht und sich mit dem Bösen höchstpersönlich auseinandersetzen muss. Manchmal zeigen Märchen auch, dass die bösen Wesen recht einfach zu besiegen sind. Besser jedoch scheint es zu sein, Kinder erwarten das höchstwahrscheinlich auch, dass das Böse im engagierten Kampf und mit viel Glück ausgelöscht wird. Eben genau das ist auch das Erfolgsrezept des Schalks in Hollywood, vermutet Alexander. Man darf aber niemals das Wichtigste vergessen: die Feier des großen Festes, des universellen Botschafterfestes, am Ende der Erzählung. Dieses Hochzeitsfest ist stets viel mehr, als es zunächst erscheinen mag. Nicht nur zwei, die sich mögen, erhalten den offiziellen Segen, sondern man gewinnt auf dem Fest viele Freunde und Zuschauer. Fette Wildschweine werden in fröhlicher Runde, um den runden Dorftisch sitzend, nach dem großen Abenteuer grölend verzehrt. Der Schwiegervater wird eine Rede halten. Und wenn sie noch genügend Kraft haben und nicht gestorben sind, so feiern alle Menschen immer weiter, auf immer eindrucksvolleren goldenen Veranstaltungen und verspeisen Kalbsköpfe, wie auf der Fußball-Fan-Meile in Berlin. Gute Märchen hingegen zeigen diesbezüglich doch eher Einfaches und Überschaubares. Der Festakt kann nicht entscheidend sein, wenn das Märchen zeigt, wie ein fairer Umgang mit den Ängsten aussehen kann, wie man erfolgreich hofft und bangt, wie man mit nur einem echten Freund oder einer besten Freundin das Leben meistern kann. Es geht um das gemeinsame Bangen und Hoffen mit vielen Freunden und gegen unendlich viele Feinde.
Die Fragen
Ist das Hoffen und Bangen der ganzheitliche Wert, die Wahrheit oder vielleicht sogar die Weisheit? Freundschaftliches Handeln, Friede, Liebe, Gewaltlosigkeit: Sind diese Verbündeten des Glücks die guten Wesen im dunklen Märchenwald der Geschichte? Was ist mit dem Anderssein und dem Ganz-anders-denken-wollen oder -können? Folgt man der Intuition des Herzens etwa nur auf den Heldenwegen der eingeübten Entwicklungsgeschichte? Stellt man nur eine schon vorhandene Ordnung wieder her, die dann auch noch die Ordnung der Phantasie und der Zukunft wird? Sind alle wundervollen Geschöpfe, die Feen und Zwerge, überhaupt bereit, die Schöpfung in Ordnung zu bringen? Werden, während man das fragt, die Fressfeinde ihre Opfer nicht längst verspeist haben?
Alexander hat dieses schwierige Thema mit der Frage nach der Ordnung mit Wolf durchdiskutiert. Sein kleiner Sohn sagte: „Scheiß was auf die Ordnung.“
Zunächst war Alexander entgeistert. Dann aber konnte er Wolf gut verstehen. Man kann niemals vorgeben oder voraussehen, wie eine gute Ordnung auszusehen habe und wohin die Phantasie uns führen kann.
Wie also läuft die praktische Ordnung der Dinge in der Welt der Märchen ab?
Wolf kann natürlich darauf keine vernünftige Antwort kennen. Aber in einem hat er Recht, weil Alexander es ihm in den Mund gelegt hat: „Der Wert des Geldes lässt sich nicht aus dem Edelmetallbestand ableiten.“ Wolf hat dann unfreiwillig Foucault zugestimmt, weil er erklärte, dass er auf Geld gar keinen großen Wert legt. „Nur für den Schokoriegel muss das Geld reichen“, hat er gesagt. Der wundersame Homo Faber aus dem „Frischregal“ dagegen, muss nicht nur für Geld immer und überall etwas leisten und tatkräftig hervorbringen. Ständig wird er durch den Schaffenswillen seines Autors in Bewegung versetzt. Ein Schweizer Manager eben. Er steht unter Druck und ist im Dauerstress. Homo hat keine echte freie Zeit mehr, um sich eventuell noch grundsätzliche Gedanken zu machen. Erst am Ende, als er todkrank geworden ist, will er sein Leben, seine Versäumnisse und seine Verfehlungen aufarbeiten. Das Märchenhafte im Menschen ist durch die Eindimensionalität von Arbeit und Ökonomie auch in der Phantasie dahin, dahin.
Die urdeutsche Tugend, nämlich der Fleiß, ist auch in der Sammlung der Grimmbrüder ein hochgeschätztes Thema, wie uns insbesondere die Geschichte über die Belohnung der Arbeitsmoral bei der „Frau Holle“ erklärt: „Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie.“
Männliche und weibliche Figuren stehen nach Alexanders Auffassung für die märchenhaften Seelenteile Ying und Yang. Davon hat Frau Holle natürlich nichts gehört. Riesen und Zwerge haben extrem gegensätzliche Fähigkeiten in Bezug auf ihre körperlichen und intellektuellen Kräfte.
Ziel der märchenhaften Seelen- und Körperwanderung ist meistens die Erlangung der Königswürde oder des königlichen Wohlgefallen. Prinz und Prinzessin zu sein, heißt Selbstbeherrschung anzustreben. Niemand kann natürlich beweisen, ob die uneigennützige Hingabe und das uneingeschränkte Vertrauen in die Seele des Herrschens und Beherrschens unbeirrbar zum Guten führen werden. Diese Elementargeister bescheren uns zunächst nur das unmittelbare Abenteuer, das mit vielen unterschiedlichen Verhaltensweisen bewältigt werden kann. Da kann dann auch derjenige qualvoll zu Grunde gehen, der ganz wenig egoistisch gewesen ist. Das reinigende Feuer kann niemals die Erlösung der Seele sein, weil die reine Seele unsterblich und nicht verkohlt ist, weil sie stets nach der Verbindung mit den königlich-göttlichen Kräften des Geistes sucht.
Alexander Kappel ist nur für heute am Ende seiner Gedankenreise auf der Suche nach Weisheit in Märchen angekommen. Zum Ende des Tages ist er allerdings häufig auch verwirrter als morgens. Wirklich klar ist ihm heute nur noch, dass man die Weisheit in Märchenbüchern bei Amazon kaufen kann. Er sagt sich praktischerweise: Deshalb schreibe auch ich einen neuen Roman, just nach dem Bilde von Vater Täuschgold und Mutter Trugsilber, mehr Schein als Sein, Märchen als Abendspinnerei auf einem finanziellem Hintergrund. Aber auch so gehört sein Abenteuer ihm ganz allein: Honigseim und Pfefferschoten, Lichterglanz und Sternentanz. Das ist es, was Alexander seinem Publikum verkaufen möchte. Nichts weiter, weiter nichts, nicht weniger und nicht mehr. Sein Schaffen ist wie der Honig, welcher klebrig aus der Bienenwabe fließt. Es ist wie Pfeffer, der in viele Wunden hineingehört. Märchenwesen und wundersame Gestalten streuen alles Mögliche in sein Leben hinein, und er pustet alles in veränderter Form nach draußen. Irgendwann zur Weihnachtszeit wird er sein Märchenbuch, als kleiner Bub, unter den Tannenbaum legen. Dann wird der Weihnachtsbaum abbrennen und sein allerallerletztes Exemplar mit ihm.
Erika kommt ins Arbeitszimmer. Sie hat eine Sprechausbildung als Schauspielerin und eine weiteres Zertifikat als Atem- und Stimmlehrerin vom Institut für Atemlehre. Sie schaut immer sehr genau hin, wie ihr treuer Alexander jeweils gerade atmet. Für ihn erzählt Erika jeden Tag aufs Neue die seltsamsten Geschichten, wenn sie ihm zum Beispiel mitteilt, er solle doch nun endlich bald fertig werden oder Wolf müsse sich beeilen, um in die Schule zu kommen. Ihre Stimme ist aber auch seine tägliche Sternstunde im Alltagsleben, wenn Erika zum Beispiel frühmorgens aus der Wohnung zur Arbeit geht und sich freundlich von ihm verabschiedet. Er kann dann in aller Seelenruhe weiterschreiben oder weiterschlafen, je nachdem, wie ihm zumute ist. Er weiß längst, dass er für Erika ein sonderbarer Schreiberling ist. Verkleidet als Schmarotzer und Verweigerers ist er für sie nicht.
Alexander hat eine Menge geerbtes Geld und sogar die große Eigentumsaltbauwohnung, in der sie jetzt zuhause sind, in die Beziehung eingebracht.
Er ist ein Kind wie Wolf und eine Frau wie Erika, denkt Alexander, der aber die Schule und den Beruf schon glücklich hinter sich gebracht hat. Erika ist für ihn leider noch berufstätig, weil sie es unbedingt will. Gleichheit vor dem alten Herrn wird es in dieser Frage wahrscheinlich niemals geben können.
Erika bringt ihm eine Brezel mit einer dicken Salzkruste und einen Pott mit heißem Kaffee ins Arbeitszimmer. Dann wird sie schnurstracks, mit Wolf dicht an ihrer Seite, wie immer pünktlich, aus dem Haus gehen. An diesem Morgen reicht die Zeit nicht mehr, um ihr die schwäbische Brezel-Saga, vom Frieder, dem Uracher Hofbäcker des Grafen Eberhard im Barte, zu erzählen, an der er in der Nacht herumgebastelt hat. Überhaupt hat er ihr schon viele Brezelvarianten in der letzten Woche vorgestellt. Sie alle handeln von Backen der Geschichten.
Schwäbische Brezel-Saga
Ein fleißiger Mann hatte die Freundschaft und das Wohlwollen des Grafen durch üble Nachrede verloren. Frieder hatte den Grafen beleidigt. Darauf steht die Todesstrafe. Er sollte nun gehenkt werden. Frieders Frau eilte verzweifelt ins Schloss, um gräfliche Gnade für ihren Mann zu erbitten. Der Graf wollte nur noch diesmal Gnade vor Recht ergehen lassen, denn er wusste, wenn er den Frieder aufhängt, dass er auf dessen köstliches Gebäck verzichten müsse. Nur weil der Graf Frieders Backkunst wirklich schätzte, gab er ihm noch eine Chance. Frieder musste zur Prüfung in kurzer Zeit einen Kuchen oder ein Brot erfinden, durch welches dreimal die Sonne scheint und welches besser schmeckt, als alles das, was der Graf bisher kannte. Das sollte dem Frieder die Freiheit bringen. Am dritten und letzten Tag seiner Prüfungszeit knetete Frieder einen leicht gesalzenen Hefeteig. Er formte eine Schlinge und kam dann leider aber nicht viel weiter. Erst als sein Blick auf seine Frau fiel, die gerade ihre Arme, über der Brust verschränkt, zusammenhielt, konnte Frieder seine Aufgabe lösen. Verschlungene Arme in Teig-Form. Das war es. Das war etwas Neues. In der Mitte etwas dicker als an den dünnen Enden. Das war die Form, schön und kunstvoll, die Frieder in das große Holzfeuer im Ofen legte. Die geschlungenen Teigstücke purzelten allerdings aus Versehen in einen Eimer mit heißer Lauge. Das Schlingwerk schien verloren. Nur zur Verzierung und Ablenkung streute er einige Körner grobes Salz darauf. Das Schlingwerk mit der Lauge wurde herrlich braun und um der Mitte hell aufgesprungen. Die Arme waren knusprig, die Mitte weich. Mit dem ofenwarmen Gebäck eilte Frieder zum Grafen.
Der Graf saß gerade bei einem Glas Württembergischem Wein. Der Graf nahm schweigend einen Bissen. Eberhard im Barte sprang plötzlich auf und hielt das Gebäck gegen das Fenster, durch welches soeben die milde Abendsonne schien. Die drei Öffnungen im Gebäck ließen den Sonnenstrahl in drei Bündeln hindurchfallen. Der Graf besprach sich mit seiner Frau, Prinzessin Barbara, die Angelegenheit. „Tatsächlich, es sind Arme.“ Die Prinzessin war sehr gebildet, so fiel ihr sofort das lateinische Wort für Ärmchen ein. Sie erwähnte auch das Wort Brazula, die Bezeichnung für zwei verschlungene Hände.
Der Graf erwartete am nächsten Morgen einen ganzen Korb voll Braze zum Vesper. So war nun das Leben von Frieder gerettet, und er wurde ein treuer Untertan. Das nun ist das Ende der Geburtsgeschichte von der schwäbischen Brezel.
Erika und Wolf sind schon längst fortgegangen, als Alexander diese spezielle Geburtsgeschichte der Brezel nochmals überdenkt. Eigentlich nichts für Kinder, grübelt er, sondern eher etwas für Existenzgründer. Aber ist das nicht letztendlich das Gleiche?
Die bayrische Märchenvariante der Entstehung der Laugenbrezel ist weniger originell. Alexander hat sich notiert:
Bayrische Brezel-Saga
Wilhelm Eugen von Ursingen, ein königlich-württembergischer Gesandter, soll der erste Mensch gewesen sein, der zum Frühstück, im Februar 1839, im königlichen Kaffeehaus in der Münchner Residenzstraße eine Laugenbrezel zu essen bekam. Versehentlich soll der Bäcker Pfannenbrenner die Brezeln statt mit Zuckerwasser mit Natronlauge glasiert haben, die er sonst zum Reinigen der Backbleche verwendete. Das knusprig braune Gebäck duftete und mundete dem Gast so ausgezeichnet, dass dadurch die diplomatischen Beziehungen zwischen Bayern und Württemberg wesentlich gefestigter wurden. Das ist das unspektakuläre diplomatische Ende der bayrischen Kindheitsgeschichte der Brezel.
Die Wunder der Kindheit von Dingen sind oft mit ganz speziellen Entstehungsmythen verknüpft. Das weiß Alexander nun. Wie aber gelingt es den kleinen Babys als Lurche aus dem Mutterleib zu kriechen? Wie entsteht und entwickelt sich ein Menschenkind?
In gängiger deutscher Art und Weise werden Babys vom Klapperstorch in die Welt gebracht, ordentlich gewickelt und frisch gekämmt, falls sie schon Haare haben sollten. Wir kennen die Geschichte vom Klapperstorch aus einem Hochzeitsgedicht aus dem Jahr 1723, welches in Grimms Deutschem Wörterbuch hinter der Zahl 19.373 steht:
Hochzeitsgedicht
„Zum wenigsten ist dis zu gläuben,
es musz hier gut zu wohnen seyn,
wenn andre häuser ledig bleiben,
so spricht allhier der storch doch ein …
und weil uns unsre mütter sagen:
(ich glaub es auch die stunde noch)
die störche müssen kinder tragen,
die fielen durch das schornsteinloch.“
Bei Hans Christian Andersen, im Jahr 1839, also über 100 Jahre später, lautet der Hinweis auf den Klapperstorch anders:
„Ein junger Kaufmann fliegt mit einem Koffer in die Türkei, besucht dort die Prinzessin und erzählt ihr Märchen, unter anderem ‚Vom Storch, der die herzigen kleinen Kinder bringt‘.“
Alexander weiß, dass Babys natürlich nur im Märchenbuch in fliegenden Koffern daherkommen oder im Wickeltuch vom Storch durch den Schornstein geworfen werden. Im Mittelhochdeutschen war „des Mannes Storch“ eine Umschreibung für den Penis. Er kratzt sich. Er sieht das Foto seiner Mutter vor sich auf dem Schreibtisch stehen. Er mag die Wassergeschichten über die Geburt viel lieber. Brunnen sind Märchengefäße, aus denen das Leben steigt, dunkel, grottig und feucht, wie im „Froschkönig“ geschildert. Das Froschwasser, aus dem ein Baby bei der Geburt herausgezogen wird, ist das Fruchtwasser im Leib der Mutter, oder auch das Wasser des großen afrikanischen Nils, aus dem die Königstochter einst das Kind von Moses fischte, welches sie dann adoptierte. Schon vom akkadischen König Sargon wird erzählt, er sei in einem schwimmenden Behältnis flussabwärts getrieben, ähnlich wie Romulus und Remus auch, die Gründer Roms. Grimms Märchen vom „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ greift auf dieses Motiv ebenfalls zurück, so als hätten sich die verschiedenen Erzähler abgesprochen. Der kleine Held wird oft zufällig von einfachen Leuten aus dem Wasser gezogen. Seine eigentliche Bestimmung soll eine ganz andere sein, denn er wird einmal König werden. In Ägypten hatte die Geburtsgöttin die Gestalt eines Froschs. In „Schneewittchen“ kündigt der Frosch die Schwangerschaft der Königin an. Im „Froschkönig“ werden bildhaft der Eisprung, die Schwangerschaft und die Geburt beschrieben. Der Frosch wird schließlich im Schloss wohnen. Dort wird er vom Teller der Prinzessin essen, bevor sie ihn ins Bettchen bringt.
Die echten Frösche indes werden von echten Störchen mit brutaler Gewalt und Hungergefühl aus dem Teich gezogen und aufgefressen.
Es gibt viele Geburtsmärchen. Wie aber wurde das Märchen selbst geboren?
Ludwig Bechstein hat uns Auskunft gegeben:
Die Geburt des Märchens
In der Zeit, als es noch keine Märchen gab, waren die Kinder täglich betrübt, weil der schönste Schmetterling fehlte. Zwei Königskinder spielten im prächtigen Garten ihres Vaters. Es gab im Garten auch kühle Grotten mit plätschernden Quellen. Die aufrauschenden Fontänen gingen bis in den Himmel und bildeten wundervolle Marmorbildsäulen. Gold- und Silberfische schwammen im Teich. In goldenen Vogelhäusern konnten die Vögel frei umher fliegen und ihre Lieder singen. Die Kinder saßen still beisammen und waren traurig. Sie hatten alles, was Kinder sich wünschen: gute Eltern, kostbarste Spielsachen, die schönsten Kleider, wohlschmeckende Speisen und Getränke. Sie wussten nicht, was ihnen fehlt. Ihre Mutter, eine Königin mit milden Zügen, war bekümmert. Sie war betrübt, dass ihre Kinder nicht glücklich sein konnten. „O wäre ich nur selbst wieder ein Kind!“ Um Kindeswünsche wirklich zu begreifen, müsste man selbst ein Kind sein. Wie die Königin also wünschte, wieder ein Kind zu sein, wiegte sich über ihr ein herrlicher Vogel in den Lüften. Er war so schön, dass die Königin und die Kinder erschauerten, zumal sie jetzt das Wehen seiner Flügel fühlten. Der Paradiesvogel schwebte immer höher, bis nur noch ein goldener Streif zu erkennen war. O Wunder! Als Mutter und Kinder wieder niederblickten, lag auf dem Schoße der Mutter ein goldenes Ei, welches der Vogel gelegt hatte. Die Mutter lächelte selig und voller Dankgefühl. Das müsse der Edelstein sein, der noch zum Glück ihrer Kinder fehle. Zufriedenheit und Sehnsucht werden endlich auch ihre kindische Trauer stillen. Erst wagten sie nicht, das Ei zu berühren. Endlich aber legte das Mägdelein doch eines seiner rosigen Fingerchen daran und rief: ‚Das Ei ist warm‘. Nun tippte auch der Königsknabe vorsichtig an das Ei. Endlich legte auch die Mutter ihre weiße Hand auf das köstliche Ei. Was begab sich dann? Die Schale fiel in zwei Hälften auseinander, und aus dem Ei kam ein wunderbares Wesen hervor. Es hatte Flügel und war doch kein Vogel, kein Schmetterling, keine Biene und keine Libelle, und doch von allen diesen Geschöpfen etwas. Mit einem Wort, es war das buntgeflügelte, farbenschillernde Kinderglück, des Wundervogels Phantasie: das Märchen. So war es endlich das Märchen selbst geboren worden, welches sogar den Erwachsenen gefiel, wenn sie aus dem Garten der Kindheit etwas in das reifere Alter hinüber tragen, nämlich die Kindlichkeit des Herzens.
Nun weiß jeder, wie Alexander Kappel sich fühlen muss, wenn er über die Wunder- und Märchenwelt nachdenkt und anschließend etwas davon zu Papier bringt. Es entschlüpfen ihm köstliche Eier im Garten des Königs. Er wird genau deshalb immer wieder eine neue gute Geschichte schreiben können. Immer wird sie den Namen Genesis tragen können, auch wenn sie nur nacherzählt ist. Auch wenn immer alles so ähnlich klingen mag. Die Geburt ist Liebe, Zuversicht und die Frage, wie man für vier Fische das Meer auf unsere Teller bringt.
Alexanders persönliches Märchenalter begann, soweit er sich daran erinnern kann, als er drei Jahre alt war. Schon kurz danach und besser währenddessen entwickelte sich seine magische Weltumsicht, die er beibehalten wird. Unbeeinflusst durch Naturwissenschaft und Technik kann er seither sogar physikalische Abläufe und Naturereignisse durch die Kraft geheimnisvoller Magie erklären. Märchen sind für ihn die phantasievollen Mitglieder seines Volksstamms, mit dem er lebt, der sich über Jahrhunderte hinweg entwickeln konnte. Märchen bündeln für Alexander gewissermaßen sogar die Erfahrungen der Menschheit, wie eben auch die seines winzigen Lebens.
Märchen übersetzen mit feinem Gespür allgemeine Lebenssituationen in Anthropologie, in magische Bilder und Symbole. Man kann sie besser verstehen, wenn man die Botschaften intuitiver statt rationaler erfasst. Alexanders märchenhafter Geist macht sich, wie selbstverständlich, natürlich nicht nur an den großen Heldenfiguren oder Hauptdarstellern fest. Für ihn ist es nicht von Bedeutung, ob es sich um einen männlichen Helden, eine Heldin, einen Prinzen, eine Prinzessin, einen Frosch oder eine vollkommen unbedeutende Nebenfigur handelt, da er sich in alle Geschlechter und Rollen gut hineinversetzen kann. Er ist fast hellblond und eben ein dritter Typ, ein Hermaphrodit im allerweitesten Sinne. Als schneeweißer Mann ist er im Herzen pechschwarz. Als Frau ist er wie ein Jugendlicher, ein Kind und ein Erwachsener zugleich.
| Als pechschwarzes Mädchen ist er eine Heldin. Wenn er eine wunderschöne Prinzessin sein darf, wird ein tapferer Ritter ihn erlösen. Als hellhäutiger, dünner Mann mit rötlich weißer Haut erlöst er in den „Sieben Raben“ seine vielen Brüder vom Einfluss der grimmigen Männer. Wie eine Jugendliche kennt er schmerzhafte weibliche Eifersucht, auch die weibliche Angst und Verlassenheit. Wie ein Mann kann er alles gut verdrängen und schönreden. Manchmal ist er sogar auf sich selbst eifersüchtig oder neidisch. Dies ist sein unschätzbarer Vorteil als Autor, wie er findet, wenn man ein Zwitterwesen geworden ist. Bei Reizüberflutung durch die modern inszenierten Geschlechterfragen ist seine Position außerordentlich hilfreich, fast unentbehrlich. |
Märchen vermitteln ihm, wenn er gerade ein Mädchen ist, die traditionell weibliche Werte. Als Junge schätzt er die stolze Männlichkeit. Niemals können solche unterschiedlichen Bewertungen für ihn ungültig werden oder vollständig harmonisiert sein. Alles passt stets gut in seine persönlichen Erfahrungen hinein, eben weil er flexibel ist, wie er meint, sodass das ewig Männlich-Weibliche in ihm lebendig und hochaktuell bleiben kann.
Der weiblichen Sprache, die er fabelhaft beherrscht, fügt er, im Grunde tagtäglich, neue Wörter und Wendungen seinem geschlechtsneutralen Wortschatz hinzu. Die weibliche Sprache hemmt allerdings erheblich sein Schwarz-Weiß-Denken. Oft verschwimmen vor seinen Augen die klaren Unterteilungen in Gut und Böse, in Mann und Frau, in Freund und Gegner. Er braucht allerdings, wie ein Kind, leidlich aufgeklärte Verhältnisse, damit er sich genügend friedlich orientieren kann, auch um sicher und schnell unterscheiden zu können, was gerade gut oder schlecht auf der richterlichen Geschlechterskala ist. Er fragt selten, warum dieses oder jenes so sein soll oder darf. Denn genau das hängt an der einseitigen Herrschafts- und Geschlechterfrage.
Drakonische Strafen verhängt er als Mann, der sich selbst allerdings genügend kritisch betrachtet. Wie ein Kindergartenkind hat er keinerlei Probleme mit harter Bestrafung. Er hält es für gerecht, wenn eine böse Tat hart bestraft wird und dadurch das Bessere zum Vorbild werden kann. Durch sein intensives Gespür für Gerechtigkeit plädiert er am Ende aber grundsätzlich für milde Strafen, auch bei schrecklichen Taten. Wie in Märchen geht es darum die eigenen Ängste zu erkennen, die eben für alle solche Kindermenschen zur Entwicklungsgeschichte dazu gehören.
Alexander wurde nicht mit den Instrumenten der Friedfertigkeit und Phantasie geboren. Auch hat er sie nicht im Alltag aufgedrückt bekommen, sondern er hat sie sich in geborgener Atmosphäre ehrlich selbst erworben. Die Märchenhaften Gestalten sind in ihm, wie sein Gewissen. Sie zeigen jene Wege, die man bewältigen kann. Wird die Gestalt einer bösen Hexe in ihm zu groß und übermächtig, droht er gar von ihr gefressen zu werden, wie etwa im Märchen „Hänsel und Gretel“, so kann er sich davon befreien und lossagen, indem er alles, einfach alles, in den Backofen schiebt und verbrennen lässt.
Alexanders Eltern haben ihm leider wenig geeignete Interpretationshilfen an die Hand geben können, wie man das Bestimmende in den Märchenfiguren erkennen kann oder wie man sich die eigenen Zauberschauplätze zusammenstellt, damit man sie vernünftig verwenden kann. Vielleicht kann er deshalb, wie ein unberührtes Kind, unmittelbar ausdrücken, was er wirklich braucht. Er kann jeden Zauber verarbeiten, der ihn gerade überfällt, bedrückt oder beglückt. Er benötigt eigentlich kein Vorbild, sondern er hat unendlich viele gute Vorbilder. Er kann sich als Teil des Märchens, als Märchenfigur gewissermaßen, gut mit sich selbst identifizieren. Er kann Rollen spielen, die er sich vorher gar nicht zutraute. Er kann in alles, wie ein Symbiont, hineinschlüpfen. Manchmal lässt er die Märchenfiguren auch erst einmal in Ruhe wirken und nur für sich alleine handeln. Er lässt sie quasi selbst entscheiden, um dadurch gutachterlich die Erfahrungen einsammeln und neue Rollen ausprobieren zu können. Er ist extrem unverfälscht und besitzt keinen tieferen oder versteckten Sinn. Er ist als Hermaphrodit nur das dritte, vierte oder fünfte Geschlecht, welches niemals von allen erkannt und akzeptiert werden wird, nicht einmal von ihm selbst. Wenn er mit Erika schläft, dann liegt er mal oben und mal unten, gelegentlich sogar dazwischen. Wie unglaublich kompliziert sind doch diese medizinischen Geschlechterfragen, denkt er manchmal laut vor sich hin. Ein Umstand ist ihm allerdings klar. Er wird niemals die Richtlinien einer strengen Regierungsorganisation erfüllen können, weil er dafür einfach zu „missgebildet“ und „krank“ ist, obwohl seine Genitalien völlig in Ordnung sind. Wenn Frauen einen Mann wollen, der alles zugleich sein soll, ein Vernunftmensch, ein Macho und ein Kuschelbär, dann will er selbstverständlich, dass Frauen das alles ebenfalls zugleich sein müssten.
Kappels Lieblingsfigur, wenn er in seiner Kindheit forscht, ist ohne Zweifel „Pippi Langstrumpf“. Sie ist für ihn ein kleiner weiblicher Zeitgeist, weil sie die Geschichten vom Einhalten und Nichteinhalten der allgemeinen Regeln lebt. Pippi ist überragend stark und hat zugleich unendlich viele kleine Schwächen. Sie ist die perfekte Hauptrolle. Sie ist klein und groß zugleich. Sie ist nicht unmittelbar an eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort gebunden. Ihr Appetit und ihre Unwissenheit sind vorbildlich. Ihre Freundschaft zu Tommy und Annika ist Pflicht genug und keine momentane Sichtweise. Quatsch machen ohne Manieren ist ihre Lebensphilosophie. Aufmüpfigkeit ist ihr Lebensweg. Ihre Perspektive setzt sich schon deshalb immer durch, weil sie ein einfaches Mädchen ist. Sie könnte jener Teil der Frauenbewegung sein, der Männer unmittelbar überzeugen kann. Ihre Rolle funktioniert für alle Menschen, Männer wie Frauen, Kinder wie Alte. Harry Potter, wie er findet, ist dagegen mehr ein Junge. Sie aber ist multikulturell und gelegentlich auch stereotyp, wo sie es sein muss. Genau deshalb zeigt sie eine enorme Stärke. Sie ist das mutige Vorbild für den ständigen Rollenwechsel. Dabei ist sie stets gut berechenbar. Wenn sie sich bei allen bedankt, so sagt sie nur: „Danke, Annika.“ Sie ist wie die kleine freche „Baronin von Münchhausen“, die wunderbare Lügenmärchen kennt. Sie verkörpert das Heldenepos, weil sie der Wirklichkeit so unendlich nahekommt. Sie prahlt nicht mit Pseudowissen, sondern sie besitzt es. Sie ist grundsätzlich nicht therapierbar, sondern völlig symptomfrei.
Es ist schon 15.30 Uhr. Bald kommen Erika und Wolf vom Dienst. Erika wird heute die Lebensmittel einkaufen. Schon allein deshalb ist Alexander wie verhungert. Er ist der lebende Beweis, dass Hunger ein wichtiger Bestandteil der Projektionen in Legenden und Märchen sein kann. Der Hunger ist sein persönlicher Apokalyptischer Reiter, den ihm Johannes offenbarte. Schon im Buch Mose träumt der ägyptische Pharao von sieben fetten Kühen, die aus dem Nil steigen und dann von sieben mageren Kühen verschlungen werden. Wenn es Erika am heutigen Tag nicht geben würde, würde er also sieben gute und fette Jahre vorausplanen müssen, damit er Vorräte für sieben Dürrejahre hat.
Der Vater von Hänsel und Gretel gibt erst dem Drängen seiner Frau nach, nachdem überhaupt kein Brot mehr da war. Der Hunger scheint die Kinder im Wald auszusetzen. Als es plötzlich wieder genügend Lebensmittel gibt, kehren die Kinder zurück. Jack wird von seiner Mutter losgeschickt, um aus Not die letzte Kuh zu verkaufen: „Aber lass dich nicht betrügen, sonst müssen wir verhungern“, sagt sie zu ihm, und er nun tauscht die Kuh schließlich gegen einige wenige Bohnen ein.
Alexanders eigenes Ernährungsrealmärchen spielt in jenem deutschen Zauberreich, in dem es Essen und Trinken ganz im Überfluss gibt. Natürlich kennt er alle märchenhaften Symbole für Essen und Trinken, das Töpfchen im Märchen „Vom Süßen Brei“, das Tischtuch im „Burschen, der den Nordwind besuchte“, das Tischlein in „Tischlein-deck-dich“ und den bulgarischen „Zauberranzen“. In seinem paradiesischen „Schlaraffenland“ hingegen fließen Milch und Honig, und die Häuser bestehen nur aus essbarem Material. Alexander fliegen gebratene Hühnchen und Fische meistens direkt in den Mund. Wenn er ein Säufer wäre, so bekäme er fürs Trinken wahrscheinlich noch Geld. Als glückloser Spieler fließt aller Reichtum sogleich zurück in seine Tasche. Als guter, fleißiger und bescheidener Mensch bekommt er täglich allerlei gute Geschenke, trotz Neid und Missgunst vieler anderer. Durch Klugheit und Erbschaft kann er, bei vollem Einsatz, alles stets zum Guten wenden.
Es ist der Fischer Urashima in einem lehrreichen Märchen aus Japan. Er fängt einen schönen Fisch, den er aus Mitleid wieder freilässt, obwohl er seit langem nichts mehr nach Hause bringen konnte. Der Fisch ist die wundersam verwandelte Tochter des Meerkönigs, und so wird Urashima am Ende reich belohnt, anders als die üblichen japanischen Fischer und ihre Frauen. Der Japaner lässt den Fisch ziehen und dadurch werden ihm fortan alle Wünsche erfüllt. Die Frau des Fischers allerdings ist maßlos und übertrieben. Und so verlieren sie am Ende wieder alles Glück. Andersens „Mädchen mit den Schwefelhölzchen“ dagegen ist ein hungerndes Kind, das sich am Silvesterabend nicht nach Hause traut, weil es kein Geld verdient hat. Das Mädchen erfriert auf offener Straße, während die reichen Bürger eilig ihre letzten Besorgungen machen.
Alexander ist inzwischen kühl geworden, wahrscheinlich nur weil er Hunger am Schreibtisch hat.
Metzeln, Lachen, Hexen, Träumen, Verhungern und Sterben! Diese Stichworte könnte man vor allem den Geschichten aus Spanien zuschreiben. Sie erzählen von Untoten, von Transvestiten und dem Inzest. Selbst vor Menschenfresserei schrecken diese Spanier nicht zurück. Es sind eben die spanische Geschichten über der Welt, in der die ewige Armut regiert. Oft hat man den Eindruck, als gäbe es die Geschichte überdauernde spanische Hunger-Halluzinationen. Der größte aller spanischen Träume geht aber stets in Erfüllung, nämlich wenn der Held sich endlich sattessen kann. Selbst die katholische Kirche ist den spanischen Märchenerzählern nicht besonders heilig. Mit Tod und Teufel stehen sie auf Du und Du. Das einzige aber, was wirklich satt macht, ist ihr bizarrer Humor. Mit ihm ausgestattet können die Märchenhelden der Welt wirklich begegnen. Spanien? Das ist eben der unbesiegbare Picaro des Schelmenromans oder der knochige Windmühlen-Junker „Don Quijote von der Mancha“ oder auch Goyas Visionen von viel Schrecken und noch mehr Hoffnung. Das alte Spanien wird immer auch die Wiege des Neuen sein können, weil alle arabischen, jüdischen und baskischen Einflüsse unverkennbar vorhanden sind.
Dem Sammeleifer der Gebrüder Grimm hatten die Spanier lange Zeit nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Kein Wunder, dass die iberischen Hungermärchen bei uns im Land weitgehend unbekannt geblieben sind. Erst der Schriftsteller J. M. Guelbenzu hat sie vor ein paar Jahren ins Licht der Öffentlichkeit gestellt.
Wie süßlich schmeckt dagegen das Antispanische, der sättigende deutsche Brei, den die Brüder Grimm angerührt haben:
Der süße Brei
Stets lebte das Kind mit seiner armen Mutter allein zusammen. Zum Essen ging es betteln, bis eine seltsame alte Frau ihr einen Zaubertopf schenkt, der auf das Kommando „Töpfchen, koch“ den süßen Hirsebrei wie von Zauberhand selbst zubereitet und bei den Worten „Töpfchen, steh“ wieder damit aufhört. Von da an musste niemand wieder hungern. Als die Mutter dem Topf befiehlt, „Töpfchen, koch“, kochte der Topf ordentlich den Brei. Den zweiten Spruch konnte sich die Mutter leider nicht so gut merken, so hörte der Topf also nicht wieder damit auf. Die ganze Stadt lag schon unter dem Brei begraben. Erst nach dem das kleine Mädchen „Töpfchen, steh“ sagte, hörte das automatische Kochen wieder auf.
Einen überlaufenden Krug kann man nur mit Unschuld kontrollieren, wie auch jenen Topf in der indischen Erzählung, in dem ein Reiskorn endlos lange kocht. Goethes „Zauberlehrling“ verwandelt mittels eines Zauberspruchs sogar den Besen in einen Knecht, der dann das Wasser schleppt. „Die ich rief, die Geister, Werd’ ich nun nicht los.“ Der süße Brei ist der Hausfrauen Ungeschick aus der Sicht der männlichen Zauberarbeiter und der technischen Sachverständigen, die meinen, durch ihre Mühlenarbeit, zuvor alles ordentlich zermahlen zu haben.
Warum ist der Brei eigentlich süß?
Alexander findet im Werk von Erasmus Francisci, „Der Höllische Proteus“, die Antwort: „Und endlich der so genannte Süsse Brey; derselbe mag gleich aus Erbsen, Buchweitzen, oder Heidelkorn oder sonst aus einer andren Hülsen-Frucht gekocht seyn. Vor Alters pflag man ein wenig Honigs drein thun: daher nennet man ihn noch heut den Süssen Brey.“
Am Eingang zum Schlaraffenland empfängt das arme und fromme Mädchen die Sterntaler. Solche Trost- und Belohnungsmotive sind märchenhaft, wegen derer sich wahrscheinlich auch die Märchen vom Essen so unendlich lange halten. Gelegentlich steht der echte Hunger gar nicht im Mittelpunkt, sondern der vorgestellte Hunger, um schließlich das Sattwerden und auch die Völlerei als Belohnung empfinden zu können. Das vergnügliche Bild einer Stadt voller Brei ist die unerbittliche Lehre: Wunder werden anvertraut. Eine solch anvertraute Gabe, dem Beschenkten hinterrücks wieder zu entziehen, sollte keine Mutter ihrem Kind zumuten. Unsegen und Verdruss stünden ins Haus. Das kochende Gefäß ist der Frauen nahrungsspendende Funktion. Gewissenmaßen ist es das archetypische Bild der Mütter und Hausfrauen. Sonne und Mond dagegen sind himmlische Breikessel, die nur das kindliche Seelenleben einfangen kann. Die Weisheit kindlicher Zuversicht ist ein Lasso, mit dem man den Ingrimm und die Vergesslichkeit der Alten einfangen und in eine wundersame neue Mechanik umwandeln kann, die auch in der Wassermühle funktioniert, die auf dem Meeresgrunde mahlt und mahlt und mahlt.
Erika und Wolf verspäten sich. Die Zeit ist verstrichen, in der sie üblicherweise zuhause eintreffen. Allerdings hat Alexander nun keine Lust mehr, sich Märchen über das Verspäten, Vertrödeln, Bummeln, Warten, Zagen, Aufschieben, Schwanken, Vergeuden und Versäumen auszudenken. Verspätung zählt bei ihm nichts. Er macht sich lieber ein Butterbrot mit Salz. Da Alexander etwas tieferes Verständnis von Lebensprozessen im Allgemeinen besitzt, kennt er viele solcher blockierter Situationen, solche spontanen Verspätungen. Er kennt auch seine eigenen Symptomkreise von Blockierung, Erschöpfung, Resignation und Depression. Das Burn-Out-Phänomen kennt er auch sehr gut. Es steht sinnbildlich für das Butterbrot mit Salz. Das Heilsame und Wichtige in Märchen ist nämlich, dass im Verlauf der Handlung tragfähige Lösungsmöglichkeiten gesucht und gefunden werden, die einen neuen Zugang zum eigenen Verdauungsprozess initiieren können.
Erika und Wolf sind wohlauf und fröhlicher Dinge, als sie endlich zuhause eintreffen. Alexander dagegen kaut weiter an seinem kleinen, runden Burn-Out-Brötchen. „Mir geht es heute gar nicht gut“, sagt er. „Alles schwirrt mir wie ein Fliegenschwarm im Kopf herum.“
„Du musst mal nach draußen an die frische Luft“, antwortet Erika. „Schon wieder hast du eine ganze Schachtel geraucht.“
„Ich rauche keine Schachteln, sondern Zigaretten. Wunder und Märchen können eben auch manchmal sehr anstrengend sein“, antwortet Alexander.
Wolf hat keine Lust mit nach draußen zu kommen. Alexander hat ihn gefragt, ob er Rollschuhe mit ihm laufen würde. So beschließt Alexander, in die nächste Eckkneipe zu gehen, um ein kühles Bier zu trinken.
„In einer Stunde essen wir“, ruft Erika ihm nach. „Es gibt Kartoffelsuppe mit Würstchen.“ Er wird aus voller Einsicht gehorchen können.
In der Kneipe sitzen Alexanders entfernte Bekannte, die häufiger auch gute Märchen erzählen können. Diesmal will er ihnen nur zuhören. Die Kneipe war früher mal eine Künstlerkneipe, bis immer mehr normale Menschen kamen. Inzwischen haben sogar schon die Wirtsleute gewechselt. Schon nach kurzer Zeit beginnt er sich vor den „Märchen“ seiner Bekannten zu ekeln. Ihre „Märchen“ tragen heute merkwürdige Überschriften: „Die Brücke über die Autobahn ist nun endgültig gesperrt. Lange Autoschlangen bilden sich.“ „Rudis Frau hat eine Diagnose bekommen. Sie hat Diabetes.“ „Der alten verknitterten Sandra tut wieder ihre Hüfte so furchtbar weh.“ „Die Amerikaner bespitzeln uns jeden Tag aufs Neue.“ „In der Flüchtlingsunterkunft brennt es lichterloh.“ „Der neue Wirt, wie heißt er gleich noch mal, ist ein fauler Typ. Nie bringt er pünktlich unser Bier.“
Die Gegenwart seiner Mitbürger hat ihn dramatisch eingeholt. Das hat man nun davon, wenn man nach draußen geht. Nichts, aber auch gar nichts wird er denen mehr erklären, heute jedenfalls nicht, weil die Magie in ihren heurigen Emotionen so furchtbar banal ist. Eine ganz besondere Anstrengung wäre nötig, sie umstimmen zu wollen, die Alexander aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht aufbringen will. Wenn der Tag so läuft, wie er läuft, und die Gruppen sich in schlechten Geschichten zusammengefunden haben, dann läuft er so, der Tag. Stets sind so unendlich viele Anpassungen und schrecklich grobschlächtige Hintergründe dabei.
An diesem Trauertag begegnet ihm in der Kneipe allerdings auch noch das große Glück. Situationen können blitzschnell ganz anders werden. Ein Wunderfall geschieht. Das ganz unerwartete plötzliche Wunder tritt ein. Eine junge Frau und ein jüngerer Mann betreten das Lokal. Fremde sind es. Ein selteneres Ereignis für diese Lokalität der deutschen Mittelalten und Alten. Sie bestellt ein gespritztes Bier und er zwei Gläser Wodka und ein Glas Mineralwasser.
Was ist denn nun los? Wie toll. Ein Russe?
Aber klar doch, er sieht wie Wladimir Kaminer aus, der gerade aus der „Russendisco“ gekommen ist und nun wahrscheinlich weiterziehen will. Alexander setzt sich frech zu den beiden an den Tisch. Da er ein äußerst charmanter Erzähler sein kann, wenn er etwas erreichen möchte, dulden die neuen Gäste ihren neuen Tischnachbarn. Sie freuen sich sogar über seine Aufmerksamkeit, die er ihnen vermitteln kann. Im Nu ist ein flottes Gespräch in Gang. Er stellt sich mit dem Namen Gustav Schwab vor und redet über merkwürdige Dinge. In einem managementmäßigen Berichtston erzählt er: „Die Robert-Jungk-Gesamtschule hat im Deutschen Museum in München den ‚History Award‘ bekommen. Der Pay-TV-Sender ‚History‘ hat einen Geschichtswettbewerb ausgeschrieben. Moderatoren waren Nina Eichinger und der Geschäftsführer von ‚History‘, Andreas Weinek.“ Alexander Gustav Kappel-Schwab hat das Geschehen, über das er berichtet, zufällig einen Tag zuvor im Netz gelesen.
„Ich war dabei. Ich heiße Kaminer“, ruft der jüngere Mann plötzlich. Nun weiß Gustav genau, dass es tatsächlich der Buchautor Wladimir Kaminer ist, der ihm gegenüber am Tisch sitzt. Auch Wladimir Kaminer wurde im Netztbeitrag erwähnt. Kaminer entzieht ihm sofort das Wort. Das hat er von ihm erwartet.
„Globalisierung, Internet, Krisen und Kriege entreißen der Heimat ihre Wurzeln“, sagt Wladimir. „Es war eine bewegende Geschichte über die Wolgadeutschen, die dieses Mal den ‚History Award‘ bekommen hat.“
„Lustig ist leider nur das Zigeunerleben. Den Sinti und Roma dagegen geht es dreckig, weil sie keine Heimat finden können, wo sie sesshaft werden können oder wollen“, so Gustav Schwab.
Kaminer ist zunächst irritiert. Aber dann erkennt er den Kern der Aussage und grinst freundlich mit großem Gesichtsmuskelaufwand.
„Ging es bei dem ‚History‘-Preis um Blitzlicht und Champagner?“, fragt Gustav Alexander ihn.
„Ich antworte Ihnen am besten mit den Worten von Wigald Boning“, entgegnete Wladimir. „Ich bin ein geschichtsinteressierter Morgenmensch, und insofern war ich dort viel besser aufgehoben als bei so mancher Abendveranstaltung. So fühlte ich mich persönlich auch.“
„Herr Boning überraschte wahrscheinlich wieder mit einem extravaganten Outfit: blau-weiß-gestreiftes Hemd, bunt-gestreifte Krawatte, eigenartige Socken, Slipper in Gold oder Silber und kurze Shorts in Gelb“, wirft Gustav Schwab ein.
„Er probiert zweifellos durch seine Kleiderwahl den Sommer herbeizuzwingen. Bunt sind diese Nachtvögel eben auch noch bei Tag“, so Kaminer.
„Erzählen Sie doch bitte etwas genauer von diesem Geschichtswettbewerb“, so Alexander.
Kaminer erzählt: „Insgesamt nahmen über 200 Schüler aus acht Bundesländern teil. Sie setzten sich filmisch mit ihrer Umgebung auseinander und machten sich Gedanken darüber, was hinter dem Begriff Heimat steckt. Was ist ein Zuhause? Liegen die Wurzeln in der Kultur, der Geschichte oder vielleicht sogar in der Sprache? Oder hat Heimat nur etwas mit Integration und Identität zu tun? Welche Rolle spielt das Internet bei diesen Themen?“
Alexander fühlt sich fast wie in ein Märchenbuch gebunden. Kaminers Begleiterin, seine Frau oder Freundin, verzieht häufiger das Gesicht, so als hätte sie seine Geschichten bereits über tausendundein Mal gehört.
Kaminer: „Die Beiträge der Finalisten zeigten, dass für die Schüler die weltweiten Konflikte ein wichtiges Thema sind. Filmisch setzten sich die Sieger mit Krisen, Kriegen, Vertreibung, Flucht und deren Folgen für die Heimatfindung auseinander. Die Schüler der Robert-Jungk Gesamtschule in Krefeld überzeugten mit dem 15-minütigen Film: ‚Do Swídanja Heimat - Die Geschichte der Wolgadeutschen‘.“
„Für den ersten Platz gab‘s 2000 Euro. Oder?“ Gustav schätzt die Summe nur, weil er irgendetwas dazwischen reden will.
„Stimmt genau. Woher wissen Sie das? Egal.“ Kaminer führt weiter aus: „In aufwändig nachgestellten Szenen, sogar mit einigen Stunt-Einlagen, haben die Schüler ein Dokudrama über die Geschichte der Wolgadeutschen erzählt. Am Beispiel der russlanddeutschen Familie des Schülers Rudolf Gerner werden 200 Jahre Geschichte deutscher Bauernfamilien erzählt. Mit der Einladung Zarin Katharinas der Großen nach Russland folgten sie der Hoffnung auf einer bessere Zukunft. Nicht nur Saatgut und Land, sondern auch die Religionsfreiheiten wurden ihnen in Aussicht gestellt. Alles ist schließlich vom Stalin-Regime beendet worden. Sie wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet, enteignet und nach Sibirien und Kasachstan deportiert. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurden die Deutschen verbannt oder sollten sterben. Doch sie starben nicht, sondern haben Kinder und Enkelkinder zur Welt gebracht. Diese Enkelkinder kehren 50 Jahre später nach Deutschland zurück, wo sie als unheimliche Wesen, also als Russen wahrgenommen werden.“
Gustav ist begeistert vom russischen Überblickswissen Kaminers. Alexander ist weniger begeistert- Kaminer kann das R so wunderbar russisch rollen. „Es muss eine akribische Recherchearbeit der Schüler gewesen sein“, sagt er. Ein wenig konnte er auch das R im Wort akribisch rollen.
Kaminer: „Mit gutem Blick für die Details haben sie kenntnisreich sehr ansprechende und amüsante Dialoge geschrieben.“
Wir alle sind irgendwie auch Wolgadeutsche, geht Kappel durch den Kopf. Er spricht es aber nicht aus.
Kaminer hält ihm das zweite Glas Wodka hin und sagt: „Das habe ich für Sie bestellt. Ich bestelle immer gleich zwei Gläser von dem Zeug, falls sich mal ein Gast unverhofft an meinen Tisch setzt.“
„An unseren Tisch“, ruft seine Freundin dazwischen und verzieht dabei das Gesicht.
Dann erzählt Kaminer noch etwas über den Zweitplatzierten aus der Brodmann-Schule am Bodensee. Integration und Migration sei ihr Thema gewesen. Es ging um die Geschichte des Ortes Immenstaad, durch den die Schüler einen unterhaltsamen Rundgang gemacht haben. „Es geht um die Familienfreundlichkeit eines Ortes und um das Thema Migration. Was sie gern tun würden, um ihren Ort zu verbessern, hat Nina Eichinger die ganze Klasse bei der Preisverleihung gefragt. Wir wollen den Flüchtlingen helfen, die Immenstaat bald aufnehmen wird, sagte eine Zweitklässlerin.“
Nun erst fragt Kaminer ihn, wer er denn überhaupt sei, denn er trüge ja einen berühmten Namen - Gustav Schwab. Was soll Alexander nun tun? Er kann nun doch nicht erzählen, dass er das Standardwerk über die Sagenwelt des klassischen Altertums oder gar eine Schiller-Biographie geschrieben hat. Aber er liebt solche kniffligen Situationen. Er überlegt hin und her. Dann antwortet er: „Gustav Benjamin Schwab war mein Ur-, Ur-, Urgroßvater, ein deutsche Pfarrer. Er war Gymnasialprofessor und ein Schriftsteller der Schwäbischen Dichterschule. Mit seinem Werk ‚Sagen des klassischen Altertums‘ hat er seinerzeit den Klassiker der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur geschaffen.“ Er fühlt sich dabei wie der Hochstapler „Felix Krull“. Ein Glück, dass seine Familie nicht anwesend ist. Sonst gäbe es lautes Gelächter.
Kaminer ist entzückt. Anscheinend hat er ihm die Geschichte geglaubt. Vielleicht aber auch nicht. Nun beginnt es am Tisch wildwuchernd hin und her zu gehen: die Illias und die Odyssee, Himmel und Erde, Russen und Deutsche. Das Meer und die meterhohen Wellen wiegen sich an mittelmeerischen Uferrändern. Die Fische spielen darin. In den Lüften singen bunt beflügelte Vögel. Der Erdboden wimmelt von aufregenden Kleintieren. Es fehlen auch nicht die Geschöpfe, in denen nur der Geist der Phantasie seine Wohnstätte hat. Prometheus als Spross des Göttergeschlechts, welches Zeus entthront hatte, betritt die Erde. Der Sohn des erdgeborenen Uranossohns Iapetos weiß, dass im Erdboden der Same des Himmels schlummert. Darum befeuchtet er den Ton mit dem Wasser des Flusses. Er knetet ihn und formt daraus ein Gebilde nach dem Ebenbilde der Götter. Die Zeit rast und vergeht. Nie steht sie still.
„Ich bin hundemüde“, sagt die Freundin von Kaminer in die Tischrunde der Männer. Sie hat sich leider nicht am Gespräch beteiligt und ist deutlich motiviert, zu gehen. Sie scheint ihn, den Enkel Gustav Schwabs, nicht sonderlich zu mögen. Er seinerseits mag Kaminer sehr. Alexander schaut auf seine Armbanduhr. Es ist 21.30 Uhr und schon fast dunkel. Au Wei! Auch Gustav will sich nun ganz schnell verabschieden, weil er ganz vergessen hat, dass Erika und Wolf schon lange mit dem Essen auf ihn warten, zu lange schon. Alle verabschieden sich mit einem eiligen Händedruck. Alexander grüßt noch seine Alltagshelden am Nebentisch: „Lasst euch von mir grüßen, ihre lieben Leute.“ Sie winken ihm zurück.
Erst auf dem Weg nach Haus bemerkt Alexander, dass er ganz vergessen hat, sich mit Kaminer zu verabreden. Gut so, sagt er sich. Es ist manchmal besser, einen großen Autor nicht noch ein zweites Mal zu treffen, denn dann könnte es unter Umständen langweiliger werden. Man kommt sich dann möglicherweise zu nah und versteht die Bilder und Geschichten nicht mehr richtig, sondern die Person, die sich viele spezielle und unnütze Gedanken macht.
Zu Hause angekommen ist es natürlich so, dass seine Familie schon längst zu Mittag gegessen hat. Erika sitzt vor der Glotze. Wolf spielt an seinem Pad herum, wie so häufig. Noch nie hat er Wolf gefragt, ob er schon seine Hausaufgaben ordentlich gemacht habe, weil Alexander Schulen und Kontrollen nicht sonderlich mag. Wenn überhaupt, dann ist das Leben selbst für ihn eine Schule, die man unter vielen Lehrern hinter sich bringen muss, in der man seine Prüfungen besteht und ein sehr verstecktes Bildungsziel sucht. Auch diesmal spielt Alexander lieber mit Wolf, anstatt ihn irgendwie auszufragen, wie es ihm gehe. Sie spielen immer das gleiche Computerspiel. Beide haben ihr Pad vor der Nase und spielen über das Netz, nebeneinander sitzend, ihr Autorennspiel. Das Spiel heißt „Asphalt“ oder so ähnlich. Alexander ist und bleibt der ewige Anfänger und Wolf der siegreiche Asphaltcowboy. Er hat noch nie gegen den Kleinen gewonnen. Wolf ist mit seinen Fingerchen viel zu schnell. Nur weil der Junge so jung ist, ist er so furchtbar schnell, sagt sich Alexander zum Trost. Mit der Zeit wird er schon noch langsamer werden, hofft er. In 20 Jahren vielleicht. Der Junge kennt einige Abkürzungen und Beschleunigungshilfen, die er noch nie entdeckt hat.
Erika schaut gerade Frauenfußball im Ersten Deutschen Fernsehprogramm. Wenn sie sagt, dass Frauen inzwischen viel eleganter spielen, sagt er, dass sich die Frauen eben den Männern anpassen würden.
Auf dem Wohnzimmertisch steht ein Teller mit Gemüseschnipsel und dreierlei Dips aus Curry, Ingwer und Tomate-Chili. Alles hat er im Nu weggeputzt und auch noch die Kartoffelsuppe mit Würstchen. Dabei hat er stets an die Wolgadeutschen gedacht.
Alexander spricht mit Erika, wenn sie abends zu Hause zusammen sitzen, meistens nicht übermäßig viel, wenn aber doch, dann sehr präzise und höflich. Sie verstehen sich, ohne groß zu palavern. Dadurch streiten sie nicht mehr so häufig wie früher, vor ein paar Monaten, weil ihre Streits immer nur durch das unvorsichtige Daherreden von Floskeln entstanden sind. Das haben sie weitgehend abgestellt. Mit Wolf hingegen plappert Alexander unentwegt, manchmal stundenlang, mit anwachsender Begeisterung, über die Weltgeschichte und so weiter.
Er ist im Pad-Rennen wieder einmal nur Dritter und dann noch Vierter geworden. Wolf und die Computergegner sind wieder einmal vor ihm ins Ziel gekommen. Goldmedaille leider wieder knapp verfehlt.
Am späten Abend gehen Alexander meistens Gutenachtgeschichten durch den Kopf. Bis vor ein paar Monaten hat er sich sogar noch selbst solche Nachtgeschichten vorgelesen. Inzwischen kennt er viele solche Abendnächte, wie Kaminer übrigens auch. Mindestens über Hundert davon kennt er. „Die zwölf Brüder“, „Brüderchen und Schwesterchen“, „Strohhalm, Kohle und Bohne“, „Vom Fischer und seiner Frau“ und „Das Rätsel“ sind seine Lieblinge.
Er hat auch schon einiges zur guten Nacht für seinen Roman notiert. Meistens sind seine eigenen, aber auch nacherzählte Märchen. Die Nacherzählten sind immer viel kürzer als im Original, weil er schnell vorankommen möchte. Er hat keine Ewigkeiten Zeit. Deshalb misslingen ihm einige seiner Notizenmärchen bisweilen auch, weil nämlich die Verkürzung misslingt.
Bruder und Schwester
Der Bruder nahm seine Schwester an der Hand und sprach: „Seit Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füssen fort. Harte Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise. Dem Hund unter dem Tisch geht’s besser, dem wirft sie manchmal einen guten Bissen zu. Dass Gott erbarm! Wenn das unsere Mutter wüsste! Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt hinausgehen!“
Den ganzen Tag liefen die Geschwister über Wiesen, Felder und Steine, bevor sie in einem hohlen Baum einschliefen. Beide Kinder waren sehr traurig. Deshalb begegneten sie der bösen Hexe, die sie verwandelte, bis schließlich der König das schöne kleine Mädchen auf seinem Pferd in sein Schloss trug, wo die prächtige Hochzeitsfeier stattfand. Nach einigen Verwicklungen kamen die vielen Nächte für die Kindfrau, in denen sie sich nicht allzu viel zutraute. Sogar das Sprechen fiel ihr schwer. Der König aber konnte sich nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach: „Du kannst niemand anderes sein, als meine liebe Frau!“ Sie antwortete: „Ja, ich bin deine Frau“. Von diesem Zeitpunkt an hatte sie, durch Gottes Gnade und ihren Ehemann, ihr Leben wiedererhalten. Sie war frisch, rotbäckig und gesund, nicht mehr verhext. Sie erzählte dem König vom Frevel, den die böse Hexe an ihr und ihrem Bruder verübt hatte. Der König führte Gericht, und es ward dem Bösen das Urteil gesprochen. Die Hexe ward ins Feuer gelegt und musste jammervoll verbrennen. Als sie zu Asche verbrannte, verwandelte sich auch das Rehkälbchen, ihr Bruder, wieder in seine menschliche Gestalt. Schwester und Bruder lebten fortan in wohlhabenden Verhältnissen glücklich zusammen bis an ihr Lebensende.
Was wird das wieder für eine gute Nacht? Das ist Alexanders tägliche Prophezeiung in Frageform. Nur eine Nacht? 1000 Nächte werden es werden, weil die Nacht indische, persische und arabische Ursprünge hat. Im Grunde stammt sie aus dem Orient. Sie ist auch eine Tierfabel, in der eine neunmalkluge Eule die Hauptrolle spielt. Die Nacht ist ein Geschichtsbuch der Tausend Erzählungen (زار افسان). Räumlich betrachtet spielt die europäische Nacht im spätantiken Mittelmeerraum. Sie erzählt uns abenteuerliche Episoden vom See des Odysseus. Alexander kennt viele islamische Formeln und auch viele ihrer sprudelnden Quellen. Die Nacht ist für ihn eine Sammlung, in der mittelmeerische Ereignisse ohne kontinentale Katastrophenstimmung übermittelt werden. Am meisten mag er die Scheherazade-Geschichte, die kleine niedliche Schwester der großen Rahmenhandlung. Im maurischen Andalusien soll sie wohl entstanden sein:
Scheherazade
König Schahriyâr von einer ungenannten Insel zwischen Indien und China ist schockiert über der Untreue seiner Frau, so dass er sie töten lässt und seinem Wesir die Anweisung gibt, ihm fortan jede dritte Nacht eine neue Jungfrau zuzuführen, die jeweils am nächsten Morgen ebenfalls umgebracht wird. Scheherazade aber, die Tochter des Wesirs, will das Morden endlich beenden, indem sie ihm Geschichten erzählt. Geschichten statt Mord. Nach tausendundeins Nächten hat sie ihm drei Kinder geboren. Der König gewährt Gnade vor Recht. Sie hat dem König das Unrecht seines Tuns vor Augen geführt und ihn bekehrt. Er seinerseits dankt Gott, dass er ihm Scheherazade gesandt hat, und feiert Hochzeit mit ihr. Der König bewundert Scheherazade und rückt innerlich von seinem Schwur ab, seine Frau nach der Hochzeitsnacht töten zu lassen.
Das ist die Gnade des nächtlichen Schlafs, schlussfolgert Alexander, weil man nämlich wieder friedlich erwachen darf.
Alexander begibt sich nun zur Ruhe in ihr „magrebinisches“ Himmeldoppelbett. Die Göttlichkeit des ruhigen und erholsamen Schlafs ist, wenn ihn keine Erbse unter der Matratze stört. Erika schläft schon tief und fest. Sie atmet wunderbar. Wundervolle Klanggestalten und Metriken kennt die Nacht. Ein gnadenvoller, gleichmäßig-ruhiger Rhythmus, die waagerechte schwerelose Körperlage, der Partner friedlich nebenan liegend: Das alles kann die Zeit so unendlich kinderleicht machen.
Erika und Alexander gehen im Regelfall gemeinsam zu Bett. Fast schon zu einem Ritual ist das geworden. Das gemeinsame Waschen und Zähneputzen im Bad gehört wesentlich dazu. Er kann dann schlafen wie ein Murmeltier, das ihn täglich rührend verabschiedet und frühmorgens wieder freundlich begrüßt. Wenn es nicht die schöne schwarzlanghaarige Frau neben ihm gäbe, würde ihm die Hälfte des Himmels im verschneiten Punxsutawney fehlen.
Der nächste Tag beginnt im Grunde wie schon der Tag zuvor. Ist es eigentlich wieder der gleiche Tag wie gestern schon? Erika muss zum Dienst, Wolf in die Schule. Alexander muss die Welt neu erfinden, so ähnlich wie am Vortag. Für ihn beginnt der Tag prinzipiell zu früh. Ein Lichtfehler ist das. Man muss sich trotzdem duschen und anziehen, gegebenenfalls eine Jacke anziehen oder, wenn es am Kopf kalt ist, sogar eine Mütze aufsetzen. So geht es immer wieder und dann noch einmal: Zahnbürste, Küsschen, Winken, Tür auf, Tür zu, Wetterbericht. Was mache ich heute? Jeder banale Morgen ist ganz früh noch ohne große Krisenerscheinungen, aber mit vielen kleinen Handgriffen verbunden. Als Erika und Wolf noch ihre kleine Hündin Mowgli hatten, war der Morgen nur noch etwas komplizierter, weil auch Mowgli ihre Bedürfnisse hatte. Am Morgen, bei Sonnenaufgang, wird aber keine Träne vergossen. Der Morgen ist das Morgen, der Aufbruch in den neuen Tag, die ewige Neuschöpfung und das Gassi gehen mit einem niedlichen kleinen Hund. Zauberblumen beginnen langsam zu erzählen, wie man Prinzessinnen erlösen kann. Die kurze sinnliche Zeit des Aufwachens der Blüten beginnt. Auch die Menschen wachsen einen neuen Tag lang, im Inneren wie im Äußeren, am Rand des tagvertrauten Lebenswegs. Der Morgen ist ein Marmorbild in der Räuberhöhle, das ökumenische Frauenfrühstück, an dem auch die Männer teilnehmen dürfen. Der Morgen ist der ewig buntsonnige Wintermorgen in den Rocky Mountains mit einem lustigen Kragenbär, welcher auf dem Hügel sitzt und wie ein Maskottchen glänzt. Spaß muss sein! Micky Mouse ist wieder mit neuen Abenteuern da. Kinder, aufgepasst! Heute versucht Micky sich als Bergsteiger. In schwindelnder Höhe haben Kater Karlo und Donald Duck sich schon an die Arbeit gemacht. Im Glockenturm muss ein altes Uhrwerk gereinigt werden. Dabei geraten sie in große Schwierigkeiten. Alle kommen sich andauernd ungeschickt in die Quere. Vielleicht kann Micky seinen beiden Kollegen in ihrer argen Bedrängnis behilflich sein.
Alexander hat, tief in der Nacht, sogar noch spät in der Frühe, von Wladimir Kaminer geträumt, von wem denn auch sonst. Sein Traum hatte ein reales Ereignis als Hintergrund. Kaminer hatte sich vor einiger Zeit zum Eurovision Song Contests geäußert und für eine kleine Irritation gesorgt. Er relativierte angeblich die gewaltsame Niederschlagung einer Schwulendemo durch die russische Polizei, als er auf die Frage eines Moderators mit den Worten antwortete: „Die Russen sind nicht schwulenfeindlich, sie sind schwulenfreundlich, sie zeigen es nur nicht.“
Alexanders weiß, dass der Traum ohnehin eines Tages immer wahr werden wird, denn beim Träumen sitzt er auf der Mondschaukel und macht gewissermaßen autogenes Training in einer Miniaturform. Träume sind nur Nachtmärchen. Es sind die dicken alten Eichen, genau 365 Jahre alt. Aber diese lange Zeit bedeutet für den Baum nicht mehr als 8 Stunden für uns Menschen. Man träumt sogar das Wachwerden oder die eigene Notdurft, wenn kleinen oder großen Bettnässern die Blase zu sehr drückt und sie dann an die alte Eiche pinkeln.
Schlafenszeit und die Zeit des Träumens. Es ist der Winter nach den langen Tagen des Frühlings, des Sommers und des Herbstes. Die Eintagsfliege beginnt aufs Neue loszufliegen und ihre Besorgungen zu machen. Aber nur einen Tag lang. Dann ist alles wieder vorbei. „Nichts ist vorbei“, sagt die Eintagsfliege. „Ich lebe viele Tausende von deinen Tagen in ganzen Jahreszeiten. So lange und so viel, dass es keiner vernünftig berechnen kann.“
Im Winter beginnt wieder die festliche Zeit des Sommers, schon so um Weihnachten herum. Die Kirchenglocken läuten ihr Bim und Bam. Ein schöner Tag wird es werden, mild und warm, frisch und grün oder kalt und wintergrau gemalt. Die Liebespaare treffen sich schon ganz früh beim Mondschein im stillen Glück ihrer Umarmungen. Sie ritzen ihre Herzen mit den Anfangsbuchstaben A und O in die Eiche. Schon ist man über die Wolken hinausgewachsen und kann ein stolzer Zugvogel werden. Große und kleine Lebewesen durchleben die Äste und Blätter der Eichenbäume. Die Krone bewegt sich sanft im Wind wiegend hin und her. Den Duft des Waldmeisters beantwortet der Kuckuck. Wir sind dabei, dabei. Sang und Klang fliegen uns voraus. Jetzt nur keine Bande mehr, bis der Sturm sich legt und die Sonne wieder aufgehen kann. Der Baum wird fortgehen und unser Land neu erkennen, sagen die Seeleute. Halleluja. Die Traum-Weihnacht erhebt sich in zeitlicher Schönheit. Hans Christian Andersen ist leider noch immer in Dänemark verschollen. Womöglich wird er in einem bayrischen Dirndlkleid recycelt.
Alexander lauscht den zwitschernden Vögeln, die vor dem Fenster ihres Schlafzimmers im Baum sitzen. Der Hofraum verstärkt und bündelt die Akustik enorm. So viele Vögel gibt es in der Großstadt noch. Das Frühstück lässt er diesmal beiseite. Er spürt noch den Wladimir-Wodka im Magen, der wie Rotkäppchen in ihm herumirrt.
Nur bei geöffnetem Fenster kann Alexander richtig schlafen, wahrscheinlich weil Erika es in der Nacht immer zumacht, weil es ihr regelmäßig fröstelt. So schläft er manchmal erst am frühen Morgen wieder tief und fest ein, wenn sie das Fenster für ihn wieder geöffnet hat. Dieser morgendliche Traum gibt ihm die Hoffnung, neue Wege zu gehen, aber auch vor Gefahren zu warnen. Das Erleben des Erwachens ist doppelt schön und wunderbar, immer wenn er in der Zirkuswelt aufersteht. Dann traut er sich zu, wie die nackte Hexe Pamphile, über die Autos und Straßen hinwegzufliegen, was er natürlich nicht tut, weil er ja ein vernünftiger, wohlerzogener und intelligenter Mann ist.
Was steht heute auf dem Programm?
Alexander wird seinen Schreibtisch aufräumen und seine Notizen sortieren. Er will, um es so überaus konkret auszudrücken, gewissermaßen von der ewigen Kindheit in die Jugendzeit hinüber wechseln. Alles muss ein wenig aufgeräumter und sachlicher werden: Verbindungen, Assoziationen, Weltbilder, Anknüpfungspunkte müssen gesucht und gefunden werden, um ein größeres Werk zu beginnen und zu strukturieren.
Eine beste Freundin, einen guten Freund oder auch eine Bande hat man vornehmlich in der Jugendzeit, um die eigenen Bedürfnisse und Emotionen besser kennen zu lernen.